(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=06.09.2000 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 02.08.24
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail: sekretariat@sgipt.org_Zitierung & Copyright
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie,
Abteilung Allgemeine Psychologie, Bereich Denken und hier speziell zum Grundbegriff:
Denken [Definition]
Eine wichtige psychologische Grundfunktion. Einführung
in die Denkpsychologie
aus Sicht der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie
Zur Aktualisierung am
1.6.2010 * Zur
neuen Defintionsseite Denken als Erleben
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
Die Welt ist alles, was der Fall ist. [Wittgenstein, TLP Satz
1]
"Denken steckt in jeder Leistung, vom Wahrnehmungsakt bis zur Sprache."
[Jaspers 1948, S. 163]
Ich denke, du denkst, ich habe gedacht, du dachtest, ich sollte
... [> Laing] in
profaner Form:
"Wenn Du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ..."
[Video,
Text]
_
Zusammenfassung
- Summary -Abstract.
Denken heißt geistige Modelle bilden oder zueinander in Beziehung
setzen. In dieser Arbeit wird die Denkpsychologie aus allgemeiner und integrativer
Sicht so aus Basisbegriffen und einfachen Grundversuchen aufgebaut, wie
sie in der psychologischen oder psychotherapeutischen Erkundungssituation
angewendet werden kann, um das Erleben eines Menschen verständlich
und kontrollierbar zu erfassen. Hierbei wird auf die Geschichte und Entwicklung
der Denkpsychologie sowie der anderen Wissenschaften, die sich mit dem
Denken und seiner kognitiven Umgebung befassen, bis in die Gegenwart Bezug
genommen und ihre Ergebnisse, Begriffe und Methoden, soweit sie für
unsere Ziele und Zwecke nützlich erscheinen, einbezogen. Als grundlegender
struktureller Rahmen wird in Anlehnung an Popper eine drei Welten-Perspektive
(W1 [Physik], W2 [Psychologie], W3 [Objektiver Geist/ Kulturwelt]) eingenommen,
wobei W3 - im Unterschied zu Popper - eher reduziert als Welt der Zeichen
und nicht im Sinne einer Welt des objektiven Geistes interpretiert wird.
In der wichtigen Universalienfrage
tendiere ich - nach
Stegmüller
höchstens zum konstruktiven Konzeptionalismus.
Fragt man einen Menschen: "Wie
geht es Ihnen?" so fordert man ihn auf zur Innenschau. Man setzt
voraus, dass er die Frage versteht - womit wir beim
Denken sind - , sie annehmen und ausführen kann. Wenn auch die Frage
auf das Befinden abzielt, also mehr die affektive Seite (Antrieb, Gefühle,
Wünsche und Bedürfnisse, Stimmung, Verfassung) betrifft, so ist
dieses in der Innenschau zu erfassen, in Begriffe und Worte und Sätze
zu bringen, wozu auch das Denken benötigt wird. Eine andere wichtige
Frage ist oft, die Beratungs- oder Therapieziele betreffend: Was möchten
Sie? Dem könnte die Frage nach den Beschwerden oder Symptomen
vorausgehen: woran leiden Sie oder was stört Sie?
Diese Arbeit gibt eine Antwort auf die Frage: Wie
erkundet
man nun das Erleben und Denken, das ja immer eingebettet ist in
einen unaufhörlichen
Bewusstseinsstrom,
in eine Erlebens- und Gesamtbefindlichkeit, in eine Situation? Wie unterscheidet
sich Denken überhaupt von den anderen wichtigen psychischen Grundfunktionen,
wie wahrnehmen, bewusst sein, aufmerken, konzentrieren, wünschen,
bedürfen und brauchen, wollen, fühlen, empfinden, spüren,
vorstellen und phantasieren, erinnern, merken, lernen und lenken? Lassen
sich die psychischen Elementarfunktionen überhaupt unterscheiden
und voneinander trennen, d.h. ein Ganzes teilen und fixieren
oder
festhalten? Damit haben wir schon mehrere wichtige elementare Denkfunktionen
benannt: ein
Ganzes teilen, fixieren oder festhalten,
unterscheiden
und trennen.
Ziel ist letztlich, die schwierig zu fassenden psychischen
Elementarbegriffe - hier im Umfeld denken - über einfache Versuche,
die im Grunde fast jeder durchführen kann, so zu normieren, dass eine
intersubjektiv kontrollierbare Kommunikation nicht nur theoretisch, sondern
vor allem auch praktisch im Sinne meines Ideals der Einheitswissenschaft
gefördert wird.
Zum Aufbau der Arbeit: 1. Zunächst wird der
"reine" psychologische Denkbegriff entwickelt und abgegrenzt von anderen
wichtigen psychischen Funktionen wie z.B. sprechen oder vorstellen. 2.
werden die Hauptfunktionen des Denkens (Repräsentation und Verstehen
der Welt) erörtert. Es wird aus dem weiten Feld der denknahen Worte
und Begriffe, die die deutsche Sprache bereitstellt, berichtet. Sodann
werden exkurshaft einige wichtige denknahe Begriffe - Begabung, Dummheit,
Intelligenz, Bildung - erörtert und abgegrenzt. 3. werden systematische
und chronologische (Zeittafel) Ausführungen zur Geschichte der Denkpsychologie
und ihrer Ergebnisse dargestellt. 4. werden die Methoden der Denkpsychologie
und ihrer Umgebung mitgeteilt. 5. wird der systematische und experimentelle
Aufbau allgemeiner und integrativer Denkpsychologie anhand einfach durchzuführender
Versuche entwickelt. 6. beschäftigt sich zunächst mit dem Weltbild
eines Säuglings, Kleinkindes, Kindergartenkindes, Vorschulkindes und
Grundschulkindes. Sodann wird ein begrifflicher und relationaler Aufbau
der Welt entworfen, wie er für einen durchschnittlich gebildeten Jugendlichen,
Heranwachsenden oder Erwachsenen gegliedert werden kann. Damit ist
die Denkpsychologie im engeren Sinne abgeschlossen. 7. beschäftigt
sich mit den vielfältigen Störungen und Erkrankungen des Denkens,
reicht also teilweise weit in das Gebiet der Psychopathologie hinein. Und
8. schließt mit den Behandlungsmöglichkeiten des Denkens an
Kapitel 7 an. Im Anhang sind der wissenschaftliche Apparat, Literatur,
Links und andere Hinweise untergebracht.
Zur Aktualisierung: Die Grundidee, Denken als Sprache des Geistes, wurde im September 2000 im Internet quasi als erstes Kapitel publiziert und wurde nach intensiver Arbeit seit Dezember 2009 am 1.6.2010 auf 8 Kapitel erweitert. Organisatorische Anmerkung: Nachdem der Text ziemlich umfangreich wurde, werden künftige Erweiterungen und Vertiefungen ausgelagert und verlinkt. Hinweis: Zur neuen Defintionsseite Denken als Erleben
1 Einführung: erste Unterscheidungen und Näherungen
Wort und Begriff denken sind im Alltagssprachgebrauch Homonyme, d. h. Wort und Begriff haben viele Bedeutungen und werden ganz unterschiedlich verwendet. Denken wird für Bewußtseinsinhalte ausdrücken, erleben, für etwas bewußt sein, für erinnern, überlegen, meinen, werten, beurteilen, schließen, vorstellen, phantasieren, für Erlebnisinhalte, die sprachlich formulierbar sind, verwendet. Damit sind wir bei einer grundlegenden Schwierigkeit der Psychologie und Psychotherapie, nämlich dem Problem der klaren Fassbarkeit ihrer "Gegenstände". Woran erkenne ich, daß ich oder ein anderer denkt und nicht fühlt, vorstellt, empfindet, wahrnimmt, erinnert, "Bewußtseinsfilme dreht" = tagträumt oder lernt? Man erkennt an dieser Frage sofort die oben erwähnte grundlegende Schwierigkeit der Psychologie und Psychotherapie. Häufig wird denken mit sprechen gleich gesetzt, was ich nicht nur für unangemessen, sondern sogar für falsch halte.
Denken
und Sprechen - Denken nennen wir die Sprache des Geistes
_
|
(Klix, Erwachendes Denken, 1993, S. 130.) |
Sprache fassen wir hier so allgemein, daß auch das Denken als Sprache des Geistes interpretiert werden kann. Die natürliche Alltagssprache und die Sprache des Denkens sind in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie nicht identisch. Das ist ganz wichtig zu begreifen. Ich halte es für einen fundamentalen Fehler, das Denken oder die "Denksprache" mit der natürlichen Alltagssprache gleichzusetzen und damit zu verwechseln. Menschen, die der natürlichen Alltags-Sprache nicht mächtig sind, z. B. Taubstumme, könnten dann ja nicht denken, wenn die Denksprache der natürlichen Alltagssprache gleichgesetzt würde. Auch die Tiere könnten nicht denken, was jeder sorgfältigen Beobachtung entgegenstünde, vollzöge man diese unzulässige Gleichsetzung.
Denken und Sprechen. Definition: Denken und Sprechen sind zwei verschiedene psychologische Grundfunktionen. (1). Satz: Denken ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Fähigkeit kommunikativ zu sprechen. Axiom: Denken ist grundsätzlich unabhängig von der Fähigkeit zu sprechen (es sei denn, man definiert Denken als Sprache des Geistes). Wollte man das Axiom beweisen und damit aus ihm einen Satz machen, würde man für die Versuche irgendeine Art der Sprache anwenden müssen und damit in einem logischen Zirkel landen - daher das Axiom. Genauere Ausarbeitungen überlassen wir den psychologischen WissenschaftstheoretikerInnen.
Die Wirklichkeit oder besser noch "Welten" werden also mit Hilfe einer Sprache konstruiert. Voraussetzung dafür, daß dies gelingen kann, ist, daß die Sprache die entsprechenden Elemente der Wirklichkeit und ihrer Relationen darstellen kann. Die Sprache entwickelt sich natürlich aus den Kommunikationsinteressen, die wiederum in den grundlegenden Bedürfnissen und Interessen der Sozialgemeinschaft wurzeln. Tatsachen der Wirklichkeit können möglicherweise nicht abgebildet werden, weil die Sprache hierfür keine Strukturelemente entwickelt hat. Andererseits kann eine hinreichend entwickelte Sprache Konstruktionen von Phantasiewirklichkeiten erlauben, die es realiter so gar nicht gibt. Wenn der Mensch selbständig zu denken beginnt, hat er schon eine Wirklichkeitsstruktur verinnerlicht, nämlich diejenige, selbst wenn er taubstumm ist, die seiner Wahrnehmungs- und Interessenwelt und seiner sozialen Bezugsgruppe entspricht.
Denken "ist"
nicht sprechen und sprechen "ist" nicht denken. y
Denken
bedeutet geistige Modelle bilden und / oder zueinander in Beziehung setzen.
Denken kann in oder mit einer Sprache kommuniziert werden. Wir sollten
daher die primäre Denksprache von der sekundären Kommunikationssprache
unterscheiden.
Anmerkung: Diese Definition des Denkens
wurde in Sponsel
(1995, S. 126) formuliert.
Der alltagssprachliche und bildungsübliche Denkbegriff beinhaltet sowohl y Vorstellen als auch y Phantasieren. Für einen strengen terminologischen Aufbau ist indessen eine differenzierte Betrachtung zu empfehlen, unter keinen Umständen aber eine Gleichsetzung. Wir können aber Vorstellungen als geistige Modelle von Wahrnehmungen und Phantasien als geistige Modelle von Möglichkeiten auffassen, dann ergeben sich Vorstellen und Phantasieren als spezielle und differenzierte Formen des Denkens.
Denken ist auch nicht
gleich
vorstellen, ein fundamentaler Fehler, den die SchöpferInnen
des sog. Neurolinguistischen Programmierens begehen. Exkurs: Falscher
Ansatz bei den NLP-Begründern Grinder & Bandler, die meinen (1984,
S. 313): "Die meisten Menschen erleben ihre Informationsverarbeitenden
Prozesse als Einheit und nennen es »Denken«; Bandler und Grinder
haben jedoch festgestellt, daß es sinnvoll sein kann, das Denken
nach den verschiedenen Sinnesmodalitäten, in denen es stattfindet,
zu unterteilen. Wenn wir Informationen innerlich verarbeiten, tun wir das
visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch oder gustatorisch."
Hier wird offensichtlich "denken" mit "vorstellen" gleichgesetzt, wobei
wir unter vorstellen die Repräsentation einer im Gedächtnis gespeicherten
Wahrnehmung im Bewußtsein verstehen. Das "Denken", worunter wir das
Bilden von geistigen Modellen verstehen, ist bei den meisten Menschen abstrakt
und unanschaulich, weshalb Verfahren, die nur das Denken des Menschen ansprechen,
auch nicht sehr tief gehen, wie alle therapeutisch Tätigen wissen.
Wie soll aber der Denktyp eines Menschen erkannt werden, wenn man den Vorstellungstyp
meint und ihn damit verwechselt? Ende_Exkurs.
Anmerkung: Auch Gottlob Frege verwendet in "Der
Gedanke" einen von der Psychologie abweichenden Vorstellungsbegriff.
Wir stellen hingegen fest: y Vorstellen bedeutet, Wahrnehmungen aus dem Gedächtnis aufrufen und im Bewußtsein repräsentieren. y Vorstellen von dieser strengen psychologischen Definition ist also nichts anderes als Wahrnehmungen erinnern und apperzipieren; und eine y Vorstellen ist eine im Bewußtsein repräsentierte erinnerte Wahrnehmung. Demgegenüber ist die y Phantasie um Elemente angereichert, die keiner Realwahrnehmung entsprechen müssen. Phantasiere ich Pegasus, ein Pferd mit Flügeln, so ist so ein Wesen in der Natur nicht wahrnehmbar, allenfalls im Film oder im Zirkus, in einer Werkstatt der Illusionen hergestellt, also nur virtuell existent.
Die Sprache wird von den Interessen der Kommunikatoren und ihren Erfahrungen geprägt. So haben Eskimos viele Begriffe für "weiß" und Wüstenbewohner viele Worte für "sandfarben". Unsere Erfahrung ist, daß die Zeit nicht umkehrbar ist und sich nach vorwärts, in die Zukunft hinein entwickelt. Weil wir das so erleben und erfahren, glauben wir im Laufe der Zeit, daß sich die Zeit nicht zurück entwickeln kann, daß es eine Reise in die Vergangenheit nicht gibt. Wir neigen also aufgrund persönlich eindringlicher Erfahrungen und Erlebnisse dazu, das Erlebte für ein Naturgesetz oder für die Wirklichkeit zu halten. Ist ein Nachbar zu mir immer mürrisch, habe ich ihn nie anders gesehen, bin ich geneigt zu glauben, daß er so ist, obwohl ich eigentlich nur sicher wissen kann, daß er bislang zu mir so gewesen ist. Sage ich z. B. weiter, das i s t ein mürrischer Kerl, habe ich unzulässig generalisiert, ich gehe weiter, als ich sollte und darf. Ich verlasse meine Erfahrungsbasis. Ich habe eine Einstellung, ein Stereotyp, ein Vorurteil, gebildet.
Unsere Vorstellung von der Welt wird also sehr beeinflußt, von unseren Erfahrungen, von der Kommunikation mit anderen und von unseren Interessen, Wünschen und Motiven. Wissenschaft ist nun ein Unterfangen, das die Welt und die Ereignisse auf allen Repräsentations-Ebenen zutreffend erfassen will. Zwischen Modell und Wirklichkeit besteht eine Äquivalenzrelation der - jeweils bezüglich bestimmter Zwecke und Ziele betrachteten - relevanten Elemente und ihrer Beziehungen, die mehr oder minder richtig sein kann - dann repräsentiert das Modell die Wirklichkeitsstücke mehr oder minder korrekt - oder nicht.
Wissenschaft, Denken und Sprache: Wissenschaftliche Theorien sind in Sprache ausgedrückte Modelle, Repräsentationen von allgemeinen oder speziellen Wirklichkeiten oder Teilen davon.
Beispiel
zur Selbstuntersuchung des Denkprozesses: Damit das Ganze nicht so
trocken bleibt, hier eine psychologische Denkaufgabe, die einiges erhellen
können sollte: Versuchen Sie, einem Unkundigen zu erklären,
was Unteilbares bedeuten soll! Sie werden bei der Lösung
der Aufgabe feststellen, daß diese nicht so einfach ist. Man muß
denken und die Aufgabe, den Sachverhalt erst einmal erfassen. Eine Möglichkeit,
das Denken psychologisch zu studieren ist, die Versuchsperson nach entsprechender
Einübung und Training zu bitten, laut zu denken.
Die eigenen Gedanken dem Ablauf nach auf ein Tonband sprechen läuft
auf dasselbe hinaus.
Nun, was haben Sie festgestellt: daß
dies eine schwierige und auf Anhieb nicht zu lösende Aufgabe ist?
Welten. Der Ursprung des Denkens liegt sicher in der Repräsentation der Wahrnehmungswelt. Eine ganz wichtige Aufgabe des Denkens ist daher die Repräsentation nicht nur der Wahrnehmungswelt, sondern der Welten, die sich aus der Perspektive des Menschen ergeben. Die Relativität der menschlichen Perspektive und die Unzulänglichkeit seiner Wahrnehmung auf der einen Seite und die spezifisch menschliche Perspektive auf der anderen Seite führen zu einer Vielzahl von Welten: objektive Welt (die unabhängig vom menschlichen Bezugssystem gelten soll: die Welt der Naturwissenschaft: Physik, Chemie, Biologie und ihrer Derivate wie z. B. die Technik), die intersubjektive Welt, wie sie sich Menschen mit gleichartigen Wahrnehmungssystemen phänomenologisch darstellt, gruppensubjektive Welten wie sich sich bestimmten ökologischen und interessengeleiteten Gruppen darstellt (Sozialwissenschaften, Soziologie, Sozialpsychologie) und die subjektiven Welten wie sie sich den idiographischen Fragen und Problemen von Individuen (Medizin, Psychologie, Kultur- und Kommunikationswissenschaften). Hinzu kommen noch die Modi der wirklichen Welt, möglicher Welten und normative Welt (erwünschte oder gesollte Welten). Ausführlicher hier.
Da diese verschiedenen Perspektiven und Modi auf komplexe Weise miteinander vernetzbar sind, ergeben sich nicht selten erhebliche Komplikationen und zahlreiche Mißverständnisse in der Kommunikation beim Austausch des Denkens. Hinzu kommt, daß die Sprache in steter Entwicklung und im Fluß ist. Erschwerend ist weiter die häufige babylonische Sprachverwirrung in den sogenannten nicht-exakten Wissenschaften.
Denken und Wissenschaft. In der Wissenschaft geht es in erster Linie um die Repräsentation (Modellbildung) der objektiven Welt. Die allgemeine Denkpsychologie könnte hierzu allgemeinste geistige Modelle elementarer und vielfach ähnlicher Wirklichkeitselemente, Wirklichkeitsstrukturen, Ereignis- und Geschehensmodelle beitragen.
Denken ist nur zu einem geringen Teil an das Bewußtsein gebunden und insofern auch nur zum Teil ein bewußter Prozeß. Und es ist vielfach auch nur am bewußten Ende des Denkprozesses ein logisch anmutender und klarer Prozeß, den man gewöhnlich als rational bezeichnet. Die Wirklichkeit des Denkprozesses ist gut mit dem geistigen Modell der Eisberg-Analogie beschreibbar: nur die kleine aus dem Wasser herausragende Spitze ist nachvollziehbar logisch, klar, bewußt, der "Hauptsachenrest" spielt sich im Halb- bis Unbewußten ab. Auch diese Tatsache macht die Erforschung des wirklichen und vollständigen Denkens so schwierig. Hinzu kommt, daß es nicht oft blitzschnell verläuft und auch von der Geschwindigkeit des Ablaufes her eine Untersuchung sehr erschwert. So gesehen ist die Psychoanalyse grundsätzlich auf dem richtigen Weg, indem sie die Bedeutung der unbewußten Prozesse erkennt und betont. Statt aber wissenschaftliche Methoden zu entwickeln, die den Fakten und Problemen der unbewußten Prozesse Rechnung tragen, ist man beim esoterischen bloßen Meinen im wesentlichen auf Freuds Niveau stehen geblieben, und das ist nun auch keine Lösung.
Definition Denken
Zur Definition des Denkens wird im Rahmen der elementaren Dimensionen
der Erlebensforschung eine eigene Seite erarbeitet.
| Denken ist eine psychologische
Grundfunktion und bedeutet geistige Modelle von Sachverhalten bilden
oder zueinander in Beziehung setzen.
Denken kann als die (Primär-) Sprache des Geistes angesehen werden (gegenüber den Sekundär-Sprachen mit KommunikatorInnen). Damit ist der Begriff denken auf den Begriffsverschiebebahnhof geistige Modelle bilden oder zueinander in Beziehung setzen verschoben. Es muss daher geklärt und erklärt werden, was geistige Modelle oder zueinander in Beziehung setzen bedeuten soll. Als Grundbegriff wäre geistiges Modell nicht definierbar. Aber man kann über Beispiele und Gegenbeispiele hinreichend klar machen, wie man geistiges Modell verstehen kann. Beispiele für geistige Modelle: Baum, Himmel, Gedanke, ist, oder, auf, ab, Richtung, Angst, Absicht, Urteil, Prädikat, Aussage, Gedächtnis. Als elementarstes geistiges Modell kann man einfache Begriffe betrachten. Nach der Anzahl der Begriffe, kann man dann verschiedene Stufen oder Komplexitätsgrade unterscheiden. Stufe 1: Begriff als einfachstes geistiges Modell. Stufe 2: Zwei Begriffe, die zueinander in Beziehung gesetzt werden. Stufe 3: Drei Begriffe, die zueinander in Beziehung gesetzt werden. Stufe n: n Begriffe, die zueinander in Beziehung stehen. Theorem: Begriffe, die zueinander in ein einer gesetzesartigen oder regelhaften Beziehung stehen. Theorie: verknüpft mehrere Theoreme, z.B. Theorie der Assoziation. Anmerkung-1: Im Alltag und in der Bildungssprache
bedeutet denken eine Vielzahl von psychologischen Funktionen: Vorstellung,
Phantasie, Bewußtseinsinhalte vergegenwärtigen oder reflektieren,
erinnern, urteilen, schließen, empfinden, fühlen, wahrnehmen,
werten, konstruieren u.a.m.
"... Wenn die Denkkraft der Seele mit dem Bewußtseyn, mit dem Unterscheiden, mit dem Ueberlegen der Idee, die sie vor sich hat, beschäftiget ist; so ist sie schon als eine Denkkraft thätig, und wirket auf eine vorzügliche Art nach einer bestimmten Richtung hin. Sollte sie nun in demselben Augenblick auch über diese ihre Thätigkeit reflektiren, so müßte sie die nemliche Arbeit zugleich auf diese Thätigkeit verwenden. Kann sie aber ihr Vermögen des Bewußtseyns zerspalten, und mit Einem Theil desselben bey der Idee von der Sache, und mit dem andern zugleich bey der Anwendung, die sie von dem Vermögen machet, wirksam seyn? Sie müßte alsdenn noch mehr thun, als auf zwey Sachen auf einmal aufmerken. Dieß letztere läßt sich noch wohl auf eine gewisse Weise thun, aber wenn sie ihre Aufmerksamkeit und ihr Gewahrnehmungsvermögen auf eine Idee verwendet, wie will sie solche denn zugleich auf ihre eigene Aufmerksamkeit und auf ihr eigenes Gewahrnehmen verwenden? Indem wir denken, und dieß zeiget sich am deutlichsten, wenn wir mit Anstrengung und mit einem glücklichen Fortgange denken, wissen wir nichts davon, daß wir denken. Sobald wir auf das Denken selbst zurücksehen, so ist der Gedanke entwischet, wie das gegenwärtige Zeitmoment, das schon vergangen ist, wenn man es ergreifen will.Ich bin nicht sicher, ob das richtig ist, denn für das Vorstellen konnte ich beweisen, dass man sich selbst beim Vorstellen beobachten kann. Wieso sollte das für andere elementare Dimensionen des Erlebens wie z.B. das Denken nicht gelten? Auch ist nicht ausgemacht, ob nicht zwei ICH-Konstruktionen sinnvoll sind, eines, das handelt und eines, das dieses Handeln beobachtet und lenkt. Viele Paradoxien, Antinomien oder Aporien des ICH-Erlebens könnnten dadurch verschwinden. Schließlich ist es auch allgemeine Erfahrung: es gibt Handeln und Tun und es gibt Aufsicht und Lenken, Steuerung, Regelung des Handelns und Tuns. |
2
Grundaufgaben des Denkens:
1. Geistige Re-Präsentation und 2. Verstehen der
Welt
2.0 Philosophischer Einstiegs-Exkurs zur Erkenntnistheorie.
Erkenntnistheoretischer Hauptsatz: Jede Erkenntnis irgendeines Sachverhalts erfolgt durch ein erkennendes System und seine Filter. Erkennen eines Sachverhalts gibt es nur relativ zu einem erkennenden System, d.h. erkennen ergibt sich aus dem Zusammenspiel Erkennendes System und Sachverhalt. Das Ding an sich gibt es nicht, daher sollte man es gar nicht erst suchen, weil man es nicht finden kann. [Q] Aber man kann dem Objektiven sehr nahe kommen.
Die Denkpsychologie hat seit langem bedeutende Vorfahren:
1) die Mathematik und Logik als bislang höchste Form reinen Denkens,
2) die Erkenntnistheorie, früher meist von von Philosophen, heute
teilweise von WissenschaftstheoretikerInnen betrieben und 3) die empirischen,
besonders die sehr erfolgreichen Natur-Wissenschaften. Nicht zu vergessen
ist natürlich das Denken im Alltag. Fast alle Menschen denken nahezu
ständig. Das Denken spielt sozusagen eine überragende Rolle im
Leben. Das Denken ist somit Forschungsgegenstand vieler Wissenschaften,
einschließlich des alltäglichen Denkens. Nur in diesem Punkt
hat
Ryle mit seiner Kritik an der Denk-Psychologie
recht.
Die philosophische Erkenntnistheorie führt
aber leider nicht weiter, weil sie nur
auf das Denken setzt. Das ist zwar auch in der Mathematik so, aber
dort diszipliniert der Beweis
sehr streng und sehr radikal. Ansonsten sind die meisten Wissenschaften,
die diesen Namen verdienen, an die Erfahrung gebunden und werden auch an
ihr geprüft. Aber nicht nur die mathemathematische Beweisstrenge,
auch die empirische Anbindung fehlt der Philosophie in ihrer
genuinen Denkpraxis meist gänzlich, so bleibt sie meist auf dem Niveau
von Theologie, Meinungsideologien oder anderen Glaubensgebäuden stehen
(Ausnahmen). Daher soll der Ausflug in die philosophische
Erkenntnistheorie sehr kurz gehalten werden.
Gibt es die Welt, das Ding an sich [Kant,
Eisler],
also eine "objektive" Welt? Oder gibt es die Welt immer nur relativ
zu einem Erfassungs- , Erkenntnis- und Konstruktionssystem? Obwohl wir
das Ding an sich [Kant,
Eisler]
per definitionem eigentlich gar nicht erkennen können, braucht es
das auch nicht, wie uns besonders die Naturwissenschaften zeigen und vormachen.
Die Wissenschaften haben ihre Erkenntnisse unabhängig von ihrer Stellungnahme
zum Ding an sich [Kant,
Eisler]
und der Philosophie gewonnen. So gesehen kann man also getrost auf die
nur
denkende Philosophie verzichten. Denken, vor allem richtig denken, ist
zwar eine notwendige Bedingung für wissenschaftliche Erkenntnis und
Fortschritt, aber sie reicht natürlich längst nicht hin.
Die Begrenztheit unseres direkten Erkenntnisvermögens
durch unsere Sinne wurde durch die Entwicklung von Meßgeräten
wenn auch nicht gänzlich überwunden, so aber doch sehr stark
erweitert. Wir wissen dank der (Natur-) Wissenschaft über die Welt
viel, viel mehr als wir nach unseren Sinnesorganen wissen könnten.
Das eben ist der große Vorzug aller Wissenschaft:
sie erweitert unser naives Erfahrungswissen, unser gewöhnliches Denken
oder unseren naiven Glauben. Dieses Wissen ist wesentlich eine Errungenschaft
des wissenschaftlichen Denkens.
Die alte Frage nach dem Ding an sich hat im 20.
Jahrhundert eine neue und radikale Interpretation durch den Konstruktivismus
erfahren, wobei mit diesem oft in vulgärkonstruktivistischer
Manier das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet wird. In der
Wissenschaftstheoretischen Bewegung sind nicht wenige fragwürdige
Geister unterwegs und es ist manchmal sehr schwer, die Spreu vom Weizen
zu trennen.
Die allgemeinen wissenschaftstheoretischen Hilfsmittel
zum Verstehen der Welt behandle ich unter den Methoden 4.3
2.1. Geistige Re-Präsentation
Als erste Grundaufgabe des Denkens kann gelten: Geistige Modelle der Welt (einschließlich von sich selbst) bilden und zueinander in Beziehung setzen, wobei in Beziehung setzen schon ein gewisses Verstehen - zumindest erste (implizite) Hypothesen - bedeutet, wodurch 2.1 und 2.2 zusammenhängen. Wahrscheinlich ist eine isolierte begriffliche Erkenntnis ohne begriffliche Umgebung und Kontext auch gar nicht möglich. Die Welt-Repräsentation ist - psychologisch gesehen - geistig aus Begriffen aufgebaut, die zueinander in Beziehung stehen und dadurch eine Re-Präsentation der Welt ermöglichen. Jeder Mensch erschafft - meist ohne das besonders zu bemerken, er denkt "einfach" - seine eigene subjektive Welt. Naive Menschen halten ihre eigene subjektive Welt für die Welt schlechthin und glauben, dass die Welt so ist, wie sie ihnen erscheint, wie sie sie erleben. Kritische Geister wissen um die Subjektivität und Relativität ihrer Konstruktionen. Die persönliche Erschaffung eines Modells der Welt oder von ihren Teilen ist eine konstruktive Leistung, die mit anderen Modellen, auch anderer Menschen, teilweise übereinstimmen oder nicht übereinstimmen kann. So lässt sich auch der schwierige Wahrheitsbegriff als Relation zwischen Wirklichkeitsmodellen vernünftig begründen
2.2 Verstehen
der Welt
Wozu brauchen Lebewesen ein Verständnis der Welt? Nun, die Antwort
hat Darwin gegeben. Wer seine Welt verstehen kann, überlebt eher und
lebt womöglich auch besser. Verstehen der Welt dient also der Sicherung
der Existenz und ihrer Qualität. Geht man von diesen beiden
Elementarzielen aus, so sollte auch Erziehung, Schule, Ausbildung, Arbeit
und Beruf an diesen Elementarzielen ausgerichtet sein. Leider lernt man
- gemessen an den beiden Elementarzielen - viel überflüssigen
Plunder in der Schule, aber nicht das das, was man in seinem Leben wirklich
brauchen kann und weiter führt.
Ausgehend von den beiden Elementarzielen, die Existenz
und ihre Qualität zu sichern, käme es in der Hauptsache darauf
an, die Welt, sich selbst und die anderen so zu begreifen, das sich einem
Zusammenhänge, Gesetzmäßig- und Regelhaftigkeiten erschließen.
2.3
Das weite Feld denknaher Worte und Begriffe in der deutschen Sprache.
Besondere Denkbegriffe, Spezifikationen, denknahe Begriffe, Denkweisen,
Umgebung und Faktoren A-Z.
Sieht man sich die Worte und Sprache um den Begriff des Denkens an,
stellt man fest, dass das ein riesiges Gebiet ist. Es reicht auch in andere
psychische Funktionsbereiche hinein (Beurteilen und Bewerten, Entscheiden,
Verhalten, Tun- und Lassen, Anpassen und Gestalten) und setzt auch andere
voraus, z.B. Erfahren und Erleben, Begabung, Wahrnehmung, Gedächtnis,
Beurteilen, bewerten; planen; entscheiden; lenken; merken, lernen, wissen,
können; vorstellen, phantasieren, konfabulieren; Begabung, Fähigkeiten,
Gedächtnis, Intelligenz, Klugheit, Kreativität, Problemlösung,
Dummheit. Einstellung, Vorurteil. Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Interesse,
Wünsche, Bedürfnisse, Motivation. Wille, Anpassungs- und Gestaltungsfähigkeit.
Das theoretische und praktische Werkzeug für genaue begriffliche Unterscheidungen
wird in Kapitel 5 entwickelt.
Die Denkpsychologie im engeren Sinne ist inzwischen
- wie die Psychologie - als eigene wissenschaftliche Disziplin über
100 Jahre alt und hat in dieser Zeit sehr viel wissenschaftliches Material
erarbeitet. Im Zuge dessen wurden auch viele Denkbegriffe und solche aus
ihrer kognitiven Umgebung geschaffen. Die größte sprachliche
Materialsammlung wurde im deutschen Sprachraum von Dornseiff
1955 auf 23 Seiten mit ca. 250 Worten pro Seite zur Verfügung
gestellt, was dann rund 6000 Worte ergibt (Beispiele
hier).
Stoffsammlung: Denkbegriffe, Spezifikationen
und ihre kognitive Umgebung
Vorbemerkung: Die folgenden, teilweise redundanten Wort-
und Begriffsschöpfungen erfassen lediglich, welche Worte in der denkpsychologischen
Literatur gebraucht werden [In eckigen Klammern ein Nachweisbeispiel aus
der Literatur; viele Worte und Begriffe kommen auch bei mehreren AutorInnen
vor: die Nennung steht lediglich für eine Belegstelle, die
meist nicht den Erfinder der Wortschöpfung angibt]. Über den
wissenschaftlichen oder praktischen Sinn und Nutzen ist damit nichts gesagt
(D.:= Denken). Denken einschließlich der Denkstörungen oder
der Denkprozess im engeren Sinne gefettet; Charakterisierende
Kennzeichnungen können voran- oder nachgestellt sein. Die Auswahl
zeigt, welche Komplexität und Vielfalt zum Denkraum gehört.
Abgleiten d. Gedanken [Zeigarnik]
* Ablenkung [?] * Absolut richtiges D. (Geiger
S. 41) Abstraktes D. [AEM]
* Abstraktionsarmes D. [Bleuler]
* Agnosie [Franke]
* Aha Erlebnis [Hussy
1] *
Aktives D. [Langer]
* Aktivieren [Dörner74]
* Allgemeines D. [Graumann]
* Alltagsdenken (Jedermannsdenken) [Hussy
2] * Analoges D. [Vester85]
* Analogie [deWitt;
Hofstadter]
* Analogieschluss [Hussy
1] *
Analytisches D. [Graumann]
* Anarchistisches D. [1: 2: Feyerabend]
* Anfangszustand [Dörner79]
* Anschauliche Modelle beim D. [Oerter]
* Anschauliches D. [Arnheim]
* Archaisches D. [Klix1980,267]
* Archetyp [Jung] * Argumentieren [?] * Assoziationslockerung [Bleuler]
* Assoziatives D. [Graumann]
* Auf der Zunge liegen [?] * Aufmerken
[] * auswählen [] * Autistisches
D. [Bleuler]
* Autistisch-undiszipliniertes D. in der Medizin [Bleuler21]
* Autonomes D. [?] * Begabt, Begabung [?] * Begriffliches
D. [Selz; Graumann]
* Begriffsgefühle [Szymanski]
* Behavioristisches D. [Graumann]
* Beiderseits offener Denk-Typus [Wertheimer]
* Beschleunigtes D. [Margraf]
* Beweis * Bewußtseinslenkung
[Jörg]
* Bildliches D. [?] * Bizarres D. [?] * Blöde, Blödheit
> Dumm * Bürgerliches D. (Geiger
S. 41) Debil [?] * Deduktives D. [Hussy
2] * Definiendum [Savigny]
* Definiens [Savigny]
* definieren, Definition [Savigny]
*
Denkakt [Hönigswald]
* Denkbares, Denkbarkeit [Hönigswald]
*Denkblockaden [Vester
> Gedankenblockade] * D. als Aufgabe [Graumann]
* D. als Disposition [Graumann]
* D. als dynamischer Prozeß [Graumann]
* D. als Entscheidung [Graumann]
* D. als Innehalten [Graumann]
* D. als inneres Handeln [Oerter]
* D. als Meinen [KülpeR3]
* D. als vorwissenschaftlicher Begriff [Graumann]
* Denkanlässe [Wertheimer]
*
Denken der Epileptiker [Bleuler]
*
D. der Realitäten [KülpeR3]
* Denken fremder Völker [Funke]
* Denken in Modellen [SchaeferG]
* Denken in Systemen [Dörner1992]
* D. interpolierendes [Oerter]
* Denken in Zusammenhängen mit Fühlen und Wollen [Dörner1992]
* Denken lernen [Mayer]
* Denkerlebnis [Hönigswald]
* Denkfähigkeit, Verbesserung der [Dörner1992]
* D. [Funke]
*
Denkfehler [Funke]
* Denkfiguren [Dörner1992]
* Denkmuster, bewusste und unbewusste [Stavemann]
* Denken, evaluatives [Zimbardo]
* Denken im Schlaf [Funke]
* Denken ohne bestimmtes Ziel [Wertheimer]
* Denken, strategisches [Dörner1992]
* Denken: Unfähigkeit zum nichtlinearen [Dörner1992]
* Denken, vernetztes [Dörner1992]
* Denkoperationen, formale [Mayer]
* Denkpsychologie [Funke]
* Denkschleifen [Dörner1992]
* Denkstile, inadäquate [Margraf],
krankmachende, neurosefördernde [Stavemann]
* Denkstörungen, formale und inhaltliche
[Spitzer] * Denktraining
[Dörner1979]
* Denkverlauf [Hönigswald]
* Denkweisen, dysfunktionale und funktionale [Stavemann]
* Depressives D. [?] * Dereierendes
/ dereistisches D. [Bleuler]
* Dialektisches D. [Funke]
* Dichotomes D. [Queckelberghe]
* Didaktisches D. [Funke]
* Digitales D. [Vester85]
* Divergentes D. [Hussy
2] * Diskursives D. [Oerter]
* Disziplinierendes D. [?] * Divergierendes D. [Graumann]
* Dumm, Dummheit, dummes D. [Geyer]
*
Egoistisches D. [Wertheimer]
* Egozentrisches D. [Wertheimer]
* Eingeengtes D. [Margraf]
* Einsicht [Graumann]
* Empirisches D. [?] * Entknüpfen [Dörner74]
*Erfassendes D. [Graumann]
* Erkennen [?] * Esoterisches D. [?] * Exaktes D.
[Reidemeister]
* ex falso quodlibet [Logik]
* Experimentelles D. [Leuders] * Extrapolierendes D. [Oerter]
* Fabulieren [?] * Faden verlieren [Hönigswald]
* Falsch [?] * Fantasieren (phantasieren) [?] *
Figurales
D. [Hussy 1]
* Folgebeziehung [Funke]
* Formales D. [] * formal-operatorisches D. [OerMon]
*
Formale Denkstörungen [Bleuler]
* Freies D. [Graumann]
*
Funktionales D. [SchaeferR;
Vollrath]
* Ganzheitliches D. [PetersR]
* Gebundenes D. [Graumann]
* Gedanke (Frege)
* Gedanken abreißen [PetersUH]
* Gedankenausbreitung [PetersUH]
* Gedankenbeeinflussung [PetersUH]
* Gedankenbilder [Arnheim]
*
Gedankenblockade [PetersUH>
Denkblockade] * Gedanken drängen [PetersUH]
* Gedankeneingebung [PetersUH]
*
Gedankenentzug [PetersUH]
* Gedankengefüge (Frege)
Gedanken
laut werden [PetersUH] *
Gedankenleere
[PetersUH] * Gedankenschwund
[PetersUH] * Gedankensperrung
[PetersUH] * Gedankenzerfall
[PetersUH] * Gegenstandslehre
(Meinong) *
Gehemmtes D.
[Margraf]
* Geistesblitz [Wertheimer]
* Geistige Gewohnheiten [Levy-Bruhl1927]
* Gewohnheit [] * Gerichtetes D. [Mayer]
* Geschlossenes
Denksystem [Albertz]
* Geschlossener Denktypus [Wertheimer]
* Gesetz der Partizipation [Levy-Bruhl1926]
* Gestörtes D. [?] * Glossogenes D. [Bergius]
* Grübeln [?] * Heuristisches D. [Funke]
* Holzwege [Koch-Hillebrecht]*
Hypothese
[Funke] * Idealtypus
[W]
* Ideenflüchtiges D. [Margraf]
* "Illegales" D. (Fehler) [Dörner74]
* Induktives D. [Zimbardo]
* Information [] * Informationsverarbeitung [Klix71]
*
Inhaltseffekt [Beller]
* Inhibieren [Dörner74]
*Inkohärentes D. [Margraf]
* Intelligenz [Funke]
* Interpolierendes D. [Oerter]
* Intuitives D. [Bergius]
* Instrumentelles D. [Wertheimer]
* Introspektion [Ziehe]
* Irrationales D. [?] * irren, Irrtum [Selz]
* Juristisches D. [Engisch] * Kausales
D. [OerMon]
* Kindliches D. [?] * Klares D. [?] * Klugheit [Hassenstein]
* Kollektivvorstellungen [Levy-Bruhl1926]
* Kompromissloses D. [?] *
Konditionales D. [Funke]
* Konditionierung [] * Konfabulieren [Bleuler]
* Konformistisches D. [?] * konkret-operatorisches D. [OerMon]
* Kontextualisiertes D. [Funke]
* Konvergentes D. [Hussy
2] * Konvergierendes D. [Graumann]
* Konzentriertes D. [?] * Kreatives D. [Hussy
2] * Kritisches D. [PetersR]
* Künstlerisch-schöpferisches D. [Bergius]
* Kunst des D. [Arnauld]
* Laterales D. [PetersR]
*
Lautes D. [Hussy 1,
2]
* Lautes, konversationsbasiertes D. [Funke]
* Lautes, nachträgliches D. [Funke]
* Leises D. [Funke]
* Logik,
Logisches
D. [Funke]
*
Magisches D. [Oerter;
Geiger
S.151ff] * Mathematisches D. [Oerter]
* Mechanisches D. [Bergius]
* Mehrgleisiges D. [Wertheimer]
* Meinen > D. * Mentaler Raum [Wenninger]
*
Merkmal (e/staxonomie) [Funke]
* Metaphysisches D. [Strasser]
* Metaphorisches D. [Graumann]
* Modell [> D. in Modellen] * Multidimensionales D. [PetersR]
* Multiples D. [Oerter]
* Mystisch-prälogisches D. [Lurje]
* Nachdenken > D. Naives D. [?] * Naturwissenschaftliches
D. [?] * Neuronale Netze [] * Nichtendes D. [Graumann]
*Nichtgegebenes denken [KülpeR3]
* Nichtsprachliches D. [Funke]
* Normales, gerichtetes D. [Mayer]
* Normatives D. [Feldkeller]
*
Numerisch-zahlengebundenes D. [Hussy
1] *
Ökologie d. D. [Funke]
* Operation [Dörner79]
* Operatives D. [Piaget] * Operator [Dörner79]
* Östliches D. [Funke]
* Paralogisches D. [Margraf]
* Pathologisches D. [Hussy
2] * Perseveration d. D. [Margraf]
* Personalität d. D. [Funke]
* Phantasierendes D. [Graumann]
* Phantastisches D. [?] * Philosophisches D. [Bochenski]
* Poretisches D. [Helgi]
* Prälogiches D. [Bleuler32] * Präoperatives D.
[Hallpike]
*
Pragmatisches D. [?] * Praktisches D. [?] * Praktische
Intelligenz
[PetersR]
* Primitives D. [Graumann]
* Problem(begriff) [Bergius]
* Problemlösendes D. [Graumann]
* Produktives D. [Hussy
1], [Duncker] * Prototypische Begriffe
[Rosch] * Psychoanalytisches
D. [?] * Psychologisches D. [?] * Querdenken
[Beck-Bornholdt] * Radikales D. [?] * Räumlich-relationales
D. [Funke]
* Rationales D. [BochenskiDZDM]
* Rationelles D. [?] * Realitätsorientiertes D. [Oerter]
* Rechnerisches D. [Feldmann]
* Reflexion [Hartmann]
* Reflexives D. [Stavemann,
S.106] * Relationales D. [Funke]
* Relativ richtiges D. (Geiger
S. 41) Religiöses D. [Strasser]
* Reproduktives D. [Hussy
1] * Richtig [> wahr, Wahrheit] * Richtiges D. [Bergius]
* Romantisches D. [?] * Scharfsinniges D. [?] * Schizophrenes
D. [?] * Schlußfolgerndes D. [Hussy
1] *
Schnelligkeit des D. [Hönigswald] * Selbstreflektorisches
D. [Funke]
* Schöpferisches D. [Graumann]
*
Schwarz-Weiß-D. [> dichotom] * Sinn [Bergius]
* Sinnen [?] * Sinnloses D. [?] * Sinnvolles D. [Wertheimer]
* Skeptisches D. [Strasser]
* Skurriles D. [?] * Soziologisches D. [Francis]
*
sprachliches D. [Schwemmer] * Sprachloses
D. [Funke]
* Sprachunabhängiges D. [Bergius]
* Sprunghaftes D. [Ideensprung > [Zeigarnik]
* Stereotypes D. [Hussy
1] * Struktur [Oerter]
* Subjektive Denkstörungen [Bleuler]
* Syllogistisches D. [Graumann]
* Symbolisches D. [Bergius]
*
Systemtranszendierendes D. [Oerter]
* Tagtraum [Bleuler]
* Techniken d. D. [Wertheimer]
* Theoretisches D. [BochenskiDZDM]
* Transzendentales D. [Kant] * Triebfedern zum D. [Hassenstein]
* Überlegen [?] * Überwertige Ideen [Margraf]
* Umsichtiges D. [Hassenstein]
* Umständliches D. [Margraf]
* Umstrukturierung [Bergius]
* Unabhängiges D. [?] * Unanschauliches D. [Graumann]
* Ungeordnetes D. [?] * Unklares D. [Bleuler]
*
Unpersönliches D. [Feldkeller]
* Unterscheiden [Lompscher72]
* Unzusammenhängendes D. [Bleuler]
* Urteilen [?] * Verarmtes D. [Bleuler]
* Verbal-sprachgebundenes D. [Hussy
1] * Vergleichen [Lompscher72]
* Verhältnisblödsinn [Bleuler]
*
Verknüpfen [Dörner74]
* Verlangsamtes D. [Margraf]
* Verneinung (Frege)
Versetzendes
D. [Graumann]
* Vertikales D. [Peters]
* Verwirrtes D. [Bleuler
> wirres D.] * Voraussetzungen erfolgreichen D. [Wertheimer]
* Vorbegriffliches D. [Bergius]
* Voroperatorisches D. [OerMon]
* Vorstellendes D., vorstellen [?] * Vorurteil [Bergius]
* wähnen, Wahnhaftes D. und Wahn [Margraf]
* wahr, Wahrheit [?] * Wahr-nehmen [?] * Wertendes D., werten
[Graumann] * Wesen
d. D. [Graumann]
* Westliches D. [Funke]
* Wiedererkennen [Zimbardo]
*
Wildes D. [Lévi-Strauss]
* Wirres D. [? > verwirrtes D.] * Wissen [?] * Wissenschaftliches
D. [Mayer]
* Wortloses D. [Bergius]
* Wunsch D. [Oerter]
* Zahlbegriff [Oerter]
* Zeigarnik-Effekt [Zeigarnik]
* Zeitgenössische Denkmethoden [Bochenski]
* Zerfahrenes D. [Zeigarnik]
* Zielzustand [Dörner79]
* Zukunftsdenken [Oettingen]
* Zwangsgedanken [Bleuler]
* Zweifel [Bergius]
*
Anmerkung: Die verschiedenen Denkbegriffe
werden im Laufe der Zeit und bei Gelegenheit ausführlicher dokumentiert.
{Intern: Ergänzende Materialsammlung: Absurd, Abwehr, Antinomie, Aporie, Ausdruck, Aussage, Aussagenlogik, Axiom, contradictio in adjecto, Deduktion, definitio fit per genus proximum et differentiam specificam (Begriffsbestimmung über die nächste Gattung und den Artunterschied [Kondakow] * Filter, Folgerung, Form, formal, genus proximum (nächste Gattung), Gleichheit, Identität, Induktion, Invarianzprinzip, Kausalität, Klassenlogik, Konstanz, Kopula, Logik, Modallogik, modus barbara, Objektkonstanz, Permanenzprinzip, Prädikatenlogik, Prinzip, Postulat, Reflexivität, Relation, Relationenlogik, Schlussfigur, Syllogistik, Tertium non datur, Transitivität, Umformung, Widerspruch,}
2.4
Intelligenz und Bildung.
Intelligenz und Bildung sind zweierlei. Es gibt Gebildete, sie nicht
besonders intelligent sind
und es gibt Hochintelligente, die nicht gebildet sind, weil sie keine Bildungseinrichtung
durchlaufen haben oder nicht nutzen konnten oder wollten. Nicht wenigen
wird aber auch in unseren Bildungseinrichtungen die Lust auf Lernen und
die Aneignung von Bildung gründlich verdorben.
2.5
Über die sog. Dummheit
Das Wort "Dummheit" hat seinen sachlichen Kernbezug - sofern es diesen
überhaupt schon jemals hatte - lange verloren und funktioniert im
Sprachgebrauch als Entwertung und Schimpfwort.
Vorläufige Definition: Ein Lebewesen heißt
dumm, wenn es (1) einfache Probleme seiner Bezugsgruppe nicht lösen
kann oder (2) wenn es im Verhältnis zu seiner Bezugsgruppe zu lange
Mittel und Methoden anwendet, die für eine Problemlösung nicht
geeignet sind oder (3) wenn es aus Fehlern nicht lernt.
2.6
Die Egozentrik der Intelligenten und Gebildeten
Die meisten Intelligenten oder Gebildeten gehen von ihren eigenen Begabungen,
Kenntnissen, Fähig- und Fertigkeiten aus und neigen dummerweise dazu,
Menschen, die nicht wenigstens Gleichartiges vorweisen können, geringzuschätzen.
Sie machen sich selbst zur Bezugsbasis und zum Maßstab und kommen
sich nicht selten dabei auch noch großartig vor. Kann einer X, blickt
er auf all jene herab, die X nicht oder nicht so gut können. Hat einer
Geld, wähnt er sich tüchtiger als einer, der weniger oder keines
hat.
2.7 Die
Egozentrik der eigenen Kultur
Egozentriker der westlichen Kultur dünken sich sich oft fremden,
anderen Kulturen überlegen, weil sie ihre eigenen Lebensgewohnheiten,
Denkweisen, Ideologien und Errungenschaften zur Bezugsbasis und zum Maßstab
nehmen. Das geht manchmal sogar so weit, dass man von "primitiven" Gesellschaften
spricht, die man teilweise sogar in die Steinzeit zurückversetzt.
Nachdem "primitiv" eine stark entwertende Bedeutung hat sollte man diesen
Ausdruck in wissenschaftlichen Arbeiten nicht mehr verwenden und durch
andere
oder fremde Kulturen ersetzen.
2.8
Die anthropomorphe Egozentrik:
Der Mensch, die Krone der Schöpfung oder nur die Krone der
Egozentrik?
Die schärfte Form egozentrischen Überheblichkeit zeigen viele
Menschen gegenüber der Natur, den Pflanzen und Tieren gegenüber
(nicht so z.B. Mach). So wähnen sich einige gar
als "Krone der Schöpfung" und produzieren Wahnideen dergestalt, von
Gott
auserwählt und dazu bestimmt zu sein, sich die Erde untertan zu
machen, und alles seinen menschlichen Wünschen und Bedürfnissen
unterzuordnen. Beschäftigt man sich näher mit diesen Denkweisen,
erkennt man schnell, dass der Wahn offensichtlich viel verbreiteter ist
als man denkt. psychopathologisch eindeutiger Wahn wird meist durch gesellschaftliche
Akzeptanz neutralisiert und mit anderen Worten (Religion, Ideologie, Weltanschauung,
Glauben) bezeichnet.
3 Geschichte und einige Ergebnisse der Denkforschung
Eine der wichtigsten Grundlagenfragen der Denkpsychologie ist: wie geschieht
"reines" Denken tatsächlich? Kann der Vorgang des Denkens klar abgegrenzt
werden von anderen psychischen Funktionen, z.B. Vorstellen, Phantasieren,
Wahrnehmen, Empfinden, Fühlen, Lernen, Erinnern? Und falls: wie geht
das?
Im Alltag wird denken oft mit dem, was im Bewusstsein
vor sich geht, gleichgesetzt. Aber im Bewusstsein geht vieles vor sich
und in die jeweilige aktuale Bewusstseinsgestalt gehen prinzipiell viele
psychische Funktionen mit ein. Tatsächlich scheinen immer nur ganze
Bewusstseinsgestalten
vorzuliegen, deren Analyse notwendigerweise etwas "Künstliches" anhaften
muss. Aus dieser Überlegung ergibt sich die Frage: wie können
wir aus solchen ganzen Bewusstseinsgestalten das Denken - neben anderen
"Elementen" - herausschälen? Es sind immer aktuell eine Wachheit,
eine Aufmerksamkeit, eine Befindlichkeit, eine Stimmung, Gefühle,
Assoziations- und Erinnerungsfragmente, Empfinden und Wahrnehmungen,
Bedürfnislagen, vielleicht auch Konflikte und nicht bewusste Wirkungen
im aktualen Bewusstseins des Augenblicks mehr oder minder vorhanden. In
dieser Umgebung schält sich ein Gedanke heraus, rückt - meist
sehr flüchtig, wenig greifbar und schnell - in den Mittelpunkt des
Bewusstseins, sucht oder ruft andere hervor, verbindet sich mit anderen
und so entsteht eine Gedankenkette, innerhalb derer hin- und her, aber
auch ganz woanders hin gesprungen werden kann. Das Denken geschieht hierbei
so flüchtig und wenig greifbar, dass man sogar vertreten könnte,
denken geschähe nicht bewusst, sei gar kein Bestandteil des Bewusstseins,
zumindest kein fassbarer. Die Nichtbewusstheit kann aber schon deshalb
nicht stimmen, weil Menschen sonst keine Auskunft, was und wie sie denken,
geben könnten. Man kann ja auch "laut" und "schriftlich" denken -
was man in der denkpsychologischen Forschung auch bewusst anwendet.
3.1
Fragen und Themen der Denkpsychologie (Auswahl)
3.1.01 Wie können wir erkennen, dass wir denken?
3.1.02 Wie können wir denken von andern psychischen Funktionen
(aufmerken, bedürftig sein [ein Bedürfnis haben, brauchen], empfinden,
phantasieren (fantasieren), fühlen, erinnern, konzentrieren, lenken
[Bewusstseinsinhalte], lernen, vorstellen, wahrnehmen, wollen) oder
Zuständen unterscheiden?
3.1.03 Wie hängen denken und die anderen psychischen Funktionen
zusammen?
3.1.04 Wie kann denken gelenkt (anfangen, dabeibleiben, unterbrechen,
beenden, prüfen und kontrollieren) werden?
3.1.05 Wie kommen Unterbrechungen zustande?
3.1.06 Wie kommen Wiederaufnahmen oder -anknüpfungen zustande?
3.1.07 Welche Wirkungen hat das Denken auf andere psychische
Funktionen oder Zustände?
3.1.08 Kann man denken, ohne dass es einem bewusst ist? Gibt
es nicht-bewusstes Denken?
3.1.09 Können wir im Schlaf denken?
3.1.10 Geht Denken immer mit Vorstellungen, z.B. Bildern einher?
3.1.11 Wie werden Begriffe im Gedächtnis (Gehirn) repräsentiert?
3.1.12 Wie kann man Denkprozesse sichtbar machen (> bildgebende
Verfahren)?
3.1.13 Wie kann die Bildung von Universalien
denkpsychologisch verstanden werden?
3.1.14 Wie kann man irrationales, unlogisches, falsches Denken
verstehen?
3.2
Geschichte und Ergebnisse der Denkforschung und ihres Umfeldes (Auswahl)
mit anderen Ereignissen, die für eine wissenschaftliche Psychologie
von Bedeutung waren
3.2.1 Anfänge und Grundlagen: Experimentelle Psychologie, Ethnologische Forschungen und Piagets Entwicklungspsychologie des Denkens. Das aus dem Alltagsleben und von den Wissenschaften vorliegende Material, das Alltagsleben und die Wissenschaften zur Verfügung stellen, ist unerschöpflich und insgesamt für einen einzelnen nicht mehr im Detail sicht- und bewältigbar. Denken als Problemkategorie der Geistesgeschichte wurde in Eislers Wörterbuch der philosophischen Begriffe ausführlich dargestellt. Große Bedeutung und eine angemessene Bearbeitung im engeren psychologischen Sinne - d.h. untersuchen der Frage: wie denken Menschen? - nahm das Denken mit der Entwicklung der wissenschaftlichen Psychologie, die gewöhnlich um die Zeit als Wilhelm Wundt sein Labor 1879 in Leipzig aufbaute, angesiedelt wird, wobei vielleicht schon mit den ersten Empfindungsmessungen von Tetens um 1770 und 1783 mit dem Magazin für Erfahrungsseelenkunde von Moritz der Weg bereitet wurde. Wichtige Stichworte für eine wissenschaftliche Psychologie und Denkpsychologie sind z.B.: Beobachtung, Dokumentation, Experiment, Operationalisierung, Messung, Tests, Kontrolle, Evaluation. Die erste psychologische Theorie des Denkens begann mit der Assoziationspsychologie (H. Ebbinghaus, G. E. Müller). Der überragende Kopf zur Analyse der psychischen Elemente war Wundt und seine Schule. Großen Einfluss hatte auch die Würzburger Schule der Denkpsychologie. Als wichtige Gegenbewegung zur Elementenpsychologie entwickelte sich die Gestaltpsychologie. Mit den Anfängen der Denkpsychologie ging auch einige große Werke der Ethnographie, Völkerkunde oder Kulturanthropologie einher (Frazer, Levy-Bruhl) und Jean Piagt begann sein großes entwicklungspsychologisches Werk.
3.2.2
Testentwicklungsphase und der Irrweg
der Faktorenanalyse.
Das grosse Plus der Testentwicklungsphase war und ist, dass man das
abstrakte Konstrukt Intelligenz oder Denkfähigkeit, in konkrete, prüf-
und kontrollierbare Aufgaben gebracht hat: man sagt auch operationalisiert.
Mit der Entwicklung der Intelligenzdiagnostik hat sich aber auch die relativierende
Meinung verbreitet: Intelligenz sei das, was ein Intelligenztest "messe".
Das ist zwar eingeschränkt richtig, besser wäre allerdings zu
sagen: Spezifische Intelligenz ist das, was ein spezifischer Intelligenztest
misst. Fasst man Intelligenz als die Fähigkeit auf, Probleme zu lösen
und Aufgaben zu bewältigen, so gibt es theoretisch so viele unterschiedliche
Intelligenztests, wie es unterschiedliche Probleme und Aufgaben gibt. So
gesehen ist es ganz natürlich und normal, dass Intelligenztests, die
praktisch und notwendigerweise auf spezifische Probleme und Aufgaben beschränkt
oder zugeschnitten sind, auch nur für spezifische Ziele und Zwecke
geeignet sind.
Ungeachtet dessen hat sich in der Frühzeit
der Intelligenzdiagnostik, vor allem durch die Faktorenanalyse, besonders
durch Charles Spearman, die Idee eine allgemeinen Intelligenzfaktors, auch
Generalfaktor
"g" genannt, herausgebildet; eine These die ich jüngst bei einigen
Faktorenanalysen von Intelligenztests bestätigen konnte. Die Generalfaktortheorie
postuliert einen allgemeinen Generalfaktor und eine Reihe spezifischer
Intelligenzfaktoren. Demgegenüber entwickelte - vor allem - Thurstone
seine multiple Faktorenanalyse der Intelligenz. Hier werden z.T. völlig
unnötige abstrakt-allgemeine Debatten geführt, weil man nicht
klar und deutlich operational angibt, welche Problemlösefähigkeiten
man zu analysieren wünscht.
Die meisten Intelligenztests waren an den Zielen
und Zwecken der Schul- und Ausbildung ausgerichtet. Hier ging und geht
es in erster Linie um Auswahl und Prognose.
3.2.3
Neuorientierung zu realistischeren, komplexeren, nicht-linearen Aufgaben.
Die Aufgaben traditioneller Intelligenztests hatten oft wenig mit dem
Leben und seinen vielfältig vernetzten und komplexen Problemen zu
tun. Unerwarteter Weise schienen Intelligenz und Schulerfolg nicht mit
Lebenserfolg, Lebenstüchtigkeit und Lebenszufriedenheit zu korrelieren.
Die Unzulänglichkeit traditioneller Intelligenztests rief im letzten
Drittel des vorigen Jahrhundert einige Kritiker auf den Plan. Als wichtigster
und typischer Repräsentant kann Dietrich Dörner et al. mit dem
berühmten Werk "Lohausen" angesehen werden. Aufgaben des Typs "Lohausen"
trugen nicht-linearen, komplexen und vielfältig vernetzten Beziehungen
der für ein Gebiet bedeutsamen Variablen Rechnung.
3.2.4
Künstliche Intelligenz, Neuronale Netze und Fuzzy.
Mit dem Aufkommen der Informationstheorie, Kybernetik, Informatik und
den Computerwissenschaften entwickelte sich das Fachgebiet der künstlichen
Intelligenz, aus der sich das in einer Art zweiten Welle die Kognitionswissenschaften
entwickelten. Man hat sich von der künstlichen Intelligenz sehr viel
versprochen und in der Anfangseuphorie die wesentlichen, vermutlich nur
schwer lösbaren Probleme, die sich mit ihr verbinden, nicht erkannt.
Denken und Problemlösen verläuft nicht logisch, fehlerfrei, konsequent,
stringent. Sondern Denken ist mit Unschärfen und Unklarheiten, Umwegen
und Holzwegen, Fehlern und Irrtümern, Sprüngen, Irrationalitäten
und Phantasien verbunden. Wie soll das programmiert werden? Künstliche
Intelligenz strebt die richtige und ökonomische Lösung von Problemen
an, aber das bildet unser menschliches Denken nicht ab. Wie denken wirklich
psychologisch vor sich geht, kann man wahrscheinlich nur über Versuche,
wie sie in der experimentellen denkpsychologischen Forschung erdacht und
durchgeführt wurden, herausfinden. Die künstliche Intelligenz
kann helfen, richtige und ökonomische Wege zu finden, zu evaluieren
und zu übertragen, aber sie ist immer noch weit davon entfernt, das
menschliche Denken, wie es wirklich vor sich geht, zu repräsentieren.
3.2.5 Kognitionswissenschaften.
Die Kognitionswissenschaften erweiterten das Intelligenzkonzept und
entwickelten allgemeinere und realistischere Modelle über das "bloße"
Denken und die Intelligenz hinaus, die Gedächtnis und Erfahrung, Aufmerksamkeit
und Wahrnehmung, Lernen und Prüfen (evaluieren), nicht bewusste Prozesse,
Intuition, Entscheidung, Planung, Ziele, Werte, Affekte (Wünsche,
Bedürfnisse, Gefühle, Befinden), also immer mehr den "ganzen"
Menschen, das "ganze" Gehirn einbezogen, obwohl die affektive Seite oft
nicht ausdrücklich mit einbezogen wurde oder sehr kurz kam. Im engeren
Sinne beschäftigte sich die Kognitionswissenschaft daher hauptsächlich
mit Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Bewusstsein, Denken, Gedächtnis,
Lernen, Wissen, Planen, Entscheiden. Die Einbeziehung des affektiven Bereiches
(Antrieb, Befinden, Gefühle Stimmung, Bedürfnisse, Motivation,
Wille), der natürlich mit dem kognitiven Bereich in enger Wechselwirkung
steht, spielte keine oder eine untergeordnete Rolle. Noch fehlen auch oft
integrative Konzepte zum Gesamt-Lenkungs-System sowie die Verbindung zum
Handeln und Verhalten in einer Umgebung.
3.2.6 Neurobiologische
Variante.
Nachdem man Hirnprozesse immer detaillierter "abbilden" konnte - genau
genommen natürlich nur besondere Operationalisierungen - , teilweise
sogar in den Millisekundenbereich hinein, hatte man nun endlich Möglichkeiten
gefunden, den physiologischen und biologischen Grundlagen der Bewusstseins-,
Erlebens- und Verhaltensprozesse "objektiv" im wahrsten Sinne des Wortes
auf den Leib zu rücken. Im Zuge der neuen und genutzten Möglichkeiten
stellte man fest, dass viele Prozesse nicht bewusst ablaufen und manches,
was im Bewusstsein als bewusste Entscheidung erlebt wurde, schon deutlich
vorher seine Spuren im Gehirn hinterließ (Libet-Experimente).
Durch die bildgebenden
Verfahren wurde ein weiterer Entwicklungsschub angeregt. Funke fasst
1996 [O]
zusammen: "Im Bereich der kognitiven Neurowissenschaften haben in den letzten
Jahren technische Fortschritte zu einem enormen Aufschwung sogenannter
bildgebender Verfahren geführt. Diese Verfahren lassen anatomische
und funktionale Aspekte des gesunden wie kranken Gehirns in einer nie geahnten
Deutlichkeit sichtbar werden. Neben der inzwischen schon fast klassischen
Computertomographie (CT) mit Röntgen-Strahlen (statische Darstellung
der Gewebestrukturen) sind inzwischen auch Positronen-Emissions-Tomographie
(PET; dynamische Durchblutungsmessung anhand der Konzentration rasch zerfallender
Radioisotope, die vor Aufgabenbearbeitung injiziert werden müssen),
Kernspin-Tomographie (NMR, nuclear magnetic resonance; umgetauft in MRI,
magnetic resonance imaging; fast risikolose Messung des Sauerstoffverbrauchs
durch Änderung der Kernspinresonanz in einem Hochfrequenz-Magnetfeld)
und Mehrkanal-Magnetenzephalographie (MET; Erfassung der von der Hirnaktivität
resultierenden magnetischen Felder) zu zwar äußerst kostspieligen,
aber dafür auch hochinformativen Zugängen zu Gehirnprozessen
geworden. Bei der Kartierung von kognitiven Funktionen mittels PET wird
z.B. analog zum Donder'schen Subtraktionsverfahren vorgegangen: Die mittels
PET meßbare Hirndurchblutung wird vor und während einer ganz
spezifischen kognitiven Aktivität erfaßt, aus der Differenz
ergeben sich die besonders aktiven Hirnareale für die spezifische
Aktivität." Ausführlich werden die bildgebenden Verfahren und
ihre Bedeutung für die Neuropsychologie von Herholz & Heindel
(1996, 635-723) beschrieben.
Meilensteine
in der Entwicklung (Neurowissenschaft Schweiz SS 2006: Einführung
Bildgebung):
1895 Röntgen. 1900ff Elektronenröhrenentwicklung.
1917
Radon-Transformation.
1937 Rabi: Kernresonanzspektroskopie oder
NMR (nuklearmagnetische Resonanz). [PDF].
1946
NMR Bloch und Purcell (Nobelpreis 1952). ... 1970 chemische Analyse,
Spektroskopie, Strukturanalysen. 1971 Entdeckung der Gewebesensitivität
von NMR-Messungen durch Damian. 1972 G.N. Hounsfield und J. Ambrose
führen erste klinische Untersuchungen mit Computertomographie durch.
1973
Aufnahme des ersten MR-Bildes durch Lauterbur. 1975 Einführung
der Fourierbildgebung durch Ernst (Nobelpreis 1991). Seit 1984 Nutzung
des MRI in der klinischen Praxis.
1990 Entdeckung des BOLD-Effektes
durch Ogawa. Siehe auch [W]
Aus radiologischer Sicht kommt Reisner
(1996, S. 176) zu folgender Einteilung:
- "1. Entwicklungszeit der Summationsaufnahmetechnik einschließlich
Spezialprojektionen (1897-1930);
2. die Entwicklungsphase der Schnittbildtechnik, beginnend mit der konventionellen Tomographie (1921-1970);
3. die Entwicklungsphase der Computertomographie (ab 1972) und der Kernspintomographie (ab 1979)."
3.2.7 Ausblick
Die Entwicklung ist so breit, vielfältig und tief, dass es schwierig, ja inzwischen wahrscheinlich unmöglich ist, den Überblick zu behalten. Komplexe- und nichtlineare Modelle, Informatik, Computer- und Neurowissenschaften haben neben den Fortschritten in der Neurobiologie die Psychologie des Denkens einerseits "revolutioniert". Andererseits sind viele Grundfragen noch offen. Das Denken ist - direkt betrachtet - zu schnell, kaum greifbar, oft flüchtig und vielfach im Detail gar nicht nicht bewusst. Trotz aller Schwierigkeiten, das Denken empirisch wissenschaftlich und psychologisch im Detail zu erfassen, ist nicht zu vergessen, dass die Ergebnisse des Denkens in Wissenschaft, Technik und Alltag doch gewaltig und in den Resultaten auch greif- und kontrollierbar sind, auch wenn das Mikrogeschehen des Denkens noch vielfach einer Blackbox gleicht, die diese Arbeit etwas aufzuhellen versucht.
3.3
Zeittafel zur Denkpsychologie (Auswahl) und ihres Umfeldes
> Zeittafel
zum Grundlagenstreit in der Mathematik. > Literatur
Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben (Verteilerseite). > Assoziationsversuche.
> Lit.
| ~340
_ |
Aristoteles formuliert grundlegende Regeln für Denken und Logik; auch für die Assoziationen stellt er bereits "Gesetze" (Regelhaftigkeiten) auf: Ähnlichkeit, Gegensatz und der Benachbarung von Raum und Zeit. |
| Mittel-
alter (Scho- lastik) _ _ _ _ _ _ _ |
Universalienstreit:
in welcher Weise existieren die realen Entsprechungen der Allgemeinbegriffe?
"In der Einleitung des Porphyrius (§ 49) zu Aristoteles' logischen Schriften wird die Frage aufgeworfen, ob die Gattungsbegriffe (genera und species, zusammengefaßt unter dem Namen universalia), z.B. Eiche, Rind, wirklich d.h. dinglich oder nur in unseren Gedanken vorhanden, ob sie körperlich oder unkörperlich seien, ob sie gesondert von den Sinnendingen oder nur in und an denselben existieren. An diese, dem Mittelalter nur in der lateinischen Übersetzung des Boethius vorliegende, Stelle knüpfte sich der fast das ganze Mittelalter durchziehende sogenannte Universalienstreit. Die einen (die Realisten) behaupten, indem sie sich dabei auf Plato (von dem freilich damals nur ein Teil des Timäus bekannt war!) beriefen, daß die Gattungsbegriffe das Ursprüngliche und Wirkliche, sowohl der Zeit wie dem Range nach, also die wahrhaften Dinge (res) seien, welche das Besondere aus sich erzeugten (universalia ante rem). Demgegenüber behauptete die andere Partei, die Nominalisten, daß die allgemeinen Begriffe bloße Worte (nomina, voces) oder Abstraktionen (intellectus) des Verstandes seien, während in Wirklichkeit nur die Einzeldinge existierten (universalia post rem). Zwischen beide schob sich später eine vermittelnde, auf Aristoteles sich berufende Ansicht (sog. gemäßigter Realismus), wonach die Universalien zwar real existierten, aber nur in oder an den Einzeldingen (universalia in re)." (Vorländer Geschichte der Philosophie Bd. 1, S. 243). Prophyrios (232/33 Tyron - 504 Rom), gr. Philosoph. |
| 1662 | Die Logik oder die Kunst des Denkens ("Port Royal" [Arnauld & Nicole]) |
| 1690 | Locke: Assoziationen kommen durch Zufall oder Gewohnheit zustande. |
| 1748 | Hume: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. |
| 1770 | Tetens mißt um 1770 die Dauer von Nachempfindungen |
| 1783 | Die "Erfahrungsseelenkunde" entwickelt sich und findet einen Ausdruck in Moritz' gleichnamigem Magazin. |
| 1826 | Erste Fotografie durch Joseph Nicéphore Nièpce, 1837 durch Daguerre verbessert. |
| 1843/46 | J. S. Mill: Induktive Logik (dt. 1849). |
| 1847
_ 1874_ _ |
Boole, George: The mathematical analysis of logic: being an essay towards
a calculus of deductive reasoning. London-Cambridge: Cambridge: Macmillan,
Barclay, & Macmillan. [PDF]
[W]
Brentano: Psychologie vom empirischen Standpunkt [RS: gespickt mit vielen typischen Vorurteilen der Nur-Denker-Zunft ohne jede Empirie, Experiment, Beobachtung, Protokoll oder dialogischer Exploration] |
| 1879
_ _ |
Psychologisches Labor durch Wilhelm Wundt in Leipzig eingerichtet (gilt teilweise als Geburtsjahr der unabhängigen wissenschaftlichen Psychologie, die im Laufe ihrer Geschichte fast immer von anderen Fachrichtungen - Theologie, Philosophie, Medizin und jüngst der Neurowissenschaft - bemächtigt wurde. |
| 1882 | Stanley Hall gründet das erste amerikanische psychologische Labor an der Johns Hopkins University. |
| 1883 | Galton führt die Statistik mit Tests und Fragebogen in die Psychologie ein. |
| 1885 | Ebbinghaus (Über das Gedächtnis ): Messmethoden der Gedächtnisleistungen. |
| 1887
_ |
Helmholtz, Hermann von (1887). Zählen und Messen erkenntnistheoretisch betrachtet. In: Philosophische Aufsätze. Leipzig: Fues. |
| 1889 | Erster internationaler Psychologenkongreß in Paris. |
| 1888
_ |
Rieger, C. (1888). Beschreibung der Intelligenzstörungen in Folge einer Hirnverletzung: nebst einem Entwurf zu einer allgemeinen anwendbaren Methode der Intelligenzprüfung. Würzburg: Stahel. |
| 1892
_ |
Int. Kongreß für Experim. Psychologie, London [Janet berichtet u.a. über Amnesie und unbewußte fixe Ideen] - sechs Monate vor Freud [11.1.1893] |
| 1893
_ |
Külpe: Grundriss der Psychologie: Hier spielt Denken noch keine Rolle, hat kein eigenes Kapitel oder Abschnitt und wird im Sachregister auch nur vier mal erwähnt [455, 459, 464, 468]. |
| 1895
_ _ _ |
Le Bon: (fr 1895, dt. 1973). Psychologie der Massen. Stuttgart: Kröner.
Cantor: Unter einer ‚Menge‘ verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten m unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die ‚Elemente‘ von M genannt werden) zu einem Ganzen. Röntgen: Röntgenstrahlen (eine Grundlage eines bildgebenden Verfahrens). |
| 1896 | Külpe gründet das Labor der Würzburger Schule. |
| 1897
_ |
Ebbinghaus, H. (1897). Über eine neue Methode zur Prüfung geistiger Fähigkeiten und ihre Anwendung bei Schulkindern. Zeitschrift für Psychologie, 13, 401-459. |
| 1900
_ |
Binet: La Suggestibilité. Paris: Schleicher, Cotes suc.
ff: Elektronenröhrenentwicklung |
| 1901
_ _ _ _ |
Külpes Würzburger
Schule beginnt ihre Arbeit.
Marbe: Anschauungsloses Denken. Probanden können nicht angeben wie ihr Urteil schwerer oder leichter beim Vergleichen von Gewichten zustandekommt, wodurch widerlegt wurde, dass Urteilen ein voll bewusster Vorgang sei und sich von anderen Satzerlebnissen unterscheide. Gründung der Biometrika. |
| 1902
_ |
„Die fehlerlose Erinnerung ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme." William Stern 1902 in der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, S. 327 |
| 1903 | Binet: Etude Expérimentale de l'Intelligence. |
| 1904
__ |
Spearman:
Factor analysis (Geschichte)
*
Gründung der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (100 Jahre 2004 PDF) |
| 1905 | Ach: Über die Willenstätigkeit und das Denken |
| 1907
_ _ _ |
Bühler: Aha-Erlebnis. Erfindung der "systematisch experimentellen
Introspektion"; Unterbrechungsmethode der systematischen Introspektion;
Kriterium der Wiederholbarkeit introspektiver Versuche [noch überprüfen]
Wells: "Halo-Effekt" (> Thorndike 1920) |
| 1908
1909 |
Bühler: Denken kann gegenstandslos ohne Bilder erfolgen
6. Internationaler Psychologenkongreß in Genf. |
| 1910
_ _ |
Lévy-Bruhl: Fonctions mentales dans les sociétés
inférieures; dt. 2. A. 1926: Das Denken der Naturvölker.
Whitehead & Russell: Zirkularitätsprinzip (Imprädikativität) als Quelle der Antinomien. |
| 1911
_ |
Bleuler: autistisches Denken als phantastisch-traumhaftes, frei-assoziatives und affektiv-impulsives Denken und Sprechen. Absicht: irrationales Denken |
| 1912
1913 |
Külpe: 1. Band Die Realisation
Selz postuliert Problemlösen als den wesentlichen Denkvorgang. (> 1924) [nach Koch in Bergius S. 70] |
| 1915
_ |
Pick: Beitrag zur Pathologie des Denkverlaufs beim Korsakow.
Baade: Über Vergegenwärtigung v. psychischen Ereignissen durch Erleben, Einfühlung z. Repräsentation ... |
| 1916
_ _ _ |
Lindworsky: Das schlussfolgernde Denken
Journal of Experimental Psychology, Zeitschrift für angewandte Psychologie. Karl Marbe: Die Gleichförmigkeit in der Welt. Richard Baerwald: Zur Psychologie der Vorstellungstypen. Leipzig: Barth (2. Aufl. 1928). |
| 1917
_ _ _ _ |
Köhler: Intelligenzprüfungen an Menschen. Weist in Teneriffa
nach, dass Affen zum Problemlösen Werkzeuge einsetzen.
Radon-Transformation (Umkehrung später wichtig geworden für die Computertomographie) Edouard Claparède beschreibt erstmals in La psychologie de I'inteligence, Scienta, Nov. 1917, S. 335, die Methode des lauten Denkens (1935 Duncker) |
| 1920
_ _ |
Külpe (posthum von Messer besorgt): 2. Band:
Die Realisation
Thorndike: A constant error of psychological ratings [Wells Halo-Effekt >1907] Stern, W.: Die Intelligenz der Kinder und Jugendlichen. Leipzig: Barth 1920. |
| 1921 | Ach Über die Begriffsbildung. Die 343 Seiten Monographie erkennt die wesentlichen Merkmale (Name oder Wiedererkennung, Begriffsinhalt, Referenz) eines Begriffs nicht. Seine Idee, Begriffsbildungen an Neubildungen (Gazun, taro, Ras und fal) zu untersuchen ist indessen sehr gut. |
| 1922 | Selz: Zur Psychologie des produktiven Denkens und des Irrtums. |
| 1923
_ _ _ |
Külpe (posthum von Messer besorgt): 3. Band: Die Realisation
Piaget: Das symbolische Denken und das Denken des Kindes * Sprechen und Denken des Kindes. Spearman: Nature of Intelligence and Principles of Cognition. |
| 1924
_ _ |
Piaget: Urteil und Denkprozess des Kindes. * Das symbolische
Denken
Selz sieht im Abstraktionsprozeß die wesentliche Denkleistung (> 1913) [nach Koch in Bergius S. 70] Selz: Die Gesetze der produktiven und reproduktiven Geistestätigkeit, Bonn: Cohen. |
| 1926
_ _ |
Piaget: La représentation du monde chez l'enfant. Dt.
1978: Das Weltbild des Kindes.
Lévy-Bruhl: La Mentalité primitive, dt. 1927 Die geistige Welt der Primitiven. Willwoll, A.: Begriffsbildung. Leipzig: Hirzel 1926 |
| 1927
_ _ |
Bühler, K.: Die Krise der Psychologie: "Zum Ausgangsgegenstand
der Psychologie gehören also die Erlebnisse, das sinnvolle
Benehmen
[Verhalten] der Lebewesen und ihre Korrelationen mit den
Gebilden
des objektiven Geistes [auch Leistungen, Werke genannt]."
Koffka: Bemerkungen zur Denkpsychologie (RS: Kontroverse Selz, Bühler; Zurückweisung Plagiatvorwurf) |
| 1928
_ _ _ _ _ _ _ _ |
Carnaps Der logische Aufbau der Welt
beruht auf psychischen Elementarerlebnissen und einer einzigen Relation,
der "Ähnlichkeitserinnerung"
(§ 78).
Popper: Zur Methodenfrage der Denkpsychologie (Dissertation). Er kommt zu folgendem Ergebnis: "5. Abschluß. Ich habe versucht, für die Denkpsychologie die Unentbehrlichkeit der Methoden der drei im engeren Sinn 'psychologischen' Aspekte, des 'Benehmensaspektes', des Aspektes der 'objektiven geistigen Gebilde' und des 'Erlebnisaspektes' nachzuweisen. Ich hoffe, daß es mir darüber hinaus gelungen ist, zu zeigen, daß einige markante Probleme der Theorie der Denkvorgänge, aber auch der genetischen Theorie des Intellekts nur aus einem Zusammenwirken der drei Aspekte heraus methodisch voll erfaßbar sind. Auch in der Denkpsychologie wird sich wohl die innere Einheit der Psychologie bewähren: Ich glaube, daß die gemeinsame Orientierung deutlich den Einfluß biologischer Überlegungen erkennen lassen wird [FN1]." (S. 254f) |
| 1929 | Manifest Wissenschaftliche Weltauffassung - Der Wiener Kreis. |
| 1931
_ _ |
Piaget: Children's philosophies. * La logique de l'enfant.
Selz: Der schöpferische Mensch. [SQ] Gödel: Unvollständigkeitssatz, der allgemein besagt, dass man nicht innerhalb eines Systems mit den Mitteln dieses Systems die Widerspruchsfreiheit der Aussagen dieses Systems beweisen kann. |
| 1932
_ _ |
Heiß: Über isolierende Abstraktion.
Piaget: Le jugement moral chez l'enfant. Deutsch 1954: Das moralische Urteil beim Kinde. * Das Umdrehen des Gegenstandes beim Kind unter einem Jahr. In: Psychologische Rundschau, 4: 110-115. |
| 1933
_ _ _ |
Piaget: Psychologie de l'enfant et enseignement de l'histoire. Rapport
présenté à la Conférence de La Haye. In: Bulletin
trimestriel de la Conférence internationale pour l'enseignement
de l'histoire, 2: 8-13. Deutsch 1999: Psychologie des Kindes und Geschichtsunterricht.
In: Über Pädagogik. Weinheim: Beltz: 118-127.
Otto Neurath: Einheitswissenschaft und Psychologie. |
| 1934
_ |
Carnaps Logische Syntax der Sprache als Basis für eine
allgemeine Wissenschaftssprache.
Popper: Die Logik der Forschung. |
| 1935
_ _ _ _ |
Duncker: Lautes Denken als Forschungsmethode. Zur Psychologie
des produktiven Denkens.
Thurstone: Vectors of mind. * Gründung der Psychometrika in Chicago. (> 1917 Edouard Claparède) Piaget: La naissance de l'intelligence chez le petit enfant. In: Revue de pédagogie, 2: 56-64. * Les théories de l'imitation. Brunswig: Experimentelle Psychologie in Demonstrationen. |
| 1937
_ _ _ __ |
Piaget: La construction du réel chez l'enfant. Deutsch
1969: Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde.
Turing, Halteproblem: On computable numbers, with an application to the "Entscheidungsproblem". Egon Brunswig: Die Eingliederung der Psychologie in die exakten Wissenschaften. Vortrag auf der Enzyklopädiekonferenz zur Einheitswissenschaft in Paris. Isidor I. Rabi: Kernresonanzspektroskopie oder NMR (nuklearmagnetische Resonanz). [PDF] |
| 1938
_ |
Piaget: La réversibilité des opérations et l'importance de la notion de 'groupe' pour la psychologie de la pensée. |
| 1941
_ __ |
Piaget & Inhelder: Le devéloppement des quantités
physiques chez l'enfant: conservation et atomisme. Deutsch 1969: Die Entwicklung
der physikalischen Mengenbegriffe beim Kinde. Erhaltung und Atomismus.
Zuse entwickelt die erste einsatzfähige, programmgesteuerte Rechenanlage, den Z3 |
| 1943 | McCulloch & W. Pitts: A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity |
| 1944 | von Neumann & Morgenstern: Spieltheorie |
| 1946 | Bildgebende Verfahren: NMR [Bloch und Purcell (Nobelpreis 1952)] s.a.> 1937 [PDF] |
| 1947
_ |
Pitts & McCulloch: How we know universals?
Norbert Wiener erfindet den Ausdruck Kybernetik. |
| 1948 | Shannon: Informationstheorie. |
| 1949
_ |
Hebb'sche Lernregel: The organization of Behaviour
Shannon: Programmieren eines Digital-Rechners zum Schachspiel |
| 1950
_ |
Lashley: In search of the engram.
Turing: Computing machinery and intelligence |
| 1953 | "Thinking". Wenig überzeugende Kritik Ryles an der Denkpsychologie (schon 1949 in The Concept of Mind im 10 Kapitel formuliert) |
| 1955
_ |
"McCarthy prägte den Begriff „artificial intelligence“ („künstliche Intelligenz“) 1955 in dem Förderantrag an die Rockefeller Foundation als Thema dieser Dartmouth Conference." [W] |
| 1956
_ _ _ |
Die Dartmouth Conference im Sommer 1956 war die erste Konferenz, die
sich dem Thema künstliche Intelligenz widmete, organisiert von McCarthy,
Minsky, Rochester und Shannon. [W]
Bruner et al.: Prozeßorientierter Begriffsbildungsansatz Cherry: Kommunikationsforschung (2. dt. A. 1967). |
| 1958
_ |
Mark I Perceptron (erster Neurocomputer von Rosenblatt & Wightman
et al.)
LISP am Massachusetts Institute of Technology (MIT) spezifiziert [W] |
| 1959 | Rosenblatt: Principles of Neurodynamics. |
| 1960 | Adaline: adaptives Lernsystem von Widrow & Hoff. |
| 1961
_ |
Newell, A. A. & Simon, H. A.: GPS, A Program that Simulates Human
Thought.
Steinbuch: Die Lernmatrix (techn. Realisierung des Pawlow'schen Reflexes) |
| 1963 | Feigenbaum & Feldman: Computers and Thought. |
| 1964 | Bergius (Hrsg.): Lernen und Denken, 2. HBdP, Allgem. I: Aufbau des Erkennens. |
| 1965
_ |
Nilsson: Learning Maschines.
Robinson, J. A.: A machine-oriented logic based on the resolution principle. Journal of the ACM 12:23–44. |
| 1966 | Laing et al: Interpersonelle Wahrnehmung (dt. 1971, 3.A. 1976) |
| 1967 | Popper formuliert in einem Vortrag in Amsterdam seine drei Welten Theorie, insbesondere Welt3. |
| 1968
_ |
Popper: Vortrag in Wien: Theorie des objektiven Geistes [Welt3]
Zadeh, L. A.: „Fuzzy Algorithms“. Information and Control. 12, 94–102 |
| 1969
_ _ _ |
Arnheim: Visual Thinking, dt. 1972: Anschauliches Denken.
Minsky & Papert zeigten die Beschränktheit des Perzeptrons und zogen den falschen Schluss, dass auch mächtigere neuronale Systeme dieser Beschränktheit unterlägen (warf die Entwicklung zurück). Popper, K. R., 1969: Die Logik der Forschung. Tübingen: Mohr |
| ...1970 | Bildgebende Verfahren: chemische Analyse, Spektroskopie, Strukturanalysen |
| 1971
_ _ |
Klix: Information und Verhalten.
Oerter: Psychologie des Denkens. Bildgebende Verfahren: Entdeckung der Gewebesensitivität von NMR-Messungen durch Damian. |
| 1972
_ _ |
Kohonen: Correlation matrix memories (Modell linearer Assoziativspeicher).
Die Groupe d'Intelligence Artificielle de Luminy mit Colmerauer implementiert Prolog. [W] Popper: Objektive Erkenntnis (dt. 1973). G.N. Hounsfield und J. Ambrose führen erste klinische Untersuchungen mit Computertomographie durch |
| 1973
_ _ _ _ |
Lüer, Gerd: Gesetzmäßige Denkabläufe beim Problemlösen.
v.d. Malsburg: Self-organization of orientiation sensitive cells in the striata cortex. Rosch: Prototypischer Denkforschungsansatz Bildgebende Verfahren: 1973 Aufnahme des ersten MR-Bildes durch Lauterbur. Arbeiten von Hounsfield und Ambrose zur Computer-Tomographie. |
| 1974
_ _ |
Dörner: Die kognitive Organisation beim Problemlösen. Glaubt,
den Problemlösungsprozess auf vier neurophysiologienahe Grundbegriffe
- aktivieren, inhibieren, verknüpfen und entknüpfen
- zurückführen zu können.
Werbos: Backpropagation. |
| 1975
_ _ _ |
Bildgebende Verfahren: Einführung der Fourierbildgebung durch
Ernst (Nobelpreis 1991)
Lompscher (Hrsg.): Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Entwicklung geistiger Fähigkeiten, S. 34f zählen einige für wichtig befundene "analytisch-synthetischen Operationen" auf: 1. Beziehung zwischen Teil und Ganzem. 2. Beziehung Ding und Eigenschaft. 3. Unterscheiden, differenzieren, generalisieren, vergleichen. 4. Ordnen. 5. Wesentliches und Unwesentliches für ein Ziel erkennen. 6. Gemeinsamkeiten und Verallgemeinern. 7. Klassifizieren, Klassenbeziehungen. 8. Konkretisieren (anwenden). |
| 1976
_ _ _ |
Dörner: Problemlösen als Informationsverarbeitung. Auf die
erst 1974 aufgestellten vier Grundbegriffe wird nicht weiter aufgebaut,
obwohl auf S. 105 erklärt wird, dass diese vier Grundbegriffe "für
die Realisierung eines komplizierten Denkprozesses hinreichen."
Neisser: Cognition and reality. |
| 1977
_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
Popper & Eccles: Das Ich und sein Gehirn (dt. 1982), u.a. drei
Welten Theorie.
Damadian: Bau Prototyp Magnetresonanztomographen: MRI – Magnetic Resonance Imaging Mayer: Denken und Problemlösen (dt. 1979, S. 9f) fasst den Stand für seine Zeit zusammen: "Das 1. Kapitel (Assoziationstheorie) untersucht die Annahme, Denken basiere auf dem Prinzip des Lernens durch Verstärkung; es wird berichtet über klassische behavioristische Arbeiten, etwa von Thorndikes Problemkäfigen, sowie über neuere Forschungen, etwa zum Lösen von Anagrammaufgaben und zu den physiologischen Korrelaten des Denkens. Das 2. Kapitel (Regellernen) untersucht die Annahme, Denken erfordere das Aufstellen und Testen von Hypothesen; beschrieben werden die grundlegenden Forschungsergebnisse von Hüll und Heidbreder zum Konzepterwerb sowie die neuesten Arbeiten und mathematische Modelle hierzu, Experimente mit Reihenfortsetzen und wie Versuchspersonen bei Lernexperimenten die Struktur einer Regel analysieren. Das 3. Kapitel (Gestalttheorie) untersucht die Annahme, Denken beinhalte das „Umstrukturieren" der Elemente eines Problems; es werden die berühmten Experimente zur Rolle von Einsicht und Einstellung beim Problemlösen sowie neuere Analysen der Stadien des Problemlösens behandelt. Das 4. Kapitel (Bedeutungstheorie) untersucht eine Weiterentwicklung der Gestalttheorie, nach welcher Denken neue Probleme mit bereits vertrauten Vorstellungen oder Erfahrungen in Zusammenhang bringt; hierzu gehören die klassischen Studien zum sinnvollen Mathematiklernen, zum Lösen mathematischer Aufgaben sowie neuere Arbeiten über „produktives" Denken fördernde Unterrichtsmethoden. Das 5. Kapitel („semantisches Gedächtnis") untersucht, wie Menschen verbal dargebotene Aufgaben angehen; zu den hier behandelten Themen gehören die vielversprechenden Entwicklungen seit Chomskys bahnbrechendem Werk, Studien über sinnvolles verbales Lernen und neuere Arbeiten über semantische Modelle und Gedächtnisrepräsentation. Das 6. Kapitel (Computersimulation) stellt den auf Informationsverarbeitungsmethoden basierenden Ansatz dar sowie noch andauernde Untersuchungen der Computersimulation menschlichen Denkens. Das 7. Kapitel (Deduktives Denken) untersucht, wie der Informationsverarbeitungsansatz auch auf deduktives und syllogistisches Denken angewandt werden kann; es werden auch klassische Arbeiten über Deduktion sowie gegenwärtige Modelle des Schlußfolgerns, Folgerns aus Textinformationen und der Gedächtnisrepräsentation von Lehrsätzen beschrieben. Das 8. Kapitel (Kognitive Entwicklung) behandelt die zur Zeit populären, auf Piagets Werk basierenden Theorien kognitiver Entwicklung; es wird berichtet über relevante Forschungsergebnisse zur Entwicklung von Zahlenverständnis, Gedächtnisrepräsentationen und Erwachsenenlogik." |
| 1978
_
|
Sydow: Experimentalpsychologische Untersuchung von Denkprozessen:
"Zusammenfassung. Es werden einige Entwicklungsrichtungen in der Denkpsychologie dargestellt und diskutiert. Neue Vorstellungen über Phasen der Denktätigkeit und über Strukturkomponenten von Denkprozessen werden referiert. Über neurophysiologische und psychophysiologische Untersuchungen wird berichtet, die versuchten, theoretische Vorstellun- gen über den Charakter, den Verlauf und Bedingungen von Denkprozessen zu prüfen. Deduktive und induktive Schluß- prozesse wurden in den letzten 10 Jahren untersucht und erbrachten neue Erkenntnisse zum Verhältnis zwischen Logik und Denken. In Verbindung mit linguistischen Forschungsarbeiten wurde eine Vielzahl neuer Erkenntnisse über das Verhältnis zwischen Sprache und Denken, zwischen begrifflichen und bildhaften Denkhandlungen gewonnen. Der Über- gang von Untersuchungen der Ausbildung einzelner Problemlösestrategien zur Erforschung allgemeinerer Problemlöse- fähigkeiten wird diskutiert." |
| 1979
_ |
Hallpike: The Foundations of Primitive Thought, dt. 1986: Die Grundlagen
primitiven Denkens.
Verleihung des Nobelpreises an Hounsfield und Cormack (CT) |
| 1980/81 | Hans Aebli: Denken. Das Ordnen des Tuns. 2 Bde, Stuttgart: Klett-Cotta 1980-81. |
| 1981 | Dörner et al: Lohhausen. Vom Umgang mit Unbestimmtheit und Komplexität. |
| 1982
1983 |
Hopfield: Netze.
Haken: Synergetics. |
| 1984
_ |
Hussy: Denkpsychologie Bd. 1
Bildgebende Verfahren: seit 1984 klinische Nutzung des MRI |
| 1986 | Interdisziplinäre Arbeitstagung Begriffsanalyse in Darmstadt > Ganter et al. 1987. |
| 1988 | Haken: Information and Self-Organization. |
| 1989 | Dörner: Die Logik des Misslingens. Reinbek: Rowohlt 1989. |
| 1990 | Bildgebende Verfahren: Entdeckung des BOLD-Effektes durch Ogawa |
| 1996 | Markowitsch (Hrsg): Grundlagen der Neuropsychologie [denken wird im SR nicht aufgeführt] |
| 1997 | Markowitsch (Hrsg): Klinische Neuropsychologie. |
| 2002
_ _ |
Dörner: Die Mechanik des Seelenwagens: "Hier wird gezeigt, dass Erinnern, Planen, Wahrnehmen, Vorstellen, usw. auf nichts anderes als auf diese vier Prozesse [aktivieren, inhibieren, verknüpfen und entknüpfen] zurückgeführt werden können." |
| 2004 | 100 Jahre Deutsche Gesellschaft für Psychologie (PDF) |
| 2006
_ |
Denken und Problemlösen
(Enzykl. d. Psychol C. II, 8)
Kognitive Entwicklung (Enzykl. d. Psychol C. V, 2). |
| 2007 | Kaufmann et al: Kognitive Entwicklungsneuropsychologie [denken wird im SR nicht aufgeführt] |
| 2008
_ |
Kircher & Gauggel (Hrsg.): Neuropsychologie der Schizophrenie. [Info] Inhaltsverzeichnis: PDF. Alle Themen sind sowohl psychologisch als auch von der bildgebenden Seite her aufbereitet. |
4
Methoden und Werkzeuge der Denkpsychologie
Vorbemerkung: Zur Einführung in die Problematik sei der Abschnitt
Exkurs
Homonyme: Die Mehrdeutigkeit der Worte in meiner Grundlagenarbeit
zu Definition und Definieren
empfohlen. Zu den entwicklungspsychologischen Grundlagen kann auch hilfreich
sein: Terminologische
Differenzierung und Entwicklung kognitiver
Schemata und Begriffsbildung. Und,
systematisch: Über
den Aufbau einer präzisen Wissenschaftssprache in Psychologie, Psychopathologie,
Psychodiagnostik und Psychotherapie. Auch die Unterscheidung
zwischen der Objektsprache [1,
2,],
die Aussagen über die Welt macht und den Metasprachen, die Aussagen
über Aussagen verschiedener Ebenen oder Stufen machen, kann sehr wichtig
sein, um Paradoxien (z.B. wie beim Lügner-Problem;
Typentheorie) zu entgehen.
4.1
Metatheorie: die drei Welten in der allgemeinen und integrativen Denkpsychologie.
Die Probleme, die sich mit den Konstrukten Objekt- und Metaebene ergeben,
sind teilweise sehr verwirrend und schwierig. Ganz allgemein gesehen, können
wir - etwas modifiziert nach Poppers
drei Welten Theorie - drei Ebenen oder Welten unterscheiden (Realwelt,
Geistwelt, Zeichenwelt): (W1) die Welt der realen Sachverhalte. (W2) die
Welt der geistigen Sachverhalte (geistige Modelle und ihre Beziehungen)
und (W3) die Welt der Zeichen, die die (W1) oder (W2) repräsentieren.
Hinzu kommen die Beziehungen zwischen diesen Welten W1, W2, W3, wobei W2
und W1 auch als Bestandteil der realen Welt betrachtet werden können.
Jedes subjektive Erleben ist auch eine Realität, auch wenn niemand
außer dem Erlebenden jemals davon erfährt und er es kurze Zeit
danach vergessen haben mag. Ein komplizierendes Problem ist, dass es viele
unterschiedliche geistige Repräsentationsebenen und Ausdrucksweisen
für die verschiedenen realen Sachverhalte gibt.
Für die Realwelt gibt es keine Metastufe: sie
ist da, ereignet sich, geschieht. Metastufen gibt es nur in Sprachen (Modellen),
in denen die reale Welt W1 repräsentiert wird. In der realen Welt
W1 gibt es auch keine Theorien, Hypothesen oder Wahrscheinlichkeiten. Das
alles sind Konstruktionen, die die geistige Welt W2 hervorbringt und ersinnt
und in Zeichensprachen (W3) ausdrückt, so dass man über die verschiedenen
Weltmodelle kommunizieren und sich auseinandersetzen kann. Welche Weltmodelle
sinnvoll und nützlich erscheinen, hängt ab von den Vergleichskriterien
und den Zwecken und Zielen, die man mit seinen Weltmodellen verfolgt. Probleme
ergeben sich natürlich durch die Spezifität - und Individualität
- der Geistwesen, die, naturgemäß, die Welt durch ihre "geistigen
Brillen" (Filter) wahrnehmen. Die geistige Welt W2 kann daher als Metastufe
der realen Welt W1 angesehen werden, die mit W3 kommuniziert wird. Sowohl
die geistige Welt W2 als auch die Zeichenwelt W3 kann als jeweils objektsprachliche
Repräsentation einer metasprachlichen Perspektive unterzogen werden.
Man kann sich Gedanken machen, auseinandersetzen und darüber streiten,
ob W2 oder W3 nach diesen oder jenen Kriterien angemessen oder nützlich
sind.
Anwendungsbeispiel Banane. Sagt jemand, auf
dem Tisch liegt eine Banane, wird eine Aussage über W1 gemacht. Hierzu
werden einige geistige Begriffe und Beziehungsworte aus W2 benötigt,
die in W3 ausgedrückt werden. Sagt man, dass man sich eine Banane
vorstellt, ist den meisten klar, dass keine real existierende Banane in
der Obstschale auf dem Küchentisch gemeint ist, sondern eine Denkgestalt,
im engeren Sinne eine Visualisierung im Bewusstsein, die man Vorstellung
nennt. Man bewegt sich also in W2. Sagt man hingegen, dass Bananen krumm
seien, spricht man von Bananen der realen Welt im allgemeinen, aber keiner
konkreten, obwohl die Aussage auch für jede konkrete gelten sollte.
Man formuliert eine Gesetz- oder Regelhaftigkeit in W2 und W3 für
W1, denn weder ist der Begriff Banane krumm, noch das Wort "Banane" als
Zeichen- oder Lautgestalt. Gäbe es irgendeine Banane, die nicht krumm
wäre, wäre die Hypothese einer Gesetzmäßigkeit
widerlegt und es gälte allenfalls noch die Regelhaftigkeit. Spricht
man über die Sinnhaftigkeit der Krümmung als Kriterium, befindet
man sich in der Metaebene von W2. Es sind durchaus Argumente denkbar, die
der Krümmung keinen besonderen Definitionsmerkmalsstatus einräumen,
sondern mehr darauf abzielen: eine Banane ist eine Südfrucht, die
man essen kann und die einen bestimmten, den "Bananengeschmack", hat.
Anwendungsbeispiel denken. Denken ist bei
Geistwesen Bestandteil der realen Welt W1. Denken ist selbst etwas Gedachtes
und ein Begriff, gehört also auch W2 an. Und denken wird in W3 als
"denken" in Zeichengestalt gefasst und ausgedrückt. Sagen wir, denken
sei ein unklarer Begriff, so sprechen wir über das Denken als Begriff,
bewegen uns also in der Metasprache zu W2, was wir mit W2.1 kennzeichnen
wollen. W2.2 würde nach dieser Notationspraxis bedeuten, dass wir
über die Metasprache 2.1 sprechen. Zu W2.2 (denken als Begriff) würde
z.B. die Aussage gehören: Der Denkbegriff lässt sich nicht zuverlässig
und einvernehmlich klar definieren, es gibt zu viele individuelle Varianten
und eine Klärung sei mangels Schärfe und Operationalisierung
nicht möglich.
Welche und wie viele Metastufen klassifikatorisch vorgesehen
werden sollten, lässt sich für mich an dieser Stelle nicht erkennen.
Daher schlage ich hier vor, sich im konkreten und aktuellen Fall jeweils
damit auseinanderzusetzen und eine Begründung zu geben.
4.1.1 Die Falle
der Meta-Ebenen. Wie wir aus der Logik durch die logischen Paradoxien,
Antinomien und Absurditäten wissen, ist es wissenschaftstheoretisch
mitunter sehr wichtig, zwischen den verschiedenen Realitäts-, Urteils-
oder Aussageebenen zu unterscheiden - und ganz besonders in der Denkpsychologie.
Spricht man
in einer Sprache über die Welt, so sagt man in
der Semantik auch, man spricht in der Objektsprache. Es gibt nun
immer mindestens zwei Metaebenen: W2 ist die Metaebene zu W1. Und W3 ist
die Ausdruckswelt und Metaebene für W2, wenn kommuniziert werden soll.
Man muss nun auseinanderhalten, ob Aussagen in der geistigen Welt W2 über
W1, W2 oder W3 gedacht werden oder ob Aussagen mit W3 über W1, W2
oder W3 kommuniziert werden sollen.
Wahrnehmungen oder geistige Repräsentationen
der Welt und was in ihr geschieht, gehört zur geistigen Welt W2 mit
Bezug auf die realen Sachverhalte W1. Werden diese Wahrnehmungen oder geistigen
Repräsentationen kommuniziert, geschieht das mit Hilfe der Zeichenwelt
W3. Werden Regeln formuliert, wie in W2 gedacht und die reale Welt W1 in
W2 repräsentiert werden sollte, befinden wir uns auf der Metastufe
W2.1; es wird nicht mehr über das Geschehen der realen Welt W1 nachgedacht,
sondern es wird über das Denken selbst nachgedacht, nämlich wie
es erfolgen sollte. Denken über denken, das ist Meta. Macht man sich
Gedanken, welche Zeichen zur Kommunikation geeigneter sind als andere,
befinden wir uns aus der Metaebene W3.1, wenn etwa erörtert wird,
ob als Definitionszeichen " := " oder " =df " Verwendung finden sollte.
Hier spricht man dann über Sinn und Nutzen, Vor- und Nachteile dieser
oder jenen Zeichengebung.
Beispiel: Diese Tasse ist leer. Nehmen wir
an, das Wort "leer" wird hier objektsprachlich als Aussage über W1
verwendet. Hingegen: Das Wort "leer" enthält vier Buchstaben (richtig)
ist eine Metaaussage W3.1. Es wird nämlich über die Zeichenkette
"leer" aus W3 gesprochen und eine richtige Aussage darüber gemacht.
Da die Qualifizierung <richtige Aussage> über die Metaaussage W3.1
gemacht wird, gehört diese Aussage W3.2 an. Die Aussage <Der Begriff
leer enthält vier Buchstaben> ist falsch. Ein Begriff enthält
keine Buchstaben, sondern ein geistiges Modell. Der Name des Begriffs enthält
aber Buchstaben. Hier wird W2 mit W3 unzulässig vermengt. Wozu gehört
nun aber die Qualifizierung <falsch>? Nun, das gehört zur Metasprache,
die sich mit der Beziehung von W2 und W3 beschäftigt und die wir daher
mit W23.1 bezeichnen können.
Der Begriff leer beinhaltet das geistige Modell
von Leere, dass, wo etwas sein könnte, nichts ist. Der Begriff
leer enthält die Kriterien dafür, etwas "leer" zu nennen, etwa
im Gegensatz zu nicht leer oder voll. Man sieht an diesen beiden Beispielen,
dass wir es beim Sprechen über Worte und Begriffe mit zwei
verschiedenen Meta-Ebenen zu tun haben. Es ist vielleicht nützlich,
dies im Hinterkopf zu behalten.
Denken wir über das Denken nach, so kann man
auch sagen: W2 wird zur realen Welt "gemacht". Man kann Denken demnach
als realen Sachverhalt, den man untersuchen möchte, W1(W2) zuordnen
oder, metasprachlich, als W2.1. Denken über das Denken interpretieren.
In diesem Fall sollte man gleichsetzen können W1(W2) = W2.1. Ist das
sinnvoll, angemessen, richtig gar? Als W1 kann alles Geschehen, auch alles
subjektive Geschehen, jedes Fühlen, gestimmt sein, jede Körperregung,
jeder Wunsch, jede Phantasie, jede Erinnerung oder Vorstellung aufgefasst
werden. Das ist ja gerade der fachliche Gegenstand der Psychologie und
all der Menschen, die sich mit ihrer Befindlichkeit auseinandersetzen.
Wir untersuchen wahrnehmen, erinnern, wollen, entscheiden, fühlen,
empfinden, phantasieren ... u.a.m. Als dies ist für die PsychologIn
W1, W2 und W3.
Paradoxer Fallstrick: Ein Problem ergibt sich, wenn
wir einerseits sagen, in W2 können Sachverhalte gedacht werden, die
es in W1 nicht gibt, z.B. Pegasus, andererseits aber behaupten, wir können
jeden Gegenstand, z.B. Pegasus aus W2 auch als W1 ansehen und untersuchen.
Dem paradoxen Fallstrick entgeht man, wenn man W1 näher spezifiziert.
4.1.1.0.
Realität
Auch das Geschehen der realen Welt kann man als "Sprache" interpretieren,
nämlich als die Sprache des Geschehens in der Welt, genauer in den
Welten
(Natur, Kultur, Phantasie).
In unserem Ansatz wird von einer real existierenden
Außenwelt ausgegangen, der wir uns auch - paradox anmutend - selbst
zugehörig denken können. Als Denkende sind wir Subjekt und Objekt
zugleich. Wir können uns selbst und unsere Denken zum Gegenstand unseres
Denkens machen. Das führte in der Geistesgeschichte und im Denken
zu einigen Komplikationen und Problemen, meist erst dann so richtig, wenn
man ausdrücklich darüber nachdenkt. Wir können jede Welt
W zur realen Welt W1 machen: die Außenwelt, die Innenwelt und die
Welt der Zeichen: W1, W1(W2), W1(W3). Eine streng objektive Wahrnehmung
und Konstruktion von W1 gibt es nicht, wie schon 2.0
kritisch erörtert wurde. Man könnte hier den leider ziemlich
belasteten Begriff der Dialektik einführen, um der Idee der Wechselwirkungen,
die in die Erkenntnis und Konstruktion der Welten eingehen, einen Namen
zu geben. Ein Weltbild ergäbe sich demnach aus einem dialektischen
Prozeß zwischen objektiver Welt und ihrer subjektive Erfassung. Der
Bau unserer Gehirne, die Strukturen unseres Werdens, unserer Erfahrung
und unsere Art zu denken
Damit sind wir schon bei der ersten Paradoxie. Wir denken uns einerseits
eine von uns unabhängige Außenwelt und bekennen gleichzeitig,
dass in die Konstruktion dieser Außenwelt schon unser Denken einfließt.
Durch das Denken werden nun selbst 'neue' Welten
geschaffen, indem bestimmte Sachverhalte erst durch "lebendige", geistige
und erlebnisfähige Wesen in die Welt kommen, besonders durch unsere
Phantasie. Es gibt sozusagen auch die Welt der Gefühle, der Wünsche,
der Träume, der Ideale, Normen und Werte und der Möglichkeiten.
Diese Phänomene sind nicht weniger real als Sonne und Mond, Gravitation
und Fallgesetz, Massen und Energie. Aber sie sind flüchtiger, schwer
zu greifen und entziehen sich einfachen naturwissenschaftlichen Beobachtungen
und Messungen, wobei es aber durch die neuen bildgebenden Verfahren zunehmend
möglich wird, auch die subjektiv flüchtigen Ergebnisse teilweise
objektiv zu erfassen.
Einen erkenntnistheoretischen Realismus vertreten
heißt für uns: Es gibt eine Welt, auch wenn wir uns alle wegdenken;
die Welt ist kein Produkt des menschlichen Geistes, sondern umgekehrt:
der menschliche Geist ist ein Produkt der Welt.
4.1.1.1.
Denken
als mentale Metasprache über die Realität.
Denken kann als Metasprache über "die" Realität, genauer,
über die verschiedenen Welten aufgefasst werden. Verwickelt und verwirrend
wird es, wenn Denken sich selbst zum Gegenstand hat oder macht. Denken
ist dann Objektsprache und Metasprache. Und das Denken hierüber muss
dann noch einmal eine Ebene höher angesetzt werden. Die Verwicklung
und Verwirrung geht aber noch weiter, wenn wir bedenken, dass Denken über
das Denken ja nicht nur eine psychologische Angelegenheit ist, sondern
in gewisser Weise von jedem, auch von den anderen Fachwissenschaften, und
jedermann betrieben wird. So gesehen macht Ryles
Kritik an der Denkpsychologie - und Psychologie im allgemeinen schon
einen gewissen Sinn - und sollte uns anregen, die komplizierten Verhältnisse
zu entwirren. Das genau ist aber nicht einfach.
Die allermeisten Menschen lernen denken wie sprechen
bereits als kleine Kinder, ganz ohne förmliche Schule. Sie lernen
denken und sprechen durch machen, probieren, anfassen, greifen, hantieren,
wahrnehmen, schauen und beobachten, nachmachen, durch Versuch und Irrtum,
durch Neugier, durch Interaktion und Kommunikation. Der Mensch kann längst
in vielerlei Hinsicht denken, ohne zu wissen, wie er das macht. Er denkt
"einfach". An dieser Stelle mag es daher interessant sein zu fragen, wie
lernt der Mensch, das Kind das Wort "denken"
und seine Bedeutung?
Denken kann man nicht direkt sehen. Es geschieht,
wie wir alle wissen, im Kopf. Und da können wir erst seit einiger,
relativ kurzer, Zeit, begrenzt und nur ein wenig mit den bildgebenden
Verfahren hineinschauen. Die Klärungsfrage wird zusätzlich
erschwert durch die Probleme, die sich mit der Sprache ergeben. Über
denken kann man natürlich nur über eine Sprache kommunizieren.
Um so wichtiger erscheint mir daher, von Anfang an möglichst klar
und präzise zu sein, und das heißt auch möglichst konkret,
operational und mit Beispielen zu arbeiten.
MathematikerInnen, PhysikerInnen, KünstlerInnen,
Hebammen, LehrerInnen, BiologInnen, Kinder, InformatikerInnen, NachbarInnen,
MusikerInnen, JournalistInnen, AbenteurerInnen u.v.a.m - sie alle denken
und betrachten die Welt und das Geschehen durch ihre berufs- oder rollenspezifische
Brille. Viele von ihnen haben keine ausdrückliche und sogenannte Denktheorie
im namentlichen Sinne und denken trotzdem theoretisch und praktisch sehr
erfolgreich. Aber die FachwissenschaftlerInnen haben alle eine fachspezifische
Denktheorie, auch wenn sie sie nicht so nennen. Ihre Art Wissenschaft zu
treiben, zu reflektieren, darzustellen und zu kommunizieren durch Diskussionen
und Veröffentlichungen zeigt, wie sie denken und wie sie meinen, dass
sie in ihrem Fachgebiet denken sollten.
Besondere Abgrenzungsaufgaben ergeben sich gegenüber
den Wissenschaften, die sich ebenfalls sehr stark mit dem Denken befassen:
Logik, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie und der ganze Komplex um
die künstliche Intelligenz und kognitiven Neurowissenschaften. Räumt
man ein, dass in der Erforschung des Denkens auch der Sprache und dem Sprechen
eine große Bedeutung zukommt, dann kommen auch noch die Probleme
der Sprachtheorie bzw., allgemeiner, der Semiotik, der Longistik \g und
Kommunikationswissenschaften, hinzu. Vergegenwärtigt man sich die
komplexe und verwickelte Situation um "das" Denken, dürfte es nicht
schwerfallen, all die vielen Möglichkeiten der Verwirrung und Fallstricke
zu ahnen, denen die Denkpsychologie ausgesetzt ist.
4.1.1.2.
Denkpsychologie als Metasprache über das Denken. Viele,
fast alle Menschen denken (und auch viele Tiere können denken, auch
wenn der anthropomorphe egozentrische Narzismus dies gerne herunterspielt).
Und sie denken, je nach Entwicklungsstand, Intelligenz, Bildung, Beruf,
Rolle, in Abhängigkeit von ihren Zielen und Zwecken und den Situationen,
in denen sie sich befinden oder wähnen, ganz unterschiedlich. Was
sind also nun eigentlich die Objekte der Denkpsychologie? Was unterscheidet
eine DenkpsychologIn von einer denkenden MathematikerIn, ChemikerIn oder
KünstlerIn? Auch die DenkpsychologIn braucht Inhalte, sie kann schlecht
"Denken" ohne jeden Inhalt untersuchen. Was macht nun aber einen Denkinhalt
zu einem, der besonders für die Denkpsychologie typisch erscheint
(Ryles Kritik)? Ganz allgemein ist sicher
die Entwicklungspsychologie des Denkens - vom Säugling bis zum Greis
- eine typisch psychologische Fragestellung. Aber wir wissen, dass zum
großen Gebiet der Allgemeinen Psychologie neben der Wahrnehmung,
der Motivation, den Gefühlen, den Affekten und der Stimmung, dem Wollen
auch das Denken gehört. Was untersuchen die allgemeinen PsychologInnen
da?
Eine allgemeine, besonders die DenkpsychologInnen
interessierende Frage ist sicher: Ist denken immer, manchmal und falls,
unter welchen Bedingungen mit visuellen Vorstellungen verbunden? Wieso
sollte dies die GermanistIn, die ChemikerIn oder die MusikerIn interessieren?
Nun, für PädagogInnen und ErzieherInnen, und damit auch für
alle potentiellen Eltern, kann die Frage ebenso interessant sein wie für
KünstlerInnen oder GeometrikerInnen.
Auch Problemlösungsprozesse
spielen bei den allermeisten Menschen und den FachwissenschaftlerInnen
eine große Rolle. Nun spielt etwa das 9-Punkteproblem in der kreativen
Denkpsychologie eine wichtige Rolle, es könnte aber auch in einer
anderen Wissenschaft, die sich mit Problemlösungsprozessen in ihrem
Fach beschäftigt, eine ebenso wichtige Rolle spielen. Was unterscheidet
z.B. eine chemische Problemlösungsmethode von einer psychologischen?
Nun, bei einer chemischen Problemlösung wird chemisches Fachwissen
hilfreich sein und die DenkpsychologIn wird sich mehr für allgemeine,
fachunspezifische Problemlösungsmethoden interessieren. Hier gibt
es allerdings eine große Nähe zur Mathematik, die ja ebenfalls
sehr allgemeine und vielfältig spezifisch interpretierbare Problemlösungen
anbietet.
Auch für die MathematikdidaktikerIn kann es
sehr interessant sein zu wissen, ab wann die Abstraktion "gleichmächtig"
oder die Volumenkonstanz gelingt oder gar ein Verständnis, wie abstrahieren
geht, entwickelt ist. Für die LogikdidaktikerIn kann es ebenso interessant
sein, ob, wann und unter welchen Bedingungen die Implikation von ProbandInnen
verstanden und richtig angewendet wird.
Typisch und wesentlich für die allgemeine Denkpsychologie
ist die Abwesenheit fachspezifischer Denkinhalte oder Methoden. PhysikerInnen
interessieren sich für physikalische Begriffe, ChemikerInnen für
chemische, JuristInnen für juristische und ÖkonomInnen für
ökonomische. Aber LogikerInnen, Erkenntnis- und WissenschaftstheoretikerInnen
interessieren sich für die Begriffe selbst. Was unterscheidet dann
logisches von psychologischem Begriffsinteresse? Die LogikerIn ist wohl
meist an der logisch korrekten Technik der Merkmalistik von Begriffen interessiert.
Die DenkpsychologIn möchte wissen, was passiert da im Denken, wie
geschieht es, welche Elemente braucht man, welche sind hilfreich, welche
störend, wie kann man es lernen, ab welchem Alter sind die Voraussetzungen
da?
4.1.1.3.
Wissenschaftstheoretische
Erörterungen über die Denkpsychologie als Metasprache der Denkvorgänge.
Wird die Denkpsychologie zum Gegenstand der Betrachtung und Forschung
gemacht, ergibt sich eine weitere Metastufe. Dazu gehören Auseinandersetzungen,
ob und wie man Denkpsychologie betreiben kann und sollte. Hier geht es
um die Mittel, Werkzeuge und Methoden der Denkpsychologie, um ihre Angemessenheit
und Güte (Objektivität, Reliabilität, Validität, Utilität).
Erörtern wir z.B. das Für und Wider der Methode des lauten Denkens,
so befinden wir uns auf einer weiteren Metaebene.
4.1.2
Die sachlich-fachlichen Metakategorien
Wo gehört nun aber die Frage hin, ob ein Denken richtig oder falsch
ist? Auf den ersten Blick, scheint das in die Wissenschaftstheorie zu gehören.
Auf den zweiten Blick kann aber damit nicht das gemeint sein, was unter
4.1.1.3 ausgeführt wurde. Denn dort geht es darum, ob die Denkpsychologie
das Denken mehr oder minder richtig oder falsch erforscht. Wir wollen nun
aber wissen, ob ein Denken richtig oder falsch ist. Betrachten wir eine
Reihe von Beispielen: (1) Kreta ist eine Insel im Mittelmeer. (2) Unter
Pegasus versteht man ein Pferd mit Flügeln, das ist eine Begriffsschöpfung
aus der griechischen Mythologie. (3) Unendliches hat kein Ende. (4) Eine
Sprache besteht aus wahrnehmbaren Zeichen, die einer Grammatik folgen und
der Kommunikation dienen. (5) Gott ist geschlechtslos. (6) Universalien
sind Produkte des Geistes und existieren nicht real in der Natur, obwohl
man mit ihrer Hilfe die Natur teilweise sehr gut verstehen kann. (7) Der
Mensch M hat zum Zeitpunkt Z am Ort O in der Situation S Angst erlebt.
(8) A hält B für ziemlich bequem. (9) Das Volk Israel wurde von
Gott auserwählt. (10) Die Mathematiker unterscheiden drei Haupteigenschaften
von Abbildungen: injektive, surjektive und bijektive. (11) Paranoia
beruht [nicht] auf verdrängter Homosexualität. (12) Kinder können
bereits im Kindergartenalter abstrahieren. (13) Die Unterscheidung von
Ich und Nicht-Ich (innen und außen) beherrschen die meisten Kinder
schon ab dem 2. Lebensjahr. (14) Die Bedeutung von Namen geben bereits
kleine Kinder korrekt an, wenn sie meinen, Namen seien dazu da, damit man
gerufen werden könne. (15) Bei der Abendmahlfeier ist Christus leibhaftig
zugegen, sein Leib inform eines Gebäckes, sein Blut inform eines Getränkes.
(16) Jede Beobachtung geht auch mit einem Beobachtungsfehler einher. (17)
Es gibt Gravitation und ihr Ausmaß bemißt sich nach der Newton'schen
Größengleichung [W].
(18) Volumenkonstanz lernen Kinder gewöhnlich schon im Vorschulalter.
(19) Introspektion ist keine angemessene Methode zur Erforschung des Denkens.
(20) Die Methode des lauten Denkens erweitert die Möglichkeiten der
Denkpsychologie. (21) Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. (22)
Was ist von der
Universalien-Beziehung
potentiell unendlicher Erfüllungen und ihrem Namen zu halten?
4.1.2.1
Die Metakategorien richtig, korrekt, wahr, falsch, unzulänglich.
Sätze, die wahr oder falsch sein können, nennt man gewöhnlich
Aussagen. Merkmale von Sachverhalten kann man in Begriffe oder Aussagen
fassen. Können nun auch Begriffe wahr oder falsch sein?
Es heißt, Definitionen seien nicht wahr oder
falsch, sondern freie und willkürliche Setzungen, die nur zweckangemessen
oder zweckunangemessen sein könnten. Das ist nur bedingt richtig.
Sofern Definitionen Elemente der Realität repräsentieren sollen,
müssen diese natürlich widerspruchsfrei existieren. Es gibt keinen
Fisch, der aus Holz mit einem spezifischen Gewicht von 0 besteht. Und es
gibt keine endlose Folge mit einem Ende oder ein Leben nach dem Tod - jedenfalls
nicht in der bisherigen Organisationsform und Ganzheit der Menschen.
Ob Denkergebnisse mehr oder weniger richtig oder
falsch sind, ist vielfach eine fachwissenschaftliche, allgemeine oder alltägliche
Frage und unterliegt dann nicht der Kompetenz der Denkpsychologie. Die
Frage, wie ein Denk-Ergebnis psychologisch gefunden wird, ist zwar von
Haus aus eine psychologische Frage, sie kann aber so schwierig oder fachspezifisch
sein, dass zu ihrer Beantwortung erhebliche andere fachwissenschaftliche
Kenntnisse erforderlich sind, die in vielen Fällen bei den PsychologInnen
möglicherweise gar nicht vorliegen. In solchen Fällen muss man
dann auf die psychologischen Kompetenzen anderer WissenschaftlerInnen zurückgreifen,
kooperieren - oder verzichten.
Allgemein wissenschaftstheoretisch betrachtet stellt
sich das Objekt- und Metasprache-Problem wie folgt dar: Wir gehen einmal
von der Realität aus (Objektstufe), sodann gibt es das fachwissenschaftliche
oder allgemeine Erfassen und Denken dieser Realität, das kann man
als Metasprache für die Realität interpretieren. In der Objektsprache
werden die Objekte und Beziehungen des wissenschaftlichen Gegenstandsbereichs
beschrieben. Zur Metasprache einer höheren Stufe gehören
die Fragen von richtig oder wahr und falsch, die alle drei einer Metastufe
angehören. Eine Variante davon ist die Frage nach dem zweckangemessen
oder zweckunangemessen sein.
4.1.2.2
Die Metakategorie angemessen, nützlich, wirkungsvoll (effizient).
Von nicht wenigen Sätzen oder Ausdrücken, kann man gar nicht
sagen, dass sie wahr oder falsch seien: Aufforderungen (geh mir bitte aus
der Sonne); Ausdrücken (Seufzer; gähnen), Beschreibungen, Kennzeichnungen
und Definitionen (Pegasus heiße ein fliegendes Pferd); Wünschen
(trinken, ausruhen mögen), Wertungen (gefällt / nicht). Ist wünschen,
auffordern, definieren, werten falsch oder wahr? Erfüllt ein ausgedrückter
oder hergestellter Sachverhalt den beabsichtigten Zweck?
4.1.3 Komplizierte
metasprachliche Verschachtelungen: Ich denke, du denkst, ich denke ....
Bewusstseins- und Denkvorgänge können sehr kompliziert über
verschiedene Ebenen verschachtelt sein, z.B. (1) ich denke, du denkst,
ich denke über Dich so und so. Oder (2) ich meine, Du wünschst,
dass ich das und das aus freien Stücken denken soll, also nicht nur,
um zu gefallen oder den Schein zu erwecken. Und als drittes Beispiel: (3)
Ich glaube nicht, dass du richtig erkennst, was ich mit Aufrichtigkeit
meine. Fast jeder Mensch mit einem IQ > 90 versteht diese Sätze ohne
Probleme, obwohl, sobald man sie näher betrachtet, merkt man schnell,
dass sie ziemlich kompliziert sind. Ein Meister verschiedener, verschachtelter
und komplizierter Ebenen war der englische Psychiater Ronald Laing,
der hierzu auch ein systematisches Instrument entwickelt hat.
4.2
Die allgemeinen wissenschaftlichen Methoden:
Mein persönlicher Standort ist eine einheitswissenschaftliche
Sichtweise.
4.2.1
Auswahl durch Interesse und Zuwendung
Die Wissenschaft beginnt mit der Auswahl eines Gegenstandes durch Interesse
und Zuwendung. Dieser Punkt wird in der Wissenschaft gerne übergangen,
vermutlich weil in die Auswahl natürlich eine Wertentscheidung eingeht.
Wer bestimmten Gegenständen seine Aufmerksamkeit, sein Interesse und
seine Zuwendung schenkt, zeichnet diese Gegenstände durch seine Auswahl
aus.
4.2.2
Beobachtung und Erfassen der Erscheinungen.
Im allgemeinen beginnt die eigentliche wissenschaftliche Tätigkeit
nach der Auswahl mit Beobachten und Erfassen der Erscheinungen.
4.2.3 Experiment
(Laborexperiment)
Ein in vielen - vor allem der Natur- - Wissenschaften ist das
Experiment (Paradigma
- auch psychologischer - Experimente) , vom dem man im allgemeinen
verlangt, dass es so beschreiben werden muss, dass es von anderen Forschern
wiederholt werden kann. Meist versteht man unter Experiment ein Laborexperiment
unter guten kontrollierbaren Bedingungen. [Lit.Exp.]
- Beispiel Assoziations-Experiment:
Im folgenden erhalten Sie ein Blatt Papier, auf dem ein Wort steht. Schreiben Sie bitte ohne jede Rücksicht auf Sinn oder Moral alle Worte der Reihe nach auf, die Ihnen hierzu einfallen, egal ob sie zu einander passen oder nicht. Das spielt hier keine Rolle. Wenn Ihnen nichts mehr einzufallen scheint, machen Sie bitte einen Strich. Wenn Sie drei mal einen Strich gemacht haben, schreiben Sie bitte "ENDE".
- Beispiel 01: Holz - Kohle - Papier. Lösungsmöglichkeiten: a) Brennbares, b) Heizbares, c) Erwärmbares, d) Anzündbares, e) Vergängliches aus der Natur, f) drei Dinge. Was meinen Sie dazu? Welche Antworten könnten Sie als Lösungen anerkennen?
- Beispiel 02: hart - weich - ovalrund. Lösungsmöglichkeiten: a) Gekochtes Ei, außen hart, innen weich, von der Form ovalrund. b) ein ovalrundes Gesicht mit weichen Lippen und harten Backenknochen, c) Außen hart und innen weich von ovalrunder Form. d) Außen weich und innen hart von ovalrunder Form.
- Beispiel 03: Stuhlbein - Ding - Kante. Lösungsmöglichkeiten: a) Ein Ding, das auf der Kante eines Stuhlbeins liegt. b) Ein Stuhlbein, das mit einer Kante auf einem Ding liegt. c) Ein Ding, das mit einer Kante ein Stuhlbein berührt.
- Dreieck, Kugel, Würfel, Quadrat, Tomate. Welche Lösungsmöglichkeit(en) sehen Sie hier?
- Aus den Zahlen 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Zweiergruppen bilden, die jeweils zusammengezählt die Zahl 10 ergeben.
- Aus den Zahlen 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Zweiergruppen bilden, die jeweils zusammengezählt die Zahl 5 ergeben, wobei jede Zahl höchstens einmal verwendet werden darf.
Beispiel Metaebene Begriffsbildung:
Eine interessante, aber auch schwierige Metafrage zur Psychologie der Begriffsbildung ist, ob ein Proband ein Verständnis von einem Begriff hat. Eine solche Fragestellung kann man nur untersuchen, wenn dem Untersucher selbst klar ist, was ein Begriff ist und wie er gebildet werden kann. Der direkte Weg wäre, zu fragen: Können Sie erklären, was ein Begriff ist oder fällt Ihnen das aus dem Stegreif im Moment eher schwer? Dieser Weg erscheint insofern problematisch, als hier nicht nur die Fähigkeit, Begriffe von Nicht- oder nur Scheinbegriffen zu unterscheiden und richtig zu verwenden, erfasst wird, sondern mehr, nämlich, ob das jemand auch (richtig) erklären kann. Daher ist der indirekte Weg, neue - allgemein noch unbekannte - Begriffe bilden zu lassen, wahrscheinlich angemessener. Am Ergebnis kann man sehen, ob jemand einen Begriff vom Begriff hat, ohne dass er dies erklären muss. Erklären können muss dies eigentlich nur ein Logiker, Methodologe, Erkenntnistheoretiker oder ein experimenteller Denkpsychologe.
- Aufgabe Neubildung: Im folgenden werden Ihnen drei Merkmale genannt
und Ihre Aufgabe besteht darin, aus diesen drei Merkmalen ein Ganzes zu
benennen:
Aufgabe Sortieren, was zusammengehört:
4.2.4 Feldexperiment.
Im Unterschied zum Laborexperiment findet ein Feldexperiment unter Realbedingungen, draußen in der "wirklichen" Welt statt. Man geht hinaus in die Wirklichkeit, hier Feld, genannt, etwa bei den berühmten Feldforschungen der Arbeitslosen von Marienthal oder den vielen ethnografischen Feldstudien, wo man die "Grundlagen primitiven Denkens" (Hallpike) erforschen will. Geht man in einen Kindergarten und beobachtet Kinder nach spezifischen Kriterien, so wird ein Feldexperiment durchgeführt. Bei einem Feldexperiment sind die Variablen nicht so kontrollierbar wie in einem Laborexperiment. Aber es gibt im sozialwissenschaftlichen keine Alternative zum Feldexperiment. Ein ungewöhnliches Feldexperiment wurde in der Antike durchgeführt, um die Selbstmordepidemie der Jungfrauen von Milet zu stoppen - was durch eine gewagte, aber erfolgreiche politisch-psychotherapeutische Maßnahme (Dekret) auch gelungen sein soll.
Beispiel Sachverhaltsbildung
aus Begriffen: Am 26.-29.05.2010 habe ich einige Personen zu folgender
Aufgabe befragt:
Ich sage Ihnen drei Worte und Ihre Aufgabe ist es,
daraus einen gewöhnlichen Satz zu formulieren:
Aufgabe 1: Die drei Worte sind: Ast, 3, grün.
VP1 An einem Ast hängen
drei grüne Blätter.
VP2 Der Ast hat drei grüne
Blätter.
VP3 An einem Baum hängt
ein Ast mit drei grünen Blättern.
VP4 Der grüne Ast hat
drei Blätter.
VP5 kein Einfall.
VP6 Ast hat drei grüne
Blätter.
VP7 Drei Vögel sitzen
auf einem grünen Ast.
VP8 Drei Äste sind
grün.
VP9 Ich sehe drei grüne
Äste.
Aufgabe 2: Die drei Worte sind: Ast, 3, blau.
VP1 An einem Ast hängen
drei blaue Luftballons.
VP2 kein Einfall.
VP3 An einem Baum hängen
an einem Ast drei blaue Pflaumen.
VP4 An einem Ast hängen
drei blaue Pflaumen.
VP5 Nicht befragt.
VP6 Nicht befragt.
VP7 Drei Typen saßen
total blau auf einem Ast.
Vp8 Kein Einfall.
VP9 Blaues Wasser über
drei Ästen.
Ergebnis:
- Fast alle Befragten konstruieren einen Sachverhalt mit drei grünen Blättern, offenbar durch den Ast mit der Assoziation Baum gebahnt.
- Die Konstruktion mit blau dauert deutlich länger und hat auch verschiedene blaue Objekte.
Beispiel: Begriffsbildung aus drei Worten.
Ich sage drei Begriff und Ihre Aufgabe ist es, daraus einen einzigen
neuen zu bilden. Die drei Worte sind: Ast, 3, grün.
VP1 Baum.
VP3 Geht gar nicht.
Nach Diskussion: Laub.
2. Beispiel: Bier, Gardine, Käse.
VP1 Küche.
VP3 Haushalt.
4.2.5 Gedankenexperiment.
[W]
Gedankenexperimente sind geistige Experimente, die zum Zeitpunkt des
Ersinnens, nicht durchführbar erscheinen. Aber man erhofft sich, dass
die strenge Durchführung des Gedankenexperiments mehr Klarheit hinsichtlich
einer Frage bringt. Eine Grauzone ergibt sich zu (verdeckten) Annahmen
und Hypothesen.
4.2.6 Dokumentation.
Zu jeder ordentlichen wissenschaftlichen Arbeit gehört die Dokumentation
(Protokoll) der Daten und der Bedingungen, unter denen sie gewonnen wurden.
Das ist im psychologischen Bereich, wenn man nicht Audio / Video Technik
zur Hilfe nimmt, oft schwierig. Doch selbst wenn videodokumentiert wird,
kann die Auswertung schwierig sein, weil die Beobachtungsmerkmale mehrdeutig
und mehr oder minder interpretationsabhängig sein können.
4.2.7
Auswertung, Analyse und Schlussfolgern: Hypothesen-, Modell- und Theoriebildung.
Wurden Daten erhoben, etwa ein Protokoll von lautem Denken, so stellt
sich die Frage, die man am besten vor der Erhebung schon durchdacht haben
sollte, wie die Daten ausgewertet, analysiert und hinsichtlich ihrer Bedeutung
interpretiert werden können. Eignen sich bzw. wie sehr eignen sich
die unabhängigen Variablen zur Erklärung der abhängigen
Variablen? Wie kann ich das begründen? Was müsste der Fall sein,
damit ich die Hypothese der Begründung verwerfe? Sind weitere Befunderhebungen
und Ableitungen möglich?
4.2.8
Erklären, Verstehen, Voraussage.
Bei fortgeschrittener Theorienbildung sollten (kausale)
Erklärungen und damit Voraussagen bzw. Verstehen möglich sein.
4.2.9 Evaluation
und Kontrolle.
Evaluation heißt, den Wert eine Methode oder Maßnahme bzw.
von Ergebnissen zu begründen. Bringt die Maßnahme, was von ihrer
erwartet wurde, erhofft und erwünscht war oder nicht oder nur unter
bestimmten Bedingungen?
Querverweise: Psychotherapieforschung,
Evaluation und Qualitätssicherung in der GIPT-Praxis * Idiografische
Wissenschaftstheorie.
4.3.
Die zusätzlich besonderen Methoden der Psychologie und Denkpsychologie:
Das letzte neuere und größere Werk zur Denkpsychologie,
das ich für die Aktualisierung dieser Arbeit (2010) eingesehen habe,
ist im Rahmen der Reihe Enzyklopädie der Psychologie, Denken
und Problemlösen, 2006 erschienen. Im 11. und letzten Kapitel
werden dort von Funke und Sperring die Methoden
zur Denk- und Problemlösungsforschung abgehandelt, so dass ich
meine eigenen Vorstellungen noch einmal abgleichen konnte. Mitte Mai 2010
habe ich die Datenbank Psyndex nach dem Stichwort "Denkpsychologie" durchsucht
und 78 Einträge gefunden. Die letzte große neuere Arbeit, die
ich gesichtet aber noch nicht richtig durchgearbeitet habe, verbindet Psychologie,
Medizin und bildgebende Verfahren. (Kircher
& Gauggel, 2008).
Geschichtlicher Exkurs.
Jahrtausendelang war die Psychologie ein Bestandteil der Philosophie, Theologie,
Medizin und nunmehr scheint sie nicht zu geringen Teilen aufzugehen in
den Kognitionswissenschaften und, schlimmer noch, bei den NeuroscienceologInnen
unterzugehen. Zwar war auch der Großmeister der Entwicklungspsychologie
des Denkens, Jean Piaget kein gelernter Psychologe, sondern von Haus aus
Zoologe, aber für das Experimentieren und die Denkpsychologie hat
er bis heute weltweite Maßstäbe gesetzt. So müssen wir
zugeben, dass ein Zoologe die Entwicklungspsychologie des Denkens revolutioniert
und in Höhen gebracht hat, was den Philosophen Jahrtausende nicht
gelang und vielen Psychologen bis zu Piaget auch nicht. Das "Wunder" Piaget
lässt sich durch drei charakteristische Merkmale begreifen: Operationalität,
Orientierung am Leben und der Natur, Experiment.
Die Denkpsychologie ist im wesentlichen am Bewusstseinsproblem
gescheitert insofern als man die methodologisch wichtigen Unterscheidungen
zwischen den verschiedenen psychischen Funktionen, die das jeweilige Aktualbewusstsein
bilden, wie sie zusammenwirken und miteinander verschachtelt sein können,
nicht lösen konnte. Teilweise kann man das auf Unfähigkeit der
im 19. Jahrhundert noch relativ mächtigen philosophischen Gepflogenheiten
zurückführen. In der 2500jährigen Geistgeschichte habe ich
bis zu den PhänomenologInnen und DenkpsychologInnen keinen einzigen
Denker gefunden, der sein eigenes Bewusstsein untersucht, protokolliert
und dokumentiert hat. Man erkannte nicht, wie grundlegend und notwendig
eine differenzierte, klare, operationale und normierte Terminologie ist,
um die den Bewusstseinsproblemen beizukommen.
4.3.1 Assoziationsuntersuchungen [QV]
4.3.2 Protokolliertes
Denken. (ausgelagert)
Vorbemerkung Protokolliertes
Denken.
Selbstversuche
Rudolf Sponsel.
Thema
denken.
Protokoll
vom 02.10.2018, 10.03-10.24.
Nachbetrachtung
Denkprotokoll vom 02.10.2018, 10.03-10.24.
Thema
Bewusstsein.
Protokoll
Thema Bewusstsein Di 02.10.2018, 14.22-14.33.
Nachbetrachtung
Bewusstsein 02.10.2018, 14.22-14.33.
Thema
vorstellen.
Thema
wahrnehmen.
Thema
erkennen.
Thema
Kategorien - Einteilung der Welt.
Kaminskis PMOe Psychologische
Mikro Oekonomie.
Segals Versuche Über
das Vorstellen (1911/12, veröf. 1916).
Vorbemerkung.
Versuchsbeschreibung.
Vorstellungs-Protokolle:
Herr
X. in seinem Sprechzimmer.
Rw
Hauptpost.
X
Wandern.
XII:
Rw Kurszimmer.
Rw.
Remigiusstraße.
Rw.
Neue Wohnung.
VII.
Rw. Koblenzer Straße.
Duncker Lautes Denken
(1935).
§
2. Versuchsverfahren.
§
3. Ein Protokoll der „Bestrahlungs“aufgabe.
§
4. Nichtpraktikable „Lösungen“.
Duncker
ueber Protokolle.
Narziss
Ach Über die Begriffsbildung (1921):
Einführung
und Zusammenfassung zur Ach'schen Begriffsbildungsuntersuchung.
Aus
Achs Originalarbeit 1. Kapitel Einleitung § 1. Die Aufgabenstellung.
Allgemeine
Schilderung der Suchmethode.
Tabelle
IV Schema der Differenzierung von 48 Versuchskörpern.
Auseinandersetzung
mit Achs genetisch-synthetischer Methode:
Wygotski,
L. S. (1981; russ 1934).
Kritische
Anmerkung zu einer These Wygotszkis.
Glossar,
Anmerkungen und Endnoten:
Unterschiedliche
Niveaus der Begriffsentwicklung:
Aus
Jagusch (2000) 3.3 Die Stufen der Entwicklung des begrifflichen Denkens.
Determinierende
Tendenz - zielorientierter Prozess.
Determination,
determinierende Tendenz.
Link
zu James Joyce Ausschnitt aus Ullysses.
Link
zu Geschnittener Lorbeer.
Glossar,
Anmerkungen und Endnoten.
Literatur
* Links * Querverweise
* Zitierung & Copyright * Änderungen.
4.3.3 Beobachtung und Analyse von Aufgabenbewältigungen
(Tests).
- Z.B. Denkprobleme nach Oerter:
Bergtourproblem, Bestrahlungsaufgabe, Bohrerproblem,
Büroklammer-Problem, Dreizehn-Aufgabe, logische Blöcke, Maiersche Seilaufgabe,
Pendelaufgabe, Problem der falschen Münze, Schachtelproblem, T-Aufgabe,
Transpositionsaufgaben, Turm von Hanoi, Zahlenreihen-Aufgaben.
unterschiedlichen Alters, Herkunft, Bildung und Kultur.
4.3.5 Getestetes Denken: Methoden der Intelligenztests oder anderen kognitiven Problemlösungs-Aufgaben.
4.3.6 Kontrolliertes Denken.
4.3.7 Kreativitäts-, Fehler- und Irrtumsforschung.
4.3.8 Lautes Denken (Duncker 1935). > protokolliertes Denken (Duncker).
4.3.9 Problemlösung einfacher (linearer) Modelle: Klassifizieren, Regeln erkennen,
Übereinstimmungen und Unterschiede erkennen; einfache Alltagsaufgaben,
4.3.10 Problemlösung schwierigerer Aufgaben: Beispiele: Türme von Hanoi,
9 Punkte Problem, Denksport- und Knobeleien, Paradoxa, Koans, Rätsel,
4.3.11 Problemlösung komplexer (nicht linearer) Modelle: Prototyp Lohhausen,
Lebensplanung u. -gestaltung: Selbstverwirklichung (ich-angemessen leben).
4.3.12 Selbstbeobachtung und Introspektion
4.3.13 Textanalysen und Textauswertungen.
4.3.14 Wissenschaftliche Modellbildungen (Neuronale Netze, Homunkuli-Konstruktionen,
Roboter, Simulatoren und Simulationen).
4.3.15 Neuropsychologische Denkanalysen nach Hirnläsionen und Erkrankungen.
4.3.16 Bildgebende Verfahren als Hilfsmittel kognitiver Psychologie.
_
4.4
Die Sicherung des Verstehens zum
Zwecke forschender Kommunikation.
Für die meisten Untersuchungen zum Denken ist Verstehen eine wichtige
Voraussetzung. Eine Denkaufgabe kann nur dann sinnvoll ausgeführt
werden, wenn verstanden wird, was zu tun ist. Damit gelangen wir in einen
grundlegenden Zirkel. Denn beim Verstehen von Aufgaben, ist Denken beteiligt
und auch eine Sprache nötig. Verstehen ist ein grundlegender Begriff,
der nur auf dem ersten Blick klar scheint. Tatsächlich dürfte
es in den meisten Situationen so sein, dass wir zwar meinen oder glauben,
zu verstehen - aber verstehen wir "wirklich"? Wie können wir prüfen,
ob wir "wirklich" verstehen? Wie macht man das? Die einfachste Möglichkeit,
verstehen zu prüfen, geht über das Verhalten oder Handeln.
4.4.1 Paradigmatisches
Grundproblem:
Wie kann man feststellen und ermitteln, welchen Begriff
ein Kommunikator mit der bildlichen oder lautlichen Ausdruckshülle
eines Wortes verbindet? Das Problem hat in allen Wissenschaften, die mit
Erleben und Verhalten zu tun haben, eine kaum zu überschätzende
Bedeutung.
Aus dieser Fragestellung ergibt sich sofort die
nächste und noch grundlegendere Frage: was können oder sollen
wir unter einem
Begriff verstehen? Eine Idee, eine Vorstellung,
ein kognitives Schema, eine mehr oder minder deutliche Merkmalskombination
in dieser oder jener Kommunikationssituation? Auf den ersten Blick scheint
intuitiv klar, was wir unter einem Begriff verstehen können, etwa
dadurch, dass wir Beispiele und Gegenbeispiele für Begriffe angeben
können, z.B. Baum, Anfang, und, .... Tatsächlich geben wir beim
Kommunizieren aber
nur Worte an. Worte sind aber nur die
"Kleider" der Begriffe. Sie repräsentieren oder bezeichnen
einen Begriff, aber welchen nun genau? Man könnte auch sagen, mit
Worten
rufen wir in unserem Geist, in unserem Gedächtnis, in unserer Erfahrung
Begriffe auf. Aber welche? Wie geschieht das? Wie können wir prüfen,
welcher Begriff sich bei diesem oder jenen Menschen, in dieser oder jener
Situation, mit diesem oder jenem Wort verbindet? Fragen wir nach und ausführlicher,
erhalten wir als Antwort wiederum Worte, so dass sich ein sog. unendlicher
Regress, ein nicht endender Frage- und Wortkreislauf anbahnt. Aus empirisch-
operational- wissenschaftlicher Sicht sind daher vor allem solche Methoden
erwünscht, die nicht nur eine Prüfung gestatten, sondern auch
ein Ende haben. Beispiel: Es bestehe die Aufgabe darin, aus drei Gegenständen,
die blau, rot und gelb sind, einen auswählen. Aus der Wahl lässt
sich bei ehrlichen Probanden schließen, ob z.B. die Begriffe blau,
rot, gelb zur Verfügung stehen. Relativ einfach erscheinen hierbei
Begriffe, die Äußeres, Wahrnehmbares, Zeigbares betreffen. Sehr
viel schwieriger wird es, wenn die Begrifflichkeit von Innerem, Erleben,
Gefühlen oder Stimmungen, Wünschen, Bedürfnissen oder Zielen
zu überprüfen sind.
4.4.2 Fuzzy-Begrifflichkeit
im Alltag. In alltäglichen kommunikativen Situationen begnügt
man sich meist mit einem ungefähren Verständnis, d.h. man prüft
hier meist gar nicht, was gemeint ist, sondern nimmt eine Bedeutung einfach
an. In der Psychodiagnostik und Psychotherapie kann dies sehr problematisch
werden, weil man möglicherweise nur meint, sich zu verstehen. Fragt
man etwa:
Welche Gefühle kennen Sie? und fragt nicht: Welche
Gefühle kennen Sie vom eigenen Erleben her? kann man Antworten
bekommen, die nur den Wortschatz der Gefühle einer Person repräsentieren,
aber nicht das Erleben. Fühlprobleme werden so vielleicht übersehen.
Andererseits ist die Idee reizvoll, dass die Alltagswelt
vielleicht gerade deshalb praktisch funktioniert, weil man sich mit dem
Ungefähren begnügen kann. Man konnte unter 4.1 oben schön
sehen, dass die Dinge vielleicht erst dann richtig schwierig werden, wenn
man sie genau und ausdrücklich zu erfassen sucht. Vielfach gibt es
keinerlei Probleme zu verstehen, was jemand meint, auch wenn viele objekt-
und metasprachliche Ebenen ineinander verschachtelt sind. Erst wenn man
genauer einzudringen versucht, stellt man fest, dass es dann kompliziert
und schwierig werden kann. Kaum ein des Rechnens mächtiger Mensch
hat ein Problem mit den natürlichen Zahlen, jeder weiß, wie
sie aufeinander folgen und wie man ihnen umgeht, zählt und rechnet
- bis man sich fragt: gibt es alle? Und was bedeutet hier alle?
Und was heißt geben? Gibt es Dinge, die sich selbst enthalten?
Gibt es Unvollendbares als Vollendetes? Gibt es Teile eines Ganzen, die
genau so groß sind wie das Ganze?
4.4.3
Entwicklungspsychologie der kognitiven
Schemata (Vorstufe) und des Denkens.
Der Großmeister entwicklungspsychologischer Denkforschung, Jean
Piaget, hat den Denkbegriff der Kinder selbst zum Forschungsgegenstand
gemacht und schreibt in Das Weltbild
des Kindes, S. 43:
- "Der Begriff Denken
Stellen wir uns ein Wesen vor, dem die Unterscheidung zwischen dem Denken und den Körpern völlig fremd ist. Dieses Wesen wird sich seiner Wünsche und seiner Gefühle durchaus bewußt, aber es würde zweifellos einen sehr viel weniger klaren Begriff von sich selbst als wir von uns haben. Es würde sich gewissermaßen als sich selbst weniger innerlich denn wir, als weniger unabhängig von der äußeren Welt empfinden. Daß wir uns bewußt sind zu denken, hebt uns von den Dingen ab. Ein solches Wesen würde aber vor allem ein ganz anderes psychologisches Bewußtsein als wir haben. Die Träume zum Beispiel würden ihm als ein Einbruch des Äußeren in das Innere erscheinen. Die Wörter wären an die Dinge gebunden, und das Sprechen wäre eine direkte Aktion auf die Körper. Umgekehrt wären die äußeren Körper nicht so materiell : sie wären von Absichten und von einem Willen durchdrungen.
Wir möchten zeigen, daß das die Wirklichkeit des Kindes ist. Das Kind weiß noch nichts von der Besonderheit des Denkens, noch nicht einmal in dem Stadium, wo es sich von den Aussagen der Erwachsenen zum „Geist", zum „Gehirn", zur „Intelligenz" beeinflussen läßt,
Unsere Technik, das Kind zu befragen, läßt sich folgendermaßen kurz beschreiben. Man fragt: „Weißt du, was das ist, ,denken'? Wenn du hier bist und du an dein Haus denkst, oder wenn du an die Ferien denkst, oder an deine Mama, weißt du, was das ist, an etwas denken?" Sobald das Kind begriffen hat, worum es geht, fährt man fort: „Also! Womit denkt man?" Falls das Kind die Frage nicht erfaßt, was selten vorkommt, so entwickelt man den Gedanken: „Wenn du gehst, dann gehst du mit den Füßen. Also! Wenn du denkst, womit denkst du?" Man fragt, wie die Antwort auch ausfällt, weiter, um sich zu vergewissern, was hinter den Wörtern der Antwort steht. Zum Abschluß fragt man, wie das wäre, wenn man den Kopf öffnen könnte, ohne daß man dabei sterben würde, ob man dann das Denken sehen oder berühren oder mit den Fingern abtasten usw. könnte. Diese letzten Fragen, die Suggestivfragen sind, müssen für das Ende aufgespart werden, das heißt für den Zeitpunkt, da das Kind nicht mehr dazu zu bringen ist, von selbst zu sprechen."
Ruch & Zimbardo berichten in ihrem Lehrbuch (1976, S. 176):
- "Konzeptentwicklung während der Kindheit
Wenn wir wissen wollen, ob ein Kind ein bestimmtes Konzept gebildet hat, so können wir ihm unbekannte Objekte darbieten und sehen, ob es diejenigen identifizieren kann, zu denen das Konzept paßt. Nehmen wir z. B. an, daß ein Kind lernen soll, Gras mit „grün" zu bezeichnen. Wir wissen, daß es das Konzept „grün" gelernt hat, wenn es die Bezeichnung „grün" auch auf andere Objekte richtig anwenden kann — so z. B., wenn es sagt, daß das Blatt grün ist, aber der Himmel nicht. Es kommt auch Öfters vor, daß ein Kind die verbale Bezeichnung nicht weiß, aber durch seine Handlungen deutlich macht, daß es ein Konzept gebildet hat, d. h., daß es die differenzierenden Merkmale kennt. So kann es z. B. jedesmal schreien und weglaufen, wenn es einen Hund sieht, bei einer Katze aber seine Hand nach ihr ausstrecken. Die Tatsache, daß viele grundlegende Konzepte schon während der frühen Kindheit gelernt werden, weist daraufhin, daß Sprache für die Bildung von Konzepten nicht unbedingt notwendig ist. Die ersten richtigen Worte, die ein Kind gebraucht, bezeichnen gewöhnlich einzelne konkrete Objekte. Die Worte „Hund" oder „Katze" z.B. gebraucht das Kind nur für das zur Familie gehörende Haustier oder ein anderes bestimmtes Tier. Als nächsten Schritt lernt es dann die Kategorien von „Hund", „Katze", „Kuh" usw. und kann dann viele einzelne Tiere in diese Kategorien einordnen. Später lernt es, alle diese Objekte unter dem Oberbegriff „Tier" zusammenzufassen. Diesen Lernprozeß, viele verschiedene Objekte auf Grund einiger gemeinsamer Merkmale Gruppen zuzuordnen, bezeichnet man als „Abstraktion". Je älter und reifer eine Person wird, umso mehr entwickelt und gebraucht sie Konzepte auf einem höheren Abstraktionsniveau — Konzepte wie „Wahrheit", „Schönheit" „Demokratie", „Gerechtigkeit" usw. Die folgende Untersuchung über Abstraktion bei Kindern befaßte sich mit dem Konzept „rund".
Der Apparat bestand aus zwei gleichen Abteilen, in denen sich Reizobjekte befanden. Solange die Abteile von innen her beleuchtet waren, waren die Objekte durch eine Spiegelwand am Vorderteil des Abteils sichtbar. Jedes Abteil hatte vorne eine Öffnung, aus der ein Bonbon kommen konnte, wenn der Spiegel gedrückt wurde. Alle Versuchspersonen wurden einzeln in das Zimmer gebracht und durften mit der Apparatur spielen. Wenn ein Kind den Spiegel des Abteils, das den positiven Reiz enthielt, drückte, ging das Licht aus und es wurde ein Bonbon als Verstärkung gegeben. Die Kinder drückten den Spiegel gewöhnlich spontan; war dies nicht der Fall, wurde es ihnen vom Versuchsleiter vorgemacht. Nachdem die Versuchspersonen gelernt hatten, den positiven Reiz (immer irgendeinen Ball) anstatt des negativen Reizes (nie einen Ball) zu wählen, wurde anhand einer Reihe von Objekten überprüft, ob sie das Konzept „rund" gelernt hatten. Alle Versuchspersonen reagierten auf das Merkmal „rund", indem sie rundliche Objekte öfters wählten und indem sie aus einem Paar von Objekten, die nicht während des Trainings benutzt wurden, immer erst das runde Objekt aussuchten. Für 11 der 13 Versuchspersonen beinhaltete das Konzept „rund" auch zylindrische und andere kugelförmige Objekte. Wenn den Versuchspersonen ein Paar von Objekten, von denen keines ganz rund war, dargeboten wurde, wählten sie jeweils das „rundere". Ältere Kinder lernten besser als jüngere und solche mit höherem Intelligenzalter schneller als solche mit niedrigerem (Long, 1940)."
Kritische Anmerkung: Ein Ball ist nicht nur rund, sondern auch eine dreidimensionale Kugel und etwas, das hüpft, wenn man es wirft und es aufschlägt.
Beispiele einer Kinder-Exploration:
- Weißt Du, was ein Kreis ist oder weißt Du das noch nicht? Dieser Sachverhalt ist einfach zu prüfen: man lässt aus zwei Mengen mit verschiedenen Objekten (eine mit Kreis, die andere ohne) auswählen oder man lässt einen zeichnen.
- Weißt Du, wozu man Namen braucht? Kinder haben mit der Beantwortung dieser Frage weniger Probleme als Erwachsene, weil sie ursprünglicher und direkter denken, wenn sie z.B. einfach sagen: Namen braucht man, damit man gerufen werden kann.
- Kennst Du schon die Farben? Auch diese Prüfung ist einfach, indem man sich Farben aufzählen, zeigen oder zuordnen lässt.
- Kannst Du schon zählen? Da habe ich vor kurzem ein Kind (3;3) gefragt, ob es schon bis fünf zählen könne. worauf ich folgende Aufzählung erhielt: „1, 2, 5, 13, 14“. Diese Antwort ist wenigstens zweideutig, denn es sind fünf Zahlen genannt, aber nicht die ersten fünf in der üblichen Reihenfolge.
- Kannst Du mir sagen, was ein Satz ist? Darauf dürfte kaum ein Kind, das nicht schon 1-2 Jahre zur Schule geht, eine Antwort geben können. Hingegen ist es gut möglich, dass ein Vorschulkind aus verschiedenen Vorgaben einen Satz identifizieren kann.
Material Kritik Piaget [Quelle:
Tücke, M. 2007, S. 211]:
4.4.4 Methoden der Begriffsforschung (eigene Überlegungen)
4.4.4.1 Charakterisieren, Be- und Umschreiben lassen: Was fällt Ihnen zu B. ein?
4.4.4.2 Synonyme finden
4.4.4.3 Antonyme finden
4.4.4.4 Assoziieren
4.4.4.5 Den Begriff B. erklären lassen: was verstehen Sie unter B.?
4.4.4.6 Den B. in Beispielen / Erzählungen verwenden.
4.4.4.7 Gründe angeben lassen, die zur Verwendung des B. führen
4.4.4.8 Definieren lassen: Was genau soll B. Ihrer Meinung nach sein?
4.4.4.9 Referenzieren lassen: Wie und wo kann man in der Welt B., was Sie darunter verstehen, finden?
4.4.4.10 Fragen nach Gebrauchswert und Nutzen: wozu braucht man diesen B.?
4.4.4.11 Gebrauchs- und Textanalysen
Kennen des B.-Sachverhalts
Erfahrungen mit dem B.s.-Sachverhalt
B.-Sachverhalt im eigenen Erleben
_
4.5 Ethnopsychologie und vergleichende Kulturanthropologie des Denkens
Für die Denkpsychologie ist die vergleichende Kulturanthropologie und vergleichende Völkerforschung sehr, sehr wichtig, um die ganze Vielfalt und Entwicklungsvarianten des Denkens in dieser Welt zu berücksichtigen. Leider hat sich in der Wissenschaft hierfür der entwertende Begriff "primitives Denken" eingebürgert, zumal ein allgemein akzeptiertes Messverfahren für Kulturqualität bislang nicht entwickelt wurde. Meist wird daher naiv, unkritisch, egozentrisch und selbstüberheblich die eigene Erfahrung und Kultur als Wert-Basis genommen.
_
4.6. Biologie und Tierpsychologie des Denkens, wie Lebewesen Probleme lösen, etwa der Werkzeuggebrauch (z.B. Köhlers Affenversuche auf Teneriffa).
So wichtig die vergleichende Kulturanthropologie und Völkerforschung ist, so wichtig ist auch, wenngleich sehr schwierig, die biologische und tierpsychologische Forschung zum Denkvermögen der Tiere, das es unzweifelhaft gibt, wie nicht erst die Affenversuche zum Werkzeuggebrauch von Köhler - einem Psychologieprofessor, der gegen die Nazis öffentlich Stellung bezog - überdeutlich nachwiesen.
4.7
Vorschau: Psychische Störungen und Erkrankungen des Denkens.
Aus Unfällen, Kriegsverletzungen und Erkrankungen (z.B. Schlaganfälle,
Schizophrenie, Alzheimer) ergeben sich wichtige Einsichten in die biologischen
Grundlagen und Möglichkeiten von Funktionsstörungen des Denkens.
5 Aufbau und Systematik allgemeiner und integrativer Denkpsychologie
5.1 Aufbau der Basistermini - Entwicklung der Elemente der Denkpsychologie
Die Denkpsychologie wird im folgenden über einfache Bewusstseinsversuche aufgebaut.
Terminologische Konventionen
– Wortverwendungs-Vereinbarungen
Begriffe sind geistige Modelle, mit denen wir denken
und durch Denken miteinander in Beziehung setzen. Die „Kleider“
der Begriffe sind Zeichen, Worte, Sätze oder Texte. Mit Worten, Sätzen
oder Texten drücken wir uns aus, kommunizieren wir. Das Wort „Schokolade“
ist der Name für den Begriff Schokolade, der den Sachverhalt Schokolade
repräsentiert. Weder das Wort noch der Begriff schmecken nach Schokolade,
das tut nur die Schokolade selbst.
_
| Begriffs-Definiton Ein
Begriff ist ein geistiges Gebilde ("Modell") und damit ein originär
und primär psychisches Phänomen. Ein Begriff besteht aus Name
oder Wiedererkennung,
Begriffsinhalt
(der den Sachverhalt beschreibt, um den es geht) und der Referenz,
die angibt, wo und wie man den Begriffsinhalt in der Welt finden kann.
Wird ein Sachverhalt (Figur)
von einer Umgebung (Hintergrund)
unterschieden,
liegt Begriffsbildung vor. Ein Begriff wird gebildet, indem Merkmale (Definiens)
von Sachverhalten erstmals oder wiederholt erkannt (wiedererkannt) werden.
Begriffe können einen Namen erhalten indem ihnen Begriffszeichen (Definiendum
= Name des Begriffs) zugeordnet werden. Allgemein liegt ein Begriff vor,
wenn Zeichen - das können auch Bilder oder Symbole sein - Sachverhaltsbedeutungen
zugeordnet werden. Zu einem wissenschaftlichen Begriff gehört die
Referenzierung,
d.h. Angaben wie und wo man den Begriff in der Welt finden kann. Wichtige
Hilfsmethoden sind Abstrahieren und Generalisieren (verallgemeinern). Beispiele
und Gegenbeispiele erleichtern das Verständnis und fördern Präzision
und Disziplin. Sobald man konkret wird und den abstrakt- allgemeinen Wortgebrauch
verlässt, lassen sich viele Probleme
in Aufgaben verwandeln und vernünftig diskutieren, was leider oft
nicht gemacht wird (>Sprachkritik).
Denkpsychologisch werden zur Begriffsbildung die kognitiven Grundfunktionen unterscheiden und vergleichen, erkennen (Merkmalserfassung, wahrnehmen, Figur und Hintergrund), erinnern (Merkmalsgedächtnis), verbinden (hinzufügen, zu einer Einheit), trennen, (wegnehmen, abstrahieren), benennen (Namensgebung zum Kommunizieren) benötigt. |
Denken und Gedanke
Die Eingangsdefinition hieß: Denken heißt geistige Modell bilden oder zueinander in Beziehung setzen. Ein Gedanke wäre demnach ein geistiges Modell oder eine Beziehung zwischen geistigen Modellen. Sofern die geistigen Modelle oder ihre Beziehungen nicht sprachlich fassbar sind, ist es schwierig darüber zu kommunizieren.
Die Elemente und Ergebnisse des Denkens heißen Gedanken. Steht die Sprache für die Denkanalyse zur Verfügung, so kann man sagen: Einfachste Elemente des Denkens heißen die Zeichen, z.B. die Buchstaben des Alphabets a, b, c ... und die Ziffern 1, 2, 3, .... Die nächst einfachen sind die isolierten Worte (Ein-Wort-Gedanken): Apfel, der, an, oben, Tisch, Rampe, und. Es folgen zwei zusammengesetzte Worte: der Apfel, die Rampe, an oben, ...
Gedanken können sehr komplex sein, wie auch e. Eine Klassifikation ist nicht ganz einfach; sie hängt auch von Zielen und Zwecken ab. Dennoch scheint eine Analyse auch sehr komplexer Gedanken oder Sachverhalte grundsätzlich möglich.
Gedanken über die gewöhnliche Sprache auszudrücken, ist aber nur eine, vermutlich die leichteste Bestimmung. Gedanken sind manchmal unscharf, schemenhaft, undeutlich oder es existieren bei kleinen Kindern oder Tieren nur kognitive Schemata. Auch gibt es für einiges, wenn nicht gar vieles, was wir wahrnehmen oder denken können vielleicht gar keine Worte im Sinne der gewöhnliche Sprache. Man bemerkt es, aber man kann es nicht in Worte fassen, kann es vielleicht nur umschreiben. Hier muss die Denkpsychologie noch einiges leisten.
Grundbegriffe (Gb) führen
wir über Versuche und Beispiele ein. Werden Versuche (V) öfter
gemacht, kann man dies als Übung (Ü) auffassen, wenn es das Ziel
ist, die Fähigkeit, die im Versuch erworben oder verlangt wird, zu
verbessern oder zu festigen. Das kann in psychologisch- psychotherapeutischen
Situationen sinnvoll sein, wenn etwa Bewusstseinslenkung gelernt werden
soll, damit diese Methode in bestimmten Situationen, wo ihre Anwendung
nützlich und hilfreich erscheint, zur Verfügung steht.
Begriffe, die über die Grundbegriffe eingeführt oder entwickelt
werden, nennen wir Eb (entwickelte Begriffe). Analogien, Bilder, Gleichnisse,
Metaphern kennzeichnen wir mit Bm (nach Grundbegriff Typ Metapher) der
ersten Entwicklungsstufe. Begriffe, die aus Begriffen der ersten oder weiteren
Entwicklungsstufen gebildet werden, gehören zur Entwicklungsstufe
i.
- Grundbegriffe rechnen wir demnach zur Entwicklungsstufe 0.
- Aus Grundbegriffen entwickelte Begriffe rechnen wir zur Entwicklungsstufe 1.
- Aus der Entwicklungsstufe 1 entwickelte Begriffe zählen wir zur Entwicklungsstufe 2 usw.
Grundversuch Gv1: Einführung Grundbegriffe Bewusstsein(svorstellung), Bewusstseinsrand, Zentralbewusstsein. Wir stellen uns das Bewusstsein (Gb1) als eine Leinwand (M1) vor, die am Rand (Gb1.1) dunkel (Gb1.1.1) ist und zur Mitte (Gb1.2) hin immer heller (Gb1.2.1) wird. Den dunkleren Teil nennen wir Bewusstseinsrand, das Helle im Inneren das Zentralbewusstsein (Gb1.2). Das Bewusstsein nennen wir leer (Gb1.3), wenn sich im ganzen Bewusstseinsbereich, also weder im hellen Inneren, noch am dunklen Rand etwas befindet.
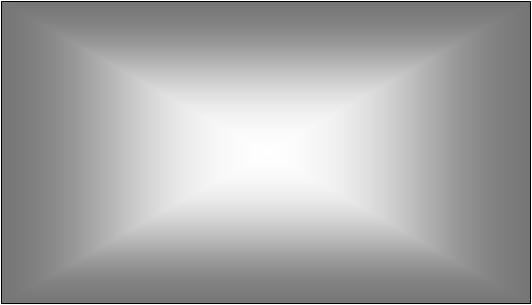
_
Wenn es Ihnen gelingt, sich auf dieses Bild so zu konzentrieren, dass
da nichts anderes ist, wollen wir davon sprechen, dass Ihr Bewusstsein
in diesem Augenblick oder Zeitraum leer ist. Das Außenherum, wenn
denn eines für Sie gerade da ist, können wir als die Welt außen
herum ansehen.
Grundbegriffe Figur und Hintergrund am Bewusstseinsrand
Grundübung Gv2a: Einführung Grundbegriff Bewusstseinsfigur. Sie sehen in Bild-02 nun am Bewusstseinsrand links oben einen grauen Kreis. Wir sprechen nun davon, dass sich in Ihrem Bewusstsein eine Bewusstseinsfigur befindet. Wir nennen diese Bewusstseinsfigur „grauer Kreis“, womit wir dieser Bewusstseinsfigur einen Namen gegeben haben. Diese Bewusstseinsfigur befindet sich zwar am Rand des Bewusstseins, ist aber für die meisten Menschen wahrnehmbar. Was beobachten Sie, wenn Sie nun Ihren Blick auf das helle Zentrum konzentrieren? Was beobachten Sie, wenn Sie näher an das Bild herangehen und sich dabei auf das helle Zentrum konzentrieren?
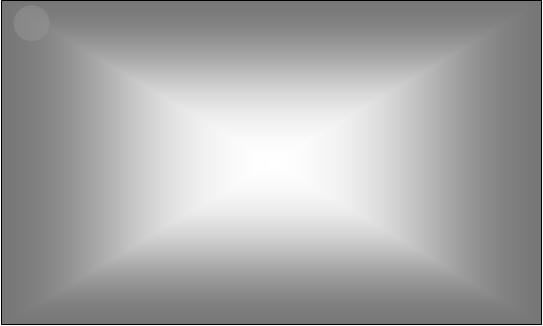
_
Vorschau
Universalien-Beziehung: Zwischen dem Namen "grauer Kreis" und grauen Kreises
selbst gibt es eine, wir nennen sie hier, in Anlehnung an das Konzept der
sog. Universalien,
Universalien-Relation,
d.h. es gibt potentiell unendlich [n+]
viele graue Kreise, die allesamt mit demselben Namen bedacht werden (s.a.
> Fallbeispiel c)
Grundübung
Gv2b:
Verschwinden einer Wahrnehmungsfigur durch Veränderung
der Entfernung. Der Entwickler dieses Versuchs hat bei sich beobachtet,
dass je näher er an das Bild herangeht und je mehr er sich auf die
helle Mitte konzentriert, desto mehr ver-schwindet der kleine graue Kreis.
Die vier vorher klar wahrnehmbaren Strahlen verschwinden und verändern
sich zu einem fleckartigen hellen Gebilde. Er weiß zwar noch, dass
er da ist, aber er nimmt ihn nicht mehr wahr. Wir können daraus für
das Denken folgenden Schluss ziehen. Etwas kann da sein, obwohl es nicht
(mehr) wahrgenommen wird.
Anmerkung: Es ist ein entwicklungspsychologisch
betrachtet beachtlicher Schritt (Objektpermanenz), wenn ein Kind in seine
Denktheorie aufgenommen hat, dass die Gegenstände noch da sind, auch
wenn es nicht mehr hinschaut (nach Piaget Ausbildung zwischen dem 8. und
dem 12. Lebensmonat). Dazu passt das Phänomen, dass Kinder ein Zeit
lang glauben, wenn sie ihre Augen verdecken, andere also nicht mehr
sehen können, dann könnten auch diese sie selbst nicht sehen.
Grundbegriffe Figur und Hintergrund im Bewusstseinszentrum
Grundübung Gv3: Wahrnehmungsfigur im Bewusstseinszentrum. Bei diesem Bild wollen wir davon sprechen, dass der graue Kreis sich im Zentrum des Bewusstseins befindet.
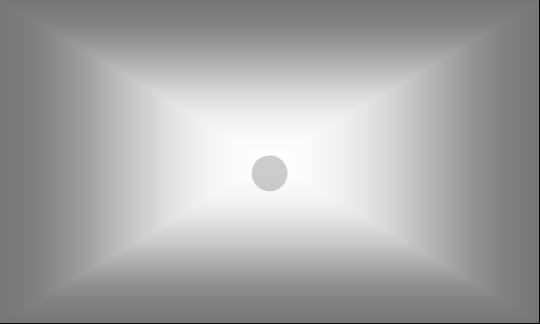
_
Grundübung Gv4
(Vergleichen): Was können wir über die Wahrnehmung im Vergleich
zur vorherigen sagen? Betrachten Sie hierzu abwechselnd
Bild-03
und Bild-02.
Grundbegriffe
Unterscheiden und vergleichen
Wir können nun den Begriff des Unterschiedes und Unterscheidens
einführen. Wir können nämlich sagen, dass sich Bild-01,
Bild-02
und Bild-03 unterscheiden. Den Unterschied stellen
wir hier durch vergleichen des Wahrgenommenen fest. In Bild-01 befindet
sich kein grauer Kreis oben links, in Bild-02 befindet sich ein solcher
oben links und in Bild-03 ist er in das Zentrum gerückt. Ergebnis:
Wir erkennen Unterschiede durch Vergleichen, was nichts anderes bedeutet
als die Wahrnehmung abwechselnd von einem Objekt O1 zum anderen Objekt
O2 auszurichten und nach Gleichem und Ungleichen, d.h. Unterschieden zu
suchen.
Für diesen Vergleich haben wir folgende Hilfsmittel
oder geistigen Modelle benötigt: Bild, Hintergrund, Figur, Rand, grau,
Kreis, oben, links, Zentrum, wahrnehmen, konzentrieren im Sinne von Blick
richten auf …, Mitte, Zentrum, Rand, dunkel, hell, außenherum,
Welt, ...
Grundbegriffe
wegnehmen und hinzufügen
Vergleicht man Bild-02 und Bild-03
kann man sagen, das der kleine graue Kreis aus dem oberen linken Ecke weggenommen
und im Zentrum des Bewusstseins hinzugefügt wurde. Wegnehmen und hinzufügen
lässt sich über viele einfache praktische Versuche mit Alltagsgegenständen
einführen: mit Steinchen, Streichhölzern, Kärtchen, Löffeln,
Bierdeckeln u.v.a.m
Wegnehmen und hinzufügen sind die allgemeinen
Grundbegriffe für ein Weniger oder Mehr erzeugen. Auch die natürlichen
Zahlen lassen sich ganz einfach durch eine Strichliste entwickeln und darstellen,
wobei es aber nach der Anschauung mehrere Typen gibt: Vorgänger
und Nachfolger mit oder ohne Lücken und einzelne Repräsentanten
gleich und oder ungleich in der Breite, was hier nicht vertieft werden
soll, sondern in eine Denkpsychologie der Ausprägungen gehört.
Wegnehmen und Hinzufügen können einmal
als Handlungen zum anderen als Beziehungsergebnisse gedacht werden. Man
kann einen Bierdeckel zu einem anderen durch eine Handlung hinzufügen
und man kann das Ergebnis anschließend betrachten. Das eine bezeichnet
die Handlung, das andere die Beziehungslage als Ergebnis der Wegnahme-
oder Hinzufügungshandlung. Das alles kann problemlos über Vormachen
- direkt oder über Zeichnungen oder ein Video - so gezeigt werden,
dass man sagen könnte, wegnehmen oder hinzufügen ist über
Zeigehandlungen sprachnormiert worden.
Grundbegriff auswaehlen (Auswahl)
Der Auswahlbegriff ist von grundlegender Bedeutung für die Denkpsychologie,
u.a. weil er die Voraussetzung für das Abstrahieren ist (und
Voraussetzung für auswählen sind wohlunterscheidbare Merkmale).
Grundbegriff abstrahieren
Von etwas absehen ist dem wegnehmen sehr ähnlich. Betrachtet man
aus einer Kiste mit bunten Bauklötzchen nur die gelben, falls es solche
gibt, so sieht man von allen anderen andersfarbigen Bauklötzchen ab.
Dadurch wurde eine Abstraktion durchgeführt. (Könnte man auch
abstrahieren, indem man etwas hinzufügt?)
Grundbegriffe Verbinden
und Trennen
Verbinden und Trennen sind Wegnehmen und Hinzufügen ein wenig
ähnlich, wenn Zwischenraum hinzugefügt - die Trennung wird größer
- oder weggenommen wird - die Trennung wird kleiner. Auch hierfür
gibt es zahlreiche einfache praktische Alltagsversuche. Man kann eine Jacke
am Haken aufhängen, dann ist sie mit dem Haken verbunden. Man kann
zwei Würfel oder Kärtchen aneinanderlegen, dann sind sie verbunden
und kann sie wegziegen, dann sind sie getrennt. Man kann die Trennung größer
machen, indem man den Abstand oder Zwischenraum vergrößert.
Auch die psychologische Verbindung oder Trennung kann direkt physikalisch
ausgedrückt werden durch Nähe- (aufeinander zugehen, umarmen)
und Trennungshandlungen (Umarmung lösen, voneinander weggehen). Mit
den beiden Grundbegriffen verbinden und trennen kommen auch die Grundbeziehungen
"verbunden mit" und "getrennt von" ins Spiel.
Grundbegriffe Teil und
Ganzes
Man kann Teile zu einem Ganzen zusammenfügen, wodurch etwas Neues
entstehen kann. So kann man etwa vier kleine Quadrate so zusammenfügen,
dass ein vier mal so großes Quadrat entsteht, z.B. aus 4.1 wird durch
vierfaches Hinzufügen 4.4. 4.3 entsteht aus dreimal 4.1 und
einmal 4.2.
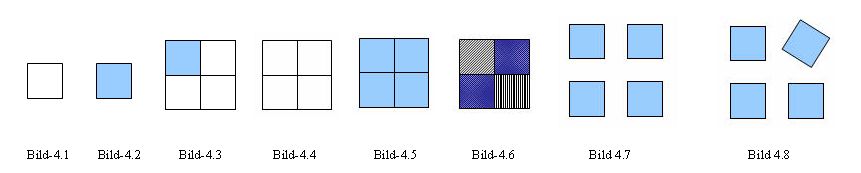
Jedes der 8 Bilder gleicht jedem und jedes ist unterscheidbar von jedem.
Jedes der Bilder besteht aus Quadraten. 4.1 und 4.2 unterscheiden sich
in der Füllung und scheinen der Größe nach gleich. Man
kann die Quadrate unterschiedlich zusammenfügen, man kann Zwischenräume
(4.7; 4.8) lassen oder nicht (4.3; 4.4; 4.5; 4.6).
In bezug auf den Menschen kann man Teil und Ganzes
sehr schön über die Körperteile demonstrieren: Kopf, Hals,
Rumpf, Arme, Hände, Beine, Füße können als Teile des
ganzen Körpers angesehen werden. Auch dass es unterschiedlich umfängliches
Ganzes gibt lässt sich am Körper gut zeigen: Finger und Hände;
Zehen und Füße; Nase, Mund, Augen, Ohren, Stirn, Wangen, Kinn,
Haare oder Kopfhaut und Kopf.
Teil und Ganzes stehen in einer gewissen Beziehung,
indem die Teile zum Ganzen gehören. Damit wird auch die wichtige grundlegende
Beziehung "gehören zu" in ihrer spezifischen und problematischen Bedeutung
enthalten
sein angesprochen, der eine eigene Studie gewidmet wird.
Erhaltung des Ganzen
Man kann in einem Ganzen Teile verändern, etwa durch verschiedene
Anordnung oder Lagen, ohne dass Teile weggenommen oder hinzugefügt
werden. So kann man etwa sagen, das Ganze in Bild 4.7 und Bild 4.8 bleibt
erhalten, obwohl die Bilder "ganz" ;-) unterschiedlich aussehen. Das rechte
obere Teil-Quadrat in Bild 4.8 wurde gedreht, ob von links nach rechts
oder umgekehrt kann man dem Bild nicht ansehen, auch nicht wie oft gedreht
wurde. Sucht man die 8 Bilder zu klassifizieren, so fallen wohl den meisten
auf Anhieb drei Gruppen auf: I. (4.1, 4.2); II. (4.3 - 4.6) und III. (4.7,
4.8).
Biegt man ein Blatt, so sieht es anders aus. Aber
es ist noch ganz. Es ist auch noch dasselbe, doch ist es noch das Gleiche?
Was hat sich verändert? "Nur" die Form.
Anmerkung: In der Entwicklungspsychologie
des Denkens sind hier Begriff wie (Objekt-) Konstanz, Invarianz und Permanenz
angesprochen, z.B. die berühmten Volumenkonstanz-Versuche von Piaget.
Grundbegriff tauschen
Nimmt man an, dass der kleine graue Kreis in Bild-02
und Bild-03 derselbe ist, so kann man sagen, er
hat seinen Ort getauscht. Den Ort tauschen bedeutet auch, dass dasselbe
Objekt nicht zugleich an zwei oder mehr verschiedenen Orten sein kann.
Das ginge nur mit Kopien. Beim Tauschen wird Mehr oder Weniger nicht verändert.
Man kann sagen: verändert ein Gegenstand als Teil eines Ganzen nur
seine Lage innerhalb des Ganzen, so bleibt der Inhalt gleich.
Grundbegriffe Lage und Ort
Die Worte Lage und Ort werden manchmal gleichbedeutend verwendet, manchmal
auch nicht. "Er saß auf seinem Bett" bezeichnet eine andere
Lage als die Aussage, "er lag in seinem Bett". Während der
Ort Bett in beiden Aussagen denselben bezeichnet, sind beide Lagen verschieden,
nämlich
sitzen und liegen. Orte und Lagen setzen Bezugssysteme
voraus, oft werden sie als vertraut und "normal" unterstellt.
Grundbegriff das Gleiche
Kopiert man eine Figur A, so dass es nun zwei Figuren A1 und A2 gibt,
so können wir sagen, die beiden Figuren sind gleich. Für die
Wahrnehmung sind sie aber nicht mehr gleich, wenn wir uns auf eine der
beiden konzentrieren. Wir schließen daraus: die Dinge können
sich in ihrer Erscheinung durch die Wahrnehmungsrichtung ändern. Für
unser Denken und Wissen sind die Figuren aber gleich. Daraus können
wir den weiteren Schluss ziehen: Objekte, die in der Wahrnehmung verschieden
erscheinen, können für das Wissen oder Denken gleich sein. Das
Phänomen ist in der Allgemeinen Psychologie unter Wahrnehmungskonstanz
bekannt. Konstanz- und Permanenzphänomene spielen in der kognitiven
und Denkpsychologie eine wichtige Rolle. Noch weiter gedacht: Gleiches
kann viele Erscheinungsformen annehmen. Einer der einfachsten Versuche
ist hierzu, den Hintergrund oder die Perspektive für eine gleiche
Figur zu verändern. Dies weist nun auf den Veränderungsbegriff.
Grundbegriffe
Dasselbe und das Gleiche
Was ist die Idee Desselben im Unterschied zum Gleichen?
Ist eine solche Unterscheidung sinnvoll? Haben wir zwei Autos A1 und A2
gleichen Typs, Baujahrs und Erscheinung, so sagen wir im allgemeinen, die
beiden Autos A1 und A2 seien gleich, aber dasselbe ist nur jedes einzelne
für sich: A1 gleicht A2, aber A1 ist nicht A2 und natürlich auch
nicht umgekehrt. Für beliebige natürliche Zahlen n>0 gilt n-(n-1)
= 1. Soll die Differenz 17-16 verglichen mit 5-4 die gleiche oder dieselbe
heißen? Jeder Mensch ändert sich ununterbrochen, schon dadurch,
dass er älter wird. So lange er gesund, wach und im Besitz seiner
Geisteskräfte ist, wird er sich immer als ein und derselbe Identische
fühlen, obwohl er sich verändert. Er braucht keinen Pass, um
zu wissen, wer er ist. Wie kann man das verstehen? Obwohl er nicht einmal
mehr der Gleiche ist, fühlt er sich doch als derselbe?
Eine Idee der Identität bedeutet das Unveränderliche,
Bleibende, Konstante - eine Auffassung, die schon vor langer Zeit verworfen
wurde: Heraklit meinte "alles fließt" und man könne nicht zwei
Mal in denselben Fluß steigen [W]
und das folgende Zitat trifft den Sachverhalt ziemlich genau: „Wir steigen
in denselben Fluß und doch nicht in denselben, wir sind es und wir
sind es nicht.“
Gibt es schon das Gleiche streng betrachtet wahrscheinlich
nur idealisiert und gedacht, so dürfte es in der Wirklichkeit meist
nur näherungsweise vorkommen. Nicht so vom praktischen Standpunkt
aus gesehen: hier können viele Sachverhalte als "praktisch" gleich
gewertet werden. Gleich heißt also wirklich gleich oder die Abweichungen
vernachlässigend. Das gilt auch für viele Handlungen, die man
hinsichtlich ihres funktionellen Ergebnisses als "gleichwertig" ansehen
kann.
Man kann sagen, dass Identität dadurch entsteht,
wenn ein Sachverhalt als Individuum angesehen wird. Identität hat
nichts mit Gleichheit zu tun. Man kann auch Gleiches mit unterschiedlichen
Identitäten ausstatten. Identität erfordert, dass man Individualität
erkennen und damit von anderem unterscheiden kann. Nach diesen Überlegungen
erscheinen Gleichheit und Identität als Gegensätze. Gleich sein
zu erkennen bedeutet gerade vom Individuellen, Einmaligen, Einzigartigen
abzusehen. Wenn sich aber alles ununterbrochen verändert, wie kann
man dann die Identitätskonstanz erkennen? Wenn sich etwas aufgelöst
hat, nicht mehr existiert, wo ist dann die Identität? Auch nicht mehr
existent, aufgelöst, vergangen?
Grundbegriffe
ordnen, anordnen, umordnen
Ordnen und Ordnung sind sehr wichtige Grundbegriffe der Wahrnehmung
und des Denkens. Vor, nach, Vorgänger, Nachfolger, links, rechts,
oben, unten, innen, außen, zwischen, größer, kleiner,
gleich. Einen sehr allgemeinen Begriff der Ordnung bei den natürlichen
Zahlen haben die Mathematiker, wenn jede Permutation eine Ordnung definiert,
etwa für n=1,2,3: 123, 132, 213, 231, 312, 321. Aber in dieser Ordnung
verstecken sich noch ein paar andere Voraussetzungen.
Grundbegriffe
Verändern, Bearbeiten, Gestalten
Verändern bedeutet Elemente wegnehmen, hinzufügen, anders
zu gestalten oder anders anzuordnen. Die natürlichsten Veränderungen
sind die in oder mit der Zeit. Die Zeit fließt unaufhaltsam dahin
und sie vergeht sozusagen unerbittlich. Objekte können im Verlauf
einer Zeitspanne relativ zu einem Betrachtungsfilter gleich erscheinen
oder verändert.
Grundbegriffe Form und
Gestalt
Form und Gestalt können als Grundbegriffe des Wahrnehmens und
des Denkens angesehen werden, die oft der Identifikation von Objekten dienen.
Sie können leicht operational durch Zeichnung oder Modellkörper
eingeführt und so sprachnormiert werden.
Begriffseinführungen
Be
Mit dem Kürzel „Be“ kennzeichnen wir eine Begriffseinführung.
Eine Begriffsseinführung Be benutzt durch Versuche eingeführte
Grundbegriffe oder benutzt schon eingeführte Begriffe. Im Prinzip
sollte jeder wissenschaftliche Terminus lückenlos aus den Grundbegriffen
oder / und schon eingeführten Begriffen herleitbar sein und verstanden
werden können.
Anmerkung: Die Erlanger Schule der
Philosophie um Kamlah & Lorenzen hatte einen systematischen Begriffsaufbau
der Wissenschaften in Angriff genommen.
Be Wahrnehmungsschwelle
Sind zwei Figuren oder eine Figur gegenüber einem Hintergrund
nicht unterscheidbar, obwohl es sie gibt, so wollen wir davon so sprechen,
dass wir sagen, der Unterschied liegt unterhalb unserer - individuell unterschiedlichen
- Wahrnehmungsschwelle.
Be Lenken und Bewusstseinslenkung
Wenn Sie die Instruktionen befolgen konnten, so wollen wir daraus den
Schluss ziehen, dass Sie Ihr Bewusstsein lenken können. So konnten
Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Bild-01 richten, anschließend auf Bild-02
und Bild-03 und schließlich haben Sie die Bilder 01-03 miteinander
verglichen.
Grundbegriff Vorgang verstehen.
Grundbegriffe Ursache, Wirkung, Kausalität verstehen.
Grundbegriffe wesentlich - unwesentlich
verstehen.
5.2 Die Unterscheidungen im Erleben und die Bewusstseinselemente
5.2.1 Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen verschiedenen Erlebensstufen:
- das Erleben, wie es in uns stattfindet.
- das Erleben wie es subjektiv erlebt wird.
- das Erleben, wie es bewusst erkannt wird. Hier kommt das Denken ins Spiel, etwa wenn wir ein Gefühl erkennen und mit einem Namen belegen, z.B. Freude, Lust oder Angst. So gesehen wird verständlich, dass kommunizierbare Bewusstseinsinhalte auch mit denken bezeichnet werden, obwohl ihr ursprünglicher und primärer Gehalt z.B. affektiver Natur ist. Einem Affekt, einer Befindlichkeit, einem Wunsch, Bedürfnis, Gefühl oder einer Stimmung einen Namen geben, bedeutet dass Denken zum Affekt hinzugekommen ist, genauer: identifizierendes, erkennendes Denken.
- das Erleben, wie es anderen gegenüber zum Ausdruck gebracht, also kommuniziert werden kann. Hier wird die Sprache benötigt.
- das Erleben, wie es von anderen aufgefasst und verstanden wird. Sprechen wird über das Erleben eines anderen, sollten wir dies sprachlich als Eindruck formulieren.
Nicht alles, was in uns stattfindet, wird auch subjektiv erlebt.
Nicht alles, was subjekt erlebt wird, wird vom Bewusstsein
erkannt. Nicht alles, was vom Bewusstsein als subjektives Erlebnis erkannt
wird, kann auch ausgedrückt und kommuniziert werden. Nicht alles,
was ausgedrückt und kommuniziert werden kann, wird auch so verstanden
wie es gemeint ist.
Richtet oder verdichtet sich unsere Aufmerksamkeit auf einen Bewusstseinsinhalt, so stellt die Frage: um was für einen Bewusstseinsinhalt handelt es sich? Fokussiere ich auf eine Wahrnehmung, versuche ich etwa zu hören, was sich im Treppenhaus abspielt, oder was im Hof los ist? Versuche ich, die Nachrichten zu hören? Bemerke ich ein Ziehen im Bein, eine Missempfindung im Rücken oder eine Spannung in den Gliedern?
5.2.2 Überblick über mögliche Bewusstseinsinhalte oder Bewusstseinsfiguren
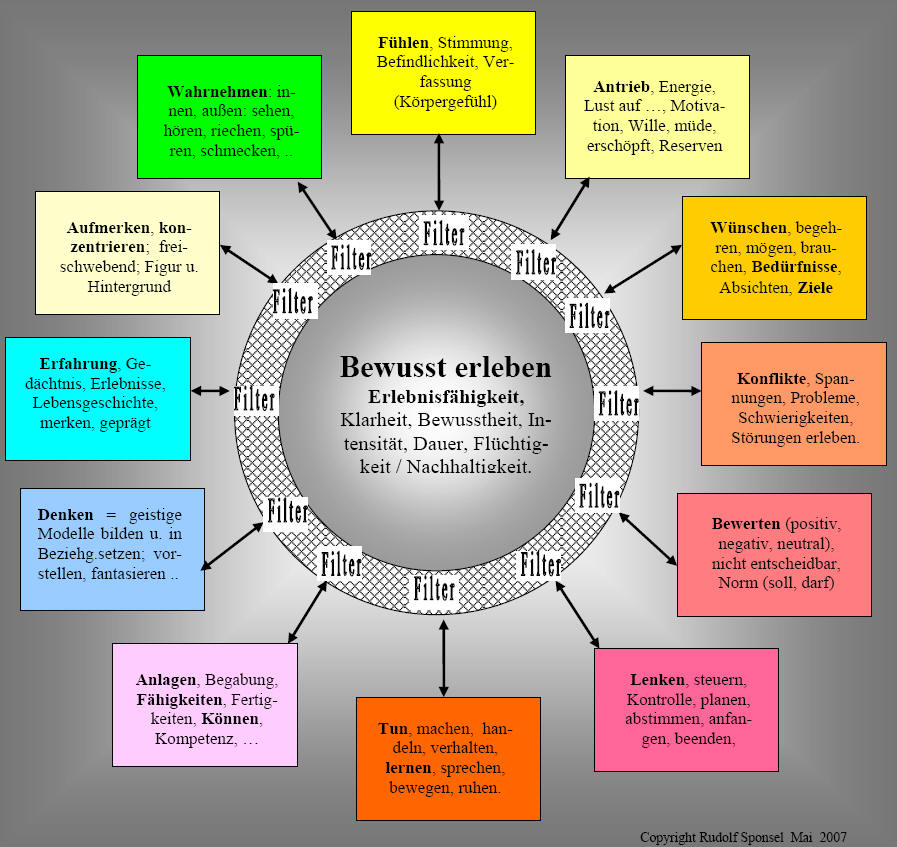
Anmerkung Brentano: Die Konzeption der Funktionseinheiten findet sich schon bei Franz Brentanos (1874) "Psychologie vom empirischen Standpunkt" - ein Buch zu einer angeblich empirischen Psychologie, die ohne Experiment, Beobachtung, Exploration, Protokolle ... auskommt (> Vorurteile der Nur-Denker-Zunft), im Grunde eine Paradoxie - wenn er Z. im Ersten Band, S. 8 ausführt:
- "Unter Seele versteht nämlich der neuere Sprachgebrauch
den substantiellen Träger von Vorstellungen und anderen Eigenschaften,
welche ebenso wie die Vorstellungen nur durch innere Erfahrungen unmittelbar
wahrnehmbar sind, und für welche Vorstellungen die Grundlage bilden;
also den substantiellen Träger einer Empfindung z. B. einer Phantasie,
eines Gedächtnisaktes; eines Aktes von Hoffnung oder Furcht, von Begierde
oder Abscheu pflegt man Seele zu nennen. [FN4 Hrsg.] Auch wir gebrauchen
den Namen Seele in diesem Sinne. Und es scheint darum nichts im Wege zu
stehen, wenn wir, trotz der veränderten Fassung, den Begriff der Psychologie
auch heute noch mit den gleichen Worten wie einst Aristoteles bestimmen,
indem wir sagen, sie sei die Wissenschaft von der Seele."
5.2.3
Normierung der verschiedenen Bewusstseinsinhalte oder Bewusstseinsfiguren
Normieren hört sich schrecklich bürokratisch, für manche
sogar regelrecht abstoßend, an. Es heißt hier aber nur, dass
man versucht, Standardsituationen zu finden, die eine hohe Gewähr
dafür bieten, dass der gemeinte Bewussstseinsinhalt, auch tatsächlich
erlebnisnahe erkannt und wiederbelebt wird. Manchmal genügt es hierzu,
sich Erfahrungen und Situationen der Vergangenheit ins Bewusstsein zu rufen.
Aber auch gezielte Fantasien und gelenkte Tagträume können hierbei
hilfreich sein. Die wichtigsten Bereiche sind:
- Antrieb (Betätigungslust, Energie, Kraft, Wille, Motivation, Aktivitätsdrang).
- Aufmerken (auswählen, auswählen, richten, verdichten, konzentrieren)
- Bewerten (gut, schlecht, nützlich, richtig, falsch, un/ angemessen, schön, interessent, wertvoll, schädlich ...)
- Denken (geistige Modelle bilden und zueinander in Beziehung setzen; Begriff, Sachverhalt, Problem lösen, vorstellen, phantasieren, tagträumen)
- Erfahrung (erinnern, aktivieren, gelernt, angeeignet, erlebt, erfahren)
- Fühlen (Stimmung, Befinden; positiv: Lust, Freude, Interesse, Wohlbehagen, Zufriedenheit, Stolz; negativ: Angst, Enttäuschung, Ärger, Trauer)
- Konflikte (Zweifel, Hemmungen, hin- und hergerissen, Spannung, ...)
- Lenken (anfangen, dabei bleiben, unterbrechen, fortsetzen, prüfen, kontrollieren, aufhören und beenden).
- Tun (machen, handeln, verhalten) oder Lassen (nicht tun, sein lassen)
- Wahrnehmen (nach außen: sehen, hören, riechen, schmecken; nach innen: empfinden, spüren, Spannung, Entspannung).
5.3 Praktisch-Systematische und psychotherapiepraxisrelevante Konzeption der Denkpsychologie
In den meisten Psychotherapien ist die Sprache das wesentliche Medium, um Erleben und Verhalten zu untersuchen und zu verändern. Es ist daher sehr wichtig, dass man sich - wirklich - versteht. Daher stellt sich in nahezu jeder Psychotherapie natürlich die Grundfrage: wie kann den PatientInnen geholfen werden, über ihr Erleben und Verhalten so zu sprechen, dass die Psychotherapie wirken kann und gut vorankommt? Die folgende Bewusstseinsinhaltsanalyse ist analytisch-künstlicher Natur, d.h. mit Hilfe der Vernunft, Erfahrung und Wissen konstruiert.
Einige Stichworte:
- Die Registrationsfunktion des Bemerkens eines Erlebnisinhaltes (Erlebnisfigur) gehört zuerst nicht zum Denken, sondern zur Aufmerksamkeits- und Bewusstseinslenkung, die durch das Motivations- und allgemeine Lenkungssystem bestimmt sind.
- Auswahlfunktion. Sobald etwas bemerkt wird, stellt sich für die Bewusstseinlenkung die Frage, ob das eben Bemerkte stärker in den Brennpunkt des Bewusstseins vorrücken soll oder nicht, was im letzeren Fall dann hieße, es wird an den Rand des Bewusstseins gedrängt, verharrt dort oder verschwindet wieder - mit oder ohne Spuren im Gedächtnis (was, wann und wie im Gedächtnis Spuren hinterlässt ist eine Frage der Gedächtnisforschung).
- Erkennensfunktionen des Denkens. Hier gibt es enge - mir noch nicht klare - Zusammenhänge zum Gedächtnis und zur Wahrnehmung. Wahr-nehmen kann im Sinne von erkennen gedeutet werden.
Das Hauptproblem der Denkforschung ist es, dass das Denken teilweise
nicht bewusst, schwer wahrzunehmen ist und meist sehr schnell erfolgt.
Aber auch die bislang von der Denkpsychologie zur Verfügung gestellten
Begrifflichkeiten und Modelle erscheinen nicht sehr forschungs- und praxistauglich.
Geht man von einer Bewusstseinseinheit aus, die Frage scheint mir wissenschaftlich
noch nicht geklärt, scheint es zudem so als wäre es nicht möglich
zu denken und zugleich dieses Denken meta-zu-denken. Das ist der Kern des
alten und im Prinzip noch aktuelle Streites um die Introspektion. Es gibt
aber einige gute Gründe für die Möglichkeit, dass meta-denken
geht: Wir scheinen nämlich - wenigstens gelegentlich - zu merken,
ob wir richtig denken oder nicht, ob wir vorwärts kommen oder
nicht, ob wir an einem Problem hängen oder nicht. Das alles sind Metaphänomene.
Aber es ist nicht klar: stellen diese sich nach dem Denken ein oder schon
während des Denkens. Noch nicht richtig gedacht wurde die Möglichkeit,
dass das Bewusstsein aus mehreren hierarchischen Ebenen besteht oder dass
mehrgleisiges denken ("multi-thinking" analog "multi-tasking") gehen kann,
obschon wir durch die Hypnoseforschung und Hypnosepraxis eigentlich darauf
eingestellt sein sollten, dass das Bewusstsein mehrere Formen annehmen
kann. Auch das Phänomen mehrfach in- oder hintereineinandergeschachtelter
Erlebnisketten geht in die genannte Richtung: ich nehme wahr - ich denke
über die Wahrnehmung nach - ich nehme wahr, was ich denke - ich denke
weiter - ich merke ich komme nicht vorwärts. Was ist das, wenn ich
wahrnehme, was ich denke oder eröffnet diese Frage nur ein neues Scheinproblem?
Das Denken scheint auch ganz unterschiedliche Klarheit und Schärfe
annehmen zu können. Meist erscheint es wenig greifbar, diffus, ungefähr,
flüchtig, schnell. Eine gute Metapher sind unklare, unscharfe und
flüchtige Wahrnehmungen, die durch Fokussierung und Konzentration
an Klarheit und Schärfe gewinnen können. Man kann nun verschiedene
Modelle entwickeln, um die Bewusstseinsvorgänge und speziell das Denken
zu untersuchen. Hierbei kann man drei Ausgangspunkte unterscheiden.
- Das Subjekt befindet sich im Zustand freischwebender Aufmerksamkeit und wendet sich keinen besonderen Bewusstseinsinhalten zu. Es fließt, kommt, geht, zieht vorüber, bleibt, verschwindet, verändert sich oder nicht.
- Die Aufmerksamkeit verweilt mehr bei einem Bewusstseinsinhalt und wählt ihn damit zu einer Bewusstseinsfigur aus. Das Subjekt befindet sich im Zustand gelenkter oder zielgerichteter Aufmerksamkeit für ein besonderes Thema.
- Verdichtet sich die zielgerichtete Aufmerksamkeit, sprechen wir auch von Konzentration. Da s ist der Fall, wenn man versucht, den Typ der Bewusstseinsfigur näher zu klären und grob einzuordnen: Wahrnehmung, Gefühl, Stimmung, Empfindung, Erinnerung, Vorstellung, Phantasie, Tagtraum, Wunsch, Bedürfnis, Plan, Ziel, Konflikt, ...?
Diese hinführenden Vorüberlegungen erlauben nun, ein realistisches
und praxistaugliches 7-Phasenmodell zu entwerfen:
Ein
7-Phasen-Modell einfacher Bewusstseinsvorgänge bei freischwebender
Aufmerksamkeit
- 1. Phase: Zustand freischwebender Aufmerksamkeit ohne besondere Fokussierung. Man erlebt alles Mögliche, ohne bei einem Bewusstseinsinhalt besonders zu verweilen, geistige Objekte steigen auf und verschwinden wieder, man bemerkt mal dieses, mal jenes, ohne es besonders zu fokussieren.
- 2. Registrieren und bemerken. In dieser Phase ist die entscheidende Frage, welche der registrierten und bemerkten Bewusstseinsfiguren für eine nähere Betrachtung ausgewählt werden.
- 3. Phase: Auswahl nach Bemerken einer Bewusstseinsfigur (da ist etwas) und richten bzw. sogar verdichten der Aufmerksamkeit auf diese Bewusstseins-Figur (bewusstes auswählen). Erstes, grobes, ungefähres klassifizieren. Aufmerksamkeit richten, zuwenden und gegebenenfalls verdichten (konzentrieren) auf eine Bewusstseinsfigur.
- 4. Phase: Klären und grobe Einordnung der Bewusstseinsfigur zu einer (Haupt-) Erlebniskategorie. Nach erfolgreicher Klärung kann der Bewusstseinsinhalt identifiziert oder erkannt werden:
- 5. Phase: Identifikation der Bewusstseinsfigur (erkannt). Das kann durch einen Namen, eine Charakterisierung, oder kennzeichnende Um- oder Beschreibung erfolgen. Mit der Identifikation hat die Bewusstheit ihren Höhepunkt erreicht. Und es stellt sich nun die Frage, ob mit dem identifizierten Bewusstseinsinhalt weiter gearbeitet werden soll:
- 6. Phase: Weiterverarbeitung mit der identifizierten Bewusstseinsfigur weiter machen? Welche Weiterverarbeitungen schließen sich nun an? Was taucht als nächstes auf?
- 7. Phase: Der kognitive Strang kommt nach einer Weile mit diesem oder jenem (Zwischen-) Ergebnis zu einem (vorläufigen) Ende.
Methodische
Anleitungsskizze zum 7-Phasen-Modell einfacher Bewusstseinsvorgänge
(1) Freischwebende Aufmerksamkeit. Versetzen Sie sich bitte in einen Zustand gleichschwebender Aufmerksamkeit. Lassen Sie die Bewusstseinsinhalte kommen und gehen, wie sie wollen. Greifen Sie nicht ein. Lassen Sie geschehen. Versuchen Sie zunächst nicht, sich einem Bewusstseinsinhalt besonders zuzuwenden. Lassen Sie bitte einfach nur geschehen und Ihr Bewusstsein treiben, wie es gerade mag. Alles oder auch gar nichts darf kommen, bleiben oder wieder gehen. Versuchen Sie keinerlei Einfluss zu nehmen. Seien Sie nur ein Beobachter Ihrer Bewusstseinsvorgänge. Es spielt an dieser Stelle keinerlei Rolle, welche Bewusstseinsinhalte auftauchen, verweilen, sich verändern, wieder gehen oder nicht. Hierzu ist es wichtig, typische und wiederkehrende Erlebnisinhalte zu unterscheiden.
(2) Bemerken,
abrufen oder Erzeugen einer Bewusstseinsfigur aus dem Hintergrund oder
der Vielfalt der Bewusstseinsinhalte
Während in Ihrem Bewusstsein diese oder jene Figuren mehr oder
minder schemenhaft, flüchtig, so oder so auftauchen, kurz da bleiben,
wieder in den Hintergrund treten oder hin und wieder auch wieder zum Vorschein
kommen, bemerken Sie mehr oder weniger grob, was da alles erscheint und
vorüberzieht. Aus diesem flüchtigen und schemenhaften Bewusstseinsstrom
haben Sie vielleicht das eine oder andere bemerken oder registrieren bemerken
können. Diese Übungen können Sie systematisch auf verschiedene
Weisen durchführen, z.B.:
Übungsvariante-1: Damit äußere visuelle
Wahrnehmungen nicht stören können, schließen Sie bitte
für ungefähr eine Minute lang die Augen und lassen den Bewusstseinsstrom
vorüberziehen. Nach einer Minute versuchen Sie sich bitte zu erinnern,
was Sie bemerkt und registriert haben.
Übungsvariante-2: Damit äußere visuelle
Wahrnehmungen nicht stören können, schließen Sie bitte
für ungefähr eine Minute lang die Augen und nehmen sich z.B.
ein Tonaufnahmegerät. Sehen Sie sich bitte ein wenig wie einen Reporter,
der Ihren Bewusstseinsstrom beobachtet, und geben Sie hin und wieder an,
was Sie gerade bemerkt haben.
Übungsvariante-3: Legen Sie sich ein Blatt
Papier vor sich hin. Notieren Sie stichwortartig, was Sie in Ihrem Bewusstseinsstrom
bemerkt haben.
(3)
Auswählen
und Richten der Aufmerksamkeit auf die bemerkte Bewusstseinsfigur, wodurch
zugleich ein erstes, grobes Klassifizieren stattfindet.
Versuchen Sie, eine Bewusstseinsfigur festzuhalten und näher zu
klären, was sie für ein Typ ist. Hierbei können Sie z.B.
auf folgendes Bewusstseinsfigurtypen-Angebot zurückgreifen, wenn Sie
versuchen, die eine oder andere Bewusstseinsfigur nach ihrem Typus näher
zu klären: Wunsch, Bedürfnis, Gefühl, Stimmung, Befindlichkeit,
Gedanke, Erinnerung, Phantasie, (innere) Empfindung, (äußere)
Wahrnehmung, Konflikt, Körperregung, Vorsatz, Vorstellung, Plan, Frage,
Aufgabe, Einfall (Idee), Irritation (Störung), Entscheidung, Entschluss,
Handlungsimpuls, Handlungshemmung.
_
(4) Näheres
Klären der ausgewählten und grob klassifizierten Bewusstseinsfigur.
Bewusstseinsinhalte werden mit Hilfe der Erfahrungen, die im Gedächtnis
gespeichert sind und des Denkens geklärt. Die zum näheren Klären
ausgewählte Bewusstseinsfigur wird näher untersucht, bestimmt,
ein- und abgegrenzt und dadurch mehr und mehr geklärt.
- Falls es ein Wunsch ist: was ist das für ein Wunsch?
- Falls es ein Bedürfnis ist, was ist das für ein Bedürfnis?
- Falls es ein Gefühl ist, ist, was ist das für ein Gefühl?
- Falls es eine Stimmung ist, was ist das für eine Stimmung?
- Falls es eine Befindlichkeit ist, was ist das für eine Befindlichkeit?
- Falls es ein Gedanke ist, was ist das für ein Gedanke?
- Falls es eine Erinnerung ist, was ist das für eine Erinnerung?
- Falls es eine Phantasie ist, was ist das für eine Phantasie?
- Falls es eine (innere) Empfindung ist, was ist das für eine Empfindung?
- Falls es eine (äußere) Wahrnehmung ist, was ist das für eine (äußere) Wahrnehmung?
- Falls es eine Körperregung ist, was ist das für eine Körperregung?
- Falls es ein Vorsatz ist, was ist das für ein Vorsatz, was habe ich mir vorgenommen?
- Falls es eine Vorstellung (in diesem oder jenem Sinnesbereich) ist, was ist das für eine Vorstellung?
- Falls es ein Plan ist, was ist das für ein Plan?
- Falls es eine Frage ist, was ist das für eine Frage?
- Falls es eine Aufgabe ist, die ich erledigen will, was ist das für eine Aufgabe?
- Falls es ein Einfall (Idee) ist, was ist das für ein Einfall (Idee)?
- Falls es eine Irritation (Störung) ist, was ist das für eine Störung?
- Falls es ein Konflikt ist, was ist das für ein Konflikt?
- Falls es eine Entscheidung ist, was ist das für eine Entscheidung?
- Falls es ein Entschluss ist, was ist das für ein Entschluss?
- Falls es ein Handlungsimpuls ist, was ist das für ein Handlungsimpuls?
- Falls es eine Handlungshemmung ist, was ist das für eine Handlungshemmung?
Das (subjektiv) erfolgreiche Klären führt
zur Identifikation der Bewusstseinsfigur durch einen Namen oder eine Kennzeichnung
(Be- oder Umschreibung), der der Bewusstseinsfigur zugeordnet wird.
(5) Identifikationsfunktion des Denkens:
- Name oder Beschreibung des Wunsches?
- Name oder Beschreibung des Bedürfnisses?
- Name oder Beschreibung des Gefühls?
- Name oder Beschreibung der Stimmung?
- Name oder Beschreibung der Befindlichkeit?
- Name oder Beschreibung des Gedankens?
- Name oder Beschreibung der Erinnerung?
- Name oder Beschreibung der Phantasie?
- Name oder Beschreibung der (inneren) Empfindung?
- Name oder Beschreibung der (äußeren) Wahrnehmung?
- Name oder Beschreibung der Körperregung?
- Name oder Beschreibung des Vorsatzes?
- Name oder Beschreibung der Vorstellung?
- Name oder Beschreibung des Plans?
- Name oder Beschreibung der Frage?
- Name oder Beschreibung der Aufgabe?
- Name oder Beschreibung des Einfalls (der Idee)?
- Name oder Beschreibung der Irritation (Störung)?
- Name oder Beschreibung der Entscheidung?
- Name oder Beschreibung des Konflikts?
- Name oder Beschreibung des Entschlusses?
- Name oder Beschreibung des Handlungsimpulses?
- Name oder Beschreibung der Handlungshemmung?
(6) Arbeiten bzw. Weiterarbeiten mit dem identifizierten geistigen Modell (Denkinhalt)
Nach der Identifizierung der Bewusstseinsfigur kann man nun mit dem geistigen Modell weiter arbeiten: Man kann Verbindungen suchen, mit früheren Erfahrungen und mit Wissen Verknüpfungen herstellen.
(7) (Vorläufige)
Beendigung und (Zwischen-) Ergebnis der Weiterverarbeitung.
Am - vielleicht vorläufigen - Ende der Verarbeitung stellt sich
die Frage nach einem - vielleicht vorläufigen - Ergebnis der Verarbeitung.
Man kann sich nun fragen, was das nun für einen insgesamt bedeutet,
was zu tun oder zu lassen ist, ob der Sachverhalt weiterhin im Auge behalten
werden soll oder nicht bzw. unter welchen Umständen?
Wird die Verarbeitung als insgesamt nicht sehr bedeutungsvoll
eingeschätzt wird sie vielleicht zur weiteren Nichtbeachtung oder
zum Vergessen freigegeben und sie verschwindet dann unter Umständen
für immer.
5.4
Verbindungen des Denkens mit den anderen psychischen Funktionen
Die engen Zusammenhänge zum Wahr-nehmen (erkennen), Gedächtnis
und Lernen. Ob Denken ohne Gedächtnis funktionieren kann, erscheint
zwar zweifelhaft, ist aber nicht auszuschließen. Hier kann nur die
Läsionsforschung weiter helfen. Kein Zweifel herrscht hingegen darüber,
dass das Gedächtnis sehr, sehr wichtig für das Denken ist. Es
wäre vielleicht gar nicht verkehrt, Gedächtnis und Denken in
einem Funktionsapparat zusammenzufassen. In gewisser Weise tut man dies
auch, wenn man einen kognitiven Apparat konstituiert und hierbei Aufmerksamkeit,
Wahrnehmung, Gedächtnis und Denken zusammenfasst.
Es gibt aber auch zu allen anderen Bewusstseinsfiguren
einen engen Zusammenhang zwischen Gedächtnis und Denken. In dem Moment,
wo eine Bewusstseinsfigur identifiziert wird, kommt naturgemäß
Denken und Gedächtnis ins Spiel, etwa wenn ein Gefühl vom Typ
Angst oder Freude erkannt wird. Auch die Wahr-nehmung ist sehr eng
mit dem Denken verbunden, so sehr, dass man die "normalen" Wahrnehmungen
wie z.B. da steht ein Baum, das Telefon klingelt, eine
Wolke zieht vorbei, es riecht nach Kaffee, da liegt die Biographie
von Popper, es duftet nach frisch gemähtem Gras, gar nicht
mehr als Denken erkennt. Ja es scheint, als könnten wir gar nicht
mehr prä-kognitiv wahrnehmen, sondern in alle Wahrnehmung giessen
wir unser Wissen, unser Gelerntes, unsere Erfahrungen hinein. Auch das
erscheint als ein Forschungsbereich, der es verdient hätte, mehr und
näher untersucht zu werden.
5.5 Skizze einer Metasprache der Denkpsychologie. W123.1
Nach den Vorbereitungen der bisherigen Ausführungen sollten wir
nun in der Lage sein, die Denkpsychologie systematisch zu umreißen.
Zunächst sollten wir klare Notationsvereinbarungen einführen,
aus denen sich im Zweifelsfall unzweideutig ergibt, in welcher
Welt oder
über welche Welt wir auf welcher Metastufe
sprechen. Über W1 kann man nach Konstruktion nur mit W2 denken und
mit W3 sprechen.
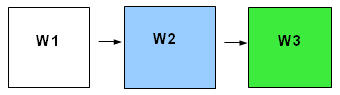
Zur Notation
der Welten und Metastufen
Die Information In Stockholm sind 15 Grad Celsius kann nun drei
Welten angehören: W1, W2 oder W3. Eine sichere Notation ist, wenn
Beginn und Ende jeweils gekennzeichnet werden:
- W1 In Stockholm sind 15 Grad Celsius W1 <=> Gemeint ist ein Geschehen der realen Welt.
- W2 In Stockholm sind 15 Grad Celsius W2 <=> Gemeint ist die geistige Repräsentation der realen Welt.
- W3 In Stockholm sind 15 Grad Celsius W3 <=> Gemeint ist der kommunikative Ausdruck der geistigen Repräsentation .
W3.1a Bei langen Ausdrücken oder Texten kann man ein zusätzliches
Anfangs- oder Endekennzeichen einführen, etwa das Zeichen a für
den Anfang und das Zeichen e für das Ende. W3.1e.
Wir haben das hier, obwohl es um keinen langen Text
ging, aus Beispielgründen angewendet. Hierbei wurde zugleich deutlich,
dass wir uns in der Metastufe 3.1 befanden. Denn wir haben über eine
Zeichenregel gesprochen.
W2.1. Kommen wir nun zu einem Beispiel für W2.1, indem wir
uns fragen, ob die Aussage In Stockholm sind 15 Grad Celsius klar
ist. Hier ist dem Kontext nach einigermaßen wahrscheinlich W2 angesprochen,
aber sicher ist es nicht. Sicher können wir das machen, indem wir
kennzeichnen: Ist die Repräsentation W2 In Stockholm sind
15 Grad Celsius
W2 klar? Hier stellen wir Fragen, die über die
mentale Repräsentation reflektiert und problematisiert. Die Aussage
W2 In Stockholm sind 15 Grad Celsius W2 ist nicht ausreichend klar,
da ihr eine genauere Ortsangabe (Meßstation) - Stockholm ist groß
- Datum und Uhrzeit fehlen.
In welche strenge und klare Form könnten wir
nun die Aussage die Aussage W2 In Stockholm sind 15 Grad Celsius W2
ist nicht ausreichend klar bringen? Nachdem es sich um eine metasprachliche
Aussage handelt, erscheint folgende Form streng und klar: W2.1a die
Aussage W2 In Stockholm sind 15 Grad Celsius W2 ist nicht ausreichend klar
W2.1e.
Problematisierung. Was ist nun W?a In Stockholm ist es milde.
W?e für eine Aussage? Nun, offensichtlich haben wir mit der Fragestellung
schon ein neues Zeichen eingeführt. Da es um ein Zeichen geht,
befinden wir uns hier auf jeden Fall in W3. Und da es um die Einführung
eines neuen Zeichens geht, also um eine Regel, befinden wir uns auf der
Metaebene:
- W3.1a Ist nicht klar, welcher Welt oder Metastufe eine Aussage zuzuordnen
ist, so kennzeichnen wir diesen unklaren Sachverhalt mit einem Fragezeichen
? W3.1e
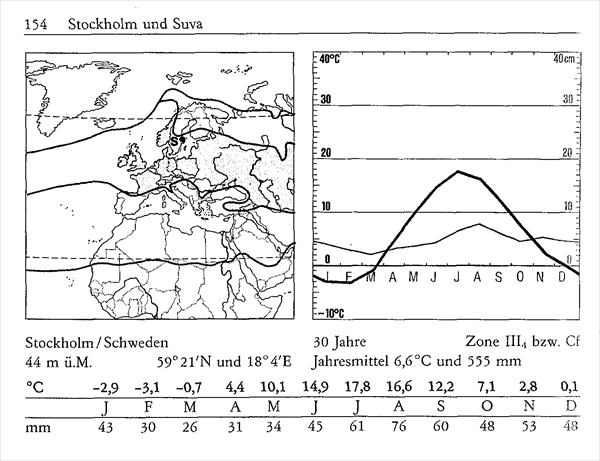
Die Bewertung milde erscheint dann richtig, wenn etwa die
15 Grad Celsius z.B. im Mai gemessen wurden, da hier die Durchschnittstemperatur
mit 10,1 Grad Celsius ausgewiesen wird. Milde ist eine Bewertung, die Klima
und Natur nicht kennen, und daher eine Bewertung des Menschen. Die Bewertung
milde
kann nicht zu W1 gehören, obwohl sie sich natürlich auf W1 bezieht.
Milde
gehört also sicher zu W2, aber es ist unklar, ob milde zu W2
oder zu W2.1 gehört. Fasst man milde also bloße nominale
Definition für den Temperaturbereich 12-16 Grad Celsius auf, gehört
milde
zu W2. Fasst man milde als Bewertung auf gehört es zu W2.1.
Damit können wir auf jeden Fall sicher sagen: der Ausdruck
milde
ist in dem gewählten Kontext in seiner metasprachlichen Bedeutung
nicht klar. An dieser Stelle könnten sich z.B. zwei Kontrahenten streiten,
ob die Aussage W2?a "15 Grad Celsius in Stockholm im Mai ist milde"
W2?e zu W2 oder zu W2.1 gehört. Der eine meint: ich sage einfach nur,
dass höhere Temperaturen als erwartet zu bemerken waren und verwende
hierfür die Abkürzung milde. Und der andere sagt, Du hast
die Temperatur als milde bewertet.
Fazit: Man sieht es den Wörtern und ihren Verwendungen
nicht immer an, wie sie gemeint sind und deshalb ist es an diesen Stellen
dann sinnvoll, seine Meinung hinzuzusagen. Das kann aber in neue Schwierigkeiten
führen, wenn eine Meinung klar ersichtlich ist und zugleich aber vom
Meinenden geleugnet wird, z.B.: Du bist zwar blöd, aber das soll
keine Wertung sein. Der Entwerter könnte sich darauf hinausreden,
indem er sagt, alle Menschen mit einem IQ < 80 dürfen abkürzend
als blöde bezeichnet werden. Blöde sei also keine Entwertung,
sondern ein Kürzel für einen IQ < 80.
Das Problem
der metasprachlichen Begriffe
Die Alltags- und Wissenschaftssprachen sind durchsetzt mit metasprachlichen
Ausdrücken:
- Es ist schon wahr, dass der Mensch gern vergißt, was ihm unangenehm ist.
- X. akzeptiert seine körperliche Erscheinung.
- Es bedarf keiner langen Ausführungen, um etwas Einfaches zu verstehen.
- Dass ein Kreis rund ist, ist keine gute Definition.
- Es ist keine gute Idee, ein geistiges Objekt zu schaffen, das sich selbst enthalten kann.
- Mit dieser Theorie kann man wenig anfangen.
- Zusammenfassend kann man sagen, dass die Hypothese sich nicht signifikant bestätigen ließ.
- Wenn der den Mund aufmacht, lügt er, und das gibt er auch noch zu.
- Schwarze Schimmel sind eigenartige Gebilde.
- Sind Sie sich da sicher?
Einige
wichtige metasprachliche Begriffe der Denkpsychologie > s.a. 5.1
ff
Geistiges Objekt, Beziehung zwischen geistigen Objekten, Name, Prädikat,
Merkmal, Begriff und Sachverhalt, Satz, Aussage, wahr, falsch, offen, Problem,
Lösung, Methode, Beobachtung, Experiment, Protokoll, ...
W2.1
Name(n), Universalien und Individuennamen
Namen sind von grundlegender und unverzichtbarer Bedeutung für
das Denken und Kommunizieren. Namen sind Kennzeichner oder Identifikatoren
für geistige Objekte und deren Beziehungen. Namen müssen aus
entwicklungs- und denkpsychologischer Sicht nicht explizit sein. Da es
ein Wahrnehmen und Denken vor dem Sprechen und Kommunizieren (Tiere, kleine
Kinder, Gehör- und Sprachlose) gibt, muss es eine Form von vorsprachlichen
Namen (> kognitive Schemata) geben.
Das ist ein Gebiet, das meines Wissens bislang kaum erforscht ist.
W2.1
Universalien und die Universalien-Relation > Stegmüller:
Das Universalienproblem einst und jetzt * Eisler
* Schneeflocke.
Menschen lernen im Lauf ihrer Entwicklung sog. Allgemeinbegriffe oder
Universalien, z.B. Baum, blau, rund, Buch, Menge, Tisch, Teil, Ganzes,
schwierig, Hoch, eckig, Dreieck.
Wie in der Zusammenfassung eingangs schon erwähnt,
neige ich - obwohl vom "Geistherzen" eher Nominalist - zu einem konstruktiven
Konzeptualismus, weil es unzweifelhaft Allgemeinbegriffe "gibt", die mit
großem Erfolg seit Jahrtausenden angewendet werden. Aber wie "gibt"
es sie? Führen sie eine selbstständige Existenz und sind das
eigentlich Wahre, wie Platon glaubte? Oder sind sie bloß nützliche
Erfindungen des menschlichen Geistes und auf diesen beschränkt? Letzteres
hieße: dächte man sich den Menschen als Geistwesen aus der Welt
weg - was sicher eines Tages der Fall sein wird, wenn wir den AstrophysikerInnen
und KosmologInnen glauben und nicht irgendwelchen metaphysisch-religiösen
Hirngespinsten
- dann gäbe es keine Universalien mehr. Universalien sind in diesem
Sinne Schöpfungen des Geistes und damit an Systeme gebunden, die Geist
hervorbringen oder denken können.
NominalistInnen argumentieren am Beispiel Baum:
es gibt zwar jede Menge konkreter Bäume, auf die man zeigen kann,
aber man kann nicht auf einen allgemeinen Baum zeigen. Baum ist nur eine
Idee, eine Abstraktion, die nur in den Köpfen der Menschen existiert,
aber in seiner Allgemeinheit keine konkrete Entsprechung hat. PlatonistInnen
argumentieren: alle konkreten Bäume dieser Welt sind nur Schattengestalten
der einzig wahren und schönen Idee des Baumes - fast möchte man
hinzufügen "an sich" oder "schlechthin". Obwohl hier seit Platon,
am schärfsten im Mittelalter im sog. Universalienstreit und dann wieder
beim Grundlagenstreit in der Mathematik gestritten wird, gibt es nicht
den geringsten Zweifel, dass Menschen mit Universalien hervorragend kommunizieren
können und sich vielfach ohne jedes Problem verstehen. Wenn jemand
etwa sagt: Da drüben steht ein Baum, dann weiß fast jeder,
was gemeint ist. Es erscheint daher nützlich, die Argumentation auf
eine praktisch, operationale Ebene zu holen, um den philosophischen Fallstricken
zu entgehen.
Ein Begriff ist eine Kombination
aus Merkmalen und ihren Beziehungen. Z.B. kann der Begriff Baum durch die
beiden Merkmale M1=Stamm und M2=Ast oder Äste bestimmt werden. Hierbei
fällt auf, dass Stamm und Ast bzw. Äste auch wieder Universalien
sind. Geht man durch die Welt, so wird man abzählbar viele Bäume
finden. Während die Natur nur abzählbar und sicher nicht unendliche
viele Bäume aufweist, kann man sich im Geiste potentiell unendlich
viele Bäume vorstellen, was nur heißt, dass man immer einen
weiter zählen kann und zu keinem Ende gelangt. Die natürlichen
Zahlen haben kein Ende, aber ihre Repräsentationen in der realen Welt.
Aber auch für einen Baum, den es noch gar nicht gibt, wird man z.B.
in zwei Jahren, wenn er denn da ist, den Begriff Baum anwenden können.
Demnach kann man die Universalien-Relation wie folgt anschreiben:
| W2.1 Objekt
1,2,3, ... n+
Die Folge der natürlichen Zahlen ist potentiell unendlich in dem Sinne, dass sie kein Ende hat. Zu jeder beliebigen natürlichen Zahl kann durch bloßes Hinzufügen einer 1, eine noch größere erzeugt werden. Das ist ein Prozeß ohne Ende. Meist drückt man dies wie folgt aus "N =1,2,3, ..." Unsere neue Ausdrucksweise "N=1,2,3, ...n+" soll zum Ausdruck bringen, dass, wie weit man immer auch konkrete Objekte zählen mag, am Ende findet sich immer eine bestimmte natürliche Zahl. So ist z.B. die Anzahl der Bäume, die je jemals gab und gibt eine natürliche Zahl vom Typ n+. Die von der Mengenlehre erfundenen Unendlich-Schimären [1,2,3] werden in der realen Welt nicht gebraucht. Ihr Nutzen ist mehr als zweifelhaft, da sie Paradoxien oder gar Antinomien erzeugen und den Geist und das Denken verwirren. W2.1 Individuen-Namen
|
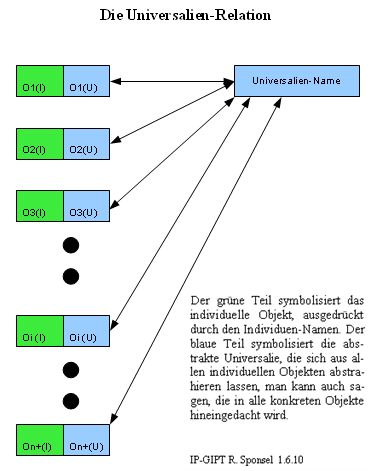 |
W2.1 Geistiges Objekt.
Undefinierter Grundbegriff, der über Beispiele und Gegenbeispiele
aus verschiedenen Bereichen eingeführt wird. Geistige Objekte und
ihre Beziehungen werden über Namen
identifiziert und kommuniziert. Einigermaßen sicher kann das über
Dialogaufgaben hergestellt werden. Ich denke an etwas, das vier Räder
hat, womit man fahren kann. Im allgemeinen wird man hier die Zeichengestalt
"Auto" gesagt oder aufgeschrieben bekommen. Dann kann man sagen: in der
Zeichengestalt "Auto" steckt das geistige Objekt Auto, die Idee des Autos.
Eine praktische und handfeste Variante ist das Zeigen auf Beispiele und
Gegenbeispiele. Eine Vereinfachung ergibt sich bei den Gegenbeispielen,
wenn die Negation (nicht) zur Verfügung steht.
W2.1 Merkmal.
Merkmale sind die Atome, aus denen Begriffe und Sachverhalte konstruiert
werden. Ein Merkmal ist etwas, das man unterscheiden, beschreiben und benennen
kann.
W2.1 Begriff. > Definieren.
Ein Begriff ist eine Merkmalskombination und besteht aus wenigstens
einem Merkmal. Im Regelfall besteht ein Begriff aus mehreren Merkmalen,
die u.U. auch noch in bestimmten Beziehungen zu einander stehen. Die exakte
Fassung eines Begriffs ist oft schwierig, hingegen eine ungefähre,
grobe Charakterisierung oft leicht.
Psychologie der Begriffe > Allgemeines
Psychologisches Referenzmodell. > Begriff
in Definition und definieren.
W2.1 Sachverhalt > Aufgabe
Sachverhalt finden aus 3 Begriffen.
Ein Sachverhalt meint (intensional) im allgemeinen einen Weltausschnitt
aus W1, W2 oder W3. Mit unseren Grundbegriffen formuliert: Irgendwelche
Objekte werden zueinander in Beziehung gesetzt, z.B. Die Krawatte liegt
auf dem Bett.
Kamlah & Lorenzen (2.A. 1973, S. 132)
führen in der logischen Propädeutik zum Terminus Sachverhalt
aus:
- "Gleichfalls in Anlehnung an den Sprachgebrauch sagen wir nun»
mehr von sprachlich verschiedenen, aber inhaltsgleichen Aussagen 'sie „stellen
den gleichen Sachverhalt dar'. Diese Gleichheit ist wieder eine
Äquivalenzrelation, und ein Sachverhalt ist somit ein abstrakter Gegenstand
ähnlich wie eine Zahl oder ein Begriff. Machen wir über Aussagen
wiederum Aussagen, die invariant sind hinsichtlich des etwa wechselnden
Wortverlaufs der besprochenen Aussagen, so machen wir Aussagen über
Sachverhalte, wir sprechen von Sachverhalten. Der Terminus 'Sachverhalt'
ist also ein Abstraktor.
Es wurde schon daran erinnert, daß FREGE hier den Terminus „Gedanke" verwendete. Diese Sprechweise wollen wir deshalb vermeiden, weil sie wieder den traditionellen Irrtum heraufbeschwört, wir hätten Sachverhalte zunächst einmal als „Gedanken" im Kopf, die dadurch, daß wir sie sprachlich „ausdrücken", zu „Aussagen"; werden. Dagegen dürfte es unverfänglich sein, auch zu sagen, daß jede Aussage einen Sachverhalt vergegenwärtigt (den man auch mit anderen Worten vergegenwärtigen könnte).
Die traditionelle Logik gebrauchte an dieser Stelle den Terminus ; „Urteil" (judicium)."
W2.1 Tatsache
Wahre Sachverhalte heißen Tatsachen. Auch das Subjektive, Flüchtige,
Individuelle sind nicht weniger Tatsachen als einfache physikalische Erscheinungen.
Sie sind aber unter Umstände (noch) nicht (intersubjektiv) zuverlässig
kommunizierbar.
Aus der Aussagepsychologie
wissen wir zudem, dass es subjektive Tatsachen gibt, die keine objektiven
sind. Das kompliziert und erschwert es noch einmal.
W2.1 wahr, falsch, offen
Wahr, falsch, offen kann über einen Vergleich
zwischen zwei Modellen zwei Welten bestimmt werden. W1 ist eine Konstruktion
wie W2 oder W3. Stimmen sie überein, kann jede von ihnen als wahres
Modell vom jeweils andern betrachtet werden. Die Sprache für W1 ist
gewöhnlich die der Wahrnehmung. Die Sprache für W2 ist üblicherweise
der Geist, das Denken. Die Sprache für W3 ist die Konvention über
Gebrauch und Bedeutung der Zeichen durch die KommunikantInnen. Manche Modelle
sind wahr, manche falsch, einige bleiben offen und sind - absolut oder
relativ betrachtet - nicht entscheidbar.
W2.1 Worte, Sätze, Texte
Worte sind die Hüllen oder Kleider der Begriffe und bestehen in
der Regel aus visuellen oder akustischen Zeichengestalten. Zum Kommunizieren
braucht man Worte und Wortkombinationen, die in Sätzen und Texten
durch Grammatiken (W3.1) geregelt werden.
6 Der begriffliche und relationale Aufbau der Welt
Eine erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch fundierte Ausarbeitung hat Rudolf Carnap (1.A. 1928) mit seinem Werk "Der logische Aufbau der Welt" vorgelegt. Er führt als Grundelemente die Elementarerlebnisse ein und entwickelt die Welt aus nur einer einzigen Relation, der Ähnlichkeitserinnerung (§ 78), was er in der 2. Auflage 1961 liberalisiert [Carnap 1961]. In seinem Buch Die logische Syntax der Sprache (1. A. 1934, 2. A. 1968) beschäftigt er sich mit einer allgemeinen Wissenschaftssprache. In diesem Kapitel geht es aber nicht um einen systematischen, erkenntnistheoretischen Aufbau, sondern mehr um eine phänomenologisch- erfahrungsmäßig gegebene Welt. Bevor wir kritisch denken lernen und können, haben wir schon ein Welt- und Menschenbild verinnerlicht.
6.1
Der natürliche und entwicklungspsychologisch geistige Aufbau der Welt:
Perspektive Säugling, Kleinkind, ...
Die wichtigsten Objekte sind für ein Kind seine Bezugspersonen,
die sich um seine Bedürfnisse kümmern und die unmittelbare Umgebung.
Die Welt des Kindes ist zunächst die Welt seiner Bezugspersonen und
seine unmittelbare Umgebung. Das Weltbild des Kindes wurde mit sehr überzeugenden
operationalen Methoden von Piaget
und seinen Mitarbeiterinnen erforscht (s.a. Hansen)
und im Laufe der Zeit differenziert, ergänzt, verbessert. Einige Grundfragen,
die vor allem auch für Eltern, ErzieherInnen und PädagogInnen
wichtig sein können, um alters- bzw. entwicklungsangemessen unterstützen
und fördern zu können:
- Zwischen sich und der Welt, zwischen innen und außen unterscheiden
- Unterscheidungen lernen
- Den Erscheinungen einen Namen geben
- Annahmen über die Existenz der Erscheinungen
- Begriffs- und Wissensbildung
- Die Erscheinungen strukturieren und klassifizieren
- Die Erscheinungen zueinander in Beziehung setzen
- Schließen und Schlussfolgern aus Wissen
- Unterscheiden zwischen Tatsachen, Vermutungen und Spekulationen
- Das Mögliche, Wahrscheinliche und Notwendige erkennen.
6.2
Näherung des systematischen geistigen Aufbaus der Welt in "Prosa"
Im folgenden wird die Systematik der Begriffe oder geistigen Grundmodelle
(fett) zunächst in "Prosa" ausgeführt, ein systematischer
Versuch wird unter 6.3 angedacht.
Raum und Zeit. Unsere Welt "spielt" sich für uns in Raum und Zeit ab, wobei wir für diese beiden Naturphänomene keinen unmittelbaren Sinn haben. Wir spüren den Raum nicht und unserer Zeitgefühl ist ziemlich schlecht. Meist erschließen wir die Zeit und das Zeitvergehen. Und auch den Raum können wir nicht wahrnehmen, wir erschließen ihn uns durch die Dinge und Körper, die sich in ihm aufhalten und wie wir in ihm wahrnehmen. Der Raum ist die eine grundlegende geistige Konstruktion, die andere ist die Zeit. Alles Geschehen der Welt scheint sich in Raum und Zeit abzuspielen. So wie wir Raum und Zeit nicht unmittelbar oder nur indirekt wahrnehmen können, so gibt es vieles andere, wie das mikroskopisch Kleine (Atome, Moleküle, Neuronen, Synapsen, Axone, Dendriten, Viren, Bakterien, u.v.a.m.) oder das, wofür wir keine Sinne oder keine genügend feinen Sinnesorgane haben (elektromagnetische Wellen, Elektrizität, Erdanziehung, Drehbewegung der Erde). Hier hilft uns das Denken, der menschliche Erfindungsgeist und die Wissenschaft. Mit ihrer Hilfe können wir unsere Erfahrungswelt sehr erweitern, sei es über Messgeräte, sei es über Schlussfolgerungen aus den Wirkungsbeziehungen in der Welt. Hinzu kommt, dass wir alles, was wir wahrnehmen, durch die Filter und Raster unseres Erkenntnissystems erkennen, wobei der An-/Schein nicht selten trügt. Die Wahrnehmungswelt der Lebewesen wird durch deren Wahrnehmungsapparat erzeugt, woraus sich die Fragestellung nach dem "Ding an sich" entwickelte.
In Raum und Zeit befinden sich Objekte (Körper, Strahlen, Wellen, Felder), die bewegt oder in Ruhe sein können. Objekte befinden sich an einem bestimmten Ort und nehmen dort eine stabile oder instabile Lage ein. Eine Bewegung hat eine Geschwindigkeit und sie kann gleichförmig oder beschleunigt sein. Bewegt sich ein Körper, so nimmt er eine konstante oder veränderliche Richtung ein, möglicherweise gibt es einen Anfang und ein Ende oder man kann einen Anfang und ein Ende denken, d.h. mehr oder weniger willkürlich annehmen. Die Objekte (Körper, Strahlen, Wellen, Felder) können (aufeinander) Wirkungen haben oder nicht. Veränderungen geschehen nicht von selbst, sondern brauchen einen Anstoss, eine Kraft oder Energie, um die Veränderung aufrecht zu erhalten, zu verstärken oder zu verlangsamen. Körper haben Massen und ortsabhängige spezifische Gewichte. Die Massen bestehen aus Stoffen, die rein (Elemente, Verbindungen) oder zusammengesetzt (Gemenge, Lösungen, Gemische) sein können. Die Stoffe sind so und so aufgebaut, haben eine äußere Gestalt oder Form und innere Struktur. Die Körper haben wie Raum und Zeit eine Ausdehnung, deren Ausmaß oder Umfang man messen kann (Fähigkeit) oder möchte (Wunsch). Mit Fähigkeit und Wunsch haben wir "Objekte" ins Spiel gebracht, die so etwas wie Verhalten und Erleben zeigen: die belebte Natur, die Tiere und den Menschen als äußerst fragwürdige Krone einer nicht minder fragwürdigen Schöpfung, die so organisiert ist, dass das Leben der einen den Tod von anderen erfordert. Mit dieser letzten Bemerkung habe ich zwei subjektive Wertungen in die Welt gebracht, jenes seltsame Phänomen, dass Lebewesen eine wertende Haltung oder Einstellung den Ereignissen gegenüber einnehmen können. Damit haben wir Lebendiges und Unlebendiges benannt. Das Leben hat merkwürdigerweise im Denken der Menschen zwei Anfänge, was sich eigentlich ausschließen sollte: die Zeugung und die Geburt, womit auch Sterben und Tod ins Spiel kommen. Kommen und gehen, Konstanz und Veränderung und damit ist auch der Wandel, für den man sich allgemein fragt: wie kommt es zum Wandel, was sind die Ursachen oder Gründe dafür? Mit der Erfahrung, dass manches Entstehen auf eine oder mehrere Ursachen zurückgeführt werden kann, kommt durch Verallgemeinerung das Kausalitätsprinzip (alles hat eine Ursache) in die Welt. Damit konnte man auch, zumindest formal, die Frage nach "der" Ursache dieser Welt stellen und erfand damit auf der einen Seite die Denk-Falle des unendlichen Regresses, auf der anderen Seite das Wunschphantasiewesen Gott, als ersten Verursacher. Doch wer hat ihn erschaffen (die abschließend überzeugendste Antwort gab bislang Feuerbach)? Günstige Rahmenbedingungen (Klima, Atmosphäre, Wasser, Sauerstoff, Stickstoff, ...) brachten das Leben hervor, das sich im steten Kampf ums Überleben entwickelte und ausdifferenzierte: Pflanzen, Tiere und als eine besondere Spezies schließlich den Menschen.
Ein ziemlich winziger, aber für uns neben der Sonne wohl der wichtigste Himmelskörper im Universum ist "unsere" sog. "Erde", die zum Sonnensystem gehört und um diese kreist, was bis Kopernikus nicht so gesehen wurde. Die Erde hat eine an den Polen abgeplattete Kugelgestalt. Sie ist eingeteilt in Nordpol, Südpol, Äquator, in Längen- und Breitengrade. Man erlebte Tag und Nacht und die Jahreszeiten, die sich wiederholten, wie so manches auf der Erde und am Himmel und im Verlauf der Zeit auch. Damit war eine natürliche Erfahrung für das Zählen mit den natürlichen Zahlen gegeben, aber auch für Wiederholung (ewige Wiederkehr), Abwechslung, Periodizität und Zyklik. Und mit dem Zählen war das Messen vorbereitet, das zunächst in der Astronomie, Geographie. Landwirtschaft und Grundbesitz lebenspraktisch fundiert war. Den Breitengraden ist per Konvention eine Zeitzone zugeordnet. Konventionellkalendarisch kann man daher, wenn man entgegen den Zeitzonen die Erde durchquert, einen Tag in die Vergangenheit reisen, eine konventionelle Tatsache, die sich Jules Verne zur Überraschung seiner LeserInnen in seinem berühmten Buch in 80 Tagen um die Welt zunutze machte. Damit kann man fragen: warum ist die Zeit so festgelegt und nicht anders? Mit dieser Frage haben wir Gründe und Motive für Ziele und Zwecke hereingebracht. Welche Kräfte rufen Veränderungen und Wandel hervor? Manche Wirkungen verstand man gar nicht, manche bewertete man gut (reiche Ernte), manche negativ (schlechte Ernte, Blitz, Donner, Unwetter, Katastrophen, Unfälle, Krankheiten, Unglück), Menge, Qualität, Kalkulierbarkeit, Vorhersage, Kontinuität, Sicherheit und Verläßlichkeit wurden wichtig. Man suchte daher nach Möglichkeiten, die erwünschten bzw. unerwünschten Wirkungen zu beeinflussen, um mit der Natur und dem Schicksal fertig zu werden. Damit war der Boden bereitet für Geister, Gespenster, Götter und Teufel und damit auch für ihre Jünger und Bändiger: Magier, Wahrsager, Astrologen, Hellseher, Zauberer, Propheten, Priester und Schamanen, der ganze Spuk menschlicher Egozentrik, Ohnmacht und Unreife bis in die jüngste Gegenwart, wie der moderne Fundamentalismus und der Esoterikboom beweisen, woraus man schließen kann, dass die Aufklärung seit 250 Jahren sehr viele nicht erreicht hat. Das wissenschaftliche Weltbild ist bislang weder willens noch in der Lage, die metaphysischen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen und eine allgemein akzeptierte Metaphysik auf wissenschaftlicher Basis haben die Philosophen bis heute leider nicht zustande gebracht, so dass man am Sinn und an der Berechtigung der Philosophie begründet zweifeln kann..
Betrachten wir die Erde, so besteht sie an der für uns besonders wichtigen Oberfläche aus Wasser, Eis und Erde, Bergen,Wäldern, Wiesen, Bäumen, Sträuchern, Gräsern, Blumen, Früchten, Tälern, Flüssen. An besonderen Stellen - Schutzzonen, Bodenschätze, Nahrungsmöglichkeiten, Flüssen, Wegen, Furten - haben Menschen Orte gegründet, Gemeinschaften und notwendigerweise ein Sozialleben entwickelt. Dazu gehörten dann Organisation und Verwaltung, Recht und Ordnung. Es entwickelte sich oben und unten, Arbeitsteilung Da die Ressourcen, Bodenschätze und allgemein die Werte begrenzt waren und sind, hat ein ewiger Kampf um diese eingesetzt, um Vorteile und Sicherung zwischen denen, denen es gut geht und die andere ausnutzen können und jenen, denen es nicht so gut geht und die ausgenutzt werden. Das führte auf vielen Ebenen zu immerwährendem Kampf und Krieg, woran sich im Grunde bis heute nichts geändert hat, nur die Waffen, Mittel, Varianten und Verkleidungen. Von existenzieller Lebenswichtigkeit ist auch unsere Atmosphäre.
Der Mensch. Er hat einen Körper,
die eine bestimmte Gestalt hat. Zur äußeren Erscheinung
gehört die Figur, Proportionen, Skelett, Knochen, Haut und Muskeln,
Kopf, Gesicht, Haar, Stirn, Augenbrauen, Augen, Lider, Nasenwurzel, Nase,
Mund, Lippen, Zähne, Zunge, Kinn, Backen, Ohren, Hals, Schultern,
Arme, Hände, Finger, Brust, Bauch, Nabel, Geschlechtsorgane, Hüfte,
Oberschenkel, Knie, Kniekehle, Unterschenkel, Wade, Schienbein, Knöchel,
Füße, Zehen.
Die Funktionssysteme: Herz- und Kreislauf,
Blut, Blutgefäße. Ernährung, Verdauungsapparat, Stoffwechsel
und Ausscheidung. Genitalapparat und Fortpflanzung, Gehirn, Nervensystem
und Hormone. Immunsystem. Bewegungsapparat: Skelett- und Muskelsystem,
Gelenke. Haut. Atemapparat und Stimme.
Innere Organe. Herz, Lunge, Leber, Niere,
Magen, Darm, Milz,
Aufbau und Bausteine des Körpers: Zelle,
Gewebe, Knochen, Knorpel, Gelenke, Sehnen, Muskeln, Nerven, Gefäße,
...
Psyche. > Die
Konstruktion des Bewusstseins und seiner Erlebenselemente. > Modell
der Psyche im Kontext.
6.3 Ansatzskizze einer Systematik
Ausdehnung: Dimensionen.
Raum
Struktur und Merkmale von Räumen und unseres
erlebten Raumes
Bezugssysteme Raum
Orte.
Lagen: überhalb, unterhalb, rechts, links,
innen, außen, davor, dahinter, ...
Zeit.
Körper
Masse
Gewicht
Stoff
Zustand
Gestalt (Form)
Oberfläche
Aufbau (Struktur)
Bewegung
Gleichförmig
Beschleunigt
Ruhe
Gleichgewicht
Energie
Energieart
Energieausdruck
Kräfte
- Kräfteart
Wirkungsweise
Wirkungsgestalt (Form)
Wirkungsrichtung
Herkunft
Ziel
Aktualisiert - Potential
Ausgeglichen (stabil) - Unausgeglichen (instabil)
Statisch - dynamisch
Status (> Welten): wirklich, möglich, wahrscheinlich, normativ (gesollt), wünschenswert, gedacht, phantasiert
Veränderung
...
...
...
6.4 Der Realitätsstatus
unserer Begriffe, das Problem der Referenz, fiktionale Begriffe und Existenz
Die Worte sind die Kleider der Begriffe
Der Text "Wirklichkeit" wurde der Definitionseite entlehnt, die Ausführungen zur "Referenz" der Seite Beweis und beweisen in Logik, Erkenntnis-, Wissenschaftstheorie und Philosophie.
Wirklichkeit Man kann das, was man landläufig die Wirklichkeit nennt als lediglich ein Modell, nämlich als Modell der sinnlich-wahrnehm- und meßbaren Außenwelt betrachten. "Wahrheit" kann in dieser Theorie dann als Äquivalenzrelation zwischen zwei Modellen definiert werden, so dass sich der Streit um die "wahre" oder - noch schlimmer - "wirkliche Wirklichkeit" erübrigt. Wir konstruieren unsere Welt oder unser Erleben ja immer, so dass Kant mit seiner Meinung, das Ding an sich bleibe uns immer verborgen insofern Recht hat, dass es ein "Ding an sich" eigentlich gar nicht gibt. Die Welten sind immer Welten relativ von erkennenden oder wahrnehmenden Systemen und damit unterliegen sie den Konstruktions-Filtern des wahrnehmenden Systems. Das heißt aber natürlich nicht, dass alles beliebig im Sinne eines Vulgärkonstruktivismus verstanden werden darf.
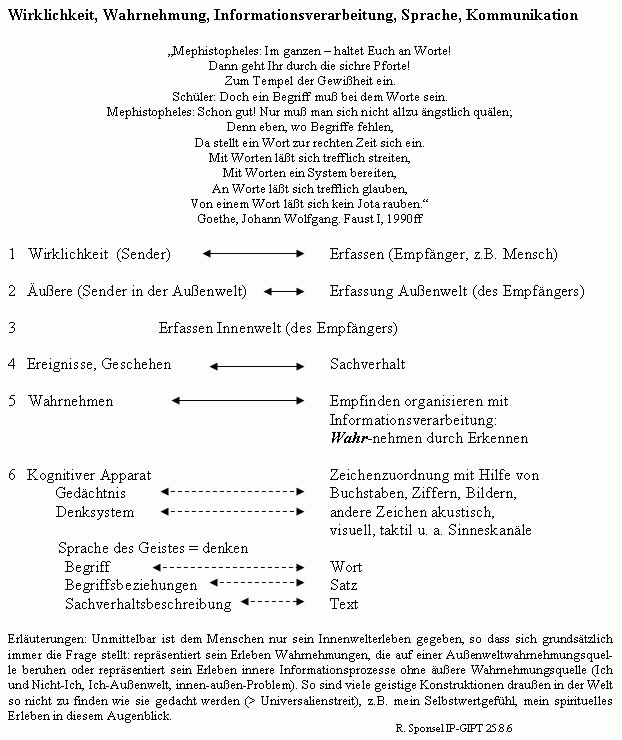
Referenz
Denken kann man viel, sehr viel, Mögliches und Unmögliches,
Widersprüchliches, Absurditäten und jeden Unsinn. Eine ebenso
interessante wie wichtige Grundfrage lautet daher: Welche Entsprechung
(Beziehung, Referenz) haben unsere Begriffe und Denkinhalte zur Wirklichkeit
bzw. zu welcher Wirklichkeit (> Welten)?
Was referenzieren unsere Begriffe und geistigen Konstruktionen? Sobald
wir mit unserem Denken auf eine Wirklichkeit Bezug nehmen (referenzieren),
sollten wir genau angeben können, wie unsere Denkinhalte in der Wirklichkeit,
die wir meinen, zu finden sind.
Gottfried Gabriel führt in der Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Bd. 3, aus:
| "Referenz (von engl, reference, Bezugnahme), grundlegender Terminus
der > Semantik für die > extensionale Komponente der > Bedeutung.
In den Bedeutungstheorien finden sich sehr unterschiedliche Auffassungen
der R.. Allgemein kann unterschieden werden (1) der Akt der R. (engl, referring),
durch den auf Gegenstände Bezug genommen wird, (2) die Beziehung der
R., die aufgrund von (1) zwischen Zeichen und bestimmten Gegenständen
besteht, (3) die Gegenstände selbst, auf die Bezug genommen wird.
Um den Unterschied von (3) zu (I) und (2) hervorzuheben, nennt man diese
Gegenstände häufig auch Referenten (engl, referents). Zu unterscheiden
ist zwischen singularer und pluraler R., deren Arten anhand der bei Akten
der R. verwendeten sprachlichen Ausdrücke bestimmbar sind. Typische
Arten solcher referenzialisierender oder referierender (engl, referring)
Ausdrücke sind > Eigennamen, > Indikatoren und > Kennzeich-
nungen. Die neuere Diskussion ist hier bestimmt durch die von S. A. Kripke
u.a. neu entfachte Diskussion Über die Bedeutung von > Namen und die
Grundlage der > Benennung (engl, naming). ...
Referenzialisierbarkeit, Terminus der > Semantik. Die Eigenschaft der R. kommt sprachlichen Ausdrücken, die ihrer grammatischen Form nach auf Gegenstände Bezug nehmen und deshalb 'referenzialisierende' (engl, referring) Ausdrücke heißen, genau dann zu, wenn sie tatsächlich > Referenz haben und nicht fiktional sind (> Fiktion, > Fiktion, literarische)." |
Eine gute Möglichkeit, sich nicht im Abstrakten, Allgemeinen
und Unbestimmten zu verlieren bietet das Konzept der Operationalisierung,
wenn es auch nicht für alles gleich gut geeignet sein mag.
Historische-Zeitgeist-Anmerkung. Das Thema im engeren
Sinne wird einigermaßen zeitraumgleich (Nachkriegszeit) von mehreren
philosophischen Autoren aufgegriffen, z.B. Strawson (1950), Searle (1958),
Kripke (1973), Quine (1974), Putnam (1975) The Meaning of 'Meaning',
(1975). Als Vordenker gelten u.a. Mill, Meinong, Frege, Russell. Im weiteren
Sinne ist das Thema aber schon immer ein Kern- und Zentralthema der Philosophie
und Erkenntnistheorie. Vereinfacht lautet die Gretchenfrage der Referenz:
welche Beziehung besteht zwischen unseren Denkinhalten und der Wirklichkeit
(> Welten).
- Exkurs:
Ist Kripke zum Referenzieren im Psychischen hilfreich?
Die John Locke Vorlesungen Kripkes 1973 in Oxford hat Kripke später in seinem vielgerühmten Buch "Referenz und Existenz" (dt. 2014) verarbeitet. S. 13: "... Einer dieser Bereiche, bei dem es sich möglicherweise um den wichtigeren von beiden handelt, ist die gesamte Thematik, wie Benennen sich auf Existenz bezieht, insbesondere das Problem der leeren Namen und der Referenz zu dem, was nicht existiert, das Problem der fik-[>14]tiven Entitäten, der Existenzaussagen und dergleichen. FN3 Der andere Bereich, den ich zu behandeln beabsichtige (ich sage mit Bedacht »beabsichtige«, denn die Ausarbeitung des ersten Themas mag mehr oder weniger ausführlich ausfallen), ist derjenige der Sprecher-Referenz [speaker’s reference] und der semantischen Referenz [semantic reference]. FN4 Unter »Sprecher-Referenz« verstehe ich eine Referenz, wie sie in einem komplexen Ausdruck wie »Jones bezog sich auf Smith, als er sagte ›dieser fette alte Heuchler‹« zur Anwendung kommt – also Referenz durch einen Sprecher. Die andere, damit verwandte Konzeption der semantischen Referenz pflegt in Aussagen wie »der Ausdruck ›der Verfasser von Waverley‹ bezieht sich in der deutschen Sprache auf Walter Scott« zur Anwendung zu kommen. ..."
Die meisten philosophischen Arbeiten - wie auch
Kripkes - sind einerseits sehr breit und episch aufgebaut, enthalten aber
andererseits wenig genaue und durchgearbeitete Beispiele, die die Sache
auf den Punkt bringen. Selbst einfache Sachverhalte, wie einem Ding einen
Namen zuordnen, werden überdimensional aufgebauscht. Man fragt sich,
was es für ein Problem sein soll, einem fiktionalen Sachverhalt (literarische
oder mythologische Figur) einen Namen zuzuweisen oder dessen Existenz klar
zu legen. Ähnlich verhält es sich mit dem - gänzlich, partiell
oder vorübergehend - Nichtexistenten, sprachlich der Verneinung.
Für kognitive und EntwicklungspsychologInnen erscheint Quines "Die
Wurzeln der Referenz" besonders zugänglich, weil er an der Wahrnehmung,
Lernen und Entwicklung der Sprache ansetzt. Und für die differentielle
Persönlichkeitspsychologie ist das Werk Ulrichs besonders geeignet.
Für die wirklich schwierigen und praktischen Fragen zum Referenzieren
im (Fremd-) Psychischen, kann man die Philosophie der Referenz nur eher
selten gebrauchen.
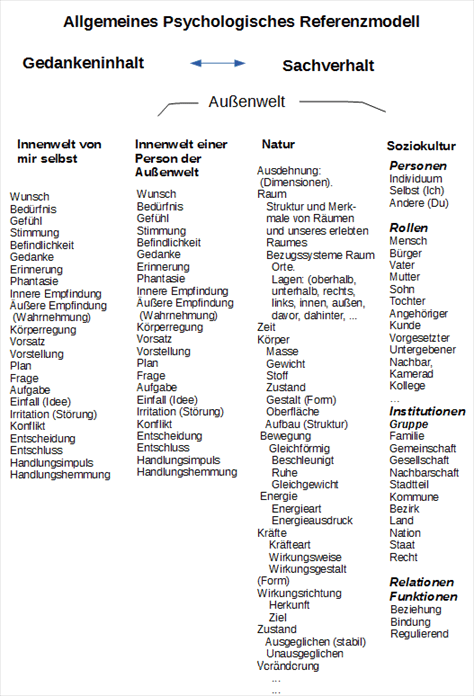 |
Die Graphik zeigt vier Grundaufmodelle der Referenzierung aus denkpsychologischer Sicht: Ich (Aussagen über mich), Anderer (Aussagen über andere), Natur (Aussagen über die Natur), Kultur (aussagen über Soziokulturelles). Am einfachsten ist zweifellos das Referenzieren auf äußere Dinge, die der Wahrnehmung und gemeinsamer Handlungs- und Lebenspraxis zugänglich sind. So fängt die Sprach- entwicklung auch weitgehend an: Mama, Papa, Auto, Handy, Wauwau, ... Schwieriger kann es werden, wenn es um das Erleben und nicht direkt beobachtbare seelisch-geistige Prozesse eines ich oder selbst oder gar um "höhere" Wahrnehmungsebenen (Laing) geht. Die Referenz der Innenwelt kann den Objekten des Personalpronomen
"ich" (bzw. seinen Entsprechun- gen) zugeschrieben werden.
Bemerkt ein Mensch, was in ihm vorgeht, so heißt "ich"
das Referierende und das, was bemerkt wird, die Referenz. Z.B. wenn sich
jemand fragt, wie es ihm geht, dann heißt ergehen die
Referenz. Wenn sich jemand fragt, wie sein Partner meint, dass es ihm geht,
gibt es zwei Referenzen, nämlich erstens mein Ergehen wie ich
es beurteile und zweitens in die Augen meines Partners projiziere.
Die Referenzen des Erlebens können also als unterscheidbare Bewusstseinsinhalte
angesehen werden.
|
Selbstreferenz
Sich auf sich selbst beziehen. Typisch: Ich-mich-Bezug. Ich-mich-Bezüge
charakterisieren die Subjekt-Objekt-Referenz, etwa, wenn ein Mensch Betrachtungen
zu sich selbst anstellt. Hier wird man dem \g Subjekt (ich)
Fiktionale Begriffe
und Existenz
Die bekannteste Fiktion der Geistesgeschichte ist sicher "Gott".
Zu den schärfsten Kritikern der fiktionalen Begriffe gehört Max
Stirner ("Der Sparren"). Dem
Thema der Fiktionen hat der Philosoph Hans Vaihinger
ein ganzes Buch gewidmet: Die Philosophie des Als Ob. S. 171-175
der zweiten Auflage nennt er vier allgemeine Merkmale der Fiktionen -im
Unterschied zu Hypothesen:
- Willkürliche Abweichung von der Wirklichkeit bis zum Selbstwiderspruch (S. 172)
- Provisorium und Vorläufigkeit (S. 173)
- Ausdrückliches Bewusstsein um das Fiktionale (S. 173)
- Zweckmäßigkeit, Mittel zum Zweck (S. 174)
6.4.2
Zusammenfassung der vorläufigen Ergebnisse
[steht noch aus]
7 Psychische Störungen und Erkrankungen des Denkens und seiner Umgebung
7.1
Einführende Vorbemerkungen.
Aus den vielen Erkrankungen von Gehirn und Nervensystem oder mit ihnen
in Zusammenhang stehenden Organen oder körperlichen Funktionseinheiten
ergibt sich ganz klar: Alles Denken ist an die Biologie und an ein funktionierendes
Gehirn gebunden. Damit stellt sich auch die Frage, was eigentlich -
psychologisch betrachtet - Denken ist, sein kann oder sein soll? Ganz scharf
gefragt: Gibt es überhaupt eine psychologische Seite des Denkens oder
ist eine solche nur Einbildung, ein kultur- und wissenschaftsgeschichtlicher
Zufall, eine Gewohnheit und sprachliche Nachlässigkeit? Nun, besinnen
wir uns auf die Definition der Psychologie, nämlich die Wissenschaft
vom Erleben und Verhalten. Was heißt das denn? Dass es ein "eigenes"
Erleben trotz, nach oder begleitend zu den biologischen und neuronalen
Prozessen gibt? Die NeuroscienceologInnen sagen: es gibt Bewusstsein nur
als bedeutungsloses Epiphänomen, nicht als "Controler-Cockpit". Wir
bemerken das Geschehen immer erst im Nachhinein, wenn sozusagen schon alles
gelaufen ist, deshalb könnten wir auch nicht so, wie wir wähnen,
eingreifen. Der freie Wille ist nach neuroscienceologischer Überzeugung
eine Illusion, ein Irrglaube. Demnach sollte auch jegliches Denken deterministisch
ablaufen, also ein freies Denken nicht möglich sein. So mag der eine
oder Neuroscienceologe sogar denken, dass Psychologie eine Schimäre
und Scheinwissenschaft ist, deren Gegenstand nur eingebildet und scheinbar
existiert. Am subjektiven Erleben gibt es zwar keinen Zweifel, aber an
seiner Bedeutung. Der Streit um diese Bedeutung hat eine lange Geschichte.
Seine Stichworte lauten: Leib-Seele-Problem,
Bewusstseinsproblem,
Problem
der Willensfreiheit, Ich und
Ich-Identität.
Nach dem Eingangspostulat ergibt sich, dass jede
Form einer Denkstörung auch eine körperliche Entsprechung haben
muss - unabhängig davon, ob wir sie finden können. Schwierig
ist es aber auch oft, die Kausalität zu bestimmen, zumal noch gar
nicht richtig geklärt ist, was körperlich, psychisch und psychosomatisch
genau heißen soll. Es gibt körperliche Störungen ohne nennenswerte
psychische oder geistige Auswirkungen und solche mit erheblichen bis zum
Totalausfall. Und es scheint, als ob Körper und Psyche sich wechselseitig
beeinflussten. Als Psychotherapeut konnte ich seit Jahrzehnten beobachten,
dass Menschen, wenn sie sich in für sie unlösbar erlebten Konfliktsituationen
befinden, früher oder später z.T. sehr starke körperliche
Symptomproduktionen entwickeln.
| Exkurs: Biologische Psychologie
Befragen wir ein repräsentatives Werk zur biologischen Psychologie, Bierbaumer & Schmidt und schauen ins Sachregister, stellen wir verwundert fest, dass das Wort "denken" dort gar nicht vorkommt, nur "Denkstörung" (732-739). Das ist insofern merkwürdig, als man sich natürlich fragt, wie man Störungen eines Sachverhalts erörtern kann, ohne den zugrunde liegenden Sachverhalt selbst genau zu kennen? Das Kapitel beginnt auch etwas unverständlich mit der Alzheimer-Krankheit, die ja im Kern erst einmal das Gedächtnis betrifft. Zwar braucht das Denken das Gedächtnis und wird natürlich durch Gedächtnisstörungen - teilweise sehr massiv - beeinträchtigt, aber das Denken selbst gilt traditionell als eigene geistige Funktion. |
Eine ähnliche Situation finden wir bei bei dem Neuroscienceologen
Gerhard Roth. Im Sachregister seines Buches "Fühlen, Denken, Handeln"
gibt
es zwar keinen Eintrag "denken", aber das 6. Kapitel ist mit "Denken, Intelligenz,
Kreativität" überschrieben:
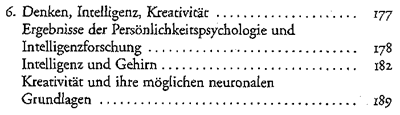
"6. Denken, Intelligenz, Kreativität Denken gilt als die Krone menschlicher Fähigkeiten. Es ist in traditioneller
Sicht identisch mit dem Besitz von Verstand und Vernunft und stellt damit
dasjenige Merkmal dar, welches uns neben der Sprache am eindeutigsten von
den Tieren unterscheidet. Tiere - so haben wir im ersten Kapitel im Zusammenhang
mir dem Instinkt-Begriff gehört - denken nicht. Sie können zwar
erstaunlich vernünftige Dinge tun, z. B. kunstfertige Nester bauen,
nach dem Sonnenkompass fliegen und komplizierte Staaten bilden, aber sie
tun dies aufgrund angeborenen Wissens und ohne Einsicht in ihr Handeln.
Nur der Mensch besitzt ein »logistikon«, ein Vernunftvermögen,
mithilfe dessen er von Denken und Überlegen geleitete Dinge tun kann.
|
Die Zunft der NeuroscienceologInnen möchte zwar gerne die Wissenschaft revolutionieren, sieht man sich ihre Texte aber etwas näher und kritischer an, erschrickt man regelrecht, wie naiv, fehlerhaft, unzulänglich und inkompetent die großen wissenschaftlichen Themen dort teilweise abgehandelt werden. Hier werden eingangs gleich zwei kardinale Fehler offenbar, nämlich: dass Tiere nicht denken können und über keine Sprache verfügen sollen. Überdies wird Denken völlig falsch mit Verstand und Vernunft identifiziert. Das ist dann auch noch widersprüchlich zu dem Anschlusssatz, "dass keineswegs alle Menschen vernünftig sind", wobei die Relativität des üblichen Vernunft- begriffs eines westlich Gymnasialgebildeten noch nicht einmal angedacht wird. Vernunft begabt sein und vernünftig handeln oder sein Leben so einrichten, sind außerdem zwei paar Stiefel. Wo immer man die NeuroscienceologInnen näher überprüft: Fehler über Fehler, Unzulänglich- keiten und Schwächen überall. Leider: Denn von der biologischen Basis und Funktionalität des Denkens ist einiges zu erhoffen. |
Etwas unverständlich erscheint auch, dass in den Grundlagen der Neuropsychologie (Markowitsch, 1996, Hrsg.) wie auch nicht in der Kognitiven Entwicklungsneuropsychologie von Kaufmann et al. das Denken keinen Eintrag im Sachregister erhalten hat. Denken scheint auch keine Rolle bei den von Klimesch referierten "Netzwerktheorien der Informationsspeicherung" zu spielen. Nicht ganz unerwähnt, aber doch auch eine weitgehend nebensächliche und mehr beiläufige Rolle spielt das Denken auch im zweiten Bd. Klinische Neuropsychologie (Markowitsch, 1997, Hrsg.).
7.2
Idee zu einer Allgemeinen Systematik der Denkstörungen
Hypothese: Alles, was gedacht werden kann, kann auch - funktionell
betrachtet - vorübergehend oder dauerhaft gestört sein oder,
im schlimmsten Falle, gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine Vorstellung,
was alles ausgefallen oder gestört sein kann, finden Sie z.B. bei
den Denkfunktionen (z.B. Lompscher 1975) oder auch
in der Ausarbeitung "Normtag". Schwierige
Abgrenzungsprobleme kann es mit den Gedächtnisstörungen geben,
weil diese meist auch das Denken beeinträchtigen. Man muss auch aufpassen,
Sprachstörungen nicht mit Denkstörungen zu verwechseln. Aus der
Tatsache, dass ein Aphasiker z.B. die Lautgestalt für ein Wort nicht
findet (Zugriffsstörung Lautgestalt für ein Wort), ist nicht
unbedingt zu schließen, dass auch der Begriff fehlt. Erinnern wir
uns: die Worte die Kleider der Begriffe: ein Nackter hat nur seine Kleider,
nicht seinen Körper verloren.
Das Denken kann verlangsamt, gehemmt (Depression)
oder beschleunigt, enthemmt sein (Manie, maniforme Zustände). Es kann
abreißen, kleben, sich wiederholen (Perseveration), aus dem Zusammenhang
geraten (Inkohärenz), umständlich, eingeengt, unklar, unverständlich,
bizarr, phantastisch, eigen und unzugänglich erscheinen. Es kann zu
Konfabulationen (Erinnerungslücken werden ohne es zu bemerken mit
naheliegenden Inhalten gefüllt) kommen und es kann sich verirren und
verwirren. Jemand kann sogar denken, er sei jemand ganz anderer, kann eine
andere Identität annehmen, darin wechseln oder seine verlieren. Die
Wirklichkeit kann wahnhaft mißverstanden werden. PatientInnen wähnen,
dass in ihre Gedanken eingegriffen werde, dass sie fremd gesteuert würden,
dass ihnen Gedanken entzogen würden oder dass sich ihre Gedanken ausbreiten.
(> Scharfetter,
Psychopathologie, Kap. 9: Denken, Sprache, Sprechen).
7.3
Störungsspezifische Denkstörungen.
Agnosie, Aphasie, Angst, Chromosomenanomalien, Depression, Eigenbezug,
Epilepsie, Grübelsucht, Manie, Neurosen, Organisches Psychosyndrom,
Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie, Schlaganfall, Stirnhirnsyndrom,
Stoffwechselstörungen, Stress, Sucht, Überforderung, Vergiftungen,
Wahn, Zwang.
Denkstörungen
in der neueren Verhaltenstherapie (Margraf 1999).
Beispiel aus dem Glossar von Margraf (1999, 563f): "Denkstörungen.
Unterschieden werden (1) formale Denkstörungen (den Vorgang des Denkens
betreffend bzw. Störungen des Gedankenablaufes) und (2) inhaltliche
Denkstörungen (die Inhalte des Denkens betreffend). Zu den formalen
Denkstörungen gehören gehemmtes, verlangsamtes, beschleunigtes
oder ideenflüchtiges, eingeengtes, umständliches, unklares, paralogisches
und inkohärentes (zerfahrenes) Denken sowie Gedankensperrungen, Gedankenabreißen
und Perseveration des Denkens. Zu den inhaltlichen Denkstörungen zählen
der > Wahn und > überwertige Ideen. Denkstörungen treten als
Symptom vieler psychischer Störungen (prominent z.B. bei der > Schizophrenie)
auf. "
\ge
8 Behandlungsmöglichkeiten des Denkens.
Das Denken hängt vielfältig mit anderen Funktionen oder Funktionseinheiten, wie z.B. der Ernährung, dem Gedächtnis, der Sprache und Bildung, mit Zuwendung und Förderung durch Bezugspersonen zusammen.
8.1 Familiennahes
Fördern des Denkens.
Anregen, unterstützen, helfen, lehren, Lust, Nutzen und Erfolg
mit Denken vermitteln: Rahmenbedingungen und Umgebung angemessen
einrichten: Lebensführung, Bewegung, Ernährung, Schlaf, erholen,
ruhen, faulenzen, Sport, Spiel, Spaß und Vergnügen.
8.2
Soziokulturelle Unterstützung und Förderung
Zeitgeist und Normative Vorstellungen bezüglich des Denkens und
seiner gesellschaftlichen und institutionellen Förderung (Kinderkrippen,
Kindergarten, Vorschulen, freiwillige und private Lerneinrichtungen [Sonderform
Nachhilfe], Horte, Hausaufgabenbetreuung, Schule, Sport- und Kultureinrichtungen).
8.3 Behandlung
von Denkstörungen
Es gibt viele Ansätze zu Zugangsmöglichkeiten, Denkstörungen
zu behandeln. Sinnvoll scheint hier aber, dass eine sorgfältige Differentialdiagnostik
und spezifische Denkstörungs-Anamnese unter Beachtung
einiger Fallstricke (z.B. auch Suggestivfragen
in der Diagnostik) durchgeführt wird.
8.3.1
Medizinische Behandlungsmöglichkeiten
Gründer
(2008) kommt in seiner Arbeit Pharmakotherapie kognitiver Störungen
zu folgendem Ausblick (S. 610): "Bis vor wenigen Jahren war der Anspruch
an die antipsychotische Pharmakotherapie, mit einer Substanz alle Aspekte
der heterogenen Psychopathologie schizophrener Störungen zu behandeln.
Die Suche nach dem idealen »atypischen« Antipsychotikum, das
nicht nur gegen Positivsymptome wirksam ist, sondern auch Negativsymptome
und kognitive Störungen effektiv reduziert und dabei keine EPS induziert,
muss als gescheitert betrachtet werden. Heute ist klar, dass eine effektive
Pharmakotherapie kognitiver Störungen nur durch die Modulation von
gestörten neurochemischen Prozessen möglich ist, die die Basis
von kognitiven Leistungen bilden. Das Verständnis für diese Prozesse
hat sich in den letzten Jahren mit der Entwicklung von selektiven Pharmaka
erheblich erweitert. Mit der Evaluation dieser innovativen Substanzen werden
sich künftig unser Verständnis von der Neurochemie kognitiver
Prozesse und die Möglichkeiten ihrer pharmakologischen Beeinflussung
wechselseitig fortentwickeln."
8.3.2
Psychologische Behandlungsmöglichkeiten
Die psychologischen Therapiemöglichkeiten umfassen ein weites
Spektrum, sind aber teilweise eingeschränkt durch die jeweiligen institutionellen
Rahmenbedingungen, die finanziellen Möglichkeiten der Betroffenen
aber auch durch wenig oder gar nicht evaluierte Verfahren. In nicht wenigen
Einzelfällen ist auch nur individuelle Einzelfallevaluation möglich,
wobei man berücksichtigen muss, dass in letzter Instanz jede
Evaluation auf den jeweiligen Einzelfall Anwendung finden muss. Wir arbeiten
nicht mit Populationen, nicht mit Stichproben, nicht mit Mittelwerten oder
Zufallsauswahlen, sondern mit ganz konkreten, individuellen Menschen, denen
geholfen werden soll.
Voraussetzungen
für eine Kognitive Verhaltenstherapie
Für eine aussichtsreiche kognitive Verhaltenstherapie ist nach
Stavemann (2005, S. 106f) die Fähigkeit zu reflexivem Denken erforderlich.
Er schreibt:
"Der Patient ist nicht zu reflexivem Denken fähig
Ohne die Fähigkeit, eigenes Denken, Planen
und Handeln auf mindestens einfacher Abstraktionsebene betrachten und reflektieren
zu können, ist die Prüfung ihrer Funktionalität hinsichtlich
eigener Normen und Ziele und damit sinnvolles kognitiv-verhaltenstherapeutisches
Arbeiten nicht möglich. Der Patient muss für einen erfolgreichen
Veränderungsprozess in der Lage sein, einen Perspektivenwechsel (vgl.
Mead, 1969; Kriz, 2001) vorzunehmen, um die eigene Wirkung seiner Person
oder seines Handelns auf andere antizipieren und seine Handlungen und Pläne
daran auszurichten zu können.
Dieses reflexive Denken und reflexive Bewusstsein
ist häufig bei Patienten mit hirnorganischen Erkrankungen, Demenz,
Alzheimer oder bei stark minderbegabten Patienten erheblich eingeschränkt.
Das Gleiche gilt für Menschen in akuten, schweren depressiven oder
psychotischen Phasen."
Aus
Margraf (1999, S. 141): Inadäquate Denkstile. Die inadäquaten
Kontrollüberzeugungen sollten durch Differenzierung von veränderbaren
und nicht veränderbaren Situationen und entsprechenden Bewältigungsstrategien
modifiziert werden. Durch Reattribuierungstechniken und alternative Erklärungen
sollen Erfolge auf eigene stabile Fähigkeiten zurückgeführt
und als jederzeit wiederholbar eingeschätzt werden, Mißerfolge
auf die Einwirkung anderer Personen, zufällige Geschehnisse oder mangelnden
Einsatz (statt Unfähigkeit) attribuiert werden (Roth & Rehm,
1985). Wichtig hierbei ist, daß der notwendige Disput nicht im Sinne
einer »Überredung« durch den Therapeuten, sondern durch
Realitätsüberprüfung durch den Patienten selbst erfolgt.
Das dichotome und rigide Denken kann in differenzierteres
Denken umgewandelt werden, indem zwar akzeptiert wird, daß es für
den Patienten keine völlig annehmbare Lösung des Problems zu
geben scheint, unter den abgelehnten Möglichkeiten aber u.U. eine
Rangreihe nach der Akzeptanz möglich ist (vgl. Freeman & Reinecke,
1995; Shneidman, 1984).
Bei einigen Patienten, deren Verhalten besonders
durch Omnipotenzgedanken und erwünschte mittelbare Konsequenzen nach
dem Tod gekennzeichnet ist (z.B. indem sie z.B. Sozialpartnern für
die Zeit nach ihrem Suizid genaue Verhaltensmaßregeln geben oder
Rachegedanken entwickeln), kann u.U. auch eine Konfrontation angezeigt
sein. Dies kann durch ein systematisches Durchdenken der Konsequenzen erfolgen,
mit dem Ziel, dem Patienten die fehlende Kontrollmöglichkeit über
die Durchführung solcher Anweisungen und die Nutzlosigkeit dieses
Vorhabens nach seinem Tod bewußt zu machen. Ähnliche Techniken
sind auch angebracht, wenn die Konsequenz der suizidalen Handlung eigentlich
nicht der Tod selbst ist, sondern mit dem Tod als Mittel zum Zweck Sozialpartner
beeinflußt werden sollen (z.B. bei Rachemotiven nach Kränkungen).
Generell ist zu vermitteln, daß diese Entscheidungen nicht so »frei«
sind, wie sie vermuten, sondern im Gegenteil das Verhalten nach relativ
rigiden Schemata ausgerichtet ist, die sich in der Lebensgeschichte nachweisen
lassen. Auch die oft irrationalen und magischen Vorstellungen über
die Konsequenzen der suizidalen Handlung, z.B. Vorstellung vom Tod als
»Schlaf«, muß korrigiert und das Endgültige und
Irreversible des Todes immer wieder betont werden (Achte, 1990)."
Kognitive Therapie
bei Denkfehlern und irrationalen Ideen
Ellis hat
eine spezielle Interaktions- und Interventionsmethode - die rational-Emotive-Therapie
(RET) - entwickelt, um ungünstige irrationale Ideen, die dem persönlichen
Fortschritt sehr im Wege stehen oder gar Neurosen hervorriefen und am Leben
erhalten, auszumerzen. Eine noch weit umfassendere Sammlung von kognitiven
Denkfehlern und Konzeptionen, wie man sie behandeln kann, findet sich im
Handbook
of cognitive Therapy von Mc
Mullin.
Kognitives
Training bei schizophrenen Psychosen
Hier sind eine Reihe von Methoden entwickelt worden. Z.B ein Integriertes
psychologisches Therapieprogramm für schizophrene Patienten (IPT)
enthält auch sog. kognitive Bausteine (Module). Eine neuere Arbeit
findet sich bei Bender
& Dittmann-Balcar (2007).
Vielversprechend erscheinen mir auch ganz gezielte
kognitive Ansätze zur besseren Bewältigung oder sogar Überwindung
der Vulnerabilität (Verletzlichkeit). Auch für paranoide Empfindlichkeiten
gibt es sehr gute Möglichkeiten, positiv kognitiv therapeutisch einzuwirken.
Kognitives
Training bei SchlaganfallpatientInnen und vergleichbaren hirnorganischen
Störungen
Üben und Trainieren ist für SchlaganfallpantientInnen seit
jeher für wichtig und hilfreich befunden worden. Neue Möglichkeiten
ergeben seit Bekanntwerden der sog. Spiegelneurone (Rizzolatti),
die zu einem wichtigen Erklärungs- und Therapiefaktor für das
Lernen am Modell, also für Lernen durch Zuschauen und Dabeisein, geworden
sind. So wird vom [IR
13.3.2008] berichtet: "Mitglieder des Kompetenznetzes Schlaganfall
erforschen neue Möglichkeiten der Rehabilitation nach Schlaganfall
... Die Spiegelneurone spielen eine Rolle bei der Wahrnehmung und Ausführung
von Bewegungen; sie verknüpfen Beobachtungen oder Geräusche mit
der eigentlichen Durchführung von Aktionen. Bereits in den 1990er
Jahren stellte der italienische Neurologe Vittorio Gallese fest, dass bestimmte
Nervenzellen nicht nur Signale abgeben, wenn sie eine Bewegung veranlassen,
sondern auch, wenn das Gehirn sich eine Bewegung nur vorstellt oder beobachtet.
Mit den Spiegelneuronen haben die Hirnforscher auch die physiologische
Grundlage des Mitgefühls und der Intuition entdeckt. Die Zellen befinden
sich nicht nur in einer Region, sie sind nach ihren Aufgaben im Gehirn
verteilt." Weitere Meldungen: [IR
14.5.10]: "Die Rolle von Spiegelneuronen ist weitreichender als bisher
angenommen. Spiegelneurone tragen nicht nur dazu bei, die Handlungen anderer
besser zu verstehen, sondern möglicherweise auch dazu, geeignete eigene
Reaktionen auf diese Handlungen auszuwählen." s.a. > [IR
24.9.2008: Chamäleoneffekt]
Kognitive Therapie
bei Minderbegabten
Minderbegabte können für ihre Weiterentwicklung von spezieller
Förderung naturgemäß sehr profitieren. Der Sonderschulpädagogik
kommt hier eine hervorragende Bedeutung zu. Denn in diesem Feld dürfte
der allgemeine therapeutische Grundsatz, man muss die Menschen dort abholen,
wo sie gerade stehen, eine vielleicht noch größere Bedeutung
haben als sonst. Durch Überforderung kann viel zunichte gemacht werden.
In diesem Feld könnten sich adaptive Testverfahren, die den jeweiligen
individuellen Fähigkeitsstand angemessen zu diagnostizieren gestatten,
sehr wichtig sein. Denn die allgemeine und paradox anmutende Therapieregel,
am erfolgsreichsten ist der Erfolg, kann nur dann wirken, wenn der Erfolg
und sei er noch so klein, tatsächlich eintritt.
8.3.3 (Sozial-)
Pädagogische Therapiemöglichkeiten
Wenn es gelingt, Interesse und Motivation zu wecken, sind die Möglichkeiten
für erfolgreiche (sozial-) pädagogische Therapiemöglichkeiten
sehr gut. Schon deshalb, weil entsprechende Erfolgserlebnisse zu einer
positiven Selbstverstärkungsschleife führen können.
8.3.4 Andere
und sonstige.
Eine der berühmtesten, vielleicht auch berüchtigsten Psychotherapien
der Geschichte, wurde mit Hilfe eines politischen Dekretes durchgeführt,
um die Selbstmordepidemie der Jungfrauen
von Milet zu stoppen. Hier wurde massiv, aber erfolgreich in das Denken
der Jungfrauen eingegriffen.
Bei psychischen Störungen gibt es viele Modeerscheinungen,
Epi- und Pandemien. In jüngerer Zeit sind sicher die Medien und ihre
suggestive Propaganda für die Entwicklung oder Förderung vielen
Störungen verantwortlich. Denn alles
was erlebt und erfahren wird, hat durch das bloße Geschehen einen
suggestiven Charakter.
Manche Störungen sind nützlich, werden von der Gesellschaft
oder sonst wem belohnt und von daher gefördert. Manche Störungen
werden gar nicht als solche angesehen, sondern gelten als erstrebenswert,
womöglich gar als Ideal (Selbstmordattentate, tödliche Hungerexzesse
von Models).
Werden die Kosten für bestimmte Therapien nicht mehr übernommen,
können - müssen nicht - Störungen sehr drastisch zurückgehen.
Therapien können "schick" oder "in" sein oder werden und von
vielen bei entsprechender medialer Aufbereitung und Propaganda auch eine
"boomende" Nachfrage erleben. Und die therapeutische Industrie wirkt hier
natürlich interessengeleitet auch entsprechend mit.
8.4
Erhaltung, Verbesserung, Training und Optimierung des Denkens.
Wie insgesamt ist auch hier die Literatur kaum übersehbar, was
aber die Bedeutung des Denkens für das Leben nur unterstreicht.
Wissenschaftlicher und praktischer Apparat, Belege und Hilfen
Literatur
(Auswahl)
Die Literatur zum Denken und seiner Umgebung
ist sehr, sehr umfangreich. Ich beschränke mich hier auf die Werke,
die ich in der Arbeit ausdrücklich genutzt und genannt oder verwendet
habe. Nahestehende IP-GIPT-Literaturlisten: Analogie,
Erfinden, Heuristik, Intuition, Irrtum, Kreativmethoden, Problemlösung,
Produktives Denken, Schöpferische Prozesse * Literatur
zur wissenschaftlichen Symboltheorie * Beweis
und beweisen in Wissenschaft und Leben * Definition
und definieren * Assoziation
* Alles und jeder*
Evaluation
und Experiment * Wissenschaftliches
Arbeiten *
Externe Literaturliste mueller
science: Philosophie des Denkens (ab 1480), Denkpsychologie (1901),
Problemlösen (1907/25) und Kognitive Psychologie (1956/67) Philosophy
of Thinking, psychology of thinking, problem solving, cognitive psychology.
> Denken in Eislers Wörterbuch.
- Ach, Narziss (1900) Ueber geistige Leistungsfähigkeit im Zustande des eingeengten Bewusstseins. In: Zeitschrift für Hypnotismus, Psychotherapie sowie andere psychophysiologische und psychopathologische Forschungen 9: 1-4.
- Ach, Narziss (1905). Über die Willenstätigkeit und das Denken. Eine experimentelle Untersuchung mit einem Anhange; Über das Hippsche Chronoskop. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ach, Narziss (1921). Über die Begriffsbildung. Bamberg: Buchners.
- Aebli, Hans (1980). Denken: das Ordnen des Tuns. Bd. I. Kognitive Aspekte der Handlungstheorie. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Aebli, Hans (1981). Denken: das Ordnen des Tuns. Bd. II. Denkprozesse. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Albertz, Peter (2009) Denken. Systematische Betrachtungen. Würzburg: Könighausen und Neumann.
- Anderson, J. A. (1977). Neural models with cognitive implications. In LaBerge, D. and Samuels, S. J., editors, Basic processes in reading perception and comprehension, pages 27–90. Erlbaum, Hillsdale, N.J.
- Anderson, J. A. (1983). Cognitive and psychological computation with neural models. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 13:799–815.
- Anderson, John R. (dt. 1988, engl. 1985). Kognitive Psychologie. Heidelberg: Spektrum.
- Arnauld, Antoine & Nicole, Pierre (dt. 1994, fr. 1685). Die Logik oder die Kunst des Denkens. Darmstadt: WBG.
- Arnheim, Rudolf (dt. 1980, 4.A., engl. 1969). Anschauliches Denken. Köln: DuMont.
- Aster, Ernst von (1908). Die psychologische Beobachtung und experimentelle Untersuchung von Denkvorgängen. In: Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane 49: 56-107.
- Baerwald, Richard (1908). Die Methode der vereinigten Selbstwahrnehmung. In: Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane 46: 174-198.
- Bartlett, Frederic (dt. 1952, engl. 1951). Denken und Begreifen. Experimente der praktischen Psychologie. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Beller, Sieghart (1997). Inhaltseffekte beim Logischen Denken - Der Fall der Wason'schen Wahlaufgabe. Eine wissensbasierte Lösung für ein altes Problem. Lengerich: Pabst.
- Bender, Stefan & Dittmann-Balcar, Alexandra (2007). Kognitives Training bei Schizophrenie. In (589-598): Kircher, Tilo & Gauggel, Siegfried (2007, Hrsg.). Neuropsychologie der Schizophrenie. Symptome, Kognition, Gehirn. Berlin: Springer. [O]
- Benetka, Gerhard (2002). Denkstile der Psychologie: Das 19. Jahrhundert. Wien: Facultas.
- Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1980, 5.A.). Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt aM: Fischer.
- Bergius, R. (1964, Hrsg.). Der Aufbau des Erkennens. 2. Halbband: Lernen und Denken. Handbuch der Psychologie, Allgemeine. Göttingen: Hogrefe.
- Biedenkapp, Georg (1896). Denk-Dummheiten. Merkworte zur geistigen Selbstzucht. Leipzig: Naumann.
- Bierbaumer, Niels & Schmidt, Robert F. (2003). Biologische Psychologie. Berlin: Springer.
- Binet, Alfred (1894). The mechanism of thought. Fortnightly Review, vol. LV, N. S., June 1894.
- Binet, Alfred (1903). L'étude expérimentale de l'intelligence. Paris: Schleicher.
- Bischof-Köhler, Doris (1989). Spiegelbild und Empathie. Die Anfänge sozialer Kognition. Bern: Huber.
- Bleuler, Eugen (1975; 1921 1.A.). Das autistisch-undisziplinierte Denken in der Medizin und seine Überwindung. Berlin: Springer.
- Bleuler, Eugen (1923, 4.A.) Lehrbuch der Psychiatrie. Berlin: Springer.
- Bleuler, Eugen (1932, 1921 1.A.). Naturgeschichte der Seele und ihres Bewußtwerdens. Mnemistische Biopsychologie. Berlin: Springer.
- Bleuler, Eugen (1972, 12.A.). Lehrbuch der Psychiatrie. Neubearbeitet von Manfred Bleuler. Berlin: Springer.
- Bochenski, I.M. (1965). Die zeitgenössischen Denkmethoden. Bern: Francke (Dalp TB).
- Bochenski, I.M. (1967). Wege zum philosophischen Denken. Einführung in die Grundbegriffe. Freiburg: Herder.
- Boxsel, Matthijs van (dt.2001, ndl. 1999 ). Die Enzyklopädie der Dummheit. Berlin: Eichborn.
- Brentano, Franz (1924; 1874). Psychologie vom empirischen Standpunkt aus. Erster Band. Hamburg: Meiner.
- Brentano, Franz (1925). Psychologie vom empirischen Standpunkt aus. Zweiter Band. Hamburg: Meiner.
- Bruner, J. S., Goodnow, J. J., & Austin, G. A. (1956). A study of thinking. New York: Wiley.
- Bruner, J. S., Olver, R. R., & Greenfield, P. M. (1966). Studies in cognitive growth. New York: Wiley.
- Brunswig, A. (1910). Das Vergleichen und die Relationserkenntnis. Leipzig: Teubner.
- Bühler, Karl (1907). Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge. I. Über Gedanken. (Würzburger Habilitationsschrift.) Archiv für die gesamte Psychologie 9, 297-365.
- Bühler, Karl (1907). Eine Analyse komplizierter Denkvorgänge. In: Schumann, F. (Hg.) Bericht über den II. Kongreß für experimentelle Psychologie in Würzburg. 263—266.
- Bühler, Karl (1908). Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge: II. Über Gendankenzusammenhängen III. Über Gedankenerinnerungen, IV.
- Bühler, Karl (1908) Antwort auf die von W. WUNDT erhobenen Einwände gegen die Methode der Selbstbeobachtung an experimentell erzeugten Erlebnissen. In: Archiv für die gesamte Psychologie 12: 93-122.
- Bühler, Karl (1909). Zur Kritik der Denkexperimente. Zeitschrift für Psychologie 51, 108-118.
- Bühler, Karl (1912). Denken. Handwörterbuch der Naturwissenschaften, hrsg. von E. Korschelt und al., Bd. 2, Jena, Fischer, 889-896.
- erzeugten Erlebnissen ", Archiv für die gesamte Psychologie 12, 1-23, 24-92, 93-123.
- Bühler, Karl (1918). Die geistige Entwicklung des Kindes. Jena: G. Fischer [2 : 1921, 3 :1922, 4 : 1924, 5 : 1929, 6 : 1930].
- Bühler, Karl (1919). Eine Bemerkung zu der Diskussion über die Psychologie des Denkens. Zeitschrift für Psychologie 82, 97-101.
- Bühler, Karl (1919). Abriss der geistigen Entwicklung des Kindes. Leipzig: Quelle & Meyer. [2 : 1925, 3 : 1928. 4 : 1929, 5 : 1929, 6 : 1935, 7 : 1949, 8 : 1958, 9 : 1967].
- Bühler, Karl (1921) Der Ursprung des Intellektes. Die Naturwissenschaften 9, 144-155.
- Bühler, Karl (1927). Die Krise der Psychologie. Jena: G. Fischer.
- Bühler, Karl (1969). Die Uhren der Lebewesen. Studien zur Theorie der raumzeitlichen Orientierung. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte, 265. Band, Wien, Böhlaus Nachf., 71-160.
- Bühler, Karl (1969). Der Modellgedanke in der Psychologie. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte, 265. Band, Wien, Böhlaus Nachf., 169-220.
- Burri, Alex & Huemer, Wolfgang (2007, Hrsg.). Kunst denken. Paderborn: mentis.
- Carnap, Rudolf (1932/33). Psychologie in physikalischer Sprache. In: Erkenntnis 3: 107-142.
- Carnap, Rudolf (1961, 1. A. 1928). Der logische Aufbau der Welt. Hamburg: Meiner.
- Carnap, Rudolf (1934, 2.A. 1968). Logische Syntax der Sprache. Wien: Springer.
- Cherry, Colin (dt. 1967 2.A.). Kommunikationsforschung - eine neue Wissenschaft. Frankfurt aM: Fischer.
- Claparède, Edouard (1917) La psychologie de I'inteligence, Scienta, Nov. 1917.
- De Witt, Hermann (1983). Analogik. Bd. 1: Grundlagen einer Wissenschaft der Analogien, ihre Gesetze und Anwendungen. Oberwil: Kugler.
- De Witt, Hermann (1982). Analogik. Bd.2: Anwendung der Analogiegesetze auf Person, Nation, Fahrer, Wagen, Seele, Leib, Tag, Jahr, Menschenleben. Oberwil: Kugler.
- De Witt, Hermann (1983). Analogik. Bd. 3: Anwendung der Analogiegesetze auf räumliche, zeitliche und physikalische Analogien. Oberwil: Kugler.
- Dörner, Dietrich (1974). Die kognitive Organisation beim Problemlösen. Versuche zu einer kybernetischen Theorie der elementaren Informationsverarbeitungsprozesse beim Denken. Bern: Huber.
- Dörner, Dietrich (1979, 2.A.). Problemlösung als Informationsverarbeitung. Stuttgart: Kohlhammer.
- Dörner, Dietrich; Bick, Thomas; Brüderl, Leokadia; Jüttner, Anneliese; Klee, Ute & Reh, Helmut (1983). Lohhausen. Vom Umgang mit Unbestimmtheit und Komplexität. Bern: Huber.
- Dörner, Dietrich (1992). Die Logik des Mißlingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen. Reinbek: Rowohlt.
- Dörner, Dietrich (1999). Bauplan für eine Seele. Das Bamberger Projekt Y im Buch. Reinbek: Rowohlt.
- Dornseiff, Franz (1959). Das Denken. In: Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, Kap. 12. Berlin: De Gruyter. [Auszug Kap. 12]
- Dürr, Ernst (1903) Ueber die Grenzen der Gewissheit. Würzburg: Anton Boegler.
- Dürr, Ernst (1908). Über die experimentelle Untersuchung der Denkvorgänge. In: Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane 49: 313-340.
- Dürr, Ernst (1909). Über die experimentelle Untersuchung der Denkvorgänge. In: Schumann, F. (Hg.) Bericht über den III. Kongreß für experimentelle Psychologie in Frankfurt a.M. 232—234.
- Duncker, Karl (1935) Zur Psychologie des produktiven Denkens. Berlin:
- Dunlap, Knight (1912). The case against introspection. In: The Psychological Review 19: 404—413.
- Ebert, Manfred (1993) Grundgedanken einer Psychologie des logischen Denkens. Basel: Sonderdruck Selbstverlag.
- Eidens, H. (1929) Experimentelle Untersuchungen über den Denkverlauf bei unmittelbaren Folgerungen. Arch. ges. Psychol., 71,1-66.
- Eisenhans, Theodor (1897). Selbstbeobachtung und Experiment in der Psychologie. Ihre Tragweite und ihre Grenzen. Freiburg i. Br. u.a.: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Ellis, Albert (dt. 1977, engl. 1975, 9.A. ). Irrationale Ideen, die psychische Störungen verursachen und aufrechterhalten. In (63-90): Die rational-emotive Therapie. Das innere Selbstgespräch bei seelischen Problemen und seine Veränderung. München: Pfeiffer.
- Engelkamp, Johannes (1984, Hrsg). Psychologische Aspekte des Verstehens. Berlin: Springer.
- Engisch, Karl (1956). Einführung in das juristische Denken. Stuttgart: Kohlhammer (Urban TB).
- English, Horace Bidwell (1921) In aid of introspection. In: The American Journal of Psychology 32: 404-414.
- English, H. B. (1922) An experimental study of certain initial phases of abstraction. Am J. Psychol., 33, 305-350.
- Erdmann, Benno (1895). Zur Theorie der Beobachtung. In: Archiv für systematische Philosophie 1: 14-33, 145-164.
- Erdmann, B. (1908) Umrisse zur Psychologie des Denkens. 2. A., Tübingen:
- Feldkeller, Paul (1913;14). Untersuchungen über normatives und nichtnormatives Denken. Diss. Univ. Tübingen 1913; Borna/ Leipzig: Noske 1914.
- Feldkeller, P. (1949) Das unpersönliche Denken. Berlin.
- Feldmann, Paul (1973). Denktraining. Ein praktisches Übungsprogramm, um besser verstehen, überlegen, prüfen und urteilen zu können. München: Heyne. [theoretisch sehr schwach, vertritt z.B. S. 12 Denken sei an Sprache gebunden]
- Feyerabend, Paul (1980). Erkenntnis für freie Menschen. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Feyerabend, Paul (dt. 1979, engl. 1975). Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Flach, A. (1925) Über symbolische Schemata im produktiven Denkprozeß. Arch. ges. Psych 32, 369-440.
- Fleischer, Jürgen (2008). Denken und Sprechen. Eine Untersuchung über das Wesen von Denken und von Sprechen und über das Verhältnis von Denken und Sprechen unter dem Gesichtspunkt des Erkennens. Oldenburg: Selbstverlag.
- Foppa, K. (1958) Hypothesenbildung bei einfachen Denkprozessen. Ber. Dtsch. Ges. Psychol. 21, 174-177.
- Franke, Ulrike (1984, 2.A.). Logopädisches Handlexikon. München: Reinhardt (UTB).
- Francis, E.K. (1965). Wissenschaftliche Grundlagen Soziologischen Denkens. Bern: Francke.
- Frege, Gottlob (1918) Der Gedanke Eine logische Untersuchung. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus, 1, Heft 1, 58-77. Wieder abgedruckt in Patzig, Günter (1966, Hrsg.) Gottlob Frege. Logische Untersuchungen. Göttingen; Vandenhoeck & Ruprecht.
- Frege, Gottlob (1919) Die Verneinung Eine logische Untersuchung. Teil. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus, 2, Heft 1, 143-157. Wieder abgedruckt in Patzig, Günter (1966, Hrsg.) Gottlob Frege. Logische Untersuchungen. Göttingen; Vandenhoeck & Ruprecht.
- Frege, Gottlob (1923) Das Gedankengefüge Logische Untersuchungen Dritter Teil. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus, 3, Heft 1, 36-51. Wieder abgedruckt in Patzig, Günter (1966, Hrsg.) Gottlob Frege. Logische Untersuchungen. Göttingen; Vandenhoeck & Ruprecht.
- Funke, Joachim (2006, Hrsg.). Denken und Problemlösen. Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich C, Theorie und Forschung, Serie II. Kognition, Bd. 8. Denken und Problemlösen.
- Furth, Hans G. (dt. 1972, engl. 1966). Denkprozesse ohne Sprache. Düsseldorf: Schwann.
- Galton, Francis. (1880). Statistics of mental imagery. Mind, 5, 301-318. [Online]
- Ganter, B.; Wille, R. & Wolff, K.E. (1987). Beiträge zur Begriffsanalyse. Vorträge der Arbeitstagung Begriffsanalyse, Darmstadt 1986. Mannheim: BI.
- Geiger, Theodor (1953) Ideologie und Wahrheit. Eine soziologische Kritik des Denkens. Stuttgart: Humboldt.
- Geyer, Horst (1954). Über die Dummheit. Ursachen und Wirkungen der intellektuellen Minderleistungen der Menschen. Ein Essay. Wiesbaden: VMA.
- Geyser, Joseph (1908). Vorzüge und Schwächen der neueren Untersuchung der Denkvorgänge durch das Aussageexperiment. In: Philosophischesjahrbuch 21: 90-102.
- Geyser, Joseph (1909). Einführung in die Psychologie der Denkvorgänge. 5 Vorträge [...] Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Ghiselin, B. (1952) The creative process. A symposium. Berkeley.
- Gibson, J. J. (1941) A critical review of the concept of set in contemporary experimental psychology. Psychol. Bull., 38, 781-817.
- Glucksmann, André (dt.1985 fr.1985). Die Macht der Dummheit. Stuttgart: DVA.
- Graumann, Carl Friedrich (1965, Hrsg.). Denken. Köln: Kiepenheuer & Witsch. [Reader mit über 30 z.T. "klassischen" Texten oder Auszügen aus solchen]
- Grossberg, S. (1980). How does the brain build a cognitive code? Psychological Review, 87:1–51.
- Gründer, Gerhard (2008). Pharmakotherapie kognitiver Störungen. In: Kircher, T. & Gauggel, S. (2008, Hrsg.), 599-612.
- Hallpike, Christopher Robert (dt. 1990, engl. 1979). Die Grundlagen primitiven Denkens. München: dtv.
- Hansen, Wilhelm (1949). Die Entwicklung des kindlichen Weltbildes. München: Kösel.
- Hartmann Dirk (1998). Denken. In (164-200): Philosophische Grundlagen der Psychologie. Darmstadt: WBG.
- Hassenstein, Bernhard (1992). Klugheit. Zur Natur unserer geistigen Fähigkeiten. München: Piper.
- Hebb, D. O. (1949). The Organization of Behavior. New York: Wiley.
- Hejl, Peter M. (2001). Universalien und Konstruktivismus. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Helgi, Jon (2005). Poretisches Denken. Diessen: NotaBene.
- Hensel, K. Paul (1977). Systemvergleich als Aufgabe. Stuttgart: G. Fischer.
- Herbart, J. F. (1877). Possibility and necessity of applying mathematics in psychology (H. Haanel, Trans.). Journal of Speculative Philosophy, 11, 251-264. [Online]
- Herholz, Karl & Heindel, Walter (1996). Bildgebende Verfahren. In: Markowitsch (1996, Hrsg.; 635-723).
- Hobson, Peter (dt. 2003, engl. 2002). Wie wir denken lernen. Gehirnentwicklung und die Rolle der Gefühle. Düsseldorf: Walter. [Auch Denken von autistischen Kindern untersucht]
- Höffding, Harald (1903, 1911). Der menschliche Gedanke, seine Formen und seine Aufgaben. Erw. Ausg. d. "Philosophischen Probleme" (1903). Leipzig: Reisland.
- Hofstadter, Douglas & Sander, Emanuel (dt. 2014) Die Analogie. Das Herz des Denkens. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Hönigswald, Richard (1921). Die Grundlagen der Denkpsychologie. Studien und Analysen. München: Reinhardt. Das Buch enthält fünf Abhandlungen:
- Ueber das sogenannte Verlieren des Fadens.
- Ist Psychisches zählbar?
- Ueber Begriff und Möglichkeit des Psychologismus.
- Ueber das Begriffspaar "Inhalt-Gegenstand" (Zum Problem der Bedeutung).
- Zum Problem des geordneten Denkens.
- Ueber die Stellung der Psychologie im System der Wissenschaften.
- Hopfield, J. J. (1982). Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 79:2554–2558.
- Hopfield, J. J. (1984). Neurons with graded response have collective computational properaties like those of two-state neurons. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 81:3088–3092.
- Hunziker, Hans-Werner (1964). Plastizität als Faktor der Spannungsüberwindung in Denkaufgaben. Eine feldtheoretisch- faktorenanalytische Untersuchung der Umstrukturierung von Problemsituationen. In: Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie. Band 11, Heft 2, Springer, Berlin 1964. [PDF] Anmerkung: Die Korrelationsmatrix im Teil 3 enthält einen Symmetriefehler in Zeile 5 Spalte 7 bzw. Zeile 7 Spalte 5 (.38 zu .18).
- Hussy, Walter (1984). Denkpsychologie. Ein Lehrbuch. Bd. 1: Geschichte, Begriffs- und Problemlöseforschung, Intelligenz. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hussy, Walter (1986). Denkpsychologie. Ein Lehrbuch. Bd. 2: Schlußfolgern, Urteilen, Kreativität, Sprache, Entwicklung, Aufmerksamkeit. Stuttgart: Kohlhammer.
- Iwin, A.A. (dt.1975, russ. 1970). Die Logik von Wertungen. Berlin: Akademie.
- Janke, W. & Schneider, W. (1999). 100 Jahre Institut für Psychologie und Würzburger Schule der Denkpsychologie. Göttingen: Hogrefe.
- James, William (1884). On some omissions of introspective psychology. In: Mind 9: 1-26.
- James, William. (1892). The stream of consciousness. From Psychology (chapter XI). Cleveland & New York, World. [A somewhat shorter account of consciousness than that found in the full Principles.] [deutsch]
- Jegge, Jürg (1983). Dummheit ist lernbar. Erfahrungen mit "Schulversagern". Reinbek: Rowohlt.
- Jörg, Sabine (1984). Möglichkeiten und Grenzen der Bewußtseinslenkung beim Hörer. In (91-109): Engelkamp, J. (1984, Hrsg.)
- Jung, Carl G. (1910). The association method. American Journal of Psychology, 31, 219-269. [Introduction of Jungian psychology to North America; Jung's most important empirical work.]
- Kamlah, W., Lorenzen, P. (1967). Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens. Mannheim: Bibliographisches Institut.
- Kant, Immanuel (1787). Die Kritik der reinen Vernunft. [Online 2.A.]
- Katona, Georg (1924). Psychologie der Relationserfassung und des Vergleichens. Leipzig: Barth.
- Kaufmann, Liane; Nuerk, Hans-Christoph; Konrad, Kerstin & Willmes, Klaus (2007, Hrsg.). Kognitive Entwicklungsneurospsychologie. Göttingen: Hogrefe.
- Keller, Evelyn Fox (dt. 1998, engl. 1995). Das Leben neu denken. Metaphern der Biologie im 20. Jahrhundert. München: Kunstmann.
- Kircher, T. & Gauggel, S. (2008, Hrsg.): Neuropsychologie der Schizophrenie. Heidelberg: Springer.
- Klix, Friedhart (1971). Information und Verhalten. Kybernetische Aspekte der organismischen Informationsverarbeitung. Einführung in naturwissenschaftliche Grundlagen der Allgemeinen Psychologie. Bern: Huber.
- Klix, Friedhart (1980). Erwachendes Denken. Eine Entwicklungsgeschichte der menschlichen Intelligenz. Berlin: VEB d. Wiss.
- Klix, Friedhart (1993) Erwachendes Denken. Geistige Leistungen aus evolutionspsychologischer Sicht. Heidelberg: Spektrum.
- Kluwe, R.H. & Spada, H. (1981, Hrsg.). Studien zur Denkentwicklung. Bern: Huber.
- Koch-Hillebrecht, M. (1978). Der Stoff aus dem die Dummheit ist. Eine Sozialpsychologie der Vorurteile. München: C.H. Beck.
- Köhler, Wolfgang (1917, 3.A. 1973). Intelligenzprüfungen an Menschenaffen. Berlin: Springer.
- Koffka, Kurt (1911). Über Vorstellungen. Leipzig: August Fries.
- Koffka, Kurt (1927). Bemerkungen zur Denk-Psychologie. Psychologische Forschung, 9,1, 163-183.
- Kohonen, T. (1977). Associative memory: A system theoretical approach. Springer, New York.
- Kohonen, T. (1982). Self-organized formation of topologically correct feature maps. Biological Cybernetics, 43:59–69.
- Koller, Siegfried (1989). Vom Wesen der Erfahrung. Stuttgart: Trias (Thieme).
- Kramar, Udalrich (1914). Neue Grundlagen zur Psychologie des Denkens. Brünn: Winiker.
- Kreiser, Lothar (2003) Was denken wir, wenn wir denken? Wilhelm Drobischs Beitrag zur Entwicklung der Logik. In (2003) Moritz Wilhelm Drobisch anlässlich seines 200. Geburtstages. Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig • Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse • Band 60 • Heft 3. ISBN: 3777612839
- Külpe, Oswald (1893). Grundriß der Psychologie. Leipzig: Engelmann. [OL]
- Külpe, Oswald (1904). Versuche über Abstraktion. In: Schumann, F. (Hg.) Bericht über den I. Kongreß für experimentelle Psychologie in Gießen. 56-68.
- Külpe, Oswald (1912a) Über die Bedeutung der modernen Denkpsychologie. In: Schumann, F. (Hg.) Bericht
- Külpe, Oswald (1912b) Über die moderne Psychologie des Denkens. In: Internationale Monatsschrift für Wissenschaft Kunst u. Technik VI: Sp. 1069-1110.
- Külpe, Oswald (1912c). Wilhelm Wundt zum 80. Geburtstage. In: Archiv für die gesamte Psychologie 24: 105-110.
- Külpe, Oswald (1912). Die Realisierung. Bd. 1. Ein Beitrag zur Grundlegung der Realwissenschaften. Posthum von Messer herausgegeben. Leipzig: Hirzel. [OL]
- Külpe, Oswald (1920). Die Realisierung. Bd. 2. Ein Beitrag zur Grundlegung der Realwissenschaften. Leipzig: Hirzel.
- Külpe, Oswald (1923). Die Realisierung. Bd. 3. Ein Beitrag zur Grundlegung der Realwissenschaften. Posthum von Messer herausgegeben. Leipzig: Hirzel.
- Küppers, Bernd-Olaf (1990) Der Ursprung biologischer Information. Zur Naturphiliosophie der Lebensentstehung. München: Piper.
- Küppers, E.W.Udo (2018) Die humanoide Herausforderung. Leben und Existenz in einer anthropozänen Zukunft. Wiesbaden: Springer-Vieweg.
- Kutzner, Marianne (1991). Mentale Konstruktion von Begriffen. Eine Untersuchung auf der Grundlage der genetischen Erkenntnistheorie Jean Piagets.
- Laing, Ronald; Philippson, H. & Lee, A. R. (dt. ). Interpersonelle Wahrnehmung. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Langer, Ellen J. (dt. 1991, engl. 1989). Aktiv denken. Wie wir geistig auf der Höhe bleiben. Reinbek: Rowohlt.
- Lenk, Hans (2001) Das Denken und sein Gehalt. München: Oldenbourg. [GB]
- Leuders, Timo; Naccarella, Dominik & Philipp, Kathleen (2011) Experimentelles Denken – Vorgehensweisen beim innermathematischen Experimentieren. J Math Didakt 32, 205–231
- Lévy-Bruhl, Lucien (dt. 1926, 2. A.). Das Denken der Naturvölker. Wien u. Leipzig: W. Braumüller.
- Lévy-Bruhl, Lucien (dt. 1927). Die geistige Welt der Primitiven. München: F. Bruckmann A.-G.
- Lévi-Strauss, Claude (dt. 1968, fr. 1962 ). Das wilde Denken. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Lindworsky, Johannes (1913). Neuere Arbeiten über die Methode der Selbstbeobachtung. In: Archiv für die gesamte Psychologie 29: Literaturbericht 49-62.
- Locke, John (dt. 1962; engl. 1689). Über den menschlichen Verstand. 2 Bde. Hamburg: Meiner.
- Lohberg, Rolf & Lutz, Theo (1963). Was denkt sich ein Elektronengehirn? Ein aktuelles Thema - verständlich dargestellt. München: Heyne.
- Lohmar, Dieter () Denken ohne Sprache? Zur Phänomenologie alternativer Repräsentations-Systeme kognitiver Inhalte beim Menschen und anderen Primaten . Meaning and Language: Phenomenological Perspectives pp 169-194 Part of the Phaenomenologica book series (PHAE, volume 187)
- Lohmar, Dieter (2016) Denken ohne Sprache. Phänomenologica 219. Berlin: Springer.
- Lompscher, Joachim (1972, Hrsg.). Probleme der Ausbildung geistiger Handlungen. Neuere Untersuchungen zur Anwendung der Lerntheorie Galperins. Berlin: Volk und Wissen.
- Lompscher, Joachim (1972, Hrsg.). Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Entwicklung geistiger Fähigkeiten. Berlin: Volk und Wissen.
- Lorenzen, Paul & Schwemmer, Oswald (1973). Konstruktive Logik, Ethik und Wissenschaftstheorie. Mannheim: BI.
- Lüer, Gerd (1973). Gesetzmäßige Denkabläufe beim Problemlösen. Ein empirischer Beitrag für eine psychologische Theorie der Entwicklung des Denkens. Weinheim: Beltz.
- Lurija, Alexander Romanowitsch (1982; russ. 1979) Sprache und Bewußtsein. Pahl-Rugenstein.
- Lurje, Walter (1923). Mystisches Denken, Geisteskrankheit und moderne Kunst. (= Kleine Schriften zur Seelenforschung, 4, herausgegeben von Arthur Kronfeld). Stuttgart: J. Püttmann.
- Mach, Ernst (1922). Die Empfindungen. [Begriffe S. 262-67] 9.A. mit Zusätzen. Jena. G. Fischer.
- Mach, Ernst (1968=1926 4.A.). Erkenntnis und Irrtum. Darmstadt: WBG.
- Malsburg, C. von der (1973). Self-organizing of orientation sensitive cells in the striate cortex. Kybernetik, 14:85–100.
- Marbe, Karl (1901). Experimentell-psychologische Untersuchungen über das Urteil. (Eine Einleitung in die Logik): Leipzig: Engelmann.
- Marbe, Karl (1915). Zur Psychologie des Denkens. In: Ders. (Hg.) Fortschritte der Psychologie und ihrer Anwendungen 3: 1-42.
- Marbe, Karl. (1930). Autobiography of Karl Marbe. In C. Murchison (Ed.), History of Psychology in Autobiography (Vol. 1, pp. 181-213). Worcester, MA: Clark University Press. [The prominent Würzburg psychologist's account of his own life.]
- Margraf, Jürgen (1999, Hrsg., 2.A.). Lehrbuch der Verhaltenstherapie. Bd. 2. Störungen - Glossar. Berlin: Springer.
- Markowitsch, Hans J. (1996, Hrsg.). Grundlagen der Neuropsychologie. Enzyklopädie der Psychologie, C Theorie und Forschung, Serie 1 Biologische Psychologie Bd. 1. Göttingen: Hogrefe.
- Markowitsch, Hans J. (1997, Hrsg.). Klinische Neuropsychologie. Enzyklopädie der Psychologie, C Theorie und Forschung, Serie 1 Biologische Psychologie Bd. 2. Göttingen: Hogrefe.
- Mayer, August & Orth, Johannes (1901) Zur qualitativen Untersuchung der Association. In: Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane 26: 1-13.
- Mayer, Richard E. (dt. 1979, engl. 1977). Denken und Problemlösen. Berlin: Springer.
- Mc Mullin, Rian E. (1986). Handbook of Cognitive Therapy Techniques. New York: Norton.
- Meili, Richard & Rohracher, Hubert (1968, 2.A.). Denken. In (172-234): Lehrbuch der experimentellen Psychologie. Bern: Huber.
- Meinong, A. (1904) Über Gegenstandstheorie. In (1-50) Meinong, A. (1904, Hrsg.) Untersuchungen zur Gegenstandstheorie und Psychologie. Leipzig: Barth.
- Merlau-Ponty, Maurice (dt. 1966. fr. 1945). Phänomenologie der Erfahrung. Berlin: de Gruyter.
- Messer, August (1900) Kritische Untersuchungen über Denken, Sprechen und Sprachunterricht. Berlin: Reuther & Reichard.
- Messer, August (1906). Experimentell-psychologische Untersuchungen über das Denken. In: Archiv für die gesamte Psychologie 8: 1-224.
- Messer, August (1907) Bemerkungen zu meinen „Experimentell-psychologischen Untersuchungen über das Denken". In: Archiv für die gesamte Psychologie 10: 409—428.
- Messer, August (1928). Empfindung und Denken. 3. Aufl. [1. Aufl. 1907.] Leipzig: Quelle & Meyer.
- Messer, August (1931). Die Würzburger Schule. In: Saupe, Emil (Hg.) Einführung in die neuere Psychologie. Osterwieck: A. W. Zickfeldt. 16-25.
- Metzger. W. (1966, Hrsg.). Der Aufbau des Erkennens. 1. Halbband: Wahrnehmung und Bewußtsein. Handbuch der Psychologie, Allgemeine. Göttingen: Hogrefe.
- Michotte, Albert (1907). A propos de la „méthode d'introspection" dans la psychologie expérimentale. In: Revue Néo-Scolastique 14: 507-532
- Mill, John Stuart (dt. 1849, engl. 1846). Die inductive Logik: eine Darlegung der philosophischen Principien wissenschaftlicher Forschung, insbesondere der Naturforschung. Braunschweig: Vieweg.
- Minsky, M. and Papert, S. (1969). Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry. MIT Press, Cambridge, MA.
- Moskiewicz, Georg (1910). Zur Psychologie des Denkens. Leipzig: Engelmann.
- Müller, Georg Elias (1911-17). Zur Analyse der Gedächtnistätigkeit und des Vorstellungsverlaufes. 3 Bde, Leipzig: Barth. [Nachdruck Amsterdam: Swets & Zeitlinger 1970].
- Müller, Ernst; Schmieder, Falko (2008, Hrsg.). Conceptual History of the Natural Sciences / Begriffsgeschichte der Naturwissenschaften. Zur historischen und kulturellen Dimension naturwissenschaftlicher Konzepte. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
- Occam, Wilhelm von [1288-1347] (1323, dt. 1996) Texte zur Erkenntnis und der Wissenschaft. Aus der Summa Logicae. Stuttgart: Rclam.
- Oerter, Rolf (1980, 6.A.). Psychologie des Denkens. Donauwörth: Auer.
- Oerter, Rolf & Montada, Leo (1998, 4.A., Hrsg.). Entwicklungspsychologie. Weinheim: Beltz PVU.
- Oettingen, Gabriele (1997). Psychologie des Zukunftsdenkens. Göttingen: Hogrefe.
- Oppenheimer, Hans (1925). Die Logik der soziologischen Begriffsbildung. Tübingen: Mohr.
- Orth, Johannes (1901). Kritik der Associationseinteilungen. In: Zeitschrift für pädagogische Psychologie und Pathologie 3: 104-119.
- Pascal, Blaise (1670) Gedanken. Gutenbergprojekt.
- Perrig, Walter J. (1988). Vorstellungen und Gedächtnis. Berlin: Springer.
- Peters, Roger (dt. 1991). Praktische Intelligenz. München: mvg.
- Peters, Uwe Henrik (1984). Wörterbuch der Psychiatrie und medizinischen Psychologie. München: Urban & Schwarzenberg.
- Piaget, Jean (dt. 1978, fr. 1926). Das Weltbild des Kindes. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Piaget, Jean; Inhelder, Bärbel & Szeminska, Alina (dt. 1975, fr. 1948). Die natürliche Geometrie des Kindes. GW 7 Studienausgabe. Stuttgart: Klett.
- Piaget, Jean (dt. 1975, fr. 1950). Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde. GW 2 Studienausgabe. Stuttgart: Klett.
- Piaget, Jean (dt. 1976, fr. 1975). Die Äquilibration der kognitiven Strukturen. Stuttgart: Klett.
- Piaget, Jean (dt. 1976, fr.). Sprechen und Denken des Kindes. Frankfurt: Ullstein.
- Piaget, Jean (dt. 1981, fr.). Urteil und Denkprozeß des Kindes. Frankfurt: Ullstein.
- Piaget, Jean (dt. 1990, fr. 1966). Die Entwicklung des inneren Bildes beim Kind. Frankfurt: Suhrkamp.
- Piaget, Jean (dt. 1975, fr. 1959). Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde. GW 1 Studienausgabe. Stuttgart: Klett.
- Piaget, Jean & Szeminska, Alina (dt. 1975, fr.). Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde. GW 3 Studienausgabe. Stuttgart: Klett.
- Piaget, Jean & Inhelder, Bärbel (dt. 1975, fr.). Die Entwicklung der physikalischen Mengenbegriffe beim Kinde. GW 4 Studienausgabe. Stuttgart: Klett.
- Piaget, Jean (dt. 1975, fr. 1959). Nachahmung, Spiel und Traum. GW 5 Studienausgabe. Stuttgart: Klett.
- Piaget, Jean; Inhelder, Bärbel und 18 weiteren MitarbeiterInnen (dt. 1975, fr.). Die Entwicklung des räumlichen Denkens beim Kinde. GW 6 Studienausgabe. Stuttgart: Klett.
- Piaget, Jean (dt. 1975, fr. 1950). Die Entwicklung des Erkennens I Das mathematische Denken. GW 8 Studienausgabe. Stuttgart: Klett.
- Piaget, Jean (dt. 1975, fr. 1950). Die Entwicklung des Erkennens II Das physikalische Denken. GW 9 Studienausgabe. Stuttgart: Klett.
- Piaget, Jean (dt. 1975, fr. 1950). Die Entwicklung des Erkennens III Das biologische Denken, Das psychologische Denken, Das soziologische Denken. GW 10 Studienausgabe. Stuttgart: Klett.
- Piaget, Jean (dt. 1999, fr. 1933). Psychologie des Kindes und Geschichtsunterricht. In: Über Pädagogik. Weinheim: Beltz: 118-127.
- Pinker, Steven (dt. 2014, engl. 2007) Der Stoff aus dem das Denken ist. Frankfurt: S. Fischer.
- Pinker, Steven (dt. 2018, engl. 2018) Aufklärung JETZT. Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Eine Verteidigung. Frankfurt: S. Fischer.
- Popper, Karl (1928). Zur Methodenfrage der Denkpsychologie. Diss. Wien. Neu abgedruckt in (1187-260): Hansen, T.E. (2006, Hrsg.). Karl R. Popper Frühe Schriften. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Popper, Karl (1934 ff). Die Logik der Forschung. Tübingen: Mohr.
- Popper, Karl (dt. 1973). Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf. Hamburg: Hoffmann & Campe.
- Popper, Karl & Eccles, John (1982). Das Ich und sein Gehirn. München: Piper.
- Putnam, Hilary (engl. 1975, dt. 1979) Die Bedeutung von "Bedeutung". Frankfurt aM: Klostermann.
- Queckelberghe, van Renaud (1979). Modelle kognitiver Therapien. München: Urban & Schwarzenberg.
- Range, Friederike (2009). Wie denken Tiere ? Wien: Ueberreuter.
- Rathenau, Walther (1922) Die Mechanik des Geistes. Berlin: Fischer.
- Reichwein, Georg (1910). Die neueren Untersuchungen über Psychologie des Denkens nach Aufgabestellung, Methode und Resultaten übersichtlich dargestellt und kritisch beurteilt. Halle: C. A. Kaemmerer & Co.
- Reidemeister, Kurt (1928). Exaktes Denken. Philosophischer Anzeiger 3,1, 15-47. Darin auch eine Entgegnung Geigers (2; 261-64) und das Schlusswort Rs. (2; 265-66).
- Reisner, K. (1996). Geschichte der bildgebenden Verfahren im Kopf-Hals-Bereich. Der Radiologe, Heft Volume 36, Number 3, 175-180.
- Richter, Dieter (1983). Taschenatlas Klimastationen. Braunschweig: Höller und Zwick.
- Rieger, C. (1888). Beschreibung der Intelligenzstörungen in Folge einer Hirnverletzung: nebst einem Entwurf zu einer allgemeinen anwendbaren Methode der Intelligenzprüfung. Würzburg: Stahel.
- Rizzolatti, Giacomo & Sinigaglia, Corrado (2008). Empathie und Spiegelneurone. Die biologische Basis des Mitgefühls. Frankfurt: Suhrkamp.
- Roder, Volker; Brenner, Hans D.; Kienzle, Norbert & Hodel, Bettina (1992). Integriertes Psychologisches Therapieprogramm für schizophrene Patienten (IPT). Weinheim: PVU.
- Rosch, E. H. (1973). Natural categories. Cognitive Psychology 4, 328-350.
- Rosch, E. H. (1975). Cognitive representations of semantic categories. Journal of Experimental Psychology: General 104, 192—233.
- Rosch, E. H. & Mervis, C. B. (1975). Family resemblances: studies in the internal structure of categories. Cognitive Psychology 7, 573—605.
- Rosch, E. H.; Mervis, C. B.; Gray, W. D.; Johnson, D. M., & Boyes-Bream, P.(1976). Basic objects in natural categories. Cognitive Psychology 8, 382-439.
- Roth, Gerhard (2003). Denken, Fühlen, Handeln. Frankfurt: Suhrkamp.
- Russel, Bertrand (dt. 1967, engl. 1912). Die Welt der Universalien (81-89). Und: Unsere Erkenntnis von den Universalien (90-98). In: Probleme der Philosophie. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Rubinstein, S. L. (dt. 1968, 5. A.). Das Denken und die Wege seiner Erforschung. Berlin VEBdWiss.
- Ruch, F.L. & Zimbardo, P.G. (dt. 1975, engl. 1971; 2.A.). Werkzeuge des Denkens. In: Denken, Sprache und Gedächtnis. In (172-177): Lehrbuch der Psychologie. Berlin: Springer.
- Ryle, Gilbert (dt, 1969, engl. 1949). Der Begriff des Geistes. Stuttgart: Reclam.
- Ryle, Gilbert (1953). Thinking. Acta psychol. 9, 189-196. Deutsch als "Kritik der Denkpsychologie" in Graumann (1969, Hrsg.; S. 461-466)
- Sauze, J.-B. (1911). L'école de Wurtzbourg et la méthode d'introspection expérimentale. In: Revue de philosophie 18: 225-251.
- Savigny, Eike von (1970). Grundkurs im wissenschaftlichen Definieren. München: dtv.
- Schaefer, Gerhard; Trommer, Gerhard & Wenk, Klaus (1977, Hrsg.). Denken in Modellen. Braunschweig: Westermann.
- Schaefer, Ralf E. (1985). Denken. Informationsverarbeitung, mathematische Modelle und Computersimulation. Berlin: Springer.
- Scharfetter, Christian (1976). Kap. 9 Denken, Sprache, Sprechen. In (98-112): Allgemeine Psychopathologie. Stuttgart: Thieme.
- Schneider, W. & Sodian, D. (2006, Hrsg.). Kognitive Entwicklung. Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich C: Serie V: Entwicklungspsychologie, Bd. 2. Göttingen: Hogrefe.
- Schultz, Julius (1899). Das Vergleichen. In (S.41-47): Psychologie der Axiome. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schultze, F. E. Otto (1906). Einige Hauptgesichtspunkte der Beschreibung in der Elementarpsychologie. I. Erscheinungen und Gedanken. In: Archiv für die gesamte Psychologie 8: 241-338.
- Schwemmer, Oswald (2010) Das Ereignis der Form. Zur Analyse des sprachlichen Denkens. München: Fink.
- Searl, John R. (dt. 1997, engl. 1995). Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Reinbek: Rowohlt (rde).
- Seel, Norbert M. (1991). Weltwissen und mentale Modelle. Göttingen: Hogrefe.
- Segal, Jakob (1916) Über das Vorstellen von Objekten und Situationen. Stuttgart: Spemann.
- Selz, Otto (1910). Die psychologische Erkenntnistheorie und das Transzendenzproblem. Arch. ges. Psychol. 16, 1-110
- Otto Selz (1912). Die Gesetze der produktiven Tätigkeit. (Vortrag 1912). Arch. ges. Psychol. 27, 1913, 367-380; Reprint in Carl Friedrich Graumann (Ed.): Denken. Köln: Kiepenheuer & Witsch 1965, 215-224.
- Selz, Otto (1913). Über die Gesetze des geordneten Denkverlaufs. Eine experimentelle Untersuchung. Stuttgart: Spemann.
- Selz, Otto (1922). Über die Gesetze des geordneten Denkverlaufs. Zweiter Teil: Zur Psychologie des produktiven Denkens und des Irrtums. Eine experimentelle Untersuchung. Bonn: Cohen.
- Selz, Otto (1924). Die Gesetze der produktiven und reproduktiven Geistestätigkeit. Bonn: Cohen.
- Selz, Otto (1931/1991): Der schöpferische Mensch. In: Métraux, Alexandre & Herrmann, Theo (Hrsg.): Otto Selz: Wahrnehmungsaufbau und Denkprozess – ausgewählte Schriften: Bern, Stuttgart, Toronto: Hans Huber Verlag, 159 - 172 (Erstdruck 1931 in: Zeitschrift für pädagogische Psychologie 32, 229 – 241)
- Selz, Otto (1942/1991): Die geistige Entwicklung und ihre erzieherische Beeinflussung. In: Métraux, Alexandre & Herrmann, Theo (Hrsg.): Otto Selz: Wahrnehmungsaufbau und Denkprozess – ausgewählte Schriften: Bern, Stuttgart, Toronto: Hans Huber Verlag, 71 – 136.
- Selz, Otto (1991). Wahrnehmungsaufbau und Denkprozeß. Ausgewählte Schriften. hrsg. v. A. Métraux und T. Hermann. Huber, Bern
- Spearman, Charles. (1904). "General intelligence," objectively determined and measured. American Journal of Psychology, 15, 201-293. [Probably the most influential paper in the history of psychometric intelligence theory.] > Lit.
- Spitzer, Manfred (1996). Geist im Netz. Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg: Spektrum.
- Sponsel, Rudolf (1995). Denken und Sprechen. In (126-128): Sponsel, R. (1995). Handbuch Integrativer Psychologischer Psychotherapie. Zur Theorie und Praxis der schulen- und methodenübergreifenden Psychotherapie. Ein Beitrag zur Entmythologisierung der Psychotherapieschulen. Mit einem 74-teiligen Reader zur Psychotherapie, ihrer Geschichte, Forschung und Methodologie und 43 Fallbeispielen zur Demonstration der allgemeinen psychologischen Heilmittellehre. Wissenschaftlicher Anhang ca. 300 Seiten mit 5 Registern. Erlangen: IEC-Verlag. > Überblick Denken in der IP-GIPT.
- Stavemann, Harlich H. (2005). 6 Rekonstruktion bewusster und unbewusster Denkmuster. In (Stavemann 2005, S.186-203)
- Stavemann, Harlich H. (2005). 7 Disputation identifizierter dysfunktionaler und Aufbau neuer, funktionaler Konzepte. In (Stavemann 2005, S.204-245)
- Stavemann, Harlich H. (2005). 8 Training funktionaler Denkmuster. In (Stavemann 2005, S.246-269)
- Stavemann, Harlich H. (2005, Hrsg.). KVT-Praxis. Strategien und Leitfäden für die Kognitive Verhaltenstherapie. Mit CD-ROM .Weinheim: BeltzPVU.
- Stegmüller, Wolfgang (1956). Die Funktionen des "ist". In: Sprache und Logik. In: Der Phänomenalismus und seine Schwierigkeiten. Sprache und Logik, 66-100. Darmstadt: WBG. Erstmals veröffentlicht in: Studium Generale. 9. Jahrgang, 2. Heft, 1956 (s. 57—77).
- Strasser Peter (2000). Der Weg nach draußen - Skeptisches, metaphysisches und religiöses Denken. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Strombach, Werner (1975). Die Gesetze unseres Denkens. Eine Einführung in die Logik. 3. üa. A. München: C.H. Beck.
- Strümpell, Ludwig (1871). Die zeitliche Aufeinanderfolge der Gedanken. Nach einem Vortrage im Dorpater Handwerkerverein. Berlin: C. G. Leuderitz
- Sydow, Hubert (1978). Experimentalpsychologische Untersuchungen von Denkprozessen. Zeitschrift für Psychologie, 186,4, 455-470.
- Szymanski, J. Stephan (1929). Zur Denkpsychologie. Die Begriffsgefühle des Evidenzerlebnis. Das Denken durch Bilder. Wien: M. Perles.
- Thiel, Rainer (1967). Quantität oder Begriff ? Der heuristische Gebrauch mathematischer Begriffe in Analyse und Prognose gesellschaftlicher Prozesse. Berlin. VEBdWiss.
- Tomasello, Michael (dt. 2006, engl. 1999). Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Thorndike, Edward L. & Woodworth, Robert S. (1901a). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions (I). Psychological Review, 8, 247-261. [Classic study in the transfer of training from one task to another.]
- Thorndike, Edward L. & Woodworth, Robert S. (1901b). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions: II. The estimation of magnitudes. Psychological Review, 8, 384-395. [Classic study in the transfer of training from one task to another.]
- Thorndike, Edward L. & Woodworth, Robert S. (1901c). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions: III. Functions involving attention, observation, and discrimination. Psychological Review, 8, 553-564. [Classic study in the transfer of training from one task to another.]
- Thorndike, Edward L. (1911). Animal intelligence. [Most important book of the significant Columbia functionalist.]
- Thumb, Albert & Marbe, Karl (1901) Experimentelle Untersuchungen über die psychologischen Grundlagen der sprachlichen Analogiebildung. Leipzig: Wilhelm Engelmann.
- Titchener, E.B. (1912). The Schema of Introspection. American Journal of Psychology, 23, 485-508.
- Titchener, Edward Bradford (1909). Lectures on the Experimental Psychology of the Thought-Processes. New York: Macmillan.
- Titchener, Edward Bradford (1912a). Description vs. statement of meaning. In: The American Journal of Psychology 23:165-182.
- Titchener, Edward Bradford (1912b). Prolegomena to a study of introspection. In: The American Journal of Psychology 23:
- 427-448.
- Trautscholdt, Martin (1883). Experimentelle Untersuchungen über die Association In: Philosophische Studien 1: 213-250.
- Vaihinger, Hans (1913) Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit aufgrund eines idealistischen Positivismus. Berlin: Reuther & Reichard.
- Vester, Frederic (1985). Denken, Lernen, Vergessen. Was geht in unserem Kopf vor, wie lernt das Gehirn, wann läßt es uns im Stich? München: dtv.
- Vester, Frederic (1985, 3.A). Neuland des Denkens. Vom technokratischen zum kybernetischen Zeitalter. München: dtv.
- Volkelt, Johannes (1887). Psychologische Streitfragen. I. Selbstbeobachtung und Analyse. In: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 90: 1-49.
- Vollmers, Burkhard (1992). Kreatives Experimentieren. Die Methodik von Jean Piaget, den Gestaltpsychologen und der Würzburger Schule. Wiesbaden: DUV.
- Vollrath, Hans-Joachim (1989) Funktionales Denken. Journal für Mathematik-Didaktik, 3-37.
- Washburn, Margaret Floy. (1922). Introspection as an objective method. Psychological Review, 29, 89-112.
- Watt, Henry J. (1905). Experimentelle Beiträge zu einer Theorie des Denkens. In: Archiv für die gesamte Psychologie 4: 289-436.
- Watt, Henry J. (1906a). Sammelbericht über die neuere Forschung in der Gedächtnis- und Assoziationspsychologie aus den Jahren 1903/4. In: Archiv für die gesamte Psychologie 7: Literaturbericht 1-48.
- Watt, Henry J. (1907). Sammelbericht (II.) über die neuere Forschung in der Gedächtnis- und Assoziationspsychologie aus dem Jahre 1905. In: Archiv für die gesamte Psychologie 9: Literaturbericht 1-34.
- Watzlawick, P., Weakland, J. H. & Fisch, R. (1979). Lösungen. Zur Theorie und Praxis menschlichen Wandels. Bern Stuttgart.
- Weigl, Irina (1973). Vergleichen, Ordnen, Zuordnen. Transfervorgänge bei Vorschulkindern und Schulanfängern. Berlin: Volk und Wissen.
- Wertheimer, Max (1906). Experimentelle Untersuchungen zur Tatbestandsdiagnostik. In: Archiv für die gesamte Psychologie 6: 59—131.
- Wertheimer, Max (1925). Über Gestalttheorie. Philosophische Zeitschrift für Forschung und Aussprache 1, 39-60 (1925) und als Sonderdruck: Erlangen: Verlag der philosophischen Akademie (1925). Reprint in: GESTALT THEORY, Vol. 7 (1985), No. 2, 99-120. [Online]
- Wertheimer, Max (dt. 1964, engl. 1945). Produktives Denken. Was geschieht, wenn man wirklich denkt und dabei vorwärts kommt? Was sind hierbei die entscheidenden Schritte? Wie kommen sie zustande? Woher kommt die Erleuchtung, der Geistesblitz? Übersetzt von Wolfgang Metzger. Frankfurt a. M: Kramer.
- Wessels, Michael G. (1984) Kognitive Psychologie. New York: Harper & Row.
- Widrow, G. and Hoff, M. E. (1960). Adaptive switching circuits. In: Institute of Radio Engineers, Western Electronic Show and Convention, Convention Record, Part 4, pages 96–104, New York. IRE.
- Wittenberg, Alexander Israel (1957). Vom Denken in Begriffen. Mathematik als Experiment reinen Denkens. Mit einem Geleitwort von Paul Bernays. Basel: Birkhäuser.
- Wittgenstein, Ludwig. Schriften in 8 Bdn. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Woodworth, Robert Sessions (1906). Imageless thought. In: The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods 3: 701-708.
- Wundt, Wilhelm (1883). Ueber psychologische Methoden. In: Philosophische Studien 1, 1-38.
- Wundt, Wilhelm (1888). Selbstbeobachtung und innere Wahrnehmung. In: Philosophische Studien 4, 292-309.
- Wundt, Wilhelm (1907). Über Ausfrageexperimente und über die Methoden zur Psychologie des Denkens. Psychologische Studien 3, 301-360.
- Wundt, Wilhelm (1908). Kritische Nachlese zur Ausfragemethode, In: Archiv für die gesamte Psychologie 9, 445-459
- Wygotski, L.S. (1981; russ 1934) Denken und Sprechen. Frankfurt aM: Fischer.
- Zadeh, L.A., 1968: „Fuzzy Algorithms“. Information and Control. 12, 94–102
- Zeigarnik, Bluma W. (1927). Das Behalten erledigter und unerledigter Handlungen. Psychologische Forschung 9, 1-85.
- Zeigarnik, Bluma W. (dt. 1961. russ. 1958). Denkstörungen bei psychischen Krankheiten. Berlin: Akademie Verlag.
- Zell, Andreas (1994). Simulation Neuronaler Netze. Bonn: Addison-Wesley.
- Ziehe, Paul (1999). Introspektion. Texte zur Selbstwahrnehmung des Ichs. [Külpe, Mayer & Orth, Marbe, Ach, Bühler] Wien: Springer.
- Zimbardo, P.G. (dt. 1983, engl. 1979). Psychologie. Berlin: Springer.
über den V. Kongreß für experimentelle Psychologie in Berlin. 117f.
Werani, Anke (2011) Inneres Sprechen: Ergebnisse einer Indiziensuche. Berlin: lehmanns media.
- Flügel, Heinz: (1952). Zweifel, Schwermut Genialität. Witten: Eckard.
- Noelle-Neumann, E. & Maier-Leibnitz (1987). Zweifel am Verstand. Das Irrationale als die neue Moral. Zürich: Edition Interfrom.
- Offermann, Peter (1986). I Ging - Das alte chinesische Orakel- und Weisheitsbuch - Konflikte klären, Zweifel lösen - Den besseren Weg wählen. O?: Gondrom.
- Rapoport, Anatol (1994). Gewissheiten und Zweifel. Darmstadt: Darmstädter Blätter.
- Stekel, Wilhelm (1927/28). Zwang und Zweifel. Für Ärzte und Mediziner dargestellt. München: Urban & Schwarzenberg.]
Links (Auswahl: beachte) > Lit.
- Denkpsychologie.
- Classics in the History of Psychology.
- Piaget Bibliographie.
- Würzburger Schule.
- Gestaltpsychologie.
- Lerntheorie
- Intelligenz.
- Begabung.
- Lernen.
- Allgemeiner Begriff.
- Kognitve Science.
- Künstliche Intelligenz.
- Neuronale Netze: [W]
- Problemlösen.
- Kreativität.
- Meta-Problemlösungs-Strategien und die Idee der Problemlösungen II. Ordnung nach Watzlawick et al. (1979).
- Allgemeines und Sonstiges.
- Oxfordjournals.
- https://jigpal.oxfordjournals.org/cgi/content/refs/jzp046.
Glossar, Anmerkungen und Endnoten: > Eigener wissenschaftlicher Standort.
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
Stichworte Glossar:
Absurdität
* Ähnlichkeitserinnerung
* Antinomie * Aphasie
* Aporie * Assoziationspsychologie
* Auf der Zunge liegen
* Aufgabe * Ausnahmen
* Bedeutung * Carnap
1961 * Denken
in Eislers Wörterbuch der Philosophie * Dereierendes
/ dereistisches Denken * Ding an sich
aus Eislers Wörterbuch der philosophischen Begriffe * Dornseiff
zu den Denkbegriffen der dt. Sprache * Fehler
* Fehlschluss * Funke
& Sperring Inhaltsverzeichnis * Gesetz
der Partizipation. (Lévy-Bruhl) * Gestaltpsychologie
und Gestalttheorie * Homonym
* Haupteigenschaften
von Abbildungen * Irrtum *
Kant
zum "Ding an sich" * konfus (wirr)
*
Kontamination * Külpe:
Denken im Grundriss 1893 * Laings
komplizierte Metakonstruktionen * laut
denken * Lösung * Mach
* Manisch,
Manie, Maniform; Hypomanisch, Hypomanie, Hypomaniform * nur
denkende Philosophie * Paradoxie
* Philosophie (Querverweise) * Popper
* Poretisches Denken * Problem
* Pseudoparadoxie * Reiz-Reaktions-Theorien
* Ruch & Zimbardo Anmerkung
* Ryle, Gilbert * Salonblödsinn
* Sophisma * Sprache
das wesentliche Medium? * strittig
* Trugschluss * unklar
* unverständlich * Unsinn
* Verhältnisblödsinn (Verhältnisschwachsinn)
* Voluntarismus * Wert
* Widerspruch * Wie
arbeitet die Wissenschaft wirklich? * wirr
* Würzburger
Schule der Denkpsychologie * Wundt,
Wilhelm * Zukunftsdenken
*
___
Absurdität. > Unsinn.
Je nach Bezugsbasis: widersinnig, falsch, grotesk. Beispiele: Zwei Eier
sagen weniger als ein Dotter. Der Mensch ist hilfreich und gut. Die
Sprache ist das Haus der ehrlichen U-Boote. Gott ist gütig und liebt
die Menschen. Den Seinen ist kein butterblau. Das Nichts nichtet. Absurder
Dialog: Heribert: "i". Xaver: "mul". Hermine: [?].
___
Ähnlichkeitserinnerung.
Relationaler Grundbegriff in Carnaps Der logische Aufbau der Welt (§
78):
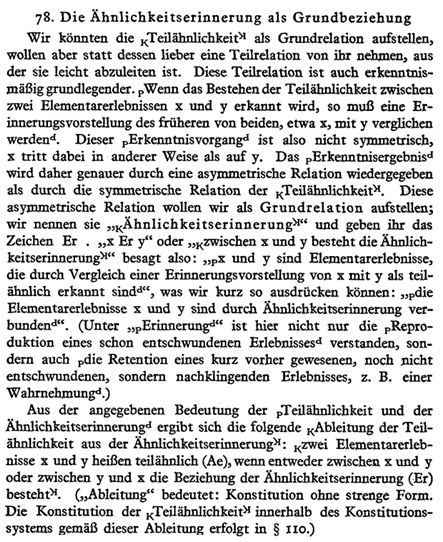 |
In § 68 führt Carnap die Idee aus § 67 fort: "Die Elementarerlebnisse sollen die Grundelemente unseres Konstitutions- systems sein." Nach diesem Ansatz meint er, mit nur einer Grundbeziehung aus- kommen zu können. Das ist insofern natürlich und eingängig, weil alle Erkenntnis ja tatsächlich aus der Psyche kommt. Trotzdem fehlt mir bei diesem kühnen Entwurf die Praxisnähe. Das meiste bleibt abstrakt und sehr allgemein. Ich sehe hier nicht, wie das nun beispielhaft gehen soll. So meine ich, es wäre gut gewesen, wenn Carnap und der Wiener Kreis der interaktiv-kommunika- tiven Situation, auch dem Alltag, etwa im Sinne der radikalen Hilbert-Forderung, mehr Rechnung getragen hätten. Viele Probleme verschwinden ganz einfach, sobald man konkret und praktisch wird, Papier und Bleistift zur Hand nimmt und in einen konkreten Dialog mit zweck- angemessenen Regeln eintritt. Dieser Weg wird im Kapitel 5 nicht nur an- gedacht, sondern an einigen grund- legenden Beispielen auch so durch- geführt, dass die Versuche jeder mit sich selbst oder auch mit anderen durchführen kann. |
Antinomie. unlösbarer (logischer) Widerspruch: schwarzer Schimmel, eckiger Kreis, vollendetes Unvollendetes, unvollendetes Vollendetes (Anwendung: aktual Unendliches). S ist P und S ist nicht P.
___
Aphasie. Wortfindungsstörung bei vorhandener Begriffsgegebenheit und intaktem Denkvermögen, das aber durch die Wortfindungsstörungen beeinträchtigt sein kann. Eine Störung, die bei hirnorganisch Beeinträchtigen, typisch etwa beim frischen Schlaganfall, beobachtet wird und sich mehr oder minder schnell oder vollständig zurückbilden können. Es ist im Grunde eine Ausdrucksstörung, wenn "Kleider" der Begriffe, die Worte nicht gefunden werden. Aphasie bedeutet also keineswegs eine Intelligenz- oder Denkstörung. Die "normale" oder natürliche Erscheinungsvariante der Aphasie, die fast jeder Mensch kennt, ist das Phänomen "Auf der Zunge liegen".
___
Aporie. Grundsätzliche Unlösbarkeit, grundsätzlich unlösbares Problem. Verändert eine Beobachtung das Beobachtete, so scheint es grundsätzlich keine Möglichkeit zu geben, Erkenntnisse unabhängig von der Beobachtung zu gewinnen. Das ist in der Psychologie der Selbstbeobachtung, insbesondere bei den flüchtigen Bewusstseinsinhalten der Fall. Aber auch die Physik scheint mit der Unschärferelation das Phänomen zu kennen und zu bestätigen. Doch noch viel grundlegender und allgemeiner zeigt sich die Aporie einer völlig exakten Messung, die es nach dem Satz, jede Messung ist mit einem Fehler behaftet, nicht gibt. Der aporetische Satz lautet also: eine fehlerfreie Messung ist nicht möglich. Aber nicht jeder Beobachtungsfehler ist fatal und unkorrigierbar (> Bessel: persönliche Gleichung; W: Parallaxenfehler; Fehlertheorie- und Fehlerkorrekturen).
Aus der Tatsache, dass alle Erkenntnis Erkenntnis eine Subjekts (Beobachter) von einem Objekt (Beobachtetes) ist, ergeben sich zwei "Kandidaten" für Aporien, nämlich das Subjekt-Objekt-Problem - das, wie oben schon erwähnt, auch eine bedeutende Rolle in der Psychologie spielt - und das Problem subjektunabhängiger, "objektiver" Erkenntnis, die man gewöhnlich den Naturwissenschaften zubilligt. Wenn alle Erkenntnis Erkenntnis eines erkennenden Subjektes ist, wie kann dann subjektunabhängige, "objektive" Erkenntnis möglich sein?
Will man etwas untersuchen oder verändern, was gar nicht da ist (z.B. Teufel > Exorzismus), muss man scheitern, es sei denn, man glaubt daran und begnügt sich mit Veränderungen im Glauben. Will man etwas mit Mitteln herbeiführen, los werden oder verändern, was nach Erkenntnissen der Wissenschaften nicht funktionieren, etwa beten, damit es regnet oder aufhört, muss man scheitern. Es scheint sehr viele Zweck-Mittel-Aporien, die durch Gewöhnung und Alltagsselbstverständlichkeiten oft gar nicht bemerkt werden. Eine exakte Entsprechung der Zweck-Mittel-Aporie kann in den Unmöglichkeitsbeweisen gesehen werden (z.B. Quadratur des Kreises, Dreiteilung des Winkels, Würfel-Verdoppelung).
In der idiographischen Wissenschaftstheorie von Heilbehandlungen scheint es eine Heilmittelaporie zu geben: man weiß sozusagen nie sicher, ob eine Heilmethode, die im allgemeinen und schon und so vielen geholfen hat, auch im jeweiligen Einzelfall heilen, bessern oder lindern wird. Verallgemeinert kann man die These vertreten: Im Empirischen gibt es keine wirklich sichere Erkenntnis. Räumt man ein, dass auch Mathematik und Logik nur relativ zu bestimmten Voraussetzungen und Annahmen, Beweise liefern, so hängen auch diese von eben den Voraussetzungen und Annahmen ab und gelten keineswegs "absolut".
Wie es scheint, müssen wir uns ganz allgemein, aber auch in der Wissenschaft mit Näherungen begnügen. Das könnte so etwas wie ein Hauptsatz der Aporie zum Inhalt haben.
___
Assoziationspsychologie. Philosophische Vorläufer: Platon [Über das Gedächtnis und die Erinnerung], Aristoteles; Hobbes, Hume, Locke, Brown, Mill, Bain. In der Psychologie rechnet man im engeren Sinne Herbart, Ebbinghaus, G.E. Müller, Ziehen als Vertreter der Aossiozationspsychologie. Name und Bedeutung erklären sich aus dem Umstand, dass der Begriff der Assoziation eine zentrale Bedeutung für die Erklärung der psychischen Phänomene erhielt. Der Assoziationsbegriff - aber neben anderen - hat seine grundlegende Bedeutung erhalten und spielt eine vielfältige Rolle in der Psychologie und ihren Nachbardisziplinen.
___
Auf der Zunge liegen. Normal-aphasisches Problem, wenn einem ein Wort für einen geistiges Sachverhalte nicht einfallen will. Man hat das Gefühl, dem Wort ganz nahe zu sein. Das ist sozusagen die "Normalausgabe" der Aphasie: Die Verbindung zwischen Wort und Begriff ist gestört. Das geflügelte Wort geht auf Goethes "Zauberlehrling" zurück: ""Ach, ich merk es! Wehe! wehe! / Hab ich doch das Wort vergessen! / Ach, das Wort, worauf am Ende / Er das wird, was er gewesen!" / Vergessen, wer das bange ausrief, von der Idee besessen, einen / "Zauberbesen" zum Wasser holenden Arbeitstier umzufunktionieren? / Wie kann ein Wort auf der Zunge liegen? "
___
Aufgabe. Im Unterschied zum Problem eine Arbeit, die verrichtet werden kann, von der also klar ist, wie sie getan werden kann.
___
Ausnahmen. Die "neuere" sprachkritische Philosophie und wissenschaftstheoretisch orientierte Philosophie (z.B. Stegmüller). Grundsätzlich interessant ist auch die Philosophie des Geistes, aber nicht dann, wenn sie nur theoretisiert und keine fundierte Empirie betreibt. "Nur" denken genügt eben nicht, wie die Philosophiegeschichte eindringlich lehrt.
___
Bedeutung. Alltagssprachlich das, was gemeint ist. Wissenschaftlich z.B. der Inhalt einer Definition oder einer Aussage. Unterschiedliches kann gleiches bedeuten (Abendstern, Morgenstern, Venus), Gleiches kann Unterschiedliches bedeuten (Star als Vogel, Augenkrankheit, in den Medien und der Öffentlichkeit bekannter Mensch. Daraus ergeben sich mitunter vielfältige Klärungsaufgaben.
___
Carnap 1961: In der 2. Auflage (1961) schreibt Carnap hierzu (S. XII):
- "Das in dem Buch aufgestellte System nimmt als Grundelemente die Elementarerlebnisse
(§ 67). Nur ein einziger Grundbegriff wird verwendet, nämlich
eine bestimmte Relation zwischen Elementarerlebnissen („Ähnlichkeitserinnerung",
§ 78). Es wird dann gezeigt, daß die weiteren Begriffe, z. B.
die verschiedenen Sinne, der Gesichtssinn, die Sehfeldstellen und ihre
räumlichen Beziehungen, die Farben und ihre Ähnlichkeitsbeziehungen,
auf dieser Basis definiert werden können. Daß die Beschränkung
auf einen einzigen Grundbegriff möglich ist, ist gewiß interessant.
Aber heute erscheint mir ein solches Verfahren doch als zu künstlich.
Ich würde vorziehen, eine etwas größere Anzahl von Grundbegriffen
zu verwenden, zumal hierdurch auch gewisse in meiner früheren Konstruktion
der Sinnesqualitäten auftretende Mängel (vgl. die Beispiele in
§ 70 und 72) vermieden werden können. Ich würde heute in
Erwägung ziehen, als Grundelemente nicht Elementarerlebnisse zu nehmen
(trotz der Gründe, die im Hinblick auf die Gestaltpsychologie für
diese Wahl sprechen, siehe § 67), sondern etwas den Machschen Elementen
Ähnliches, etwa konkrete Sinnesdaten, wie z. B. „rot einer gewissen
Art an einer gewissen Sehfeldstelle zu einer gewissen Zeit". Als Grundbegriffe
würde ich dann einige Beziehungen zwischen solchen Elementen wählen,
etwa die Zeitbeziehung „x ist früher als y", die Beziehung der räumlichen
Nachbarschaft im Sehfeld und in anderen Sinnesfeldern, und die Beziehung
der qualitativen Ähnlichkeit, z. B. Farbähnlichkeit.
Ein System der soeben angegebenen Art hat, ebenso wie das in dem Buch dargestellte System, seine Basis in den eigenen Erlebnissen, im „Eigenpsychischen". Ich habe aber im Buch auch schon die Möglichkeit einer anderen Systemform dargestellt, deren Basisbegriffe sich auf physische Gegenstände beziehen (§ 59). Außer den drei als Beispiele dort angegebenen Formen einer Basis im Physischen (§ 62) würde ich vor allem auch eine Form in Erwägung ziehen, die als Grundelemente physische Dinge enthält und als Grundbegriffe beobachtbare Eigenschaften und Beziehungen solcher Dinge. Einer der Vorzüge dieser Basisform ist die Tatsache, daß in bezug auf Eigenschaften und Beziehungen der genannten Art eine größere intersubjektive Übereinstimmung besteht. Die von Wissenschaftlern in der vorsystematischen sprachlichen Verständigung verwendeten Begriffe sind von dieser Art. Daher erscheint mir ein Konstitutionssystem auf einer solchen Basis besonders geeignet für eine rationale Nachkonstruktion der Begriffssysteme der Realwissenschaften."
Denken in Eislers Wörterbuch der Philosophie [Onlinequelle]:
- "Denken: 1) im allgemein-populären Sinne =
sich vorstellen, überlegen, urteilen, schließen. 2) im engeren
Sinne: a. psychologisch = die apperceptive (s. d.) Tätigkeit, innere
Willenshandlung, durch welche Vorstellungen in Elemente zerlegt, miteinander
verglichen und aufeinander bezogen und zu einer Einheit bewußt, willentlich
zweckvoll verknüpft werden. Das Denken ist also analytisch-synthetische,
vergleichend-beziehende, auswählende, bevorzugende, hemmende Tätigkeit,
die Associationen (s. d.) voraussetzt, aber selbst nicht Association ist,
die sie vielmehr activ, spontan gestaltet, wodurch Denkverbindungen entstehen;
b. logisch - Bildung von Begriffen, Urteilen, Schließen, wobei das
Urteilen (s. d.) die Grundfunction ist. Die (gewollte) Function des Denkens
ist Herstellung eines objectiv gültigen Zusammenhanges in einer Reihe
möglicher Vorstellungen, Auffindung der Wahrheit (s. d.), Setzen einer
Bestimmung im Unbestimmten, Formung und Gliederung eines Vorstellungsinhaltes
zu Gebilden, in welchen die Wirklichkeit, das Sein der Objecte zum (symbolischen)
Ausdruck kommt. Das primäre Denken bearbeitet den Vorstellungsinhalt
direct, das secundäre Denken reproduciert das Gedachte oder knüpft
an dieses an. Das concrete Denken arbeitet mit Anschauungen und Erinnerungsbildern,
das abstracte Denken mit Begriffen, die es zerlegt und verknüpft,
was ohne Sprache (s. d.) nicht möglich ist. Bedingungen, Postulate
des Denkens sind die Denkgesetze (s. d.). Die allgemeinen, für alle
Erfahrung notwendigen und gültigen Denkweisen heißen Denkformen
(s. d.). Ein Denken ohne Inhalt gibt es in Wirklichkeit nicht, das »reine«
Denken ist nur eine Abstraction sowohl vom besonderen Inhalte als auch
vom Gefühls- und Willensfactor des Denkens. Ursprünglich hat
das Denken rein biologische Bedeutung, es dient der Erhaltung des Lebens.
Der weitere Begriff des Denkens (cogitatio) findet sich, abgesehen von älteren Bestimmungen, die das Denken noch nicht im heutigen engsten Sinne nehmen, bei DESCARTES. Er versteht unter Denken jedes bewußte Vorstellen jedes Präsenthaben eines Bewußtseinsinhaltes. »Cogitationis nomine intelligo illa omnia, quae nobis consciis in nobis sunt, quatenus eorum in nobis conscientia est: atque ita non modo intelligere, velle, imaginari, sed etiam sentire, idem est hoc quod cogitare« (Phil. princ. I, 9). Die Seele ist »res cogitans« (Med. II). MALEBRANCHE sagt demgemäß, die Seele denke stets (»l' âme pense toujours«, Rech. I, 3, 2). SPINOZA faßt das »Denken« als Attribut (s. d.) Gottes auf (Eth. II, prop. I); Gott ist das letzte Subject aller unserer Gedanken, er denkt in jedem seiner Modi, ist unendlicher Intellect (s. d.): »Singulares cogitationes sive haec et illa cogitatio modi sunt, qui Dei naturam certo et determinato modo exprimunt« (Eth. II, prop. I). Gott denkt Unendliches auf unendliche Weise, indem er sein eigenes Wesen denkt. »Deus enim infinita infinitis modis cogitare, sive ideam suae essentiae et omnium, quae necessario ex ea sequuntur, formare potest« (l.c. prop. III, dem.). Das vernünftige Denken (s. Vernunft) betrachtet die Dinge in ihrer constanten Wesenheit und Notwendigkeit. CHR. WOLF definiert: »Cogitare dicimus, quando nobis conscii sumus eorum, quae in nobis contingunt, et quae nobis tanquam extra nos repraesentantur. Cogitatio igitur est actus animae, quo sibi rerumque aliarum extra se conscia est« (Psychol. emp. § 23). Denken ist »das Bewußtsein von Dingen außer uns« (Vern. Ged. I, § 194). BILFINGER: »Repraesentatio rerum illa, cuius conscii sumus nobis, dicitur cogitatio« (Diluc. § 240). Bei HUME und anderen englischen Philosophen heißt »thinking« so viel wie: etwas gegenwärtig haben, ferner: Vorgestelltes verknüpfen; »reasoning« = logisch verknüpfen (Treat., übers. von LIPPS, S. 10). Im engeren Sinne besteht das Denken in einer »comparison« von Vorstellungen, im Auffinden der Relationen zweier Objecte (l.c. III, sct. 2). J. G. FICHTE versteht unter Denken im weitesten Sinne »vorstellen oder Bewußtsein überhaupt« (Syst. d. Sittenl. S. 12). Es ist im engeren Sinne ein »Herausgehen aus der unmittelbaren Anschauung« (WW. I, 2, 545). Das reine Denken ist das sich selbst denkende, seinen Inhalt selbst producierende Denken.
Das Denken wird ferner als geistige, von der sinnlichen Wahrnehmung verschiedene, auf das Allgemeine, Seiende, Wahre gehende Tätigkeit bestimmt. ALKMAEON soll im Denken ein ausschließliches Kennzeichen des Menschen erblickt haben (hoti monos xyniêsi, Theophr., De sens. 25). HERAKLIT lehrt, die vernünftige Denkkraft (s. Vernunft) sei allen gemeinsam (xynon esti pasi to phronein, Fr. 91; Stob. Floril. III, 84: Sext. Emp. adv. Math. VII, 133). Er, wie die Eleaten und wie DEMOKRIT, betont, daß die Wahrheit nur durch denkende Verarbeitung des Wahrnehmungsinhaltes erlangt werde. PARMENIDES lehrt die Identität (s. d.) von Denken und Sein. PLATO betrachtet das Denken als rein geistige Seelenfunction, die Seele denkt das Allgemeine durch sich selbst, ohne ein Organ (autê di' hautês hê psychê ta koina moi phainetai peri pantôn episkopein, Theaet. 185 E). Das Denken ist ein inneres, stilles Sprechen der Seele mit sich selbst. Plato nennt das Denken ein logon hon autê pros hautên hê psychê diexerchetai peri hôn an skopê... touto gar moi indalletai dianooumenê ouk allo ti ê dialegesthai, autê heautên erôtôsa kai apokrinomenê, kai phaskousa kai ou phaskousa... ou mentoi pros allon oude phônê, alla sigê pros hauton (Theaet. 189 E). Man vergleiche damit die Ansicht PRANTLS, Denken und Sprechen seien dem Wesen nach eins, ferner die Behauptung von L. GEIGER, unser heutiges Denken sei nur ein »leises Sprechen, ein Sprechen mit oder in uns selber« (Urspr. u. Entwickl. d. m. Spr. I, 12, 59; vgl. Sprache). Und LAZARUS: »Alles Denken ist entweder ein Dialog oder ein Monolog, denn das Wort, hörbar oder unhörbar, ist für das Denken die unablösliche Form, die unzertrennliche Gestalt, die unentrinnbare Fessel seines Inhalts« (Leben d. Seele II2, 3). - ARISTOTELES unterscheidet das Denken vom sinnlichen Wahrnehmen (noein... heteron tou aisthanesthai, De anim. III 3, 427 b 27). Aber ohne anschauliche Grundlage kann man nicht denken (oudepote noei aneu phantasmatos hê psychê, De an. III 7, 431 a 16; hotan te theôrê, anankê hama phantasmati theôrein, De an. 432 a 8). Das Denken geht aufs Allgemeine, Constante, auf die »Form«, das Wesen (hê d' epistêmê tôn katholou; tauta d' en autê pôs esti tê psychê; dio noêsai men ep' autô, hopotan boulêtai (De an. II 5, 417 b 22 squ.). Indem das Denken die »Formen« der Dinge begrifflich erfaßt, bewußt macht, wird es gleichsam mit diesen Formen eins, formt es sich selber (vgl. SIEBECK, Aristot. S. 80). Nur den vernünftigen Wesen eignet das Denken (dianoesthai... oudeni hyparchei hô mê kai logos, De an. III 3, 427 b 14). Gott ist reines Denken, Denken seiner selbst (noêsis noêseôs, Met. XII 9, 1074 b 34). THEOPHRAST (Simpl. Phys. Fol. 225 a) und STRATO sehen im Denken eine (geistige) Bewegung. Den Wert des Denkens betonen die Stoiker (Diog. L. VII, 83). PLOTIN unterscheidet vom Denken das Bewußtsein des Denkens (Enn. IV, 3, 30). Das Denken ist ein Product des Strebens (Enn. V, 6, 5). Das Eine, Göttliche bedarf nicht des Denkens (ib.).
GREGOR VON NYSSA bestimmt das Denken (dianoia) als Betätigung des Geistes. AUGUSTINUS erklärt (ähnlich wie VARRO): »cum in unum coguntur, ab ipso coactu cogitatio dicitur« (De trin. XI, 3, 6). Das Denken ist ein inneres Sprechen. »Formata cogitatio ab ea re quam scimus, verbum est, quod in corde dicimus quod nec Graecum est, nec Latinum« (l.c. XV, 10). Die Scholastiker stellen die »vis cogitativa« dem Wahrnehmen gegenüber, als »virtus, distinguere intentiones individuales et comparare eas ad invicem« (THOMAS, Cont gent. II, 60). Das Denken ist also unterscheidende und vergleichende Tätigkeit, es abstrahiert die geistigen »Formen« (species, s. d.) der Objecte und bringt sie in begriffliche Beziehungen. THOMAS sieht im Denken die unmittelbare, organlose Seelenfunction (De ver. 15, 2). »Intelligere est operatio animae humanae, secundum quod superexcedit proportionem materiae corporalis et ideo non fit per aliquod organum corporale« (De spir. creat. art. 2). Das »cogitare« ist ein »considerare rem secundum partes et proprietates suas, unde cogitare dicitur quasi coagitare« (1 sent. 3, 4, 5 c). Wir können nur an der Hand von Anschauungen denken: »Intellectus noster secundum statum praesentem nihil intelligit sine phantasmate« (Cont. gent. III, 41). Object des Denkens ist das Wesen, das »quod quid est« der Dinge, das Allgemeine (Sum. th. II, 8, 1). So sagt auch DUNS SCOTUS: »Proprium obiectum intellectus est universale, sicut singulare est obiectum sensus« (Quaest. univ. 13, 2, 15). Das Allgemeine (s. d.) wird durch die »species intelligibiles« (s. d.) erkannt.
Als verbindend-trennende Tätigkeit bestimmt das Denken LOCKE, der die Beteiligung der willkürlichen Aufmerksamkeit am Denken beachtet (Ess. II, ch. 9, § 1). LEIBNIZ betrachtet jede Seelentätigkeit als ein (deutliches oder verworrenes) Denken; dieses ist im engeren Sinne ein vernünftiges Vorstellen, Reflexionsfähigkeit (Erdm. p. 464, 716). Unsere Gedanken (idées) »se forment par nous, non pas en conséquence de notre volonté, mais suivant notre nature et celle des choses« (l.c. p. 619b, 620a). Nach BAUMGARTEN ist Denkobject das Allgemeine (Akroas. Log. § 51). HOLBACH bestimmt das Denken als Fähigkeit des Menschen, »d'appercevoir en lui-même ou de sentir les différentes modifications ou idées qu'il a reçues, de les combiner et de les séparer, de les étendre et de les restreindre, de les comparer, de les renouveler« (Syst. d. l. nat. I, ch. 8, p. 112). Nach DESTUTT DE TRACY ist Denken = »sentir un rapport, appercevoir un rapport de convenance ou de disconvenance entre deux idées« (El. d'idéol. I, 23).
Eine Art Rechnen ist das Denken nach HOBBES, ein Addieren und Subtrahieren von Begriffen oder Worten. »Ratiocinari igitur idem est, quod addere et abstrahere, vel si quis adiungat his multiplicare et dividere. Computare est plurium rerum simul additarum summam colligere vel una re ab alia detracta cognoscere residuum« (El. phil. I, 1, 2, Leviath. I, 5). Auch BARDILI sieht im Denken eine Art Rechnen. So auch J. J. WAGNER (Organ. d. m. Erk. 1830). Und SCHOPENHAUER bemerkt: »Denken im strengsten Sinne ist etwas, das große Ähnlichkeit mit einer Buchstabenrechnung hat: die Begriffe sind Zeichen für Vorstellungen, wie Worte Zeichen für Begriffe sind: wir kennen die Beziehungen der Begriffe aufeinander und können deshalb die Begriffe hin und her werfen zu allerhand neuen Verbindungen, ohne daß wir nötig hätten, die Begriffe in Bilder der Phantasie von den Gegenständen, die sie vorstellen, zu verwandeln. Bloß beim Resultat pflegt dies zu geschehen« (Anmerk. S. 64 f.). Nach M. MÜLLER ist das Denken ein Combinieren und Trennen (Das Denken im Lichte der Sprache S. 26). Denken ist Sprache (l.c. S. 69 ff.).
Als active, synthetische, Einheit setzende Function, aus der Begriffe entspringen, wird das Denken wiederholt bestimmt. Nach TETENS heißt denken »selbständig Vorstellungen bearbeiten und tätig mit dem Gefühl auf diese bearbeiteten Vorstellungen zurückwirken« (Phil. Vers. I, S. 607). »Denkkraft« ist das Vermögen der Seele, »womit sie Verhältnisse in den Dingen erkennt« (l.c. I, 295). KANT scheidet das Denken schroff von der Anschauung (s. d.). Das Denken ist Function der »Spontaneïtät« (s. d.) des Verstandes (Kr. d. r. V. S. 76). »Die Sache der Sinne ist, anzuschauen; die des Verstandes, zu denken« (Prolegom. § 22). Aber ohne Anschauung ist alles Denken »leer«. Denken ist »Vorstellungen in einem Bewußtsein vereinigen«, und da dies ein Urteilen ist, ist »denken so viel wie als urteilen oder Vorstellungen auf Urteile überhaupt beziehen« (ib., Krit. d. r. Vern. S. 88). Es ist »Erkenntnis durch Begriffe« (Kr. d. r. V. S. 89), anderseits »die Handlung, gegebene Anschauung auf einen Gegenstand zu beziehen« (l.c. S. 229). Bedingungen und Formen des Denkens sind die Kategorien (s. d.) des Verstandes. Die Einheit der Apperception (s. d.) liegt allem Denken zugrunde. CHR. E. SCHMID nennt als Denkfunctionen das Verbinden, Trennen, Vergleichen der Vorstellungen (Empir. Psychol. S. 226 f.). Nach S. MAIMON heißt denken »Einheit im Mannigfaltigen hervorbringen« (Vers. üb. d. Transc. S. 33). Nach KRUG ist das Denken »das mittelbare Vorstellen, welches darin besteht, daß ein gegebenes Mannigfaltiges von Vorstellungen zur Einheit eines Begriffs verknüpft wird« (Fundam. S. 175). KIESEWETTER definiert das Denken als »diejenige Handlung des Gemüts, wodurch Einheit des Bewußtseins in die Verknüpfung des Mannigfachen gebracht wird« (Gr. d. Log. § 10). Nach FRIES ist Denken die »willkürliche Tätigkeit« des Bewußtseins, welche im Urteile Erkenntnisse als Verbindungen allgemeiner Vorstellungen zum Bewußtsein bringt (Syst. d. Log. S. 94). G. E. SCHULZE bezeichnet als Denken alles das, »was im Erkennen und Vorstellen aus dem Entschlusse, es entstehen zu lassen, herrührt. Es zeigt aber nicht bloß das Vorstellen durch Begriffe an, sondern auch das Deutlichmachen jeder Art von Erkenntnis durch das willkürliche Verwenden der Aufmerksamkeit auf die Unterschiede an den Bestandteilen derselben, ferner das Vorstellen abwesender Dinge durch Erinnerung, desgleichen alles aus Gründen herrührende Urteilen, endlich das Vorstellen und Handeln nach Absicht« (Gr. d. allg. Log.3, S. 4). Nach DROBISCH ist Denken »ein Zusammenfassen eines Vielen und Mannigfaltigen in eine Einheit« (N. Darst. d. Log.5, S. 5). VOLKMANN bestimmt das Denken als »Verbinden und Trennen der Vorstellungen, das seinen Grund hat lediglich im Inhalte der betreffenden Vorstellungen selbst« (Lehrb. d. Psychol. II4, 238). Nach LIPPS ist Denken »objectiv bedingtes Vorstellen« (Gr. d. Log. S. 4), ein »Hinausgehen über das unmittelbare Tatsächliche zu dem, was um dieses Tatsächlichen willen gedacht werden muß« (ib.). Nach REHMKE ist das Denken ein activer Seelenproceß, der Zerlegen oder Unterscheiden und Verknüpfen enthält (Allg. Psychol. S. 478, 486). Nach HELMHOLTZ ist Denken »die bewußte Vergleichung der schon gewonnenen Vorstellungen unter Zusammenfassung des Gleichartigen zu Begriffen« (Vortr. u. Red. II4, 341). Als Vergleichung von Daten bestimmt das Denken TÖNNIES (Gem. u. Ges. S. 168 f.). H. SPENCER versteht unter Denken (thought) das Feststellen von Beziehungen (»establishment of relations«), das Zusammenordnen von Eindrücken und Ideen (Psychol. § 378), eine »Anpassung von inneren an äußere Beziehungen« (l.c. § 174).
Nach HEGEL ist das Denken der Intelligenz ein »Gedanken-haben«, wobei der Gedanke die Sache selbst ist, »einfache Identität des Subjectiven und Objectiven« (Encykl. § 465), d. h. wir denken im Begriffe das Wesen des Dinges selbst. Das Denken ist (subjectiv) das »tätige Allgemeine«. Das Denken ist, als Subject vorgestellt, Denkendes (l.c. § 20). Das »reine« Denken denkt sich selbst (l.c. § 24, Zus.), hat bloße Begriffe zum Inhalt. Das »abstrahierende Denken« ist »nicht als bloßes Auf-die-Seite-stellen des sinnlichen Stoffes zu betrachten, welcher dadurch in seiner Realität keinen Eintrag leide, sondern es ist vielmehr das Aufheben der Reduction desselben als bloßer Erscheinung auf das Wesentliche, welches nur im Begriff sich manifestiert« (Log. III, 20). Die Denkbewegung ist »dialektisch« (s. d.), eine Folge des in den Gedanken steckenden »Widerspruches«, der zum »Umschlagen« der Begriffe ins Gegenteil und zur »Aufhebung« der Gegensätze in einem höheren Begriff führt (vgl. K. ROSENKRANZ, Syst. d. Wiss. § 644 ff.). Nach SCHELLING ist reines Denken kein wirkliches Denken; dieses ist nur da, wo »ein dem. Denken Entgegengesetztes überwunden wird« (WW. I 10,141). HILLEBRAND erklärt das reine Denken als »'Setzung der allgemein-concreten Einheit des Subject-Objects« (Phil. d. Geist. I, 198), als »subjective Position der reinen, der absoluten Wahrheit« (l.c. S. 199 ff.). Nach HEINROTH ist das Denken durch den Willen geleitet (Psychol. S. 141) es ist ein »Im-Bewußtsein-beschränken« (l.c. S. 247). TRENDELENBURG betont, es gebe »kein Denken ohne das gegenüberstehende Sein, an dem es arbeitet« (Gesch. d. Kategor. S. 364). Das Denken muß »die Möglichkeit seiner Gemeinschaft mit den Dingen in sich tragen« (l.c. S. 365), dadurch, daß die »constructive Bewegung« desselben, vermöge deren es tätig ist, dem Wesen nach dieselbe ist wie die Seinsbewegung (ib.; vgl. Log. Unt. I2, 136, 144). LOTZE sieht im Denken »eine fortwährende Kritik, welche der Geist an dem Material des Vorstellungsverlaufs ausübt, indem er die Vorstellungen trennt, deren Verknüpfung sich nicht auf ein in der Natur ihrer Inhalte liegendes Recht der Verbindung gründet« (Gr. d. Log. S. 6). »Das Denken, den logischen Gesetzen seiner Bewegung überlassen, trifft am. Ende seines richtig durchlaufenen Weges wieder mit dem Verhalten der Sachen zusammen« (Log. S. 552). Nach STEINTHAL, ist das Denken »die Erkenntnisbewegung als logische angesehen« (Einl. in d. Psychol. S. 108). ÜBERWEG definiert es als »die auf mittelbares Erkennen abzielende Geistestätigkeit« (Log. 4, § 1). Es spiegelt »die innere Ordnung, welche der äußeren zugrunde liegt«, ab (l.c. S. 14). Nach E. DÜHRING ist das Denken ein Product des Seins selbst, ein besonderer Fall der Wirklichkeit (Log. S. 171). Es ist »eine Hervorbringung subjectiver Formen für die Auffassung und Kennzeichnung von Gehalt und Wirkungsweise der Dinge«. (l.c. S. 173). Denken und Sein »entsprechen sich völlig« (l.c. S. 207). »Reines« Denken ist nichts als »die Gedankenbewegung in dem abgesonderten Gebiete der reinen Logik und Mathematik« (N. Dialekt. S. 196). L. BÜCHNER sieht im Denken nur »eine besondere Form der allgemeinen Naturbewegung« (Kr. u. St. 15, S. 321). KIRCHMANN erklärt: »Das Denken befaßt alle zu dem Wissen gehörenden Tätigkeiten mit Ausnahme des Wahrnehmens. Es bewegt sich in fünf Richtungen: 1) als das wiederholende Denken, 2) als das trennende Denken, 3) als das verbindende Denken, 4) als das beziehende Denken und 5) als die verschiedene Art, den Inhalt eines Gegenstandes zu wissen« (Kat. d. Philos. S. 27). Nach DEUSSEN ist Denken ein »Operieren mit Begriffen« (Elem. d. Met. § 33). SIGWART charakterisiert das Denken als »rein innere Lebendigkeit des Vorstellens« (Log. I2, 2), dessen Zweck »Erkenntnis des Seienden« ist (l.c. S. 4), indem es darauf ausgeht, »in dem Bewußtsein seiner Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit zu beruhen« (l.c. S. 6). Es entspringt dem »Denken-wollen« (l.c. S. 3). Nach VOLKELT ist Denken eine »Verknüpfung der Vorstellungen mit dem Bewußtsein, der logischen und sachlichen Notwendigkeit« (Erfahr. u. Denk. S. 163), ein »Postulieren transsubjectiver Bestimmungen« (l.c. S. 96). Nach O. SCHNEIDER ist Denken »diejenige geistige Tätigkeit des Menschen, in welcher er sich mittelst der Stammbegriffe überhaupt erst einen Inhalt schafft, sich dessen Eigenschaften nach Maßgabe der ihn schaffenden Stammbegriffe zum Bewußtsein bringt und zugleich des Verhältnisses solches Inhaltes zu einem gegebenen Sein bewußt ist« (Transcendentalpsych. S. 167). Nach H. CORNELIUS verfolgt das theoretische Denken »stets das Ziel, Zusammenhang zwischen den zunächst getrennt vorgefundenen Tatsachen herzustellen, das Mannigfaltige unter einheitliche Gesichtspunkte zu ordnen« (Einl. in d. Philos. S. 26). RIEHL, betont die Notwendigkeit des Denkens für alle Erfahrung (s. d.). »Das Denken ergänzt die Wahrnehmung. Immer wieder setzen wir einen weit größeren Zusammenhang voraus, als in den bloßen Tatsachen gegeben ist« (Einl. in d. Philos. S. 69). Als active Betätigung der Aufmerksamkeit (des Wollens), vergleichend-synthetische Tätigkeit bestimmt das Denken SULLY (Handb. d. Psychol. S. 235 ff.; Hum. Mind C. 11). Ähnlich STOUT (Anal. Psychol. II, C. 9 u. 10), JAMES, BALDWIN, auch HÖFFDING.
W. HAMILTON bestimmt das Denken als Bedingen (»to think is to condition«). ULRICI versteht unter Denken »die geistige Tätigkeit überhaupt« (Log. S. 4), es ist wesentlich »unterscheidende Tätigkeit, und zwar sich in sich selbst unterscheidend« (l.c. S. 13). Nach HARMS ist das Denken »eine reine, ihr Object nicht verändernde Tätigkeit« (Log. S. 87). Nach SPICKER ist Denken nichts als »die logische Verallgemeinerung der empirischen Einzelwahrnehmung« (K., H. u. B. S. 181). J. ST. MILL (Examin. P. 453), B. ERDMANN (Log. I, 1), HAGEMANN (Log. u. Noët. S. 22), W. JERUSALEM (Lehrb. d. Psychol.3, S. 103) bestimmen das Denken als Urteilen.
Nach LECLAIR sind Denken und Gedachtes nur eine »Abbreviatur für die ganze Mannigfaltigkeit der Bewußtseinstatsachen« (Beitr. S.16). Alles Denken ist Denken eines Seins (s. d.). Nach SCHUPPE gehört es zum Denken, daß es »einen Inhalt oder Object hat«, sowie der »Anspruch, bloß dieser Inhalt wirklich Seiendes ist«. »Was eine rein subjective Denktätigkeit ohne oder noch ohne Object... sein könnte, ist absolut unerfindlich« (Log. S. 7). Das Denken ist ein »Im-Bewußtsein-haben« ohne »subjectives Tun« (l.c. S. 35, 37), es besteht im Urteilen, d. h. es »nennt die Art des Zusammenseins der Daten« (ib.). SCHUBERT-SOLDERN: »Das Denken ist nur ein Denken der Welt, und die Welt ist nur in Denkbeziehungen gegeben, ohne welche sie reines Abstractum ist« (Gr. e. Erk. S. 226, vgl. S. 155).
Der Sensualismus (s. d.) betrachtet das Denken als eine Art Wahrnehmung oder Product von Empfindungen. Nach CAMPANELLA ist das Denken nur ein abgeblaßtes Wahrnehmen (»sentire languendum est et a longe«, Univ. philos. I, 4, 4). CONDILLAC betrachtet das Denken als Entwicklungsproduct des Empfindens (»penser c'est sentir«). Die Empfindung wird von selbst Aufmerksamkeit, Urteil, Reflexion (Tr. d. sens. p. 38). Logisch ist das Denken »décomposition des phénomènes et composition des idées« (Log.). Nach CZOLBE sind alle Begriffe der empirischen Erkenntnis »aus Empfindungen und Gefühlen als ihren Merkmalen zusammengesetzt, oder anschauliche Begriffe«, »alles Denken ist ein Schauen, das Innere der körperlichen und geistigen Welt in seinen Principien absolut durchsichtig oder begriffen« (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. S. 257). Nach NIETZSCHE beruht das Denken auf einem praktischen Instinct, es wurzelt im Lebenstrieb, im »Willen zur Macht« (WW. XV, 268, 270), ist biologisch wertvoll, ohne wahres Erkenntnismittel zu sein (l.c. 272 ff.). Es ist nur eine Fortsetzung und Umformung unserer Empfindungen. Gedanken sind nur der »Schatten unserer Empfindungen - immer dunkler, leerer, einfacher als diese« (WW. V, 187). Sie sind nur Symbole für die Wirklichkeit, zugleich sind sie Folgen von Triebbewegungen. Das bewußte Denken ist nur die Oberfläche des instinctiv-unbewußten Denkens. Das Denken ist, als Vorgang des Wählens, Auslesens, Bevorzugens, ein »moralisches Ereignis«, es beruht auf Wertschätzungen (WW. XI, 6, 250, 254 ff., 258, X, S. 194 f., XV, 356). Es birgt alle Irrtümer der Sprache (s. d.). Unser Denken ist nur ein »sehr verfeinertes, zusammenverflochtenes Spiel des Sehens, Hörens, Fühlens«, es ist Übung der Phantasie (WW. XI, 6, 233-235). Als eine Art Nachbild der Wahrnehmung betrachtet den Gedanken R. AVENARIUS (Kr. d. r. Erf. II, 77). E. MACH erblickt im Denken eine Fortsetzung der Wahrnehmungsvorgänge, es hat zunächst biologische Bedeutung, ist nur ein Teil des Lebens der Welt (Populärwiss. Vorles. 3, S. 208), geht auf Vereinheitlichung, Vereinfachung, Beherrschung der Erfahrungen aus (s. Ökonomie).
Die Associationspsychologie (s. d.) anerkennt keine spontane Denktätigkeit, sondern sieht in allem Denken nur ein Spiel der Associationen, eine »zusammengesetzte« Association. So ZIEHEN, welcher meint: »Wir können nicht denken, wie wir wollen, sondern wir müssen denken, wie die gerade vorhandenen Associationen bestimmen« (Leitfad. d. physiol. Psychol. 2, S. 171). Die »Willkürlichkeit« des Denkens beruht nur darauf, daß das Denken von Bewegungsempfindungen begleitet wird (ib.). Ähnlich MÜNSTERBERG.
Der Intellectualismus (s. d.) sieht im Denken die primäre geistige Tätigkeit. Die Gefühlspsychologie leitet das Denken aus dem Gefühle (s. d.) ab als gesteigerte Energie u. dgl. So HORWICZ (Psychol. Analys. I, 258, II, 115 ff.) und TH. ZIEGLER. - Nach RIBOT ist das Denken schon der Beginn eines motorischen Processes, ein »commencement d'activité musculaire« (Psychol. de l'attent. p. 20; vgl. L'évolut. des idées générales 1897).
Der Voluntarismus (s. d.) betrachtet als das eigentlich Active im Denken den Willen (s. d.), der (in der activen Aufmerksamkeit) den Lauf der Vorstellungen hemmt, regelt, der (durch die Apperception, s. d.) Vorstellungen und Vorstellungsbestandteile auswählt, bevorzugt, zur Klarheit bringt. Nach SCHOPENHAUER ist das Denken eine Function des (im Gehirn objectivierten) Willens (s. d.). RÜMELIN betont: »Der Intellect ist nicht das Primäre und Leitende in uns, sondern er nimmt eine secundäre und dienende Stellung ein. Alle seine Tätigkeiten sind nur formeller Art und bestehen in einem fortwährenden Bilden und Umbilden, Verknüpfen und Unterscheiden nach stets gleichen Formen und Gesetzen. Seine Richtung, sein Stoff wird ihm durch den Willen, oder..., da es kein Wollen im allgemeinen geben kann, durch die Triebe gesetzt« (Red. u. Aufs. I, 64 f.). »Die Triebe... sind die Directiven des Intellects« (l.c. S. 65). Nach TÖNNIES liegt dem Denken ein Gefühls- und Willenscharakter zugrunde (Gem. und Gesellsch. S. 139 f.). Das abstracte Denken ist die »mit wacher Aufmerksamkeit geschehende Vergleichung von Daten, welche bloß vermöge der mit Wortzeichen operierenden Erinnerung wahrnehmbar sind, ihre Auflösung und Zusammensetzung« (l.c. S. 168 f.). SULLY betont: »Das Kind offenbart sich als Denker zuerst dunkel auf praktischem Gebiet. Die Denkfähigkeit ist bei der Entwicklung der Rasse zuerst durch die Erregung des instinctiven Begehrens und Widerstrebens in Tätigkeit gesetzt worden« (Unters. üb. d. Kindh. S. 65). Nach KREIBIG ist das Denken eine Willenserscheinung (Die Aufmerks. S. 3). - WUNDT erblickt im Denken eine Function der Aufmerksamkeit oder Apperception (s. d.). Das Denken ist, psychologisch, Willenstätigkeit, innere Willenshandlung, die das Material der Associationen bewußt verwertet. Das Denken ist willkürliche, zweckvolle Tätigkeit. Indem verschiedene Associationen miteinander in Kampf geraten, ist es »der willkürlich fixierte Zweck des Gedankenverlaufs, der einer bestimmten, diesem Zweck entsprechenden Verbindung vor anderen den Vorzug gibt« (Syst. d. Philos. S. 41; Grdz. d. phys. Psychol. II4, 479 f.; Log. I2, 79 f.; Gr. d. Psychol. 5, S. 301 ff.). Die Merkmale des Denkens sind (psychologisch): 1) subjective Tätigkeit (Spontaneität), 2) selbstbewußte Tätigkeit, 3) beziehende Tätigkeit (Syst. d. Philos.2, S. 35 ff.). Die logischen Merkmale des Denkens sind Evidenz (s. d.) und Allgemeingültigkeit (s. d.). Das Denken als Verstandestätigkeit (s. d.) wird von einem Gesetz der »discursiven Gliederung von Gesamtvorstellungen«, vom Gesetz der »Dualität der logischen Denkformen« (s. d.) beherrscht. Das abstracte Denken entwickelt sich Hand in Hand mit der Sprache (Gr. d. Psychol. 5, S. 365). Logisch ist das Denken »jedes Vorstellen, welches einen logischen Wert besitzt«. Ein leeres, reines Denken gibt es nicht (Log. I2, S. 59; 435; Syst. d. Philos.2, S. 85 ff.) Zwischen Denken und Sein besteht keine Identität, wohl aber eine Conformität. Die Denkfunctionen sind die Hülfsmittel, mit denen wir die realen Beziehungen der Objecte auffinden und sie in idealer Weise (begrifflich-symbolisch) nachconstruieren (Ideal-Realismus) (Log. I2, S. 86 f., 90, 98 f., 6 f.; Grdz. d. phys. Psychol. II4, 479 f.). Die Einheit von Denken und Sein besteht nur vor der Differenzierung des Bewußtseins in Subject und Object (Syst. d. Philos.2, S. 87 f.). Das Denken beginnt schon an der Anschauung (Syst. d. Philos.2, S. 67, 77, 150 ff.; Log. I2, 558 ff.). KÜLPE bemerkt: »Die innere Willenshandlung tritt uns namentlich beim Denken entgegen. Auch hier handelt es sich um eine anticipierende Apperception, die teils einen größeren, teils einen kleineren Kreis einzelner, Reproductionen beherrscht und sich nur durch die Consequenz, mit der alles diesem Kreise Fernstehende zurückgehalten oder verdrängt wird, von zufälligen Reproductionsmotiven unterscheidet« (Gr. d. Psychol. S. 464). »Nicht durch eine besondere Art von Verbindungen, sondern nur durch die Leitung des Vorstellungsverlaufs vermittelst anticipierender Apperceptionen scheint uns das Denken von dem automatischen Spiel der Vorstellungen sich zu unterscheiden« (ib.) Nach W. JERUSALEM ist das Denken (praktisch) das Überlegen, das unseren Entschlüssen voranzugehen pflegt, theoretisch die Seelentätigkeit, die bei der Erforschung der Wahrheit wirksam ist. Das Denken ist der vom Willen beeinflußte, d. h. der apperceptive Vorstellungsverlauf (Lehrb. d. Psychol. 3, S. 103). - HUSSERL erklärt: »Alles Denken... vollzieht sich in gewissen ›Acten‹, die im Zusammenhange der ausdrückenden Rede auftreten. In diesen Acten liegt die Quelle all der Geltungseinheiten, die als Denk- und Erkenntnisobjecte oder als deren Theorien und Wissenschaften dem Denkenden gegenüberstehen« (Log. Unt. II, 472). Das objectiv Gedachte gilt allgemein, unabhängig vom Acte des Denkens (s. Wahrheit).
Nach FLECHSIG gibt es »Cogitationscentren« (s. d.). M. BENEDICT bemerkt: »In der grauen Substanz des Stirnhirns befindet sich ein eigenes Sammelorgan, ein Leistungsknoten für die höhere Denktätigkeit - ein Denker-Organ« (Die Seelenkunde d. Mensch. S. 79). Damit ist eine phrenologische Anschauung GALLS wieder erneuert. Vgl. Gedanke, Verstand, Ökonomie, Urteil, Wahrnehmung, Erkennen, Rationalismus, Panlogismus, Parallelismus (logischer).
Denkformen s. Kategorien.
Denkgegenstand s. Object.
Denkgesetze (logische Axiome) sind 1) psychologisch
- die natürlichen Bedingungen, unter denen das Denken (s. d.) sich
vollzieht; 2) logisch - die Postulate des Denken- und -Erkennen-wollens,
des einheitlichen und seine Einheit bewahren-wollenden Ich, denen alles
Denken folgen muß, soll, weil sonst eine normale, fortschreitende,
erkennende Function desselben nicht möglich ist und weil sonst die
Einheit, der Zusammenhang des (geistigen) Ich in Frage gestellt wird. Die
Denkgesetze sind Normen des Denkwillens. Sie sind die allgemeinsten Bedingungen
des Erkennens, des empirischen wie des speculativen. Die specificieren
sich in die Sätze der Identität (s. d.), des Widerspruches (s.
d.), des ausgeschlossenen Dritten (s. d.) und des Grundes (s. d.).
Dem älteren Rationalismus gelten die Denkgesetze
als »ewige Wahrheiten« (s. d.), d. h. als unmittelbar evidente
und allgemein-notwendig aufzustellende Gesetze für das Denken. Sie
haben apriorische (s. d.) Natur. So nach PLATO, ARISTOTELES, nach den Scholastikern,
nach DESCARTES (Princ. philos. I, 49), LEIBNIZ, CUDWORTH, der schottischen
Schule u. a. J. G. FICHTE leitet die Denkgesetze aus »Setzungen«
des Ich (s. d.) ab. SCHOPENHAUER bezeichnet sie als »metalogische
Wahrheiten« (W. a. W. u. V. Bd. I, 454), ULRICI als Gesetze der unterscheidenden
Tätigkeit des Denkens (Log. S. 93 ff.). Nach RÜMELIN sind die
Denkgesetze »nicht in dem Sinn Gesetze, daß sie ein ausnahmsloses
tatsächliches Geschehen bewirkten, sondern sind die Regeln, von welchen
das aufmerksame, unbeirrte und auf Erkenntnis der Wahrheit gerichtete Denken
unwillkürlich geleitet wird und sich leiten lassen muß, wenn
es zur Wahrheit gelangen und andere davon überzeugen will« (Red.
u. Aufs. II, 123). Nach SIGWART sind sie »die ersten und unmittelbaren
Ergebnisse einer auf unsere Denktätigkeit selbst gerichteten, sie
in ihren Grundformen erfassenden Reflexion« (Log. II, 40). Nach WUNDT
sind die Denkgesetze zugleich »Gesetze des Willens« (Log. I2,
79 f.). Die psychologischen Denkgesetze »sagen nur aus, wie sich
unter gewissen Bedingungen das Denken tatsächlich vollzieht«,
»die logischen Denkgesetze aber sind Normen, mit denen wir an das
Denken herantreten, um es auf seine Richtigkeit zu prüfen.«
Da es kein Denken ohne Inhalt gibt, so sind sie zugleich die allgemeinsten
Gesetze des Denkinhalts selbst. Sie sind von allgemeinster Geltung, weil
jedes Anschauungs- und [Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe.
Geschichte der Philosophie, S. 12843 (vgl. Eisler-Begriffe Bd. 1, S. 208
ff.)
https://www.digitale-bibliothek.de/band3.htm ]"
denken wird im SR nicht aufgeführt: Im Denken mancher NeuropsychologInnen [z.B. Markowitsch 1996; Kaufmann 2007] scheint das Denken verschwunden zu sein. Das sollte bei Gelegenheit einmal näher untersucht werden.
___
Dereierendes / dereistisches Denken. Im Gegensatz zu anderen Wortneubildungen (z.B. Ambivalenz, Schizophrenie) von Bleuler, eine wenig sinnvolle Wortschöpfung, erst recht nicht, wenn sie mit "autistisch" kombiniert wird. Im Grunde bedeutet dereistisch nichts anders als phantasievolles "Denken" oder tagträumen. In der vierten Auflage seines Lehrbuchs der Psychiatrie von 1923, S. 34f schreibt Bleuler:
- "k) Das dereistische [autistische FN1)] Denken.
Wenn wir spielend unserer Phantasie den Lauf lassen, in der Mythologie,
im Traum, in manchen krankhaften Zuständen, will oder kann sich das.
Denken um die Wirklichkeit nicht kümmern; es verfolgt von Instinkten
und Affekten gegebene Ziele. Für dieses „dereistische Denken", „die
Logik des Fühlens" (Stransky) ist charakteristisch, daß es Widersprüche
mit der Wirklichkeit unberücksichtigt läßt. Das Kind und
manchmal auch der Erwachsene träumen sich im Wachen als Held oder
Erfinder oder sonst etwas Großes; im Schlaftraum kann man sich die
unmöglichsten Wünsche auf die abenteuer-[>35] lichste Art erfüllen;
der schizophrene Taglöhner heiratet in seinen halluzinatorischen Erlebnissen
eine Prinzessin. Die Mythologie läßt den Osterhasen Eier legen,
weil Hasen und Eier zufällig das Gemeinsame haben, daß sie als
Symbole der Fruchtbarkeit der Ostara heilig sind. Der Paranoide findet
eine Leinfaser in der Suppe; das beweist seine Beziehungen zu Fräulein
Feuerlein. Die Wirklichkeit, die zu solchem Denken nicht paßt,
wird oft nicht nur ignoriert, sondern aktiv abgespalten, so daß sie,
wenigstens in diesen Zusammenhängen, gar nicht mehr gedacht werden
kann: Der Taglöhner ist eben als Verlobter der Prinzessin nicht mehr
der Taglöhner, sondern der Herr der Welt oder eine andere große
Persönlichkeit.
In den besonnenen Formen des dereistischen Denkens, vor allem in den Tagträumen, werden nur wenige reale Verhältnisse weggedacht oder umgestaltet und nur einzelne absurde Ideenverbindungen gebildet; um so freier aber verfügen der Traum, die Schizophrenie und zum Teil auch die Mythologie, wo sich z. B. ein Gott selbst gebären kann, über das Vorstellungsmaterial. In diesen Formen, geht die Dereation bis zur Auflösung der gewöhnlichsten Begriffe; die Diana von Ephesus ist nicht die Diana von Athen; Apollo wird in mehrere Persönlichkeiten gespalten, in eine sengende und tötende, eine befruchtende, eine künstlerische, ja, obgleich er für gewöhnlich ein Mann ist, kann er auch eine Frau sein. Der eingesperrte Schizophrene fordert Schadenersatz in einer Summe, die in Gold trillionenmal die Masse unseres ganzen Sonnensystems übersteigen würde; eine Paranoide ist die freie Schweiz, weil sie frei sein sollte; sie ist die Kraniche des Ibikus, weil sie sich ohne Schuld und Fehle fühlt. Auch sonst werden Symbole wie Wirklichkeiten behandelt, verschiedene Begriffe werden zu einem einzigen verdichtet (die im Traum der Gesunden erscheinenden Personen tragen meistens Züge mehrerer Bekannter; eine gesunde Frau redet, ohne es zu merken, von den „Hinterbeinen" ihres kleinen Kindes: sie hatte es mit einem Frosch verdichtet).
Das dereistische Denken verwirklicht unsere Wünsche, aber auch unsere Befürchtungen; es macht den spielenden Knaben zum General, das Mädchen mit seiner Puppe zur glücklichen Mutter; es erfüllt in der Religion unsere Sehnsucht nach ewigem Leben, nach Gerechtigkeit und Lust ohne Leid ; es gibt im Märchen und in der Poesie allen unsern Komplexen Ausdruck; dem Träumenden dient es zur Darstellung seiner geheimsten Wünsche und Befürchtungen; dem Kranken schafft es eine Realität, die für ihn realer ist als das, was wir Wirklichkeit nennen; es beglückt ihn im Größenwahn und entlastet ihn von der Schuld, wenn seine Aspirationen scheitern, indem es die Ursache in Verfolgungen von außen, statt in seine eigene Unzulänglichkeit, legt.
Erscheinen die Resultate des dereistischen Denkens an der realistischen Logik gemessen als barer Unsinn, so haben sie als Ausdruck oder Erfüllung von Wünschen, als Spender von Trost, als Symbole für beliebige andere Dinge doch eine Art Wahrheitswert, eine „psychische Realität" in dem Seite 5 Anmerkung definierten Sinne.
FN1) Da die Bezeichnung „autistisch" zu Mißverständnissen Anlaß gab (Beschränkung auf schizophrenen Autismus, Identifikation mit „egoistisch" usw.), habe ich „dereistisch" vorgeschlagen (reor, ratio, real)."
AS5: " Psychoanalytiker unterscheiden auch eine „psychische Realität". Der Ausdruck ist mißverständlich: es handelt sich da um Vorstellungen, die, aus inneren Bedürfnissen geschaffen,, angenommen und verwendet werden, wie wenn sie dem, was wir sonst Wirklichkeit nennen, entsprechen würden (Weiterleben des gestorbenen Kindes, das Feuer der Liebe, das wirklich brennt, der mittelalterliche persönliche Gott)."
Anmerkung RS: Besser wäre es, von subjektiver und persönlicher Erlebenrealität zu sprechen, die zweifellos eine Realität ist. Schwierig wird es aber für die Wissenschaft - nicht für die Psychoanalyse - , sog. unbewusste Realitäten zu evaluieren und kontrollierbar zu erforschen. Freud ist dem grundsätzlichen und fatalen wunschgeleiteten Irrtum erleben, Phantasien des Analytikers mit Wissenschaft zu verwechseln (> Junktim-Dogma)
Ding an sich. Aus Eislers Wörterbuch der philosophischen Begriffe:
- "Ding an sich heißt dasjenige,
was den Objecten der Außenwelt als transcendenter Factor (s. d.)
zugrunde liegt, das Ding, wie es unabhängig vom erkennenden Subject
in seinem Eigensein besteht, die Wirklichkeit außerhalb des erkennenden
Bewußtseins und nicht in die Formen desselben gekleidet. Es manifestiert
sich in der Erscheinung (s. d.). Da die Dingheit schon (an der Hand der
Erfahrung) durch das Denken gesetzt ist, so spricht man besser vom »An-sich
der Dinge« als dem äußeren Grunde der Objectvorstellungen.
Die Unabhängigkeit dieser vom Willen des Subjects, ihre Constanz,
Bestimmtheit und Gesetzmäßigkeit nötigt das Denken, ein
An-sich der empirischen Dinge anzunehmen, zu fordern; dadurch wird das
Transcendente nicht zu einem Bewußtseinsimmanenten, sofern es nur
mit Bestimmungen gesetzt wird, die wirklich als außer dem erkennenden
Ich existierbar gedacht werden können. Das An-sich der Dinge ist ein
Correlat, ein Analogon zur Ichheit. Es wird denn auch vom Spiritualismus
(s. d.) als etwas Seelisches, vom Voluntarismus (s. d.) als Wille, vom
Intellectualismus (s. d.) als Vernunft gedacht. Für den Materialismus
(s. d.) ist die Materie Ding an sich. Für den subjectiven Idealismus
gibt es überhaupt keine Dinge an sich. Der (aprioristische) Kriticismus
(und Agnosticismus) behauptet die Unerkennbarkeit der Dinge an sich.
Der Begriff des »An-sich« (s. d.) findet sich schon in der antiken Philosophie. Die Kyrenaiker unterscheiden von dem objectiven Bewußtseinsinhalte (to pathos êmin esti phainomenon) das Ding an sich, das unbekannt ist (to ektos hypokeimenon kai tou pathous poiêtikon, Sext. Empir. adv. Math. VII, 191). Auch CHRYSIPP unterscheidet Erscheinung und Ding (l.c. VIII, 11; Pyrrhon. hypot. II, 7).
Nach DESCARTES sagen uns die Sinnesqualitäten in der Regel nichts über die Beschaffenheit der Dinge an sich. »Satis erit, si advertamus, sensuum perceptiones non referri nisi ad istam corporis humani cum mente coniunctionem, et nobis quidem ordinarie exhibere, quid ad illam externa corpora prodesse possint, aut nocere; non autem, nisi interdum et ex accidenti, nos docere, qualia in seïpsis existant« (Princ. philos. II, 3). MALEBRANCHE meint, Gott schaue die Dinge an sich (»en elles-mêmes«). LEIBNIZ sieht in den Monaden (s. d.) Dinge an sich, deren Phänomene die Körper sind.
LOCKE hält das Wesen des Geistes und der Materie, die »things themselves«, für unbekannt; so auch HUME (Treat. Einl. S. 5). MAUPERTUIS erklärt: »Nous vivons dans un monde où rien de ce que nous apercevons ne ressemble à ce que nous apercevons. Des êtres inconnus excitent dans notre âme tous les sentiments, toutes les perceptions, qu'elle éprouve, et, ne ressemblant à aucune des choses que nous apercevons, nous les représentent toutes« (Lettres philos. 1752). Nach CONDILLAC steht es fest, daß wir nicht die Dinge an sich wahrnehmen. Sie können ganz anders sein, als sie sich uns darstellen (Trait. d. sens. IV, 5, § 1). BONNET unterscheidet die Erscheinung (»ce que la chose paraît être«) von der »chose en soi«. »Autrefois on cherchait ce que les choses sont en elles-mêmes, et on disait orgueillensement des savantes sottises. Aujourd' hui on cherche ce que les choses sont par rapport à nous, et ont dit modestement des grandes vérités.« »L'essence réelle de l'âme nous est aussi inconnue que celle du corps. Nous ne connaissons l'âme que par ses facultés, comme nous ne conaissons le corps que par ses attributs« (Ess. de Psychol.c. 36). Ähnlich HEMSTERHUIS. Nach LAMBERT ist die Sache, »wie sie an sich ist«, zu unterscheiden von der Sache »wie wir sie empfinden, vorstellen« (Organ. Phaen. I, § 20, 51).
Eine neue Prägung bekommt der Begriff des Ding an sich bei KANT. Er versteht darunter das unerkennbare Sein der Dinge außerhalb des erkennenden Bewußtseins, den »Grund« unserer Wahrnehmungen. Es sind uns Dinge gegeben, »allein von dem, was sie an sich sein mögen, wissen wir nichts, sondern kennen nur ihre Erscheinungen (d. i. die Vorstellungen, die sie uns wirken)« (Prolegom. § 13, Anm. II). Die Dinge an sich sind uns gänzlich unbekannt, alles Vorstellbare, positiv begrifflich zu Bestimmende gehört zur Erscheinung (s. d.), die aber ein »Correlat« an sich haben muß (Krit. d. r. Vern. S. 57). »Was für eine Bewandtnis es mit den Gegenständen an sich und abgesondert von aller dieser Receptivität unserer Sinnlichkeit haben möge, bleibt uns gänzlich unbekannt« (l.c. S. 66). Doch kann, ja muß die Existenz von Dingen an sich zwar nicht erkannt, aber doch wenigstens gedacht werden. »Denn sonst würde der ungereimte Satz daraus folgen, daß Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint« (l.c. Vorr. z. 2. Ausg., S. 23). Der »Grund des Stoffes sinnlicher Vorstellungen« liegt in etwas »Übersinnlichem«; »die Gegenstände, als Dinge an sich, geben den Stoff zu empirischen Anschauungen (sie enthalten den Grund, das Vorstellungsvermögen, seiner Sinnlichkeit gemäß, zu bestimmen), aber sie sind nicht der Stoff derselben« (Üb. e. Entdeck. S. 35 f.). Die praktische Philosophie Kants ist geneigt, den reinen Willen, d.h. den freien, sich selbst zur Sittlichkeit bestimmenden Willen, als Ding an sich anzusehen (Kr. d. pr. Vern. 1. T., 1. B., 3. Hptst.). Als »Noumenon« (s. d.) ist das Ding an sich ein »Grenzbegriff« (Kr. d. r. Vern. S. 235).
Die Annahme von Dingen an sich zugleich mit der Behauptung der Subjectivität der Kategorien, welche ein »Ding« erst constituieren, wird von einer Reihe von Philosophen beanstandet oder corrigiert. So von JACOBI. Nach ihm können Dinge an sich nicht auf uns einwirken, da die Causalität nur für Erscheinungen gilt (WW. II, 301 f.). Ohne die Voraussetzung von Dingen an sich kommt man nicht in das Kantsche System hinein, und mit ihr kann man nicht darin bleiben (l.c. S. 304). Ganz ähnlich argumentiert G. E. SCHULZE. (Aenesid. S. 262). BECK will den Begriff des »Dinges an sich« eliminieren, das Subject wird nicht durch dasselbe, sondern durch die Erscheinungsobjecte afficiert (Erl. Ausz. III). Auch S. MAIMON setzt die »Affection« ins Bewußtsein selbst und negiert das Ding an sich. Mit diesem Idealismus macht J. G. FICHTE vollkommen Ernst. Nach ihm ist der Gedanke des »Dinges an sich« ein Ungedanke; das Ding ist so, wie es von jedem Intellecte gedacht werden muß. Kein Object ohne Subject - daher kein Ding an sich (Gr. d. g. Wiss. S. 131). Das Ding ist ein Setzungsproduct des Ich (s. d.), praktisch so, wie wir es machen sollen (l.c. S. 275). Doch kann Fichte den »Anstoß« nicht beseitigen, der uns nötigt, Objecte anschaulich-begrifflich zu setzen. - SCHELLING erklärt die Dinge an sich für »Ideen in dem ewigen Erkenntnisart« (Naturphil. S. 70). Es gibt wohl ein Erstes, für sich Unerkennbares, aber es gibt kein Ding an sich, das Ding mit den subjectiven Bestimmungen ist das wahre Ding (WW. I 10, 216). HEGEL sieht im »Ding an sich« ein Abstractionsproduct aus der Reflexion auf die Dingheit. Es ist »das Existierende als das durch die aufgehobene Vermittlung vorhandene wesentlich Unmittelbare« (Log. II, 125). Das An-sich der Dinge ist nicht unerkennbar, es ist »Idee« (s. d.). K. ROSENKRANZ: »Das sogenannte Ding an sich ist... ein bloßes Abstractum«, weil jedes Ding nur in seinen Bestimmtheiten Existenz hat (Syst. d. Wiss. S. 61). »Das wahrhafte Ding an sich sind die Unterschiede, welche das Wesen in seine Existenz setzt« (ib.). Nach CHALYBÄUS ist der Begriff des Ding an sich der, daß es das »andere« jedes subjectiven Begriffs ist (Specul. Philos. seit Kant4, S. 92).
Die Unerkennbarkeit des »Ding an sich« betonen in abgestufter Weise die Kantianer und andere Denker. So V. COUSIN: »Nous savons qu' il existe quelque chose hors de nous, parceque nous ne pouvons expliquer nos perceptions sans les rattacher à des causes distinctes de nous-mêmes... Mais savons-nous quelque chose de plus? Nous ne savons pas ce que les choses sont en elles-mêmes« (Cours d'hist de la phil. moderne). Ähnlich W. HAMILTON, J. ST. MILL (Log. I, 74), auch H. SPENCER, nach welchem das Absolute, Gott (s. d.) »unknowable« ist. A. LANGE sieht im Ding an sich einen »Grenzbegriff«, der notwendig aber völlig problematisch, ohne positiven Inhalt ist (Gesch. d. Mat. II3, 49). Wir kennen nur die Eigenschaften; das Ding selbst ist nur ein »Ruhepunkt für unser Denken«. O. LIEBMANN hält das Ding an sich, wie es bei Kant auftritt, für ein »Unding« (K. u. d. Epig. S. 45 ff.), für ein »hölzernes Eisen« (l.c. S. 27). Nach COHEN ist das Ding an sich ein bloßer »Grenzbegriff« (Kants Theor. d. Erf. S. 252). HELMHOLTZ hält unsere Erkenntnis für ein »Zeichensystem« unbekannter Verhältnisse der Dinge an sich (Tatsach. i. d. Wahrn. S. 39). SABATIER hält das »Ding an sich« für ein »Unding« (Religionsphilos. S. 295). E. LAAS hält die Frage nach den Dingen an sich, wegen der Relativität (s. d.) unseres Erkennens, für undiscutierbar (Id. u. pos. Erk. S. 458 f.). RIEHL hält nur die »Grenzen« der Dinge für erkennbar, d.h. die in unseren Anschauungs- und Denkformen zum Ausdruck gelangenden einfachen Verhältnisse derselben (Phil. Krit. II 1, 24).
Von Idealisten und Positivisten wird das »Ding an sich« ganz eliminiert. So von der »Immanenzphilosophie« (s. d.). Nach HODGSON gibt es kein Ding an sich, »because there is no existence beyond consciousness« (Phil. of Reflect. I, 219). »Thing-in-itself is a word, a phrase, without meaning, flatus vocis«. »Everything is phenomnal« (l.c. p. 167, vgl. p. 213). SCHUPPE hält den Begriff des »Ding an sich« für einen »unmöglichen«. Etwas, das weder formal (mittelst der Kategorien) noch inhaltlich (nach Analogie der Wahrnehmung) gedacht werden darf, ist ein Nichtseiendes (Log. S. 14). - L. STEIN betont: »Die Welt erscheint uns... nicht, wie sie ist, sondern sie ist so, wie sie uns erscheint; das Ding an sich ist nur ein Ding für mich... Eine andere Wirklichkeit, als die von uns gedachte, gibt es schlechterdings nicht« (An d. Wende d. Jahrh. S. 266). Nach H. CORNELIUS ist das »Ding an sich« im Sinne der unerkennbaren Ursache der Erscheinungen ein »Unvorstellbares und seinem. Begriffe nach innerlich Widerspruchsvolles« (Einl. in d. Philos. S. 323). Die Frage nach der Beschaffenheit der Dinge an sich, des »beharrlichen Seins in der Welt« hat eben »in dem gesetzmäßigen Zusammenhange der Erscheinungen« ihre Antwort (l.c. S. 330; Allg. Psychol. S. 246 ff.). E. MACH hält das Ding an sich für eine Fiction (Anal. d. Empfind.4, S. 10), so auch OSTWALD (Vorles. üb. Naturphil.2, S. 242).
Nach anderen Philosophen ist die Unerkennbarkeit des Dinges an sich eine relative; das An-sich der Dinge wird von ihnen meist nach Analogie der Ichheit, des geistigen Seins bestimmt. SCHOPENHAUER betont, durch äußere Erfahrung, auf dem Wege der Vorstellung kann man nie zu Dingen an sich gelangen. Nur durch innere Erfahrung, besser durch innere Intuition erfaßt das Ich sich selbst unmittelbar in seinem An-sich, als Willen (s. d.). »Ding an sich... ist allein der Wille: als solcher ist er durchaus nicht Vorstellung, sondern toto genere von ihr verschieden: er ist es, wovon alle Vorstellung, alles Object die Erscheinung, die Sichtbarkeit, die Objectität ist. Er ist das Innerste, der Kern jedes Einzelnen und ebenso des Ganzen: er erscheint in jeder blind wirkenden Naturkraft« (W. a. W. u. V. Bd. I, § 22, II, C. 1). Nach HERBART erkennen wir nur die Beziehungen, welche die Dinge an sich (»Realen«, s. d.) in unserem Denken annehmen (Met. I, S. 412 ff.). BENEKE (Syst. d. Log. II, 288,) hält das geistige Leben für eine angemessene Erscheinung der Dinge an sich. LOTZE bestimmt die Dinge an sich als (geistige) Monaden (s. d.), deren Beziehungen objectiv-phänomenal erkannt werden, so auch RENOUVIER (Nouv. Monadol.) CLIFFORD bestimmt die Empfindung (s. d.) als »Ding an sich« (Von d. Nat. d. Dinge an sich S. 39, 44). Das Ding an sich ist »Seelenstoff« (mind-stuff, s. d.). R. HAMERLING sieht im Ding an sich die »Voraussetzung desjenigen, was von dem Wahrgenommenen übrigbleibt, wenn man die Wahrnehmung davon abzieht« (Atom. d. Will. I, 82). Das An-sich der Dinge besteht in Kraft- und Lebenspunkten (l.c. S. 83 f.). NIETZSCHE verwirft den Begriff einer Welt von Dingen an sich unbekannter Qualität, einer »Hinterwelt«, die von uns nur zu den Erscheinungen hinzugedichtet wird (WW. XV, 271, 278, 285). Er selbst betrachtet als das An-sich der Dinge den »Willen zur Macht« (s.d.). Nach WUNDT entsteht der Begriff des »Ding an sich« durch Hypostasierung der Objectivität. Die Möglichkeit, daß unser Denken »zur idealen Fortsetzung von Gedankenreihen veranlaßt wird, die über jede gegebene Erfahrung hinausreichen«, ist nicht zu bestreiten. Aber dabei müssen doch wieder die Denkgesetze und Denkformen angewendet werden (Phil. Stud. VII, 45 ff.). Bezeichnet man als Ding an sich den »Gegenstand unmittelbarer Realität«, so muß das denkend-wollende Subject ein solches sein. Die Objecte haben nur mittelbare Realität, sie weisen auf ein An-sich hin, das als Wille (s. d.) gedacht werden kann, sind aber selbst nur Phänomene, das geistige Subject aber ist nicht Erscheinung, sondern Ding an sich (Log. I2, 546 ff., 549, 552, 555). Das An-sich der Welt ist (vorstellender) Wille (Syst. d. Phil.2, S. 403 ff.; Phil. Stud. XII, 61 f.). Vgl. An-sich, Ding, Erscheinung, Object, Noumenon, Gott, Spiritualismus." Quelle: [Eisler: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Geschichte der Philosophie, S. 12890 (vgl. Eisler-Begriffe Bd. 1, S. 225) https://www.digitale-bibliothek.de/band3.htm ]
Dornseiff (1959, S. 339 ff) gliedert in seinem Deutschen Wortschatz nach Sachgruppen das Kapitel 12, Denken, wie folgt:
-
12. Das Denken
| 12.1 Instinkt
12.2 Gedanke, Einfall 12.3 Überlegung 12,4 Begriff, Denkergebnis 12.5 Thema 12.6 Wißbegierde 12.7 Aufmerksam 12.8 Forschen 12.9 Experiment 12.10 Vergleich 12.11 Unterscheiden 12.12 Messen, Rechnen 12.13 Unaufmerksamkeit 12.14 Logisches Denken 12.15 Begründen 12.16 Folgern 12.17 Grundsatz 12.18 Gesunder Menschenverstand 12.19 Unlogik 12.20 Entdeckung, Wahrnehmung 12.21 Schöpfertum 12.22 Ansicht 12.23 Ungewißheit, Mißtrauen 12.24 Vermuten 12.25 Leichtgläubig 12.26 Wahrheit 12.27 Falsch, Irrtum 12.28 Einbildung, Wahn 12.29 Annahme |
12.30 Wesensschau
12.31 Verstehen 12.32 Kenntnis 12.33 Lehren 12.34 Verbilden 12.35 Lernen 12.36 Schule 12.37 Unwissenheit 12.38 Absichtliches Übersehen 12.39 Gedächtnis 12.40 Vergessen 12.41 Überraschung, Erwartung 12.42 Vorhersicht 12.43 Vorhersagung 12.44 Eintreffen 12.45 Überraschung 12.46 Enttäuschung 12.47 Übereinstimmung 12.48 Meinungsverschiedenheit 12.49 Urteil, Bewertung 12.50 Überschätzen 12.51 Unterschätzen 12.52 Klug 12.53 Schlau 12.54 Freier Geist 12.55 Enger Geist 12.56 Dumm 12.57 Verrückt |
- Beispiele:
"2. Gedanke, Einfall. s.
unvorbereitet 9.27. Bewußtsein 11.1. Schöpfertum 12.21. Satz
13.20.
denken *** draufkommen • kommen auf • konzipieren • verfallen
auf • hat Einfälle wie ein altes Haus *** aufblitzen •
auftauchen • einfallen • anwandeln • durch den Sinn, in ihn fahren • es
kommt über ihn • in den Sinn kommen • es geht ihm ein F... durchs
Hirn *** schießt ihm durch den Kopf *** begrifflich
• gedacht • gedanklich • geistig • immateriell • ideell • körperlos
• metaphysisch • physisch • psychologisch • seelisch • stofflos • subjektiv
• transzendent • unkörperlich • virtuell *** vorgestellt
• vernunftbegabt • geistreich • geistvoll *** Brust • Busen
• Denkorgan • Empfindungssitz • Gehirn • Herz • Hirn • Kopf • Schädel
• Seele • der innere Mensch • Aperçu • Assoziation • Begnadung •
Bonmot • Einfall • Eingebung • Erleuchtung • Film • Gedanke • Gedankensplitter
• Geistesblitz • Idee • Inspiration • Intuition • Konzeption ***
Anlage • Auffassungsgabe • Begabung • Begriffsvermögen • Bewußtsein
• Denkkraft • Einsicht • Erkenntnisvermögen • Fähigkeit • Fassungskraft
• Geist • Geistigkeit • Ideenreichtum • Intellekt • Kopf • Naturgabe •
Sinn • Vernunft • Verstand • Witz.
3. Überlegung.
s. langsam 8. 8. Absicht 9.14. seelische Art 11. 2. seelischer ad 11. 3.
forschen 12. 8. rechnen 12.12; 18. 30.
abstrahieren • austüfteln • betrachten • brüten • denken
• forschen • grübeln • klügeln • meditieren • nachdenken • nachsinnen
• prüfen • ratschlagen • reflektieren • simulieren (hess.) • sinnen
• sinnieren • spekulieren • spintisieren • studieren • träumen • überlegen
• ventilieren • sich vergegenwärtigen • sich sammeln • versenken •
mit sich zu Rate gehen • hin und her • sich den Kopf zerbrechen •
die Worte abwägen • in eine Ansicht vernarrt sein ***
argumentieren • sich bedenken • ersinnen • sich hingeben • sich versenken
• sich vertiefen • seine Gedanken sammeln • einen Gedanken fassen
*** ausklügeln • beabsichtigen • berechnen • ermessen • erörtern
• (er)wägen • planen • prüfen • studieren • überlegen •
untersuchen • eine Sache beschlafen • in Betracht ziehen • sich beschäftigen
mit • sich durch den Kopf gehen lassen *** anregen • bannen
• sich darstellen • nicht aus dem Sinn kommen • die Gedanken auf sich lenken
• Eindruck machen • den Geist in Anspruch nehmen *** achtsam
• aufmerksam • bedächtig • bedachtsam • beschaulich • betrachtend
.• gedankenvoll • nachdenklich *** beflissen • eifrig • emsig • fleißig
• gesetzt • reif • stetig • tief • tätig ***
sorgfältig abgewogen *** Aufmerksamkeit • Betrachtung
• Denken • Eifer • Forschung • Gedankenfülle • Gedankentiefe
• Kontemplation • Kopfarbeit • Meditation • Reflexion (Locke) • Studium
• Überlegung • Versenkung *** Abstraktion • Abstrahierung
• Begriffsfolge • Denkart • Denkhaltung • Denkweise • Gedankengang • Gedankenreihe
• Geisteshaltung, -Verfassung, -zustand • Ideenkette • -verbindung • Mentalität
• Seelenhaltung • Seelentum • Weltanschauung;
Fehler. Relativ zu Kriterien eine Abweichung.
___
Fehlschluss. allgemein falsche Schlussfolgerung, gewöhnlich ohne Absicht in Abgrenzung von einer Variante des Trugschlusses.
___
Funke & Sperring Inhaltsverzeichnis
- 11.Kapitel: Methoden der Denk- und Problemlöseforschung.
Von Joachim Funke und Miriam Spering
1 Einleitung: Gegenstandsbereich und methodische Zugänge . 647
1.1 Was ist Gegenstand der Denk- und Problemlöseforschung? 648
1.2 Wie beeinflussen die Methoden den Gegenstand? 649
1.3 Wie beeinflusst der Gegenstand die Methoden? 650
1.4 Methodologische Divergenzen . 651
2 Methoden zur Präsentation, Diagnose und Auswertung kognitiver Prozesse 653
2.1 Aufgabentypen und Untersuchungsparadigmen 653
2.1.1 Einfache Aufgabentypen 654
2.1.1.1 Klassische Denksportaufgaben (Einsichtsprobleme) 654
2.1.1.2 Kryptarithmetische Probleme 657
2.1.1.3 Sequenzielle Problemstellungen 658
2.1.2 Komplexe Aufgabentypen 660
2.1.2.1 Inhaltlich orientierte Planspiele und Szenarien 661
2.1.2.2 Formal orientierte Szenarien 666
2.2 Diagnostische Zugänge zu Denk- und Problemlöseprozessen 673
2.2.1 Selbstauskünfte 673
2.2.1.1 Verbale Daten 674
2.2.1.2 Befragungen 679
2.2.1.3 Psychometrische Tests 680
2.2.1.4 Kontrollierte Wissensdiagnostik 682
2.2.2 Verhaltensdaten 686
2.2.2.1 Zeitmessung 688
2.2.2.2 Blickbewegung 690
2.2.2.3 Ausdrucksbeobachtung (Mimik, Gesten und Bewegungen) 704
2.2.3 Psychophysiologische Messmethoden 705
2.2.3.1 Bildgebende Verfahren 705
2.2.3.2 Pupillometrie 713
2.3 Auswertungsverfahren 716
2.3.1 Kognitive Modellierung 716
2.3.1.1 Produktionssysteme 717
2.3.1.2 Konnektionistische Verfahren 717
2.3.1.3 Multinomiale Modellierung 717
2.3.2 Synthetische Versuchspersonen 720
2.3.3 Markov-Analysen 721
2.3.4 Latent Semantic Analysis 724
3 Schlussbemerkungen 725
Gesetz der Partizipation. Ein wenig klares Konzept von Levy-Bruhl (1926, S. 51-82), dem er ein ganzes Kapitel widmet, ohne klipp und klar zu sagen, was es nun mit diesem "Gesetz" auf sich hat. Die bloße Tatsache, an Kollektivorstellungen zu "partizipieren" ist keine Besonderheit der sog. "Wilden" oder "Primitiven". Hingegen ist natürlich eine Besonderheit, den Satz vom Widerspruch nicht zu berücksichtigen und an die universelle Verbundenheit und wechselseitigen Beeinflußbarkeit aller verbundenen Sachverhalte zu glauben. Er führt aus (S. 57):
- "Versuchen wir es also nicht mehr, diese Verbindungen,
sei es durch die geistige Schwäche der Primitiven zu erklären,
sei es durch die Gesetze der Ideenassoziation, sei es durch einen naiven
Gebrauch des Kausalitätsprinzips, sei es durch das Sophisma post hoc,
ergo propter hoc; kurzum verzichten wir darauf, ihre Geistestätigkeit
auf eine niedrigere Stufe der unseren zurückführen zu wollen.
Dagegen ist es angezeigt, diese Verbindungen für sich zu betrachten
und zu untersuchen, ob sie nicht von einem allgemeinen Gesetz abhängen,
einem gemeinsamen Fundament dieser mystischen Zusammenhänge, welche
für den Geist der Primitiven so oft zwischen den Wesen und den
Gegenständen gegeben sind. Nun, es gibt ein Element, das in diesen
Zusammenhängen niemals fehlt. Es liegt ihnen allen eine »Partizipation«
(Anteilnahme) zwischen den Wesen und den Gegenständen, die in einer
Kollektivvorstellung verknüpft sind, in verschiedenen Formen und Graden
zugrunde. Darum werde ich das der primitiven Geistesbeschaffenheit (mentalité)
eigentümliche Prinzip, das die Verbindungen und Vorverbindungen (préliaisons)
dieser Vorstellungen beherrscht, in Ermanglung eines besseren
Terminus »Gesetz der Partizipation« (Anteilnahme) nennen."
Gestaltpsychologie und Gestalttheorie. Psychologische Richtung, 1890 durch die Arbeit von Chr. v. Ehrenfels Über Gestaltqualitäten angeregt, die zwei Schulen hervorbrachte: Leipzig (Krueger, Sander, Volkelt, ...) und Berlin (Köhler, Koffka, Lewin, Metzger, Wertheimer, ...). Ausgangs- und Schwerpunkt war die Wahrnehmung: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Wichtige Gestaltbegriffe wurden z.B.: Aha-Erlebnis, Aufforderungscharakter, Einsicht, Figur und Hintergrund, Gestalt, Ganzheit, Problemlösen, Struktur, Umstrukturierung, Werte, Ziel und Zielgerichtetheit. Weitere Gestaltpsychologen: Arnheim, Brunswig, Bühler, Duncker (Heuristik), Gelb, Goldstein, Gottschaldt, Katz, Rausch, von Restorff (-Effekt), Wellek, ... ....
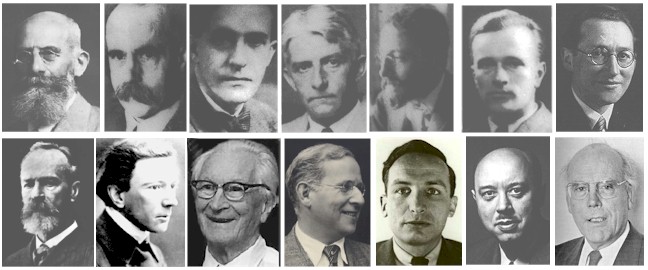 |
Chr. v. Ehrenfels
Max Wertheimer Kurt Koffka Wolfgang Köhler E.M. v. Hornbostel Karl Duncker Kurt Lewin Albert E. Michotte
(Auswahl) |
Man kann auch von einer gestaltpsychologischen Schule
- mit den führenden Köpfen Köhler, Duncker, Selz, Wertheimer
- des Denkens und Problemlösens sprechen. Eine wesentliche Idee ist
die Interpretation der Problemlösung als Umstrukturierung. Ein Problem
ist eine "schlechte" Gestalt, die Lösung eine "gute". Zwei Hauptarten
des Denkens werden unterschieden: produktives (Lösungen suchen) und
reproduktives (Lösungen anwenden).
Gestaltpsychologie
im Lexikon der Gestalttherapie * Gestaltgesetze * Gestalttheorie
*
___
Haupteigenschaften
von Abbildungen.
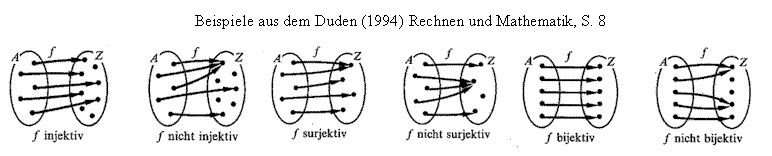
In der Mathematik werden drei Haupteigenschaften von Abbildungen unterschieden: 1) Injektive, 2) surjektive, 3) bijektive. Im allgemeinen gehört zur Definition einer Abbildung, dass jedes Original ein Bild und nicht mehr als ein Bild hat: jedem Element der Originalmenge muss eindeutig ein Bild der Bildmenge zugeordnet sein. Eine Abbildung heißt injektiv, wenn zwei verschiedene Originale immer zwei verschiedene Bilder haben, was im Pfeildiagramm bedeutet, dass jedes Element der Bildmenge höchstens ein Pfeilende aufweist und es heißt auch, dass nicht alle Bildelemente Bilder von Originalen sein müssen, es kann sozusagen ungenutzte Bilder geben. Eine Abbildung heißt surjektiv, wenn jedes Bild genutzt wird, wobei zu einem Bild auch mehrere Originale gehören können. Ist eine Abbildung injektiv und surjektiv, so ist sie auch bijektiv. Hat die Originalmenge O mehr Elemente als die Bildmenge B, kann die Abbildung weder injektiv noch bijektiv sein, zumindest nicht bei endlicher Anzahl (ob Zuordnungen, die endlich nicht fertig werden können, sinnvoll sind, mag hier offen bleiben). Es gibt Originale und Bilder, die in gar keiner Beziehung zueinander stehen (Fall a) oder Beziehungen zwischen Originalen und Bildern (Fall b), die keine Abbildungen sind (weil nicht von allen Originale ein Beziehungspfeil ausgeht). Es gibt auch Abbildungen (Fall c), die nicht injektiv, surjektiv oder bijektiv sind. Fall c ist nicht injektiv, weil zwei verschiedenen Originalen keine zwei verschiedenen Bilder zugeordnet sind und Fall c ist nicht surjektiv, weil nicht jedes Bild genutzt wird. Damit ist es natürlich auch nicht bijektiv. Anwendung: 8 Sportler aus O, die alle in B die Qualifikationsklasse 1 erreicht haben oder 8 Löffel, die im gleichen Besteckfach oder Schub untergebracht sind.
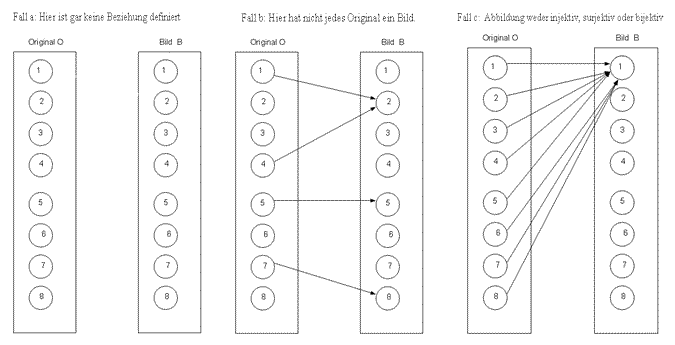
Anmerkung: Lässt man im Fall c auf der Originalseite potentiell
unendlich viele Realisierungen zu und interpretiert man Bild 1 als den
Namen für die potentiell unendlich vielen Realisierungen, so kann
man diese Beziehung in Anlehnung an das Universalienproblem, universale
Beziehung nennen (> Beispiel),
__
Hofstadter & Sander führen
im Vorwort "Die Analogie" aus: "Die notwendige Aufwertung der Analogie
In diesem Buch über das Denken werden Analogien und Begriffe die
Hauptrolle spielen, denn ohne Begriffe kann es kein Denken geben, und ohne
Analogien gibt es keine Begriffe. So lautet die These, die wir hier entwickeln
und vertreten.
Was ist damit gemeint? Jeder Begriff in unserem
Denken verdankt seine Existenz einer langen Abfolge von Analogien, die
im Lauf der Jahre unbewusst entstanden sind, die bereits dazu geführt
haben, dass der Begriff entstanden ist, und die ihn im Lauf unseres Lebens
fortwährend bereichern. Außerdem erhalten in jedem Augenblick
unseres Lebens unsere Begriffe Anstöße von Analogien, die das
Gehirn -indem es sich bemüht, sich mithilfe des Alten und Bekannten
das Neue und Unbekannte zu erschließen - pausenlos herstellt. Das
Hauptziel dieses Buches besteht also darin, der Analogie gleichsam Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen; zu zeigen, wie die menschliche Fähigkeit zur
Analogiebildung die Wurzel all unserer Begriffe ist und wie Analogien selektiv
Begriffe entstehen lassen. Kurz gesagt: Wir möchten zeigen, dass die
Analogie der Treibstoff und das Feuer des Denkens ist."
Ein riesiges, mehr flapsig und gewollt ("Zeugmata")
geistreiches brainstorming, das nirgendwo erkennen lässt, was empirische
und experimentelle Wissenschaft und Psychologie leisten sollte - und könnte,
wenn man denn wollte und könnte.
__
Homonym.
Die Worte können metaphorisch als die Kleider der Begriffe angesehen
werden. Begriffe sind Merkmalseinheiten oder Bedeutungen. Bei psychologisch
strenger Betrachtung hat ein Wort so viele unterschiedliche Begriffe, wie
es Subjekte gibt, die es benutzen, wobei sich die Bedeutungen im zeitlichen
Verlauf auch noch mehr oder minder ändern können. Deshalb behält Aristoteles
Empfehlung auch seine zeitlose Richtigkeit:
|
|
"Nun müssen diejenigen, welche ihre Gedanken untereinander austauschen wollen, etwas voneinander verstehen; |
Irrtum. Relativ zu Kriterien falsches geistiges Modell gewöhnlich ohne Absicht in Abgrenzung zu Lüge, Täuschung, bewusster Irreführung.
___
Kant (1787): Aus der Vorrede zur 2. Auflage zum Kant'schen Gebrauch des "Ding an sich":
- "Dieses Experiment der reinen Vernunft hat mit dem der Chemiker, welches
sie manchmal den Versuch der Reduktion, im allgemeinen aber das synthetische
Verfahren nennen, viel Ähnliches. Die Analysis des Metaphysikers schied
die reine Erkenntnis a priori in zwei sehr ungleichartige Elemente, nämlich
die der Dinge als Erscheinungen, und dann der Dinge an sich selbst. Die
Dialektik verbindet beide wiederum zur Einhelligkeit mit der notwendigen
Vernunftidee des Unbedingten und findet, daß diese Einhelligkeit
niemals anders, als durch jene Unterscheidung herauskomme, welche also
die wahre ist. Nun bleibt uns immer noch übrig, nachdem der spekulativen
Vernunft alles Fortkommen in diesem Felde des Übersinnlichen abgesprochen
worden, zu versuchen, ob sich nicht in ihrer praktischen Erkenntnis Data
finden, jenen transzendenten Vernunftbegriff des Unbedingten zu bestimmen,
und auf solche Weise, dem Wunsche der Metaphysik gemäß, über
die Grenze aller möglichen Erfahrung hinaus mit unserem, aber nur
in praktischer Absicht möglichen Erkenntnisse a priori zu gelangen.
Und bei einem solchen Verfahren hat uns die spekulative Vernunft zu solcher
Erweiterung immer doch wenigstens Platz verschafft, wenn sie ihn gleich
leer lassen mußte, und es bleibt uns also noch unbenommen, ja wir
sind gar dazu durch sie aufgefordert, ihn durch praktische Data derselben,
wenn wir können, auszufüllen. [Fußnote] So verschafften
die Zentralgesetze der Bewegung der Himmelskörper dem, was Kopernikus,
anfänglich nur als Hypothese annahm, ausgemachte Gewißheit und
bewiesen zugleich die unsichtbare, den Weltbau verbindende Kraft (der Newtonischen
Anziehung), welche auf immer unentdeckt geblieben wäre, wenn der erstere
es nicht gewagt hätte, auf eine widersinnische, aber doch wahre Art,
die beobachteten Bewegungen nicht in den Gegenständen des Himmels,
sondern in ihrem Zuschauer zu suchen. Ich stelle in dieser Vorrede die
in der Kritik vorgetragene, jener Hypothese analogische, Umänderung
der Denkart auch nur als Hypothese auf, ob sie gleich in der Abhandlung
selbst aus der Beschaffenheit unserer Vorstellungen von Raum und Zeit und
den Elementarbegriffen des Verstandes, nicht hypothetisch, sondern apodiktisch
bewiesen wird, um nur die ersten Versuche einer solchen Umänderung,
welche allemal hypothetisch sind, bemerklich zu machen. ... ... ...
Daß Raum und Zeit nur Formen der sinnlichen Anschauung, also nur Bedingungen der Existenz der Dinge als Erscheinungen sind, daß wir ferner keine Verstandesbegriffe, mithin auch gar keine Elemente zur Erkenntnis der Dinge haben, als sofern diesen Begriffen korrespondierende Anschauung gegeben werden kann, folglich wir von keinem Gegenstande als Dinge an sich selbst, nur sofern es Objekt der sinnlichen Anschauung ist, d. i. als Erscheinung, Erkenntnis haben können, wird im analytischen Teile der Kritik bewiesen; woraus denn freilich die Einschränkung aller nur möglichen spekulativen Erkenntnis der Vernunft auf bloße Gegenstände der Erfahrung folgt. Gleichwohl wird, welches wohl gemerkt werden muß, doch dabei immer vorbehalten, daß wir eben dieselben Gegenstände auch als Dinge an sich selbst, wenn gleich nicht erkennen, doch wenigstens müssen denken können [Fußnote] Einen Gegenstand erkennen, dazu wird erfordert, daß ich seine Möglichkeit (es sei nach dem Zeugnis der Erfahrung aus seiner Wirklichkeit, oder a priori durch Vernunft) beweisen könne. Aber denken kann ich, was ich will, wenn ich mir nur nicht selbst widerspreche, d. i. wenn mein Begriff nur ein möglicher Gedanke ist, ob ich zwar dafür nicht stehen kann, ob im Inbegriffe aller Möglichkeiten diesem auch ein Objekt korrespondiere oder nicht. ... ... ... "
Anmerkung zum Auszug aus der Vorrede von Kant (1787): Ich weiß nicht, wie es Ihnen, werte LeserIn geht, aber ich finde Kants Äußerungen schwer verständlich und, so weit ich sie verstehe, in wesentlichen Teilen auch noch falsch, z.B.: Eine reine reine Erkenntnis a priori - also vor aller Erfahrung - gibt es für den Psychologen und Empiriker nicht, es sei, man begnügt mit der Trivialität: Es gibt ein Objekt, ein Erkenntnissystem und ein Subjekt, das es zum Erkennen benutzten kann. Wann immer der Mensch zu denken beginnt, hat er Erfahrungen gemacht und entwickelt sein Denken im Rahmen und in den Grenzen dieser, seiner Erfahrungen. Zu fragen, wie ich dächte, wenn ich keinerlei Erfahrung hätte, erscheint mir wenig sinnvoll, zumal die grundsätzliche Antwort, wenig erhellend und trivial scheint: Jede Erkenntnis setzt ein Subjekt, Objekt und einen Erkenntnisapparat, mit dem erkannt wird, voraus.
Konfus (wirr).
___
Kontamination. Verschmelzung von zwei oder mehreren Worten > W: Kofferwort.
___
Külpe: Denken im Grundriss 1893: Die erste Nennung "Gedankenverlauf" erfolgt im Abschnitt "II. Die inneren Bedingungen" [der Aufmerksamkeit, S. 455, fett-kursiv RS]: "b) Die Beziehung zur psychophysischen Disposition. Unter dieser Bezeichnung fassen wir die für das entwickelte Bewusstsein wichtigsten Bedingungen der Aufmerksamkeit zusammen. Wir verstehen darunter erstlich die associativen Beziehungen zu den im Bewusstsein anwesenden Vorstellungen, zweitens die Beziehungen zu den Reproductionsgrundlagen und drittens die relative Leere des Bewusstseins. Je größer die Reproductionstendenz ist, die ein Eindruck besitzt, um so leichter kann er unsere Aufmerksamkeit fesseln. Auf der sorgfältigen Beachtung dieses Gesetzes beruht vornehmlich alle pädagogische Thätigkeit in Erziehung und Unterricht. Das neu Aufzunehmende muss durch seine Aehnlichkeit mit schon Bekanntem oder durch andere Reproductionsmotive in Verbindung gebracht werden mit dem bestehenden Schatz von Erfahrungen. Unser ganzer Gedankenverlauf ist wesentlich beherrscht von der gleichen Gesetzmäßigkeit."
Die zweite Erwähnung S. 459 im Kapitel Aufmerksamkeit erfolgt in Bezug auf die mangelnde Lenkungsfähigkeit ("automatischen Wirbel von Vorstellungen") des "Gedankenverlaufs" bei einigen Störungen und erwähnt beispielsweise Imbecille, Deliranten, Maniakalische.
Die dritte Nennung S. 464 führt aus: "4. Die innere Willenshandlung tritt uns namentlich beim Denken entgegen. Auch hier handelt es sich um eine anticipirende Apperception, die theils einen größeren, theils einen kleineren Kreis einzelner Reproductionen beherrscht und sich nur durch die Consequenz, mit der alles diesem Kreise Fernstehende zurückgehalten oder verdrängt wird, von zufälligen Reproductionsmotiven unterscheidet. WUNDT hat deshalb den associativen Verbindungen die apperceptiven gegenüber gestellt. Während jene durch die Inhalte selbst gebildet werden und die Apperception nur passiv dabei betheiligt ist, entstehen diese mit Hülfe der activen Apperception, die theils als eine verbindende, theils als eine zerlegende Thätigkeit den peripherisch oder central erregten Empfindungen gegenübertritt. Es hängt diese Ansicht von WUNDT mit der früher bezeichneten Unterscheidung der passiven und activen Apperception (vgl. § 72, 5) auf das Engste zusammen. Jene ist die eindeutig, diese die mehrdeutig bestimmte Apperception. So sehr wir anerkennen, dass in dem letzteren Falle Verbindungsmotive eintreten können, die sich im Bewusstsein nur fragmentarisch darstellen, die also durch Charakter, Gewohnheit, Stimmung und andere, mit der ganzen Entwicklung des Individuums zusammenhängende Einflüsse bestimmt sind, so können wir doch nicht finden, dass dadurch wirklich neue Verbindungsformen entstehen, die wenigstens im Princip auf die bekannten Reproductionsgesetze nicht zurückzuführen wären. Nicht durch eine besondere Art von Verbindungen, sondern nur durch die Leitung des Vorstellungsverlaufs vermittelst anticipirender Apperceptionen scheint uns das Denken von dem automatischen Spiel der Vorstellungen sich zu unterscheiden. Wie WUNDT selbst bei der äußeren Willenshandlung zwischen der eindeutig und der mehrdeutig bestimmten Apperception keinen Wesensunterschied findet, so glauben wir auch bei der inneren Willensthätigkeit von einem solchen absehen zu müssen."
Die vierte und letzte Erwähnung S. 468 betrifft den seiner Ansicht auch im Traum geordneten Gedankenverlauf bei krankhafter Reizbarkeit.
___
Laings komplizierte Metakonstruktionen. > s.a.
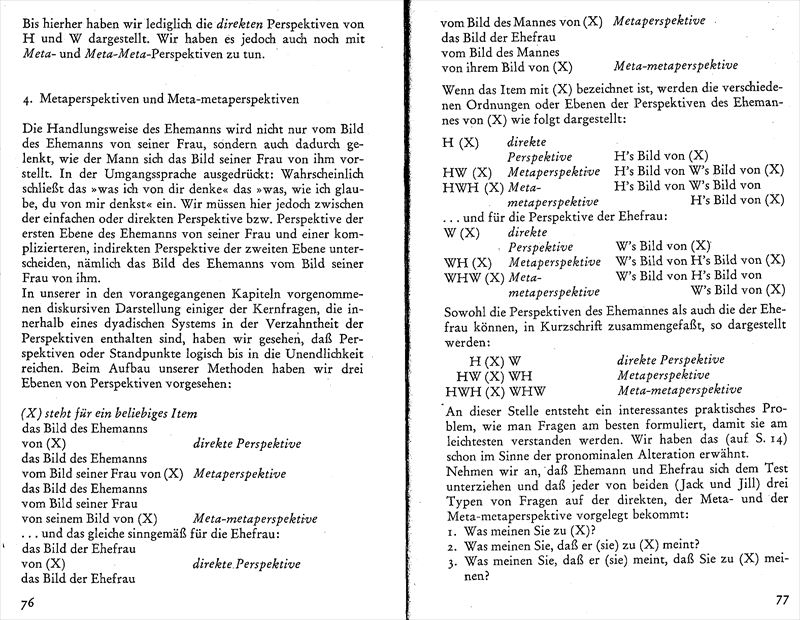
___
laut denken: Diese Methode wurde erstmals von Claparède 1917 erdacht und von Duncker zum Studium von Problemlösungsprozessen angewandt [Die sog. Würzburger Schule der Denkpsychologie (Külpe, Watt, Ach; Selz) bevorzugte die Methode der gezielten Selbstbeobachtung (Introspektion)].
Hier mein relativ spontaner Denkprozeß am Sonntag, den 27.2.2000, nachts um 1.12 bis ca. 1.25 Uhr: unteilbar, im bar steckt eine Möglichkeit. Es teilt sich nicht von selbst. Es muß geteilt werden. Also habe ich drei Systeme: (1) das zu Teilende, (2) einen Teiler, (3) einen Handhaber des Teilers, z. B. (1) ein Blatt Papier, (2) eine Schere, (3) einen Menschen, der die Schere benutzt. Stellt man sich vor, daß das Blatt oft genug zerschnitten wurde, ergibt sich ein Problem, das oben noch gar nicht gesehen wurde, daß man so etwas wie einen Halter des Papiers braucht, um die Schere anzusetzen und das Papier zu teilen. Im Beispiel ist gar nicht berücksichtigt, was mit teilbar gemeint ist. Das Beispiel geht von einer mechanischen, physikalischen Teilungsaufgabe aus. Die Idee eines reinen chemischen Stoffes ist aber gar nicht die mechanische Teilung mit dem Ziel von immer kleiner. Diese Lösung geht an einer Idee der Aufgabe völlig vorbei. Die chemische Idee der Unteilbarkeit ist die gleichbleibender Eigenschaften. Ist die Frage falsch oder unzulänglich formuliert? Was kann teilbar alles bedeuten? Im Sinne von gleicher Stoff ändert sich ja nichts, wenn ich ein Papier in zwei Stücke zerschneide. Beide Stücke repräsentieren den gleichen Stoff. Ich war also auf dem falschen Dampfer und habe teilbar nicht chemisch verstanden im Sinne in die einzelnen Elemente zerlegen bis es nicht mehr weiter geht, sondern physikalisch. Teilbar, so viel zeigt mein Denkprozeß, hat wenigstens zwei fundamental verschiedene Seiten. Die eine Bedeutung ist offenbar immer kleiner machen bis zur Auflösung der Werkzeuge. Die andere ist eigentlich nicht klar. Aber sie bedeutet wohl die Idee, alle Stoffe bestehen aus Unteilbarem (Elemente) oder aus Zusammensetzungen. Teilbar wäre im Falle von Zusammensetzungen also als ein Zerlegen in die Bestandteile der Elemente zu verstehen. Hierbei wäre natürlich vorausgesetzt, daß dies für alle Zusammensetzungen überhaupt möglich ist. Der allgemeine Algorithmus heißt aber: (1) siehe, welche Elemente sich in dem Stoff befinden und (2) siehe, ob es eine Möglichkeit gibt, ein Element noch in weitere Bestandteile zu zerlegen. An dieser Stelle angekommen, ergibt sich ziemlich klar, daß man grundsätzlich keine Sicherheit darüber erlangen kann, ob ein Element noch in weitere Elemente zerlegt werden kann, weil die Auflösung der Werkzeuge gegenüber den Elementen zu groß ist oder ihre Zusammensetzung bzw. ihre Eigenschaften selbst schon beeinflußt. Die Erkenntnis stieße hier an ihre Grenzen, die Aufgabe wäre vorläufig unentscheidbar geworden.
___
Lösung. Ein mindestens doppeltes Homonym mit nicht selten in der Psychotherapie verwirrenden Einflüssen. Einmal bedeutet Lösung das Wissen um den Weg, wie ein Ergebniss oder Ziel herbeigeführt werden, wie ein Hindernis in einem Problem beseitigt werden kann? Die zweite Bedeutung meint die Aufgabe der Beseitigung, also die eigentliche Arbeit, die immer noch verrichtet werden muss, wenn der Lösungsweg bekannt ist. Manche Menschen glauben z.B. in der Psychotherapie, dass ihre Probleme verschwinden, wenn sie wüssten, woher sie kommen, wie sie entstanden sind. Aber wenn ich bei einem Unglück mein Bein verloren habe, so hilft mir das Wissen, wie es dazu gekommen ist, wenig. Ich brauche vermutlich eine Prothese und muss damit umgehen lernen. Wenn ich herausgefunden habe, dass mir in der Kindheit eine wichtige Bezugsperson zu wenig zugetraut hat,. und dass meine Selbstwertprobleme vermutlich damit in Zusammenhang stehen, dann sind im allgemeinen die Selbstwertprobleme durch diese Einsicht noch nicht verschwunden. Es stellt sich weiterhin die Frage: was kann ich tun, was sollte ich lassen, um mit meiner Selbstwertproblematik vorwärts zu kommen?
___
Mach. Schreibt in Erkenntnis und Irrtum (S. 126): "3. Der Mensch bildet seine Begriffe in derselben Weise wie das Tier, wird aber durch die Sprache und durch den Verkehr mit den Genossen, welche beiden Mittel dem Tier nur geringe Hilfe leisten, mächtig unterstützt." [O] s.a. Punkt 2. und S. 115.
Anmerkung: den erkenntnistheoretischen Standpunkt Machs teile ich so wenig wie Schlick, der mir aber letztlich auch noch zu einseitig positivistisch-physikalistisch ist, obwohl . Einen für die PsychologInnen vernünftigen und akzektablen Standpunkt nimmt hingegen Popper in seiner Dissertation zur Denkpsychologie ein, wo er auch Schlicks Position zurückweist.
___
Manisch, Manie, Maniform; Hypomanisch, Hypomanie, Hypomaniform.
Manie: Gemütskrankheit allgemeiner Enthemmung und Beschleunigung seelisch-geistiger Abläufe mit Verlust der Realitäts- und Selbstkritik. Kommt in reiner und ausgeprägter Form eher selten vor. Die leichte Form, die oft nicht als krankheitswertig beurteilt wird, heißt Hypomanie [hypo = unter, Hypomanie = unter der Manie, unter der Schwelle der Manie], eine Art besonders gutes Draufsein und "abnormes" Wohlbefinden mit extremem Selbstbewußtsein, höhere Aktivität und Tatkraft beim sog. euphorischen Typ; weniger bekannt ist der launische und wechselhafte ("dysphorische") Typ. Ein Maniker ist ein Mensch mit einer Ausstrahlung, der ohne Sicherheiten eine Bank mit einem Kredit von einer Million Euro verläßt ;-). Maniform mutet auch der Zukauf- und Schuldenrausch - manchmal aber auch ein gezieltes Verwirrspiel (Lothar Späth?) - vieler Unternehmen an. Als hypomaniform kann man Erlebens- und Verhaltensweisen bezeichnen, die sich noch im "Normbereich" befinden. Die "Normalform" des Manischen heißt üblicherweise glücklich sein. In diese Richtung geht die Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsbehörde. Meist treten maniforme Erscheinungsformen im Rahmen manisch- depressiver ("Zyklothymie") oder schizoaffektiver Formen (Mischformen zwischen Schizophrenie und Depression und Manie) auf. Die leichten Formen heißen auch Zyklothymia. Ob es Sinn macht zu fragen, ob man ganzen Völkern, etwa den Deutschen z.B. eine manisch-depressive Bereitschaft oder Anlage zuordnen kann, ist sicher umstritten, aber eine durchaus medizin- und psychiatrie- soziologisch interessante Fragestellung, denn warum sollen nicht ganze Völker von psychopathologischen Epidemien erfaßt werden können, besonders wenn wir an den religiösen und ideologischen Fanatismus denken?
___
nur denkende Philosophie. Eine beweisende oder empirische Philosophie ist zwar möglich, hat aber keine Tradition und wird auch nicht praktiziert. Nachdem die Logik von den MathematikerInnen angeeignet wurde und die praktisch-empirischen Fragen der Erkenntnis wie auch der Ästhetik von der Psychologie und den Kognitionswissenschaften bearbeitet werden, bleibt nur die - sicherlich unverzichtbare - Ethik übrig. Auch dort wäre natürlich eine empirische Anbindung sehr wünschenswert, ja nötig. Damit ist aber wohl so schnell nicht zu rechnen.
___
Paradoxie. Scheinbar widersprüchlich, unlösbar erscheinend; Denkfalle, Verstrickung. Bei geeigneter Betrachtung aber lösbar, z.B. das Lügnerproblem > Sophisma.
___
Philosophie.
Eine Reihe philosophisch wichtiger Begriffe wurden in der Arbeit über Stirners "Sparren" in das Glossar aufgenommen, die hier verlinkt sind: Altruismus * Anarchismusfrage nach Laska * Atheismus * Aufklärung * Besessenheit * Egoismus * Ethik * Existenz * Existenzialismus * Fixe Idee * Freiheit, Verantwortung und Schuld * Goldene Regel * Ich, Identität, Selbst ... * Idealismus, philosophischer * Konstruktivismus * Kritik * Machiavellismus * Materialismus, philosophischer * Nihilismus * Nominalismus * Normale Verrücktheit * Platonismus * Pragmatismus * Realismus, naiver * Realismus, philosophischer * Recht * Relativismus * Schuld * Schizoid * Skeptizismus * Solipsismus * Spiritualität * Staat * Stirner * Universalienstreit * Utilitarismus * Verantwortung * Verrückt, normal,. krank, gestört * Vorurteile der Nur-Denker-Zunft * Zusammenleben *
___
Popper Zur Methodenfrage der Denkpsychologie > Hansen (2006, S. 191 f):
"§ l Der >Pluralismus der Aspekte<
Ist die introspektive Methode, der >Erlebnisaspekt<, geeignet, eine wissenschaftliche Beschreibung der psychischen Tatsachen zu begründen?
Wenn wir die Frage in dieser Form stellen, sind vielerlei Antworten auf sie möglich:
1. Standpunkt: Unbedingt Bejahung - unbedingte Verneinung: die introspektive Methode wird als die Methode der Psychologie schlechthin angesehen - sie wird als ungeeignet abgelehnt. Beide Ansichten sind in voller Reinheit wohl kaum festgehalten worden FN01; doch finden wir große Annäherungen an sie bei den Vertretern des
2. Standpunktes: Bejahung und Verneinung der Frage mit gewissen Einschränkungen.
Die Vertreter dieses Standpunktes sind entweder der Ansicht, daß der Erlebnisaspekt prinzipiell als die Grundposition der Psychologie anzusetzen ist und neben ihm andere Aspekte nur untergeordnete Bedeutung haben, oder sie vertreten den Standpunkt, daß der Erlebnisaspekt prinzipiell ungeeignet ist, eine Erkenntnis des Psychischen [>192] zu begründen und lassen ihn nur als Ergänzung anderer Methoden gelten. Vertreter dieser Gruppe finden wir in Karl Bühlers Werk Die Krise der Psychologie FN02 angeführt: Auf der einen Seite Vertreter des Erlebnisaspektes (zum Beispiel Wundt FN03, G. E. Müller FN04), auf der anderen Seite drei Gruppen, die sich nach den Wissenschaften richten, die anstelle des Erlebnisaspektes dominieren: 1. Die Behavioristen als Vertreter einer einseitig den >Verhaltensaspekt< betonenden Richtung (Jennings FN05, Watson FN06); 2. die mehr kulturwissenschaftlich orientierte geisteswissenschaftliche Psychologie (Dilthey FN07, Spranger FN08) und 3. (gewissermaßen als eine gemäßigte Fortsetzung des Comteschen Versuches) eine physikalisch-physiologisch orientierte Gruppe (Wertheimer FN09, Koffka FN10, Köhler FN11) die den >psychophysischen Parallelismus< zu ihrer Arbeitshypothese machen.
Der 3. Standpunkt schließlich ist dadurch zu charakterisieren, daß er prinzipiell anerkennt, daß einzig und allein aus einem Zusammenwirken der verschiedenen Aspekte, den Erlebnisaspekt eingeschlossen, eine erschöpfende Beschreibung des Psychischen entstehen kann.
Dieser Standpunkt hebt die Widersprüche der anderen Standpunkte und Gruppen dialektisch in sich auf. Jede Bearbeitung des Problems, von welcher Seite sie auch kommt, ist ihm ein willkommener Beitrag, aus dem das geschlossene Gebäude der Psychologie als eine umfassende Darstellung des Seelenlebens in allen seinen Äußerungen und Funktionen errichtet werden soll.
Nach dieser Ansicht kann keinem der Aspekte von vornherein eine dominierende Stellung zukommen; alle sind zur Beschreibung des Psychischen unentbehrlich und je nach dem bearbeiteten Gebiet kann einmal der eine Aspekt, ein andermal ein anderer Aspekt dominierend hervortreten; aber erst durch das Zusammenwirken der Aspekte kann eine befriedigende Beschreibung des >Psychischen< entstehen."
- FN01 Eine Ausnahme ist vielleicht Comte, der mit Konsequenz
versucht hat, die introspektive Psychologie durch eine phrenologische Physiologie
zu verdrängen. (Vgl. The Positive Philosophy of Auguste Comte
freely translated and condensed by Harriet Martineau I., 1853, S.460-479.)
[Vgl. z.B. S.467: »The proper object of prenological physiology ...
consists in determining the cerebral organ appropriate to each clearly
marked, simple disposition, affective or intellectual; or, reciprocally,
which is more difficult, what function is fulfilled by any portion of the
mass of the brain which exhibits the anatomical conditions of a distinct
organ.« Siehe auch §3,4: Anm. 3 und 4, sowie den Text zu diesen
Anm.] Die entgegengesetzte Ansicht ist wohl am radikalsten von Anhängern
der Kantschen Lehre vom >inneren Sinn< vertreten worden (z. B. von Fries),
doch wurde dieser (solipsistische) Ansatz wohl nie konsequent durchgeführt.
[Siehe IMMANUEL KANT, Kritik der reinen Vernunft (2. Aufl., 1787),
S.37 und 68f.; Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798; 2.
Aufl., 1800), §§ 13 und 22; JAKOB FRIEDRICH FRIES, Neue Kritik
der Vernunft I. (1. Aufl., 1807; 2. Aufl., 1828: Neue oder anthropologische
Kritik der Vernunft), §§21 ff.; sowie auch MORITZ SCHLICK,
Allgemeine
Erkenntnislehre (2. Aufl., 1925), S. 139 ff. und 217.]
FN02 [KARL BÜHLER, Die Krise der Psychologie (1927).]
FN03 [Wilhelm Wundt 1832-1920.]
FN04 [Georg Elias Müller 1850-1934.]
FN05 [Herbert Spencer Jennings 1868-1947.]
FN06 [John Broadus Watson 1878-1958.]
FN07 [Wilhelm Dilthey 1833-1911.]
FN08 [Eduard Spranger 1882-1963.]
FN09 [Max Wertheimer 1880-1943.]
FN10 [Kurt Koffka 1886-1941.]
FN11 [Wolfgang Köhler 1887-1967.]
Poretisches Denken. Titel eines Buches in sechs Heften von Helgi (2005). Poreia (gr.), das Gehen, die Reise. Wird in gewisser Weise als Gegenpol zur Logik gesehen und betrifft hauptsächlich die Entwicklung, den Weg, den Prozess des Erkennens.
___
Problem. Ein Problem liegt vor, wenn einem Ziel ein Hindernis vorgelagert ist, von dem man nicht weiß, wie es zu beseitigen ist. Ist eine Lösung gefunden, so liegt eine Aufgabe vor, d.h. man weiss dann, wie man das Hindernis überwinden kann bzw. weg bekommt, aber man muss es dann schon noch tun. Der Lösungsbegriff ist also wenigstens ein doppeldeutiges Homonym: (1) wie kann ein Hindernis beseitigt werden? (2) die Aufgabe der Beseitigung.
___
Pseudoparadoxie. > Sophisma.
___
Reiz-Reaktions-Theorien erklären den zielgerichteten Denkablauf durch eine Auswahl von Gewohnheitshierarchien. Einige Vertreter: Hull, Spence, Skinner, Maltzmann, Kendler.
___
Ruch & Zimbardo. Anmerkung: In der 4. Auflage ist Denken in Kap. 8, Sprache und schlußfolgerndes Denken" aufgegangen und das Beispiel von Long (1940) verschwunden.
___
Ryle, Gilbert. Der von Graumann herausgegebene sehr interessante Reader zum Denken lässt es sich nicht nehmen, den Band mit einer Kritik Ryles aus dem für den Reader übersetzten "Thinking" zu beschließen. Graumann (S. 459): "Um Begriffsverwirrungen zu entfernen, ist nicht harte experimentelle, sondern harte begriffliche Arbeit zu leisten! Mit dieser Aufforderung des Philosophen Ryle einen Sammelband vorwiegend experimenteller Denkforschung zu beschließen, mag nach Resignation oder Ironie aussehen. Beides wäre fehl am Platz; Selbstkritik dagegen nicht. Ryles zum Teil witzige, zum Teil scharfe Kommentare zur Psychologie des Denkens sollten diese Selbstkritik in Gang bringen. Zwar hat Humphrey (1953) einige der Ryleschen Kritiken zurückweisen können, und der Hauptvorwurf mangelhafter begrifflicher Arbeit vermag einen Gelehrten wie Humphrey ohnehin nicht zu treffen. Der Denkpsychologie im ganzen aber gilt dieser Vorwurf zu Recht. Denn die analytischen Grundeinheiten sind der Denkforschung zumeist vorgegeben gewesen; also können sie schlecht als Ergebnisse rein empirischer Arbeit ausgegeben werden. Echte Empirie hat von Tatsachen auszugehen, die, wie schon James forderte, aller Analyse unbezweifelbar vor- und zugrunde liegen. Sie mit Methoden zu erforschen, die ihnen angepaßt werden, statt nur das zu untersuchen, was zu gängigen Verfahren paßt; sie in Begriffen zu beschreiben, die ihnen angemessen werden, statt sie einschlägigen Kategorien zuzuordnen, ergibt erst den Weg, den eine deskriptiv wie experimentell gleich ausgewogene Denkforschung zu gehen hat. Die Ansätze dazu sind so alt wie die Psychologie des Denkens."
Im wesentlichen bestehen Ryles "Argumente" aus Fehleinschätzungen oder Unkenntnis, wenn er etwa die Leistungen der experimentellen Denkpsychologie allgemein entwertet. Z.B. könnte man ja darüber diskutieren, ob es eine wertvolle neue Erkenntnis über das Denken war, herausgefunden zu haben, dass Denken nicht unbedingt mit bildhaften Vorstellungen einhergeht (ein wesentliches Resultat der Würzburger Schule: Bühler 1908). Aber nicht einmal das vermag Ryle zu sehen (S. 461) : "Ich möchte zwei Fragen stellen. Die erste Frage lautet: Warum ist in der Theorie des Denkens aus den mühevollen Untersuchungen der Psychologen so wenig herausgekommen? Die zweite Frage, die der ersten zugrunde liegt, lautet: Was glaubten diese Forscher zu untersuchen?
(1) Angesichts der Probleme, die beispielsweise von der Würzburger Schule und ihren Nachfolgern in Angriff genommen wurden, befallen einen Philosophen wie mich professionelle Schuldgefühle. Immer wieder sehen wir, wie Psychologen den Versuch machen, genau die Bestandteile und Grundkomponenten von Denkoperationen zu beobachten, zu messen und zu beschreiben, von denen Logiker und Erkenntnistheoretiker feierlich versichert haben, daß sie — aus apriorischen Gründen — da sein müßten. So haben beispielsweise einige unserer philosophischen Urgroßväter erklärt, daß Gedanken aus verschieden entstandenen und verschieden zusammengesetzten Vorstellungen bestehen. Diese Vorstellungen wurden dann mit seelischen Bildern (mental images) identifiziert, da man sonst nichts fand, womit man sie hätte identifizieren können. Pflichtschuldigst begannen die Experimentalpsychologen zu erforschen, wie diese Vorstellungen oder Bilder das Denken konstituieren oder, wenn Zweifel entstanden, was, wenn sie schon das Denken nicht völlig konstituieren, denn ihre Rolle im Denken wäre, und welche anderen Bestandteile man als Lückenbüßer entdecken könnte.
Unsere philosophischen Großväter verlagerten - aus ausgezeichneten philosophischen Gründen - den Schwerpunkt ihrer Reflexion von Begriffen zu Sätzen und von Ideen zu Urteilen, und pflichtschuldigst gingen die Forscher daran, die seelischen Urteilsakte oder -prozesse zu beobachten, zu messen und zu beschreiben. Logiker und Erkenntnistheoretiker haben die Begriffe der Abstraktion und Generalisation debattiert; und pflichtschuldigst gingen die Forscher daran, unter Laboratoriumsbedingungen diese offiziell geförderten Akte des Abstrahierens und Generalisierens zu isolieren. Die bittere Wahrheit ist, daß wir Philosophen erkenntnistheoretische Fabeln erzählt haben und der Experimentalpsychologe pflichtschuldigst versucht hat, die Naturgeschichte unserer Fabelwesen zu schreiben. Folgendes dürfte passiert sein: Die Logiker und Erkenntnistheoretiker haben tatsächlich versucht, funktionale Beschreibungen der verschiedenen Elemente zu geben, nach denen man (konstruierte) Theorien analysieren kann. Ihr Blick war auf die Begriffe, die Bindewörter, die Redewendungen, die Sätze und die Argumente gerichtet, aus denen bekannte Theorien bestehen. Aber die Beschreibungen, die sie zu diesem Zweck verwendeten, waren seit etwa 300 Jahren vorwiegend cartesianischer oder lockescher Natur. ..."
Mit der größten Selbstverständlichkeit geht Ryle hier über wichtige, grundlegende und schwierige Fragen und experimentalpsychologische Anstrengungen hinweg. Er wischt sie einfach beiseite, noch nicht einmal mit einer Begründung. Spätestens an dieser Stelle erkennt man, dass es nicht nicht lohnt, sich mit solch einem Nur-Denker tiefergehend auseinanderzusetzen. Ryle versteht gar nicht, worum es in der empirischen Wissenschaft geht und deshalb ist er wahrscheinlich auch Philosoph geworden.
Ryle beschliesst "Thinking" (S. 466): "Man beachte schließlich, daß ich auch nicht darauf bestehe, am Denken wäre nie mit psychologischen und physiologischen Methoden zu erforschen. Die Forschung von Galton, Henry Head, Freud und Sherrington haben zu neuen Erkenntnissen geführt und werden noch weitere bringen. Lediglich die Suche nach Bestandteil oder Mechanismen, seien sie selbstbeobachtet oder unbewußt, die für all das, was unter dem Namen »Denken« läuft, allgemein charakteristisch sind, scheint mir die Jagd nach einem Irrlicht zu sein. Meine Schlußfolgerung lautet, daß die experimentelle Untersuchung des Denkens ganz unproduktiv geblieben ist, weil die Forscher konfuse oder irrige Vorstellungen von dem hatten, wonach sie suchten. Ihr Vorstellungen von dem, was sie suchten, waren zum Teil deswegen konfus oder irrig weil sie sie aus den jeweils herrschenden philosophischen Theorien entlehnt haben. Sie waren die Erben von Begriffsverwirrungen. Um die Begriffsverwirrungen aus einem System zu entfernen, ist aber nicht harte experimentelle, sondern harte begriffliche Arbeit vonnöten." Das ist zwar richtig, aber nur hart am Testtat der Empirie.
Aus der Einleitung Der Begriff des Geistes, S.3: "Die philosophischen Überlegungen, aus denen dieses Buch besteht, sollen unsere Kenntnisse vom Geist oder der Seele nicht vermehren, sondern die logische Geographie dieses Wissens berichtigen.
Lehrer und Prüfer, Richter und Kritiker, Geschichtsschreiber und Romanschriftsteller, Beichtväter und Unteroffiziere, Unternehmer, Angestellte und Geschäftsteilhaber, Eltern, Liebende, Freunde und Feinde, sie alle wissen gut genug, wie ihre täglichen Fragen über die Eigenschaften und den Verstand eines Menschen, mit dem sie zu tun haben, zu beantworten sind. Sie können seine Leistungen bewerten, seinen Fortschritt abschätzen, seine Worte und Taten begreifen, seine Motive durchschauen und seine Witze verstehen. Wenn sie irregehen, können sie ihre Irrtümer richtigstellen. Ja, sie können auf diejenigen, mit denen sie zu tun haben, durch Kritik oder Beispiel, durch Bestrafung, Bestechung oder Belehrung, mit Spott oder schönen Worten vorsätzlich einwirken und schließlich ihre Methoden im Lichte der erzielten Erfolge abändern.
Sowohl zur Beschreibung des Geistes anderer wie auch zur Aufstellung von Vorschriften für ihn machen sie mit größerer oder geringerer Geschicklichkeit von Begriffen für geistige Fähigkeiten und Tätigkeiten Gebrauch. Sie haben gelernt, wie man in konkreten Situationen Wörter anwendet wie: 'sorgfältig', 'dumm', 'logisch', 'unaufmerksam', 'ori-[>4]ginell', 'eitel', 'methodisch', 'leichtgläubig', 'witzig', 'beherrscht' und tausend andere, die geistige oder seelische Verhaltensweisen beschreiben.
Es besteht aber ein großer Unterschied zwischen der Fähigkeit, solche Begriffe anzuwenden, und der Fähigkeit, ihre Beziehungen miteinander oder mit Begriffen anderer Art ans Licht zu bringen. Viele Leute können mit diesen Begriffen, aber nicht über sie Sinnvolles sagen; sie wissen durch den täglichen Gebrauch, wie sie mit diesen Begriffen umgehen müssen, zumindest innerhalb der üblichen Grenzen, aber sie können nicht die logischen Regeln formulieren, die den Gebrauch dieser Begriffe bestimmen. Sie sind wie Leute, die sich wohl in ihrem eigenen Ort auskennen, aber nicht imstande sind, eine Landkarte davon anzufertigen oder zu lesen, geschweige denn eine Landkarte der Gegend oder des Kontinents, in dem ihr Ort liegt."
Was kritisiert nun Ryle eigentlich? Schaut man sich Der Begriff des Geistes an, so handelt es sich um ein Psychologiebuch, das von einem Philosophen verfasst wurde, in bester schlechter PhilosophInnen-Tradition mit viel Scharfsinn, aber natürlich ohne anständige Empirie. Der gute Mann hat wahrscheinlich in seinem ganzen Denkerleben nie ein Experiment durchgeführt, nie eine Selbstbeobachtung oder Fremdbeobachtung ordentlich dokumentiert. Immerhin spricht Ryle (S. 438) durchaus konsequent von einer philosophischen Psychologie, d.h. von einer Wissenschaft aus dem Lehnstuhl mit Hilfe von Büchern. Sieht man bei MathematikerInnen und StatistikerInnen nur noch eine Staubwolke, wenn man sie nach Bedeutung und Interpretation fragt, so verflüchtigen sich die PhilosophInnen ganz schnell, wenn Empirie, Experiment, Beobachtung, messen, dokumentieren, auswerten, testen gefragt ist (Ausnahme Tetens). Nun, Ryles Werk zielt in der Hauptsache darauf ab, seine Interpretation von Descartes Zwei-Welten-Theorie zu widerlegen, die er für eine Schimäre hält. Nachdem er den Pappkameraden, hier eine Welt der Materie, dort eine des Geistes aufgebaut hat, schlägt er ihn dogmatisch nieder und mit diesem Niederschlag auch gleich die lästige, empirische Psychologie.
___
Salonblödsinn.
Peters hierzu in seinem Wörterbuch: "Salonblödsinn (m). (A. Hoche). Ein im Verhältnis zum äußeren Habitus, gesellschaftlicher Stellung, gewählter Kleidung und zu den geistigen Ansprüchen zu niedriges Intelligenzniveau. Zeigt sich besonders in wortgewandt-eingelernten Unterhaltungen, in denen jedoch Kritik- und Urteilsschwäche nur mangelhaft verborgen werden. Fand sich häufig in den literarischen Salons des 19. Jahrhunderts. Auch in der Literatur häufig dargestellt (z. H. Ibsens »Baumeister Solneß«), selbst im Volkswitz bekannt (»Graf Bobby«). Die Bez. wird gewöhnlich von - Verhältnisschwachsinn nicht scharf getrennt."
Anmerkung: Ungeachtet dessen, daß A. Hoche - zusammen mit Karl Binding (1920) - zu den geistigen Wegbereitern der nationalsozialistischen "Euthanasie" gehörte - die keine keine echte Euthanasie im Sinne von guter Tod war, sondern Mord - , hat diese Beschreibung etwas für sich. Der intellektuelle Dandy, dem vor allem am Schein, am Beeindrucken und gut Dastehen gelegen ist, ist auch keineswegs auf die intellektuellen Snobs im 19. Jahrhundert und ihre Salons beschränkt. Wie wir inzwischen wissen, entspricht dem auch ziemlich gut der smarte Dumpfbacken- New- Economy- Typ der Gegenwart, denn in den modernen Mediokratien kommt es nahezu ausschließlich auf die Wirkung an. Der mediokratische Slogan lautet: Du bist nur, was Du scheinst.
___
Sinn. Wertzuordnung zu Sachverhalten. Beispiele: Das Mittel m ist akzeptabel für den Zweck z. Der Sinn des Lebens "ist" positives Erleben und Gestalten des Lebens.
___
Sophisma. (Pseudoparadoxie). Trugschluss. Verwirrender, mitunter paradox anmutender Sachverhalt; Denkfalle. Zenons Achilles und die Schildkröte [W], Lügner-Problem, Statistische Paradoxien [Stegmüller, ], Hat der gegenwärtige König von Frankreich eine Glatze?
__
Sprache das wesentliche Medium. Dieses Medium steht in einigen Fällen vorübergehend oder dauerhaft gar nicht oder nur unzulänglich zur Verfügung: bei Gehörlosen (Tauben), Stummen, Taubstummen, Hirngeschädigten, Aphasikern, AgnosiepatientInnen, (s/elektiven) MutistInnen. Aber auch bei vielen Menschen, die oberflächlich betrachtet zwar keine Sprech- oder Sprachstörungen zu haben scheinen, aber nur wenig einer psychotherapieerforderlichen Instrospektion fähig sind bzw. die Ergebnisse einer Introspektion nur schwer sprachlich ausdrücken können. Das mag damit zu tun haben, dass es in der Erziehung und in unseren westlichen Gesellschaften keine Kultur der Instrospektion gibt. Möglicherweise ist dies im Zusammenhang mit Schein und materieller Oberflächenorientierung ein Grund für die Verbreitung (sekundärer) Alexithymie, also dem Unvermögen, seine Gefühle, Stimmungen und affektiven Befindlichkeiten wahrzunehmen und auszudrücken, wobei die differentialdiagnostische Unterscheidung - Erlebens- oder Ausdrucksstörung? - auch nicht einfach ist.
___
Strittig. Unterschiedliche Beurteilung in der Sache oder in der Wertung.
___
Trugschluss. Mindestens zweideutiges Homonym: 1) unwissentlich falscher, irrtümlicher Schluß, Fehlschluss; 2) wissentlich falsche, betrügerischer Fehlschluss aus rabulistischen oder rhetorischen Gründen.
___
Unklar. Mehrdeutig, vielsagend, nichtssagend.
___
Unsinn. Relativ zu einer Perspektive kein Sinn erkennbar. Die Fleischerzähne des Schmetterlings wirken gut gelaunt.
___
Unverständlich. Behauptung, einen Sachverhalt oder eine Wertung nicht zu verstehen.
___
Verhältnisblödsinn (Verhältnisschwachsinn)
Eugen Bleuler war ein kreativer Kopf in der Psychiatrie und erfand auch einige wichtige Worte oder Begriffe für die Psychiatrie, so den Begriff der Schizophrenie [kritisch auch], der Ambivalenz, Udenustherapie und auch den häßlichen Begriff "Verhältnisblödsinn", so nachzulesen in: Eugen Bleuler (1923, 4. A.: S. 472 f; 12. A. 1972: S. 585), Lehrbuch der Psychiatrie, im Abschnitt Die Oligophrenien (Psychische Entwicklungshemmungen) und ausführlich unter: Bleuler, Eugen (1914). Verhältnisblödsinn. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch gerichtliche Medizin. Bd. 71. Berlin: Reimer.
1923 (S. 472): "II. Eine andere Form, in die der höhere Blödsinn ohne Grenze übergeht, ist der Verhältnisblödsinn. Nicht immer, wenn auch oft, besteht auch hier eine gewisse Unklarheit des Denkens. Das Wesentliche aber ist ein Mißverhältnis zwischen Streben und Verstehen. Es sind Leute, deren Verstand für eine gewöhnliche Lebensstellung oft sogar für eine etwas über mittelschwierige ausreichen würde, die aber zu aktiv sind und beständig sich mehr zumuten, als sie verstehen können, deshalb viele Dummheiten machen und im Leben scheitern."
1972 (S. 585): "3. Verhältnisblödsinn.
Hinter sozialem Versagen steht manchmal ein Mißverhältnis zwischen Streben und Verstehen, zwischen Wollen und Können. Viele 'Verhältnisblödsinnige' lassen sich ständig in Geschäftsgründungen ein, veranlassen unter beschönigenden Angaben andere, Geld in ihre Geschäfte zu legen. verlieren dann rasch die Übersicht über ihre Finanzen, versagen in jeder Beziehung und reißen andere im eigenen Ruin mit. Viele andere setzen es durch, Stipendien und Studienbeiträge in großen Beträgen zu erhalten, um angebliche künstlerische Fähigkeiten zu entwickeln. ohne daß diese da sind. Der Verstand dieser Leute wäre oft in einer bescheidenen Lebensstellung genügend, doch manövrieren sie sich unermüdlich und rastlos in Stellungen hinein, denen sie nicht gewachsen sind. Viele von ihnen sind im Denken unklar. 'Verhältnisblödsinn' und 'Salonblödsinn' zeigen mannigfaltige Übergänge."
Wortgebrauch 'Verhältnisblödsinn' im Netz, Beispiel: https://www.freitag.de/2001/08/01081701.htm
Kritisch ist anzumerken, daß das Wort ziemlich brutal und entwertend klingt. Heute sagt man sehr viel milder klingend: Selbstüberschätzung.
___
Voluntarismus. Psychologische Richtung, die dem Wollen, Antrieb und Dynamik eine zentrale Bedeutung zuschreibt, als bekanntester Vertreter gilt Wilhelm Wundt.
__
Vorstellungbegriff Gottlob Freges in DER GEDANKE (1919)
Frege schreibt eine klare, einfache und verständliche Wissenschaftsprosa. Er verwendet den Ausdruck "Vorstellung" unpsychologisch für jeden Bewusstseinsinhalt außer den Entschlüssen und seinem speziell entwickelten GEDANKENbegriff, der dem von mir bevorzugten Sachverhaltsbegriff entspricht. Viele Sachverhalte - so etwa alle der Natur oder unter dem Gesichtspunkt der Natur - existieren unabhängig davon, ob ein Mensch sie kennt, erkennt oder sie denken kann. Das zumindest ist die Grundüberzeugung des philosophischen Realismus. Seine Argumentation für ein neues Reich der GEDANKEN erscheint mir schwach. Wenn ich Frege richtig verstanden habe, so braucht es eines GEDANKENreichs, damit Wissenschaft möglich ist. Auch sein Argument von der ewig gültigen Wahrheit des Satzes des Pythagoras ist falsch, denn der gilt nur in der euklidischen Geometrie, aber dort hat er vermutlich recht, obwohl ich das nicht begründen kann. Mit den ewigen Wahrheiten bin ich vorsichtig. Und die Mathematik ist ja auch nicht mehr das, was sie einmal war (> Grundlagenstreit). Im folgenden einige wichtige Zitate aus Freges DER GEDANKE, insbesondere zum Vorstellungsbegriff:
- "Auch der unphilosophische Mensch sieht sich bald genötigt, eine
von der Außenwelt verschiedene Innenwelt anzuerkennen, eine Welt
der Sinneseindrücke, der Schöpfungen seiner Einbildungskraft,
der Empfindungen, der Gefühle und Stimmungen, eine Welt der Neigungen,
Wünsche und Entschlüsse. Um einen kurzen Ausdruck zu haben, will
ich dies mit Ausnahme der Entschlüsse unter dem Worte „Vorstellung"
zusammenfassen.
Gehören nun die Gedanken dieser Innenwelt an? Sind sie Vorstellungen? Entschlüsse sind sie offenbar nicht. [>67]
Wodurch unterscheiden sich die Vorstellungen von den Dingen der Außenwelt? Zuerst:
Vorstellungen können nicht gesehen oder getastet, weder gerochen, noch geschmeckt, noch gehört werden.
Ich mache mit einem Begleiter einen Spaziergang. Ich sehe eine grüne
Wiese; ich habe dabei den Gesichtseindruck des Grünen. Ich habe ihn,
aber ich sehe ihn nicht.
- Zweitens: Vorstellungen werden gehabt. Man hat Empfindungen, Gefühle,
Stimmungen, Neigungen, Wünsche. Eine Vorstellung, die jemand hat,
gehört zu dem Inhalte seines Bewusstseins.
Die Wiese und die Frösche auf ihr, die Sonne, die sie bescheint,
sind da, einerlei ob ich sie anschaue oder nicht; aber der Sinneseindruck
des Grünen, den ich habe, besteht nur durch mich; ich bin sein Träger.
Es scheint uns ungereimt, dass ein Schmerz, eine Stimmung, ein Wunsch sich
ohne einen Träger selbständig in der Welt umhertreibe. Eine Empfindung
ist nicht ohne einen Empfindenden möglich. Die Innenwelt hat zur Voraussetzung
einen, dessen Innenwelt sie ist.
- Drittens: Vorstellungen bedürfen eines Trägers. Die Dinge
der Außenwelt sind im Vergleiche damit selbständig.
Mein Begleiter und ich sind überzeugt, dass wir beide dieselbe
Wiese sehen; aber jeder von uns hat einen besonderen Sinneseindruck des
Grünen. Ich erblicke eine Erdbeere zwischen den grünen Erdbeerblättern.
Mein Begleiter findet sie nicht; er ist farbenblind. Der Farbeneindruck,
den er von der Erdbeere erhält, unterscheidet sich nicht merklich
von dem, den er von dem Blatt erhält. Sieht nun mein Begleiter das
grüne Blatt rot, oder sieht er die rote Beere grün? oder sieht
er beide in einer Farbe, die ich gar nicht kenne? Das sind unbeantwortbare,
ja eigentlich unsinnige Fragen. Denn das Wort „rot", wenn es nicht eine
Eigenschaft von Dingen angeben, sondern meinem Bewusstsein angehörende
Sinneseindrücke kennzeichnen soll, ist anwendbar nur im Gebiete meines
Bewusstseins; denn es ist unmöglich, meinen Sinneseindruck mit dem
eines andern zu vergleichen. Dazu wäre erforderlich, einen Sinneseindruck,
der einem Bewusstsein angehört, und einen Sinneseindruck, der einem
andern Bewusstsein angehört, in einem Bewusstsein zu vereinigen. Wenn
es nun auch möglich wäre, eine Vorstellung aus einem Bewusstsein
verschwinden und zugleich eine Vorstellung in einem andern Bewusstsein
auftauchen zu lassen, so bliebe doch immer die Frage unbeantwortet, ob
das dieselbe Vorstellung wäre. Inhalt meines Bewusstseins zu sein,
gehört so zum Wesen jeder meiner Vorstellungen, dass jede Vorstellung
eines andern eben als solche von meiner verschieden ist. Wäre es aber
nicht möglich, dass meine Vorstellungen, mein ganzer Bewusstseinsinhalt
zugleich Inhalt eines umfassenderen, etwa göttlichen Bewusstseins
wäre? Doch wohl nur, wenn ich selbst Teil des göttlichen Wesens
wäre. Aber wären es dann eigentlich meine Vorstellungen? wäre
ich ihr Träger? Doch das überschreitet soweit die Grenzen des
menschlichen Erkennens, dass es geboten ist, diese Möglichkeit außer
Betracht zu lassen. Jedenfalls ist es uns Menschen unmöglich, Vorstellungen
anderer mit unsern [>68] eigenen zu vergleichen. Ich pflücke die Erdbeere
ab; ich halte sie zwischen den Fingern. Jetzt sieht sie auch mein Begleiter,
dieselbe Erdbeere; aber jeder von uns hat seine eigene Vorstellung. Kein
anderer hat meine Vorstellung; aber viele können dasselbe Ding sehen.
Kein anderer hat meinen Schmerz. Jemand kann Mitleid mit mir haben; aber
dabei gehört doch immer mein Schmerz mir und sein Mitleid ihm an.
Er hat nicht meinen Schmerz, und ich habe nicht sein Mitleid.
- Viertens: Jede Vorstellung hat nur einen Träger; nicht zwei Menschen
haben dieselbe Vorstellung.
Sonst hätte sie unabhängig von diesem und unabhängig
von jenem Bestand. Ist jene Linde meine Vorstellung? Indem ich in dieser
Frage den Ausdruck „jene Linde" gebrauche, greife ich eigentlich der Antwort
schon vor; denn mit diesem Ausdrucke will ich etwas bezeichnen, was ich
sehe und was auch andere betrachten und betasten können. Nun ist zweierlei
möglich. Wenn meine Absicht erreicht ist, wenn ich mit dem Ausdrucke
„jene Linde" etwas bezeichne, dann ist der in dem Satze „jene Linde ist
meine Vorstellung" ausgedrückte Gedanke offenbar zu verneinen. Wenn
ich aber meine Absicht verfehlt habe, wenn ich nur zu sehen meine, ohne
wirklich zu sehen, wenn demnach die Bezeichnung „jene Linde" leer ist,
dann habe ich mich, ohne es zu wissen und zu wollen, in das Gebiet der
Dichtung verirrt. Dann ist weder der Inhalt des Satzes „jene Linde ist
meine Vorstellung" noch der Inhalt des Satzes „jene Linde ist nicht meine
Vorstellung" wahr; denn in beiden Fällen habe ich dann eine Aussage,
welcher der Gegenstand fehlt. Die Beantwortung der Frage kann dann nur
abgelehnt werden mit der Begründung, dass der Inhalt des Satzes „jene
Linde ist meine Vorstellung" Dichtung sei. Freilich habe ich dann wohl
eine Vorstellung; aber diese meine ich nicht mit den Worten „jene Linde".
Nun könnte jemand wirklich mit den Worten „jene Linde" eine seiner
Vorstellungen bezeichnen wollen; dann wäre er Träger dessen,
was er mit jenen Worten bezeichnen wollte; aber er sähe dann jene
Linde nicht, und kein anderer Mensch sähe sie oder wäre ihr Träger.
Ich komme nun auf die Frage zurück: Ist der Gedanke eine Vorstellung? Wenn der Gedanke, den ich im pythagoreischen Lehrsatz ausspreche, ebenso von andern wie von mir als wahr anerkannt werden kann, dann gehört er nicht zum Inhalte meines Bewusstseins, dann bin ich nicht sein Träger und kann ihn trotzdem als wahr anerkennen. Wenn es aber gar nicht derselbe Gedanke ist, der von mir und der von jenem als Inhalt des pythagoreischen Lehrsatzes angesehen wird, dann dürfte man eigentlich nicht sagen „der pythagoreische Lehrsatz", sondern „mein pythagoreischer Lehrsatz", „sein pythagoreischer Lehrsatz", und diese wären verschieden; denn der Sinn gehört notwendig zum Satze. Dann kann mein Gedanke Inhalt meines Bewusstseins, sein Gedanke Inhalt seines Bewusstseins sein. Könnte dann der Sinn meines pythagoreischen Lehrsatzes wahr, der seines falsch sein? Ich habe gesagt, das Wort „rot" sei anwendbar nur im Gebiete meines Bewusstseins, wenn es nicht eine Eigenschaft von Dingen angeben, sondern einige meiner Sinneseindrücke kennzeichnen solle. So könnten auch die Wörter „wahr" und „falsch" so, wie ich sie verstehe, anwendbar sein nur im Gebiete meines [>69] Bewusstseins, wenn sie nicht etwas betreffen sollten, dessen Träger ich nicht bin, sondern bestimmt wären, Inhalte meines Bewusstseins irgendwie zu kennzeichnen. Dann wäre die Wahrheit auf den Inhalt meines Bewusstseins beschränkt, und es bliebe zweifelhaft, ob im Bewusstsein anderer überhaupt etwas Ähnliches vorkäme.
Wenn jeder Gedanke eines Trägers bedarf, zu dessen Bewusstseinsinhalte er gehört, so ist er Gedanke nur dieses Trägers, und es gibt keine Wissenschaft, welche vielen gemeinsam wäre, an welcher viele arbeiten könnten; sondern ich habe vielleicht meine Wissenschaft, nämlich ein Ganzes von Gedanken, deren Träger ich bin, ein anderer hat seine Wissenschaft. Jeder von uns beschäftigt sich mit Inhalten seines Bewusstseins. Ein Widerspruch zwischen beiden Wissenschaften ist dann nicht möglich; und es ist eigentlich müßig, sich um die Wahrheit zu streiten, ebenso müßig, ja beinahe lächerlich, wie es wäre, wenn zwei Leute sich stritten, ob ein Hundertmarkschein echt wäre, wobei jeder von beiden denjenigen meinte, den er selber in seiner Tasche hätte, und das Wort „echt" in seinem besonderen Sinne verstände. Wenn jemand die Gedanken für Vorstellungen hält, so ist das, was er damit als wahr anerkennt, nach seiner eigenen Meinung Inhalt seines Bewusstseins und geht andere eigentlich gar nichts an. Und wenn er von mir die Meinung hörte, der Gedanke wäre nicht Vorstellung, so könnte er das nicht bestreiten; denn das ginge ihn ja nun wieder nichts an.
So scheint das Ergebnis zu sein: Die Gedanken sind weder Dinge der Außenwelt
noch Vorstellungen.
Ein drittes Reich muss anerkannt werden. Was zu diesem gehört,
stimmt mit den Vorstellungen darin überein, dass es nicht mit den
Sinnen wahrgenommen werden kann, mit den Dingen aber darin, dass es keines
Trägers bedarf, zu dessen Bewusstseinsinhalte es gehört. So ist
z. B. der Gedanke, den wir im pythagoreischen Lehrsatz aussprachen, zeitlos
wahr, unabhängig davon wahr, ob irgendjemand ihn für wahr hält.
Er bedarf keines Trägers. Er ist wahr nicht erst, seitdem er entdeckt
worden ist, wie ein Planet, schon bevor jemand ihn gesehen hat, mit andern
Planeten in Wechselwirkung gewesen ist. (FN5)"
Vorurteile der Nur-Denker-Zunft. Wo diese Philosophenkrankheit hinführt, hat Brecht ins einem Galilei sehr schön ausgeführt.
Beispiel Brentano (Bd. 2, S. 34):
- "Darüber, was wir Vorstellen nennen, haben wir uns auch früher
schon erklärt, Wir reden von einem Vorstellen, wo immer uns etwas
erscheint. Wenn wir etwas sehen, stellen wir uns eine Farbe, wenn wir etwas
hören, einen Schall, wenn wir etwas phantasieren, ein Phantasiegebilde
vor. Vermöge der Allgemeinheit, in der wir das Wort gebrauchen, konnten
wir sagen, es sei unmöglich, daß die Seelentätigkeit in
irgendeiner Weise sich auf etwas beziehe, was nicht vorgestellt werde.*)
Höre und verstehe ich einen Namen, so stelle ich mir das, was er bezeichnet,
vor; und im allgemeinen ist dieses der Zweck der Namen, Vorstellungen hervorzurufen.**)"
___
Wert. Grundlegend neue Kategorie, die Sachverhalte nicht "nur" wahrnimmt und erkennt, sondern einen Wert beimisst. Beispiel: Ein Nahrungsmittel, das schmeckt; ein Bild, das gefällt; eine Methode, die im gewünschten Sinne wirkt.
Querverweis: Die Psychologische Grundfunktion und das Heilmittel Werten in der GIPT.
___
Widerspruch. S ist p und S ist nicht p.
kontradiktorischer Widerspruch. p, nicht-p. Beispiele: schwarz - nicht schwarz; gut - nicht gut; hoch - nicht hoch;
konträrer Widerspruch. p, Gegenteil p. Beispiele: schwarz - weiß; gut - schlecht; hoch - niedrig; richtig - falsch;
___
Wie arbeitet die Wissenschaft wirklich ? "Schaut man sich jedoch an, was die Wissenschaftler tun, hält man sich also an ihre Taten und hört nicht auf ihre Worte, so stellt man erstaunt fest, dass die Forschung in Wirklichkeit zwei Gesichter hat, die ein guter Autor als Tagwissenschaft und als Nachtwissenschaft bezeichnet hat. Wie ein Räderwerk greifen die Beweisführungen der Tagwissenschaft ineinander, und ihre Resultate haben die Kraft der Gewissheit. ... Die Nachtwissenschaft dagegen ist blindes Irren. Sie zögert, stolpert, weicht zurück, gerät ins Schwitzen, schreckt auf. An allem zweifelnd, sucht sie sich, hinterfragt sich, setzt immer wieder neu an. Sie ist eine Art Werkstatt des Möglichen, in der das künftige Material der Wissenschaft ausgearbeitet wird. ... Hier sind die Phänomene noch Einzelerscheinungen ohne Zusammenhang, sind die Pläne für Versuchsreihen noch nicht ausgereift. FN1" (Steinle, S.15)
___
Wirr.
___
Würzburger Schule der Denkpsychologie.
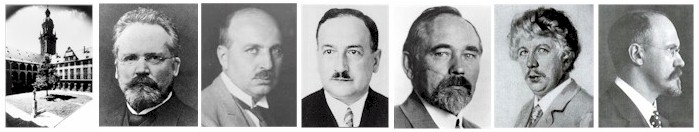
Q: Alte Universität, Oswald Külpe Karl Bühler Otto Selz Narziss Ach Karl Marbe August Messer.
Wendete sich gegen die Assoziationspsychologie und entwickelt eigene
Methoden, u.a. - von Wundt abgelehnt, von Bühler weitgehend widerlegt
(Ziche 1999, Reader 213-235) - eine methodische Introspektionsweise. Einige
Vertreter sind z.B.: Ach, Narziss (1871-1946), Bühler,
Karl [1869-1963; 1938 emigriert], Dürr, Ernst (1878-1913);
Grünbaum. Adolf (1923*); Külpe,
Oswald (1862-1915); Lindworsky, Johannes (1875-1939); Marbe,
Karl (1869-1953); Mayer, August (1874-1951); Messer, August
(1867-1937); Orth, Johannes (1872-1949); Schulze, Otto F.E (1872-1950);
Selz, Otto (1881-1943; von den Nazis auf dem Weg ins KZ Auschwitz ermordet),
Taylor, Clifton O. (1888-1975); Thumb, Albert (1865-1915); Watt, Henry
J. (1879-1925). Die Idee und Behauptung der Würzburger Schule (Ziche
1999, S.23) wonach das Denken grundsätzlich der Introspektion zugänglich
sei, ist zwar richtig, aber weshalb Introspektion ein vollständiges
Bild der mentalen Zusände erlaube, ist für mich nur schwer nachzuvollziehen.
Es hätte doch auch der Würzburger Schule auffallen müssen,
dass das Denken meist sehr schnell, unscharf, flüchtig, wenig begrifflich
klar und über weite Strecken auch nicht bewusst erfolgt. Schon deshalb
erscheint es mir völlig klar, dass die Erforschung des Denken so lange
schwierig bleiben muss, bis es gelingt, die Denkprozesse im Gehirn herauszufiltern
und mit Zeitlupenfunktion darzustellen. Das wird mit den Fortschritten
der Hirnforschung eines - mehr oder minder fernen - Tages möglich
sein.
___
Wundt, Wilhelm. Gilt als Begründer
der wissenschaftlichen Psychologie (1879, Psychologisches Labor Leipzig),
der den Stellenwert von Beobachtung und Experiment nachhaltig einführte
und konsequent vertrat. Bildete viele - und besonders auch wissenschaftlich
- tätige Psychologen in diesem empirischen Geiste aus. Sah zwei Hauptaufgaben:
individuelle und Völkerpsychologie (Sozial- und Kulturpsychologie).
Sah die innere
Wahrnehmung als Grundlage der Psychologie an.
___
Zukunftsdenken. Das Buch von Oettingen
stellt der ihrer Ansicht nach bisherigen Forschungstradition Zunkunftsdenken
als Erwartungsurteil, Zukunftsdenken als wunschgeleitete Phantasie gegenüber.
Das sind zwei völlig verschiedene Kategorien. Das eine erfordert in
der Tat echtes Denken, wenn es um Erwartungen geht, also die Frage ansteht:
womit rechne ich, dass es (nicht) geschieht. Das andere betrifft das bloße
Erkennen von Wünschen und Bedürfnissen: was möchte ich,
dass geschieht?
___
[Zur internen Verwendung: Querverweise: Absurdität, Antinomie, Aporie, konfus (wirr), Fehler,Fehlschluss, Irrtum, Lösung, Paradoxie, Problem, Pseudoparadoxie, Sophisma, Strittig, Trugschluss, unklar, unverständlich, Unsinn, Widerspruch. > Rabulistik, Rhetorik, Sophistik, ...]
Standort Denken.
*
Terminologische Differenzierung und Entwicklung kognitiver Schemata und Begriffsbildung.
Überblick Denkpsychologie.
Überblick Wissenschaft in der IP-GIPT.
*
| Suchen in der IP-GIPT, z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff> site:www.sgipt.org |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS) Einführung in die Denkpsychologie aus Sicht der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/allpsy/denk/denk0.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert: irs 05.09.2023 Rechtschreibprüfung / grob-korrigiert irs 31.05.2010
Änderungen: wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft, kleine Änderungen werden nicht immer extra ausgewiesen * Anregungen und Kritik erwünscht
10.11.23 Zur neuen Defintionsseite Denken als Erleben
26.10.23 Zur Definition des Denkens wird im Rahmen der elementaren Dimensionen der Erlebensforschung eine eigene Seite erarbeitet. * Eingefügt beim Begriff: "Ein Begriff besteht aus Name oder Wiedererkennung, Begriffsinhalt (der den Sachverhalt beschreibt, um den es geht) und der Referenz, die angibt, wo und wie man den Begriffsinhalt in der Welt finden kann." * Tabelle: 1921 Ach Über die Begriffsbildung eingebaut.
17.10.23 In der Definition des Denkens Bewusstseinsinhalte durch Sachverhalte ersetzt.
14.10.23 Begriffsverschiebebahnhof Geistige Modelle prädiziert.
05.09.23 irs Rechtschreibprüfung
13.12.22 Den Hauptsatz der Erkenntnistheorie eingefügt.
16.04.22 Erg. Würzburger Schule Denkpsychologie; Wundt.
12.11.21 Schwemmer Sprachliches Denken.
16.11.19 Begriffseinführungen: Vorgang verstehen * Ursache, Wirkung, Kausalität * Wesentlich/unwesentlich.
08.10.18 Protokoll Stadien des Denkens. Stichworte Physik.
03.10.18 4.3.2 ausgearbeitet.
01.10.18 Begriffs-Definition eingefügt.
10.08.18 Ergänzung zweier wichtiger Grundbegriffe: auswählen und abstrahieren.
16.06.18 Erg. 1917, 1935 zur Geschichte des lauten Denkens.
30.10.17 Graphik Referenzmodell fehlerkorrigiert.
30.08.17 Kurzdefinition Gedanke: Denken und Gedanke.
08.02.17 Querverweise Begriffe auf das Allgemeine Psychologische Referenzmodell.
30.01.17 Kritik an Hofstadter & Sander (Die Analogie")
21.10.16 Lit-Erg.
25.09.16 Klix-Zitat.
22.12.15 Lit-Aufnahme Ebert.
08.06.15 Der Vorstellungsbegriff Gottlob Freges in DER GEDANKE.
07.06.15 Lit: Meinong (Gegenstandslehre). Frege: Gedanke, Gedankengefüge, Verneinung.
31.03.15 Linkfehler geprüft und korrigiert.
30.04.11 Exaktes Denken (Reidemeister).
08.04.11 Neu ins Glossar genommen: Absurdität * Antinomie * Aporie * Bedeutung * Fehler * Fehlschluss * Homonym * Irrtum * konfus (wirr) * Kontamination * Lösung * Paradoxie * Problem * Pseudoparadoxie * Sophisma * strittig * Trugschluss * unklar * unverständlich * Unsinn * Wert * Widerspruch * wirr *
11.06.10 Modellierungen bei 3.2.5 Kognitionswissenschaften. * Nachtrag 1910 (Zirkularitätsprinzip) 1917 (Radon-Transformation),
08.06.10 Vorurteile der Nur-Denker-Zunft. * Anmerkung Funktionseinheiten zu Brentano * Lit-Erg: Aebli *
06.06.10 Der Pluralismus der Aspekte zur Methodenfrage der Denkpsychologie aus Popper zitiert, Ryle nachkorrigiert.
02.06.10 Die Idee, das reale Geschehen der Welt als "Sprache" des Geschehens in den Welten zu interpretieren, eingebaut: 4.1.1.0.
01.06.10 Erweiterung von einem auf nunmehr acht, also um sieben Kapitel, womit der weitere Forschungsrahmen auch abgesteckt ist.
23.05.04 Lay out Überarbeitung.