(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=03.10.2018 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 26.10.23
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Ach Begriffsbildung _Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Narziss Ach Über die Begriffsbildung
(1921)
Zur Haupt-
und Verteilerseite Protokolliertes Denken.
Ausgelagert von der Hauptseite
Denken (Kap 4.3.2).
Originalarbeit von Rudolf
Sponsel, Erlangen
_
Ach Begriffsbildung (1921)
| Einfuehrung und Zusammenfassung
zur Ach'schen Begriffsbildungsuntersuchung
Ach hält eine neue Methode, die er genetisch-synthetisch nennt, zur Untersuchung der Begriffsbildung (>Definition Begriff) für erforderlich, um den Begriffsbildungsprozess in reiner und echter Form zu studieren. Die einleuchtende Grundidee ist, dass neue und bislang unbekannte Begriffe zu lernen sind (S. 33), hier sind es die Begriffe groß und schwer zugleich (Name Gazun), groß und leicht zugleich (Name Ras), klein und schwer zugleich (Name taro) und klein und leicht zugleich (Name fal). Die Begriffsbildung ist mit dem Zusammendenken "... zugleich" (Definientia) abgeschlossen. Die Definienda Gazun, taro, Ras und fal sind für die Begriffsbildung und auch durch die Kürze der Beschreibung für die Kommunikation nicht notwendig, aber für die Ach'schen Prüfmethoden. Gegeben sind die Begriffsmerkmale Pappschachtel (im Grundversuch alle 12 blau, 6 große, 6 kleine), Größe (groß, klein), Form (4 Würfel, 4 Pyramiden, 4 Zylinder), Gewicht (schwer, leicht) [>Abb.1] . Die Standardversuchsreihe besteht aus drei Versuchsgruppen: Lernen, Anwenden und Prüfen. In der Lernphase werden die Namen für die vier Begriffsneubildungen gelernt. Die Vpn müssen bei jedem der 12 Körper - in der Regel drei mal - aufsagen, was auf dem Zettel steht (Gazun, taro, Ras oder fal) und dabei den Körper heben. Das geschah in drei Anordnungen (vorne die schweren, hinten die schweren, "bunt" gemischt). Die Namensgebung wurde durch die Ebbinghaus'schen Versuche angeregt. Es zeigt sich, dass die Vpn die Bedeutung von Gazun, taro, Ras und fal lernen. So weit so gut. Aber was wissen wir durch diese Versuche nun mehr über die Begriffsbildung? Ich vermisse in der Arbeit eine klare Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse und neuen Befunde zur Begriffsbildung. Ach ist ja angetreten mit dem Anspruch, den Begriffsbildungsprozess über Neubildungen zu erforschen. Dafür hat er sich seine genetisch-synthetische Methode und Anordnung ausgedacht. Ach zeigt, dass vier Begriffsneubildungen gelernt und mit neuen Namen versehen werden können: groß und schwer zugleich (Name Gazun), groß und leicht zugleich (Name Ras), klein und schwer zugleich (Name taro) und klein und leicht zugleich (Name fal). Die neuen Namen erscheinen eher ablenkend von der eigentlichen Aufgabe der Begriffsneubildung. Das bedeutet in der Regel Neubildung durch neue Kombination schon gegebener Begriffsmerkmale BM1, BM2, ... BMi, BMj, ... BMn. (z.B. gekrümmter Raum, Materiewellen; Verhältnisblödsinn nach Bleuler; Oudenus-Therapie; neue Krankheiten). Die Lehr- und Lernmittel sind im Ach'schen Versuch: die Namenszettel an den Objekten (Würfel, Pyramide, Zylinder), das Aufsagen der Namen (Assoziation Begriffsmerkmale und Name) und das Heben der Objekte. Nach der Lernphase kommt die Anwendungs- und danach die Prüfphase. Die Prüfmethode besteht im (Nach-) Fragen. Fazit Begriffs-Definition-Ach-1921: Dass ein Begriff aus Namen oder Wiedererkennung, Begriffsinhalt und Referenz (wo und wie man den Begriffsinhalt in der Welt finden kann) erkennt Ach nicht. Obwohl Ach die Bedeutung des Wiedererkennen durch 5 Erwähnungen (2x S. 21; 22; 30, 177) unterstreicht, fällt ihm nicht auf, dass Wiedererkennen ein Begriffsäquivalent ohne Namen ist. Insgesamt ein interessantes Werk vor allem durch Achs Idee, Begriffsbildungen an Neubildungen (Gazun := groß und schwer, taro := klein und schwer, Ras := groß und leicht und fal := klein und leicht) zu untersuchen ist indessen wegweisend und damit sehr gut. Kritik: Es ist mir leider nicht klar geworden,
was Ach nun für die Begriffsbildung neu herausgefunden haben
will. Entscheidend sind ganz sicher nicht die Namen (Gazun, taro, Ras,
fal), die lenken eigentlich nur ab. Die Aufgabe war ja, einen neuen Begriff
zu bilden, der aus zwei Merkmalen besteht m12 := m1
und m2, in seinem Versuch z.B. groß und schwer zugleich.
Der Versuch hätte zeigen sollen, wie genau es zu dieser Begriffsbildung
kommt, welche Wege es gibt, und das hätte exploriert werden müssen,
so dass am Ende eine Theorie - zumindest dieser - Begriffsbildung steht.
|
Aus Achs Originalarbeit
Ach, Nariziss 1921. Über die Begriffsbildung. Bamberg.
Was ist ein Begriff bei
Ach (1921)?
hier fett ist bei Ach g e s p e r r t
Zusammenfassung-Begriff-bei
Ach-1921
ZA1921-1: Durchsuchen der 343-Seiten Arbeit
nach "defin" ergibt 21 Fundstellen. "begriff" ergibt 314 Treffer. Nach
der Grundregel
für wichtigere Begriffe einer Arbeit sollte zu Beginn eine Erklärung
Achs erfolgen, was er unter Begriff versteht. Das ist auch der Fall, auch
wenn er S. 1 statt mit der erforderlichen Begriffsklärung des Begriffs
Begriff zu beginnen, sogleich mit seinem methodischen Ansatz und Grundsatz
beginnt (A1921-S.1).
ZA1921-2: Die Begriffsexplikation verschiebt
Ach sogleich auf den Begriffsverschiebebahnhof
Wortbedeutung:
- "Dabei wollen wir unter Begriff zunächst die Wortbedeutung verstehen,
die signifikative Bedeutung des Wortes als eines Zeichens oder Symbols,
wie sie jedermann vom sinnvollen Lesen eines Wortes, eines Textes oder
vom Auffassen der Rede her bekannt ist.2) Diese Definition des Begriffes
als der Wortbedeutung soll aber nur eine vorläufige sein. Sie soll
unserer Untersuchung zunächst die Richtung geben, sodaß unsere
Aufgabe vorerst ebensogut auch lauten könnte: es sollen die psychologischen
Bedingungen der Entstehung der Wortbedeutung untersucht werden."
Ach glaubt damit Begriff definiert zu haben, wenn er von Terminus spricht: A1921-S.3:
- "... Nur insofern ist durch die von uns gewählte Definition des
Terminus ..Begriff' eine Festlegung gegeben, als die Worte die normalen
Mittel der sprachlichen Verständigung einer Mehrheit von Individuen
bilden. Und dieser Tatbestand ist, wie wir sehen werden, für die Begriffsbildung
von größter Wichtigkeit"
ZA1921-Fazit: Dass ein Begriff aus Namen oder Wiedererkennung, Begriffsinhalt und Referenz (wo und wie man den Begriffsinhalt in der Welt finden kann) erkennt Ach nicht. Obwohl Ach die Bedeutung des Wiedererkennen durch 5 Erwähnungen (2x S. 21; 22; 30, 177) unterstreicht, fällt ihm nicht auf, dass Wiedererkennen ein Begriffsäquivalent ohne Namen ist. Insgesamt ein interessantes Werk vor allem durch Achs Idee, Begriffsbildungen an Neubildungen (Gazun := groß und schwer, taro := klein und schwer, Ras := groß und leicht und fal := klein und leicht) zu untersuchen ist indessen wegweisend und damit sehr gut.
A1921 Fundstellen zum Begriff des Begriffs
- hier fett ist bei Ach g e s p e r r t
- A1921-S.1 "Wenn wir die Begriffsbildung einer
experimentellen
Untersuchung unterziehen wollen, können wir uns nicht damit
begnügen, bereits fertige Begriffe einer psychologischen Analyse
zu unterwerfen. Wir müssen vielmehr künstlich diejenigen
Bedingungen herstellen, unter denen es zwangsläufig zur
Bildung neuer, dem Individium bisher fremder Begriffe kommt.
Nur bei einem derartigen Verfahren sind wir im Stande, die
Faktoren festzulegen, welche für die Begriffsbildung wesentlich
sind. Das Verfahren zur Lösung der analytischen Aufgabe
hat also ein genetisches zu sein, zugleich ist es
synthetisch, da durch das Zusammenwirken gewisser
Bedingungen ein vorher nicht Vorhandenes, nämlich ein
bestimmter Begriff aufgebaut wird bezw. zur Ausbildung
kommt. Nur durch ein derartiges genetisch-synthetisches
Verfahren, das zugleich die notwendige Variierung der ur-
sächlichen Bedingungen der zu untersuchenden Erscheinungen
in sich schließt, läßt sich der gesetzmäßige Zusammenhang
festlegen, in dem der Begriff zu andersartigen seelischen
Tatbeständen steht. Es ist dies im Grunde dieselbe Methode,
die auf dem Gebiete des Gedächtnisses mit so großem Erfolge
zur Analyse des Vorstellungsverlaufes zur Anwendung ge-
langt ist."
Aber noch auf S. 1 wendet er sich der Begriffsexplikation des Begriffs
zu:
- A1921-1f: "Was nun den eigentlichen Gegenstand unserer
Frage-
stellung, nämlich den Begriff betrifft, so ist eine nähere
Umgrenzung dieses Gegenstandes schon deshalb erforderlich,
weil es noch in der Gegenwart namhafte Vertreter der [>2]
Psychologie gibt, welche die Untersuchung des Begriffes
überhaupt von jeder psychologisdien Betrachtungsweise
ausschließen und sie allein der logischen Betrachtung zu-
weisen wollen. So sagt z. B. Ziehen, die Lehre vom
Allgemeinbegriff, bei dem die Allgemeinvorstellung wenigstens
formal über die individuelle psychologische Erfahrung hinaus
verallgemeinert sei, unterstehe nicht der psychologischen,
sondern der logischen Betrachtungsweise.1) Dieser Standpunkt
kann für unsere Untersuchung um so weniger in Betracht
kommen, als wir den Begriff nicht als ideales Gebilde einer
normativen Wissenschaft, das dem logischen Grundsatze von
der Identität unterworfen ist, betrachten wollen, sondern die
realen psychologischen Bedingungen untersuchen werden,
welche zur Entstehung des Begriffs innerhalb eines Einzel-
bewußtseins führen. Dabei wollen wir unter Begriff zunächst
die Wortbedeutung verstehen, die signifikative Bedeutung
des Wortes als eines Zeichens oder Symbols, wie sie jeder-
mann vom sinnvollen Lesen eines Wortes, eines Textes oder
vom Auffassen der Rede her bekannt ist.2) Diese Definition
des Begriffes als der Wortbedeutung soll aber nur eine vor-
läufige sein. Sie soll unserer Untersuchung zunächst die
Richtung geben, sodaß unsere Aufgabe vorerst ebensogut
auch lauten könnte: es sollen die psychologischen Bedingungen
der Entstehung der Wortbedeutung untersucht werden. Daß
uns allerdings die fortschreitende Untersuchung über diese
erste Formulierung der Aufgabe hinausführen wird, werden
wir weiterhin sehen.
Die Definition des Begriffes als der Wortbedeutung, die ja
infolge ihrer Einfachheit vielfach verwendet wird, soll uns
hinsichtlich der theoretischen Auffassung dessen, was wir vom
psychologischen Standpunkte aus unter einem Begriff zu
verstehen haben, in keiner Weise festlegen, ist ja, wie
Stumpf sagt, die Frage nach dem Wesen der Begriffe
„immer noch die schwierigste von allen, die die Psychologie
der Verstandestätigkeiten betreffen".3) Auch weitere Fragen
- 1) Th. Ziehen. Leitfaden der physiolog. Psychol. 10.
Aufl. 1914. S. 242.
2) Die verschiedenen Arten der Bedeutung eines Wortes bezw. Zeichens
werden später an der Hand der Versuchsergebnisse besprochen werden.
3) C. Stumpf, Erscheinungen und psychische Funktionen. Abhandl.
d. Berliner Akademie der Wissensdiaft. phil. bist. Kl. 1907. S 2"
S.1: hier fett ist bei Ach g e s p e r r t
"1. Kapitel
Einleitung
§ 1.
Die Aufgabenstellung
Wenn wir die Begriffsbildung einer experimentellen Untersuchung unterziehen
wollen, können wir uns nicht damit begnügen, bereits fertige
Begriffe einer psychologischen Analyse zu unterwerfen. Wir müssen
vielmehr künstlich diejenigen Bedingungen herstellen, unter denen
es zwangsläufig zur Bildung neuer, dem Individuum bisher fremder Begriffe
kommt. Nur bei einem derartigen Verfahren sind wir imstande, die Faktoren
festzulegen, welche für die Begriffsbildung wesentlich sind. Das Verfahren
zur Lösung der analytischen Aufgabe hat also ein genetisches
zu sein, zugleich ist es synthetisch, da durch das Zusammenwirken
gewisser Bedingungen ein vorher nicht Vorhandenes, nämlich ein bestimmter
Begriff aufgebaut wird bzw. zur Ausbildung kommt. Nur durch ein derartiges
genetisch-synthetisches Verfahren, das zugleich die notwendige Variierung
der ursächlichen Bedingungen der zu untersuchenden Erscheinungen in
sich schließt, läßt sich der gesetzmäßige Zusammenhang
festlegen, in dem der Begriff zu andersartigen seelischen Tatbeständen
steht. Es ist dies im Grunde dieselbe Methode, die auf dem Gebiete des
Gedächtnisses mit so großem Erfolge zur Analyse des Vorstellungsverlaufes
zur Anwendung gelangt ist."
Bisherige Untersuchungsmethoden zur Begriffsbildung nach Ach (1921), S. 16ff
"1. Methoden zür Bestimmung der phänomenolögischen
Eigentümlichkeiten des Bedeutungsbewußtseins
Die die Lehre von den Begriffen
() betreffenden Untersuchungen hatten sich vor allem die Aufgabe gestellt,
festzulegen, was wir erleben, wenn uns ein Begriff
() gegenwärtig ist, oder sie suchten, im Sinne unserer Ausführungen
ausgedrückt, eine phänomenologische Charakteristik des Bedeutungsbewußtseins
zu geben. Da sich diese Versuche in der Regel noch an die bereits von Galton1)
geübte Reproduktionsmethode hielten, also in einer, wie wir sehen
werden, vom methodologischen Standpunkt aus betrachtet unzulänglichen
Weise zur Durchführung gelangten, so kann ihnen für die Beantwortung
der Frage nach der Untersuchung des Bedeutungsbewußtseins nur eine
untergeordnete Rolle zugesprochen werden, noch dazu, wenn sie wie z. B.
die Versuche von Schwiete auch in einer technisch unzureichenden Weise
zur Ausführung gelangen2). Bei den gewöhnlichen Reproduktionsversuchen
von Sch., die er ungebundene Reproduktionen nennt, werden als akustische
Reizworte Bezeichnungen sinnlich-wahrnehmbarer Eindrücke oder solche
von physikalisch-chemischen öder von psychischen Eigenschaften u.
dgl. vom Vl zugerufen und die Vp hat hierauf mit einem beliebigen .Wort
möglichst schnell zu reagieren und nachher auszusagen, „wie sie zu
dieser Reproduktion gekommen ist"3). ...
- 1) F. Ga1ton. Inquiries into Human Faculty and its Development.
London 1883, p.109 ff.
2) F. Schwiete , Ober die psychische Repräsentation der Begriffe, Ar, Gs Ps. XIX, 1910.
Sch. mißt die Zeitdauer seiner akustischen Reaktionen in der Weise daß der VT gleichzeitig mit dem Rufen des Reizwortes einen Tastet und damit .den durch das Chronoskop gehenden Strom schließt, während -die-Vp mit dem Aussprechen des Reproduktionswortes einen zweiten Taster losläßt und hierdurch den Strom unterbricht. Die Unzuverlässigkeit einer derartigen Zeitmessung ist bekannt. Vergl. auch E. Meumann (Ar Gs Ps . Bd. ?? 1907, S. 1-28). . -
3) Solche Versuche werden sonst gewöhnlich als freie Ässoziations-reaktionen. bezeichnet."
"2. Die Methoden der Untersuchung der Abstraktion in ihrer Beziehung
zur Begriffbsbildung ().
Der Vorgang der Abstraktion im Sinne des Absehens vom Individuellen,
vom Zufälligen wird schon von Plato und Aristoteles zur BegrifFsbildung
in Beziehung gebracht. Hier interessiert uns weder die metaphysische noch
die logische Bedeutung dieses Prozesses, wir haben uns vielmehr ausschließlich
mit der psychologischen Seite desselben zu befassen und zwar in diesem
Zusammenhänge auch nur soweit, als die zur Untersuchung der psychologischen
Abstraktion angewandten Methoden für die Begriffsbildung
() in Betracht kommen. Doch sind zunächst einige terminologische Bemerkungen
vorauszuschicken Abgesehen von der eben erwähnten generalisierenden
Abstraktion spricht man auch von einer isolierenden psychologischen Abstraktion,
bei der durch die besondere Richtung der Aufmerksamkeit einzelne Inhalte
des Bewußtseins herausgehoben und von den übrigen mehr oder
weniger isoliert werden. Da aber auch die generalisierende Abstraktion
zu einer Isolierung [>16] ihres Produktes, nämlich der Allgemeinvorstellung
bezw. des Begriffes () gegenüber
anderen Vorstellungen führt, so ergibt sich schon hieraus, daß
diese Unterscheidung vom psychologischen Standpunkte aus als keine glückliche
bezeichnet werden kann, wie überhaupt die Terminologie auf diesem
Gebiete noch wenig geklärt ist« So wird nicht selten die allgemeine
Vorstellung überhaupt gleich der abstrakten Vorstellung gesetjt, trotzdem
es nach den Ausführungen von Berkeieg wohl Allgemeinvorstellungen,
aber keine abstrakten Allgemeinvorstellungen geben soll, eine Auffassung,
deren Richtigkeit in der Gegenwart allerdings wieder bestritten wird.1)
Unter Teilinhalten, Modifikationen oder Momenten wollen wir im Anschluß
an die Terminologie von G. E. Müller2) unselbständige
Bewußtseinsinhalte (Vorstellungen, Empfindungen) wie Farbe, Intensität,
Größe, Form, Dauer verstehen. So sind wir zugleich zu einer
weiteren Gegenüberstellung gekommen, die im Anschluß an gewisse
Gedankengänge von Berkeley in der Geschichte der Lehre von der psychologischen
Abstraktion eine Rolle spielt, nämlich derjenigen der selbstständigen
und unselbständigen Inhalte. Th. Lipps ; definiert z. B. die Abstraktion
als das apperceptive Herausnehmen und Isolieren unselbständiger Teilgegenstände.3)
Da es nun aber auf Grund einer entprechenden Aufmerksamkeitszuwendung durch
isolierende Abstraktion möglich ist, auch ein selbständiges Objekt
z. B. der Wahrnehmung herauszuheben und hierbei von den übrigen Inhalten
mehr oder weniger zu abstrahieren, suchten wieder Andere eine Definition
der Abstraktion aufzustellen, bei der auf die Selbständigkeit oder
Unselbständigkeit des abstrahierten Inhaltes keine Rücksicht
genommen ist, so Husserl und Külpe, welch letzterer unter der psychologischen
Abstraktion den Prozeß versteht, durch den das psychologisch Wirksame
von dem psychologisch Unwirksamen geschieden wird,4) wobei [>17]
die wirksamen Inhalte die positiv abstrahierten, die unwirksamen diejenigen
sind, von denen abstrahiert wird. So ist zugleich die schon von Kant gegebene
Unterscheidung der positiven und negativen Abstraktion wieder zu ihrem
Rechte gekommen. Ob nun dem Prozesse der Abstraktion eine besondere, eigenartige
geistige Fähigkeit zugrunde liegt, oder ob er sich restlos auf andere
psychologische Tatbestände zurückführen läßt,
also nur eine Folgewirkung derselben, insbesondere der Aufmerksamkeit oder
der Apperception darstellt, wie vielfach angenommen wird, laßen wir
in dem gegenwärtigen Zusammenhänge dahingestellt. Wir werden
aber unter Berücksichtigung unserer Versuchsresultate später
hierauf einzugehen haben.
Es ist hier auch nicht der Ort, der Berechtigung der verschiedenen
Auffassungen bezw. Begriffsbestimmungen
() der psychologischen Abstraktion und
der mit ihr im Zusammenhänge stehenden Termini weiter nachzugehen
und so das ausgedehnte Gebiet der Abstraktion einer eingehenden Würdigung
zu unterziehen, vielmehr kommen für uns zunächst nur gewisse
experimentelle Methoden zur Untersuchung der Abstraktion in Betracht und
zwar soweit dieselben zugleich zur Begriffsbildung
() in Beziehung stehen. Von diesem Gesichtspunkte aus haben Versuche, wie
die von Külpe, Grünbaum und im Anschluß an dessen Methode
von Koch, Habrich, v. Kuenburg1) ausgeführten Abstraktionsuntersuchungen
kein unmittelbares methodologisches Interesse für uns, ebensowenig
auch die Versuche von Mittenzwey, Seifert, Ranguette2) u. A.
Sie alle betreifen zwar [>18] gewisse Seiten des Äbstraktionsprozeßes,
aber ohne daß dabei dem Vorgang der Begriffsbildung
() besondere Beachtung geschenkt worden wäre. ... "
- S16-1) Vergl. z. B. Messer, Psychologie,
Stuttgart-Berlin 1914, S. 194
S16-2) G. E. Müller III, S. 497 ff.
S16-3) Th. Lipps, Leitfaden der Psychologie, 2. Aufl., Leipzig 1906, S.145.
S16-4) O. Külpe, Versuche über Abstraktion, Ber. über d. 1. Kongr. f. exp. Psgchol. herausgeg. von Schumann, Leipzig, 1904, S. 67.
S17-1) A. A. Grünbaum, Qber die Abstraktion der Gleichheit Ar Gs P» Bd. Xll. 1908, S. 340 ff. A. Koch, Exp. Untersuchungen über die Abstraktionsfähigkeit von Volksschulkindern. Zeitsch. f. angew. Psychol. Bd. 7. 1913, S. 332 ff. 1· Habrich, Uber die Entwickelung der Abstraktionsfähigkeit von Schülerinnen, ebenda Bd. 9, 1914, S. 189 ff. M. v. Kuenburg, Über Abstraktionsfähigkeit und die Entstehung von Relationen beim vorschulpflichtigen Kinde, ebenda Bd. 17, 1920, S. 270 ff.
S17-2) K. Mittenzwey, Uber abstrahierende Apperception, Psycholog. Studien von Wundt, Bd. II, 1907 S. 358 ff. F. Seifert, Zur Psychol, der Abstraktion u. Gestaltauffassung, Z Ps, Bd. 78, 1917, S. 55. ff. L. Ranguette, Untersuchung über die Psychol, des wissenschaftl. Denkens auf experimenteller Grundlage 1. Teil: Die elementaren Inhalte der Denkprozesse, Ar Gs Ps. Bd. XXXVI. 1917, S. 169 ff"
3. Die sog. Intelligenzuntersuchungen in ihrer methodologischen
Beziehung zur Begriffsbildung ().
Die Definition eines Begriffes ()
bildet nicht blos eine logische Methode zur Bestimmung des Inhaltes eines
Begriffes
(), sie dient vielmehr vielfach, insbesondere in der Wissenschaft dazu,
an der Hand von Benennungsurteilen [>24] neue Begriffe
() zu bilden. So stehen auch alle jene Unter- suchungen, welche die Begriffsbestimmung
als methodologisches Hilfsmittel benutzen, in einer gewissen Beziehung,
zu unserer Problemstellung der Feststellung des Prozesses der signifikativen
Bedeutungsverleihung. Bereits Binet und Simon haben den Definitionstest
in ihre bekannte Staffelmethode aufgenommen, im jüngeren Alter die
Definition von konkreten Begriffen ()
wie Gabel, Tisch, Stuhl usw., im höheren Alter (11. u. 12. Jahr) diejenige
von abstrakten Begriffen () wie Barmherzigkeit,
Gerechtigkeit Güte. Derartige Definitionsteste sind dann in ausgiebiger
Weise von Pohlmann, Gregor, dem Hamburger psychologisdien Laboratorium
(W. Stern) und von anderen Stellen zur Intelligenzuntersuchung von
Jugendlichen verwendet worden. 1) Weiter ist hierher zu rechnen der Oberbegriffstest
() von Bobertag, 2) bei dem zu zwei oder mehr Begriffen
() der übergeordnete Begriff ()
zu nennen ist. 3) Zur Feststellung der Abstraktionsfähigkeit findet
sich ein ähnlicher Test unter dem Titel „Generalisationsfragen“ z.
B. „was sind die Eiche, die Buche, die Tanne, die Birke, die Ulme zusammen?“
in der Methode der „Psychologischen Profile“ von Rossolimo. 4)
Eine Bedeutung für das Problem der Begriffsbildung
() erhalten diese Untersuchungen vor allem dadurch, daß die Definitions-
() und Gattungsbegriffstests () in verschiedenen
Altersstufen zur Anwendung gelangen, also im Sinne einer [>25] vergleichend-statistischen
Methode verwendet werden. So sind sie innerhalb gewisser Grenzen geeignet,
uns einen Einblick in die ontogenetische Entwicklung der verschiedenen
Begriffsarten
() und der Art und Weise ihrer Verwendung zu geben; so ist z. B, bei jüngeren
Kindern (6—7 jährigen) die Zweckdefinition („Stuhl ist zum Sitzen“)
die herrschende; mit zunehmendem Alter tritt diese jedoch gegenüber
der Verwendung des Gattungsbegriffes
(), der Angabe eines Beispieles u. dergl. mehr und mehr zurück. Abstrakte
Begriffe () können erst im höheren Alter (13.
und 14. Lebensjahr) zureichend definiert werden. Nach den vergleichenden
Untersuchungen von Eng, die zu ihren ausgedehnten, in Kristiania
angestellten Versuchsreihen neben der Begriffsbestimmung
() auch die Reproduktionsmethode in Anwendung gezogen hat, scheint es sogar,
als ob Volksschulkinder unter 14 Jahren vielfach überhaupt noch nicht
imstande sind, abstrakte Hauptwörter wie Wirkung, Bewunderung in ihrer
eigentlichen Bedeutung zu erfassen, daß sie vielmehr in der Regel
mit dem abstrakten Hauptwort dieselbe Bedeutung verbinden wie mit dem entsprechenden
Zeit- oder Eigenschaftswort. Dabei besitzen die Kinder bereits vom 10.
Jahre ab eine erstaunlich hochgradige Fähigkeit, allgemeine Aussagen
zu machen.1)
M o e d e3) hat indirekte und direkte Methoden der Begriffsuntersuchung
() unterschieden. Zu den ersteren rechnet er die Begriffserklärung,
die Frage nach dem Oberbegriff ()
(Gattungsbegriff) (), die Frage nach dem Gemeinsamen, das
verschiedene Erzählungen aufweisen, die Umfangsbestimmung. ...
- S24-1) Vergl. hierzu: W. Stern. Die
Intelligenz der Kinder und Jugendlichen u. die Methoden ihrer Untersuchung,
Leipzig 1920, S. 104 ff; ferner W. Stern u, 0. Wieg mann: Methodensammlung
zur Intelligenzpröfung, Leipzig 1920, S. 138ff, wo sich nähere
Literaturangaben finden. Th. Ziehen. Die Principien und Methoden der lntelligenzpiüfung,
4. Aufl., Berlin 1908.
S24-2) O. B o b e r t a g, Uber Intelligenzprüfungen (nach der Methode von Binet u. Simon) Zeitschrift f. ang. Psychol., Bd. S, 1911, S. 130.
S24-3) Der Test wird infolgedessen zweckmäßiger Ggttungsbegriffs-test genannt. Hinsichtlich der praktischen Bedeutung dieses Tests vergl. O. Karstadt. Zur Schaffung vor> Paralleltests, Zeitschr. f. ang. Psgchol. Bd. 13, 1918, S. 340 f.
S24-4) G. Rossolimo, Klinik für psychische u. nervöse Krankheiten, Bd. 6, 1911 (Heft 3/4). Vergl. hierzu auch N. Braunshausen u. A. Ensch, Psycholog. Profile, Jahrg. 18 u. 22 der Zeitschr. f. Kinderfprschunp, 1913 u. 1917.
S25-1) a. a. O. S. 40. Vergl. vor allem nach A Gregor Untersuchungen über die Entwickl. einfacher logischer Leistungen, Zeitschr. f. ang. Psychol., Bd. 10, 1915, S* 339 ff. Zweifellos spielt für die Beurteilung gewisser Unterschiede der Untersuchungsergebnisse verschiedener Autoren die individuell verschiedene sprachliche Entwicklung eine Rolle, Neben dem Einflüsse des häuslichen und sozialen Milieus kommt auch der Gesamtentwickl. des betreffenden Volksstammes eine wesentliche Bedeutung zu. Vergl. auch A. Fischer. Sprachpsycholog. Untersuchungsmethoden im Dienst von Erziehung.u. Unterricht, Z. f. paed. Psychol,, 20. Jahrg., 1919, S. 334.
S25-2) W. Moede. Die Methoden der Begriffsuntersuchung. Zeitschr. f, paedagog. Psychol., 17. Jahrg., 191$, S. 149 ff."
S. 33:
über die Begriffsbildung an Hand der Suchmethode.
Abschnitt A.
§ 3.
Allgemeine Schilderung der Suchmethode.
Den in der Einleitung ausgesprochenen methodologischen Forderungen der
künstlichen Setzung von Bedingungen, unter denen es bei gleichzeitiger
Berücksichtigung des der Begriffsbildung eigentümlichen funktionellen
Momentes zwangsmäßig zur Ausgestaltung von Begriffen kommt,
scheint die S u ch- Methode (abgekürzt S. M.) zu genügen, zu
deren Anwendung ich nach mannigfachen Vorversuchen gekommen bin. Sie geht
von dem leitenden Gedanken aus, daß es der Vp nur mit Hilfe von gewissen,
zunächst sinnlosen Zeichen z. B. den Schrift- und Klangbildern „Gazun“
oder „taro“ möglich ist, bestimmte einfache Aufgaben zu lösen.
Diese Aufgaben bestehen u. a. darin, gewisse Körper wie Pappschachteln
oder Holzkörper, die vorher diese auf Zettel geschriebenen Worte (Gazun
und dergl.) getragen hatten, jetzt aber ohne solche Zettel waren, bei Nennung
dieser Bezeichnungen aus einer größeren oder kleineren Zahl
einander ähnlicher Körper herauszusuchen. Nur durch die vorherige
Beachtung der auf den Zetteln stehenden Worte und der Eigenschaften der
ihnen zugeordneten Körper können diese Aufgaben richtig gelöst
werden. Die Zeichen (Worte) dienten der Vp als Mittel zur Erreichung eines
bestimmten Zweckes, nämlich zur Lösung der vom Versuchsleiter
(Vl) gestellten Aufgaben, und dadurch daß sie in dieser Weise Verwendung
fanden, erhielten sie eine eindeutig bestimmte Bedeutung. Sie wurden für
die Vp zu Trägern begrifflicher Inhalte. Die Vp kann auf Grund der
sprachlichen Anwendung dieser jetzt sinnvollen Zeichen über bestimmte
Sachverhalte Aussagen machen, die vom Vl verstanden werden. [>34]
Die S. M. gestaltet sich im Einzelfalle und zwar
in einer einfachen Anordnung folgendermaßen.
Es werden zwölf blaue Pappschachteln vor die Vp auf den
Tisch in einer bestimmten Anordnung aufgestellt und zwar 4 Würfel,
4
Pyramiden und 4 Zylinder. Je 2 Würfel, 2 Pyramiden, 2 Zylinder
sind groß, die übrigen sechs klein, wie dies in
der nebenstehenden Zeichnung durch Quadrate, Dreiecke und Kreise schematisch
angedeutet ist.1) Jede Pappschachtel trägt einen Zettel,
der an der Pappschachtel mit einer Nadel angesteckt ist, so daß er
jederzeit abgenommen werden kann. Auf diese Zettel sind mit der Hand sinnlose
Worte in Antiqua aufgeschrieben.
Abgesehen von dem auffälligen Größenunterschied,
der die 12 Schachteln bei der Auffassung unmittelbar in sechs große
und sechs kleine Körper trennen ließ, zeigten die Pappgefäße
auch noch einen ziemlich erheblichen Gewichtsunterschied. Dieser
Gewichtsunterschied war so getroffen, daß man von großen
schweren und großen leichten, sowie von kleinen schweren
und kleinen leichten Schachteln sprechen kann. Das absolute Gewicht
der einzelnen Arten z. B. der drei großen schweren Schachteln war
nicht gleich. Das Wesentliche war vielmehr, daß zwischen den Gewichten
der einzelnen Paare, also z. B. zwischen dem großen schweren und
dem großen leichten Würfel ein deutlich merkbarer Gewichtsunterschied
bestand.. Doch waren auch diese Gewichtsunterschiede bei den verschiedenen
Paaren nicht völlig gleich. Es sollte nur bei unbefangenem Heben der
schweren Körper der absolute Eindruck der Schwere und bei demjenigen
der leichten der Eindruck der Leichtigkeit ausgelöst werden (Vergl.
S. 36 Anm.).
Wie schon bemerkt, trägt jeder der Körper
einen Zettel mit einem darauf geschriebenen sinnlosen Wort. ln der [>35]
schematischen Zeichnung ist die erste Aufstellung der 12 Körper
mit den sinnlosen Bezeichnungen wiedergegeben [RS: die Bezeichnungen
sind nicht sinnlos, sondern unbekannt und neu].
_
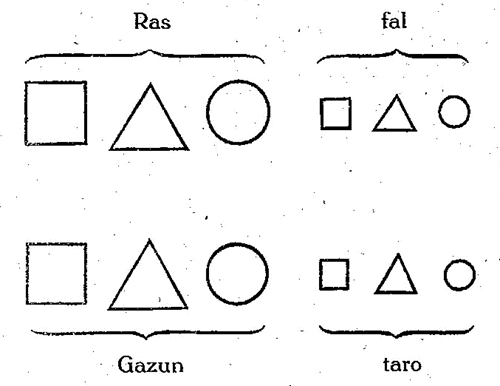
Hieraus ist ersichtlich, daß jedes der 3 großen schweren
Gefäße einen Zettel mit dem sinnlosen Wort „Gazun“ getragen
hat, jedes der hinter diesen Körpern stehenden großen leichten
Gefäße einen Zettel mit „Ras", jeder der drei kleinen schweren
Körper, die vorn in einer Reihe mit den großen schweren Gefäßen
(Gazun) stehen, einen Zettel mit „taro“ und die dahinter stehenden 3 kleinen
leichten Gefäße einen solchen mit „fal.“
- 34-FN1) Die Größenmaße waren
bei den großen Pappgefäßen folgende; Seitenlange
der Würfel 10,5 cm, Seitenlange der Pyramiden 13,5 cm, Durchmesser
der Zylinder 10 cm, ihre Höhe 6 cm; die entsprechenden Größenmaße
der kleinen Körper: Würfel 5,5 cm, Pyramide 6,5, Zylinder
5,3 und 2 cm.
Bei den später verwendeten Sätzen (Satz II) wurden kleine Änderungen vorgenommen. So als Seitenlänge der großen Würfel 10 cm, der kleinen Würfel 5 cm, der kleinen Pyramiden 6 cm, der kleinen Zylinder 5 cm.
Tabelle IV Schema der Differenzierung von 48 Versuchskörpern
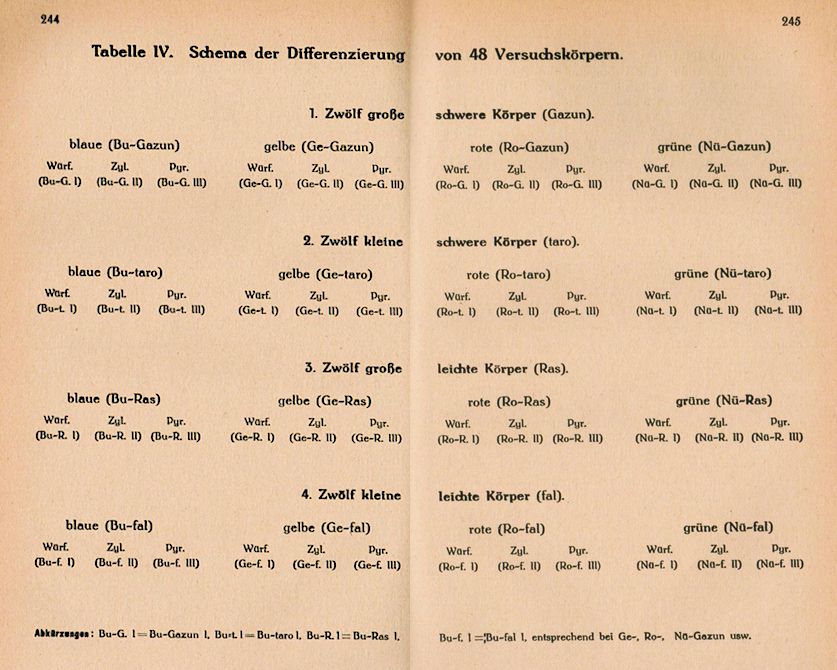
Auseinandersetzung mit Achs genetisch-synthetischer Methode
Wiederholung der Versuche von Ach durch
Alexander Willwoll im Wintersemester 1923/24,
Willwoll, Alexander (1926) Wiederholung der Versuche von Ach. In (42-59)
Willwoll, Alexander (1926) Begriffsbildung. Eine psychologische Untersuchung.
Leipzig: Hirzel.
"42 Anhang zum ersten Teil.
Wiederholung der Versuche Narziß Achs.
Es war eine lockende Arbeit, die Versuche, über
die der erste Teil referierte, soweit es möglich war zu wiederholen
und ihre Resultate nachzuprüfen und zu bestätigen. Im Wintersemester
1923/24 wiederholte der Verfasser im Psychologischen Institut der Universität
Wien die Achschen Versuche nach der Suchmethode und nach der Verständigungsmethode,
auch — aber in weit geringerem Ausmaß — die Achschen Differenzierungsversuche.
Es war wohl von vornherein zu erwarten, daß sich die Resultate Achs
bestätigen würden: die Assoziation der Wort- und Ding Vorstellungen,
ihre Notwendigkeit einerseits, ihr Ungenügen zur Herbeiführung
signifikativer Wortfunktion anderseits, ferner eine Fülle von, Ach
würde sagen: Hilfskriterien — es handelt sich um Beziehungserfassungen
verschiedener Art, die der signifikativen Wortfunktion die Wege bereiten
und sie vorbereiten —, schließlich die Bedeutungsverleihung, mitunter
zeitlich getrennt von klarer Erfassung der Bedeutungsverleihbarkeit, die
Verschiedenartigkeit der Bedeutungsverleihung, die Unterscheidung von signifikativer
und indizierender Bedeutung usw. finden sich bestätigt. Abweichend
von Achs Protokollen weisen die unseren nicht einen so reibungslosen, fast
programmgemäßen Verlauf im Entstehen der darstellenden Wortfunktion
auf, vielmehr zeigen die verschiedenen Versuchspersonen hier große
Verschiedenheiten, Es kommt nicht einmal bei allen zu dem erhofften Resultat
der Versuchsanordnung, zur vollendeten Bedeutungsverleihung. Stärker,
als es bei Achs Versuchspersonen der Fall gewesen zu sein scheint, trat
bei unseren Versuchspersonen ein oft geradezu quälendes Bedürfnis
nach mehr Sinnzusammenhängen im Material zutage, In der Analyse der
Protokolle ergab sich spontan eine stärkere Betonung der Beziehungserfassung
und ihrer Bedeutung.
Es lohnt sich, die Wiederholung der Suchmethode-
und Verständigungsmethode-Reihen Achs zu referieren.
... ... ... "
Wygotski, L.S.
(1981; russ 1934), S. 111f:
"Der Hauptmangel der Methodik von Ach besteht darin, daß wir
hier nicht den genetischen Prozeß der Begriffsbildung ergründen,
sondern lediglich das Vorhandensein oder das Fehlen dieses Prozesses konstatieren.
Bereits die Versuchsanordnung setzt voraus, daß die Mittel, mit denen
der Begriff gebildet wird, d. h,. die experimentellen Wörter, die
als Zeichen fungieren, von Anfang an gegeben sind und eine konstante Größe
darstellen, die sich während des ganzen Versuchs nicht ändert,
und daß darüber hinaus die Art ihrer Verwendung in der Instruktion
im voraus festgelegt ist. Die Wörter treten nicht von Anfang an als
Zeichen auf, sie unterscheiden sich prinzipiell in keiner Weise von einer
anderen Reihe von Reizen, die im Versuch auftreten, von den Gegenständen
nämlich, mit denen sie verbunden werden. Da Ach beweisen will, daß
die assoziative Verbindung zwischen Wörtern und Gegenständen
allein für die Entstehung einer Bedeutung unzureichend und die Bedeutung
eines Wortes oder eines Begriffs nicht gleich der assoziativen Verbindung
zwischen einem Lautkomplex und einer Reihe von Objekten ist, behält
er zum Zweck der Kritik und der Polemik den traditionellen Ablauf des gesamten
Prozesses der Begriffsbildung bei, der einem bestimmten Schema unterworfen
ist, das mit folgenden Worten gekennzeichnet werden kann: von unten nach
oben, von einzelnen konkreten Gegenständen zu wenigen sie umfassenden
Begriffen.
Aber wie Ach selbst feststellt, steht ein solcher Ablauf des Experiments
im Widerspruch zum wirklichen Verlauf der Begriffsbildung und baut sich,
wie wir sehen werden, durchaus nicht auf der Grundlage von Asso-[>112]ziationsketten
auf. Er reduziert sich nicht, um die bereits berühmt gewordenen Worte
Vogels zu gebrauchen, auf einen pyramidenartigen Aufbau der Begriffe, auf
einen Übergang vom Konkreten zum mehr und mehr Abstrakten.
Darin besteht ein Hauptergebnis der Untersuchungen
von Ach und Rimat. Sie wiesen nach, daß der Assoziations-Standpunkt
gegenüber der Begriffsbildung falsch ist, zeigten den produktiven
und schöpferischen Charakter des Begriffs und die Rolle des funktionalen
Moments bei seiner Entstehung und hoben hervor, daß nur beim Vorliegen
eines bestimmten Bedürfnisses, des Bedürfnisses nach einem Begriff,
nur im Verlauf irgendeiner bewußten zweckentsprechenden, auf die
Erreichung eines bestimmten Ziels oder die Lösung einer bestimmten
Aufgabe gerichteten Tätigkeit ein Begriff entstehen und sich herausbilden
kann. Diese Untersuchungen, die mit der mechanischen Vorstellung von der
Begriffsbildung aufräumten, gerieten aber auf den Weg rein teleologischer
Erklärungen, die im Grunde in der Behauptung gipfelten, daß
das Ziel eine entsprechende und zweckgerichtete Tätigkeit mit Hilfe
der determinierenden Tendenzen schafft, daß die Aufgabe selbst ihre
Lösung in sich schließt.
Außer der allgemeinen philosophischen und
methodologischen Unhaltbarkeit dieser Anschauung führt eine derartige
Darlegung zu unlösbaren Widersprüchen. Sie erklärt nicht,
warum bei der funktionellen Identität der Aufgaben oder Ziele die
Denkformen, mit deren Hilfe das Kind diese Aufgabe löst, sich in jeder
Altersstufe grundlegend unterscheiden.
Es ist von diesem Standpunkt aus überhaupt
unverständlich, daß sich die Formen des Denkens entwickeln.
Darum ließen die Untersuchungen von Ach und Rimat das Problem kausal-dynamisch
völlig offen, so daß die experimentelle Forschung vor der Aufgabe
stand, die Entwicklung der Begriffsbildung in ihrer kausal-dynamischen
Bedingtheit zu untersuchen."
Kritische Anmerkung: Die
These "... daß nur beim Vorliegen eines bestimmten Bedürfnisses,
des Bedürfnisses nach einem Begriff, nur im Verlauf irgendeiner bewußten
zweckentsprechenden, auf die Erreichung eines bestimmten Ziels oder die
Lösung einer bestimmten Aufgabe gerichteten Tätigkeit ein Begriff
entstehen und sich herausbilden kann. ... " halte ich für falsch.
Viele Begriffe im Kleinkindalter und später entstehen wahrscheinlich
unbeabsichtigt und im Nebenbei von Wahrnehmung, Betätigung und Situation,
wobei unterschiedliche Niveaus
von Begriffsentwicklungen zu berücksichtigen sind. Vielleicht meint
Wygotski aber auch, dass es ein Bedürfnis gibt, sich und die Welt
zu verstehen, sie zu ordnen. Die einfachste Begriffsentwicklung ist die
Unterscheidung eines Sachverhaltes (Figur) von anderen (Hintergrund).
Literatur (Auswahl) > Literaturliste Hauptseite.
- Ach, Narziss (1921). Über die Begriffsbildung. Bamberg: Buchners.
- Jagusch, Dominique (2000) Experimentelle Untersuchung der Begriffsentwicklung bei L. S. Wygotski. Linguistik Server Essen (Online).
- Willwoll, Alexander (1926) Wiederholung der Versuche von Ach. In (43-59) Willwoll, Alexander (1926) Begriffsbildung. Eine psychologische Untersuchung. Leipzig: Hirzel.
- Wygotski, L. S. (1981; russ 1934) Experimentelle Untersuchung der Begriffsentwicklung. In (104-166) Denken und Sprechen. Frankfurt aM: Fischer.
Links(Auswahl: beachte)
- Hauptseite Denken.
- Haupt- und Verteilerseite Protokolliertes Denken.
- Überblick Denken in der IP-GIPT.
- Kann die literarische Erzählform "Bewusstseinsstrom" den Bewusstseinsprozess repräsentieren?
- Das Bewusstseinsthema in der IP-GIPT.
Glossar, Anmerkungen und Endnoten: > Eigener wissenschaftlicher Standort.
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Unterschiedliche Niveaus der Begriffsentwicklung
- Jagusch, Dominique (2000) Experimentelle
Untersuchung der Begriffsentwicklung bei L. S. Wygotski. Linguistik Server
Essen (Online).
[interne Quelle: ... Ebooks/Sprachen/Begriffsanalysen/wygotski.pdf]
- "3.3 Die Stufen der Entwicklung des begrifflichen Denkens
3.3.1 Stufe 1 – die synkretische Anhäufung
Auf der ersten Stufe der Entwicklung bezieht das Kind ein Wort jeweils
auf eine Gruppe von Gegenständen, die es nach subjektiven, von Dritten
kaum nachvollziehbaren Kriterien zu-
sammengefaßt hat. WYGOTSKI hat großen
Wert auf den Hinweis gelegt, daß
sich der Spracherwerb und das Denken des Kindes von Anfang
an in Wechselwirkung mit der Sprache der Erwachsenen entwickeln. Etwa ab
dem zweiten Lebensjahr macht das Kind zielorientiert von Wörtern
Gebrauch, lange bevor es „jenen Grad der Sozialisierung seines
Denkens erreicht, der für die Herausbildung voll
entwickelter Begriffe notwendig ist.“59 Kinder benützen
„Wörter, die noch nicht die Stufe vollkommener Begriffe erreicht
haben“, als „funktionales Äquivalent“ von Begriffen, um sich mit Erwachsenen
zu verständigen.60 Eine einfache Form der Verständigung
ist bereits auf der ersten Stufe der Begriffsentwicklung möglich:
- „Die Bedeutung ein und desselben Wortes beim
Kinde und beim Erwachsenen überschneidet sich häufig
in ein und demselben konkreten Ding; und das ist für das
gegenseitige Verstehen zwischen Erwachsenen und Kindern ausreichend.“
61
Der synkretischen Anhäufung von Objekten,
die für diese Entwicklungsstufe kennzeichnend ist, entspricht eine
„diffuse, ungerichtete Ausdehnung der Wortbedeutung“.62 Die
Zusammenfassung von Wahrnehmungsphänomenen, welche das Kind vornimmt,
kann nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum oder – in einer etwas weiter
fortgeschrittenen Phase – nach den Eindrücken vorgenommen werden,
die das Kind vom räumlichen oder zeitlichen Zusammenhang der Gegenstände
gewonnen hat. Eine dritte Etappe dieser Entwicklungsstufe weist bereits
auf die zweite Stufe der Begriffsentwicklung voraus, insofern das Kind
nun jedes einzelne durch [>15] ein Wort bezeichnete Element als Repräsentanten
einer zuvor gebildeten diffusen Gruppe von Gegenständen auffaßt.
In ihrer Gesamtheit stellen die Elemente einer solchen Gruppe zwar
„eine ebenso zusammenhanglose Anhäufung dar wie die Begriffsäquivalente
der zwei vorangegangenen Etappen.“63 Die Auffassung
jedes einzelnen Elements als Stellvertreter einer Gruppe markiert jedoch
bereits die Ablösung der kindlichen Vorstellung „von der Anhäufung
als Grundform der Wortbedeutung“64 und
den Übergang zum nächsten Entwicklungsschritt, den WYGOTSKI als
„Stufe der Komplexbildung“65 bezeichnet."
- 58 Wygotski, S. 112.
59 Ebd., S. 109.
60 Wygotski, S. 109.
61 Ebd., S. 121
62 Ebd.
63 Ebd., S. 122.
64 Ebd.
65 Ebd."
Determinierende Tendenz - zielorientierter Prozess
- "Das entscheidende Ergebnis des Versuchs hat ACH mit dem Begriff der
determinierenden Tendenz belegt. ACH beobachtete, daß die Strategie
zur Lösung einer Aufgabe stets von der Vorstellung des jeweils angestrebten
Ziels ausging. Als einen derart zielorientierten Prozeß beschrieb
er auch die Herausbildung eines Begriffs. „Wenn Wörter erlernt und
mit Gegenständen verbunden werden“, faßt WYGOTSKI ACHs
Position zusammen, „so führt das noch [>13] nicht zur Begriffsbildung.
Dazu ist es nötig, daß die Versuchsperson vor einer Aufgabe
steht, die nicht anders als mit Hilfe einer Begriffsbildung zu bewältigen
ist.“55 Dieses Konzept der zielgerichteten Begriffsentwicklung
macht aus WYGOTSKIs Sicht den we-
sentlichen Fortschritt aus, den die Versuche ACHs und daran anknüpfende Untersuchungen RIMATs erbracht haben. ACH und RIMAT stellten, so WYGOTSKI, „den produktiven und schöpferischen Charakter des Begriffs und die Rolle des funktionalen Moments bei seiner Entstehung“ heraus und betonten, „daß nur beim Vorliegen [...] des Bedürfnisses nach einem Begriff, nur im Verlauf irgendeiner bewußten, zweckentsprechenden, auf die Erreichung eines bestimmten Ziels oder die Lösung einer bestimmten Aufgabe gerichteten Tätigkeit ein Begriff entstehen und sich herausbilden kann.“56 WYGOTSKI versuchte, diesen Prozeß experimentell nachzuvollziehen und dabei auch eine Erklärung für eine weitere Beobachtung ACHs zu finden. Dieser hatte festgestellt, daß Kinder unter zwölf Jahren zur Lösung der ihnen gestellten Aufgaben völlig andere Lösungswege verfolgten als Jugendliche und Erwachsene. WYGOTSKI ging davon aus, daß diese Unterschiede in den „qualitativ in jeder Altersstufe verschiedenen, aber genetisch miteinander verbundenen Anwendungsformen“57 der Wörter begründet lagen. Auf der Basis seiner experimentellen Untersuchung der Begriffsentwicklung hat er verschiedene Phasen des Wortgebrauchs beschrieben, die Stationen auf dem Weg zum begrifflichen Denken markieren"
49 Wygotski, S. 104.50
Ebd., S. 105.
51 Ebd.
52 Wygotski, S. 105.
53 S. Kegel, 1973, S. 108: „Nach Wygotski beruht die
Bildung von Begriffen auf zwei Entwicklungsvorgängen, und
zwar auf der Herausbildung bildhaft-konkreter,
synthetischer Leistungen und auf der Herausbildung
abstrakt-analytischer Leistungen bei der Aufgabenlösung.
Erst wenn sich beide Lösungen vereinen,
wird die Bildung echter Begriffe möglich.“
54 Wygotski, S. 105f.
55 Ebd., S. 108.
56 Wygotski, S. 12.
57 Ebd., S. 111."
Determination, determinierende Tendenz
Häufig vorkommender Begriff der älteren Psychologie (Blütezeit Jhd.wende 1900). Giese führt hierzu in seinem psychologischen Wörterbuch von 1920, S. 29 aus: "Determination [lt. determinare abgrenzen] Bestimmung eines Zusammenhanges und seiner Ursachen. Insbesondere: „determinierende Tendenz", (Ach): regelnder Einfluß des Wollens und Zielbew. auf den Ablauf unseres inneren Geschehens; genauer, die von einer Zielvorst. ausgehende, auf die Bezugsvorst. übergreifende Wirkung. Die d. T. kann dabei auch unbewußt statthaben"
__
Standort: Narziss Ach Über die Begriffsbildung (1921).
*
Haupt- und Verteilerseite Protokolliertes Denken.
Hauptseite Denken.
Überblick Denken in der IP-GIPT.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Inhaltsverzeichnis site: www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Narziss Ach Über die Begriffsbildung (1921). IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/allpsy/denk/DPr_Ach.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet. Zitate und Links sind natürlich erwünscht.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert: irs 03.10.2018
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
26.10.23 Was ist ein Begriff bei Ach (1921)?, Zusammenfassung-Begriff-bei Ach-1921.
07.10.18 Bisherige Untersuchungsmethoden zur Begriffsbildung nach Ach (1921), S. 16ff.
04.10.18 Wiederholung der Versuche von Ach durch Willwoll Wintersemester 1923/24.
03.10.18 Nach einigen Tagen Vorarbeit erstmals eingestellt.