(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=15.02.2004 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 16.03.24
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org__Zitierung & Copyright
Anfang_Selbstbild_| Datenschutz | Überblick_Rel. Aktuelles_ Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region__ Service-iec-verlag__ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Differentielle Psychologie der Persönlichkeit (Persönlichkeitspsychologie, Typen, Charaktere), Bereich ICH, und hier speziell zum Thema:
Selbstbild
"Der Mensch ist sich selbst das rätselhafteste Ding der Natur
... "
(Pascal: Gedanken, 35)
Das Ich, das Ich ist das tief Geheimnisvolle!
Ludwig Wittgenstein (Tagebücher 5.8.1916)
"Ein ewiges Rätsel will ich bleiben mir und anderen"
(Ludwig
II.)
Glossar, Dimensionen, Meta-Dimensionen, Lebensregel, Psychotherapiedidaktischer Auseinandersetzungs-Text zur Anregung, Besondere Bilder: Zur Theorie und Praxis der Wahrnehmungsebenen, Literatur (Auswahl).

von Rudolf Sponsel, Erlangen
Inhalts-Übersicht
- Editorial.
- Glossar wichtiger verwandter oder dazugehöriger Begriffe (Kurzkennzeichnungen):
- Abwehrmechanismen * Ambivalenz * Blinder Fleck * Charakter * Entwicklungspsychologie des Identitäts- und Selbstkonzeptes * Egomanisch * Egozentrik * Eigenes und Fremdes * ES * Fremdbild * Fremdwunschbild * Glauben im psychologischen Sinne * Ich * Ich-Auflösung * Ichmensch * Ideal-Ich * Ich-Identität * Ich-Verlust * Identität * Identitäts-Verlust * Innerer Schweinehund * Johari-Fenster * Kognitive Dissonanz * Maniform, hypo- manisch * Norm-Ich * Persönlichkeit, Persönlichkeitstheorie * Persönlichkeitsstörungen * Perspektive * Projektion * Real-Ich * Rolle * Selbst * Selbstachtsamkeit * Selbstaktualisierung * Selbstakzeptanz * Selbstaufmerksamkeit * Selbstbehauptung * Selbstbeherrschung * Selbstbeurteilung * Selbstbewertung * Selbstbewußtsein * Selbstbezogenheit * Selbstbild * Selbstbild, projiziertes * Selbstdurchsetzung * Selbstentfremdung * Selbstentwicklung * Selbstexploration * Selbstfremdwunschbild * Selbstkongruenz * Selbstkontrolle * Selbstkonzept * Selbstkritik * Selbstorganisation * Selbstreflexion * Selbstreflexivität * Selbstsicherheit * Selbstüberzeugung * Selbstvergessenheit * Selbstvertrauen * Selbstverwirklichung * Selbstvorwürfe * Selbstwahrnehmung * Selbstwerdung (Fritz Riemann) * Selbstwert, Selbstwertgefühl * Selbstwunschbild * Selbstzentrierung * Selbstzufriedenheit * Selbst-Zweifel * Super-Ich * Über-Ich * Vital-Ich * Wahrnehmungsebenen *
- Einführung und Begriffsverständnis.
- Dimensionen (Aspekte, Kriterien) des Selbstbildes.
- Dimension Identität.
- Dimension Körper und äußere Erscheinung.
- Dimension Herkunft, Familie und Sozialisation.
- Dimension Anlage und Begabungen.
- Dimension Fähigkeiten und Fertigkeiten.
- Dimension Bildung, Ausbildung, Arbeit und Beruf.
- Dimension Vitalität und Vitalbedürfnisse.
- Dimension Wünsche, Interessen, Ziele, Träume.
- Dimension Charakter und Werte.
- Dimension Lebens- und Wohnformen.
- Dimension Erfahrungen.
- Dimension Haben, Geld und Besitz.
- Dimension Sozialbeziehungen.
- Dimension Entspannung, Erholung, Freizeit, Spiel, Sport, Muse, Muße, Vergnügen.
- Quellen und Gründe für richtige und falsche Selbsterkenntnis.
- Exkurs: Kann man sein ICH, seine Identität verlieren ?
- Exkurs: ICH als Ergebnis einer Selbstorganisation neuronaler Funktionseinheiten ohne Zentrale (Singer Widersprüche).
- Bedeutungen von ICH.
- Meta-Dimensionen.
- Lebensregel.
- Psychotherapiedidaktischer Auseinandersetzungs-Text zur Anregung.
- Der Lebensbaum und seine Wurzeln (Hilfe zur Arbeit an sich selbst).
- Besondere Bilder: Zur Theorie und Praxis der Wahrnehmungsebenen.
- Literatur.
- Querverweise.
Editorial
Die Begriff Selbst und ICH sind mit allen ihren Varianten sehr vieldeutig und damit unklar. Beim Selbst wird oft auch ein sog. wahres Selbst thematisiert, wonach es offenbar ein Schein-oder falsches Selbst und ein richtiges, das wahre Selbst, gibt. Begründet, genauer erklärt oder gar definiert werden die Unterscheidungen meist nicht (> Zum Geleit).
Glossar wichtiger verwandte oder dazugehörige Begriffe (Kurzkennzeichnungen)
- Abwehrmechanismen: Funktionen, Unlustvolles auszublenden oder zu verfälschen zum Zwecke das innere Gleichgewicht (Homöostase) zu erhalten oder zu mehren. In der Kriminologie werden die Abwehrmechanismen auch Neutralisationsmechanismen (Sponsel 1976 nach Sykes & Matza) genannt. In der kognitiven Sozialpsychologie spricht man von Funktionen zur Minderung kognitiver Dissonanz (Festinger).
- Ambivalenz [1,2]: Doppelwertigkeit, gefühlsmäßig hin- und hergerissen, zwiespältig > Selbstkongruenzstörung.
- Authentisch, Authentizität > echt, Echtheit.
- Blinder Fleck: die Seiten, die man bei sich selbst nicht wahrnimmt > Abwehr,Johari-Fenster.
- Charakter: Ethisch-moralische Werte und Tugenden, die jemand lebt > Norm-Ich.
- Echt, Echtheit := innen ist außen; man gibt sich so wie man ist: Ausdrücken und Verhalten entspricht dem Inneren, seinem Meinen und Denken, Fühlen und Empfinden, Begehren und Wollen. Tiefer und weitergehend kann auch die "wirkliche" Substanz, das "Eigentliche", das in einem ist und eine Rolle spielt, gemeint sein (Schalen und Kern, wie es von Ibsen im Peer Gynt ["Zwiebelgedicht"] entwickelt wurde).
- Egomanisch. Gesteigerte Ich-Sucht (Egozentrik).
- Egozentrik. Ich bezogen, von der eigenen Perspektive und Positon gefangen sein.
- Eigenes gegenüber Fremdem. Ein großes und ungeklärtes Thema persönlicher Identität in der Entwicklungs-, differentiellen und Persönlichkeitspsychologie ist das Eigene und Fremde. Wann wird Fremdes zu eigenem? Jeder Mensch wird durch seine Erziehung und Umgebung (Sozialisation) geformt, geprägt, beeinflusst. Wann wird dieses von Außen, durch die Bezugspersonen und die Umgebung Kommende, zu Eigenem? Das Thema spielt eine wichtige Rolle bei Stirner, (Einführung).
- Entwicklungspsychologie des Identitäts- und Selbstkonzeptes: Kinder beginnen im Alter von 15-18 Monaten, sich im Spiegel selbst zu erkennen (Gallup 1968). Zwischen dem 4 und 6. Lebensjahr werden Kinder zur Perspektivenübernahme fähig (Asendorpf, S. 239). Um das 8. Lebensjahr können Kinder drei Perspektiven auseinanderhalten: eigene, andere und die eines anderen über einen dritten (Asendorpf, S. 239). Wie man sieht, werden die der Literatur (wie so oft in den Nicht-Naturwissenschaften) Identitäts-, Selbsterleben und äußeres Selbsterkennen (das bin ich) nicht klar auseinandergehalten.
- ES: Ausdrück in der Psychoanalyse für das hier sog. Vital-Ich.
- Fremdbild: wie andere mich sehen.
- Fremdwunschbild: so hätte ich Dich gern.
- Glauben im psychologischen Sinne: für wahr halten all dessen, was man nicht wissen kann, wichtig für alles, was die Zukunft betrifft oder mehr oder mindere unsichere Sachverhalte.
- Ich: vieldeutiges Homonym [1, 2, 3, 4,5] für alle möglichen Ich- und Selbstabstraktionen
- Ideal-Ich: So wäre ich gern, danach strebe ich, das hätte ich gern. Verstöße gegen das Ideal-Ich werden z.B. durch Selbstentwertungen, geringes Selbstwertgefühl und mangelndes Selbstvertrauen deutlich. In dieser Kennzeichnung spielen also nicht nur die "großen Ideale" eine Rolle, sondern auch die "kleinen Wünsche".
- Norm-Ich: dies sollte, muß ich, darf ich [nicht] tun, System der Gebote und Verbote. Verstöße gegen das Norm-Ich werden durch Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, Gewissensbisse, Selbstzweifel und Selbstvorwürfe deutlich.
- Vital-Ich: Reich der Triebe, notwendiger Grundbedürfnisse, des Antriebs und der Energie, Temperament
- Real-Ich: Wahrnehmung der eigenen und äußeren Realität, der Fähig- und Möglichkeiten.
- Super-Ich: Das Ich, das die anderen abstimmt, ausgleicht und letztlich entscheidet, was geschieht > Lenken.
- Ich-Auflösung: in schweren psychologischen Krisen und Psychosen kann das Gefühl der Ich-Auflösung auftreten, das sehr angstvoll, bedrohlich und vernichtend erlebt werden kann.
- Ich-Identität: > Identität.
- Ichmensch. Volkstümlich für Egoisten. [FN03]
- Ich-Verlust: das Gefühl, etwas von seinem Ich zu verlieren, die Kontrolle schwinden zu sehen oder verunsichernde Veränderungen zu bemerken; kann ein wichtiges psychopathologisches Zeichen sein, das auf Entwicklung einer Psychose hindeuten oder Zeichen einer solchen sein kann. Unterscheidung: Identitätsverlust heißt: ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ichverlust heißt: ich verliere etwas von mir bei Erhaltung der Identität. > Exkurs (Doku Phönix).
- Identität: Im Kern: Konstantes Erleben des Ich als ein und desselben Menschen über die Zeit hinweg. Erweitert ist nach Watts, S. 23, zu bedenken: "Wir lernen, uns — sehr gründlich, wenn auch weniger deutlich — mit dem Bilde zu identifizieren, das wir selbst von unserer Person haben. Denn das allgemeine «Selbst» oder die «Person» besteht hauptsächlich in der Geschichte verschiedener Erinnerungsmomente, die mit dem Augenblick der Geburt beginnt. Nach dieser meiner Übereinkunft mit mir selbst bin ich nicht nur das, was ich jeweils zufällig tue. Ich bin auch das, was ich getan habe, und meine in allgemeinen Begriffen abgefaßte Darstellung der eigenen Vergangenheit ist weit eher dazu angetan, mein eigentliches «Ich» auszumachen als das, was ich in diesem Augenblick gerade bin. Denn was ich bin, scheint so flüchtig und wenig faßbar, was ich war, steht jedoch fest und ist endgültig. Es bildet die sichere Grundlage aller Voraussagen darüber, was ich in Zukunft sein werde, und so kommt es derm, daß ich eher mit etwas identifiziert werde, was gar nicht mehr vorhanden ist, als mit dem, was augenblicklich existiert.
- Dimension Identität.
- Eigenes und Fremdes.
- Psychotherapiedidaktischer Text zur Selbst- und Fremdbestimmung.
- Identitätsbegriffe der Geistesgeschichte:
- Alltäglicher Begriff der Identität.
- Staatlicher und juristischer Begriff der Identität.
- Psychologischer Begriff der Identität.
- Eigenes und Fremdes.
- Ontologischer Begriff der Identität.
- Philosophischer Begriff der Identität.
- Logischer Begriff der Identität.
- Mathematischer Begriff der Identität.
- Ein Lösungsvorschlag des Identitätsproblems.
- Identitäts-Verlust: Hier weiß ein Mensch nicht mehr, wer er war und ist. Das kann z.B. durch eine multiple Persönlichkeitsstörung (selten), organische Störung (Amnesie) oder Psychose hervorgerufen werden und kann wieder verschwinden.
- Innerer Schweinehund: Wünsche, Motive, Bedürfnisse, die man sich verbietet, meist aggressiver, krimineller, egozentrischer, sexueller Natur (all das in uns, was Gott und seine Agenten sozusagen verboten haben). > Abwehr, > Therapie bei abgespaltenem inneren Schweinehund.
- Johari-Fenster: ein graphisches Schema zur Darstellung bewußter und unbewußter Wahrnehmungen zwischen Selbst und Gruppe (Luft & Ingham, 1961).
- Kognitive Dissonanz: Ausdruck von Festinger, der auf einen Mangel oder fehlende Selbstkongruenz hinweist mit z.B. den Folgen: Unangenehmes Befinden, negative Gefühle, unwohl fühlen, Selbst-Zweifel, negative Spannung, Unruhe.
- Maniform, hypo-, manisch. > maßlos, grenzenlos, enthemmt oft mit Hochgefühl; Verlust der Selbst- und Realitätskritik.
- Neutralisation, Neutralisationsmechnismen: > Abwehrmechanismen.
- Persönlichkeit, Persönlichkeitstheorie: Modell all der Teile und ihres Zusammenwirkens, die wir Persönlichkeit nennen, in der Hauptsache Theorie der > Iche, ganz besonders des Super-Ichs. > Modell der Psyche.
- Persönlichkeitsstörungen: Unklarer und umstrittener Begriff. Damit eine Störung eine Persönlichkeitsströung ist, muß sie sich nach ICD und DSM wie ein roter Faden durch das Leben eines Erwachsenen ziehen und gewisse störende Auswirkungen mit sich bringen. [1, 2, 3]
- Perspektive: einen bestimmten Ort zur Betrachtung einnehmen, die Ort kann in mir - mein Norm-Ich betrachtet betrachtet mein Verhalten - oder außer mir sein, wenn ich etwas mit den Augen eines anderen Menschen betrachte, also dessen Perspektive einnehme, z.B. kann ich mich aus der Perspektive meiner PartnerIn sehen.
- Projektion: etwas aus sich in jmd. anderen verlagern und dort wahrnehmen statt bei sich selbst. Die Psychoanalyse konstruiert dies per definitionem als unbewußten Vorgang. Dazu gehörig, Abwehr, Blinder Fleck, Vorurteil, Beurteilungsfehler.
- Rolle: Erwartungs- und Verhaltensschema für besondere, rollengebundene Verhaltensweisen und Erwartungen, z.B. ÄrztInnen-Rolle, LehrerInnen-Rolle, TherapeutInnen-Rolle, SchülerInnen-Rolle.
- Selbst: das Insgesamt der eigenen Person > Dimensionen ....
- Selbstachtsamkeit: auf sich selbst (bewußt) achten, gut mit sich umgehen. Gegensatz: nachlässig, ruppig, unachtsam, rigoros mit sich umspringen.
- Selbstaktualisierung: Menschen streben danach, wonach sie streben, ein letztlich tautologischer oder unklarer Begriff aus dem Umfeld der klientenzentrierten Persönlichkeitslehre von Rogers. [FN02]
- Selbstaufmerksamkeit: sich mit sich selbst, mit seinem Inneren, Leben und Wirken beschäftigen. Übertrieben kann die Selbstaufmerksamkeit zur dysfunktionalen (Hoyer) werden, was sich in unfruchtbarem Grübeln und hypochondrischen Befürchtungen äußern kann.
- Selbstakzeptanz: das, was man an sich selbst gut findet, bejaht, akzeptiert (> Die 5 Grundhaltungen)
- Selbstbehauptung: ich behaupte mich, grenze mich mich ab, sage, was ich will und nicht will, sage Nein, ...
- Selbstbeherrschung: wie sich jemand "zusammennehmen", selber kontrollieren und schauspielern kann
- Selbstbeurteilung: über sich selbst Aussagen machen. Das kann zwar jede, die Frage ist aber, ob und inwiefern diese Aussagen richtig oder bedeutungsvoll sind. Für alle Informationen stellt sich grundsätzlich immer die Frage nach ihrer Güte, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Stabilität und Gültigkeit bezüglich dieser oder jener Rahmenbedingungen. Siehe auch.
- Selbstbewertung: ich bewerte mich im Ganzen oder in Teilen > Selbstwertgefühl.
- Selbstbewußtsein: volkstümlich: ein Mensch, der von seinem Selbstwert überzeugt ist; psychologisch: ein Mensch, der um sich und seine Ausstattung weiß und sich kennt, sich seiner bewußt (im Prinzip zunächst ohne Wertung).
- Selbstbezogenheit: wenn jmd. zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist oder alles nur von seiner Warte aus sieht, beurteilt und bewertet, zu wenig andere Perspektiven einnimmt oder zu wenig Einfühlung und Empathie zeigt.
- Selbstbild: das bin ich, war ich, möchte ich sein und werden
- Selbstbild, projiziertes: Du denkst, ich bin
- Selbstdurchsetzung: ich setze meine Wünsche und Interessen durch
- Selbstentfremdung: Als ob man neben sich stünde, man versteht sich nicht, kommt sich fremd vor, Verlust der Vertrautheit mit sich selbst. In milder Ausprägung eine vielen Menschen bekannte Erscheinung. Bei stärkerer Ausprägung auch ein psychopathologisches Zeichen (Depersonalisation), das sehr bedrohlich erlebt werden kann [Fischer, Meyer]. Selbstentfremdung ist möglich durch die Tatsache der Selbstreflexivität, die wenigstens zwei ICHe voraussetzt.
- Selbstentwicklung: 1) entwicklungspsychologische Betrachtung, wie sich das Selbst über die Kindheit, Jugend- und Erwachsenenzeit entwickelt, aufbaut, verändert (Kegan). 2) Im Sinne von Selbstverwirklichung das eigene Potential entwickeln; auch Selbstwerdung (Fritz Riemann).
- Selbstexploration: sich selbst, sein eigenes Inneres erkunden, erforschen. Ein sehr wichtiger Begriff und Sachverhalt, der von den traditionellen Psychotherapieschulen nicht richtig verstanden und angemessen entwickelt wurde. Ein Schwerpunkt allgemeiner und integrativer Psychotherapieforschung (Beispiele in Sponsel 1995 für Focusing, Einfühlung und Durcharbeiten; auch Beispiel Nur-empfinden).
- Selbstfremdwunschbild: so würde ich gern von dir gesehen werden, so wünsche ich mir, daß du mich siehst.
- Selbstkongruenz: mit sich selbst im reinen und im Einklang. Abweichungen und Störungen bewirken eine sog. kognitive Dissonanz (Festinger).
- Selbstkontrolle: Volkstümlich gleichbedeutend mit Selbstbeherrschung. Psychologisch, besonders in der Verhaltenstherapie eine systematische Methode der Verhaltensänderung durch Kontrolle der Ziele, Pläne und des Verhaltens.
- Selbstkonzept: > wie jemand sein Selbstbild konstruiert (meist nicht bewußt und muß in der psychologisch- psychotherapeutischen Arbeit erst herausgefunden werden, auch um verändernd eingreifen zu können)
- Selbstkritik: die Fähigkeit, eigene Fehler, Mängel und Schwächen zu sehen, was eine Stärke ist, weil dadurch Selbstkontrolle möglich ist.
- Selbstorganisation: Mehrdeutig: 1) alltagssprachlich-psychopathologisch: die Selbstkontrolle und Selbstlenkung betreffend, sehr beeinträchtigt bei Psychosen, aber auch bei stärkerem AD-H-D ("desorganisiert"). 2) Neurowissenschaftlich: System (Mensch) ohne zentrale Einrichtung ("Ich"), die die Systemkomponenten lenkt. 3) Systemisch und konstruktivistisch: Entstehen neuer Strukturen in dynamischen Systemen, wozu Menschen gerechnet werden können. (> Lit)
- Selbstreflexion: sich selbst zum Gegenstand der Betrachtung machen; innehalten und die Aufmerksamkeit auf sich selbst richten. Eine Analogie gibt es in der Psychotherapie: hier entspricht es der kleinen Supervision der TherapeutIn in der Sitzung: innehalten und die Situation reflektieren.
- Selbstreflexivität: sich selbst zum Gegenstand der Betrachtung machen können. Ein Fundamentalproblem wie die Identität: wie ist es möglich, sich selbst zu betrachten? Denn wer betrachtet wen? Obwohl es fast jeder kann und tut, ist es schwer zu erklären und bis heute noch niemandem so richtig gelungen.
- Selbstsicherheit: Grad der gefühlsmäßigen Sicherheit mit dem man sich vertritt und sich verhält.
- Selbstüberzeugung: ich bin von mir überzeugt.
- Selbstvergessenheit: sehr treffliche Bezeichnung für einen - tranceartigen - Zustand völliger Hingabe ("Flow"). > Satipatthana-Medidation.
- Selbstvertrauen: Volkstümlich: ein Mensch, der sich etwas zutraut. Psychologisch im engeren Sinne: das Vertrauen, das man sich selbst gegenüber in diesen oder jenen Aspekten hat, was man sich glaubt.
- Selbstverwirklichung: wie einer lebt. Es hat eine hohe Selbstverwirklichung, wer so leben kann, wie er es möchte. Nach Maslow (Motivations und Persönlichkleit, dt. 1976, S.89) von Goldstein 1939 in Organism geprägter Begriff.
- Selbstvorwürfe: mit sich nicht einverstanden: ich sehe mich nicht so, wie ich gern wäre oder sein sollte > Ideal-Ich, > Norm-Ich, > Selbstkongruenz.
- Selbstwahrnehmung: so nehme ich mich wahr, sehe ich ich mich > Selbstbewußtsein im psycholog. Sinne
- Selbstwerdung (Fritz Riemann): Problem des sog. depressiven Menschen, er selbst zu werden
- Selbstwert, Selbstwertgefühl: so bewerte ich ich mich (so und so gut, schlecht, unterschiedlich)
- Selbstwunschbild: so wäre ich gern.
- Selbstzentrierung: einen Teil des Inneren in den Mittelpunkt der (Selbst-) Aufmerksamkeit rücken (fokussieren). Im esoterisch- metaphysischen Umfeld gelegentlich auch so etwas wie die eigene Mitte, innere Ausgeglichenheit finden.
- Selbstzufriedenheit: mit sich selbst zufrieden sein, im Einklang mit sich, ausgeglichen im Hinblick auf das eigene Selbst.
- Selbst-Zweifel: an sich selbst zweifeln, sich in Frage stellen, unsicher sein.
- Über-Ich: Psychoanalytische Bezeichnung für das hier sog. Norm-Ich.
- Wahres Selbst Wichtiger Begriff in der humanistischen Psychologie, Psychotherapie und non-direktiven Gesprächspsychotherapie.
- Wahrnehmungsebenen: Wer betrachtet wen über welches Medium aus welcher Perspektive? Z.B. ich betrachte mich; ich betrachte mich in den Augen meines Vaters; ich betrachte mich wie ich gerne wäre; wie ich meine, daß mich andere gerne hätten... (Lit: Laing et al., Sponsel 1982). Durch Vertiefung in die vielen und komplizierten Wahrnehmungsebenen kann man ganz schön durcheinander kommen (also bitte achtsam sein), was der Schlager ... wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst ... ganz gut beschreibt ;-)
> Ich-Konzepte in der Psychologie, in Geistegeschichte und Sozialwissenschaften.
> Allgemeine und Integrative ICH-Theorie.
Anmerkung: In der Psychoanalyse wird "Ich" überwiegend für das hier sog. Real-Ich verwendet. Das Strukturkonzept aus ICH, ES und ÜBER-ICH ist veraltet und nicht sinnvoll, weil Ideal- und Norm-Ich miteinander vermanscht werden und das wichtigste überhaupt, das Super-Ich ganz fehlt. Kürzel: II =: Ideal-Ich, , NI=: Norm-Ich, VI=: Vital-Ich, RI=: Real-Ich, SI=Super-Ich ("ChefIn").
Es ist wichtig zu erkennen, daß die Erinnerungen und vergangenen Ereignisse, die die historische Identität eines Menschen ausmachen, lediglich eine Auswahl bilden. Aus der tatsächlichen Unmenge von Ereignissen und Erfahrungen wurden einige als bedeutungsvoll herausgegriffen — abstrahiert; und selbstverständlich wurde ihre Bedeutsamkeit von konventionellen Maßstäben bestimmt. Das eigentliche Wesen konventionellen Wissens liegt also darin, daß es ein System von Abstraktionen darstellt."
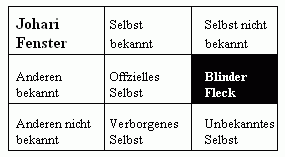
Festinger (dt. 1978, S. 253): " Der dieser Theorie zugrundeliegende Gedanke ist der, daß der menschliche Organismus bestrebt ist, eine Harmonie, Konsistenz oder Kongruenz zwischen seinen Meinungen, Attitüden, Kenntnissen und Wertvorstellungen herzustellen." Festingers Theorie ist unvollständig, weil einseitig auf Kognitionen beschränkt und muß auf alle Möglichkeiten der Dissonanz, insbesondere des wichtigeren affektiven Bereiches ausgedehnt werden, aber nicht so phantastisch und literarisch, wie das die Psychoanalyse betreibt.
Anmerkung: Lempp (1992) hat auf die Störung der Perspektivenübernahme, den Verlust der Fähigkeit, sich selbst zu betrachten und die Probleme des Um- bzw. Überstiegs verschiedener Realitäten eine Theorie der schizophrenen und autistischen Störung aufgebaut. Hierzu Reader in Sponsel (1995, 558-560)
Einführung
und Begriffsverständnis
Selbstbild heißt das Bild, das jemand von sich selbst hat bzw.
macht. Gegensatz: Fremdbild: die Bilder, die andere von einem haben. Der
Begriff ist in seiner Grundbedeutung klar. Die genaue Bedeutung hingegen
schwankt von AnwenderIn zu AnwenderIn, von PsychologIn zu PsychologIn.
Diese vieldeutige Unklarheit ist eine direkte Folge der noch nicht angemessen
entwickelten begrifflich- operationalen Normierung
in der Psychologie.
Zu einem Selbstbild können im Prinzip alle Aspekte ("Dimensionen") gehören, die jemand von sich selbst haben kann. Und genau das spiegelt das praktische Bedeutungs- und Definitionsproblem wider. Im konkreten Fall meint man ganz bestimmte, meist nicht näher ausgeführte Kriterien (Aspekte).
Im folgenden seien daher zunächst einige Dimensionen des "Selbstbildes" aufgezählt:
Dimensionen
(Aspekte, Kriterien) des Selbstbildes
Querverweis: Der
Lebensbaum und seine Wurzeln (Hilfe zur Arbeit an sich selbst).
- Dimension Identität
Das bin ich: Name, Alter, Geschlecht, Lebensort. Die Identitätsfunktion ist eine psychopathologisch sehr wichtige Funktion, die gestört sein kann (z.B. bei multiplen Persönlichkeiten oder in Psychosen). Im Grunde ist die Identitätsfunktion ein Rätsel. Denn: obwohl wir alle uns ständig ändern, neue Erfahrungen machen, älter werden, vergessen, dazu lernen, bleibt die Identität bei Gesunden erhalten: stets fühle ich mich als der ein und derselbe identische Mensch. Die Identität ist für Gesunde so etwas wie eine psychologische Konstante über das ganze Leben hinweg. Das trifft für das Selbstbild ansonsten nicht zu: dieses unterliegt einem Wandel und ist veränderungsfähig.
Dimension Körper
und äußere Erscheinung
Das ist mein Körper, der zu mir gehört und so sehe ich -
derzeit - aus. Ich habe die und die Gestalt, Figur, Größe, Gesicht;
Gesundheit, Krankheit, Beweglichkeit, Un/ Versehrtheit, Beweglichkeit,
Behinderung. Körper und äußere Erscheinung können
zudem eine Bewertung hinsichtlich der Attraktivität, die man sich
selbst zuordnet, erfahren. Hier gibt es also zwei ganz unterschiedliche
Beurteilungen: die Wahrnehmung einerseits und die Bewertung dieser Wahrnehmung
andererseits.
Dimension
Herkunft, Familie und Sozialisation
Ich komme da und da her, stamme von diesen und jenen ab, bin in der
und der Familie aufgewachsen und habe diese oder jene Sozialisation erfahren.
Dimension Anlage und
Begabungen
Ich habe diese oder jene (genetischen) Anlagen und Begabungen (Ressourcen)
für meine Selbstverwirklichung.
Dimension Fähigkeiten
und Fertigkeiten
Ich habe diese oder jene Fähigkeiten und Fertigkeiten (z.B. handwerklich,
geistig, praktisch, hauswirtschaftlich, technisch, sprachlich, mathematisch,
naturwissenschaftlich, kommunikativ, künstlerisch, psychologisch),
das und dieses kann ich so oder so gut.
Dimension
Bildung, Ausbildung, Arbeit und Beruf
Bildung, Ausbildung, Arbeit und Beruf gehören natürlich zum
Selbstbild dazu. Für Kleinkinder sind Kindergarten und Hort, für
SchülerInnen die Schule, für StudentInnen die Universität,
für Hausfrauen/ männer und RentnerInnen der Haushalt der Arbeitsplatz.
Anhaltende Arbeitslosigkeit kann das Selbstwertgefühl beeinträchtigen.
Dimension
Vitalität und Vitalbedürfnisse
Ich brauche für mein Leben dieses und jenes, das ist sehr wichtig
für mein Leben: Essen, trinken, Ausscheidung, Schlaf, atmen, Schutz,
Sexualität und Fortpflanzung, Abwechslung. Die Vitalbedürfnisse
sind im allgemeinen lebensnotwendig und unverzichtbar.
Dimension
Wünsche, Interessen, Ziele,
Träume
Ich würde gerne so und so leben, wäre gern diese oder jene,
würde gerne dieses oder jenes erleben und erfahren, möchte gerne
dieses oder jenes tun (beruflich, persönlich, kulturell, sozial, öffentlich:
in meiner Rolle als BürgerIn u.a.m). Wie möchte ich mein Leben
gestalten (Lebensträume), wonach strebe ich, was ist mir wichtig,
wo liegen meine Hauptinteressen?
Dimension Charakter und
Werte
Ich orientiere mich an folgenden Grundwerten, z.B. Echtheit, Ehrlichkeit,
Zuverlässigkeit (Vertragstreue), Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft,
Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität, Selbst / Verantwortung usw.
bzw. mein höchster Wert ist meine eigene Glückseligkeit, die
anderen interessieren mich nur insofern als sie ich sie dafür nutzen
kann (Egoismus).
Dimension Lebens-
und Wohnformen
Man kann verschiedene Lebensformen und Grundorientierungen u.B. nach
gesellschaftlichen Schichten und Zugehörigkeiten unterscheiden, z.N.
Typ bürgerlich, proletarisch, Bohemien, alternativ, akademisch, aristokratisch,
Single, Außenseiter/ Randgruppe; Single-, Wohngemeinschafts-, Ehe-
oder "Lebensabschnittsgefährtenschaftstyp" ... Siehe z.B. auch homo
oeconomicus.
Dimension Erfahrungen
Hierher gehört, was einer alles schon erfahren und erlebt hat
(habe ich nur in den Computer geglotzt, Videos geschaut und ferngesehen
oder auch richtig gelebt?).
Dimension Haben, Geld
und Besitz
Vermögen, Sach- und Geldwerte, Anleihen (Bonds), Sparguthaben
und Geld spielen für mehr Menschen eine wichtigere Rolle als sie sich
oftmals eingestehen. Was habe ich, wie gut bin ich gesichert (Versicherungen)
sind hier die Fragen. Empfehlenswert ist natürlich, seine Lebenszufriedenheit
nicht zu sehr auf diese Dimension aufzubauen.
Dimension Sozialbeziehungen
Zu mir gehören auch meine zwischenmenschlichen und Sozialbeziehungen,
das Milieu, in dem ich mich bewege und bewegen mag ("Sage mir, mit wem
Du umgehst, und ich sage Dir, wer Du bist"). Die Wertzuweisungen, Beurteilungen
und Erwartungen anderer an uns beeinflussen unser Selbstbild.
Dimension
Entspannung, Erholung, Freizeit, Spiel, Sport, Muse, Muße, Vergnügen
Zum Selbstverständnis und zur Eigencharakteristik eines Menschen
gehört natürlich auch, wie er den Reproduktionsbereich, Freizeit,
Erholung, Entspannung, Spiel, Sport, Muse, Muße und Vergnügen
gestaltet und lebt.
Quellen und Gründe für richtige und falsche Selbsterkenntnis
Sind Selbstbilder stabil oder schwanken sie von Augenblick zu Augenblick, von Situation zu Situation, von ...? Kann ein Mensch sich selbst "richtig" erkennen? Ja, gibt es überhaupt eine "richtige" Erkenntnis, was ein Mensch für ein Mensch ist? Ist das Bild nicht ganz davon abhängig, unter welcher Perspektive er in welchen Spiegel schaut? Wie kommt es zu solchen Persönlichkeits- oder Charaktezuweisungen "zuverlässig", "ehrgzeig", "ungeduldig", ...? Wie stimmig sind die allgemeinen Kennzeichnungen?
- Quelle objektive Probleme der Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis
- Quelle der Selbst-Erfahrung
- Quelle der Fremd-Erfahrung
- Quelle Selbstwunschbild
Exkurs: Kann man sein ICH, seine Identität verlieren ?
Ja, und die Folgen sind meistens sehr dramatisch, wie z.B. der Film "Hilfe, wer bin ich?" (Phönix 21.7.11, 23.50-) anhand dreier Fälle eindrucksvoll dokumentierte: "Dieser Film von Liz Wieskerstrauch begleitet Menschen ohne Erinnerung an die Vergangenheit, ohne Bezug zu denen, die einmal von größter Bedeutung waren, Menschen mit gebrochener Identität, aber voller Hoffnung."
"Nach Unfällen oder durch Krankheit erleiden manche Menschen einen Gedächtnisverlust, der manchmal das ganze Leben betrifft. Wie ist das, wenn man den Menschen, den man im Spiegel sieht, nicht mehr kennt – ebenso wenig wie alle anderen Menschen in seinem Umfeld?" Es werden drei Fälle vorgestellt, die ihr Gedächtnis und Identität nach Erkrankung verloren: (1) "Sabine B. lebt heute in Hamburg, der Stadt ihres zweiten Lebens. Es gab ein erstes Leben in Würzburg, mit Mann und Tochter und einem Beruf. Dann hatte sie eine Gehirnhautentzündung und erlitt einen totalen Gedächtnisverlust. Sie kannte ihren Mann nicht, ihre Tochter nicht, sich selbst nicht und konnte auch mit all den Fotos und Tagebüchern von früher nichts anfangen." (2) "Der Student Michael W. hat durch einen epileptischen Anfall vor einem Jahr komplett das Gedächtnis verloren." (3) "Martina K. hatte kurz nach der Geburt ihres Wunschkindes eine schwere, lebensgefährliche Gehirnblutung. Die Folge: Sie kann sich an die Geburt und die Zeit der Schwangerschaft nicht mehr erinnern, das Kind, das man ihr in die Arme legte, war ihr fremd."
Exkurs: ICH als Ergebnis einer Selbstorganisation neuronaler Funktionseinheiten ohne Zentrale > Lit.
Es gibt Systeme, die erwecken von außen betrachtet den Eindruck, als ob sie von einer Lenkungs-Zentrale organisiert würden, obwohl es nicht so ist. Solche Systeme kann man selbstorganisierende Systeme nennen. Einige Hirnforscher (Neuroscience) vertreten die Hypothese, dass es gar kein ICH im Sinne einer Zentrale gibt, wobei sich führende Vertreter gelegentlich selber widersprechen, wie z.B. Singer in der Scobel-Sendung "Wahn-Sinn - über Schizophrenie" am 27.10.11; fett-kursiv RS):
Singer: "Wahrscheinlich entwickelt sich in der, aber das ist jetzt sehr hypothetisch, in der späten Hirnentwicklungsphase, die Module in sich zu relativ autonomen Strukturen, weil die instrumentellen Fertigkeiten überall optimiert werden, und dann muss ein neues Organisationsprinzip installiert werden, dass die nun schon ziemlich selbständigen autonomen Strukturen wieder auf einen gemeinsamen Nenner einschwören kann, das braucht eine neue Architektur."
Dieses neue Organisationsprinzp, das autonomen Strukturen auf einen gemeinsamen Nenner einschwören kann, erfüllt nun genau das, was man gemeinhin mit ICH oder SELBST meint. Aber so etwas dürfte es nach Singer, wie er kurze Zeit vorher ausführt, ja gar nicht geben:
"Ein großes Problem bei der Organisation des Gehirns, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum diese Erkrankung möglich ist, diese sehr geheimnisvolle, ist ja, dass es im Gehirn keinen zentralen Organisator gibt, keinen Dirigenten, keinen Orchesterchef, sondern dass es sich um ein sehr verteilt organisiertes System handelt, in dem sehr viele verschiedene Areale sich mit unterschiedlichen Teilaspekten, die aber, um kohärentes Verhalten zu erzeugen, und natürlich auch, um dem Besitzer dieses Gehirns, die Empfindung zu vermitteln, ein intentionaler Agent zu sein, also jemand, der selbst bestimmt und über seine Zukunft entscheiden kann, muss dieses System präzise organisiert werden, so dass es kohärent als Ganzes arbeiten kann." [Im Media Player ungefähr bei 45 min].
Querverweis: Lenken, Ordnung, Selbstorganisation und Selbstlenkung.
Bedeutungen von ICH > ICH-Konzepte
in der Psychologie.
Das Wörtchen "ich" hat - wie die meisten Worte - mehrere Bedeutungen,
es ist also ein Homonym [1,
2,
3,
4,5].
Das Bedeutungswörterbuch (Duden 1970) führt aus: "ich (Personalpronomen)
bezeichnet die eigene Person: ich lese; ich Dummkopf! ich, das; -[s]: die
eigene Person: das liebe I.; sein zweites, anderes I. (diejenige Seite
seines Wesens, die im allgemeinen verborgen bleibt); schließlich
siegte sein besseres I. (siegten die besseren seiner Eigenschaften, Regungen
über die schlechteren)."
Personen-Kennzeichnung
"Ich" bedeutet in Kommunikationssituationen die Benennung des Sprechers:
- Ich meine ... (nicht)
- ich denke ... (nicht)
- ich fühle ... (nicht)
- ich finde ... (nicht)
- ich möchte ... (nicht)
- ich habe ... (nicht)
- ich war ... (nicht)
- ich bin ... (nicht)
- ich mag ... (nicht)
- ich kann ... (nicht)
- ich erinnere ... (nicht)
- Ich nehme wahr ... (nicht)
- Ich meine ... (nicht)
- ich denke ... (nicht)
- ich fühle ... (nicht)
- ich finde ... (nicht)
- ich möchte ... (nicht)
- ich habe ... (nicht)
- ich war ... (nicht)
- ich bin ... (nicht)
- ich mag ... (nicht)
- ich kann ... (nicht)
- ich erinnere ... (nicht)
- Ich nehme wahr ... (nicht)
Organisations-Struktur Kennzeichnung
"ICH" wird auch verwendet, wenn man die Selbstorganisation seines Erlebens
und Verhaltens meint. Hier wird dem "ICH" die Eigenschaft einer Systemslenkung,
einer Steuerungszentrale zugesprochen.
Persoenlichkeits-ICH
"ICH" als Kennzeichnung für die Persönlichkeit (Wesen, Charakter).
Biographisches-ICH
"ICH" als Kennzeichnung für meine Biographie: die Spuren, die
das Leben in mir hinterlassen hat, die mich zu dem gemacht haben, der ICH
bin, wobei "bin" nicht starr und statisch verstanden werden muss. Das bin
ich, da komme ich her, so war ich, so bin ich geworden, so möchte
ich noch werden.
ICH-Funktionen
All das, was eine Person im Erleben und Verhalten kann.
ICH-Instanzen > ICH-Konzepte
in der Psychologie.
Konstruierte Teilsysteme von Personen.
Klärungs- und Erklärungsbedarf wahres Selbst
Hier spielen die Themen das Eigene und das Fremde, Schein und Sein eine wichtige Rolle.
Allgemeine Bedeutung: authentisch, echt, unverstellt, wirklich, wahr, wahrhaftig. Gegenbegriffe: Aufgepropft, angenommen, Rolle, Oberfläche, Theater (Wir alle spielen Theater, Buch von Goffman 1969), Eindruck schinden, etwas vormachen, Fassade, Verkleidung, Täuschung, Lüge. (> Querverweis: Hochstapler)
Der Selbst insbesondere das wahre Selbst spielt eine große Rolle bei Rogers und auch bei Axline. Rogers zitiert in Entwicklung der Persönlichkeit S. 167 einen Ausspruch von Kiergegaard (1924 [Die Krankheit zum Tode, orig. 1848], S.17) "Das Selbst zu sein, das man in Wahrheit ist". Das ist ein interessanter wie schwieriger Ausspruch, in meiner Kierkegaardausgabe (Rowohlts Klassiker) in Bd. 4, Die Krankheit zum Tode, S. 20. Eine Idee bei Rogers und Axline könnte sein, wer sich selbst lebt, so wie er ist, ist gesund brütet keine Symptome aus. Das Selbst kann sich frei verwirklichen. Mir scheint, da gibt es eine Menge Klärungs- und Erklärungsbedarf.
Es ist unumstritten, dass wir Menschen unser echtes, tatsächliches Befinden, Wollen, Meinen oder Verhaltenmögen nicht zum Ausdruck bringen, teils individuell, teils auch gesellschaftlich so gewollt. So gesehen besteht das wahre Selbst oder ICH schlicht einfach in unserem tatsächlichen Befinden, Wollen, Meinen oder Verhaltenmögen, das man allerdings auch so oder so, mehr oder minder angepasst und sozialverträglich zum Ausdruck bringen kann.
Und es ist auch unumstritten, dass unsere Mitmenschen uns oft nicht so nehmen wollen, wie wir sind, sondern uns mit bestimmten Erwartungen, Forderungen oder sogar Maßnahmen beinflussen und gängeln.
Der stärkste Einfluss erfolgt in der Kindheit, wo uns unsere Bezugspersonen formen und prägen, was man Erziehung nennt. Das gibt es im Kern die zwei Welten, die eigene, wie wir sind, die andere, wie uns die Eltern und Erziehungspersonen haben wollen.
Materialien wahres Selbst (> Zum Geleit):
Rogers "Kapitel 8 "Das Selbst zu sein, das man in Wahrheit ist." Ansichten eines Therapeuten über persönliche Ziele." In (164-182) Rogers, Carl R. (dt.1976, engl. 1961) Entwicklung der Persönlichkeit. Stuttgart: Klett
Axline, Virginia Mae (dt. 1982) Dibs. München:
Knaur.
Aus der Einleitung S. 7: "Dies ist die Geschichte eines Kindes, das
durch die Psychotherapie zu sich selbst
fand. ... Dabei wurde es sich allmählich seiner
selbst bewußt und machte die überwältigende
Entdeckung, daß es einen Schatz an innerer Kraft und Weisheit besaß,
auf die es sich stützen konnte.
... Er strebte nach einem inneren Halt, er gab sich seinen Hoffnungen
hin und verlor sich an seinen Kummer. Langsam, sehr zaghaft entdeckte er,
daß die Sicherheit seiner Welt sich nicht außerhalb seines
Ichs befand, sondern daß der ruhende Pol, nach dem er so sehr suchte,
tief
in ihm selbst lag.
Dibs spricht eine Sprache, die uns in ihrer echten seelischen Not erschüttert.
Weil er sich danach sehnt, ein Selbst
zu finden, zu dem er sich bekennen kann, geht seine Geschichte uns alle
an. ... .
S.16f: "Als ich den East River Drive hinunterfuhr,
mußte ich an viele Kinder denken, die ich kennengelernt hatte. Es
waren unglückliche Kinder. Jedes war in der Bemühung, eine eigene
Persönlichkeit zu [>17] erlangen, auf die es stolz sein konnte; enttäuscht
worden. Sie hatten kein Verständnis gefunden und doch immer wieder
versucht, um ihrer selbst willen anerkannt
zu werden.
Kierkegaard, Sören (1848)
Die Krankheit zum Tode. Rowohlts Klassiker, S. 20 "Das Selbst zu sein,
das man in Wahrheit ist."
"Über sich verzweifeln, verzweifelt sich selbst
loswerden wollen ist die Formel für alle Verzweiflung, so daß
deshalb die zweite Form der Verzweiflung, verzweifelt man selbst sein wollen,
auf die erste zurückgeführt werden kann, verzweifelt nicht man
selbst sein wollen, ebenso wie wir in dem Vorhergehenden die Form, verzweifelt
nicht man selbst sein wollen, auflösten in die, verzweifelt man selbst
sein wollen (vgl. 'A). Ein Verzweifelnder will verzweifelt er selbst
sein. Aber wenn er verzweifelt er selbst sein will, dann will er sich ja
nicht los sein. Ja, so scheint es; aber wenn man näher hinsieht, erkennt
man doch, daß der Widerspruch der gleiche ist. Das Selbst, das er
verzweifelt sein will, ist ein Selbst, das er nicht ist (denn
das Selbst sein wollen, das er in Wahrheit ist, ist ja gerade
das Entgegengesetzte der Verzweiflung), er will nämlich sein Selbst
von der Macht losreißen, die es setzte. Aber dies vermag er trotz
allen Verzweifelns nicht; trotz aller Anstrengung der Verzweiflung ist
jene Macht die stärkere und zwingt ihn, das Selbst zu sein, das er
nicht sein will. Aber so will er ja sich selbst loswerden, das Selbst,
das er ist, loswerden, um das Selbst zu sein, wonach er selber getrachtet
hat. Ein Selbst zu sein, wie er das will, würde, wenn auch in einem
anderen Sinne ebenso verzweifelt, seine höchste Lust sein; aber gezwungen
zu werden, Selbst zu sein, wie er es nicht sein will, das ist seine Qual,
die ist, daß er sich selber nicht loswerden kann."
Arnold,
Eysenck, Meili (1976) Lexikon der Psychologie
"Selbstverwirklichung. In der Psychol. wird Selbstverwirklichung oder
Selbstaktualisierung verstanden als autonome Entwicklung und Entfaltung
aller in einem Individuum angelegten physischen, psychischen und sozialen
Potenzen. Vor allem im Kreis der sog. Humanistischen Psychol. spielt das
Konzept der Selbstverwirklichung eine zentrale Rolle, und zwar als zusammenfassender
Beschreibungsbegriff höherer menschlicher Motive (Maslow), als Erziehungsziel
(Bühler) und als Therapieziel (Rogers, Fromm). Maslow zufolge steht
Selbstaktualisierung an oberster Stufe der Motivhierarchie, d.h., daß
sie sich erst dann entfaltet, wenn alle rangniediigeren Bedürfnisse
befriedigt sind. Obwohl das Bemühen um Operationalisierung eines so
komplexen Begriffs wie S. auf grundsätzliche Schwierigkeiten stößt,
gibt es Versuche, Meßinstrumente für S. zu entwickeln (Shostrom;
Bottenberg & Keller),
Lit: Bottenberg, JE.H, & l.A.
Ketten Beitrag zur empir. Klin. Psychol. u. Psychotherapie, 1975,23,21-53;
Maslow, A.H.: Motivation and personality. 2nd Ed. New Yotk 1970; Rogers,
C.R On becoming a person. Boston 1961. Shostrom, San Diego (Calif.), 1966.
J. A. Keller"
Meta-Dimensionen
Das Selbstbild läßt sich für psychologisch-psychotherapeutische
Zwecke noch wie folgt betrachten und klassifizieren:
- Wertigkeit: positiv, negativ, ambivalent (zwiespältig)
- Stabilität: konstante Wertigkeit, oder fragil, flüchtig, wechselhaft.
- Kongruenz: Selbst- und Fremdbild sollten innerhalb des Lebensmilieus in für wichtig erachteten Dimensionen nicht zu sehr oder/ und zu stark voneinander abweichen, um nicht Dauerkonflikte und Beziehungsprobleme hervorzurufen.
Im allgemeinen gilt, daß jeder Mensch ein im Grunde stabiles
und positiv kongruentes Selbstbild haben will und sollte.
Lebensregel
Ein positives Selbstbild wird gefördert durch eine Umgebung, die
einen in seinem Selbstbild bestätigt, wertschätzt und unterstützt.
Es ist daher sinnvoll, sich als Erwachsene sein soziales und zwischenmenschliches
Umfeld entsprechend einzurichten und zu gestalten. Metapher: wer sein Zelt
auf einem Misthaufen stellt, bei dem wird es stinken. Damit man entsprechende
Fähigkeiten ausbilden kann, muß man die Anlagen mitbringen und
eine förderliche Umgebung vorfinden. Zum Teil erlebt man sich so,
wie man behandelt wird. Sofern man schlecht oder ungerecht behandelt wird,
sollte man sich lösen lernen.
Psychotherapiedidaktischer Auseinandersetzungs-Text zur Anregung
Mit freundlicher Genehmigung der Gemeinschaftspraxis Rathsmann-Sponsel & Sponsel ©
Besondere
Bilder: Zur Theorie und Praxis der Wahrnehmungsebenen
Zur Warnung ;-): Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du
denkst .... Die verschiedenen Ebenen und Projektionen machen die Selbstbildforschung
nicht nur sehr spannend und attraktiv, sondern auch sehr verwirrend und
schwierig. Ein paar Beispiele können die Probleme verdeutlichen:
- Selbstbild: so sehe ich mich ...
- Selbstwunschbild: so wäre ich gern ...
- Projiziertes Selbstbild: ich denke, du siehst mich so ...
- Projiziertes Selbstwunschbild: ich denke, du möchtest, daß ich bin ...
- Selbstakzeptanzbild: ich akzeptiere bei mir ...
- Reflexiv projiziertes Selbstbild: du meinst, ich sehe mich so ...
Literatur (Kleine Auswahl) > Literatur Selbstorganisation und Schwärme.
- 3sat Scobel: Identität, Ich, Selbst.
- Asendorpf, Jens (1988). Die Rolle des Selbstkonzeptes. In: Keiner wie der andere. Wie Persönlichkeitsunterschiede entstehen. München: Piper. S. 237-242.
- Beck, Eleonore & Hoben, Josef (1982, Hrsg.) Wenn du zu dir selbser kommst. Erzählungen über Aufbruch, Mitte und Reife. Istfildern: Schwabenverlag.
- Branden, Nathaniel (2010) Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls. Erfolgreich und zufrieden durch ein starkes Selbst. München: Piper.
- Craanen, Michael & Gunsenheimer, Antje (2006, Hrsg.) Das 'Fremde' und das 'Eigene' Forschungsberichte (1992 – 2006). Bielefeld: transcript.
- Eckert, Martina & Wicklund, Robert A. (1987). Selbstkenntnis als Personenwahrnehmungsphänomen - Eine vernachlässigte Annäherung an ein bevorzugtes Konzept. Archiv für die Psychologie, 139, 159-179. [Abstract] [FN04]
- Eickelpasch, Rolf & Rademacher, Claudia (2004). Identität. O:? Transcript. ISBN: 978-3-89942-242-9
- Erikson, Erik H. (dt. 2008). Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze. Frankfuret: Suhrkamp. ISBN: 978-3-518-27616-7
- Festinger, Leon (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: University Press. dt. 1978, hrsg. von Martin Irle und Volker Möntmann bei Huber, Bern.
- Filipp, S.-H. (1979. Hrsg.). Selbstkonzeptforschung. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fischer, Arthur (1970). Die Entfremdung des Menschen in einer heilen Gesellschaft. Materialien zur Adaption und Denunziation eines Begriffs. München: Juventa.
- Frank, Manfred (2007). Warum bin ich Ich? Eine Frage für Kinder und Erwachsene. O:? Insel. ISBN: 978-3-458-17349-6
- Gallup, G.G. Jr. (1968). Mirror image stimulation. Psychological Bulletin, Vol. 70, 782-793.
- Gerhardt, Volker (1999). Selbstbestimmung: Das Prinzip der Individualität. O:? Reclam. ISBN: 978-3150097618
- Greve, Werner (2000, Hrsg.) Psychologie des Selbst. O:? Beltz . ISBN: 978-3-621-27462-3
- Heidegger, Martin (2002). Identität und Differenz. Stuttgart: Klett-Cotta. ISBN : 978-3-608-91045-2
- Hoyer, Jürgen (2000). Dysfunktionale Selbstaufmerksamkeit. Klinisch-psychologische und gesundheitspsychologische Untersuchungen. Heidelberg. Asanger.
- Humphrey, Nicholas (dt. 1995, engl. 1992). Die Naturgeschichte des Ich. Hamburg: Hoffmann & Campe.
- Kaufmann, Jean-Claude (2005). Die Erfindung des Ich. Eine Theorie der Identität. O:? UVK. ISBN: 978-3-89669-533-8
- Kegan, Robert (dt. 3.A. 1986, engl. 1982). Die Entwicklungsstufen des Selbst. Fortschritte und Krisen im menschlichen Leben. München: Kindt. [FN01]
- Keupp, Heiner; Ahbe, Thomas & Gmür, Wolfgang (1999). Identitätskonstruktionen: Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek: Rowohlt. ISBN: 978-3-499-55634-0
- Krappmann, (1978). Soziologische Dimensionen der Identität. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Kundera, Milan (2006). Die Identität. Frankfurt: Fischer. ISBN: 978-3-596-50954-6
- Laing, R.D.; Phillipson, H. & Lee, A.R. (dt. 1976, engl. 1966). Interpersonelle Wahrnehmung. Frankfurt: Suhrkamp.
- Lempp, R. (1992). Vom Verlust der Fähigkeit, sich selbst zu betrachten. Eine entwicklungspsychologische Erklärung der Schizophrenie und des Autismus. Bern: Huber.
- Luft, Joseph (1971). Einführung in die Gruppendynamik. Stuttgart: Klett.
- Mead, G. H. (1978). Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp.
- Metzinger, Thomas (2009). Der Egotunnel. Berlin: Berlin Verlag. ISBN: 3827006309
- Meyer, J. E. (1968, Hrsg,). Depersonalisation. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft.
- MacParkland, T. S. & Cumming, J.H. (1973). Selbstkonzept, soziale Schicht und psychische Gesundheit. In: Steinert, Heinz (1978, Hrsg.). Symbolische Interaktion. Arbeiten zu einer reflexiven Soziologie. Stuttgart: Klett-Cotta. S. 175-191.
- Pöppel, Ernst (2006). Der Rahmen. Ein Blick des Gehirns auf unser Ich. O:? Carl Hanser. ISBN: 978-3-446-20779-0
- Precht, David (2007) Wer bin ich und wenn ja, wie viele? München: Goldmann.
- Satir, Virgina (dt. 1988, engl. 1978) Meine vielen Gesichter. Wer bin ich wirklich? München: Kösel.
- Schutz, A. (2003). Psychologie des Selbstwertgefühls. Von Selbstakzeptanz bis Arroganz. Stuttgart: Kohlhammer.
- Sponsel, R. (1976). Delinquenz im Alltag. Empirische Prüfung der Delinquenztheorie "Techniken der Neutralisierung" von Sykes & Matza bei Bagatell- und Kavaliersdelikten. Diplom-Arbeit Psychologisches Institut Universität Erlangen. Quintessenzversion auch unter Egg & Sponsel unter dem Titel "Bagatelldelinquenz" und Techniken der Neutralisierung. Eine empirische Prüfung der Theorie von Sykes & Matza in Monatsschrift für Kriminologie, 1978, 61, 1, 38-50.
- Sponsel, R. (1982). Theorie der Wahrnehmungsebenen. In: CST, 01-10-01 bis 06. Erlangen: IEC-Verlag. ISSN-0722-4524.
- Sponsel, R. (1998). Identität, Ich, Selbst-Konzept-Varianten. In: Kristina, 108-112. Erlangen: IEC-Verlag.
- Swientek, Christine (2007). Ausgesetzt - verklappt - anonymisiert. Deutschlands neue Findelkinder. O:? Kirchturm. ISBN: 978-3-934117-10-5
- Spitzer, Manfred (1985). Allgemeine Subjektivität und Psychopathologie. [Dissertation] Pommersfeldener Beiträge, Sonderband 3, hrsg. von Claus Bussmann und Friedrich A. Uehlein. Frankfurt a.M.: Haag+Herchen.
- Taylor, Charles (1999). Quellen des Selbst: Die Entstehung der neuzeitlichen Identität. Frankfurt: Suhrkamp. ISBN: 978-3-518-58192-6
- Vossenkuhl, Wilhelm (2007). DVD Uni Auditorium: Philosophie: Identität. Studio Komplett Video.
- Zeitschrift "Du" - Das Kulturmagazin (2009). Wer willst du sein? - Identität zerlegen. Du 794, März 2009. ISBN: 978-3-905852-13-4
- Watts, Allan W. (1961) Zen-Buddhismus. Tradition und lebendige Gegenwart. Reinbek: rde.
Video: scobel Schwaerme 11.09.01 21-00 3sat * X.enius: Wie funktioniert ein Schwarm? 23.4.2009 * youtube *
- Dambeck, Holger (2011). Schwarm-Mathematik. Das merkwürdige Formationstauchen der Brillenenten. Spiegel Online, 27.7.2011.
- Eigen, Manfred & Winkler, Ruthild (1975 ff). Das Spiel. Naturgesetze steuern den Zufall. München: Piper.
- Haken, Hermann & Schiepek, Günter (2006). Synergetik in der Psychologie. Selbstorganisation verstehen und gestalten. Göttingen: Hogrefe.
- Honermann, Hermann (2002). Selbstorganisation in psychotherapeutischen Veränderungsprozessen. Eine kombinierte Prozess-Outcome-Studie im Kontext stationärer Psychotherapie. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde in der Fakultät für Pädagogik, Philosophie und Psychologie der Otto-Friedrich Universität Bamberg
- Jetschke, Gottfried (2009). Mathematik der Selbstorganisation. Qualitative Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme und gleichgewichtsferner Strukturen in Physik, Chemie und Biologie. Frankfurt am Main: Deutsch.
- Kratky, Karl W. (1990). Grundprinzipien der Selbstorganisation. Darmstadt: Wiss. Buchges.
- Kriz, Jürgen (1997). Systemtheorie. Eine Einführung für Psychotherapeuten, Psychologen und Mediziner. Wien: Facultas.
- Paslack, Rainer (1991). Urgeschichte der Selbstorganisation. Zusatz zum Titel: zur Archäologie eines wissenschaftlichen Paradigmas. Braunschweig: Vieweg.
- Schiepek, G. & Strunk, G. (1994). Dynamische Systeme - Grundlagen und Analysemethoden für Psychologen und Psychiater. Mit einem Vorw. von Uwe an der Heiden. - Heidelberg: Asanger.
Anmerkungen
FN01 Das Buch ist sehr weitschweifig, wenig operational und substanziell, obwohl es sich ausdrücklich auf Piaget beruft.
___
FN02 Man findet den Begriff z.B. nicht als Stichwort bei Grunwald, Wolfgang (1979, Hrsg.). Kritische Stichwörter zur Gesprächspsychotherapie. München: Fink. Indirekt findet er sich aber im Stichwort "Persönlichkeitstheorie" unter "3.13 Verwirklichungstendenz". Der Ausdruck wird auch nicht im Register von Tausch, R. (1973, 5.A.). Gesprächspsychotherapie. Göttingen: Hogrefe aufgeführt. Und so auch nicht bei Rogers, C. R. (dt. 1972, engl. 1942). Die nicht-direktive Beratung. München: Kindler. Und nicht in: GwG (1975, Hrsg.). Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. München: Kindler. Man muß schon in ein DDR-Buch schauen, um eine ordentliche Sachregistererfassung zu finden, so in: Helm, J. (1978). Gesprächspsychotherapie. Forschung - Praxis - Ausbildung. Berlin: VEB der Wissenschaften. Es heißt dort (S. 34): "Allen Änderungsprozessen bzw. Lernvorgängen liegt nach Rogers eine sog. Selbstaktualisierungstendenz des Organismus als allgemeiner Motivationsfaktor zur Realisierung der eigenen Potenzen zugrunde, dessen Wirksamkeit durch die psychotherapeutischen Bedingungen erheblich gefördert werden soll." Dies hört sich sehr tautologisch an, indem der Mensch offenbar danach strebt, wonach er strebt. Rogers hat hier wohl wunschgeleitetet seine eigene "humanistische" Ideologie und Metaphysik mit der Wissenschaft verwechselt, eine weit verbreitete Unsitte in der Psychotherapietheorie und ganz extrem von Freud und den PsychoanalytikerInnen betrieben. Es ist erstaunlich, mit welcher Naivität und wissenschaftlicher Basis- Inkompetenz die Begründer von Psychotherapie-Schulen ihre Quasi-Theologien in die Welt setzen.
___
FN03 Egoisten sind wir alle, entweder kluge oder dumme. Mit "Ichmensch" ist gewöhnlich der dumme Egoist gemeint, der sich über die Interessen anderer einfach hinwegsetzt, ohne zu bemerken, daß die Umgebung dann seine Interessen zunehmend weniger berücksichtigt. Ein kluger Egoist ist daher sozial: er berücksichtigt die Interessen anderer, weil er auch möchte, daß die anderen seine Interessen berücksichtigen.
___
Abstract Eckert, Martina & Wicklund, Robert A. (1987). Selbstkenntnis als Personenwahrnehmungsphänomen - Eine vernachlässigte Annäherung an ein bevorzugtes Konzept. Archiv für die Psychologie, 139, 159-179.

Barnum-Effekt
- Neigung der Menschen, vage und allgemeine Beschreibungen über
sich selbst, für wahr zu halten. [W]
FN04. Die Arbeit wurde wissenschaftssprachanalytisch untersucht von Fabriele Graefen (1997). Der Wissenschaftliche Artikel – Textart und Textorganisation. Arbeiten zur Sprachanalyse Herausgegeben von Konrad Ehlich Band 27. Frankfurt: Lang.
- "Die Autoren sind Martina Eckert und Robert A. Wicklund.
Der Titel lautet: "Selbstkenntnis als Personenwahrnehmungsphänomen
– Eine vernachlässigte Annäherung an ein bevorzugtes Konzept".
Der Artikel erschien 1987 in der Zeitschrift "Archiv für Psychologie"
(Jahrgang 139). Er gehört zu den langen Texten des Korpus (21 Seiten,
286 Sätze, 44.695 Zeichen).
b) Thema ist das psychologische Konzept der "Selbstkenntnis" bzw. des "Selbstkenners". Die Autoren demonstrieren, daß verschiedene theoretische Schulen gegensätzliche Aussagen darüber gemacht haben. Die Autoren äußern Vorbehalte besonders gegenüber den "klinischen Modellen". Die im Artikel dargestellten Experimente dienen der Kontrolle der fragwürdigen theoretischen Aussagen. Anlage, Durchführung und Ergebnisse der Experimente werden einzeln beschrieben und diskutiert. Das erste Experiment geht der Frage nach, ob sich die Kontrollierbarkeit einer Zielper-son für den Beobachter positiv auf dessen Zuschreibung von Selbstkenntnis auswirkt. Das wird bestätigt. Das zweite und dritte Experiment dienen der Klärung der entgegengesetzten Frage, ob "das offene autonome Verhalten einer Zielperson zu höheren Selbstkenntniszuschreibungen führt". Diese Frage wird fast vollständig verneint.
Am Ende kommen die Autoren auf die allgemeine Fragestellung zurück. Sie belegen deren praktische Bedeutung. Der letzte Paragraph setzt die ei-gene Untersuchung ins Verhältnis zur aktuellen sozialpsychologischen Forschung.
c) Dem Text geht eine Zusammenfassung in Deutsch und Englisch voraus. Er ist mit Zwischenüberschriften in zwei verschiedenen Schrifttypen unter-gliedert, ohne numerische Einteilung. Die experimentellen Ergebnisse werden mit Hilfe von Wertetabellen wiedergegeben."
Standort: Selbstbild.
*
Integrativer Persönlichkeits Fragebogen
Axiome und Konstruktionsprinzipien Differentieller Psychologie der Persönlichkeit in der Allgemeinen und Integrativen Psychodiagnostik, Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie.
Übersicht Differentielle Psychologie der Persönlichkeit in der Allgemeinen und Integrativen Psychodiagnostik, Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie.
Welten und die Konstruktion unterschiedlicher Wirklichkeiten in der GIPT.
Norm, Wert, Abweichung (Deviation), Krank (Krankheit), Diagnose. "Normal", "Anders", "Fehler", "Gestört", "Krank", "Verrückt".
Übersicht Heilmittellehre in der GIPT.
Wünschen und Wollen, Werten, Lenken, Anpassen und Gestalten, Aufgeben,
Zitierung
Sponsel, R. (DAS). Selbstbild. Glossar, Dimensionen, Meta-Dimensionen, Lebensregel, Psychotherapiedidaktischer Auseinandersetzungs-Text zur Anregung, Besondere Bilder: Zur Theorie und Praxis der Wahrnehmungsebenen, Literatur (Auswahl). Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/diffpsy/ich/sb.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen
Ende Selbstbild_| Datenschutz | Überblick_Rel. Aktuelles_ Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region__Service-iec-verlag__Zitierung & Copyright___Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_
korrigiert: 15.02.04 irs
Änderungen/ Ergänzungen wird allgemein im Laufe der Zeit unregelmäßig ergänzt und überarbeitet
16.03.24 Editoiral * Wahres Selbst * Erg. Selbstverwirklichung.
07.02.22 LitErg (Precht, Satir).
05.10.21 LitErg.
30.12.19 Eigenes gegenüber Fremdem.
10.09.19 Link zum Lebensbaum und seinen Wurzeln.
20.08.18 Allan Wattts zur (erweiterten) Identität.
03:06:18 Linkfehler korrigiert.
27.03.18 Neuer Abschnitt: Bedeutungen von ICH.
15.10.17 LitErg.
29.10.11 Link zu: Synergetik in der Psychologie. Selbstorganisation verstehen und gestalten.
28.10.11 Exkurs: ICH als Ergebnis einer Selbstorganisation neuronaler Funktionseinheiten ohne Zentrale (Singer Widersprüche).
23.07.11 Exkurs: Kann man sein ICH, seine Identität verlieren ?
23.07.10 Lit-Erg.
28.01.10 Pascal Zitat (s.a. Ludwig II.).
17.01.10 Link Identität verändert auf eine neue Ausarbeitung.
13.04.07 Aufnahme Egozentrik , egomanisch und maniform ... mit Querverweis.
26.02.04 Linkhinweis auf den Integrativen Persönlichkeits Fragebogen, der viele der hier behandelten Begriffe operationalisiert und erhebt
21.02.04 Ichmensch mit Kommentar.