(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=13.10.2018 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 23.10.23
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_ Sprachkritik_Datenschutz_ Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Sprachkritik und hier speziell zum Thema:
Kritik des Sprachgebrauchs in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
Allgemeine, abstrakte, unklare, hypostase-homunkulusartige autonome Begrifflichkeiten und Geisterwelten
Haupt- und Verteilerseite
Begriffsanalysen (Überblick).
Zur Haupt- und Verteilerseite
Begriffsanalyse Begriff.
Definition
Begriff.
Signierung
Begriffe und Begriffsmerkmale (BM).
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
|
"Das Haupthindernis des Fortschrittes in moralischen und metaphysischen Wissenschaften liegt deshalb in der Dunkelheit der Begriffe und Zweideutigkeit der Worte." David Hume 1748, Untersuchung über den menschlichen Verstand [Online] "Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung des Verstandes durch die Mittel unserer Sprache." Wittgenstein Philosophische Untersuchungen, 109 |
Zusammenfassung - Abstract - Summary
Philosophen, Juristen, Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaftler reden meist so, als bedeuteten ihre Worte etwas. Das mag sein, aber wir wissen oft nicht, was ihre Worte bedeuten, weil ihre Bedeutung vielfältig ist, dunkel und oft unklar bleibt. Das gilt für die meisten Philosophen, für viele Juristen, Historiker, Geistes- und Kultur und auch für viele Sozialwissenschaftler. Dahinter steckt offensichtlich die irrationale Idee, dass Worte von selbst etwas bedeuten müssen, oder im schlimmsten Platonismus, als ewige Begriffs-Geister fix und fertig für jeden verständlich real existieren. Das war die Ursünde und der Irrsinn des Geistes, den Platon über das Abendland brachte, weil er dem Universalienproblem und der Analyse des Denkprozesses hinten und vorne nicht gewachsen war. Empirie, Experiment, Beobachtung, Denkprotokolle und Einzelfallanalysen gehörten nicht zum altgriechischen Wissenschaftsverständnis, woran sich leider auch ihre philosophischen Nachfahren hielten (Ausnahme Charles S. Peirce). Rein äußerlich fallen diese Texte durch einen substantivistischen, allgemeinen, abstrakten, verallgemeinernden Stil auf, mit selbstständig handelnden Entitäten.
Viele Philosophen, Juristen, Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaftler bewegen sich begrifflich auf vor-aristotelesischem "Niveau" und können das elementar Notwendige nicht, das jede WissenschaftlerIn beherrschen muss:
|
|
welche ihre Gedanken untereinander austauschen wollen, etwas voneinander verstehen; denn wie könnte denn, wenn dies nicht stattfindet, ein gegenseitiger Gedankenaustausch (...) möglich sein? Es muß also jedes Wort (...) bekannt sein und etwas, und zwar eins und nicht mehreres, bezeichnen; hat es mehrere Bedeutungen, so muß man erklären, in welcher von diesen man das Wort gebraucht. ..." Aus: Aristoteles (384-322) Metaphysik. 11. Buch, 5. Kap., S. 244 (Rowohlts Klassiker 1966). Sehr richtig, nur wie man das genau macht hat uns Aristoteles nicht verraten. |
Leider verstehen viele Philosophen, Juristen, Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaftler auch nach 2300 Jahren Aristoteles immer noch nicht, wie Wissenschaft elementar funktionieren muss: Wer wichtige Begriffe gebraucht, muss sie klar und verständlich erklären und vor allem auch referenzieren können, sonst bleibt alles Schwall und Rauch (sch^3-Syndrom). Wer also über irgendeinen Sachverhalt etwas sagen und herausfinden will, der muss zunächst erklären, wie er diesen Sachverhalt begrifflich fasst, auch wenn dies manchmal nicht einfach ist.
Dokumentation Auf dieser Seite werden
für diese im wahrsten Sinne des Wortes weit verbreitete
Geistes-Krankheit
Beispiele gegeben, ausführlich analysiert, kritisiert und die Mängel
und Fehler nachvollziehbar und prüfbar signiert und dokumentiert.
Franz
Rosenzweig sieht die Sache ähnlich; auch Stirner. Grundlage hierfür
ist die umfangreiche Arbeit Begriffe, Begriffsbildung
und Gebrauchsbeispiele.
Beispiele:
- "Da Verstehen seinem Wesen nach ein unselbständiger Akt ist, ..." (> Graumann)
- "Die Bildung ontologischer Begriffe bietet natürlich eine Reihe von Schwierigkeiten dar. Der Gegenstand leistet ihr durch seine Fernstellung und Abgeklärtheit eine ganz spezifische Art von Widerstand." (>N. Hartmann)
- "Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe." (>Hegel)
- "Die vergleichende Anthropologie sucht den Charakter ganzer Classen von Menschen auf, vorzüglich den der Nationen und der Zeiten." (>W.v.Humboldt)
- "Es werden darum im allgemeinen Besonderheiten des vorliegenden Bewusstseinsinhaltes unberücksichtigt bleiben; einesteils, weil das Denken an ihnen kein Interesse hat, andernteils, weil das Denken ihre Bedeutung nicht zu erkennen vermag" (> G. F.Lipps)
- "Der Synkretismus verhindert also die Analyse und verhindert das deduzierende Denken. Man sieht in einem solchen Fall auch, daß der Synkretismus die Unfähigkeit des Denkens zur logischen / Multiplikation erklärt und daß er seine Neigung (BMautonS), die Synthese durch die Beiordnung zu ersetzen, erklärt." (>Piaget)
- Sprache "ist die allumfassende Vorausgelegtheit der Welt." (>Gadamer)
- "Jede Wissenschaft hat zum Ziel eine sachlich und zweckmäßig geordnete Darstellung allgemeingültiger Erkenntnisse." (>Külpe)
- "Das seelische Sein ist zwar getragenes Sein, aber in seiner Eigenart ist es bei aller Abhängigkeit autonom." (>N. Hartmann)
- "Die Individualität eines Menschen ist Eins mit seinem Triebe. Das ganze Universum besteht nur durch den Trieb, ..." (>W.v.Humboldt)
- "In der Psychoanalyse bestand von Anfang an ein Junktim zwischen Heilen und Forschen, ..." (>Freud)
- "Dies ist die eine Art, wie sich die Bisexualität in die Schicksale des Ödipuskomplexes einmengt..." (>Freud)
- In den 34 Entscheidungen ab 2002-2016 findet sich keine einzige numerische oder inhaltliche Spezifikation einer Wahrscheinlichkeit, so dass völlig offen bleibt, was das BVerwG mit seinen Wahrscheinlichkeitsbegriffen tatsächlich meint. Das gilt leider auch für die 17 Fundstellen für "hinreichende Wahrscheinlichkeit". (>BVerwG)
Kritikhintergrund Meine Kritik beruht (1) erkenntnistheoretisch auf dem Realismus, (2) auf dem aufgeklärten gesunden Menschenverstand, (3) auf dem Grundpostulat, dass es Erkenntnis nur relativ zu einem Sachverhalt gibt, der erkannt werden soll, und einem erkennenden System, das diesen Sachverhalt erkennt oder erkennen will. So gesehen gibt es kein Ding an sich in dem Sinne, wie das Ding an sich beschaffen sein könnte, wenn man es sich allein, ohne erkennendes System denkt. Denn danach müsste ich mich wegdenken, um das Ding an sich vor mir zu haben, was aber nicht mehr geht, wenn ich mich weggedacht habe (> Aporie). Es gibt also kein voraussetzungsloses erkennendes System. (4) sind Begriffe (>Definition Begriff), die nicht definiert oder wenigstens näher charakterisiert werden unverständlich. (5) Damit ein - wenigstens wissenschaftlicher - Begriff nachvollziehbar, prüf- und kontrollierbar ist, müssen seine Referenzen, nämlich wie und wo er in der Welt zu finden ist, angegeben werden. (6) Sehr hilfreich und nützlich sind operationale Kriterien und konkrete Beispiele und Gegenbeispiele.
Das Grundproblem der Mehrdeutigkeit
der Worte und Begriffe (Homonyme)
|
|
welche ihre Gedanken untereinander austauschen wollen, etwas voneinander verstehen; denn wie könnte denn, wenn dies nicht stattfindet, ein gegenseitiger Gedankenaustausch möglich sein? Es muß also jedes Wort bekannt sein und etwas, und zwar eins und nicht mehreres, bezeichnen; hat es mehrere Bedeutungen, so muß man erklären, in welcher von diesen man das Wort gebraucht." Aus: Aristoteles (384-322) Metaphysik. 11. Buch, 5 Kap., S. 244 (Rowohlt Klassiker 1966). Sehr richtig, nur wie man das genau macht hat uns Aristoteles nicht verraten. |
Die Worte sind die "Kleider" der Begriffe. Verschiedene Menschen werden
meist mit den gleichen Worten unterschiedliche Bedeutungen verknüpfen,
je nach ihren Erfahrungen, Wissen und Kenntnissen, Interessen und Kommunikationssituationen.
D.h., aus der bloßen Tatsache, dass Menschen das gleiche Wort verwenden,
kann leider nicht geschlossen werden, dass sie auch den gleichen Begriff
meinen (Querverweise: Das
Thema Homonyme in der IP-GIPT). Die Problematik betrifft auch keineswegs
nur die Alltagskommunikation, die Geistes- und Sozialwissenschaften, sondern
auch die Naturwissenschaften und die Mathematik, wenngleich es gerade bei
Begriffen, die psychisches Erleben beschreiben besonders schwierig ist,
einen auch nur annähernd gleichen Begriff zu normieren (> nur
empfinden, fühlen, spüren, > Terminologie).
Das Problem der Homonymie betrifft im Kern den Begriff,
den Menschen sich von Sachverhalten bilden. Die Verwendung des bloßen
gleichen Wortes, also der bildlichen oder lautlichen Ausdruckshülle,
sagt bei etwas strengerer Betrachtung gar nichts über den Begriff.
Es stellt sich daher die Frage: was kann oder muss man denn tun, um herauszufinden,
welcher Begriff mit der bildlichen oder lautlichen Ausdruckshülle
genau gemeint ist? Wie macht man das im Alltagsleben oder in der
Wissenschaft, eine Frage, die Aristoteles leider nicht beantwortet. Die
Beantwortung dieser Frage wird von verschiedenen Fachrichtungen erörtert:
Denk-
und kognitive Psychologie, Erkenntnistheorie, Logik und Methodologie, Wissenschaftstheorie,
Kommunikationstheorie, Sprachwissenschaft, Linguistik und Semiotik, Medienwissenschaften
und Soziologie. Die praktische Seite erörtere ich in der Denkpsychologie
der Begriffe, die grundlegende methodologische in folgendem Abschnitt:
DieWohlunterscheidbarkeit
von Objekten oder Sachverhalten als Grundlage angemessener Definitionen
Grundlage der Wohlunterscheidbarkeit sind Merkmale. Die einfachste
Definition ergibt sich aus der Zuweisung(en) oder Abweisung(en) eines einfachen
Merkmals M zu einem Objekt O, wie wir es z.B. in der formalen Prädikatenlogik
vorfinden: (1a) O e M oder (1b) O en M. Hierbei bedeutet: (1a) Dem Objekt
O wird das Merkmal M zugesprochen oder (1b): Dem Objekt O wird das Merkmal
M abgesprochen. Der komplexe Fall ergibt sich durch das Zu- oder Absprechen
von mehreren, unterschiedlichen Merkmalen. Ausgeschlossen ist in der Regel
nach dem Satz
vom Widerspruch, einem Objekt O zugleich das gleiche Merkmal M zu-
und abzusprechen.
Homunkulesk-hypostatische
begriffliche Entgleisungen
Werden allgemeinen oder abstrakten Begriffen Handlungs- oder
Verhaltensfähigkeiten zugeordnet, die Begriffe oder die repräsentierenden
Sachverhalte also wie handlungs- und verhaltensfähige Personen behandelt,
bezeichne ich das als Homunkuleske-hypostatische begriffliche Entgleisung,
worin
sich eine besondere Unart philosophischer, sozial-, geistes-, kultur- und
rechtswissenschaftlicher Fehlleistung ausdrückt. Streng formal handelt
sich um begriffliche Wahnsysteme (> wissenschaftliche
Wahnsysteme).
Beispiele (Quellen-Belege im Text):
- Wilhelm von Humboldt Vergleichende Anthropologie. "Die vergleichende Anthropologie sucht den Charakter ganzer Classen von Menschen auf, vorzüglich den der Nationen und der Zeiten." (>W.v.Humboldt). Kommentar: Die Anthropologie ist eine Schöpfung des menschlichen Geistes und sucht gar nichts auf, weil sie kein selbständig handelndes autonomes Subjekt ist.
- Beispiel Gruppe als autonom handelndes Subjekt nach Ruth Benedict Urformen der Kultur (Quelle)
- Der deutsche Geist als autonom handelndes Subjekt. Kommentar: Der deutsche Geist ist kein autonom handelndes Subjekt, das bleiben oder oder hervorbringen kann, sondern eine Konstruktion der Menschen. Zumindeste wäre zu zeigen, wie der deutsche Geist handeln und wirken kann.
- Hirnforschung: Das Gehirn als handelndes Subjekt In der Hirnforschung herrscht Begriffsebenenchaos (> Janich, 2009). Ein Kategorienfehler reiht sich an den anderen, oft werden die biologisch-medizinischen mit den psychologischen Begriffebenen vermengt und durcheinander gebracht. Es fehlt an den einfachsten Grundtugenden des wissenschaftlichen Arbeitens, so wird völlig unbekümmert drauflos schwadroniert, ohne es zu bemerken. Die erste wissenschaftstheoretische Aufgabe der Hirnforschung wäre, die Termininologie der verschiedenen Begriffsebenen in einem Grundmodell vernünftig und kritisch aufzubereiten.
- Das Gedaechtnis luegt. Kommentar: Das Gedächtnis ist kein autonom handelndes Subjekt, das bewusst und mit Absicht die Unwahrheit sagt. Das Gedächtnis spricht überhaupt nicht. Auch der 2. Artikel bringt wie der erste gleich zu Beginn diesen Kategorienfehler.
- Bewusstsein. Kommentar: .... Das Bewusstsein, ein Projektionsraum für das Erleben, macht gar nichts, es ist kein autonom handelndes Subjekt. Es ist da und funktioniert so oder so. Besser wäre es gewesen zu sagen: Durch das Bewusstsein wird das Leib-Seele-Problem aus meiner (Thomas Nagel) Sicht zu einer schwierigen Sache.
- "Narzissmus unseres Gehirns" Kommentar: Das Gehirn ist weder narzisstisch noch unmoralisch. Hier werden die biologisch-medizinischen und psychologischen Kategorien vermischt.
- Ein Kognitives System ergruendet sich selbst (Singer) Kommentar: Ein kognitives System ist kein selbständig handelndes Subjekt, sondern in einem Menschen lokalisiert. Es ergründet sich nicht selbst und betrachtet sich auch nicht im Spiegel.
- Damasio: Das Gehirn "veranlasst". Ein kognitives System ist kein selbständig handelndes Subjekt, sondern in einem Menschen lokalisiert. Es ergründet sich nicht selbst und betrachtet sich auch nicht im Spiegel.
- Die Philosophie als autonomes Subjekt bei Gadamer Kommentar: "Die" Philosophie ist eine Schöpfung des menschlichen Geistes, daher tut sie nichts. Das mögen Philosophen denken oder tun wie offenbar Gadamer, aber diese Sprache ist schlicht und einfach falsch und lässt hinsichtlich der Aufklärung nichts Gutes ahnen.
- Gadamer die Philosophie meint Kommentar: Die Philosophie ist eine Schöpfung des menschlichen Geistes, sie ist kein selbständiges Subjekt und meint daher gar nichts. Gadamer hingegen meint das. Aber Gadamer ist nicht die Philosophie, er ist nur ein Philosoph.
- Nicolai Hartmann Hypostasisch-homunkuleske Konstruktionen Kommentar: Der Gegenstand leistet keinen Widerstand, weil er kein hypostasisch-homunkuleskes Subjekt ist. Das erkennende Subjekt erlebt vielleicht einen Widerstand, weil es sich mit Erkennen schwer tut. Auch: Kommentar: Die Ontologie vollzieht gar nichts. Ontologie ist eine Schöpfung des menschlichen Geistes, um die Welt zu strukturieren. Und auch die Kategorien sind eine Schöpfung des menschliches Geistes und kein autonomes, hypostasisch-homunkuleskes Subjekt.
- Hegel Intelligenz bringt hervor (Name und Begriff): Die Intelligenz bringt nichts hervor, erinnert nicht und "setzt" nichts. Intelligenz ist eine Konstruktion des menschlichen Geistes und kein autonom handelndes Subjekt.
- Platon Vernunft kein autonomes Subjekt: Merkmals-Kritik im Detail: Hypostasisch-homunkulesker Gebrauch der Vernunft, die hier Anaxagoras und Sokrates zugeordnet wird, so als ob diese selbständig handeln würde, wobei unklar ist, wo diese Vernunft in der Welt zu finden (BMRef) ist und Belege (BMBeleg-) fehlen.
- Afrika als Subjekt Sarr, Felwine (dt. 2019. fr 2016) Afrotopia. Berlin: Matthes & Seitz
- Denkinteresse. Kommentar: "Das Denken" ist kein autonomes Subjekt, das ein Interesse bildet. Der Denkende bildet womöglich ein Interesse aus oder auch nicht. Jedenfalls kann man das in einem wissenschaftlichen Text nicht so formulieren. Es muss genau gesagt werden, wer das Interesse aufbringt oder nicht.
- Synkretismus Piaget, Jean Kommentar: Den Synkretismus gibt es nicht als autonom handelndes Subjekt. Er hat auch keine Neigungen und erklärt nichts.
- Ekman - Gesichtsausdruecke sind keine autonomen Subjekte Kommentar: [1] Das Gesicht lügt weder noch sagt es die Wahrheit, es liefert allenfalls Ausdrucksindizien für Lüge oder Wahrheit. Das Gesicht ist kein autonomes Subjekt mit eigenen Absichten.
- Freuds autonome Subjekte Ich und Es. Kommentar Oedipuskomplex Die Bisexualität greift ein; die Objekte halten fest; der vollständige Ödipuskomplex wird angenommen, geht unter, hinterlässt Niederschläge im Ich; Identifizierungen gelangen zu Vereinbarungen; die Ichveränderung tritt anderen Inhalten des Ichs entgegen. Das ist eine abstrakte, verallgemeinerte Redeweise über fiktive Menschen, in der Freuds phantastischen Konstruktionen ein homunkuleskes, autonomes Eigenleben entfalten.
- Kopnin Dialektik als autonom handelndes Subjekt. Kommentar Kopnin : "Die" Dialektik ist kein autonom handelndes Subjekt, die erfasst oder nicht erfasst, sich befasst oder nicht befasst, sie nimmt nichts ..., sondern sie ist eine Schöpfung oder Konstruktion des menschlichen Geistes, genauer einzelnen menschlicher Geister, die der Dialektik solche Merkmale zuordnen.
- Ziel der Wissenschaft nach Kuelpe "Jede Wissenschaft hat zum Ziel eine sachlich und zweckmäßig geordnete Darstellung allgemeingültiger Erkenntnisse." Kommentar Külpe : Die Wissenschaft ist kein selbstständiges, autonomes Subjekt, sondern eine Schöpfung des menschlichen Geistes. Daher kann sie auch kein Ziel haben. Aber Menschen können mit der Wissenschaft Ziele verfolgen und das tun sie in der Regel auch. Ob man mit ihr nur ausschließlich allgemeingültige Erkenntnisse anstreben sollte, bezweifele ich. Im übrigen ist "allgemeingültig" hier nicht erklärt. Wie der Namen schon verkündet: Wissenschaft schafft Wissen.
- DAS Boese als autonomes Subjekt. Philosoph Noller, der sich zwar eingangs kritisch gegen die Wendung DAS BÖSE wandte, hielt diese vernünftige Haltung nicht vollständig durch und erlag einmal dem Gebrauch der verselbständigenden Substantivierung in der Sternstunde Philosophie, 3sat am 14.10.18, zum Thema ImSog des Bösen, bei ca. 6.05 min: "Das Böse schleicht sich ein und ist strategisch sehr geschickt" (BMautonS) (6.05)
- Tatbestand als autonomes Subjekt. Ein Tatbestand ist kein autnom handelndes Subjekt, das auf sich aufmerksam macht. Hans Thomae (1944) in Die Antriebsstruktur, S. 26: "Dem Begriff der Einheit des Seelischen ist aber noch durch ein anderes Rechnung zu tragen: alle seelischen Phaenomene haben nicht bloße Koexistenz in einem neutralen Raum, der „Bewußtsein“ oder „Unbewußtes“ genannt wird und aus dem sie ohne weiteres als sich stets, gleichbleibende Tatsache zu entnehmen wären. Sie sind Äußerungen einer lebendigen menschlichen Existenz. Dieser Tatbestand, den die beginnende experimentelle Psyhologie zunächst einmal übersehen zu können glaubte, macht auf sich mit zu gebietenden Argumenten aufmerksam, als daß wir ihn nicht schon bei der Inangriffnahme unserer beschreibenden Bemühungen berücksichtigen müßten. Alles von uns zu Beschreibende ist Glied einer Struktur, wobei wir diesen Ausdruck zwar vorzugsweise für das im Phaenomenalen erscheinende „Seiende“, jedoch dort, wo eine Trennung zwischen beiden unmöglich ist, auch zur Bezeichnung von Phaenomenalem gebrauchen werden."
Signierung Wissenschaftlicher Begriffsmerkmale (BM) nach dem Grundlagen-Artikel "Begriff, Begriffsbildung und Gebrauchsbeispiele". > Zur Methodik. > Stand der Signierungen.
[Status/Stand der Signierungen: m= markiert (), s= signiert (BM...), k= korrigiert, t= teilweise signiert]
_
Sprachkritik im Metzler-Lexikon-Sprache
"Sprachkritik 1. Auseinandersetzung und Beurteilung herrschender >Sprachnormen, von Stilkritik über die Kritik von Sprachformen der Presse, des Rundfunks und Fernsehens, der Verwaltung und von Institutionen bis zur ideologiekrit. polit. S. Die Erscheinungsformen der S. sind sehr verschiedenartig. Sie werden bestimmt von ihren Zielen (Verbesserung des herrschenden Sprachgebrauchs durch Vorschriften zur Beachtung geltender Normen), ihren Gegenständen (Kritik am System einer Spr., am Sprachverhalten einzelner Sprecher oder Sprechergruppen), den Intentionen der Sprachkritiker (z. B. feminist. Ansätze), dem Infragestellen der theoret. Grundlagen von Äußerungen (gesellschafts-, sprachtheoret., kommunikationseth. Basis) sowie der »Dimension der Werte«, die durch die S. als hinter den sprachl. Äußerungen stehend bewusst gemacht und hervorgehoben werden soll (Wahrheit, Genauigkeit, Ordnung, Schönheit). Allgemein kann S. als Analyse sprachl. Äußerungen im Hinblick auf ihre Intentionen und ihre kommunikativen Effekte umschrieben werden. F. Mauthner setzte S. mit Erkenntniskritik gleich, eine Position, die in der Philosophie und Soziologie als Form der Gesellschaftskritik populär ist (Marcuse 1967). 2. Als philosoph. S. sind die sprachanalyt. Arbeiten der ordinary language philosophy im Anschluss an Wittgenstein anzusehen (>Philosophie der Alltagssprache). Die Vertreter dieser Richtung gehen davon aus, dass die (natürlichsprachl.) grammat. Formen von Äußerungen nicht die log. Formen von Aussagen wiedergeben, d. h. dass die Umgangsspr. log. nicht eindeutig ist (Austin, Searle, v. Savigny).
- Lit. W. Dieckmann, S. (SBS 3). Heidelberg 1992.
– F. Mauthner, Beiträge zu einer Kritik der Sprache. 3 Bde. Stgt.
1901/02. Unveränderter Nachdruck der 2. Aufl. Ffm. 1982. – H. Marcuse,
One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society.
Boston 1964. Dt.: Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der
fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Neuwied, Bln. 1967. – H. J. Heringer
(Hg.), Holzfeuer im hölzernen Ofen. Aufsätze zur polit. S. Tübingen
1982. – J. L. Austin, How to Do Things with Words. Oxford 1962. Dt.:
Zur Theorie der Sprechakte. Stgt. 1972. – J. R. Searle, Speech Acts. Cambridge
1969. Dt.: Sprechakte. Ein sprachphilosoph. Essay. Ffm. 1971. – E. v. Savigny,
Die Philosophie der normalen Spr. Eine krit. Einführung in die ›ordinary
language philosophy‹. Ffm. 1969. – J. Schiewe, Die Macht der Sprache. Eine
Geschichte der S. von der Antike bis zur Gegenwart. Mchn. 1998. – Chr.
Meier (Hg.), Spr. in Not? Zur Lage des heutigen Dt. Göttingen 1999.
– P. v. Polenz, Sprachgeschichte und S. Dt. Sprachpreis 2000 der Henning-Kaufmann-Stiftung.
Schliengen 2000. – J. Schiewe, Die Macht der Sprache. Eine Geschichte der
S. von der Antike bis zur Gegenwart. Mchn. 1998. – J. Spitzmüller
(Hg.), Streitfall Sprache. S. als angewandte Ling.? Bremen 2002.– H. Arntzen,
Sprache, Literatur und Literaturwissenschaft, Medien. Beiträge zum
Sprachdenken und zur S. Ffm 2009. – J. Schiewe, [>647] (Hg.), S.
und Sprachkultur. Bremen 2011. –W. Dieckmann, Wege und Abwege der S. Bremen
2012."
__
Beispiele scheinwissenschaftlicher
Texte und Sprachverirrungen
Anthropologie, Geschichte,
Kognitionswissenschaft,
Kommunikation
und Sprache, Neurowissenschaft und Gehirnforschung,
Philosophie,
Psychiatrie,
Psychoanalyse,
Psychologie,
Recht,
Soziologie,
Wissenschaftstheorie,
Exkurs Medien.
Anthropologie
- Vergleichende Anthropologie
S.15: "Die vergleichende Anthropologie (BMautonS) sucht den Charakter ganzer Classen von Menschen auf, vorzüglich den der Nationen (BMfragl) und der Zeiten (BMfragl). Diese Charaktere sind oft zufällig; sollen denn auch diese erhalten werden? soll der Philosoph, der Geschichtsschreiber, der Dichter, der Mensch seinen Namen, seine Nation, sein Zeitalter, sein Individuum endlich sichtbar an sich tragen? - Allerdings, nur recht verstanden. Der Mensch soll alle Verhältnisse, in denen er sich befindet, auf sich einwirken lassen, den Einfluss keines einzigen zurückweisen, aber den Einfluss aller aus sich heraus und nach objectiven Principien bearbeiten. So soll er s e y n; wieviel er hernach hievon in den verschiedenen Gattungen seiner Thätigkeit z e i g e? hängt von den Erfordernissen dieser Gattung und der Natur seiner Individualität ab. Je mehr subjective Originalität er aber, dem objectiven Werthe des Werks unbeschadet, zeigen kann, desto besser."
Quelle: Humboldt, Wilhelm Anthropologie und Theorie der Menschenkenntnis. In: Wagner, Hans-Josef von (2002) Wilhelm von Humboldt. Anthropologie und Theorie der Menschenkenntnis. Darmstadt: WBG.
- Kommentar: Die Anthropologie ist eine Schöpfung des menschlichen
Geistes und sucht gar nichts auf, weil sie kein selbständig handelndes
autonomes Subjekt ist.
Die Welt als Triebprodukt
Wilhelm von Humboldt Ueber den Charakter
der Griechen, die idealische und historische Ansicht desselben
"Die Individualität eines Menschen ist Eins mit seinem Triebe
(BMunklar), (BMfragl).
Das ganze Universum besteht nur durch den Trieb (BMunklar),
(BMfragl), und es lebt
und ist nichts, als indem und solange es mit Fortgang zu leben und zu seyn
ringt."
Quelle: Projekt Gutenberg (Abruf
09.09.18)
- Kommentar: Es liest sich wie eine Tatsachenbehauptung, aber es kann
eigentlich nur eine Definition (der Individualität) Wilhelm von Humboldts
sein. Die Individualität wird mit dem Triebe gleichgesetzt, ohne dass
erklärt würde, was darunter zu verstehen ist. Völlig unsinnig
erscheint die Behauptung: "das ganze Universum besteht nur durch den Trieb".
Welchem "Trieb" folgen die Sterne, Planeten oder das Licht?
Beispiel Gruppe als
autonom handelndes Subjekt nach Ruth Benedict Urformen der Kultur
"Das von uns untersuchte Benehmen der Gruppe ist allerdings auch das
Benehmen der Einzelperson."
Quelle: aus Mitglied
und Gruppe. Benedict spricht so, als sei die Gruppe ein eigenständiges
autonomes Subjekt, das sich "benimmt".
Geschichte
Begriff, Begriffsanalyse und Gebrauchsbeispiele in der Geschichtswissenschaft.
Der deutsche Geist als autonom handelndes Subjekt
"Noch war es nicht so weit! Der deutsche
Geist (BMautonS)
blieb auf der Bahn der reinen Wissenschaft
(BMwissB), auf der ihm
Liebig und Wöhler durch Begründung der organischen Chemie so
großen Erfolg gesichert hatten; der deutsche
Geist (BMautonS)
hat während dieses Jahrhunderts auf dem Gebiete des reinen Denkens
in Carl Friedrich Gauß einen Gelehrten von höchstem Range hervorgebracht,
der neben Newton immer als ein Ebenbürtiger genannt werden wird."
Quelle S. 258: Schnabel, Franz (1965) Deutsche Geschichte
im neunzehnten Jahrhundert. Die Erfahrungswissenschaften. Freiburg: Herder.
- Kommentar: Der deutsche Geist ist kein autonom handelndes Subjekt,
das bleiben oder oder hervorbringen kann, sondern eine Konstruktion
der Menschen. Zumindeste wäre zu zeigen, wie der deutsche Geist handeln
und wirken kann.
Kognitionswissenschaft
Begriff, Begriffsanalyse und Gebrauchsbeispiele in den Kognitionswissenschaften.
Kommunikation und Sprache
Begriff, Begriffsanalyse und Gebrauchsbeispiele in den Kommunikationswissenschaften.
Sprache "ist die allumfassende Vorausgelegtheit
der Welt."
Quelle (S.79): Gadamer, Hans Georg (1993) Hermeneutik
II. Wahrheit und Methode. Ergänzungen, Register. Tübingen: Mohr.
- Kommentar: Gemeint ist wohl dass unsere Sprache immer schon da ist,
dass wir in sie hineinwachsen und dass sich die Welt durch unsere Sprache
erschließt. So ist es zumindest für unaufgeklärte, naive
Menschen. Für WissenschaftlerInnen und PhilosophInnen sollte das nicht
so sein.
GHM234 Das Verstehen nach H. M. Graumann
"Da Verstehen seinem Wesen nach ein unselbständiger Akt ist, müssen wir erstens zwischen solchen Bedingungen, die notwendig für ein Verstehen bestehen, und solchen, die eine mögliche Grundlage für es abgeben und es dadurch modifizieren können, unterscheiden."
Quelle S. 234: Graumann, H. M. (1976) Das Verstehen. Versuch einer historisch-kritischen Einleitung in die Phänomenologie des Verstehens. In: Balmer, H. (1976, Hrsg.) Psychologie des 20. Jahrhunderts, Bd. I. Kindler, Zürich, S 159–271 (Ersterscheinung als Inauguraldissertation: München, 1924)
- Kommentar: Verstehen wird in diesem Zitat als selbständiger Begriff
verwendet. Daran knüpfen sich einige Fragen:
- Wo in der Welt kann man dieses "Verstehen" finden?
- Findet sich dieses Verstehen bei allen Menschen?
- Wie stellt man dieses Verstehen bei den Menschen fest?
- In allen soziokulturellen Bezugsgruppen oder Gebieten?
- Über alle Zeiten hinweg?
- Über alle Altersgruppen hinweg?
Unselbständiger Akt: Der Sachverhalt wird behauptet, aber nicht erklärt und begründet.
Notwendige Bedingungen für ein Verstehen: Die notwendigen Bedingungen werden weder genannt noch belegt und begründet.
Bedingungen für eine mögliche Grundlage eines Verstehens: Die Bedingungen für eine mögliche Grundlage werden weder genannt noch belegt oder begründet.
Modifizieren können: Was heißt und wie geht modifizieren können? Auch das bleibt völlig offen, dunkel, nicht belegt und nicht begründet.
Fazit: Es handelt sich um einen scheinwissenschaftlichen Text, der bei genauer Betrachtung in höchstem Maße unverständlich ist. Und das ausgerechnet bei einem wissenschaftlichen Text, der Verstehen zum Thema hat.
_
Bewusstseinsprotokoll von Charles SandersPeirce
(1903)
Als ich mich mit der Semiotik von
Peirce beschäftigte, stieß ich zu meiner positiven
Überraschung zufällig auf ein Bewusstseinsprotokoll [eingerückt]
des Autors.
"III. Einige richtungweisende Ideen
für die Logik
1. Das Phaneron und die Kategorien (H)
In der Gesamtheit alles dessen, was sich in unserem Geist befindet -
diese Gesamtheit nenne ich das Phaneron und dies ist notwendigerweise und
mit Absicht ein vager Terminus -, können wir eine Vielfalt von Bestandteilen
erkennen, und wir stellen auch fest, daß sie von ganz unterschiedlicher
Natur sind. Um diese beiden Bemerkungen der Gefahr des Mißverständnisses
zu entheben, wird der Verfasser jetzt einige der Dinge niederschreiben,
die sich während der letzten Minuten in seinem Geist vollzogen.
- Da er ein wenig seiner üblichen Gesundheit
entbehrte, war er sich bestimmter Empfindungen im Rumpf seines Körpers
bewußt. Doch die köstlich kühle Wärme des Junivormittags,
der taumelnde Sonnenschein, der mit den Schatten des grünen Buschwerks
vor seinem Fenster spielte, die absolute Stille seines Arbeitszimmers,
riefen in ihm Gefühle der Freude und Dankbarkeit hervor. Dann kam
ihm die Idee, daß all dies zu eigennützig und zu müßig
sei. Zweifellos machte er eine intensive Anstrengung, diese Sätze
zu bilden und niederzuschreiben - keine so leichte Aufgabe wie man vielleicht
annimmt. Er konnte nicht sagen, daß er sich unmittelbar dieser Anstrengung
bewußt war, so wie er sich jener Gefühle bewußt war. Ein
Gefühl zu haben und sich seiner nicht bewußt zu sein würde
heißen, gleichzeitig zu fühlen und nicht zu fühlen. Das
ergibt nur Unsinn. Aber es ist in jeder Hinsicht möglich, eine intensive
Anstrengung aufzubringen, ohne sich ihrer überhaupt bewußt zu
sein; eine solche Anstrengung ist besonders wirksam. Nicht, daß dann
überhaupt nichts im Geist geschieht, insbesondere, wenn es sich um
geistige Anstrengung handelt. Was ist nun die besondere Qualität des
Bewußtseins von Anstrengung? Es entsteht eine Art von Überlagerung
der Vorstellung des Zustands, den man herbeiführen will, über
die Wahrnehmung des Zustands, den man beseitigen möchte. Ich überlasse
es den Psychologen, genauer zu beschreiben, was dies für eine Qualität
des Bewußtseins ist. Im Moment reicht es aus festzustellen, daß
es [>52] eine Art verdoppelte Vorstellung ist. Wir denken nach über
das uns gegebene Aktuale, wobei dies uns vermittelt wird durch ein transparentes
Vorstellungsbild des erstrebten Objekts. Wir nehmen die Zeit vorweg, zu
der das erstrebte Objekt wahrnehmbar sein wird, wobei der dann überwundene
Zustand hinter ihm in die Erinnerung zurücktritt.
Doch die Gedanken des Verfassers wanderten weiter, zu einem der folgenden Teile dieses Buchs, der, so schien es ihm, nicht im richtigen Zusammenhang und ohne harmonische Verbindung mit dem Rest stand. Er versuchte darüber nachzudenken, was er dagegen unternehmen könnte. Doch nachdem er die Angelegenheit einige wenige Momente bedacht hatte, wurde ihm klar, daß gerade die besondere Eigenheit des Teils, von dem er gedacht hatte, daß er den Zusammenhang stören würde, ganz im Gegenteil dem Ganzen eine weitaus stärkere Konsistenz verleihen würde, wenn man sie nur auf bestimmte Weise entwickelte. Daraufhin faßte er den Entschluß, diese Eigenheit so zu entwickeln, und er bemühte sich, dieses Ziel in seinen Plan einzubauen. Worin bestand aber nun diese seine geistige Handlung des Einbauens? Seine Seele lehrte sich selbst einen Trick, fast so wie er einen Hund oder einen Papagei unterrichten würde. Das war sicherlich nicht nur bloße Empfindung; und es war in seiner Beschaffenheit der Unruhe der Anstrengung ganz entgegengesetzt. Denn dies war, im Gegensatz zu jener Anstrengung, ein angenehmer und zufriedenstellender Vorgang.
Wenn wir alles im Geist Enthaltene, ob nun Gefühle,
Zwänge oder Anstrengungen, Gewohnheiten oder Gewohnheitsänderungen
oder von welcher anderen Art auch immer es sein mag, mit dem Namen Bestandteile
des Phaneron bezeichnen, dann können wir ganz offensichtlich feststellen,
daß sich beliebige andere Dinge nicht mehr voneinander unterscheiden
können als sich Bestandteile des Phanerons voneinander unterscheiden;
da wir, was immer wir überhaupt wissen, durch die Bestandteile des
Phaneron wissen und da wir nicht irgendwelche Dinge unterscheiden können,
wenn wir uns nicht irgenwelche \g Vorstellungen von ihnen machen."
- Kommentar zu Peirces Bewusstseinsprotokoll (1903)
> Protokolliertes Denken.
Peirce gibt seine Bewusstseinsvorgänge, im wesentlichen denken, von einigen Minuten wieder, wobei an manchen Stellen nicht ganz klar ist, ob hier orginale Inhalte des Bewusstseinsstroms wiedergegeben werden oder ob nicht eine Metabetrachtung im Nachhinein wiedergegeben wird, z.B. hier:
- "... keine so leichte Aufgabe wie man vielleicht annimmt. Er konnte
nicht sagen, daß er sich unmittelbar dieser Anstrengung bewußt
war, so wie er sich jener Gefühle bewußt war. Ein Gefühl
zu haben und sich seiner nicht bewußt zu sein würde heißen,
gleichzeitig zu fühlen und nicht zu fühlen. Das ergibt nur Unsinn."
Neurowissenschaft und Gehirnforschung
Begriff, Begriffsbildung und Gebrauchsbeispiele in der Neurowissenschaft und Gehirnforschung.
Das Gehirn als handelndes Subjekt
In der Hirnforschung herrscht Begriffsebenenchaos (> Janich,
2009). Ein Kategorienfehler reiht sich an den anderen, oft werden die
biologisch-medizinischen mit den psychologischen Begriffebenen vermengt
und durcheinander gebracht. Es fehlt an den einfachsten Grundtugenden des
wissenschaftlichen
Arbeitens, so wird völlig unbekümmert drauflos schwadroniert,
ohne es zu bemerken. Die erste wissenschaftstheoretische Aufgabe der Hirnforschung
wäre, die Terminologie der verschiedenen Begriffsebenen in einem Grundmodell
vernünftig und kritisch aufzubereiten.
"Wie arbeitet unser Gehirn?Was tut es eigentlich"
(BMautonS),
(BMnwKF).
Quelle S. 1: Greenfield, Susan A. (2007) Das erstaunliches
Organ der Welt. In (1-26) Sentker, Andreas & Wigger, Frank (2007, Hrsg.)
Rätsel Ich. Gehirn, Gefühl, Bewusstsein. Zeit Wissen Edition.
Berlin: Springer.
- Kommentar: Das Gehirn, biologisch-medizinischer Begriff, ist kein handelndes
Subjekt, das etwas tut oder lässt. Hier wird sozusagen wegweisend
auf S. 1 des Buches der grundlegende Kategorienfehler der Hirnforschung
demonstriert.
"Das Gedaechtnis luegt "
(BMautonS), (BMnwKF).
Quelle S 27: Schumacher, Andrea (2007) Das betrogene
Ich. In (27-33) Sentker, Andreas & Wigger, Frank (2007, Hrsg.) Rätsel
Ich. Gehirn, Gefühl, Bewusstsein. Zeit Wissen Edition. Berlin: Springer.
- Kommentar: Das Gedächtnis ist kein autonom handelndes Subjekt,
das bewusst und mit Absicht die Unwahrheit sagt. Das Gedächtnis spricht
überhaupt nicht. Auch der 2. Artikel bringt wie der erste gleich zu
Beginn diesen Kategorienfehler.
"Das Bewusstsein macht das
Leib-Seele-Problem erst zu einer wirklich schwierigen Sache." (BMunklar)
Quelle S. 35: Koch, Christof (2007) Das Rätsel
des Bewusstseins. In (35-55) Sentker, Andreas & Wigger, Frank (2007,
Hrsg.) Rätsel Ich. Gehirn, Gefühl, Bewusstsein. Zeit Wissen Edition.
Berlin: Springer.
- Kommentar: Das Eingangszitat von Nagel ist eine interessante Formulierung.
Rein formal-sprachlich enthält es den für den für die Neurowissenschaft
und Gehirnforschung so typischen Kategorienfehler. Man weiß natürlich,
was gemeint ist. Aber formal-sprachlich wird trotzdem suggeriert, als machte
das Bewusstsein etwas, nämlich eine schwierige Sache für das
Leib-Seele-Problem zu sein. Das Bewusstsein, ein Projektionsraum für
das Erleben, macht gar nichts. Es ist da und funktioniert so oder so. Besser
wäre es gewesen zu sagen: Durch das Bewusstsein wird das Leib-Seele-Problem
aus meiner (Thomas Nagel) Sicht zu einer schwierigen Sache.
"Narzissmus unseres Gehirns"
Quelle S. 143: Fine, Cordelia (2007) Das unmoralische
Gehirn. In (129-147) Sentker, Andreas & Wigger, Frank (2007, Hrsg.)
Rätsel Ich. Gehirn, Gefühl, Bewusstsein. Zeit Wissen Edition.
Berlin: Springer.
- Kommentar: Das Gehirn ist weder narzisstisch noch unmoralisch. Hier
werden die biologisch-medizinischen und psychologischen Kategorien vermischt.
Damasio:
Das Gehirn "veranlasst".
_
Ein Kognitives
System ergruendet sich selbst
"Die Erforschung des menschlichen Gehirns ist
ein eigentümliches, weil letztlich zirkuläres Unterfangen. Ein
kognitives
System versucht sich selbst zu ergründen (BMautonS),
indem es sich im Spiegel naturwissenschaftlicher Beschreibungen betrachtet.
(BMautonS)"
Quelle S.9: Singer, Wolf (2002)
Auf dem Weg nach innen. 50 Jahre Hirnforschung in der Max Planck Gesellschaft.
In (9-33) Singer, Wolf (2002) Der Beobachter im Gehirn. Frankfurt
aM: Suhrkamp.
- Kommentar: Ein kognitives System ist kein selbständig
handelndes Subjekt, sondern in einem Menschen lokalisiert. Es ergründet
sich nicht selbst und betrachtet sich auch nicht im Spiegel.
Wie gelangt
Wissen über die Welt in das Gehirn?
"Es soll der Frage nachgegangen werden, wie
Wissen über die Welt in das Gehirn gelangt (), wie
es dort verankert wird und wie es bei der Wahrnehmung der Welt genutzt
wird, um diese zu ordnen."
Quelle S.87 : Singer,
Wolf (2002) Neurobiologische Anmerkungen zum
Konstruktivismus-Diskurs
In
(87-111) Singer, Wolf (2002) Der Beobachter im Gehirn. Frankfurt
aM: Suhrkamp.
- Kommentar: Woher soll Wissen über die Welt in das Gehirn
gelangten? Wird es nicht im Gehirn erzeugt? In der Frage stecken zwei unterschiedliche
Begriffsebenen: die psychologische, wenn von Wissen die Rede ist
und die biologisch-medizinische, wenn vom Gehirn gesprochen wird.
S. 111 beantwortet die Eingangsfrage am Ende im Sinne des Konstruktivismus: "Wie versucht wurde zu zeigen, tun wir gut daran, uns das Gehirn als distributiv organisiertes, hochdynamisches System vorzustellen, das sich selbst organisiert (), anstatt seine Funktionen einer zentralistischen Bewertungs- und Entscheidungsinstanz unterzuordnen; als System, das sich seine Kodierungsräume gleichermaßen in der Topologie seiner Verschaltung und in der zeitlichen Struktur seiner Aktivitätsmuster erschließt, das Relationen nicht nur über Konvergenz anatomischer Verbindungen, sondern auch durch zeitliche Koordination von Entladungsmustern auszudrücken weiß, das Inhalte nicht nur explizit in hochspezialisierten Neuronen, sondern auch implizit in dynamisch assoziierten Ensembles repräsentieren kann und das schließlich auf der Basis seines Vorwissens unentwegt Hypothesen über die es umgebende Welt formuliert, also die Initiative hat, anstatt lediglich auf Reize zu reagieren. Insoweit entspricht die neue Sicht, mit der unser Gehirn seinesgleichen beurteilt, durchaus einer konstruktivistischen Position."
Philosophie
Begriff, Begriffsbildung und Gebrauchsbeispiele in der Philosophie.
Die fatalste Geistes-Krankheit im wahrsten Sinne des Wortes findet
sich im philosophischen Idealismus, wo zum grundlegenden Postulat oder
Dogma wurde, dass bloßes Nachdenken zu wissenschaftlichen Erkenntnissen
führen kann jenseits von Empirie, Beobachtung, Experiment, fundierten
und klaren Definitionen. Als Anführer oder Begründer dieser Geistes-Krankheit
im wahrsten Sinne des Wortes kann Platon gelten - im Gegensatz zu Aristoteles.
Aber auch die Kritiker und Gegner sind nicht frei davon. Der radikalste
Kritiker dieser Geistes-Krankheit, der sie auch für eine solche
hält, ist Max Stirner,
aber auch Rosenzweigs Kritik
ist fundamental.
_
Fichte
- Wissenschaftslehre zitiert nach Zeno.org
(Abruf 13.09.18)
Johann Gottlieb Fichte Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie
"§ 1. Hypothetisch aufgestellter Begriff der Wissenschaftslehre
[38] Um getheilte Parteien zu vereinigen, geht man am sichersten von dem aus, worüber sie einig sind.
Die Philosophie ist eine Wissenschaft (BMBeleg-); – darüber sind alle (BMzweifel-) Beschreibungen der Philosophie so übereinstimmend (BMBeleg-), als sie in der Bestimmung des Objects dieser Wissenschaft getheilt sind. Und wie, wenn diese Uneinigkeit daher gekommen wäre, dass der Begriff der Wissenschaft selbst, für welche sie einmüthig die Philosophie anerkennen, nicht ganz entwickelt (BMDefCha-) war? Wie wenn die Bestimmung, dieses einzigen von allen zugestandenen Merkmals völlig hinreichte, den Begriff der Philosophie selbst zu bestimmen (BMuonS-)?
Eine Wissenschaft hat systematische Form; alle Sätze in ihr hängen in einem einzigen Grundsatze zusammen (BMBeleg-), und vereinigen sich in ihm zu einem Ganzen (BMBeleg-) – auch dieses, gesteht man allgemein zu (BMBeleg-). Aber ist nun der Begriff der Wissenschaft (BMDefCha-) erschöpft?
... ... ..."
Querverweise:
Gadamer
- Die Philosophie als autonomes
Subjekt bei Gadamer (Hervorhebung fett-kursiv von R. S.)
Gadamer (1970) Kapitel 7. Begriffsgeschichte als Philosophie, in Hermeneutik II, S. 77:
"Das Thema »Begriffsgeschichte als Philosophie« erweckt den Anschein, als ob hier eine sekundäre Fragestellung und eine Hilfsdisziplin des philosophischen Denkens zur Unangemessenheit eines universalen Anspruchs aufgehöht \g würde. Denn das Thema enthält die Behauptung, Begriffsgeschichte sei Philosophie oder vielleicht sogar, Philosophie solle Begriffsgeschichte sein. Beides sind ohne Zweifel Thesen, deren Rechtfertigung und Begründung nicht auf der Hand liegt und denen wir uns deswegen prüfend zuzuwenden haben.
In jedem Falle liegt in der Formulierung des Themas eine implizite Aussage über das, was Philosophie ist, nämlich daß ihre Begrifflichkeit ihr Wesen ausmacht — im Unterschiede zu der Funktion der Begriffe in den Aussagen der »positiven Wissenschaften. Während diese die Gültigkeit ihrer Begriffe jeweils an dem Erkenntnisgewinn messen, der durch Erfahrung kontrollierbar ist, hat offenbar die Philosophie in diesem Sinne keinen Gegenstand. Damit fängt die Fragwürdigkeit der Philosophie an. Kann man überhaupt ihren Gegenstand angeben, ohne daß man schon in die Frage nach der Angemessenheit der Begriffe, die man dabei gebraucht, verwickelt ist? Was heißt »angemessen« dort, wo man nicht einmal weiß, woran man messen soll?
Die philosophische Tradition des Abendlandes allein kann auf diese Frage eine geschichtliche Antwort enthalten. Nur sie können wir befragen. Denn die rätselhaften Aussageformen von Tiefsinn und Weisheit, die in anderen Kulturen, insbesondere des Fernen Ostens, entwickelt worden sind, stehen mit dem, was abendländische Philosophie heißt, in einem letzten Endes nicht überprüfbaren Verhältnis, insbesondere deshalb, weil die Wissenschaft, in deren Namen wir fragen, selber eine abendländische Entdeckung ist. Wenn es nun so ist, daß die Philosophie keinen eigenen Gegenstand hat, an dem sie sich mißt (BMautonS) und dem sie sich mit ihren Mitteln des Begriffs und der Sprache anmißt, heißt das dann nicht, daß der Gegenstand der Philosophie der Begriff selbst ist? Der Begriff, das ist das wahre Sein, so wie wir [R. S. ?] ja das Wort »Begriff« zu gebrauchen pflegen. ... "
Quelle (S.77): Gadamer, Hans Georg (1993) Hermeneutik II. Wahrheit und Methode. Ergänzungen, Register. Tübingen: J. C. B. Mohr.
- Kommentar: "Die" Philosophie ist eine Schöpfung des menschlichen
Geistes, daher tut sie nichts. Das mögen Philosophen denken oder tun
wie offenbar Gadamer, aber diese Sprache ist schlicht und einfach falsch
und lässt hinsichtlich der Aufklärung nichts Gutes ahnen.
Gadamer die Philosophie meint
"... Die Philosophie als die Wissenschaft, die wir hier suchen, hat keinen so umgrenzten Gegenstand. Sie meint das Sein als solches (BMautonS), und es verknüpft sich mit dieser Frage nach dem Sein als solchem der Blick auf sich voneinander unterscheidende Weisen zu sein: das unveränderlich Ewige (BMBeleg-) und Göttliche, das sich ständig Bewegende, die Natur, das sich bindende Ethos, der Mensch. ..."
Quelle (S.78): Gadamer, Hans Georg (1993) Hermeneutik II. Wahrheit und Methode. Ergänzungen, Register. Tübingen: J. C. B. Mohr.
- Kommentar: Die Philosophie ist eine Schöpfung des menschlichen
Geistes, sie ist kein selbständiges Subjekt und meint daher gar nichts.
Gadamer hingegen meint das. Aber Gadamer ist nicht die Philosophie,
er ist nur ein Philosoph.
Metaphysik der Erkenntnis
(MdE)
- Hypostasisch-homunkuleske
Konstruktionen
MdE-S.287: "Die Bildung ontologischer Begriffe bietet natürlich eine Reihe von Schwierigkeiten dar. Der Gegenstand leistet (BMautonS) ihr durch seine Fernstellung und Abgekehrtheit eine ganz spezifische Art von Widerstand."
- Kommentar: Der Gegenstand leistet keinen Widerstand,
weil er kein hypostasisch-homunkuleskes Subjekt ist. Das erkennende
Subjekt erlebt vielleicht einen Widerstand, weil es sich mit Erkennen schwer
tut.
- Kommentar: Die Ontologie vollzieht gar
nichts. Ontologie ist eine Schöpfung des menschlichen Geistes, um
die Welt zu strukturieren. Und auch die Kategorien sind eine Schöpfung
des menschliches Geistes und kein autonomes, hypostasisch-homunkuleskes
Subjekt.
Seele getragen-autonomes Sein
Nicolai Hartmann (1962), S. 16: "Das seelische Sein ist zwar getragenes Sein (BMunklar), (BMungen) aber in seiner Eigenart ist es bei aller Abhängigkeit autonom (BMungen), (BMwid)."
Quelle: Hartmann, Nicolai (1962) Das Problem des geistigen Seins, Untersuchungen zur Grundlegung der Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften. 3. A. Berlin: De Gruyter.
- Kommentar: Obwohl es getragen ist, ist es autonom? Hier wären
Erklärungen und Belege geboten.
Hegel
Hegel, hochgebildet, aber durch und durch naiv-unkritisch, identifizierte - idealistisch entrückt - Sein und Geist als eines, was ihm Referenzieren und echtes Forschen ersparte. Wissenschaftliches Arbeiten war ihm völlig fremd. Er hielt sich und sein eigenes Denken für die Wissenschaft und Wirklichkeit - wie später Freud (>Junktim) und die PsychoanalytikerInnen. Sein Glaube, mit seinem System sei die wissenschaftliche Entwicklung und Philosophie abgeschlossen, ist ein guter Kandidat für eine paranoide Größenidee wie seine Systematik für ein Wahnsystem. Dazu passt auch, dass, was er dachte, für die Wirklichkeit schlechthin zu halten. Immerhin: seine Grundidee dass alles Existierende seinen Gegensatz enthält, und aus der Auseinandersetzung und Entwicklung dieses Gegensatzes das Werden, die Bewegung und die Veränderung entsteht, ist originell und kreativ. Aber seine Ausführungen und Erklärungen sind völlig unzulänglich und konfus, so dass sein System als Mischung aus fehlendem wissenschaftlichen Grundverständnis, philosophischer science fiction, Geisteslyrik und Wahn anzusehen ist - bestenfalls als Anregung für die eine oder andere Hypothese tauglich.
- Wissenschaft der Logik (Zitate
nach Zeno.org, Abruf 11.09.18)
- Hegel beginnt seine Logik mit der sinnvollen Frage:
"Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden (>Kamlah ...) ? In neueren Zeiten erst ist das Bewußtsein entstanden, daß es eine Schwierigkeit sei, einen Anfang in der Philosophie (BMBeleg-) zu finden, und der Grund dieser Schwierigkeit sowie die Möglichkeit, sie zu lösen, ist vielfältig besprochen worden. Der Anfang der Philosophie muß entweder ein Vermitteltes oder Unmittelbares sein, und es ist leicht zu zeigen (BMBeleg-), daß er weder das eine noch das andere sein könne (BMwid); somit findet die eine oder die andere Weise des Anfangens ihre Widerlegung."
- Kommentar: Anfangen geht also weder so noch anders, also gar
nicht, damit könnte Hegel an dieser Stelle bereits aufhören.
Keine der beiden Thesen wird belegt, sondern nur behauptet.
Stillschweigend wird das Anfangsproblem der Wissenschaft mit dem der Philosophie gleichgesetzt.
Eigentlich sollte der Anfang schon vor Jahrtausenden gemacht sein und man sollte aufeinander aufbauen können. Das dies seit Jahrtausenden immer noch nicht der Fall ist, zeigt, dass mit der Philosophie und ihrer Institutionalisierung an den Universitäten etwas grundsätzliches nicht stimmen kann. Hier gibt es kein auf den Schultern seiner Vorgänger stehen und aufeinander aufbauen: 1000 Philosophen, 1000 Lehren und jeder fängt von vorne an.
An den Anfang gehören natürlich (1) die Ziele, die man verfolgt und (2) die Methoden, mit denen man sie erreichen will. (3) Dazu gehört natürlich eine klare Terminologie mit Beschreibungen, Definitionen und Begründungen der wichtigen Begriffe und Sätze, die man benutzt. (4) Und schließlich gehört dann gezeigt, wie es geht. Es müssen Sätze aufgestellt werden, die zu beweisen sind. So geht im allgemeinen Wissenschaft.
"A. Sein
[82] Sein, reines Sein (BMunklar),
– ohne alle weitere Bestimmung. In seiner unbestimmten Unmittelbarkeit
(BMunklar) ist es nur
sich selbst gleich und auch nicht ungleich gegen Anderes (BMwidfrei-),
hat keine Verschiedenheit innerhalb seiner noch nach außen (BMfragl),
(BMwidfrei-). Durch irgendeine
Bestimmung oder Inhalt, der in ihm unterschieden oder wodurch es als unterschieden
von einem Anderen gesetzt würde, würde es nicht in seiner Reinheit
festgehalten. Es ist die reine Unbestimmtheit und Leere. – Es ist nichts
in ihm anzuschauen, wenn von Anschauen hier gesprochen werden kann; oder
es ist nur dies reine, leere Anschauen selbst. Es[82] ist ebensowenig etwas
in ihm zu denken, oder es ist ebenso nur dies leere Denken. Das Sein, das
unbestimmte Unmittelbare ist in der Tat Nichts und nicht mehr noch weniger
als Nichts."
- Kommentar: Das liest nicht nicht wie der Anfang einer Wissenschaft
der Logik, sondern der Ontologie. Wenn man über das reine Sein nichts
bestimmen oder feststellen kann, wieso kann man dann von ihm und über
es sprechen? Dass es in sich gleich ist, erscheint trivial. Da es nicht
verschieden sein soll von anderem, heißt es eigentlich, es gibt gar
kein anderes. "Es ist die reine Unbestimmtheit und Leere". Liest sich wie:
das
Sein ist das Nichts und das Nichts ist das Sein, alles ist Nirwana.
"B. Nichts
[83] Nichts, das reine Nichts; es ist einfache Gleichheit mit sich
selbst, vollkommene Leerheit, Bestimmungs- und Inhaltslosigkeit; Ununterschiedenheit
in ihm selbst. – Insofern Anschauen oder Denken hier erwähnt werden
kann, so gilt es als ein Unterschied, ob etwas oder nichts angeschaut oder
gedacht wird. Nichts Anschauen oder Denken hat also eine Bedeutung; beide
werden unterschieden, so ist (existiert) Nichts in unserem Anschauen oder
Denken; oder vielmehr ist es das leere Anschauen und Denken selbst und
dasselbe leere Anschauen oder Denken als das reine Sein. – Nichts ist somit
dieselbe Bestimmung oder vielmehr Bestimmungslosigkeit und damit überhaupt
dasselbe, was das reine Sein ist."
- Kommentar: Nichts gleicht sich. Nichts ist also Nichts. Hegel sagt
uns nicht, wie das Nichts denken geht.
"a. Einheit des Seins
und Nichts
[83] Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. Was die
Wahrheit ist, ist weder das Sein noch das Nichts, sondern daß das
Sein in Nichts und das Nichts in Sein – nicht übergeht, sondern übergegangen
ist. Aber ebensosehr ist die Wahrheit nicht ihre Ununterschiedenheit, sondern
daß sie nicht dasselbe, daß sie absolut unterschieden, aber
ebenso ungetrennt und untrennbar sind und unmittelbar jedes in seinem Gegenteil
verschwindet. Ihre Wahrheit ist also diese Bewegung des unmittelbaren Verschwindens
des einen in dem anderen: das Werden; eine Bewegung, worin beide unterschieden
sind, aber durch einen Unterschied, der sich ebenso unmittelbar aufgelöst
hat."
- Kommentar: Geisteslyrik.
Begriff des Begriffs
"Es ergibt sich hieraus für den Begriff sogleich folgende nähere Bestimmung. Weil das Anundfürsichsein unmittelbar als Gesetztsein ist, ist der Begriff in seiner einfachen Beziehung auf sich selbst absolute Bestimmtheit, aber welche ebenso als sich nur auf sich beziehend unmittelbar einfache[251] Identität ist. Aber diese Beziehung der Bestimmtheit auf sich selbst, als das Zusammengehen derselben mit sich, ist ebensosehr die Negation der Bestimmtheit, und der Begriff ist als diese Gleichheit mit sich selbst das Allgemeine. Aber diese Identität hat so sehr die Bestimmung der Negativität; sie ist die Negation oder Bestimmtheit, welche sich auf sich bezieht; so ist der Begriff Einzelnes. Jedes von ihnen ist die Totalität, jedes enthält die Bestimmung des Anderen in sich, und darum sind diese Totalitäten ebenso schlechthin nur eine, als diese Einheit die Diremtion \g ihrer selbst in den freien Schein dieser Zweiheit ist – einer Zweiheit, welche in dem Unterschied des Einzelnen und Allgemeinen als vollkommener Gegensatz erscheint, der aber so sehr Schein ist, daß, indem das eine begriffen und ausgesprochen wird, darin das andere unmittelbar begriffen und ausgesprochen ist.
Das soeben Vorgetragene ist als der Begriff des Begriffes zu betrachten. Wenn derselbe von demjenigen abzuweichen scheinen kann, was man sonst unter Begriff verstehe, so könnte verlangt werden, daß aufgezeigt würde, wie dasselbe, was hier als der Begriff sich ergeben hat, in anderen Vorstellungen oder Erklärungen enthalten sei. Einerseits kann es jedoch nicht um eine durch die Autorität des gewöhnlichen Verstehens begründete Bestätigung zu tun sein; in der Wissenschaft des Begriffes kann dessen Inhalt und Bestimmung allein durch die immanente Deduktion bewährt werden, welche seine Genesis enthält und welche bereits hinter uns liegt. Auf der ändern Seite muß wohl an sich in demjenigen, was sonst als der Begriff des Begriffs vorgelegt wird, der hier deduzierte zu erkennen sein. Aber es ist nicht so leicht, das aufzufinden, was andere von der Natur des Begriffes gesagt haben. Denn meistens befassen sie sich mit dieser Aufsuchung gar nicht und setzen voraus, daß jeder es schon von selbst verstehe, wenn man von dem Begriffe spreche. Neuerlich konnte man sich der Bemühung mit dem Begriffe um so mehr überhoben glauben, da, wie es eine Zeitlang Ton war, der Einbildungskraft, dann dem Gedächtnisse[252] alles mögliche Schlimme nachzusagen, es in der Philosophie seit geraumer Zeit zur Gewohnheit geworden und zum Teil noch gegenwärtig ist, auf den Begriff alle üble Nachrede zu häufen, ihn, der das Höchste des Denkens ist, verächtlich zu machen und dagegen für den höchsten sowohl szientifischen als moralischen Gipfel das Unbegreifliche und das Nichtbegreifen anzusehen."
"A. Der allgemeine Begriff
[274] Der reine Begriff ist das absolut Unendliche, Unbedingte und
Freie. Es ist hier, wo die Abhandlung, welche den Begriff zu ihrem Inhalte
hat, beginnt, noch einmal nach seiner Genesis zurückzusehen. Das Wesen
ist aus dem Sein und der Begriff aus dem Wesen, somit auch aus dem Sein
geworden. Dies Werden hat aber die Bedeutung des Gegenstoßes seiner
selbst, so daß das Gewordene vielmehr das Unbedingte und Ursprüngliche
ist. Das Sein ist in seinem Übergange zum Wesen zu einem Schein oder
Gesetztsein und das Werden oder das Übergehen in Anderes zu einem
Setzen geworden, und umgekehrt hat das Setzen oder die Reflexion des Wesens
sich aufgehoben und sich zu einem Nichtgesetzten, einem ursprünglichen
Sein hergestellt. Der Begriff ist die Durchdringung dieser Momente, daß
das Qualitative und ursprünglich Seiende nur als Setzen und nur als
Rückkehr-in-sich ist und diese reine Reflexion-in-sich schlechthin
das Anderswerden oder die Bestimmtheit ist, welche ebenso daher unendliche,
sich auf sich beziehende Bestimmtheit ist.
Der Begriff ist daher zuerst so die absolute Identität
mit sich, daß sie dies nur ist als die Negation der Negation oder
als die unendliche Einheit der Negativität mit sich selbst. Diese
reine Beziehung des Begriffs auf sich, welche dadurch[274] diese Beziehung
ist, als durch die Negativität sich setzend, ist die Allgemeinheit
des Begriffs.
Die Allgemeinheit, da sie die höchst einfache
Bestimmung ist, scheint keiner Erklärung fähig zu sein; denn
eine Erklärung muß sich auf Bestimmungen und Unterscheidungen
einlassen und von ihrem Gegenstande prädizieren; das Einfache aber
wird hierdurch viel mehr verändert als erklärt. Es ist aber gerade
die Natur des Allgemeinen, ein solches Einfaches zu sein, welches durch
die absolute Negativität den höchsten Unterschied und Bestimmtheit
in sich enthält. Das Sein ist einfaches, als unmittelbares; deswegen
ist es ein nur Gemeintes und kann man von ihm nicht sagen, was es ist;
es ist daher unmittelbar eins mit seinem Anderen, dem Nichtsein. Eben dies
ist sein Begriff, ein solches Einfaches zu sein, das in seinem Gegenteil
unmittelbar verschwindet; er ist das Werden. Das Allgemeine dagegen ist
das Einfache, welches ebensosehr das Reichste in sich selbst ist, weil
es der Begriff ist.
..."
Quelle: Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke. Band
6, Frankfurt a. M. 1979, S. 274-280. Auch: Permalink: http://www.zeno.org/nid/20009178716.
Lizenz: Gemeinfrei
Name und Begriff - Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften
im Grundrisse, § 462
"Der Name als Existenz des Inhalts in der Intelligenz ist die Äußerlichkeit
ihrer selbst in ihr, und die Erinnerung des Namens als der von ihr hervorgebrachten
Anschauung ist zugleich die Entäußerung, in der sie innerhalb
ihrer selbst sich setzt." [Quelle]
- Kommentar: Schwieriger Text, der einige Fragen aufwirft: (1) Was ist
unter Äußerlichkeit der Intelligenz zu verstehen? (2) was heißt
Äußerlichkeit ihrer selbst in ihr? Wieso ist die Äußerlichkeit
in ihr?
Der Name ist nicht die Existenz des Inhalts, sondern, wie der Name "Name" schon nahelegt, der Name. Der Name (BMName) steht . ist Zeichenreferenz - für den Inhalt (>Definition Begriff). Die Intelligenz bringt nichts hervor, erinnert nicht und "setzt" nichts. Intelligenz ist eine Konstruktion und kein autonom handelndes Subjekt.
Anmerkung: In Glockners Hegel-Lexikon wird ausgeführt:
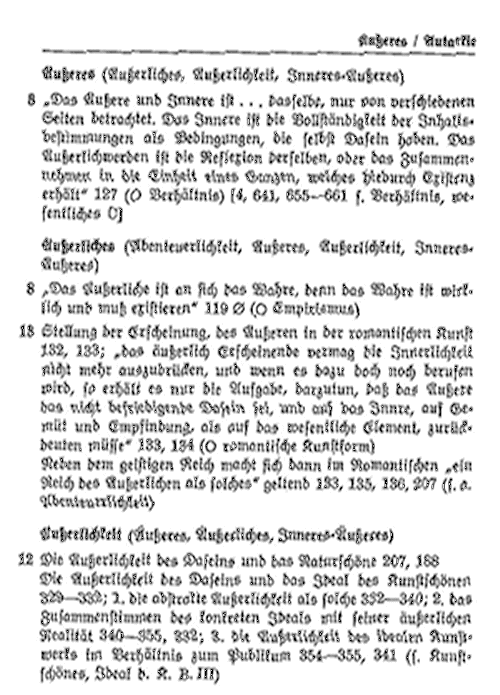
>Hegel
Sämtliche Werke Fundstellen.
"Es ist in Namen, daß wir denken."
Quelle: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften
im Grundrisse, § 462
- Kommentar: Wir denken mit Namen - nicht ausschließlich,
aber auch. Es ist nicht in den Namen, dass wir denken.
_
Japsers > Jaspers, Karl (1947) Der Begriff in (276-282) Von der Wahrheit.
_
Peirce: Erstheit, Zweitheit, Drittheit.
Peirce, Charles S. (orig. 1903, dt. 1983) Phänomen und Logik der Zeichen. Frankfurt aM: Suhrkamp. S. 54ff: () \g
"Kritik des Sprachgebrauchs in den Geistes-,
Sozial- und Kulturwissenschaften
Die Phänomenologie ist jener Zweig der Wissenschaften, der in
Hegels Phänomenologie des Geistes behandelt wird (einem Werk, das
viel zu fehlerhaft ist, als daß man es irgend jemand anderem als
einem reifen Gelehrten empfehlen kann, obwohl es vielleicht das tiefgründigste
Werk ist, das jemals geschrieben wurde). In jenem Werk versucht der Autor
zu klären, was die Elemente oder, wenn man so will, Gattungen der
Elemente sind, die unveränderlich in allem gegenwärtig sind,
was in irgendeinem Sinne im Geist enthalten ist. Nach der Meinung des Verfassers
gibt es drei universale Kategorien. Da alle drei stets gegenwärtig
sind, ist es unmöglich, eine reine Idee von irgendeiner von ihnen
zu haben, die absolut von den anderen unterschieden ist. Ja, selbst so
etwas wie ihre ausreichend klare Unterscheidung, kann nur das Ergebnis
langen und angestrengten Forschens sein. Sie können als Erstheit
(BMDefiniendum),
Zweitheit (BMDefiniendum)und
Drittheit (BMDefiniendum)
bezeichnet werden.
Erstheit ist
das, was so ist, wie es eindeutig und ohne Beziehung auf irgend etwas anderes
ist (BMDefiniens),
(BMfragl), (BMunklar),
(BMBspGeg-).
Zweitheit ist
das, was so ist, wie es ist, weil eine zweite Entität so ist, wie
sie ist, ohne Beziehung auf etwas Drittes (BMDefiniens),
(BMDefiniens), (BMfragl),
(BMunklar), (BMBspGeg-).
Drittheit ist
das, dessen Sein darin besteht, daß es eine Zweitheit
hervorbringt (BMDefiniens),
(BMDefiniens), (BMfragl),
(BMunklar), (BMBspGeg-).
Es gibt keine Viertheit,
die nicht bloß aus Drittheit bestehen
würde.
Von diesen drei Kategorien ist die Zweitheit
am leichtesten verständlich, weil sie das Element ist, das im Auf
und Ab des Lebens am deutlichsten hervortritt (BMunklar).
Wir sprechen von harten Tatsachen (BMunklar).
Diese Härte, dieser Zwang der Erfahrung, ist Zweitheit
(BMunklar). Eine Tür
steht ein wenig offen. Ich versuche sie zu öffnen. Etwas hindert mich
daran. Ich presse mich gegen sie und erfahre ein Gefühl der Anstrengung
und ein Gefühl des Widerstands. Dies sind keine zwei Bewußtseinsformen,
es sind zwei Aspekte eines doppelseitigen Bewußtseins.(BMunklar)
Es ist unvorstellbar, daß es irgendeine Anstrengung ohne Widerstand
geben könnte oder irgendeinen Widerstand ohne die entgegengesetzte
Anstrengung. Dieses doppelseitige Bewußtsein ist Zweitheit
(BMunklar). Alles Bewußtsein,
die gesamte wache Existenz, besteht in einem Gefühl der Reaktion zwischen
Ich und Nicht (BMunklar)-Ich,
obwohl das Gefühl der Anstrengung nicht vorhanden sein muß.
Es ist eine Besonderheit der Zweitheit
(BMunklar), daß
sie sich, in welchem Bereich auch immer, in zwei Formen präsentieren
kann, und diese zwei Formen unterscheiden sich, da die Zweitheit
in dem einen Fall vollständiger verwirklicht ist als in dem anderen.
So ist eine Reaktion, die von einem Gefühl des Bemühtseins begleitet
wird und die wir als von uns verursacht betrachten, eine Willenshandlung.
Die Zweitheit ist dort (BMunklar)
stark. Doch in der Wahrnehmung haben wir ein Gefühl der Reaktion
ohne ein Bemühtsein, von der wir meinen, daß sie den äußeren
[>56] Dingen zuzurechnen ist (BMunklar).
Man kann vielleicht sagen, daß es sich dabei um eine degeneriertea
Form der Zweitheit handelt (BMunklar)"
\g
- Fußnote a : Dieser Ausdruck
wurde von den Geometern übernommen, die von einem Paar gleichflächiger
Strahlen als von einem »degenerierten Kegelschnitt« sprechen.
D. h. die Vorstellung, daß sie einen Kegelschnitt bilden, ist hinzugefügt,
ohne daß dies notwendig wäre.
Kommentar Erstheit
...: Das ist ein Meisterwerk der Unklarheit. Hegel hätte es
kaum besser gekonnt. Und es passt so überhaupt nicht zu Peirces Kritik
der Logiker und seiner Forderung nach klarem Denken. Hier fehlt es
am
Grundverständnis
wissenschaftlicher Arbeit, womit bei Peirce eigentlich niemand rechnet.
Anmerkung: es wird auch nicht viel klarer, wenn
ich Sekundärliteratur heranziehe, etwa Arroyaba (1982), S. 58 zur
"Erstheit":
- "3 a) Erstheit
Vergleicht man das Gefüge der drei Kategorien, dann drängt sich die Frage auf: Ist es überhaupt möglich, ein Erfahrungselement ohne tatsächliche (Zweitheit) Fixierung (Drittheit), „abgesehen von allem anderen“ zu beschreiben? Doch genau das versucht Peirce in der folgenden Stellungnahme: „Die Idee des absolut Ersten muß völlig von jedem Begriff von oder Referenz zu etwas anderem losgelöst werden . . . Das Erste muß demnach gegenwärtig und unmittelbar sein, sodaß es kein Zweites zu einer Repräsentation sei. Es muß frisch und neu sein, denn wenn es alt ist, ist es Zweites zum früheren Zustand ... Es geht jeder Synthese und jeder Differenzierung voraus ... Es kann nicht artikuliert gedacht werden .. Was die Welt für Adam an dem Tag, da er seine Äugen öffnete, bevor er irgendwelche Unterscheidungen gemacht oder sich seiner eigenen Existenz bewußt geworden war - das ist Erstes, Gegenwärtiges, Unmittelbares, frisch, neu, anfänglich, originell, spontan, frei, lebhaft, bewußt und flüchtig. Bloß sei nicht vergessen, daß jede Beschreibung davon dem untreu sein muß“ . Diese lange Reihe von Eigenschaftswörtern zum Zweck der Feststellung, daß jede Beschreibung unzuverlässig sei, ist Zeichen einer Anstrengung, die ihr Ziel nicht oder nur teilweise erreichen kann."
Platon (Ideenlehre)
Platon behandelt das interessante und schwierige Thema mehr kursorisch und metaphorisch, eine richtige Untersuchung des Denkens fehlt, dabei wäre es so leicht gewesen, sich selbst als Versuchsperson zu wählen und sein Denken zu erforschen, aber das passte ganz und gar nicht in sein Wissenschaftsverständnis.
- Quellen: Ich folge hier den Ausführungen
des Platon-Biographen Gottfried Martin S. 110-119,l der die Ideenlehre
chronologisch folgenden Werken entnimmt: (1) Phaidon (S. 110),
(2) Ausbau in der Politeia mit dem Höhlen- und Liniengleichnis
(S. 112), (3) eine neue Stufe im Parmenides
(S. 113), (4) Timaios und (5) Zusammenfassung (342.a-344.d)
im Siebten Brief (nach
354 im Alter von 75), was nicht ganz richtig ist, weil Ausführungen
zum
ontologischen Status fehlen.
- (1) Phaidon
(2) Das Hoehlengleichnis im Gutenbergprojekt (Eingesehen 13.09.18): Platon Politeia (Übersetzer: Friedrich Schleiermacher) Siebentes Buch.
_(3)
Parmenides (128c-135b)
zitiert nach Zeno.org (Eingesehen 13.09.18)
An den angegebenen Stellen habe ich kaum klare Aussagen zur Ideenlehre
gefunden.
(5) Nach dem 7. Brief der
Internetquelle Abruf
10.09.18, signierte Begriffe fett-kursiv 14p
gesetzt:
[342 St.3 A] "Hier taucht mir der Gedanke auf, mich noch etwas ausführlicher
über jenes Thema von der Veröffentlichung der höheren
Wahrheiten (BMDefCha-)
durch Schriften zu verbreiten, denn es dürfte die hier in Rede stehende
Aussage dadurch noch klarer einleuchten. Denn es gibt eine unumstößlich
wahre Gegenansicht (BMDefCha-)
von der verwegenen Verkündung von Wahrheit durch die Schrift, eine
Ansicht, welche schon mehr als einmal von mir ausgesprochen worden ist,
welche aber jetzt hier näher erörtert werden müsst.
Jedes der Dinge, die sind, hat dreierlei, durch welche es zu erkennen
ist, ein Viertes ist das Verständnis von ihm, als ein Fünftes
ist die wahre Wissenschaft (BMDefCha-)
zu setzen, durch die wir erkennen, was und wie es in Wahrheit ist. [B]
Das erste davon ist der Name, das zweite ist die Erklärung, das dritte
ist das Exemplar, das vierte ist das fassende Verständnis. Wenn man
nun das hier allgemein Gesagte deutlicher verstehen will, so fasse man
es an einem besonderen Beispiel, und denke sich dann die Sache bei allen
Dingen überhaupt. Kreis ist zum Beispiel ein sprachlich bezeichnetes
Ding, [C] das eben den Namen hat, welchen wir eben laut werden ließen.
Das Zweite von jenem Dinge würde die sprachliche ausgedrückte
Erklärung sein, welche aus Nenn- und Aussagewörtern zusammengesetzt
ist, zum Beispiel: ‚das von seinem Mittelpunkt überall
gleich weit Entfernte’ (BMDefCha+)
wäre wohl die Erklärung von jenem Dinge, das den Namen Rund,
Zirkel, Kreis hat. Das Dritte ist das in die Sinne wahrnehmbare Exemplar
davon, zum Beispiel vom Zeichner oder vom Drechsler angefertigt, was sich
wieder auslöschen und vernichten lässt, Zufälle welchen
der Begriff des Kreises an sich(BMDefCha-),
mit dem alle jene Meister sich beschäftigen, nicht unterworfen ist,
weil er etwas anderes und ganz davon Verschiedenes ist. [D] Das Vierte
ist das dies zusammenfassende Verstehen, das Begreifen durch den Verstand,
die
wahre Vorstellung (BMDefCha-)
von solchen Dingen, und diese ist eine, die nicht in äußerlichen
sprachlichen Lauten, nicht in den der körperlichen Wahrnehmung zugänglichen
Gestalten, sondern innerhalb der Seele ist, und durch diese Innerlichkeit
unterscheidet sich dieses Verständnis erstlich von dem Kreis
an
sich (BMDefCha-)
und zweitens auch von den drei vorhin Genannten. Das Vermögen der
Vernunft, das Fünfte, ist dem Kreis an sich
(BMDefCha-) an Verwandtschaft
(BMDefCha-) am nächsten,
die anderen aber stehen weit zurück. Das hier
beispielsweise vom Kreise Gesagte gilt nun natürlich überhaupt
ebenso gut von der gradlinigen Figur und Zeichnung wie von der zirkelrunden
und der mit Farben dargestellten, [E] vom Begriff Gut sowohl wie vom Schönen
und Gerechten, von allem Körperlichen sei es Kunst- oder Natur-Produkt,
von Feuer und Wasser und allen dergleichen Elementen, von jedem Geschöpfe
der Tierwelt wie von jeder Verfassung der menschlichen Seele, von allen
Ursachen und Wirkungen (BMBeleg-).
Denn wenn jemand nicht die vier ersten auf irgendeine
Weise (BMDefCha-)
innehat, so kann er des fünften nicht vollständig
teilhaftig werden (BMBeleg-).
Außer den vorgenannten Aufschlüssen haben jene vier folgenden
Nachteil: sie suchen nämlich nichts weniger, als das durch die Vernunft
wahrnehmbare Wesen (BMBeleg-),
(BMDefCha-) eines jeden
durch die sinnliche Eigenschaft zu zeigen, [343 St.3 A] und zwar mit Hilfe
der
unzulänglichen sprachlichen Bezeichnungen
(BMBeleg-), (BMBspGeg-).
Aus diesem Grunde wird kein vernünftig gebildeter Mensch es je über
sich gewinnen, die durch die reine Vernunft
(BMDefCha-) von ihm erfassten
Wahrheiten
(BMDefCha-) in jene unzulänglichen
sprachlichen Bezeichnungen zu setzen (RS: wenn man es nicht
benennen kann, kann man darüber nicht kommunizieren), zumal da diese
etwas ganz Unbeholfenes sind, ein Missstand welcher bekanntlich bei den
durch Buchstaben geschehenden Veröffentlichungen eintritt. Das hier
allgemein Gesagte muss man sich wiederum an demselben Beispiel erläutern.
Jeder Kreis, welcher unter der Menschen Händen gezeichnet oder gedrechselt
wird, hat sehr vieles vom Gegenteil dessen, welches mit den Fünfen
gegeben ist, denn der sinnliche Kreis zeigt überall andere Stücke,
dagegen hat der richtige Kreis (BMDefCha-)
schlechterdings [B] nichts von der gegenteiligen Natur
(BMDefCha-)
an
sich (BMDefCha-).
Nicht einmal der Name jener einzelnen in die Sinne fallenden Dinge hat
dabei einen festen Bestand, und es hindert gar nichts die jetzt krumm genannten
Dinge grad zu nennen und die graden krumm, und sie bleiben uns nach dieser
Umänderung und entgegensetzten Benennung noch ebenso fest vorhanden.
Dieselbe Betrachtung gilt vom sprachlichen Ausdruck oder der Begriffserklärung.
[C] Insofern sie aus der Zusammensetzung von Nenn- und Aussagewörtern
besteht, so ist gar nichts vollkommen Festes daran. Und so lässt sich
tausendfach von jedem der vier nachweisen (BMBeleg-),
dass es dabei kein deutlich Festes gibt. Das Ärgste hierbei ist, was
wir schon oben berührt haben, während nämlich die Seele
von den zwei Seiten des Seins, das nicht sinnlich wahrnehmbare wesenhafte
Sein und die sinnlich wahrnehmbare Beschaffenheit eines Wesens, nicht nach
der sinnlichen Beschaffenheit, sondern nach dem wesenhaften Sein strebt,
so hält jedes der vier in derselben Seele, sowohl im Reiche des Gedankens
wie in dem der Wahrnehmung zuvor, das nicht Gesuchte, die sinnliche Beschaffenheit,
vor und erfüllt dadurch jeden Menschen mit jeder Art von Zweifel und
Unklarheit, weil allemal ein jedes der erwähnten vier durch sinnliche
Worte oder Zeichen Ausdrückbare [D] als etwas für leibliche Sinne
leicht Fassliches dazwischen schiebt. Bei diesen Untersuchungen sind wir
nun in Folge schlechter Erziehung nicht einmal gewöhnt, nach der reinen,
nicht sinnlichen Wahrheit zu forschen, und daher genügt schon das
vorgeschobene wahrnehmbare Abbild, da werden wir bei Fragen und Antworten
darüber voneinander gar nicht lächerlich befunden, und die Fragenden
vermögen nur im Gebiete der ersten vier zu widerlegen und des Irrtums
zu überführen. Bei welchen Dingen aber wir in Bezug auf das Fünfte
zu antworten und Erklärungen zu geben nötigen, da ist dann nur
einer derer, welche hier mit dem Widerlegen umgehen können, [E] wenn
er will, der Meister, und stellt allemal den, welcher nur in definierenden
Ausdrücken der Sprache sei es durch Schrift oder durch mündliche
Antwort sich darüber erklären will, bei der Mehrheit des zuhörenden
Publikums als einen Ignoranten dessen hin, worüber er durch schriftliche
oder durch mündliche Sprachzeichen sich auszudrücken versucht.
Manchmal indessen wissen die Widerlegungskünstler gar nicht, dass
nicht das Wesen dessen, der sich durch schriftliche oder mündliche
Sprachzeichen über jenes Fünfte ausgesprochen hat, die Widerlegung
trifft, welches hierfür unzulänglich ist, sondern die ursprüngliche
Fehlerhaftigkeit jener Vier. Ja der durch alle jene Erkenntnisstufen mit
Anstrengung und oft wiederholte Gang der Überlegungen erzeugt nur
wirklich eine Erkenntnis vom ursprünglich vollkommen Wesenhaften bei
dem Denker, welcher mit den jenem Wesenhaften verwandten Eigenschaften
geboren ist. ... "
- Kommentar: Thema der Zitierstelle ist der (auch abstrakte) Allgemeinbegriff,
der nach Platon weder sprachlich, noch wahrnehmungsmäßig oder
operational so gefasst werden kann, wie er durch die Vernunft (idealiter)
gedacht wird, gedacht werden kann oder sogar gedacht werden muss. So weit,
so richtig. Aber es bleibt ungeklärt, was es nun mit "wahre Vorstellung",
"... an sich", "das durch die Vernunft
wahrnehmbare Wesen", "durch reine Vernunft erfasste Wahrheiten" genau auf
sich hat und wie das zu finden, zu erkennen und zu begründen ist.
Der ontologische Status wird im Siebten Brief
nicht thematisiert, deshalb ist es auch falsch, hier von einer Zusammenfassung
(Martin) zu sprechen. Im Grunde ist die Ideenlehre
Platons unklar, metaphorisch bis wirr.
Zeller zu Platons Ideenlehre S. 121f
"... Alles Werdende hat seinen Zweck an einem Sein (BMBeleg-): es ist so, weil es gut ist, dass es so sei (BMBeleg-) die Welt ist, wie Anaxagoras und Sokrates lehrten, das Werk der Vernunft (BMautonS); und ebenso soll (BMBeleg-) [>122] alles unser Thun einem vernünftigen Zweck (BMDefCha-), (BMBeleg-) dienen. Diese Zwecke können nur in der Verwirklichung dessen liegen, in dem das Denken die unwandelbaren Urbilder (BMBeleg-) der Dinge erkennt (BMBeleg-), der Begriffe (BMDefCha-). Wir sind somit, wie Plato glaubt, in jeder Beziehung genöthigt, das unsinnliche Wesen der Dinge als das allein (BMBeleg-) wahrhaft(BMDefCha-)\g Seiende von ihrer sinnlichen Erscheinung zu unterscheiden."
Quelle S. 121f: Zeller, Eduard (1883) Grundriss der Geschichte der Griechischen Philosophie. Leipzig: Fues's Verlag.
Kommentar: Die Ideenlehre Platons wird hier auf den Punkt gebracht. Sie besteht aus Phantasien und Behauptungen. Mit Wissenschaft hat das nichts zu tun. Eigentlich zeigen Zellers Ausführungen, dass zumindest Platon überhaupt kein Verständnis vom wissenschaftlichen Arbeiten hat. Wissenschaft schafft Wissen, und zwar nachprüfbares. Nach Platon wandelt man, unterhält sich, liest und denkt.
Merkmals-Kritik im Detail: Hypostasisch-homunkulesker Gebrauch der Vernunft, die hier Anaxagoras und Sokrates zugeordnet wird, so als ob diese selbständig handeln würde, wobei unklar ist, wo diese Vernunft in der Welt zu finden (BMRef) ist und Belege (BMBeleg-) fehlen.
Windelband über Platons Ideenlehre S. 116f:
"Diese Begriffe nun enthalten nach Platon eine ihrem Ursprung wie ihrem Inhalte nach völlig andere Erkenntnis als die sinnlichen Wahrnehmungen: während in den letzteren die wechselnden und relativen Produkte des Geschehens zum Bewusstsein kommen, erfassen wir in den ersteren das bleibende Wesen (BMDefCha-) der Dinge (......) (BMBeleg-). Diesen objektiven Inhalt der begrifflichen Erkenntnis bezeichnet Platon als I d e e (BMdefNam). Wenn in den Begriffen — so folgert Platon aus der sokratischen Lehre — die wahre Erkenntnis (BMBeleg-) gegeben sein soll, so muss sie eine Erkenntnis des Seienden sein (BMBeleg-).5) Wie deshalb die relative Wahrheit der sinnlichen Wahrnehmung darin besteht, dass sie die in dem Prozess des Geschehens entspringenden, wechselnden Verhältnisse wiedergibt, so besteht die absolute Wahrheit der begrifflichen Erkenntnis (der Dialektik) darin, dass sie in den Ideen das wahre, von jeder Veränderung unabhängige Sein (.....) erfasst (BMBeleg-). So [>117] entsprechen den beiden Erkenntnisweisen zwei verschiedene Welten; eine Welt der wahren Wirklichkeit, die Ideen, das Objekt der begrifflichen Erkenntnis, und eine andere Welt relativer Wirklichkeit (BMDefCha-), die werdenden und vergehenden Dinge, das Objekt der sinnlichen Wahrnehmung. 1)"
Quelle S. 116f: Windelband, W. (1894). 2. A. Geschichte der Alten Philosophie. Nebst einem Anhang: Abriss der Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften im Altertum von Dr. Siegmund Günther. München: Beck'sche Verlagsbuchhandlung.
Kommentar: Die mystische Konstruktion einer unwandelbaren, ewigen Ideenwelt wird weder begründet (BMBeleg-) noch erläutert (BMDefCha-), wie man zu ihr Zugang finden kann. Hier hängt alles in der Luft und an Platons Phantasien. Zur Grundtatsächlichkeit der Welt scheint der Wandel, die Veränderung, die Bewegung zu gehören. So gesehen, wäre diese wirkliche Welt eher als wahre Wirklichkeit anzusehen.
Ideenlehre
Platons in der Enzyklopädie der Philosophie und Wissenschaftstheorie
>
Platonismus,
platonistisch.
"Ideenlehre (BMDefiniendum),
Bezeichnung für eine auf Platon und den >Platonismus zurückgehende
Theorie nicht-empirischer Gegenstände (BMDefiniens).
Als Bezeichnung für den systematisch und historisch wichtigsten Teil
der Philosophie Platons ist sie in der Philosophiegeschichte seit dem 19.
Jh. üblich, wenn auch bis heute umstritten (BMumstr \r),
da sie in der Regel einerseits von einer besonderen Existenzweise und damit
von einer >Verdinglichung< der Ideen, andererseits von einer systematischen
Einheit der Philosophie Platons (insbes. der I.
(BMplato)) ausgeht. Beide
Annahmen werden von vielen Philosophiehistorikern nicht geteilt.
Die Kontroversen um das richtige Verständnis der I.
(BMumstr \r) beruhen vor allem darauf, daß Platon die
I.
überwiegend in >Metaphern und Gleichnissen (BMmetaph \r),
nur selten in apophantischer Rede (>Urteil, apophantisches) zur Sprache
bringt und darauf verzichtet, sie als explizite Theorie zu formulieren.
Die im »Parmenides« (128c-135b) diskutierten Fragen - (1) wovon
gibt es Ideen (BMFrage)?,
(2) wie ist die Beziehung der Ideen
(BMFrage) zu den Dingen?,
(3) welches ist der ontologische Status der Ideen
(BMFrage)?, (4) sind die
Ideen
(BMFrage) erkennbar (BMerk)?
- werden nur zum Teil bzw. nur andeutungsweise beantwortet (BMunw):
Ideen
(BMIdee \r) (>Idee (historisch
(BMEWGB) )) gibt es nicht
von Individuen, nur von >Eigenschaften (geometrischen, ethisch-politischen,
empirischen). Sie verhalten sich zu den Dingen (ihren >Abbildern) wie deren
Urbilder bzw. Ursachen (>Methexis). Ihr ontologischer Status ist unklar.
Versteht man sie als eigenständige Entitäten, als eigene Klasse
von Gegenständen mit einer besonderen Existenzweise, so bilden sie
neben der Welt der Dinge einen eigenen Kosmos (BMIdee \r). Manche
Äußerungen Platons deuten auf einen derartigen >Dualismus (z.
B. die Lehre von der > Anamnesis), doch wendet sich Platon andererseits
ausdrücklich gegen die hiermit verbundene Vergegenständlichung
und die methodische Verwendung des Wortes >Idee<
als >Eigenname (BMeignam).
Die Erkennbarkeit der Ideen (BMerk)
scheint Platon für möglich, ja sogar für notwendig zu halten,
ohne eine derartige Erkenntnis als gesichertes Wissen in Anspruch zu nehmen.
..."
_
Ideen Platons nach Kutschera
(2005), S.99: "... das eigentliche Problem, das Platon damit lösen
will, ist jedoch das der Erkennbarkeit der Ideen
(BMerk).
Ideen (BMDefCha)
waren für ihn keine Begriffe (BMBkein
\r), keine Konstrukte menschlichen Denkens, sondern etwas, das ebenso
unabhängig (BMplato)
von unserem Denken existiert wie die physische Welt. Empirische Erkenntnis
beruht letztlich auf Wahrnehmung als unserem Zugang zur physischen
Welt. In der Wahrnehmung zeigt sich, was wahr ist, und daraus können
wir dann auf anderes schließen, das wir nicht direkt wahrnehmen.
Nach diesem Modell fasst Platon auch apriorische Erkenntnis auf. "
_
Villers zur Ideenlehre Platons in Metzler
Lexikon Philosophie
"Ideenlehre (BMDefiniendum),
zentrales Lehrstück der Philosophie Platons und des >Platonismus,
das in der Annahme der Existenz besonderer, nicht-empirischer
Gegenstände besteht (BMplato).
Da die Theorie von Platon nie in expliziter Form formuliert wurde, ist
ihre Interpretation bis heute umstritten. Bei Platon selbst besitzt sie
nur hypothetischen Charakter, was sich schon daran zeigt, dass die Lehre
und die mit ihr verbundenen Lehrstücke durchgehend in mythisch-metaphorischer
Einkleidung (BMunw)
präsentiert werden. Um dem Grundanliegen seiner Philosophie, der Gewährleistung
sicheren Orientierungswissens in theoretischer und praktischer Hinsicht,
gerecht werden zu können, wurde die I.
(BMEWGB) von Platon in Form
einer Synthese der dynamischen flusslehre \g der Herakliter und der statischen
Seinslehre der Eleaten entwickelt (BMEWGB),
indem er die Existenz besonderer (stets gleichbleibender,
unveränderlicher, ewiger) noumenaler Gegenstände
(BMDefiniens) postulierte:
der >Ideen (BMDefiniendum),
die er der (veränderlichen) Welt der Erscheinungen gegenüber-
und voranstellte. Nur den Ideen (BMunw),
die den unvollkommenen Gegenständen der Erscheinungswelt als unwandelbare
Vorbilder und Ursachen dienen, wird wahre Realität zugesprochen: Während
man im Bereich der sinnlichen Wahrnehmungen, der Abbilder, höchstens
zu wahrer Meinung (BMunklar)
gelangen kann, gibt es im Bereich der Ideen,
die hierarchisch, mit der Idee des Guten an der Spitze geordnet sind, sicheres,
allgemeingültiges Wissen (BMunw).
Da die Vorstellung zweier strikt voneinander getrennter Seinsbereiche dadurch,
wenn nicht impliziert, dann doch zumindest nahegelegt wird (>Chorismos),
musste sich Platon mit zwei systematischen Problemen auseinandersetzen:
(1) Um die Möglichkeit einer Verbindung der sinnlichen Welt mit den
als raum- und zeitunabhängig gesetzten Ideen
(BMmerkm) erklären
zu können, führte er die Lehre der Teilhabe (>Methexis) an: Zwar
kommt (im Gegensatz zu den Einzelgegenständen) nur den Ideen
wahre Realität (BMmerkm)
zu, und sie sind auch nicht in den Einzelgegenständen, aber diese
haben als Abbilder der Ideen doch eine Art von Teilhabe am wahren Sein
der Ideen (). (2) Um die Möglichkeit
einer Erkenntnis der raum- und zeitunabhängigen
Ideen (BMmerkm)
zu erklären, postuliert Platon die Unsterblichkeit der Seele: Der
Mensch kann die Ideen (BMunw)
erkennen, weil seine unsterbliche Seele vor ihrer Verkörperung unbehindert
durch einen materiellen Körper die Ideen
(BMunw) selbst »schauen«
konnte; durch die Einkörperung hat sie dieses Wissen zwar verloren,
aber sie kann sich wiedererinnern. Zu dieser Wiedererinnerung (>Anamnesis)
soll die eigens dafür von Platon entwickelte Methode der Dialektik
anleiten, einer geregelten Form der dialogischen Gesprächsführung
in Frage und Antwort, die den Gesprächspartner durch Begriffsklärungen
von den Erscheinungen der Sinnenwelt zur Wahrheit der Ideen führen
soll. Den letzten Schritt der Ideen-Erkenntnis
(BMerk) scheint sich Platon
allerdings zeichen-unvermittelt vorgestellt zu haben als eine argumentativ
nicht einholbare und daher »plötzlich« einsetzende Ideenschau(BMunw).
- Schon in der antiken Rezeption wurde der hypothetische Charakter der
Theorie meistens vernachlässigt und die Existenz transzendenter Gegenstände
als gesichert vorausgesetzt (). So interpretierte bereits der Mittelplatonismus
anknüpfend an den Timaios, in dem ein göttlicher >Demiurg
die Gegenstände der Welt nach dem Vorbild der ewigen
und vollkommenen Ideen (BMmerkm)
bildet, diese als die Gedanken Gottes, wodurch die I.
(BMunw) in die christliche
Theologie integrierbar wurde (Augustinus). Die Deutung von Begriffen
als transzendente Ideen (BMmerkm)
führte im mittelalterlichen >Universalienstreit
() zu einer heftigen Kontroverse über die >Referenz
von Prädikatoren."
- Sprache und Gegenstand. In: Ontologische Relativität und
andere Schriften (eng. 1969, dt. 1975), S.7-40.
Der Zentralbegriff Gegenstand wird S. 7-10 nicht eingeführt.
Der Ausdruck "individuativer Term" wird nicht erklärt, S. 16.
"eingebaute Verfahren der Individuation" werden behauptet, aber nicht erklärt und begründet, S. 16
Kontinuativer Term wird nicht erklärt, S. 16 ff
Kategorie kontinuativer Terme wird nicht erklärt, S. 20
"Erwachsenen Begriffsschema" wird nicht erklärt S. 17
"Schema der beständigen und wiederkehrenden materiellen Gegenstände" S. 17 wird nicht erklärt
...
Kommentar: Von einem berühmten Logiker, Wíssenschaftstheoretiker und Philosophen sollte man erwarten, dass er seine Termini durch verständliche Einführung erklärt und seine Behauptungen begründet, wenigstens durch einen Hinweis. Das ist in der Arbeit Quines bis S. 20 leider nicht der Fall. Aufgrund der vielen Mängel habe ich das Lesen abgebrochen.
Physik
Begriff, Begriffsanalyse und Gebrauchsbeispiele in der Physik
Politik
Afrika als Subjekt oder, verallgemeinert, Kontinente
als Subjekt
Sarr, Felwine (dt. 2019. fr 2016) Afrotopia. Berlin:
Matthes & Seitz > Sternstunde
Philosophie.
Zusammenfassung-Afrotopia:
Grundinfo: Afrika ist der zweitgrößte Kontinent nach Asien mit
55 Mitgliedsstaaten in der afrikanischen Union und über 1,3 Mrd Einwohnern,
vielen Völkern und Sprachen. Was heißt es, wenn man von Afrika
oder vom Kontinent Afrika - was eigentlich nur eine geographische
Fläche ist - spricht? Das ist weitgehend unklar. Sicher ist,
Afrika ist eine sprachliche Bezeichnung und Konstruktion für den Kontinent
und anscheinend all dem, was dort geschehen ist oder geschieht. Damit sind
wir bei einem Grundproblem der Geschichte, die sich in der Zeit ereignet
und fortlaufend ändert. Nachdem meist nicht ausdrücklich gesagt
wird, was genau mit Aussagen über Afrika - oder auch über einen
anderen Kontinent - gemeint sein soll, kann man das nur dem Zusammenhang
entnehmen. S. 9 spricht nicht vom Kontinent als geographische Fläche,
sondern über das, was dort seit den 1960er geschehen ist (das dürfte
sehr, sehr viel sein). Mit der Fragestellung Afrika oder ganz allgemein
ein Kontinent als Subjekt erlebe ich ein merkwürdiges Paradoxon. Obwohl
gar nicht klar ist, was genau gemeint ist, versteht es doch fast jeder,
auch ich - und das wundert mich. Eine Erklärung liefert das Konzept
des Containerbegriffs.
- S.9: "Afrika denken
Überlegungen über den gesamten afrikanischen Kontinent anzustellen, ist eine schwierige Aufgabe, bekommt man es doch mit hartnäckigen Gemeinplätzen, Klischees und Pseudogewissheiten zu tun, die sich wie ein Dunstschleier über die Realität legen. Seit den 1960er-Jahren und seit dem Morgen der Unabhängigkeit ist Afrika von der afropessimistischen Vulgata ohne Unterlass als der Kontinent beschrieben worden, der einen Fehlstart hingelegt hat und seitdem am Abdriften ist: ein sterbendes Ungeheuer, dessen jüngste Zuckungen das baldige Ende ankündigen. Die grimmigen Zukunftsprognosen Afrikas folgen aufeinander im Gleichschritt mit den Erschütterungen und Krisen, die der Kontinent durchlaufen hat. ..."
- Kommentar-Afrotopia-S.9: Afrika als der Kontinent, der einen Fehlstart
hingelegt hat gebraucht die begrifflichen Konstruktionen Afrika und der
Kontinent als handlungsfähige Subjekte, die sie nicht sind.
S.17: "Gegen den Strom
Jedes weitertreibende Nachdenken über den afrikanischen
Kontinent muss dem Anspruch einer absoluten intellektuellen
Souveränität genügen. Es geht darum, dieses in Bewegung
befindliche Afrika ohne die gängigen
Worthülsen wie »Entwicklung«, »wirtschaftlicher
Durchbruch«, »Milleniums-Entwicklungsziele«, »nachhaltige
Entwicklung« ... zu denken, die bisher dazu gedient haben, Afrika
zu beschreiben, vor allem aber, die Mythen des Westens auf die Entwicklungsverläufe
afrikanischer
Gesellschaften zu projizieren. Diese Vokabeln haben es nicht
vermocht, den Dynamiken des
afrikanischen Kontinents
gerecht zu werden oder die tiefgreifenden Veränderungen zu fassen,
die sich dort abspielen. Dazu bleiben sie zu sehr einem westlichen Begriffskosmos
verhaftet, der ihre Deutung der Wirklichkeit bestimmt. Indem sie die Entwicklung
der
afrikanischen Gesellschaften in
eine Teleologie mit universellem Anspruch einschreiben, haben diese Kategorien,
die in ihrer Prätention einer Bewertung und Beschreibung gesellschaftlicher
Dynamiken Hegemonie beanspruchen können, die besondere
Kreativität
Afrikas ebenso verleugnet wie dessen Fähigkeit, Metaphern
des eigenen Zukunftspotenzials zu formulieren. Diese Begriffe kollidierten
mit der kulturellen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Komplexität
der afrikanischen Gesellschaften und
haben fremden mythologischen Universen ihr Interpretationsraster aufoktroyiert."
- Kommentar-Afrotopia-S.17: Kann ein Kontinent eine Dynamik zeigen? Kann
Afrika Kreativität zeigen? Kann Afrika Metaphern seines eigenen Zukunftspotentials
formulieren?
Psychiatrie
Den PsychiaterInnen gelingt es seit über 100 Jahren nicht, Wahn
operational klar und überprüfbar zu definieren. Das hat auch
wesentlich damit zu tun, dass das Haus
der Psychiatrie im 1. Stock anfängt und kein Erdgeschoß
hat, also im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft hängt. Es ist aber
auch Ausdruck eines gestörten Verhältnisses zur wissenschaftlichen
Methodik.
Begriff, Begriffsanalyse und Gebrauchsbeispiele in der Psychologie
Denkinteresse
"Es werden darum im allgemeinen Besonderheiten des vorliegenden Bewusstseinsinhaltes
unberücksichtigt bleiben; einestheils, weil das
Denken an ihnen kein Interesse hat (BMautonS),
anderntheils, weil das Denken ihre Bedeutung nicht zu erkennen vermag"
Quelle: Lipps, Gottlieb Friedrich (1901) Die
Theorie der Collectivgegenstände. Philosophische Studien 17: 78-184,
S. 80:
Kommentar: "Das Denken" ist kein autonomes Subjekt, das ein Interesse bildet. Der Denkende bildet womöglich ein Interesse aus oder auch nicht. Jedenfalls kann man das in einem wissenschaftlichen Text nicht so formulieren. Es muss genau gesagt werden, wer das Interesse aufbringt oder nicht.
Synkretismus
Piaget, Jean (1981) Urteil und Denkprozess des Kindes. Düsseldorf:
Schwann (hier Ullstein Materialien), S. 229
"... Der Synkretismus verhindert also die Analyse und verhindert das
deduzierende Denken. Man sieht in einem solchen Fall auch, daß der
Synkretismus die Unfähigkeit des Denkens zur logischen Multiplikation
erklärt und daß er seine Neigung (BMautonS),
die Synthese durch die Beiordnung zu ersetzen, erklärt."
Kommentar: Den Synkretismus gibt es nicht als autonom handelndes Subjekt. Er hat auch keine Neigungen und erklärt nichts.
Ekman - Gesichtsausdruecke
sind keine autonomen Subjekte
Ziffern in eckigen Klammern [Z] von mir zur eindeutigen
Bezugnahme.
[1] "Für jeden, der sich daran macht, eine Lüge aufzudecken,
kann das Gesicht ein wertvolles Hilfsmittel sein, weil es sowohl lügen
als auch die Wahrheit sagen kann und nicht selten sogar beides zur gleichen
Zeit tut. [2] Das Gesicht enthält häufig zwei Botschaften: Es
enthält das, was der Lügner zeigen, und das, was er verheimlichen
möchte. [3] Einige Gesichtsausdrücke stehen im Dienst der Lüge,
indem sie unwahre Informationen liefern. [4] Andere wiederum verraten die
Lüge, weil sie unecht aussehen und [5] weil manchmal Gefühle
trotz aller Verheimlichungsversuche durchsickern. [6] Während sich
im Moment vielleicht ein vorgetäuschter, aber überzeugender Ausdruck
zeigt, sickert schon im nächsten Augenblick ein verheimlichter Ausdruck
durch. [7] Es ist sogar möglich, daß das wirklich empfundene
und das vorgetäuschte Gefühl, verschmolzen zu einem einzigen
Ausdruck, sich jeweils in einem anderen Teil des Gesichts manifestieren.
[8] Der Grund, weshalb es den meisten Menschen nicht gelingt, Lügen
am Gesicht abzulesen, liegt meiner Ansicht nach darin, daß sie nicht
wissen, wie sie die echten und die vorgetäuschten Ausdrücke auseinanderhalten
sollen."
Quelle S.97: Ekman, Paul (1989) Weshalb Lügen
kurze Beine haben. Berlin: de Gruyter.
- Kommentar: [1] Das Gesicht lügt weder noch sagt es die Wahrheit,
es liefert allenfalls Ausdrucksindizien für Lüge oder Wahrheit.
Das Gesicht ist kein autonomes Subjekt mit eigenen Absichten. [2] Das Gesicht
hat keine Botschaften, es zeigt allenfalls Ausdrucksindizien an. Das Gesicht
zeigt auch nicht an, was der Kommunikator verheimlichen möchte,
es kann allenfalls anzeigen, dass etwas verheimlicht werden soll,
aber nicht was. [3] Das Gesicht liefert auch keine unwahren Informationen,
es zeigt allenfalls mit Ausdrucksindizien an, dass Unwahrheit im Spiel
ist. [4] Hier wird unechtes Aussehen als Indikator für Lügen
verwandt. [6] Weshalb durchsickernde Gefühle auf Verheimlichungsversuche
zurückgehen sollen bleibt an dieser Stelle eine Behauptung wie dass
sie Lügen anzeigen sollen. [7] Wenn sich Ausdrücke in verschiedenen
Teilen des Gesichtes manifestieren, dann sind sie nicht in einem einzigen
Ausdruck verschmolzen, sondern getrennt. [8] Das kann gut so sein, wahrscheinlich
aber nicht allein.
Psychoanalyse
Die Psychoanalyse ist ein absolutes Eldorado für Begriffsbildungen autonomer, homunkulesker Instanzen und Funktionen, namentlich Freud selbst kann hier als Großmeister gelten (> PA-Kritik).
- Oedipuskomplex
"Der Ausgang der Ödipussituation in Vater- oder in Mutteridentifizierung scheint also bei beiden Geschlechtern von der relativen Stärke der beiden Geschlechtsanlagen abzuhängen. Dies ist die eine Art, wie sich die Bisexualität in die Schicksale des Ödipuskomplexes einmengt. Die andere ist noch bedeutsamer. Man gewinnt nämlich den Eindruck, daß der einfache Ödipuskomplex überhaupt nicht das häufigste ist, sondern einer Vereinfachung oder Schematisierung entspricht, die allerdings oft genug praktisch gerechtfertigt bleibt. Eingehendere Untersuchung deckt zumeist den vollständigeren Ödipuskomplex auf, der ein zweifacher ist, ein positiver und ein negativer, abhängig von der ursprünglichen Bisexualität des Kindes, d. h. der Knabe hat nicht nur eine ambivalente Einstellung zum Vater und eine zärtliche Objektwahl für die Mutter, sondern er benimmt sich auch gleichzeitig wie ein Mädchen, er zeigt die zärtliche feminine Einstellung zum Vater und die ihr entsprechende eifersüchtig-feindselige gegen die Mutter. Dieses Eingreifen der Bisexualität macht es so schwer, die Verhältnisse der primitiven Objektwahlen und Identifizierungen zu durchschauen, und noch schwieriger, sie faßlich zu beschreiben. Es könnte auch sein, daß die im Elternverhältnis konstatierte Ambivalenz durchaus auf die Bisexualität zu beziehen wäre und nicht, wie ich es vorhin dargestellt, durch die Rivalitätseinstellung aus der Identifizierung entwickelt würde.1
Ich meine, man tut gut daran, im allgemeinen und ganz besonders bei Neurotikern die Existenz des vollständigen Ödipuskomplexes anzunehmen. Die analytische Erfahrung zeigt dann, daß bei einer Anzahl von Fällen der eine oder der andere Bestandteil desselben bis auf kaum merkliche Spuren schwindet, so daß sich eine Reihe ergibt, an deren einem Ende der normale, positive, an deren anderem Ende der umgekehrte, negative Ödipuskomplex steht, während die Mittelglieder die vollständige Form mit ungleicher Beteiligung der beiden Komponenten aufzeigen. Beim Untergang des Ödipuskomplexes werden die vier in ihm enthaltenen Strebungen sich derart zusammenlegen, daß aus ihnen eine Vater- und eine Mutteridentifizierung hervorgeht, die Vateridentifizierung wird das Mutterobjekt des positiven Komplexes festhalten und gleichzeitig das Vaterobjekt des umgekehrten Komplexes ersetzen; Analoges wird für die Mutteridentifizierung gelten. In der verschieden starken Ausprägung der beiden Identifizierungen wird sich die Ungleichheit der beiden geschlechtlichen Anlagen spiegeln.
So kann man als allgemeinstes Ergebnis der vom Ödipuskomplex beherrschten Sexualphase einen Niederschlag im Ich annehmen, welcher in der Herstellung dieser beiden, irgendwie miteinander vereinbarten Identifizierungen besteht. Diese Ichveränderung behält ihre Sonderstellung, sie tritt dem anderen Inhalt des Ichs als Ichideal oder Über-lch entgegen."
Quelle S. 300f: Freud, Sigmund (1923) Das Ich und das Es. In (273-330) Studienausgabe Bd. III. Frankfurt aM: Fischer.
- Kommentar Oedispuskomplex Die
Bisexualität greift ein; die Objekte halten fest; der vollständige
Ödipuskomplex wird angenommen, geht unter, hinterlässt Niederschläge
im Ich; Identifizierungen gelangen zu Vereinbarungen; die Ichveränderung
tritt anderen Inhalten des Ichs entgegen. Das ist eine abstrakte, verallgemeinerte
Redeweise über fiktive Menschen, in der Freuds phantastischen Konstruktionen
ein homunkuleskes, autonomes Eigenleben entfalten.
Recht
Begriff, Begriffsbildung Gebrauchsbeispiele im Recht.
Unbestimmte
Rechtsbegriffe
Unbestimmte
Rechtsbegriffe sind wissenschaftlich meist völlig unbrauchbar
und repräsentieren eine projektive Geisterwelt, die sich der Nachvollziehbarkeit
und Kontrolle weitgehend entzieht. Es gibt eine unübersehbare Vielzahl
an juristischen Texten mit unbestimmten Rechtsbegriffen.
Wahrscheinlichkeit und hinreichende Wahrscheinlichkeit beim Bundesverwaltungsgericht: "Ergebnisse In den 34 Entscheidungen ab 2002 findet sich keine einzige numerische oder inhaltliche Spezifikation einer Wahrscheinlichkeit, so dass völlig offen bleibt, was das BVerwG mit seinen Wahrscheinlichkeitsbegriffen tatsächlich meint. Das gilt leider auch für die 17 Fundstellen für "hinreichende Wahrscheinlichkeit". Hier wird der unbestimmte Rechtsbegriff "hinreichende Wahrscheinlichkeit§" mit völliger Unklarheit ausgestattet, so dass kein Sachverständiger wissen kann, woran er sich orientieren soll und kann. Damit wird wissenschaftlich betrachtet ein naiver Platonismus und Begriffsrealismus vertreten, wie er eigentlich nach Ockham (1288-1347) nicht mehr vertretbar, aber auch heute noch sehr verbreitet ist, vor allem im Recht und in der Rechtswissenschaft und neuerdings anscheinend auch bei der Polizei (BKA, LKA)." [Quelle]
Kommentar: Fehler des Gebrauchs wahrscheinlich und hinreichend wahrscheinlich: (BMBeleg-), (BMDefCha-), (BMguelBonS), (BMnaiv), (BMoper), (BMplato), (BMRef), (BMuonS).
Soziologie und Politikwissenschaft
Begriff, Begriffsbildung und Gebrauchsbeispiele in der Soziologie und Politikwissenschaft.
Wissenschaftstheorie
Begriff, Begriffsbildung Gebrauchsbeispiele in Wissenschaftstheorie, Methodologie und Logik.
Kopnin Dialektik als autonom handelndes Subjekt.
"Wenn die Dialektik unter den gegenwärtigen Bedingungen versuchen
würde (BMautonS),
selbst alle Erscheinungen und Prozesse zu erfassen, so könnte sie
das nicht, weil sie erstens nicht über alle modernen Methoden verfügt,
die die verschiedenen Wissenschaften benutzen, um ihren Gegenstand zu studieren,
zweitens würde sie aufhören, Philosophie zu sein und würde
sich in ein System verschiedener spezieller Wissenschaften verwandeln"
(S. 102)
"Die Dialektik befaßt sich (BMautonS)
mit der philosophischen Analyse der wissenschaftlichen Begriffe und Theorien"
(S. 103a).
"Die Dialektik nimmt (BMautonS)
diese Begriffe als Grundlage, analysiert und bearbeitet sie kritisch, um
in ihnen die allgemeinen Eigenschaften und Gesetze, wie sie diesen Begriffen
und in der Praxis des Menschen überhaupt gegeben in sind, zu entdecken
und abzusondern." (S. 103b).
Quelle S. 102f: Kopnin, P. V. (russ. 1969, dt. 1970)
Dialektik - Logik - Erkenntnistheorie. Lenins philosophisches Denken -
Erbe und Aktualität. Berlin: Akademie-Verlag.
Kommentar Kopnin : "Die" Dialektik ist
kein autonom handelndes Subjekt, die erfasst oder nicht erfasst, sich befasst
oder nicht befasst, sie nimmt nichts ..., sondern sie ist eine Schöpfung
oder Konstruktion des menschlichen Geistes, genauer einzelnen menschlicher
Geister, die der Dialektik solche Merkmale zuordnen.
Ziel der Wissenschaft
nach Kuelpe > Zum Wissenschaftsbegriff
in der IP-GIPT.
"Jede Wissenschaft hat zum Ziel eine sachlich und zweckmäßig
geordnete Darstellung allgemeingültiger Erkenntnisse."
Quelle: Külpe in Die Realisierung Bd. 1, 1912,
S. 7
- _
Kommentar Külpe : Die Wissenschaft ist kein selbstständiges, autonomes Subjekt, sondern eine Schöpfung des menschlichen Geistes. Daher kann sie auch kein Ziel haben. Aber Menschen können mit der Wissenschaft Ziele verfolgen und das tun sie in der Regel auch. Ob man mit ihr nur ausschließlich allgemeingültige Erkenntnisse anstreben sollte, bezweifele ich. Im übrigen ist "allgemeingültig" hier nicht erklärt. Wie der Namen schon verkündet: Wissenschaft schafft Wissen.
Exkurs: Medien
DAS Boese als autonomes
Subjekt
Philosoph Noller, der sich zwar eingangs kritisch gegen die Wendung
DAS BÖSE wandte, hielt diese vernünftige Haltung nicht
vollständig durch und erlag einmal dem Gebrauch der verselbständigenden
Substantivierung in der Sternstunde Philosophie, 3sat am 14.10.18, zum
Thema ImSog
des Bösen, bei ca. 6.05 min: "Das Böse schleicht sich
ein und ist strategisch sehr geschickt" (BMautonS)
(6.05)
Apparat: Quellen, Belege, Querverweise, Links
- Dieckmann, Walther (2012) Wege und Abwege der Sprachkritik. Hempen.
- Eisler (1904 ff) Wörterbuch der Philosophie.
- Gadamer, Hans Georg (2010) Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: J. C. B. Mohr.
- Gadamer, Hans Georg (1993) Hermeneutik II. Wahrheit und Methode. Ergänzungen, Register. Tübingen: J. C. B. Mohr.
- Graumann, H. M. (1976) Das Verstehen. Versuch einer historisch-kritischen Einleitung in die Phänomenologie des Verstehens. In: Balmer H (1976, Hrsg.) Psychologie des 20. Jahrhunderts, Bd. I. Kindler, Zürich, S 159–271 (Ersterscheinung als Inauguraldissertation: München, 1924).
- Hartmann, Dirk (1998) Philosophische Grundlagen der Psychologie. Darmstadt: WBG.
- Hartmann, Nicolai (1962) Das Problem des geistigen Seins, Untersuchungen zur Grundlegung der Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften. 3. A. Berlin: De Gruyter.
- Hartmann, Nicolai (1949) a) Wissenschaftliche und philosophische Begriffsbildung. In (287-288) Hartmann, Nicolai (1949) Metaphysik der Erkenntnis. Berlin: De Gruyter.
- Hartmann, Nicolai (1939) Aristoteles und das Problem des Begriffs. Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1939, Philosophisch-historische Klasse, No. 5, 3-32.
- Hartmann, Nicolai (1938) Möglichkeit und Wirklichkeit. Berlin: De Gruyter.
- Hartmann, Nicolai (1964) Der Aufbau der realen Welt. Grundriss der allgemeinen Kategorienlehre. 3. A. Berlin: De Gruyter.
- Hegel > Zeno.org.
- Heidegger, Martin (2007) Gesamtausgabe /59: Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks: Theorie der philosophischen Begriffsbildung. Ausgabe: 2., durchges. Aufl..: Frankfurt aM: Klostermann.
- Humboldt, Wilhelm von (1797) Anthropologie und Theorie der Menschenkenntnis [Das achtzehnte Jahrhundert]. In: Wagner, Hans-Josef von (2002)
- Janich, Peter (2009) Zur Sprache der Hirnforschung. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Kopnin, P. V. (russ. 1969, dt. 1970) Dialektik - Logik - Erkenntnistheorie. Lenins philosophisches Denken - Erbe und Aktualität. Berlin: Akademie-Verlag.
- Pöttker, Horst (2000) Zur Bedeutung des Sprachgebrauchs im Journalistenberuf. In (11-30) Kurz, Jorsef; Müller, Daniel; Pötschke, Joachim & Pöttker, Horst (2000)
- Kurz, Jorsef; Müller, Daniel; Pötschke, Joachim & Pöttker, Horst (2000) Stilistik für Journalisten. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Kutschera, Franz von (2005) Der Wissensbegriff bei Platon und heute, In (87-102) Rapp, Christoph & Wagner, Tim (2005, Hrsg.)
- Lessl, M. & Mittelstraß, Jürgen (2005, Hrsg.). Von der Wahrnehmung zur Erkenntnis – From Perception to Understanding. Symposium der Schering Forschungsgesellschaft zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Stock, Februar 2004. Berlin: Springer.
- Martin, Gottfried (1969) Platon. Reinbek: Rowohlts Monographien.
- Mauthner, F. (1901-1902) Beiträge zu einer Kritik der Sprache. 3 Bde. Stgt.
- Mittelstraß, Jürgen (2005, Hrsg.) Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. 4 Bde. Die ersten beiden Bände erschienen bei BI, Mannheim. Die letzten beiden Bände bei Metzger, Stuttgart.
- Mittelstraß, Jürgen (2005) Zur Philosophie des Erkennens. In (133-142) Lessl, M. & Mittelstraß, Jürgen (2005, Hrsg.).
- Platon (428/27-348/47 v.Chr.) Sämtliche Werke in vier Bänden nach der Übersetzung Schleiermachers. Rohwohlts Klassiker
- I. Apologie, Kriton, Protagoras, Ion, Hippias II., Charmides, Laches, Euthyphron, Georgias, Briefe.
- II. Menon, Hippias I., Euthydemos, Menexenos, Kratylosm Lysis, Symposion.
- III. Phaidon, Politeia.
- IV: Phaidros, Permenides, Theaitetos, Sophistes.
- Rapp, Christoph & Wagner, Tim (2005, Hrsg.) Wissen und Bildung in der antiken Philosophie. Stuttgart: Metzler.
- Savigny, Eike von (1969) Die Philosophie der normalen Sprache. Frankfurt: Suhrkamp.
- Schiepek, Günter (2011, Hrsg.) Neurobiologie der Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer.
- Sentker, Andreas & Wigger, Frank (2007, Hrsg.) Rätsel Ich. Gehirn, Gefühl, Bewusstsein. Zeit Wissen Edition. Berlin: Springer.
- Singer, Wolf (2002) Der Beobachter im Gehirn. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Singer, Wolf (2011) Das Gehirn - ein komplexes, sich selbst organisierendes System. In (133-141) Schiepek, Günter (2011, Hrsg.) Neurobiologie der Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer.
- Wagner, Hans-Josef von (2002) Wilhelm von Humboldt, Anthropologie und Theorie der Menschenkenntnis. Darmstadt: WBG.
- Windelband, W. (1894) Geschichte der Alten Philosophie. Nebst einem Anhang: Abriss der Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften im Altertum von Dr. Siegmund Günther. München: Beck'sche Verlagsbuchhandlung.
- Wolfradt, Uwe; Billmann-Mahecha, Elfriede & Stock, Armin ( Hrsg.) Deutschsprachige Psychologinnen und Psychologen 1933–1945: Ein Personenlexikon, ergänzt um einen Text von Erich Stern. Berlin: Springer.
- Zeller, Eduard (1883) Grundriss der Geschichte der Griechischen Philosophie. Leipzig: Fues's Verlag.
Links(Auswahl: beachte)
- Begriffsanalyse Begriff und Gebrauchsbeispiele mit Signierungen.
- Überblick Begriffsanalysen.
- Definition und definieren.
- Allgemein-Psychologisches-Referenz-Modell.
- Grundproblem Begriffsverständnis.
- Glossar Wahrscheinlichkeit und Statistik.
- Fuzzy-Begrifflichkeit im Alltag.
- Denken. * Terminologische Differenzierung und Entwicklung kognitiver Schemata und Begriffsbildung.
- Analyse des Phantasiebegriffs mit einem Exkurs Phantasie in der Forensischen Psychologie.
- Mentale- und Bewusstseinsbegriffe.
- Aussagepsychologie.
- Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben.
- Welten.
- Wirklichkeit und wirklich. Ein alltäglicher und wissenschaftlicher Grundbegriff.
- Ontologie des Psychosozialen aus allgemeiner und integrativer psychologischer Sicht.
- Über den Aufbau einer präzisen Wissenschaftssprache in Psychologie, Psychopathologie, Psychodiagnostik und Psychotherapie.
- Verstehen.
- Kommunikation.
- Die Idee allgemeiner "normaler" Verrücktheit bei Max Stirner.
- Zitieren in der Wissenschaft - Kritik des Hochstapler-Zitierstils.
Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort > Weltanschaulicher Standort
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
an und für sich bei Platon
Die Wendung wird eigentlich Hegel zugeordnet, findet sich aber schon bei Platon.
__
Geist
Der kognitive Teil der Seele(n), der sich psychologisch im Denken, aber auch in der Sprache und im Handeln zeigt, wie die vielen Schöpfungen, Produkte und Werke belegen, die man als Äußerungen objektivierten Geistes zusammenfassen kann. Der Ausdruck objektiver Geist ist metaphysisch vorbelastet, besonders durch Platon und Hegel, neuerdings sogar durch Popper. So ist auch die philosophische Frage naiv und unsinnig, ob es einen objektiven Geist gibt. Wissenschaftlich muss man zunächst definieren, was ,man unter objekten Geist verstehen will, dann kann man suchen, in welcher Weise der so oder so definierte objektive Geist in der Welt gefunden werden kann.
__
Geistes-Krankheit
Die Begriffswelten vieler PhilosophInnen, Geistes-, Sozial- und KulturwissenschaftlerInnen erinnern an Wahnwelten. Die allermeisten davon werden aber keineswegs als geistes-krank angesehen, sondern überwiegend als gesunde und normale Menschen beurteilt. Hier stellt sich dann die Frage, was für eine Variante von Geistes-Krankheit oben gemeint sein kann. Nun, eine genaue und vorurteilslose Betrachtung zeigt, dass Wahn, Verrücktheit oder Geistes-Krankheit wahrscheinlich sehr viel verbreiteter ist als gewöhnlich angenommen wird. Wir alle sind sozusagen wahnfähig. Viele Wahninhalte werden aber gar nicht bemerkt, gelten als harmlos ("Grillen"), stören auch nicht weiter oder werden nicht so bewertet (> Überblick Verstecker Wahn- und Wahntransformationen; besonders: normaler Wahn, gesunder Wahn; rollenfunktioneller Wahn; wissenschaftlicher Wahn; ).
__
Graumann, H. M.
Graumann, H. M. (1976) Das Verstehen. Versuch einer historisch-kritischen Einleitung in die Phänomenologie des Verstehens. In: Balmer, H. (1976, Hrsg.) Psychologie des 20. Jahrhunderts, Bd. I. Kindler, Zürich, S 159–271 (Ersterscheinung als Inauguraldissertation: München, 1924 > Primärquelle.)
S. 687 ausgeführt: "Heinz M. Graumann, Dr. phil. geb. 1900 in Berlin. Auswanderung nach Hitlers Machtergreifung; lebte elf Jahre in Holland, davon 3 1/2 Jahre während der Besetzung im Verborgenen; nach dem Zweiten Weltkrieg Übersiedlung in die USA; Chefpsychologe am State Hospital Topeka, Kansas; seit 1972 im Stabe der Menninger Foundation in Topeka." In der deutschen Psychologie gibt es noch den hierzulande bekannteren Graumann, C. F. (1923-2007)
Ausführlicher in Wolradt et al. (2017), S. 146f "Graumann, Heinz 10. Mai 1900 Berlin – 4. Juni 1990 Topeka/USA Kurzbiographie: Heinz Moritz Graumann wurde als Sohn des Fabrikanten Julius Graumann und seiner Ehefrau Gertrud (geb. Königsberger) geboren. Er diente noch vor Ende seiner Schulzeit im 1. Weltkrieg als Soldat und studierte von 1919 bis 1924 in Marburg und München Philosophie und Psychologie. Er wurde 1924 in München mit der Arbeit Das Verstehen: Versuch einer historisch-kritischen Einleitung in die Phänomenologie des Verstehens promoviert. Heinz Graumann arbeitete ab 1925 als Klinischer Psychologe in Kreuzlingen/Schweiz. Er war Gründer einer Studentenbühne in Berlin, Lektor der Münchner Kammerspiele und schrieb Theaterstücke. Er arbeitete zudem als freier Journalist für die „Vossische Zeitung“ und das „Berliner Tageblatt“. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft verließ er Deutschland 1935, ging zunächst nach Spanien, 1936 nach Italien und 1937 in die Niederlande, wo er 1939 bis 1948 an den Universitäten Amsterdam, Leiden und Arnheim als Psychologe arbeitete. Von 1945 bis 1948 arbeitete er für den Psychologischen Dienst der Niederländischen Armee. Er emigrierte 1948 in die USA, wo er zunächst als freier Psychotherapeut in New York, dann in Topeka (Kansas) arbeitete. 1950 wurde er Klinischer Psychologe am Topeka State Hospital. 1972 ging er als Psychologe zur Menninger Foundation in Topeka.
In seiner Dissertation setzte sich Heinz Graumann mit der Phänomenologie des Verstehens auseinander. Nacheinander erläutert Graumann den Verstehensbegriff bei Wilhelm Dilthey, Benno Erdmann, Eduard Spranger, Georg Simmel, Heinrich Rickert, Karl Jaspers, Max Weber, Max Scheler und Edith Stein. In Abgrenzung zum Erkennen, Deuten und Erklären ist er zur Feststellung gekommen, dass Verstehen durch ein Wissen um einen Erlebniszusammenhang und die Vergegenwärtigung eines Motives (Einfühlung) bestimmt ist.
Primaerquelle: Graumann, H. M. (1924). Das Verstehen: Versuch einer historisch-kritischen Einleitung in die Phänomenologie des Verstehens. Dissertation, Universität München. Groetenherdt, Karl 147
Sekundärquelle: Röder, W. & Strauss, H. A. (1999). Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933. II. The arts, sciences and literature. München: Saur. Uwe Wolfradt"
__
Hegel-Saemtliche-Werke-Fundstellen der Glockner-Ausgabe
Kürzel: [Bd1 Jena] [Bd2 PdG] [Bd3 PP] [Bd4 LogI] [Bd5 LogII] [Bd6 EdpWiG] [Bd7 GdPdR] [Bd8 SdP-I Log] [Bd9 SdP-II NatP] [Bd10 SdPIII PdG] [Bd11 VPdG] [Bd12 Äst-I] [Bd13 Äst-II] [Bd14 Äst-III] [Bd15 Rel-I] [Bd16 Rel-II] [Bd17 VGdP-I] [Bd18 VGdP-II] [Bd19 VGdP-III] [Bd20 VS-Ber]
Zuordnungen:
- 1. Aufsätze aus dem kritischen Journal der Philosophie
und andere Schriften aus der Jenenser Zeit [Bd1 Jena]
2. Band: Phänomenologie des Geistes. Hrsg. v. [Bd2 PdG]
3. Philosophische Propädeutik, Gymnasialreden und Gutachten über den Philosophie-Unterricht [Bd3 PP]
4. Wissenschaft der Logik I. [Bd4 LogI]
5. Wissenschaft der Logik II [Bd5 LogII]
6 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse und andere Schriften der Heidelberger Zeit. [Bd6 EdpWiG]
7. Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse [Bd7 GdPdR]
8: System der Philosophie I. Die Logik [Bd8 SdP-I Log]
9. System der Philosophie II. Die Naturphilosophie [Bd9 SdP-II NatP]
10. System der Philosophie III: Die Philosophie des Geistes [Bd10 SdPIII PdG]
11 Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte [Bd11 VPdG]
12. Vorlesungen über die Aesthetik I [Bd12 Äst-I]
13. Vorlesungen über die Aesthetik II [Bd13 Äst-II]
14. Vorlesungen über die Aesthetik III [Bd14 Äst-III]
15. Vorlesungen über die Philosophie der Religion I. [Bd15 Rel-I]
16. Vorlesungen über die Philosophie der Religion II. [Bd16 Rel-II]
17. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I [Bd17 VGdP-I]
18. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II [Bd18 VGdP-II]
19. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III [Bd19 VGdP-III]
20. Vermischte Schriften aus der Berliner Zeit. [Bd20 VS-Ber]
21. Schwierigkeiten und Voraussetzungen der Hegelschen Philosophie [Bd21 SuVdHP]
22. Entwicklung und Schicksal der Hegelschen Philosophie. [Bd22 EuSdHP]
23. Hegel-Lexikon A-Leibniz [Bd23 Lex A-Leibniz]
24. Hegel-Lexikon Leibniz-Z [Bd24 Lex Leibniz-Z]
- GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
WERKE IN 20 BÄNDEN
Auf der Grundlage der Werke von 1832—1845 neu edierte Ausgabe
Redaktion Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel
1 Frankfurter Schriften
2 Jenaer Schriften
3 Phänomenologie des Geistes
4 Philosophische Propädeutik — Gymnasialreden und Gutachten — Heidelberger Schriften von 1817
5 Wissenschaft der Logik I
6 Wissenschaft der Logik II
7 Grundlinien der Philosophie des Rechts
8 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I
9 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften II
10 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften III
11 Berliner Schriften 1822—1831
12 Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte
13 Vorlesungen über die Ästhetik I
14 Vorlesungen über die Ästhetik II
15 Vorlesungen über die Ästhetik III
16 Vorlesungen über die Philosophie der Religion I
17 Vorlesungen über die Philosophie der Religion II
18 Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I
19 .Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II
20 Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III
Internetseite
Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren, geben wir nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia, DER SPIEGEL)
__
Platon
Eisler, zitiert nach Zeno.org (Abruf 10.09.18), führt aus: "Platon gehört zu den größten Philosophen aller Zeiten. Er ist der Begründer des (objektiven) Idealismus, jener Welt- und Lebensanschauung, für welche die höchsten Werte nicht im Gebiet des sinnlich-empirisch Wirklichen, überhaupt nicht im »Gegebenen« der Erfahrung, sondern in obersten Zielpunkten des Schauens, Denkens und Strebens, im Idealen, in einem Zusammenhang von »Ideen«, von Ur- und Musterbildern des Wirklichen liegen. Eine künstlerische und bei allem wissenschaftlichen Triebe zugleich tief religiöse Natur, mißt Platon das Gegebene stets au idealen Maßstäben und strebt er stets hinaus über das Gegebene zu jenen Regionen, »wo die reinen Formen wohnen«, zu einer Lichtwelt des reinen Seins, zum Reiche des Wahren, Guten und Schönen an sich, als dessen Bürger er sich fühlt und nach dem ihn die Sehnsucht hintreibt. In diesem Reiche sucht er zugleich die Grundlage für die Erkenntnis der Erfahrungswirklichkeit; logische und metaphysische Prinzipien gehen so in Eins zusammen. Fragen wir nach den Einflüssen, welche P. erfahren hat, so ist hier vor allem die Methode der Sokratischen Dialektik und die Sokratische Wertung der streng begrifflichen Erkenntnis, sowie auch die ethische Richtung des Sokratischen Denkens zu nennen, ferner Heraklit, dessen Theorie des Werdens Platon für die Sinnendinge annimmt, dann die Eleaten, deren Lehre vom unveränderlichen Sein des wahrhaft Wirklichen bei P. in modifizierter Form (Anerkennung der Realität der Vielheit) auftritt und endlich besonders der Pythagoreismus in theoretisch-praktischer Beziehung, in Verbindung mit »orphischen« u. a. Mysterien.
Die (durch das »Staunen« über die Dinge ausgelöste) Philosophie ist nach P. der Erwerb des Wissens (ktêsis epistêmê). Philosophen sind weder die absolut Wissenden noch die Nichtwissenden, sondern die in der Mitte zwischen beiden Stehenden. Es sind dies diejenigen, die nach der Erfassung des wahrhaft Seienden streben (tous ara hekaston to on aspazomenous philosophous klêteon, Republ. VI, 480 B). Die philosophische Methode ist die [552] Dialektik, das Verfahren, durch Analyse und Synthese der Begriffe, durch logische Induktion, durch Fortgang des Denkens von niederen, spezielleren zu höheren, allgemeineren Begriffen, vom Bedingten zum Unbedingten (anypotheton) und von diesem wieder zum Bedingten das Allgemeine im Einzelnen und das Einzelne aus dem Allgemeinen zu begreifen. Das Höchste in der Dialektik ist die Erfassung der Ideen durch »Zusammenschauen« des Gemeinsamen einer Vielheit zur Einheit des Gedachten (eis mian te idean xynorônta agein ta pollachê diesparmena, Phaedr. 265). Die Dialektik ist die Erkenntnis des Seienden, Wahren, in der Erscheinungen Flucht sich gleich Bleibenden (peri to on kai to ontôs kai to kata tauton aei pephykos, Phileb. 57 E. 58 A). Der vom Eros (»platonischer Liebe«) getriebene Dialektiker will Erkenntnis des Seienden um ihrer selbst willen, er sucht das Wesen der Dinge (ton logon hekastou lambanonta tês ousias, Republ. 543 B).
In seiner Erkenntnislehre ist P. Rationalist, da nach ihm die Wahrheit nur durch die Vernunft, das reine Denken gefunden werden kann. Die Sinneswahrnehmung hat nicht das wahrhaft Seiende zum Objekt, ihre Gegenstände sind die im stetem Werden begriffenen Dinge, die nur Erscheinungen (Abbilder) der wahren Wirklichkeit sind. Die sinnliche Erkenntnis ist nur »Meinung« (doxa aus pistis und eikasia bestehend), unterschieden von der wahren Erkenntnis (noêsis, in dianoia und epistêmê zerfallend, Republ. V, 476 f., VII, 533 f.; Theaet. 210 A). Eine Mittelstellung nimmt die mathematische Erkenntnis ein (die niederste Art der noêsis ), indem die Gegenstände derselben in der Mitte stehen zwischen den Sinnendingen und den Urbildern derselben, (Republ. VI, 511 D; Tim. 27; Phileb. 56 ff.). Die Mathematik ist eine Betätigung des Denkens an anschaulichen Inhalten und operiert an der Hand von Voraussetzungen (hypotheseis). P. betont den Wert der mathematischen Erkenntnis, die am besten zur Dialektik vorbereitet. Die reine Erkenntnis ist die völlig unsinnliche Erfassung des wahrhaft und unveränderlich, an sich Seienden, des Allgemeinen, Typischen durch reines (schauendes) Denken (hautê di' hautês hê psychê ta koina moi phainetai peri pantôn episkopein). Die Erfahrung gibt nur die Gelegenheit zur geistigen Schau des Seienden, zur Wiedererinnerung, Anamnese (anamnêsis) an die Urbilder der Dinge, welche die Seele (im Zustande der Präexistenz) im überhimmlischen Orte dereinst unmittelbar geschaut hat (touto de estin anamnêsis ekeinôn, ha pot' eiden hêmôn hê psychê symporeutheisa theô kai hyperidousa ha nyn einai phamen kai anakypsasa eis to on ontôs, Phaed. 249 C; hêmin hê mathêsis ouk allo ti ê anamnêsis tynchanei ousa,, Phaed. 72 E). Alles Lernen ist also nur die Auffrischung von Spuren eines latenten, potentiell angeborenen Wissens, dessen Maßstäbe a priori an die Erfahrung herangebracht werden, so daß wir im Vorhinein feste Grundlagen, Normen und Werte zur Beurteilung des Gegebenen besitzen (oukoun ei men labontes autên pro tou genesthai echontes egenometha, êpistametha kai prin genesthai kai euthys genomenoi ou monon to ison kai to meizon kai to elatton, alla kai xympanta ta toiauta, Phaed. 75 C; Meno 86 A).
Das wahrhaft Seiende, im Unterschiede vom vergänglichen Sinnending, nennt nun P. Idee (idea, eidos). Sie ist der als seiend gesetzte Gegenstand[553] des reinen Gattungsbegriffs; denn daß der Begriff ein Korrelat in der Wirklichkeit hat, daß es von einem Nicht-Seienden keinen Begriff geben kann, davon ist P. überzeugt (Begriffsrealismus). Rein logisch genommen, ist die Idee der gedanklich (und in geistiger Anschauung) festgehaltene Typus, als dessen Modifikationen und Einzelfälle die unter einen Begriff fallenden, einen gemeinsamen Namen besitzenden Dinge oder Eigenschaften erscheinen, das rein begriffliche Wesen je einer Klasse von Gegenständen, an welchem sie alle teilhaben (z.B. die Löwenheit, die Menschheit, der Mensch an sich). Diese begriffliche Wesenheit wird für P. zur Norm, an welcher er die Einzeldinge mißt, zum Urbild einer Klasse von solchen, zu einem unabhängig vom Erkennen, an und für sich bestehenden Seienden, später sogar zu einem lebendigen, beseelten Wesen, so daß der Fortgang von einer logischen zu einer metaphysischen und schließlich mystisch-mythischen Auffassung der Ideen seitens P.s klar ist. Die Ideen sind reine Denkobjekte, »Noumena« (nooumena), feste, stets mit sich identische Typen, sinnlich nicht erfaßbar (tas d' au ideas noeisthai men, horasthai d' ou, Rep. VI, 507 B: nooumena monon, Tim. 51 D), ungeworden und unvergänglich (agennêton kai anôlethron, Tim. 52 A), ewig, raum- und zeitlos, allem Werden entzogen. Sie sind in einem »überhimmlischen« Orte (hyperouraniô topô); getrennt (chôris) von den Dingen bestehen sie an und für sich (auto kath' hauto meth' hautou, Sympos. 211 B). Sie sind die Ur- und Musterbilder der Dinge, die Vollkommenheitstypen derselben (paradeigmata); die Einzeldinge selbst sind schattenhafte Nachahmungen (mimêmata), Abbilder (eidôla), Gleichnisse, Erscheinungen der Ideen (ta men eidê tauta hôsper paradeigmata hestanai en tê physei, ta de alla toutois eoikenai kai einai homoiômata). Die Einzeldinge haben an den Ideen Teil (metechousin; Methexis, methexis, Parmen. 132 D), diese haben Gemeinschaft (koinônia) mit ihnen, sind in ihnen gegenwärtig (parousia, Parousie, Phaed. 100 D). Ideen gibt es von allem, was unter einen Gattungsbegriff fällt und einen gemeinsamen Namen hat, von Natur- und Kunstobjekten, von guten und schlechten, schönen und häßlichen Dingen, auch von Eigenschaften (eidos gar pou ti hen hekaston eiôthamen tithesthai peri hekasta ta polla, hois tauton onoma epipheromen, Rep. 569 A; Theaet. 186 A; vgl. aber Aristoteles, Met. XI, 3, wonach P. später nur Ideen von Naturobjekten angenommen hat). Das Verhältnis der Ideen zueinander (Über- und Unterordnung) entspricht dem logischen Verhältnisse der Begriffe. Später schreibt P. den Ideen Wirksamkeit, Leben, Beseeltheit, Vernunft zu, sie werden zu Ursachen, welche den Dingen ihr Wesen geben, ja sogar zu »Göttern« (Timaeus; vgl. Theaet., Phaed., Phileb., Sophist. 248). Schließlich hat P. (pythagoreisierend) die Ideen als (ideale) Zahlen aufgefaßt, die aus dem Einen (hen) als der Grenze (peras) und dem Unbegrenzten (apeiron) entstanden sind (Aristoteles, Met. I, 6; XIV, 1). Auch bezeichnet P. das apeiron als das Nichtseiende (mê on), das erst durch das peras Form, Bestimmtheit, Ordnung bekommt (zum peperasmenon, zur ousia wird, Phileb. 16 D, 24). Die Erkenntnis der Ideen schildert P. auch als eine Auffahrt der Seele zu dem überhimmlischen Ort, dem Sitze der Ideen (Phaedr. 247 f.)."
__
Platonismus, platonistisch > Universalienproblem und der ontologische Status der Allgemeinbegriffe.
Kutschera (2005), S. 99: "... Die Annahme, abstrakte Objekte gehörten einer von unserem Denken unabhängigen Realität an, bezeichnet man als Universalienrealismus oder Platonismus. Diese Position ist heute keineswegs überholt, vielmehr sind wohl die meisten Mathematiker Platonisten. Sie sind es, ohne eine Wiedererinnerung zu vertreten. Besseres haben aber auch sie nicht zu bieten. Der heutige Platonismus lebt zumeist davon, dass er seine erkenntnistheoretischen Schwierigkeiten ignoriert. [FN 24] Je weniger man sie ignoriert, desto stärker neigt man einem Konzeptualismus zu, nach dem abstrakte Objekte Konstrukte unseres Denkens sind."
__
Ontologisch, Ontologie > Zur Ontologie des Psychosozialen. > Sein.
Nach Aristoteles die Wissenschaft vom Seienden als solchen (> Bochenski).
__
Sch^3-Syndrom
Polemisch könnte man vom sch3-Syndrom sprechen: schwafeln, schwätzen, schwadronieren, was das Zeug hält. Diese "Geistes-Krankheit" beruht auf der Unsitte, im Allgemeinen und Abstrakten zu reden, dem Mangel an klaren Merkmalsbestimmungen und vor allem dem Verzicht auf Referenzieren wie auf Beispiele und Gegenbeispiele, kurz nicht zu beachten, was zu einer Begriffs-Definition gehört.
Dass Philosophie keine Wissenschaft ist, wird sogar von Philosophen klar und deutlich formuliert, wie z.B. von Husserl (1910/11) in Philosophie als strenge Wissenschaft. Ich nenne vier Fundstellen:
- 289/90 Dem Anspruch, strenge Wissenschaft zu sein, hat
die Philosophie in keiner Epoche ihrer Entwicklung zu genügen vermocht.
209/1 Ich sage nicht, Philosophie “sei eine unvollkommene Wissenschaft, ich sage schlechthin, sie sei noch keine Wissenschaft, sie habe als Wissenschaft noch keinen Anfang genommen, ...
291 Was die wissenschaftliche Weltliteratur der Philosophie in alten und neuen Zeiten uns an Entwürfen darbietet, mag auf ernster, ja ungeheurer Geistesarbeit beruhen; noch mehr, es mag der künftigen Etablierung wissenschaftlich strenger Lehrsysteme in hohem Mafie \g vorarbeiten: aber als ein Fond philosophischer Wis-[9]senschaft kann darin vorlâufig nichts anerkannt werden, und keine Aussicht besteht, etwa mit der Schere der Kritik da und dort ein Stück philosophischer Lehre herauszuschneiden.
291/2 Denn mit der schroffen Betonung der Unwissenschaftlichkeit aller bisherigen Philosophie erhebt sich sogleich die Frage, ob die Philosophie noch weiterhin das Ziel, strenge Wissenschaft zu sein, festhalten will, ob sie es wollen kann und wollen muß.
__
Sein
Hat es einen Sinn von dem Sein oder von Das Sein zu reden (> Bochenski)? Nun ja, wenn wir das tun, was durchaus verständlich und sinnvoll sein kann, dann müssen wir definieren und erklären, was wir mit Das Sein meinen. Danach erst lässt sich beurteilen, was davon zu halten ist.
Ewige Wahrheiten und absolutes Sein sind keineswegs nur mystische Ideen, sondern schlicht falsch. Nach allem, was wir wissen, werden die Menschen und ihre Schöpfungen einst aus diesem Weltall verschwinden, und zwar restlos. Wir werden nicht nur vergessen, sondern selbst das Vergessen wird eines Tages vergessen sein. Von der Menschheit bleibt nichts.
Man kann aus psychologischer Sicht - problematisch die unkritische Darstellung im Dorsch - über alles reden, wenn man es in vernünftiger Weise tut, wie Kamlah & Lorenzen es in ihrer berühmten Schrift Logische Propädeutik ausführen, was aber auch schon bei Aristoteles klar formuliert wurde, wenn er auch leider nicht erklärte, wie das nun genau praktisch anzuwenden und durchzuführen ist.
Der Objektive Geist im Dorsch (Abruf 21.09.18) "(= o.G.) [engl. objective mind], [PHI], nach Hegel der Geist in Gesellschaft, Staat, Sittlichkeit, Moral, Recht, während in Wissenschaft, Kunst, Philosophie und Religion der absolute Geist vorliegt. Dilthey versteht unter o.G. die Gesamtheit der geistigen Äußerungen und Niederschläge allen kult. Lebens (Kultur). Auch die Annahme Sprangers ist hier zugehörig, dass ein Geistiges überpersönlich bestehe und in der Kultur ebenso wie in der Natur sich gestaltlich verwirkliche und allem Sein entspr. sinnvolle Ziele gebe, auch dem Psychischen. Von solchem o.G., der mit dem Hegel’schen Begriff nicht mehr allzu viel gemeinsam hat, ist zu unterscheiden der «objektivierte Geist», der sich von dem geschichtlich bedingten o.G. dadurch abhebt, dass er «die obj. Werte begründet und dass er mit seinen idealen Forderungen (Normen, soziale), in denen das Seinsollende zum Ausdruck kommt, tief in unsere Lebenswirklichkeit hineinreicht und auf diese eine richtungsweisende Funktion ausübt». geisteswissenschaftliche Psychologie."
__
Material/ Sichten
Jaakko Die Intentionen der Intentionalität, in NHfPh 8, s. 66ff.
Standort: Sprachkritik.
*
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen (Überblick).
Zur Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalyse Begriff.
Definition Begriff. * Meinen *
Signierung Begriffe und Begriffsmerkmale (BM).
Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Wissenschaft site: www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, R. (DAS). Kritik des Sprachgebrauchs in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften Allgemeine, abstrakte, unklare, hypostase-homunkulusartige autonome Begrifflichkeiten und Geisterwelten. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/BABegriff/SprKritik.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_Sprachkritik_Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_
korrigiert: irs 30.09.2022 Rechtschreibprüfung über alles / irs 13.10.2018
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
23.10.23 Thomaes Tatbestand als autonom handelndes Subjekt aufgenommen.
30.09.22 irs Rechtschreibprüfung über alles
29.09.22 irs Korrektur Sarr, Felwine (dt. 2019. fr 2016) Afrotopia. Berlin: Matthes & Seitz
22.08.22 Homunkulesk-hypostatische begriffliche Entgleisungen.
04.07.22 Hinweis auf Rosenzweigs Fundamentalkkritik.
05.09.21 Kritik der Arbeit Quines Das Sprechen über Gegenstände.
17.10.19 Ekman - Gesichtsausdruecke.
29.11.18 Links bei Fichte.
17.11.18 Hegel-Ergänzungen.
03.11.18 Beispiele Neurowissenschaft.
01.11.18 Kopnin Dialektik als autonom handelndes Subjekt. * Der deutsche Geist.
31.10.18 Humboldt signiert.
23.10.18 Titelmodifizierung * Aufnahme eines Zufallsfundes: Bewusstseinsprotokoll von Charles S. Peirce.
14.10.18 Signierungen Arbeiten zur Ideenlehre Platons: Metzlers Philosophie-Lexikon * Enzyklopädie * Kutschera.
13.10.18 Erstmals ins Netz gestellt.
29.08.18 angelegt.