(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=00.00.2013 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 17.03.24
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Verstehen
mit einer Begriffsanalyse und Gebrauchsbeispielen
und der Gretchenfrage: Wie kann man prüfen,
ob man sich versteht?
Zum Geleit:
"... denn Worte können nur zwischen denen der wahren Verständigung
dienen, die gleiche Erfahrungen teilen."
Allan W. Watts (1961) Zen-Buddhismus.
Reinbek: rde. S. 20
"... allzu genau zu sein ist nicht immer ratsam"
Feynman, Richard P. (2001) Was soll das alles. München:
Piper. S. 13
Originalarbeit von Rudolf
Sponsel, Erlangen
_
Editorial Anlässlich des in memoriam Walter Toman 2013 zum Verstehen wurde ich angeregt, diesem kaum zu überschätzenden Begriff eine eigene Seite zu widmen, um folgenden Fragen nachzugehen: Welche Bedeutungen hat verstehen? Woher wissen, wir, dass wir uns verstehen oder verstanden werden? Welcher Voraussetzungen bedarf es, damit man sich versteht? Wie kann man prüfen, ob man sich versteht?
Zusammenfassung - Abstract - Summary
Verstehen kann als kommunikativer Grundbegriff aufgefasst werden, der im Alltag von den meisten Menschen ohne Probleme verstanden :-) wird. Man weiß, was verstehen bedeutet und wie man Verständnisprobleme im Dialog klären kann. Aus dem Meinen zu verstehen lässt sich aber nicht zwingend schließen, dass man sich tatsächlich versteht, was man oft erst später merkt.
In der Wissenschaft gibt es allerdings mit dem Verstehen eine Reihe von Problemen. Windelband führt 1894 den Gegensatz zwischen naturwissenschaftlicher Orientierung, die nach allgemeinen Gesetzen und Regeln sucht und dem idiographischen Einzelfall, der verstanden werden muss, ein. Und Dilthey führte 1994 den Unterschied zwischen erklären (Naturwissenschaft) und verstehen (Geisteswissenschaft) ein (erklären und verstehen). Es gibt nur eine Wissenschaft und deshalb halte ich diese Unterschiedskonstruktionen für nicht förderlich: sie sollten überwunden werden und aus dem entweder oder sollte wenigstens ein sowohl als auch werden.
Man versteht Worte, Begriffe, Erklärungen, Beschreibungen, Texte, Geschichten, Mitteilungen, Ereignisse, Vorgänge, Sachverhalte und vieles andere mehr. Aber versteht man wirklich?
Verstehen hat neben vielen Neben- drei Hauptbedeutungen: (1) geistiges nachvollziehen, begreifen (Verstbedeut ); (2) einfühlendes, mit- oder nacherlebendes verstehen (Versteinf) und (3) billigen, akzeptieren, gut heißen (Verstbillig). Hierbei sind (1) und (2) ähnlich; (3) fällt aus dem Rahmen. Zur genaueren Begriffsanalyse (> Methode) erscheint es sinnvoll, zunächst möglichst viele Bedeutungen zu erfassen, die man später, wenn genügend Material vorliegt, klassifizieren und zusammenfassen kann.
Verstehen gelingt dort am besten, wo es in eine gemeinsame Lebenspraxis eingebunden ist und auf ähnlichen Erfahrungen (> Watts) basiert. Die wichtigste Methode zur Prüfung, ob man sich versteht, ist das Gespräch, der Dialog und der Bezug auf Lebenspraxis und Erfahrung.
In den mir bislang vorliegenden Texten wird verstehen als anscheinend bekannter Grundbegriff nicht weiter erklärt und nicht einmal über Beispiele eingeführt - eine leider weitverbreitete Krankheit der Philosophie und Geisteswissenschaften.
Die psychologische Grundlage von verstehen ist das Denken, also geistige Modelle bilden und zueinander in Beziehung setzen. Das zwischenmenschliche Verstehen bedeutet demnach, ähnliche geistige Modelle bilden oder zueinander in Beziehung setzen.
Beispiele für Sachverhalte, die man verstehen kann:
- Reich mir bitte die Kanne.
- Mir ist nicht gut.
- Mach bitte das Fenster zu.
- Ich habe keine Lust aufzustehen.
- Die Sonne dreht sich scheinbar um die Erde.
- Was weiter weg ist, sieht kleiner aus.
- Ich sehe was, was du nicht siehst.
- Ein Unglück kommt selten allein.
- Ich bin unglücklich verliebt.
- Im Herbst fallen die Blätter.
Als allgemeine Regel kann dienen: alle Aussagen des Gesunden
Menschenverstandes sind in der Regel für fast alle verstehbar,
besonders, wenn unsere Forschungshypothese gilt: Menschen verstehen (Verstbedeut)
sich umso besser, je ähnlicher ihre kognitiven Strukturen, ihre Erfahrungen,
ihre Sprachsozialisationen sind und je mehr gemeinsame Lebenspraxis sie
haben.
_
Das Verstehens Paradox - Exaktheit des
Ungefähren
Dass man sich im Alltag und "Normalleben" anscheinend meist ohne Probleme
versteht, kann man fast als ein gewisses Paradoxon ansehen: die Exaktheit
des Ungefähren. So bald man genauer wird, wird es oft schwierig;
bleibt man im Ungefähren funktioniert es meist reibungslos. Dieses
Phänomen, Begrifflichkeit im Ungefähren, ist bislang psychologisch,
genauer sprach- und sozialpsychologisch, noch wenig erkannt und aufgeklärt.
Signierung für Verstehen im Ungefähren: _VerstU.
_
Grundfaehigkeiten
des Verstehens
- Man kann den Sachverhalt beschreiben (man verfügt also über eine Sprache zu diesem Sachverhalt).
- Man kann die gemeinte Bedeutung des Sachverhalts benennen.
- Man kann die gemeinte Bedeutung des Sachverhalts erklären.
- Man kann die einzelnen Elemente des Sachverhalts benennen.
- Man kann die einzelnen Elemente des Sachverhalts erkären.
- Man kann die kann Zusammenhänge der einzelnen Elemente des Sachverhalts erklären.
- Man kann Zusammenhänge des Sachverhalts zu anderen Sachverhalten erklären.
- Man kann Aufgaben zu einem Sachverhalt richtig bearbeiten.
Stufentheorie des Verstehens
Verstehen ist nicht gleich verstehen. Verstehen kann auf verschiedenen Stufen geschehen.
Für sich selbst / allein:
- Verstehen im Ungefähren nach dem allgemeinen Sprachgebrauch.
- Mehr Verstehen im Ungefähren durch etwas nähere oder weitere Erkundung (Nachfragen).
- Genaueres Verstehen durch zusätzliche Informationsaneignung (Wörterbücher, Lexika, Fachveröffentlichungen)
- Noch genaueres Verstehen durch Einbettung in Handlungen und Situationen: Beispiele und Gegenbeispiele.
- Wissenschaftliches verstehen.
- Verstehen im Ungefähren nach dem allgemeinen Sprachgebrauch.
- Mehr Verstehen im Ungefähren durch etwas nähere oder weitere Erkundung (Nachfragen).
- Genaueres Verstehen durch zusätzliche Informationsaneignung (Wörterbücher, Lexika, Fachveröffentlichungen)
- Noch genaueres Verstehen durch Einbettung in Handlungen und Situationen: Beispiele und Gegenbeispiele.
- Wissenschaftliches verstehen.
Praktische Haupt-Paradigmen
Für sich selbst
- Ich verstehe mein Denken ungefähr und was ich meine (nicht)
- Ich verstehe mein Denken (nicht) genau und was ich meine (nicht)
- Ich verstehe (nicht) ungefähr, was du sagen willst oder meinst.
- Ich verstehe Dein Denken und was Du meinst (nicht) genau
Nonverbale Signale des Nicht-/ Verstehens
- Fragender Blick
- Irritierter Ausdruck
- Ratloser Ausdruck
- Unverständnis kündender Ausdruck
- Kopfschütteln
- Abweisende, abwehrende Gestik
- ... ...
Operationale Zugaenge zum
Verstehen
Denken wir uns einen Menschen aus einer anderen Kultur mit einer fremden
Sprache. Dem soll jetzt ein Verständnis von einem a) Ei, b)
Kieselstein oder c) Zweig beigebracht werden. Was heißt hier Verständnis?
Woran kann man feststellen, ob A den Sachverhalt S versteht?
Lassen sich an ein Verstehen Handlungskonsequenzen knüpfen, so
dass man aus den Handlungen auf das Verstehen zurückschließen
kann?
Gehen auf die Metaebene etwa durch ein Verstehst Du mich? kann
zur Prüfung zwar eingesetzt werden, aber wie kann man prüfen,
ob die Antwort stimmt?
Wie Verstehen geht, kann man sich am besten durch verstehen klarmachen
Was heißt es, das Alphabet zu verstehen?
Was heißt es, englisch zu verstehen?
Was heißt es, einen Löffel zu verstehen? Name, Bedeutung,
Gebrauch
Was heißt es, einen Strumpf zu verstehen?
Was heißt es, einen Maulwurf zu verstehen?
Was heißt es, eine Krankheit zu verstehen?
Was heißt es, eine Unlust zu verstehen?
Was heißt es, einen Fernseher zu verstehen?
Was heißt es, ein Telefon zu verstehen?
Was heißt es, einen Blume zu verstehen?
Was heißt es, eine Schreibmaschine zu verstehen?
Was heißt es, eine Kraft zu verstehen?
Was heißt es, Licht zu verstehen?
Signierungen verstehen und erklären
Signierungsbeispiele
verstehen
Verstehen ist wie die meisten Worte ein vielfältiges Homonym
hat mehrere Grund- und Nebenbedeutungen. Im Sinne von Wittgenstein (> Methodik)
ergibt sich die Bedeutung eines Wortes, der einen Begriff einkleidet, durch
seinen Gebrauch (nach Index alphabetisch sortiert; in Klammern Beispiele):
- Verstabstr Verstehen von Abstraktem (> Stern 371)
- Verstalltag alltags- und anwendungsnah verstehbar (> EP-S.XI)
- Verstbedeut verstehen der Bedeutung einer Aussage: geistig nachvollziehen, begreifen. (> B02, )
- Verstben Verstehen als benennen, mit einem Namen belegen können. > VV00.
- Verstbereit verstehen als zu etwas bereit sein (> B06, )
- Verstbezieh Sich verstehen als Beziehungsmerkmal (> B10, )
- Verstbild verstehen von Bildern (> Stern 113)
- Verstbillig verstehen als (nicht) billigen, gut heißen, verstehen als (nicht) akzeptieren. (> I12, )
- Verstbiol biologische Ereignisse, Geschehnisse, Prozesse, Zustände verstehen,
- Verstdass verstehen dass ein Vorgang abläuft.
- Verstdef Verstehen als Floskel für einen Defintion oder Charakterisierung (unter ... verstehen wir ...) (> Stern 157), (> Stern 35)
- Verstdeut Verstehen als deuten, interpretieren, auslegen (> > Jaspers, Stern 25-29)
- Verstdif verstehen unterscheiden und differenzieren von ..., z.B. Verständnis haben. (> Stern 506) Eine Differenzierung wird zwar vorgenommen, aber nicht erklärt (-) > Heidegger (echtes verstehen).
- Verstdir Direkt, unmittelbar verstehen ohne weitere Interpretationsleistungen. Beispiele: Die Straße ist gesperrt. Ich habe Hunger. Das Betreten des Rasen ist verboten. Der Mond ist aufgegangen. Ich bin sauer. Das ist unnötig.
- Verstecht Merkmal von Heidegger > Heidegger (echtes verstehen).
- Versteinf emotionales verstehen: einfühlen, nacherleben können. (> Stern 506)
- Versteinh Einheit des Verstehens (> Stern 25-29)
- Versteins Verstehen als Einsicht, verstehen als einsehen (> Keyserling G04)
- Verstew Verstehen als erkennen, wahrnehmen oder Feststellen eines Sachverhaltes > VerstIdSV.
- Versterkl-verst erklären und verstehen (> Stegmüller)
- Verstford (Auf-) Forderung, zu verstehen (> Stern S.9, S.15, S.44, )
- Verstfrage Die Verstehensfrage stellen: verstehst Du das, mich oder X? (> I02, I05, I06, I08, B01, B12)
- Verstganzh verstehen im Ganzen, ganzheitliches Verstehen (> Stern 25-29, > G09-Dilthey-S.35, )
- Verstgemein verstehen setzt Gemeinsamkeit Mitverstehende voraus (> Bollnow G12-Bollnow-S.93ff, )
- VerstgsozM verstehen als geistes- und sozialwissenschaftliche Methode im Unterschied zum naturwissenschaftlichen erklären. (> Stern 25-29)
- Versthinweis Zu verstehen geben, verstehen als Hinweis (> B03, )
- Versthist historisches Verstehen. (> (> Stern 506)
- Versthypoth Hypothesen verstehen (> Stegmüller)
- VerstIdSV Verstehen als identifzieren eines Sachverhaltes. (>Cunningham), sehr ähnlich Verstew.
- Verstinteraktiv verstehen als interaktiver Prozess ( > G07, )
- Verstkausal kausales Verstehen, ursächlich verstehen ( > Stern 64, EP-S.244a, Kausalität; Graph)
- Verstkbed Bedingung für einen Vorgang. > Graph.
- Verstkanl Anlass für einen Vorgang. > Graph.
- Verstkaus Auslöser für einen Vorgang. > Graph.
- Verstkgur Grund oder Ursache für einen Vorgang. > Graph.
- VerstKind Verstehenszustand eines Kinder (> EP2-S.18)
- Verstklass verstehen als Klasseneinteilung erkennen oder wissen (> EP-S.241)
- Verstkönn Verstehen als können (sein Handwerk verstehen > Waismann)
- Verstkomm kommunikativ: die Worte und Aussage sprachlich verstehen. (> B03, B07, )
- Versthkonstr Verstehen als Kontruktion (z.B. einer neuen Wirklichkeit > Keyserling G04)
- Verstkritisch Kritisches Verstehen ( > G10-BollnowS.34)
- Verstkunst Verstehen als Kunst (> Stern 506)
- Verstlebendig Differenmzierung von Heidegger.
- Verslebvor lebensweltliches Vorverständnis (> G12-BollnowS93ff)
- Verstlern verstehen lernen, lehren, unterweisen, fördern (> EP2-S.10, )
- Verstmensch verstehen der Menschen, auch sich selbst (> Bollnow G12-Bollnow-S93ff, )
- Verstmess mehr oder minder gut verstehen, messen (schätzen) des Verstehens (> EP2-S.18,)
- Vertmissv Missverstehen (> I13, )
- Verstmoti motiviertres, interessiertes Verstehen; Motive verstehen ( > Stern 203)
- Verstnaterkl im Sinne naturwissenschaftlicher Erklärung (> noch ohne Beispiel, evtl. löschen)
- Verstnatwis naturwissenschaftlichen Verstehen (> Stegmüller)
- Verstnicht Nichtverstehen, etwas nicht verstehen, falsch verstehen, kein verstehen scheitern (> I10, G11-Gadamer2-S.57)
- Verstnorm Normen für verstehen, z.B. Erwachsenenverständnis (> > EP2-S.18,)
- VerstonS? verstehen ohne nähere Spezifikation oder unklare Bedeutung (> I10, I12, I13,)
- Verstprozess Verstehen als Prozess (> I10, G08, )
- Verstpsych psychologisches Verstehen (> kritisch Bollow B12-BollnowS93ff)
- VerstssB Sonstige spezifische Bedeutung (> Stern 144)
- Versttest Verstehenstest (Piaget > EP-S.130)
- Verstheorie Theorie des Verstehens (> G03, G05, G06, Stern 25-29, )
- Versturspr ursprüngliches Verstehen nach Heidegger, wobei unklar bleibt, was er damit meint. > Heidegger.
- Verstvield verstehen als vieldeutiges Homonym. (> Stegmüller)
- Verstwarum verstehen warum ein Vorgang abläuft.
- VerstWbild verstehen in einem Weltbild > Quantenmechanik.
- Verstwie verstehen wie ein Vorgang abläuft. > VV1.
- VerstWelt verstehen der Welt (> EP2-S.16, )
- Verstwert Verstehen als Wert, Vorteil im Leben (> I09, )
- Verstwis verstehen als wissen (> I04, B19, ), siehe bitte auch Verstname.
- Verstwiss wissenschaftliches verstehen (> EP2-S.18, )
- Verstwitz verstehen von Witzen (> Stern 98)
- Verstzirkel Zirkel des Verstehens: vom Ganzen zum Teil und vom Teil wieder zum Ganzen. (> G11-Gadamer2-S.57)
- Verstzusam verstehen eines Zusammenhanges; Sinnerfassung. (> Stern 25-29)
Verstname verstehen als wissen, wie etwas heißt, den Namen wissen (entwicklungspsychologisch bedeutsam). Allgemeinbegriff: dies ist ein Hund; Eigenname: dies ist Bello. Namen braucht man, damit man gerufen werden kann und verschiedene, ähnliche Sachverhalte, Gegenstände oder Personen unterscheiden kann).
Signierungsbeispiele
erklaeren (zur Abgrenzung und zum Kontrast)
Viele Bedeutungen des Wortes verstehen lassen sich auch dem Wort erklären
zuordnen.
- Erklbedeut Bedeutungserklärung, Begriffserklärung
- Erklbegrü Erklären im Sinne von begründen
- Erkldeuten Erklären als deuten, interpretieren, auslegen.
- ErklGründe Gründe G für einen Sachverhalt S angeben: S wird durch G erklärt.
- ErklHOS Hempel-Openheim-Schema
- ErklonS? erklären ohne nähere Spezifikation oder unklare Bedeutung
- Erklpraxis Erklären wie man etwas macht.
- Erklrechtf Erklären als rechfertigen
- ErklssB Sonstige spezifische Bedeutung
- Erkltheorie Theorie des Erklärens, z.B. HOS.
- Erklursach Ursachen U für einen Sachverhalt S angeben: S wird durch U erklärt.
- Erklverst Erklären im Sinne von verstehen
- Erklzusam Einen Zusammenhang erklären: was hängt wie mit wem zusammen?
Entwicklungspsychologie des Verstehens
EP Auswahl aus Siegler et al.
Siegler, Robert; Eisenberg, Nancy; DeLoache, Judy & Saffran, Jenny
(2016) Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. Berlin: Springer.
Verstehen wird in dem Buch nicht weiter differenziert und erklärt. Die Kenntnis der Bedeutung von Verstehen wird offenbar als allgemein bekannter Grundbegriff vorausgesetzt. Dabei wäre gerade für die kognitive Entwicklung ein differenziertes Bild der Verstehensbedeutungen sehr wünschenswert.
Verstehen weist folgende Sachregistereinträge auf: Verstehen 245,
250, 253, 300, 303
–– biologische Prozesse 253
–– Denkweise anderer 250
–– Emotionen 245
–– Handlungsabsicht 245
–– mathematisches Konzept 303
–– menschliches Erleben 245
–– metakognitives 300
–– Test 130
Verständnis weist folgende Sachregistereinträge auf:
Verständnis 137, 211, 245, 248, 250, 306, 377
–– Autismus 248
–– biologisches 137
–– des Denkens 248
–– emotionales 377
–– frühes 245
–– metakognitives 306
–– soziales 250
–– teilen 211
Ausgewaehlte Gebrauchsbeispiele
EP-S.XI: "Auch waren wir bemüht, Fachsprache
und Umgangssprache so zu verzahnen, dass die unterschiedlichen Terminologien
in den verschiedenen theoretischen Ansätzen und Kontexten alltags-
und anwendungsnah verstehbar (Verstalltag)
bleiben."
EP-S.5: "Das Wesen des Menschen verstehen
(Verstzusam) Ein dritter Grund für
die Erforschung der Kindesentwicklung besteht darin, dass man das Wesen
des Menschen besser verstehen (Verstzusam)
lernt."
EP-S.6: "In Kürze Für die Untersuchung
der Kindesentwicklung gibt es mindestens drei gute Gründe: Man kann
die Erziehung der eigenen Kinder verbessern, zur Verbesserung der sozialen
Situation von Kindern im Allgemeinen beitragen und die Natur des Menschen
besser verstehen (Verstzusam)."
EP-S.11a: "Forscher, die die Entwicklung als
diskontinuierlich betrachten, gehen von einer allgemeinen Beobachtung aus:
Kinder verschiedenen Alters erscheinen qualitativ unterschiedlich. Beispielsweise
unterscheiden sich Vier- und Sechsjährige nicht nur darin, wie viel
sie wissen, sondern in der gesamten Art und Weise, wie sie die Welt verstehen.
(Verstdif)"
EP-S.11b: "Etwa vom zweiten Lebensjahr an geben
Kinder in gespielten Szenen manchmal vor, jemand anders zu sein. Zum Beispiel
behaupten sie, dass sie jetzt Superhelden im Kampf mit Monstern oder Eltern,
die sich um ein Baby kümmern, seien. Neben dem intrinsischen Vergnügen
bringen diese Fantasiespiele wertvollen Lernzuwachs, beispielsweise darüber,
wie
man mit Ängsten umgeht oder eigene Reaktionen und die anderer Menschen
versteht (Verstzusam)
(Howes und Matheson 1992; Smith 2003)."
EP-S.32: "Mit Einführung der wissenschaftlichen
Methode wurden große Fortschritte beim Verstehen
(VerstKind) von Kindern möglich."
Aus Kapitel 4: Theorien der kognitiven Entwicklung:
EP-S.119: "Kinder unter acht Monaten reagieren
auf das Verschwinden eines Objekts so, als ob sie nicht verstehen
(ErklssB - hier Objektpermanenz)
würden, dass das Objekt immer noch existiert; sie besitzen noch keine
Vorstellung von Objektpermanenz."
EP-S.130: "Säuglinge und Kleinkinder sind
kognitiv kompetenter, als Piaget dachte: Piaget gab Kindern relativ schwierige
Verstehenstests
(Versttest) vor. Das führte ihn
dazu, die frühesten Konzepte, über die Säuglinge und Kleinkinder
bereits verfügen, zu übersehen. Beispielsweise durften die Kinder
bei Piagets Test zur Objektpermanenz erst einige Sekunden nach dem Verstecken
nach dem verborgenen Objekt greifen; Piaget behauptete, dass Kinder dies
nicht vor ihrem achten oder neunten Lebensmonat tun. Allerdings zeigten
alternative Tests zur Objektpermanenz, bei denen die Blickfixationen des
Kindes analysiert werden, nachdem das Objekt aus dem Sichtfeld verschwunden
ist, dass Kinder bereits mit drei Monaten ein gewisses Verständnis
(ErklssB - hier Objektpermanenz)
der kontinuierlichen Existenz von Objekten besitzen (Baillargeon 1987,
1993)."
Aus Kapitel 7: Die Entwicklung von Konzepten:
EP-S.241: "Die Dinge verstehen (Verstklass)
:
Wer oder was Objekte in Klassen einteilen
Schon früh in ihrer Entwicklung versuchen Kinder zu verstehen
(VerstWelt),
welche Arten von Dingen es auf der Welt gibt. Zunächst einmal teilen
sie die Dinge, die sie wahrnehmen, in die drei allgemeine Kategorien ein:
unbelebte Objekte, Menschen und andere Lebewesen (dabei sind sie jedoch
noch einige Jahre unsicher, ob Pflanzen eher den Tieren oder den unbelebten
Objekten ähneln) (Gelman und Kalish 2006). ..."
EP-S.242: "Wie in ? Kap. 5 erwähnt, verstehen
(Verstzusam) beispielsweise schon
drei Monate alte Säuglinge, dass ein Objekt (wie etwa ein Glas) zu
Boden fallen wird, wenn es nicht durch ein anderes Objekt (etwa einen Tisch)
unterstützt wird; allerdings dauert es bis zum Alter von fünf
Monaten, bis die Säuglinge auch verstehen
(Verstzusam),
dass ein Objekt dann herunterfallen wird, wenn nur ein kleiner Teil des
Objekts gestützt wird (Baillargeon 1994)."
EP-S.244a: "Allgemein hilft das Verstehen
(Verstkausal) von Ursache-Wirkungs-Beziehungen
Menschen jeden Alters beim Lernen und Behalten"
EP-S.244b: "Für die Bildung vieler Begriffsklassen
ist das Verstehen (Verstklass),
(Verstkausal) von Kausalbeziehungen
unerlässlich."
EP-S.245a: "Im Zentrum der naiven Psychologie
stehen drei Konzepte, die wir alle normalerweise heranziehen, um das menschliche
Verhalten zu verstehen (Verstdif):
Wünsche, Überzeugungen und Handlungen."
EP-S.245b: "Entwicklung im späteren Kindesalter
Im Kleinkind- und Vorschulalter bauen Kinder auf ihren früh entstandenen
psychologischen Grundkenntnissen auf, um ein immer differenzierteres Verständnis
von sich selbst und anderen Menschen zu entwickeln und auf immer komplexere
Weise mit anderen zu interagieren. In zwei Bereichen ist diese Entwicklung
besonders eindrucksvoll: bei den Spielaktivitäten und beim Verstehen
(Verstzusam) des menschlichen Erlebens
und Verhaltens."
EP-S.246: "Ein wichtiger Bestandteil einer solchen
Theory of Mind, das Verstehen (Verstzusam)
der Verbindung zwischen den Wünschen anderer Menschen und ihren Handlungen,
taucht gegen Ende des ersten Lebensjahres auf."
EP2 - Auswahl aus Entwicklungspsychologie 2
Köhnlein, Walter ; Marquardt-Mau, Brunhilde & Helmut
Schreier (1997, Hrsg.) Kinder auf dem Weg zum Verstehen der Welt. Bad Heilbrunn:
Klinkhardt. [... E-Books/PsychologiePDF/EntwickPsy/Koehnlein_MarquardtMau_Schreier_1997_Kinder_auf_dem_Weg.pdf]
EP2-S.7: "... Das „Verstehen (Verstprozess)der Welt“ ist demgegenüber keineswegs eine vorgegebene Konstante, sondern ein Prozeß, der vielfältige Konstruktionsmöglichkeiten zuläßt. ..."
EP2-S.8: "Die hier zusammengetragenen Texte befassen sich mit jedem der drei im Titel des Buches angesprochenen Begriffe. Sie gehen etwa folgenden Pagen nach: Was heißt „Kinder“ und „Kindheit“?; Was heißt „Verstehen“ (Verstfrage), (Verstdef), (Versttheorie) ?; Was heißt „Welt“ oder „Wirklichkeit“? Zwar ist in jedem der Beiträge jeweils der gesamte Zusammenhang des Titels unter der Perspektive eines bestimmten Faches oder einer bestimmten Forschungs-Tradition reflektiert, aber Unterschiede der Betonung gestatten die Untergliederung in drei Teile, die dem Lesenden den Zugang erleichtern. So ergibt sich die äußere Form als ein Bild, das Bilanzierungsversuche (entsprechend dem Forschungstyp der Metaanalyse), Annäherungen an Verstehensprozesse (Verstprozess) von Kindern und Vorschläge oder Programme zur künftigen Orientierung der Forschung umfaßt. Die Reihenfolge entspricht der Vorstellung des fortschreitenden Forschungsprozesses: Am Anfang der Blick zurück, am Ende der Blick in die Zukunft (oder das, was wir dort wahmehmen), dazwischen das, was in der Gegenwart zur Wirksamkeit zu gelangen versucht und in die Unterrichtspraxis hineindrängt."
EP2-S.10: "Der zweite Teil Überlegungen zum Verstehenskonzept (Versttheorie) enthält solche Texte, die auch als „Annäherungen an die Lebenswelt von Kindern“ akzentuiert werden könnten. Das Verstehenskonzept(Versttheorie) ist hier insofern zentral und auf fundamentale Weise von dem unterschieden, das im drittenTeil zugrundegelegt wird - was bei Gelegenheit des dritten Teils näher zu erläutern ist -, als die Verfasser der vier Texte von der Möglichkeit ausgehen, daß Verstehen (Versttheorie) im Sinne der Entdeckung eines unabhängig vom erkennenden Menschen gegebenen Zusammenhangs überhaupt möglich ist. In diesem Sinne erinnert Kay Spreckelsen an die eigentliche Schlüsselqualifikation von Didaktikern des Sachunterrichts, die in ihrer Fähigkeit liegt, die zunächst gewissermaßen stummen und dumpfen Gegenstände der Umwelt in rätselhafte Phänomene zu verwandeln, welche Kinder ansprechen und die dazu geeignet sind, die lernenden Kinder auf die Spur zum Verstehen (Verstlern) der Welt zu führen. Daß dies Verstehen (VerstonS?) eben nicht ins Abgründig-Chaotische, sondern in die wohlgeordnete und bewundernswert schöne Welt namens Kosmos mündet, ist auch die dem „Philosophieren im Sachunterricht“ [>11] von Martin Ganter eingeschriebene Orientierung."
Dollase, Rainer (1997) Entwicklungspsychologische Grundlagen des kindlichen Weltverstehens. In (16-38) Köhnlein et al. (1997, Hrsg)
EP2-S.16: "Entwicklungspsychologische Grundlagen des kindlichen Weltverstehens (Versttheorie) Weithin wird akzeptiert, daß die Entwicklungspsychologie versucht, die Veränderungen des Erlebens und Verhaltens eines Menschen während seiner Lebensspanne zu beschreiben und zu erklären (vgl. Oerter, Montada 1982, S. 3 f). Die Beschreibung und Erklärung der Veränderung von Erleben und Verhalten schließt das Verstehen (VerstWelt) der Welt ein, allerdings ist der Begriff „Weltverstehen” (VerstWelt) heute ungebräuchlich. Er erinnert eher an Klassiker der Entwicklungspsychologie, z.B. an Wilhelm Hansen „Die Entwicklung des kindlichen Weltbildes” (1949, 2. Auflage). Heute ist die Frage nach der „Entwicklung des Weltverstehens” (VerstWelt) in die kognitive Entwicklungspsychologie bzw. die Informationsverarbeitungstheorie (z.B. nach Trautner 1992 bzw. Miller 1993) einzuordnen, deren Ahnen mit Namen wie Piaget, Bruner oder Wygotski (nach Gage und Berliner 1996) so wie vielen anderen angegeben werden. Das zugehörige Forschungsgebiet ist derart gigantisch umfangreich und komplex, daß eine knappe Zusammenfassung lediglich ein paar Grundstrukturen benennen kann."
EP2-S.16b: "1. Der Gegenstand: das Verstehen (VerstWelt) der Welt Der umgangssprachliche Begriff „verstehen” (Versttheorie) ist keineswegs eindeutig, er hat mehrere Bedeutungen (z.B. von „ich verstehe mich als Arno Schmidt Fan” bis zu „ich verstehe etwas von Soziometrie”). „Weltverstehen” (VerstWelt) verweist auf Kognitionen des Menschen, die ihn befähigen, die soziale und nicht soziale Umwelt zu „verstehen” (VerstWelt) (im Sinne von „sich auskennen, besondere Kenntnisse haben”) (Verstdif), (Verstwis)."
EP2-S.17: ""Zum Weltverstehen (VerstWelt) ist also nicht nur Speicherung von Information nötig, sondern auch Verarbeitung, Motivierung und Steuerung.
EP2-S17b: "Die verstehende(VerstonS?) Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt produziert keineswegs nur Wissen, kognitive Schemata, Strategien etc. über sich selbst und die Umwelt, sondern auch sogenannte metakognitive Wissensbestandteile und -prozesse (vgl. Hasselhom 1992 in Nold). Zu diesen Metakognitionen gehören z.B. das Wissen über das eigene kognitive System, das Wissen über Strategien, aber auch sogenanntes epistemisches Wissen, z.B. Wissen über die Inhalte und Grenzen des eigenen Wissens oder über dessen Verwendungsmöglichkeiten sowie über exekutive Prozesse, wodurch eigene Lernprozesse geplant, überwacht und gesteuert werden können. Hinzu käme auch noch eine gewisse Sensitivität für die Möglichkeiten kognitiver Aktivitäten (Erfahrungswissen und Intuition) sowie metakognitive Erfahrungen bezüglich der eigenen kognitiven Aktivität (z.B. bewußte kognitive Empfindungen und bewußte affektive Zustände). Wie weit allerdings Grundschulkinder über metakonzeptionelle Kognitionen verfügen, ist nach wie vor noch strittig (vgl. Sodian 1995)."
EP2-S.18: "Wenn man sagt, „dem Kinde gelingt ein zunehmend besseres Verstehen (VerstWelt) der Welt” so impliziert dies die Verfügbarkeit über einen Maßstab schlechten bzw. besseren Verstehens (Verstmess). Zumeist wird das erwachsene Verstehen (Verstnorm) als Norm oder Maßstab genommen - was leicht zu problematisieren ist. Auch die Messung des Verstehens (Verstmess ) von Welt am wissenschaftlichen Erkenntnisstand ist nicht unumstritten - dieser ist stets grob unvollständig, zum Teil falsch und möglicherweise unter funktionalen Überlegungen „schädlicher” für ein zukunftsfähiges Handeln als der kindliche Verstehenszustand (VerstKind). Jedenfalls gilt für kindliches, erwachsenes und wissenschaftliches Weltverstehen (Verstwiss) gleichermaßen die Unvollständigkeit, das Nicht- und Falschverstehen als normale Erscheinung."
II. Überlegungen zum Verstehenskonzept
Spreckelsen, Kay (1997) Phänomenkreise als Verstehenshilfe. In
(111-127) Köhnlein et al. (1997, Hrsg)
Denken und Verstehen
Texte von der Hauptseite denken0:
2
Grundaufgaben des Denkens:
1. Geistige Re-Präsentation und 2. Verstehen der
Welt
2.0
Philosophischer Einstiegs-Exkurs zur Erkenntnistheorie.
Die Denkpsychologie hat seit langem bedeutende Vorfahren:
1) die Mathematik und Logik als bislang höchste Form reinen Denkens,
2) die Erkenntnistheorie, früher meist von Philosophen, heute teilweise
von WissenschaftstheoretikerInnen betrieben und 3) die empirischen,
besonders die sehr erfolgreichen Natur-Wissenschaften. Nicht zu vergessen
ist natürlich das Denken im Alltag. Fast alle Menschen denken nahezu
ständig. Das Denken spielt sozusagen eine überragende Rolle im
Leben. Das Denken ist somit Forschungsgegenstand vieler Wissenschaften,
einschließlich des alltäglichen Denkens. Nur in diesem Punkt
hat
Ryle mit seiner
Kritik an der Denk-Psychologie recht.
Die philosophische Erkenntnistheorie führt
aber leider nicht weiter, weil sie nur
auf das Denken setzt. Das ist zwar auch in der Mathematik so, aber
dort diszipliniert der Beweis
sehr streng und sehr radikal. Ansonsten sind die meisten Wissenschaften,
die diesen Namen verdienen, an die Erfahrung gebunden und werden auch an
ihr geprüft. Aber nicht nur die mathematische Beweisstrenge, auch
die empirische Anbindung fehlt der Philosophie in ihrer genuinen
Denkpraxis meist gänzlich, so bleibt sie meist auf dem Niveau von
Theologie, Meinungsideologien oder anderen Glaubensgebäuden stehen
(Ausnahmen). Daher
soll der Ausflug in die philosophische Erkenntnistheorie sehr kurz gehalten
werden.
Gibt es die Welt, das Ding an sich [Kant,
Eisler],
also eine "objektive" Welt? Oder gibt es die Welt immer nur relativ
zu einem Erfassungs- , Erkenntnis- und Konstruktionssystem? Obwohl wir
das Ding an sich [Kant,
Eisler]
per definitionem eigentlich gar nicht erkennen können, braucht es
das auch nicht, wie uns besonders die Naturwissenschaften zeigen und vormachen.
Die Wissenschaften haben ihre Erkenntnisse unabhängig von ihrer Stellungnahme
zum Ding an sich [Kant,
Eisler]
und der Philosophie gewonnen. So gesehen kann man also getrost auf die
nur
denkende Philosophie verzichten. Denken, vor allem richtig denken, ist
zwar eine notwendige Bedingung für wissenschaftliche Erkenntnis und
Fortschritt, aber sie reicht natürlich längst nicht hin.
Die Begrenztheit unseres direkten Erkenntnisvermögens
durch unsere Sinne wurde durch die Entwicklung von Meßgeräten
wenn auch nicht gänzlich überwunden, so aber doch sehr stark
erweitert. Wir wissen dank der (Natur-) Wissenschaft über die Welt
viel, viel mehr als wir nach unseren Sinnesorganen wissen könnten.
Das eben ist der große Vorzug aller Wissenschaft:
sie erweitert unser naives Erfahrungswissen, unser gewöhnliches Denken
oder unseren naiven Glauben. Dieses Wissen ist wesentlich eine Errungenschaft
des wissenschaftlichen Denkens.
Die alte Frage nach dem Ding an sich hat
im 20. Jahrhundert eine neue und radikale Interpretation durch den Konstruktivismus
erfahren, wobei mit diesem oft in vulgärkonstruktivistischer
Manier das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet wird. In der
Wissenschaftstheoretischen Bewegung sind nicht wenige fragwürdige
Geister unterwegs und es ist manchmal sehr schwer, die Spreu vom Weizen
zu trennen.
Die allgemeinen wissenschaftstheoretischen Hilfsmittel
zum Verstehen der Welt behandle ich unter den Methoden 4.3
2.1. Geistige Re-Präsentation
Als erste Grundaufgabe des Denkens kann gelten: Geistige Modelle der Welt (einschließlich von sich selbst) bilden und zueinander in Beziehung setzen, wobei in Beziehung setzen schon ein gewisses Verstehen - zumindest erste (implizite) Hypothesen - bedeutet, wodurch 2.1 und 2.2 zusammenhängen. Wahrscheinlich ist eine isolierte begriffliche Erkenntnis ohne begriffliche Umgebung und Kontext auch gar nicht möglich. Die Welt-Repräsentation ist - psychologisch gesehen - geistig aus Begriffen aufgebaut, die zueinander in Beziehung stehen und dadurch eine Re-Präsentation der Welt ermöglichen. Jeder Mensch erschafft - meist ohne das besonders zu bemerken, er denkt "einfach" - seine eigene subjektive Welt. Naive Menschen halten ihre eigene subjektive Welt für die Welt schlechthin und glauben, dass die Welt so ist, wie sie ihnen erscheint, wie sie sie erleben. Kritische Geister wissen um die Subjektivität und Relativität ihrer Konstruktionen. Die persönliche Erschaffung eines Modells der Welt oder von ihren Teilen ist eine konstruktive Leistung, die mit anderen Modellen, auch anderer Menschen, teilweise übereinstimmen oder nicht übereinstimmen kann. So lässt sich auch der schwierige Wahrheitsbegriff als Relation zwischen Wirklichkeitsmodellen vernünftig begründen
2.2 Verstehen
der Welt
Wozu brauchen Lebewesen ein Verständnis der Welt? Nun, die Antwort
hat Darwin gegeben. Wer seine Welt verstehen kann, überlebt eher und
lebt womöglich auch besser. Verstehen der Welt dient also der Sicherung
der Existenz und ihrer Qualität. Geht man von diesen beiden
Elementarzielen aus, so sollte auch Erziehung, Schule, Ausbildung, Arbeit
und Beruf an diesen Elementarzielen ausgerichtet sein. Leider lernt man
- gemessen an den beiden Elementarzielen - viel überflüssigen
Plunder in der Schule, aber nicht das, was man in seinem Leben wirklich
brauchen kann und was weiter führt.
Ausgehend von den beiden Elementarzielen, die Existenz
und ihre Qualität zu sichern, käme es in der Hauptsache darauf
an, die Welt, sich selbst und die anderen so zu begreifen, das sich einem
Zusammenhänge, Gesetzmäßig- und Regelhaftigkeiten erschließen.
4.4 Die Sicherung des Verstehens zum Zwecke forschender Kommunikation.
Für die meisten Untersuchungen zum Denken ist Verstehen eine wichtige Voraussetzung. Eine Denkaufgabe kann nur dann sinnvoll ausgeführt werden, wenn verstanden wird, was zu tun ist. Damit gelangen wir in einen grundlegenden Zirkel. Denn beim Verstehen von Aufgaben, ist Denken beteiligt und auch eine Sprache nötig. Verstehen ist ein grundlegender Begriff, der nur auf dem ersten Blick klar scheint. Tatsächlich dürfte es in den meisten Situationen so sein, dass wir zwar meinen oder glauben, zu verstehen - aber verstehen wir "wirklich"? Wie können wir prüfen, ob wir "wirklich" verstehen? Wie macht man das? Die einfachste Möglichkeit, verstehen zu prüfen, geht über das Verhalten oder Handeln.
4.4.1 Paradigmatisches
Grundproblem:
Wie kann man feststellen und ermitteln, welchen Begriff
ein Kommunikator mit der bildlichen oder lautlichen Ausdruckshülle
eines Wortes verbindet? Das Problem hat in allen Wissenschaften, die mit
Erleben und Verhalten zu tun haben, eine kaum zu überschätzende
Bedeutung.
Aus dieser Fragestellung ergibt sich sofort die
nächste und noch grundlegendere Frage: was können oder sollen
wir unter einem
Begriff verstehen? Eine Idee, eine Vorstellung,
ein kognitives Schema, eine mehr oder minder deutliche Merkmalskombination
in dieser oder jener Kommunikationssituation? Auf den ersten Blick scheint
intuitiv klar, was wir unter einem Begriff verstehen können, etwa
dadurch, dass wir Beispiele und Gegenbeispiele für Begriffe angeben
können, z.B. Baum, Anfang, und, .... Tatsächlich geben wir beim
Kommunizieren aber
nur Worte an. Worte sind aber nur die
"Kleider" der Begriffe. Sie repräsentieren oder bezeichnen
einen Begriff, aber welchen nun genau? Man könnte auch sagen, mit
Worten
rufen wir in unserem Geist, in unserem Gedächtnis, in unserer Erfahrung
Begriffe auf. Aber welche? Wie geschieht das? Wie können wir prüfen,
welcher Begriff sich bei diesem oder jenem Menschen, in dieser oder jener
Situation, mit diesem oder jenem Wort verbindet? Fragen wir nach und ausführlicher,
erhalten wir als Antwort wiederum Worte, so dass sich ein sog. unendlicher
Regress, ein nicht endender Frage- und Wortkreislauf anbahnt. Aus empirisch-
operational- wissenschaftlicher Sicht sind daher vor allem solche Methoden
erwünscht, die nicht nur eine Prüfung gestatten, sondern auch
ein Ende haben. Beispiel: Es bestehe die Aufgabe darin, aus drei Gegenständen,
die blau, rot und gelb sind, einen auswählen. Aus der Wahl lässt
sich bei ehrlichen Probanden schließen, ob z.B. die Begriffe blau,
rot, gelb zur Verfügung stehen. Relativ einfach erscheinen hierbei
Begriffe, die Äußeres, Wahrnehmbares, Zeigbares betreffen. Sehr
viel schwieriger wird es, wenn die Begrifflichkeit von Innerem, Erleben,
Gefühlen oder Stimmungen, Wünschen, Bedürfnissen oder Zielen
zu überprüfen sind.
4.4.2 Fuzzy-Begrifflichkeit
im Alltag. In alltäglichen kommunikativen Situationen begnügt
man sich meist mit einem ungefähren Verständnis, d.h. man prüft
hier meist gar nicht, was gemeint ist, sondern nimmt eine Bedeutung einfach
an. In der Psychodiagnostik und Psychotherapie kann dies sehr problematisch
werden, weil man möglicherweise nur meint, sich zu verstehen. Fragt
man etwa:
Welche Gefühle kennen Sie? und fragt nicht: Welche
Gefühle kennen Sie vom eigenen Erleben her? kann man Antworten
bekommen, die nur den Wortschatz der Gefühle einer Person repräsentieren,
aber nicht das Erleben. Fühlprobleme werden so vielleicht übersehen.
Andererseits ist die Idee reizvoll, dass die Alltagswelt
vielleicht gerade deshalb praktisch funktioniert, weil man sich mit dem
Ungefähren begnügen kann. Man konnte unter 4.1 oben schön
sehen, dass die Dinge vielleicht erst dann richtig schwierig werden, wenn
man sie genau und ausdrücklich zu erfassen sucht. Vielfach gibt es
keinerlei Probleme zu verstehen, was jemand meint, auch wenn viele objekt-
und metasprachliche Ebenen ineinander verschachtelt sind. Erst wenn man
genauer einzudringen versucht, stellt man fest, dass es dann kompliziert
und schwierig werden kann. Kaum ein des Rechnens mächtiger Mensch
hat ein Problem mit den natürlichen Zahlen, jeder weiß, wie
sie aufeinander folgen und wie man ihnen umgeht, zählt und rechnet
- bis man sich fragt: gibt es alle? Und was bedeutet hier alle?
Und was heißt geben? Gibt es Dinge, die sich selbst enthalten?
Gibt es Unvollendbares als Vollendetes? Gibt es Teile eines Ganzen, die
genau so groß sind wie das Ganze?
Das Verstehens Paradox - Exaktheit des Ungefähren.
Elementare denkpsychologische Untersuchung des Verstehensprozesses.
Zur genauen denkpsychologischen Untersuchung des Verstehensbegriffs empfehlen sich einfache operationale Versuche, die man mit jedem ab einem IQ von 90 ohne Aufwand durchführen kann.
VV0 Verstehens-Versuch 0
Die VersuchsleiterIn präsentiert die Graphik und stellt die Fragen:
Können Sie bitte beschreiben, was Sie wahrnehmen oder erkennen?
 |
Die "einfach" erscheinende Aufgabe erfordert einige kognitive Fähigkeiten,
nämlich: Ich muss die Worte oder Zeichen und Begriffe Hintergrund
oder Umgebung, Bild, Bild aiA, Bild aaA, Viereck, Kreis, grün,
a, A, oben-links, innen und außen unterscheidend erkennen können.
_ |
Mit dieser Aufgabe wird sichergestellt, dass die Versuchsperson(en)
die Worte und Begriffe, die für die nächste Aufgabe erforderlich
sind, versteht. (Verstben).
Verstehen
(Verstben) wird hier also durch Abfragen
von Wahrnehmungen und ihren Benennungen erfasst. Wahrnehmungen
benennen können ist damit ein wichtiges Kriterium für
verstehen (Verstben).
_
VV1 Verstehens-Versuch 1 Vorgang verstehen
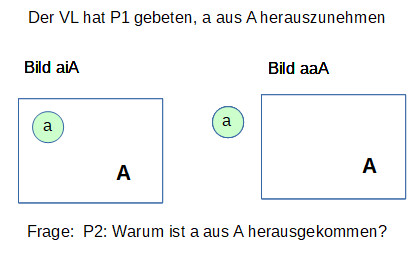 |
P2 hört die Bitte des VL an P1, a aus A herauszunehmen. P1 ergreift
a, nimmt es aus dem Viereck A heraus und platziert es oben links außerhalb
des Vierecks A (Bild aaA).
P2 versteht den Vorgang, wie a in aaA platziert wurde. Geprüft wird das, indem man sich den Vorgang von P2 beschreiben lässt. _ _ _ _ _ |
Die etwas genauere Analyse der Voraussetzungen, wie es zur Auslagerung von a kommt, ergibt:
- P1 hat die Bitte des VL verstanden
P1 hat die Bitte des VL akzeptiert
P1 folgt der Bitte des VL, ergreift a und legt es außerhalb A auf (das geht z.B. nicht, wenn a festgeklebt ist, es muss also vorausgesetzt werden, dass a nur aufliegt und auch ergriffen werden kann)
P2 hat die Bitte des VL an P1 gehört und verstanden.
P2 nimmt wahr, dass P1 a ergreift, aus A herausnimmt und außerhalb von A platziert.
P2 erklärt, dass a nun außerhalb von A liegt, weil P1 a ergriffen und herausgelegt hat. Die Herausnahme von a kann als Ursache für die neue Lage außerhalb von A bezeichnet werden. Anlass ist die Bitte des VL, die P1 akzeptiert hat.
VV2 Verstehens-Versuch 2 Ursache und Wirkung,
Kausalität verstehen.
Der Versuch VV1 eigenet sich auch, um die Begriffe Ursache, Wirkung
und Kausalität zu lernen.
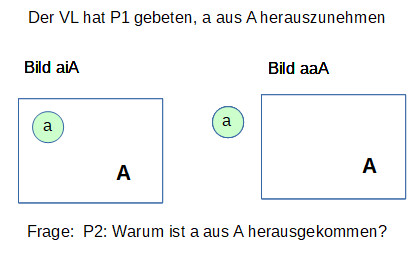 |
Der VL hat P1 gebeten, a herauszunehmen, was P1 dann auch gemacht hat. P1 hat a ergriffen und links oben außerhalb von A platziert. Die Herausnahme und Umplat- zierung ist die Ursache für die neue Lage außerhalb von A. Und die neue Lage ist die Wirkung der Herausnahme und Umplatz- ierung. Damit ist an diesem Beispiel Ursache und Wirkung also Kausalität gelernt. Dass das möglich ist, setzt voraus, dass P1 den VL vertsteht, seine Bitte akzeptiert, a nicht festgeklebt, sondern frei beweglich ist und P1 das erforderlich Handgeschick aktuell zur Verfügung hat. |
VV3 Verstehen Versuch 3 wesentlich und unwesentlich
unterscheiden lernen
Der Versuch VV2 eigenet sich auch, um die Begriff "wesentlich" und
"unwesentlich" zu lernen.
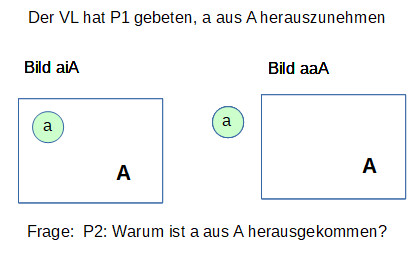 |
Für das Verstehen von Ursache und Wirkung ist es unwesentlich
und unwichtig, ob der kleine Kreis a ein Kreis oder wie er gefärbt
ist. Das gleiche Verständnis würde sich auch einstellen, wenn
man statt einem grünen Kreis mit einem kleinen blauen oder weißen
Quadrat hantieren würde.
Das gleiche gilt für A, das irgendeine Form haben könnte, in die nur a hineinpassen muss. _ _ _ _ |
Was versteht man? Genauer: Was meint man zu verstehen?
Hypothesen
Was man schon kennt
Was man schon erlebt hat
Womit man Erfahrungen gemacht hat
Kennen und verstehen: Was sind die Unterschiede von kennen und verstehen
Eine Wolke kennen, eine Wolke verstehen
ich weiß, wie eine Wolke aussieht; ich kann eine Wolke mit ihrem Namen "Wolke' benennen.
Systematische Pruefmethoden zum Verstehen
Die Nachfrage: Bitte um Erläuterung,
Beispiele.
Die einfachste und natürlichste Form, verstehen abzusichern, ist
die Nachfrage: wie meinst Du das? Kannst Du das noch ein bißchen
näher ausführen, kannst Du vielleicht ein Beispiel nennen?
Klaerender Dialog
Ausführlicher als die einfache Nachfrage ist der klärende
Dialog, das Wechselspiel von Frage und Antwort, um den Sachverhalt, den
es zu verstehen gilt, weiter aufzuklären, wobei man gelegentlich darauf
achten muss, nicht abzudriften.
Kontrollierter Dialog in besonderen
Fällen.
Unter einem kontrollierten Dialog zwischen A und B versteht man einen
Dialog, wo B erst antworten darf, wenn er vorher wiedergibt, was A gesagt
hat und A das bestätigt. Ein Trainingsprogramm findet sich in einem
Partnerschafts-Programm in einem Therapieforschungsprojekt des Psychologischen
Instituts der Westfälischen-Wilhelms-Universität (1970/80er Jahre),
herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie
e.V. Dort werden auch die Trainingsregeln, ein Beispiel und die Hauptschwierigkeitsquellen
von A und B gelistet (S. 88-89):
- Organisiert seine Gedanken nicht, bevor er spricht.
- Drückt sich ungenau aus.
- Versucht, zu viel in einer Aussage unterzubringen, so daß sie verwirrend wirkt Wirksamkeit nimmt mit der Kürze zu.
- Bringt zu viele Ideen in seine Äußerungen ein, oft untereinander nicht verbunden, so daß eine Zusammenfassung für den Partner schwierig ist.
- Redet aus Unsicherheit immer weiter, ohne die Auffassungskapazität seines Partners abzuschätzen: Fehlende Resonanz bei langem Sprechen erhöht ein Bestätigungsbedürfnis, das wirkungslos bleiben muß.
- Übersieht bestimmte Punkte der Antwort des vorausgegangenen Sprechers und antwortet daher nicht aktuell zu dem, was zuvor gesagt wurde: Das Gespräch kommt nicht vorwärts.
- Hat keine ungeteilte Aufmerksamkeit.
- Denkt schon an und probt seine Antwort, statt aufmerksam zuzuhören, legt sie sich zurecht, während der Partner noch spricht. Erfolg: Er kann nicht vollständig wiederholen, vergißt, was gesagt ist und was er sagen will.
- Neigt eher dazu, auf Details zu hören und sich evtl, über sie zu echauffieren, anstatt den ganzen Sinn und die wesentlichen Mitteilungen zu erfassen.
- Denkt den Gedanken des Sprechenden schon weiter, wiederholt mehr, als der Partner gesagt hat.
- Versucht, weniger Vertrautes in seine Denkschemata einzuordnen."
"Häufige Fehler auf der Seite des Sprechenden
Häufige Fehler auf der Seite des Zuhörers
Die AutorInnen ergänzen:
"Die reale Erfahrung, daß Verstehen und Verstandenwerden keineswegs so selbstverständlich sind, wie oft naiverweise angenommen wird, macht sensibler gegenüber den Möglichkeiten des Mißverstehens, Mißhörens und Mißverstandenwerdens in einer größeren Gruppe. Diese Erfahrung kann zu einem Bewußtsein dafür führen, wie leicht von dem unbewußten Vorurteil ausgegangen wird, die eigene Psychologie sei jeweils auch die des anderen. Erweitert und modifiziert nach Brocher, T. (1967). Auch in: Nylen , D. et al. (1967), Antons, K„ Enke, E., Malzahn, P. v. , Troschke, J. 1971)."
Einbindung oder Bezug zum Handeln.
Die beste und sicherste Methode, Un- oder Missverständnisse zu
vermeiden, ist, wenn man einen Sachverhalt mit Handlungen verbindet, die
fast jeder kennt.
Sich selbst einbringen: bei mir ist das
so ...
Manchmal ist es leichter zu klären, wenn man aus dem eigenen Erleben
etwas einbringt.
Andere Quellen oder Belege: wie sehen andere
das?
Man kann nachschlagen, andere fragen, recherchieren, um die Klärung
voranzubringen. Wissenschaftliche, psychologische oder kommunikationsfachliche
Quellen heranziehen
Sonstige, bislang nicht berücksichtigte
(Rest- und Auffangkategorie).
Es ist eine gute methodische Tradition, immer daran zu denken, dass
man nicht an alles gedacht hat, dass es noch andere Möglichkeiten
gibt.
Grundproblem
Vielfach meint man, auch ich, zu verstehen und hinterfragt es deshalb
nicht.
Das Grundproblem des Meinens, dass man sich versteht, ergibt folgende
Möglichkeiten:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materialien zum Verstehen des Verstehens
- Aristoteles: Aus der Metaphysik.
- Allan W. Watts (1961) Verstehen erfordert gleiche Erfahrungen.
- Waismann (1976) Können, Wissen, Verstehen.
- Wittgenstein.
- Dilthey Erklären und verstehen.
- Wright (1974). Erklärung und Verstehen.
- Stegmüller zum verstehen und erklären.
- Jaspers (1948) Erklären und Verstehen.
- Gruhle (1948) Verstehende Psychologie.
- Kehrer, F.A. (1951) Das Verstehen und Begreifen in der Psychiatrie.
- Sachse, Rainer (2013) Persönlichkeitsstörungen verstehen.
- Heilmann, Christa M. (2011) Körpersprache richtig verstehen und einsetzen.
- Verstehen bei William Stern.
Aristoteles [Quelle: Exurs Homonyme: Die Mehrdeutigkeit der Worte.]
|
|
welche ihre Gedanken untereinander austauschen wollen, etwas voneinander verstehen; denn wie könnte denn, wenn dies nicht stattfindet, ein gegenseitiger Gedankenaustausch möglich sein? Es muß also jedes Wort bekannt sein und etwas, und zwar eins und nicht mehreres, bezeichnen; hat es mehrere Bedeutungen, so muß man erklären, in welcher von diesen man das Wort gebraucht." Aus: Aristoteles (384-322) Metaphysik. 11. Buch, 5 Kap., S. 244 (Rowohlts Klassiker 1966) |
Die Worte sind die "Kleider" der Begriffe. Verschiedene Menschen werden meist mit den gleichen Worten unterschiedliche Bedeutungen verknüpfen, je nach ihren Erfahrungen, Wissen und Kenntnissen, Interessen und Kommunikationssituationen. D.h., aus der bloßen Tatsache, dass Menschen das gleiche Wort verwenden, kann leider nicht geschlossen werden, dass sie auch den gleichen Begriff meinen. Die Problematik betrifft auch keineswegs nur die Alltagskommunikation, die Geistes- und Sozialwissenschaften, sondern auch die Naturwissenschaften und die Mathematik, wenngleich es gerade bei Begriffen, die psychisches Erleben beschreiben besonders schwierig ist, einen auch nur annähernd gleichen Begriff zu normieren (> nur_empfinden,fühlen,spüren, > Terminologie).
Allan W. Watts Verstehen erfordert gleiche Erfahrungen
"... denn Worte können nur zwischen denen der wahren Verständigung dienen, die gleiche Erfahrungen teilen."
Quelle S. 20: Allan W. Watts (1961) Zen-Buddhismus. Reinbek: rde.
Im Kern und Ziel ist diese These Watts wohl richtig, ich würde sie aber abschwächen und statt "gleicher Erfahrungen" nur gleichartige oder ähnliche verlangen. Wahrscheinlich bietet das Erlernen der Bedeutungen der Worte und der sie ausdrückenden Begriffe durch eine gleichartige oder ähnliche Lebenspraxis die beste Gewähr für verstehen.
Eisler Wörterbuch der philosophischen Begriffe (1904, nach textlog)
Historisch interessant, aber inhaltlich wenig ergiebig, wie so oft in Philosophie und Geistesgeschichte.
"Verstehen (intelligere) heißt, die Bedeutung eines Wortes, eines Satzes, eines Satzzusammenhanges erfassen, wissen, d.h. die den betreffenden Sprachzeichen zugehörigen Vorstellungen, Begriffe, Urteile mehr oder weniger deutlich, gegliedert, zusammenhängend reproduzieren oder produzieren können. CHR. WOLF definiert: »Sobald wir von einem Dinge deutliche Gedanken oder Begriffe haben, so verstehen wir es« (Vern. Ged. I, § 276). Nach KIESEWETTER ist Verstehen »etwas hinreichend zu einem Begriff sich vorstellen« (Gr. d. Log. S. 246). Nach J. G. FICHTE drückt »Verstehen« »eine Beziehung auf etwas aus, das uns ohne unser Zutun von außen kommen soll« (Gr. d. g. Wissensch. S. 201 f.). SUABEDISSEN erklärt: »Verstanden wird, was im Verstande gefaßt. also wessen Bedeutung und Stelle im Gedankensystem erkannt wird. Es ist dann zugleich begriffen und eben damit aus einem unklaren und unsichern zu einem klaren und sichern Gedanken geworden« (Grdz. d. Lehre von d. Mensch. S.118). CALKER bestimmt: »Das Erkennen, in welchem die Verbundenheit des Mannigfaltigen mit der Einheit erkannt wird vermittelst der Allgemeinheit, ist das Verstehen« (Denklehre, S. 250). BACHMANN erklärt: »Man versteht... etwas, wenn man nicht bloß erkennt, was es ist, sondern auch warum es so ist« (Syst. d. Log. S. 73). Nach L. FEUERBACH heißt Verstehen »etwas in und aus uns selbst, in Übereinstimmung mit mehreren eigenen vernünftigen Wesen. erkennen« (WW. III, 175). Nach JESSEN ist Verstehen so viel wie »den in Gehörtem oder Gelesenem enthaltenen Gedanken vollständig in sich reproduzieren« (Physiol. d. menschl. Denk. S. 114). Nach LAZARUS heißt Verstehen »Gedachtes oder das Denken eines andern (denkenden) Subjekts auffassen« oder auch: »den inneren Zusammenhang, die Beziehung der Dinge zu andern als zu ihren Zwecken und Ursachen auffassen« (Leb. d. Seele II2, 160. v gl. Einl. in d. Psychol. I, 385 ff.). HÖFFDING erklärt: »Ich verstehe, was etwas ist, wenn ich es wiedererkenne« (Philos. Probl. S. 34). Nach A. MEINONG besteht das Verstehen des Satzes im Erfassen des »Objektivs« durch ein Urteil oder eine »Annahme« (Über Annahm. S. 272). »Verstehen eines Gesprochenen... besteht im Erfassen seiner Bedeutung« (ib.). Nach HUSSERL beruht das Verstehen nicht auf Phantasiebildern. wir können ohne Anschauungen, in bloß symbolischen Vorstellungen denken. Verstehen ist das »aktuelle Bedeuten« (Log. Unters. II, 62 ff.). Vgl. DUGAS, Le Psittcisme. RIBOT, Id. génér. - Vgl. Begreifen."
Waismann (1976) > Wittgenstein.
Waismann, Friedrich (1976) Können, Wissen, Verstehen.- In (492-530) Logik, Sprache, Philosophie, Stuttgart: Reclam. Das Buch beschreibt die Philosophie Wittgensteins und wurde bereits 1930 geplant und 1939 vollendet. Aber erst 1965 erschien die englische Fassung und 1976 die deutsche. Weder im Titel (ein Untertitel "Einführung in die Philosophie Wittgensteins" wäre angemessen) noch in der Einleitung wird Wittgenstein erwähnt, aber im Vorwort von Schlick und im Nachwort der Herausgeber). Das ist weder guter Stil von Waismann noch vom Verlag. Wittgenstein spürte etwas richtiges, wie die Herausgeber S. 653 berichten (> Wittgensteins Misstrauen). Ich zitiere zunächst das Inhaltsverzeichnis des XVII. Kapitels zum Verstehen und im Anschluss eine Textprobe.
Aus dem Inhaltsverzeichnis:
- "XVII. Können, Wissen, Verstehen 492
- 1. Der Begriff der Möglichkeit 492
2. Können 498
3. Wissen 503
4. Verstellen 505
5. Das Verstehen eines Wortes 508
6. Ist das Verstehen ein Vorgang in der Zeit? 511
7. Substanzhafte und transitive Bewußtseinszustände 513
8. Gibt es Begriffsblindheit? 518
9. Verschiedene Auffassungen eines Wortes, eines Satzes 521
10. Ist im Verstehen eines Wortes seine ganze künftige Verwendung enthalten? 522
11. Das Verstehen als Erlebnis 525
12. Gibt es Grade des Verstehens? 527
13. Nähern wir uns im Verstehen der Wirklichkeit? 529"
....
S.505f: "Ein Handwerk verstehen = Das Handwerk
können
Er versteht es, die Menschen zu behandeln = Er weiß sie zu behandeln
= Er kann sie richtig behandeln.
Hier zeigt sich wieder eine Verwandtschaft zwischen der Grammatik von
»verstehen«, »wissen« und »können«.
Sage ich aber »Er versteht Englisch«, so heißt das nicht
ganz dasselbe wie »Er kann Englisch«. Es ist vielmehr charakteristisch,
daß man sagt »Er versteht zwar Englisch, aber er kann es nicht
sprechen«. Für unser Sprachgefühl liegt im ersten Satz
mehr etwas Passives, im zweiten etwas Aktives. So hat auch der Ausdruck
»Mathematik verstehen« einen leisen Beiklang des Passiven (und
noch deutlicher ist das im Fall der Musik).
Vergleichen wir nun die Ausdrücke:
- Ich verstehe diesen Satz.
Ich verstehe diesen Beweis.
Ich verstehe Englisch.
Ich verstehe deine Handlungsweise.
- Ich verstehe dich nicht. Du mußt lauter sprechen!
Ich verstehe dich nicht, das ist ja Unsinn!
Er versteht es, sich beliebt zu machen.
Er versteht das, was er liest.
Augustinus verstand nicht, wie man die Zeit messen kann.
Erst die Relativitätstheorie läßt uns verstehen, warum
träge und schwere Masse proportional sind.
Er versteht Musik.
Das Wort »verstehen« bedeutet in einem Teil seiner Anwendungen
eine psychische Reaktion beim Hören, Lesen, Aussprechen eines Satzes.
Verstehen ist dann ein Phänomen, das sich einstellt, wenn ich den
Satz einer mir geläufigen Sprache höre, und nicht, wenn ich den
Satz einer mir fremden Sprache höre. Ich kann dann von einem »Erleben«
des Satzes sprechen. Ich folge ihm mit bestimmten Gefühlen. Und dieses
Verstehen eines Satzes weist eine Verwandtschaft auf mit dem Verstehen
eines Musikstückes, dem Erfassen einer Melodie, aber auch mit dem
Verstehen eines Bildes.
»Einen Satz verstehen« kann andererseits heißen »Wissen,
was der Satz sagt«, d. h. die Frage »Was sagt dieser Satz?«
beantworten können. Das Verstehen ist dann kein Erlebnis, sondern
eine Disposition."
..."
Wittgenstein > Waismann.
Am wichtigsten erscheint mir der Grundsatz Wittgensteins, dass sich die Bedeutung der Worte aus ihrem Gebrauch ergibt. Ich habe diesen Grundsatz auf Begriffsanalysen angewandt und dokumentiert.
Sinn, Helga (2012) Was heißt verstehen?: Eine Reise durch die Philosophie Ludwig Wittgensteins. Akademikerverlag Zu dem Werk wird ausgeführt: "Es ist nicht selbstverständlich, dass wir einander verstehen, besonders dann nicht, wenn wir über Gefühle und Gedanken sprechen. Oft fehlen einem die Worte, um etwas richtig auszudrücken, und oft fragt man sich, ob ein anderer wirklich verstanden hat, was man sagen wollte. Kann man sich denn jemals sicher sein, dass die Bedeutung von Sätzen und Worten für andere dieselbe ist wie für einen selbst? Und ist es dann nicht ein Wunder, dass wir uns dennoch irgendwie verstehen? Für Wittgenstein stellt sich diese Frage nicht. Die Bedeutung eines Wortes ist für ihn nichts Verborgenes, Inneres, das nur dem jeweiligen Sprecher zugänglich ist, und das er nur ungeschickt in Worte fassen kann. Die Bedeutung eines Ausdrucks, macht er deutlich, geht nicht über die Sprache hinaus, sondern liegt in ihr und zeigt sich in ihr durch die Verwendung, die dieser Ausdruck in der Sprache findet. Wittgenstein erklärt, wie wir verstehen, und warum man fehlgeleitet ist, wenn man sich über die Möglichkeit des Verstehens wundert. In dieser Arbeit wird Wittgensteins antimentalistische Position zum Thema „Verstehen“ erarbeitet, ein Thema, das bei ihm mit vielen anderen philosophischen Problembereichen verknüpft ist. Die vorliegende Arbeit ist deshalb auch ein Streifzug durch die wichtigsten Überlegungen Wittgensteins in den hier behandelten Werken "Big Typescript" und "Philosophische Untersuchungen"."
Anmerkung: Verstehen, Wissen und Meinen bei Wittgenstein
Hausarbeit (Hauptseminar), 1999.
Wright Erklären und Verstehen
Wright, Georg Hendrik von (1974) Erklären und Verstehen. Frankfurt aM: Athäneum.
Sachregistereinträge Verstehen: 19 f., 36 f., 37 f., 39 f., 41, 115, 122-124, 138, 141, 153 f. 14punktg fette Hervorhebungen von Sponsel.
19 f.: "Der normale Sprachgebrauch macht
keinen scharfen Unterschied zwischen den Wörtern »erklären«
und »verstehen«. Man kann praktisch
von jeder Erklärung, sei sie kausal, teleologisch oder von irgendeiner
anderen Art, sagen, daß sie unser Verstehen.
fördert. Allerdings hat »Verstehen«
auch einen psychologischen Beiklang, den »Erklären« nicht
hat. Dieses psychologische Merkmal wurde von mehreren [>20] antipositivistischen
Methodologen des neunzehnten Jahrhunderts .besonders hervorgehoben, am
eindringlichsten vielleicht von Simmel, der der Ansicht war, daß
Verstehen
als eine für die Geisteswissenschaften charakteristische Methode eine
Form von Einfühlung oder innerem Nachvollzug der geistigen Atmosphäre
ist, d. h. der Gedanken, Gefühle und Motivationen, kurz der Gegenstände,
die der Geisteswissenschaftler untersucht22.
Es ist jedoch nicht nur dieser psychologische Anstrich,
wodurch sich das Verstehen vom Erklären
unterscheiden läßt. Verstehen hängt auch mit Intentionalität
zusammen, und zwar in einer Weise, in der dies für Erklären nicht
gilt. Man versteht die Ziele und Absichten eines Handelnden, die Bedeutung
eines Zeichens oder Symbols und den tieferen Sinn einer sozialen Institution
oder eines religiösen Ritus. Diese intentionalistische oder, wie man
sie vielleicht ebenfalls nennen könnte, semantische Dimension desVerstehens
trat in der jüngeren methodologischen Diskussion immer mehr in den
Vordergrund (vgl. unten, Abschn. 10).23"
36 f.: Drays Erklärungmodell ähnle
den traditionellen Ideen über diee "methodologische Rolle des Einfühlens
und Verstehens."
37 f.: "Winchs Buch, so kann man sagen,
zentriert sich um die Frage nach den Kriterien für soziales Verhalten
(Handlung). Der Sozial Wissenschaftler muß die »Bedeutung«
der gesammelten Verhaltensdaten verstehen,
um sie in soziale Fakten um wandeln zu können. Er kommt zu diesem
Verstehen
durch Beschreibung (Interpretation) der Daten mit Hilfe der Begriffe und
Regeln, die die »soziale Realität« der un- [>38] tersuchten
Handelnden determinieren. Die Beschreibung bzw. Erklärung sozialen
Verhaltens muß dasselbe Begriffssystem verwenden wie die sozial Handelnden
selbst. Aus diesem Grund kann der Sozialwissenschaftler nicht in demselben
Sinn wie ein Naturwissenschaftler von außen an seinen Untersuchungsgegenstand
herangehen. Dies, so könnte man sagen, ist der Kern an begrifflicher
Wahrheit in der psychologischen Doktrin der »Einfühlung«.
Einfühlendes Verstehen ist kein »Gefühl«;
es ist eine Fähigkeit zur Partizipation an einer »Lebensform«80."
39 f.: "»Verstehen«
im Sinne der hermeneutischen Philosophie sollte von Einfühlung unterschieden
werden. Es handelt sich hier um eine semantische und nicht um eine psychologische
Kategorie (vgl. oben, S. 20). Der von positivistischen Philosophen so häufig
erhobene Vorwurf, Verstehen sei lediglich ein
heuristisches Mittel, das vielleicht für die Ermittlung von Erklärungen
ganz nützlich, für die begriffliche Natur des Erklärungsschemas
selbst jedoch keineswegs konstitutiv ist, mag für einige frühere
und überholte Versionen der Methodologie der Einfühlung zutreffen90.
Er ist jedoch kein fairer Einwand gegen die Methodologie des Verstehens
als solcher."
41: "Dennoch gibt es einen Dialog zwischen
den Positionen und eine Art Fortschritt. Die temporäre Dominanz einer
der beiden Richtungen ist gewöhnlich das Resultat eines Durchbruchs,
der auf eine Periode der Kritik an der anderen Richtung folgt. Das Resultat
eines solchen Durchbruchs ist niemals nur eine Rehabilitierung von etwas,
das es bereits vorher gab, es trägt vielmehr auch den Stempel der
Ideen, aus deren Kritik es hervorgegangen ist. Dieser Prozeß illustriert,
was Hegel mit den Worten aufgehoben und auf bewahrt beschrieben hat. Die
Position, die gerade aufgehoben wird, verschwendet gewöhnlich ihre
polemischen Energien zur Bekämpfung längst überholter Züge
der gegnerischen Auffassung und sieht in der Regel in dem, was in der resultierenden
Position aufbewahrt ist, lediglich einen deformierten Schatten ihrer selbst.
Genau dies ist beispielsweise der Fall, wenn positivistische Wissenschaftstheoretiker
heutzutage mit Argumenten gegen das Verstehen
vorgehen, die vielleicht auf Dilthey oder Collingwood zutreffen, oder wenn
sie Wittgensteins Philosophie der Psychologie fälschlicherweise nur
für eine andere Form von Behaviorismus halten."
115: "A beabsichtigte, den Knopf zu
drücken.
- Folglich drückte A den Knopf.
»A drückte den Knopf, weil er beabsichtigte, den Knopf zu drücken.« Dies ist keine Erklärung dafür, warum A den Knopf drückte. Es kann aber eine etwas irreführende Ausdrucksweise dafür sein, daß A beim Drücken des Knopfes kein darüber hinausgehendes Objekt der Intention, hatte als eben genau dies — den Knopf zu drücken,
»A verhielt sich so, weil er beabsichtigte, den Knopf zu drücken.« Davon läßt sich sagen, daß es einen echten Erklärungswert hat, und zwar dann, wenn es bedeutet, daß A3s Verhalten ein intentionales Drücken des Knopfes war oder ein Versuch, den Knopf zu drücken, und nicht nur eine Bewegung eines Teils seines Körpers, die in einem Druck auf den Knopf resultierte. Wenn wir so A3s Verhalten »erklären«, verstehen wir es dadurch als den äußeren Aspekt einer Handlung, daß wir diesem Verhalten eine bestimmte Intention unterstellen.
Bereits das bloße Verstehen eines Verhaltens als Handlung (z.B. als ein Knopf-Drücken) - auch ohne diesem Verhalten einen entfernten Zweck (z. B. zu klingeln) zuzuschreiben, zu dessen Erreichung die Handlung ein Mittel ist - ist selbst eine Möglichkeit, Verhalten zu erklären. Vielleicht könnte es eine rudimentäre Form einer teleologischen Erklärung genannt werden. Es ist der Schritt, wodurch wir die Beschreibung des Verhaltens sozusagen auf die teleologische Ebene heben. ... "
122-124: "1. Einer teleologischen Handlungserklärung geht normalerweise ein Akt intentionalistisdien Verstehens gewisser Verhaltensdaten voraus.
Man kann »Schichten« oder »Stufen« solcher Verstehensakte unterscheiden. Zum Beispiel: Ich sehe, wie Menschenmengen in derselben. Richtung durch die Straßen ziehen, im Chor irgend etwas schreien, einige schwenken Fahnen, etc. Was ist das, was hier vor sich geht? Die »Elemente« dessen, was ich intentionalistisch sehe, habe ich bereits. verstanden. Die Leute bewegen sich »selbst« vorwärts und werden,, nicht von einem Wind oder Sturzbach fortgerissen. Sie schreien - und: das heißt mehr, als daß Töne aus ihren Kehlen kommen. Aber dasj »Ganze«, das ich beobachte, ist mir noch nicht klar. Handelt es sich um eine Demonstration? Oder bin ich vielleicht Zeuge eines VolksfestsJ oder einer religiösen Prozession?
Ich glaube nicht, daß man diese Fragen beantworten könnte, indem man teleologische Erklärungen für das (intentionalistisch verstandene); Verhalten der einzelnen Glieder dieser Menge konstruiert. Eine Demonstration hat ein Ziel, das irgendwie aus den Zielen der einzelnen,; Leute »extrapoliert« werden kann. In welcher Weise dies aber geschehen kann, ist nicht leicht zu sagen. Ein Volksfest oder eine religiöse; Prozession ist, wenn überhaupt, nur entfernt mit Zielen verbunden.; Vielleicht nahmen einige an dem Fest teil, um sich zu amüsieren. Dies) würde ihre Anwesenheit bei diesem Ereignis erklären. Doch zu wissen, welches Ziel sie und andere Beteiligte damit verfolgten, daß sie sich der Menge anschlossen, würde uns noch nicht sagen, daß es sich; hier um ein Volksfest handelt. (Wenn man uns sagte, daß es ihr Ziel war, ein Volksfest zu besuchen, würde uns das nicht weiterhelfen, solange wir nicht über unabhängige Kriterien verfügen, nach denen wir beurteilen können, ob etwas ein Volksfest ist oder nicht.)
Die Beantwortung der Frage, was hier vor sich geht, besteht nicht in einer teleologischen Erklärung der Handlungen einzelner Personen..Sie besteht in einem neuen Akt des Verstehens, einem Verstehensakt zweiter Stufe. Wir sagten, aus der Tatsache, daß jemand den vor ihm befindlichen Knopf zu drücken beabsichtigt, folge nicht, daß er gewisse spezifische Körperbewegungen (bzw. eine von mehreren spezifizierten alternativen Bewegungen) ausführt. Es folgt lediglich, daß er mit den tatsächlich ausgeführten Bewegungen den Knopf zu drücken beabsich[>123]tigt. In ähnlicher Weise läßt sich aus der Tatsache, daß eine Menschenmenge demonstriert, nicht logisch schließen, daß die einzelnen Demonstranten gewisse spezifische individuelle Handlungen (bzw. eine von mehreren spezifizierten alternativen Handlungen) ausführen. Es folgt lediglich, daß die Handlungen, die sie ausführen, als Demonstration intendiert sind, bzw. daß ihre Absicht durchkreuzt wurde (z. B. hat die Polizei auf die Menge geschossen und sie zerstreut sich nun). Die Analogie zwischen individuellen und kollektiven Handlungen ließe sich bis ins Detail verfolgen.
Man kann die Hierarchie oder Stufenfolge dieser interpretativen Akte, eine Bedeutung zu erfassen, durchlaufen. Es gab Demonstrationen, Aufruhr, Streiks, Terror etc. Soll man die Situation »Bürgerkrieg« oder »Revolution« nennen? Es handelt sich hierbei weder um eine Frage der Klassifikation nach bestimmten Kriterien noch der willkürlichen Entscheidung über die Anwendung eines Begriffs. Es handelt sich um eine Frage der Interpretation, es geht darum, die Bedeutung dessen, was passiert, zu verstehen.
Man könnte diese Tätigkeit der Interpretation explikativ nennen. Ein Großteil von dem, was man normalerweise als die »Erklärungen« von Historikern oder Sozialwissenschaftlern bezeichnen würde, besteht in solchen Interpretationen des Rohmaterials ihrer Forschung.
Es scheint mir jedoch klarer, hier zwischen Interpretation oder Verstehen auf der einen Seite und Erklärung auf der anderen zu unterscheiden. Die Ergebnisse der Interpretation sind Antworten auf die Frage »Was ist dies?«1. Nur wenn wir fragen, warum es eine Demonstration gab, oder was die »Ursachen« der Revolution waren, versuchen wir das, was ist, die Tatsachen, in einem engeren und strengeren Sinn zu erklären.
Diese beiden Tätigkeiten scheinen außerdem in einer charakteristischen Weise miteinander verbunden zu sein und sich gegenseitig zu stützen. Dies ist ein anderer Grund, sie in einer methodologischen Untersuchung zu trennen. Oft bahnt eine Erklärung auf der einen Ebene den Weg für eine Reinterpretation der Tatsachen auf einer höheren Ebene. Wiederum besteht eine Analogie zu individuellen Handlungen. Wenn man den Akt, einen Knopf zu drücken, teleologisch erklärt, so kann dies dazu führen, daß wir das, was der Handelnde tat, neu beschreiben als einen Akt des Läutens, Aufmerksam-Machens oder sogar Hereingelassen-Werdens. »Dadurch daß er den Knopf drückte, tat er x.« Von nun an sehen wir, was er tat, primär als einen Akt des x’ens an. Ähnliches gilt für kollektive Handlungen. Was man gewöhnlich für eine reformatorische Bewegung innerhalb, der Religion hielt, kann sich mit tieferem Einblick in die Ursachen als »eigentlich« ein Klassenkampf für Landreform heraussteilen. Mit die[>124]ser Reinterpretation der Tatsachen wird ein neuer Anstoß zu einer Erklärung gegeben. Eine Untersuchung der Ursachen eines Religionszwists kann uns dazu führen, dem Ursprung sozialer Ungleichheiten nachzugehen, beispielsweise als einem Ergebnis von Veränderungen in den Produktionsmethoden einer Gesellschaft.
Mit jedem neuen Akt der Interpretation werden die verfügbaren Tatsachen unter einen neuen Begriff gefaßt . Die Tatsachen nehmen sozusagen eine »Eigenschaft« an, die sie vorher nicht besaßen. Dieser begriffliche Prozeß ist, glaube ich, verwandt mit dem, was in der Hegelschen und Marxschen Philosophie der Umschlag von der »Quantität in Qualität« genannt wird, sowie mit verschiedenen Gedanken, die Philosophen über »Emergenz« (»emergence Eigenschaften«) geäußert haben.
Bevor eine Erklärung beginnen kann, muß ihr Gegenstand - das Explanandum - beschrieben werden. Jede Beschreibung, so könnte man sagen, sagt uns, was etwas »ist«. Wenn wir jeden Akt des Erfassens, was ein bestimmtes Ding ist, »Verstehen« nennen, dann ist Verstehen eine Vorbedingung für jede Erklärung, sei sie kausal oder teleologisch. Dies ist trivial. Doch Verstehen, was etwas ist, im Sinne von von welcher Art es ist, sollte nicht verwechselt werden mit Verstehen, was etwas ist, im Sinne von was es bedeutet oder anzeigt. Ersteres ist ein charakteristisches Präliminarium der kausalen, letzteres der teleologischen Erklärung. Es ist daher irreführend zu sagen, daß Verstehen versus Erklären den Unterschied zwischen zwei Typen wissenschaftlicher Erkenntnis kennzeichnet. Dagegen könnte man sagen, daß der intentionale oder nicht-intentionale Charakter ihrer Gegenstände den Unterschied zwischen zwei Typen des Verstehens und des Erklärens kennzeichnet."
138: "Sekundäre Regeln spielen, soweit ich sehen kann, keine charakteristische oder wichtige Rolle in der Erklärung von Verhalten. Dies liegt. daran, daß sie keine Mechanismen darstellen, um jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun. Sie haben jedoch fundamentale Bedeutung für das Verstehen von Verhalten und daher für die Beschreibungen, die . Anthropologen und Sozialwissenschaftler von den von ihnen untersuchten Gemeinschaften geben14."
141: "Ein vollständiges Verstehen der vergangenen Geschichte, so könnte man sagen, setzt voraus, daß es keine Zukunft gibt, daß die Geschichte zu einem Ende gekommen ist. Es gab einen großen Philosophen, der in gewissen Momenten der Exaltation der Ansicht gewesen zu sein scheint, daß er die Geschichte vollständig »durchschaut« hat. Dieser Philosoph war Hegel. In solchen Momenten sprach er von sich als dem Ende und der Vollendung der Weltgeschichte18. Doch seine Worte, glaube ich, wollte er in dem Sinne verstanden wissen, der eine adäquate Beurteilung ihrer Wahrheit erst ermöglicht."
153 f.: Anmerkung 22: "Simmel entwickelt seine psychologistische Theorie des Verstehens und des historischen Wissens in Simmel 1892, besonders Kap. I, und Simmel 1918."
Stegmueller zum verstehen und erklären in seiner Analyse und Kritik des sog. hermeneutischen Zirkels
"... Ein anderer hermeneutischer Schlüsselbegriff ist der Ausdruck „Verstehen" (VerstgsozM). Auch heute scheint noch immer die von Dilthey stammende Gegenüberstellung von Verstehen (VerstgsozM) und Erklären eine große Rolle zu spielen. Es sollte dadurch der Gegensatz zwischen Natur- und Geisteswissenschaften sowohl charakterisiert als auch zementiert werden. Unter allen mir bekannten erkenntnistheoretischen Dichotomien — wie „analytisch — synthetisch", „a priori — empirisch", „deskriptiv — normativ", die sich alle in gewissen Kontexten als mehr oder weniger hilfreich erweisen — ist die Diltheysche Gegenüberstellung die mit Abstand unfruchtbarste. Der Grund dafür ist sprachlogischer Natur und betrifft die beiden von Dilthey benützten Worte. Was zunächst den Ausdruck „Verstehen" (Verstvield) betrifft, so ist dieses Wort so vieldeutig, daß ich fast geneigt bin, eine Wendung von Wittgenstein I, dem Verfasser des Tractatus Logico-Philosophicus, ironisch zu gebrauchen und zu sagen: „Das Verstehen (Verstvield) erfüllt den ganzen logischen Raum". Es ist kaum eine wissenschaftliche Aktivität denkbar, in bezug auf welche man das Wort „verstehen" (Verstvield) nicht auf vielfältige Weise und dabei doch durchaus adäquat verwenden könnte. So ist es zwar korrekt zu betonen, daß es Literaturwissenschaftlern und Historikern darum geht, Texte zu verstehen (oder sie verstehend zu deuten); daß sie sich bemühen, Motive und Charakterzüge historischer Persönlichkeiten zu verstehen; daß sie Norm- und Wertvorstellungen von Kulturen zu verstehen suchen. Solche Feststellungen kann man aber sofort durch ganz analoge "Aussagen über die Tätigkeit der Mathematiker und Physiker parallelisieren. Ein Student dieser beiden Fächer muß sich vor allem darum bemühen, die Grundbegriffe' der Mathematik und Physik zu verstehen (Verstnatwis). Später muß er dazu übergehen, Lehrsätze, Theorien und Hypothesen zu verstehen (Verstnatwis). Und dafür wird es sich wieder als notwendig erweisen, daß er die für die Lehrsätze gegebenen Beweise und die für die Hypothesen gegebenen Begründungen verstehen (Versthypoth) lernt. Diese Parallele zeigt nicht etwa, daß Mathematik und Physik auch ,hermeneutisch zu interpretieren' sind, sondern nichts weiter als daß das Wort „Verstehen" (Verstvield) wegen seiner zahlreichen Bedeutungen und Bedeutungsschattierungen überhaupt nichts leistet, wenn wir einen Aufschluß über die Natur der einzelnen Wissenschaften und ihr Verhältnis zueinander gewinnen wollen. Will man Differenzierungen vornehmen und Unterschiede erkennen, so darf man nich't einen Ausdruck als »Schlüsselwort' verwenden, aus dem sich für jede , Situation irgendeine darauf anwendbare Bedeutung herausquetschen läßt.
Die Sache verschlimmert sich noch dadurch, daß unglücklicherweise auch das Wort „erklären" außerordentlich vieldeutig ist. So stimmt es zwar, daß Naturwissenschaftler häufig das sogenannte Subsumtionsmodell der Erklärung gebrauchen und etwa sagen: „Das Galileische Fallgesetz und die Keplerschen Gesetze lassen sich wenigstens approximativ durch die Newtonsche Theorie erklären". Aber wiederum kann man zu anderen Verwendungen von „erklären" greifen und mit ihrer Hilfe die interpretierende Tätigkeit beschreiben. So etwa erklärt uns ein Sprachwissenschaftler die Bedeutung von Wörtern einer uns nicht bekannten Sprache; oder ein sinologischer Fachmann erklärt seinem Auditorium den Sinn eines chinesischen Gedichtes.
Entweder also bezeichnen die beiden Ausdrücke „verstehen" (Versterkl-verst) und „erklären" völlig disparate Begriffe, wie etwa in: „Verstehen eines Textes — Erklärung des Fallgesetzes". Dann ist die Gegenüberstellung ebenso uninteressant und unfruchtbar wie in anderen Fällen von disparaten Begriffen: Wir erwarten ja auch von der Gegenüberstellung solcher Begriffe wie „Primzahl" und „Papagei" keine fundamentalen Einsichten. Oder aber die Bedeutungsinhalte überschneiden sich. Dann kann man die auf ein Verstehen (Versterkl-verst) abzielende Frage so formulieren, daß sie zu einer Erklärung heischenden Frage wird, so etwa, wie wir gesehen haben, in den drei Fällen, wo jemand einen Begriff, eine Theorie oder einen Beweis nicht versteht (Versterkl-verst) und erklärt bekommen möchte. Ähnlich verhält es sich, wenn es um die Analyse der Funktion eines Automaten geht. So kann z. B. jemand fragen: „Ich verstehe (Versterkl-verst) nicht die Kopierungs- und Übersetzungsautomatik des genetischen Code. Kann mir jemand diesen Automatismus erklären?" Selbst im Frage- und Antwortspiel moralischer Vorwürfe und Rechtfertigungen greifen die beiden Bedeutungen ineinander, so wenn einer zum anderen sagt: „Ich verstehe (Verstnicht), (Versterkl-verst) nicht, wie du so etwas tun konntest. Kannst du mir dein Handeln erklären?"
Quelle S. 24f: Stegmüller, Wolfgang (1973) Der sogenannte Zirkel des Verstehens. In (21-46): Hübner, Kurt & Menne, Albert (1973, Hrsg-). Natur und Geschichte. X. Kongress für Philosophie. Kiel 8.-12. Oktober 1972. Hamburg: Meiner.
William Stern > Gebrauchsbeispiele bei William Stern.
Aufgrund des Umganges ausgelagert in eine eigene Seite: Grundlagen des Verstehens bei William Stern.
Dilthey Erklaeren und verstehen
S.10: "Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir." (Dilthey 1894).
Zur ganzheitlichen Auffassung des Verstehens siehe bitte: G09-Dilthey-S.35.
Gadamer Hermeneutik Wahrheit und Methode
Gadamer hat zwei Bände zur Hermeneutik (Wahrheit und Methode) vorgelegt. Textbeleg zum hermeneutischen Zirkel: (> G11-Gadamer2-S.57)
Im II. Band gibt es ein Sachregister für beide Bde. mit Einträgen zum Themenfeld verstehen:
- Verständigung, Einverständnis (Konsensus) I 183, 297f.;
II 16ff, 116, 183 u.ö., 225 u.ö., 266u.ö., 342ff, 497
Verständnis (sittliches) 1328; II 314ff
Verstehen s. a. Sprache, Sprachliclikeit I 183ff, 215, 219ff, 263ff; II 6ff, 30ff u.ö., 52ff, 57ff, 103, 116£, 121 ff, 222 ff u. ö., 330 u. Ö.
Sprachlichkeit des Verstehens II 64£, 73, 112, 143f£, 184ff, 232ff, 436, 444, 465, 496 £
Hermeneutik I 169 ff., 177 ff. u.ö., 300 ff., 312ff., 330f£, 346ff.; II 5 ff. u. ö„ 57ff., llOff., 178fT., 219f£ U.Ö., 297, 301 ff. u.ö., 419ff, 438ff, 493ff
- romantische I 177ff, 201 ff., 227f., 245, 301 £, 392; II97ff., 121 £, 222£
- reformatorische 1177ff.; II94f., 277, 311 f,
- theologische 1177, 312ff., 335 ff; II93 ff, 101 ff., 125f£, 281 ff, 391 €, 403ff
- juristische I 44, 314ff, 330ff; II 67£, 106 f., 278, 31 Of, 392 f, 430
- Universalität d. H. II llOf. u.ö., 186 u.ö„ 201f£, 219f£, 242 u.ö., 255f£, 312ff u.ö., 439ff
Jaspers, Erklären und Verstehen in der Allgemeinen Psychopathologie (1948)
Quelle: Jaspers, Karl (1948) Allgemeine Psychopathologie. Berlin: Springer. Erklären (Teil III ) und Verstehen (Teil II. erstes und zweites Kapitel) nehmen in Jaspers Psychopathologie einen großen Raum ein, sowohl im Inhaltsverzeichnis als auch im Sachregister.
S. 296ff: "§ 5. Die Grundgesetze des psychologischen Verstehens
und der Verstehbarkeit
Solange man sein Verstehen unter die Maßstäbe
naturwissenschaftlicher Erkenntnis stellt, bemerkt man, daß man in
Widersprüche gerät, in Ungewißheiten und Beliebigkeiten,
die unwillig machen. Man ist geneigt, das ganze Verfahren als unwissenschaftlich
beiseite zu werfen. Aber das Verstehen fordert
andere Methoden als die Naturwissenschaft und das Verstehbare
hat ganz andere Seinsweisen als ein naturwissenschaftlicher Gegenstand.
Die Methoden des Verstehens stehen unter allgemeinen
Grundsätzen, die ausdrücklich zu formulieren zweckmäßig
ist, um zu wissen, was man im Verstehen tut, was hier nicht zu erwarten
ist und worin die eigentümliche Erfüllung einer Erkenntnis auf
diesem Gebiet liegen kann.
Das Verstehbare hat Eigenschaften, denen in der
Methode des Verstehens Grundsätze entsprechen:
a) Das Verstehbare ist empirisch wirklich nur
soweit es in wahrnehmbaren Tatbeständen erscheint. Dem entspricht,
daß alles empirische Verstehen Deuten
ist. — b) Das Verstehbare hat als Einzelnes
Zusammenhang im ganzen, ist in seinem Sinn und seiner Farbe durch
dieses Ganze, den Charakter oder die Persönlichkeit bestimmt. Dem
entspricht, daß alles Verstehen im „hermeneutischen
Zirkel“ sich vollzieht: das Einzelne ist nur aus dem Ganzen, das Ganze
aber nur auf dem Wege übrtt das Einzelne zu verstehen.
— c) Alle Verstehbarkeit bewegt sich in Gegensätzen.
Dem entspricht, daß methodisch das Entgegengesetzte gleich verständlich
ist, — d) Das Verstehbare ist als Wirklichkeit
an außer bewußte Mechanismen gebunden und gründet in der
Freiheit. Dem entspricht, daß das Verstehen
unabschließbar ist. Obgleich es über jede erreichte Sti weitergeht,
stößt es an die beiden Grenzen (der Natur und Existenz). Die
Unvollendbarkeit des sich ständig hervorbringenden Verstandenen
entspricht die Unabschließbarkeit des nachfolgenden Verstehens.
— e) Das Einzelne als objektiver Tatbestand, als Ausdruck, als gemeinter
Inhalt als Tat, alle diese Erscheinungen der Seele werden in ihrer Isolierung
ärmer, im Zusammenhang reicher an Sinn. Dem entspricht die endlose
Deutbarkeit und Umdeutbarkeit aller Erscheinungen, an die das Verstehen
sich hält. — f) Das Verstehbare kann sich
in der Erscheinung nicht nur offenbaren, sondern auch verschleiern. Dem
entspricht, daß das Verstehen entweder Erhellen oder Entlarven ist."
S. 252 "b) Evidenz
des Verstehens und Wirklichkeit (Verstehen und Deuten). Die
Evidenz des genetischen Verstehens ist etwas
Letztes. Wenn Nietzsche uns überzeugend verständlich macht, wie
aus dem Bewußtsein von Schwäche, Armseligkeit und Leiden moralische
Forderungen und Erlösungsreligionen entspringen, weil die Seele auf
diesem Umweg trotz ihrer Schwäche ihren Willen zur Macht befriedigen
will, so erleben wir
eine unmittelbare Evidenz, die wir nicht weiter zurückführen
können. Auf solchen Evidenzerlebnissen gegenüber ganz unpersönlichen,
losgelösten, verständlichen Zusammenhängen baut sich alle
verstehende
Psychologie auf. Solche Evidenz wird aus Anlaß der Erfahrung gegenüber
menschlichen Persönlichkeiten gewonnen, aber nicht durch Erfahrung,
die sich wiederholt, induktiv bewiesen. Sie hat ihre Überzeugungskraft
in sich selbst. Die Anerkennung dieser Evidenz ist Voraussetzung der verstehenden
Psychologie, sowie die Anerkennung der Wahrnehmungsrealität und Kausalität
Voraussetzung der Naturwissenschaft ist.
Die Evidenz eines verständlichen Zusammenhangs
aber beweist noch nicht, daß dieser Zusammenhang nun auch in einem
bestimmten Einzelfall wirklich sei. oder daß er überhaupt wirklich
vorkomme. Wenn Nietzsche wirklich jenen überzeugend verständlichen
Zusammenhang zwischen Bewußtsein der Schwäche und Moral auf
den wirklichen einzelnen Vorgang; der Entstehung des Christentums überträgt,
so kann diese Übertragung auf den Einzelfall falsch sein, trotz der
Richtigkeit des generellen (ideal-typischen) Verstehens jenes Zusammenhangs.
Denn das Urteil über die Wirklichkeit eines verständlichen
Zusammenhangs im Einzelfall beruht nicht allein auf der Evidenz desselben,
sondern vor allem auf dem objektiven Material greifbarer Anhaltspunkte
(sprachliche Inhalte, geistige Schöpfungen. Handlungen, Lebensführung,
Ausdrucksbewegungen), in denen der Zusammenhang verstanden
wird; diese Objektivitäten bleiben aber immer unvollständig.
Alles Verstehen einzelner wirklicher Vorgänge
bleibt daher mehr oder weniger ein Deuten, das nur in seltenen Fällen
relativ hohe Grade: der Vollständigkeit überzeugenden objektiven
Materials erreichen kann. Wir verstehen, soweit
uns die objektiven Daten der Ausdrucksbewegungen, Handlungen, sprachlichen
Äußerungen, Selbstschilderungen im einzelnen Fall dies Verstehen
mehr oder weniger nahelegen. Zwar können wir losgelöst von aller
konkreten Wirklichkeit einen seelischen Zusammenhang: evident verständlich
finden. Im wirklichen Einzelfall aber können wir; die Realität
dieses verständlichen Zusammenhangs nur
in dem Maße behaupten, als die objektiven Daten gegeben sind. Je
weniger an Zahl diese, objektiven Daten sind, je weniger zwingend sie das
Verstehen
in bestimmtem Sinne herausfordern, desto mehr deuten, desto weniger verstehen
wir. Die Verhältnisse werden am klarsten durch einen Vergleich des
Verhaltens der Kausalregeln und der evident verständlichen
Zusammenhänge zur Wirklichkeit. Kausalregeln sind induktiv gewonnen,
gipfeln in Theorien, die etwas der unmittelbar gegebenen Wirklichkeit zugrunde
Liegendes denken. Unter sie wird ein Fall subsumiert. Genetisch verständliche
Zusammenhänge dagegen sind idealtypische Zusammenhänge, sind;
in sich evident (nicht induktiv gewonnen), führen nicht zu Theorien,
sondern sind ein Maßstab, an dem einzelne Vorgänge gemessen
und als mehr oder weniger verständlich erkannt werden. Fälschlicher
weise treten verständliche Zusammenhänge
als Regeln auf, indem die Häufigkeit des Vorkommens eines verständlichen
Zusammenhangs konstatiert wird. Seine Evidenz wird dadurch jedoch in keiner
Weise vermehrt; nicht er selbst, sondern seine Häufigkeit ist induktiv
gefunden. Zum Beispiel ist [>253] Häufigkeit des Zusammenhangs zwischen
hohem Brotpreis und Diebszahl verständlich
und statistisch konstatiert. Die Häufigkeit des verständlichen
Zusammenhangs zwischen Herbstwitterung und Selbstmord durch die Selbstmordkurve,
die im Frühjahr am höchsten ist, gar nicht bestätigt, darum
ist aber der verständliche Zusammenhang
nicht falsch. wirklicher Fall kann uns Anlaß werden zum Begreifen
eines verständlichen Zusammenhangs, die
Häufigkeit tut dann zur Vermehrung der einmal gewonnenen Evidenz nichts
hinzu. Ihre Feststellung dient ganz anderen Interessen. Im Prinzip ist
es durchaus denkbar, daß etwa ein Dichter verständliche
Zusammenhänge überzeugend darstellt, die noch niemals vorgekommen
sind. Sie sind unwirklich, besitzen aber ihre Evidenz in idealtypischem
Sinne. Man ist leicht voreilig, die Wirklichkeit eines verständlichen
Zusammenhangs etwa dann zu behaupten, wenn er bloß diese generelle
Evidenz hat. Wenn etwa Jung sagt, es sei „eine bekannte Sache, daß
es nicht allzu schwer ist, zu sehen, wo Zusammenhang und wo nicht“, so
ist angesichts des wirklichen Menschen gerade das Umgekehrte richtig."
Sachregistereinträge Erklären und Verstehen S. 23ff,
250-260, 261-304, S. 37
S. 23ff: ""
S. 37: ""
S. 250-260: ""
S. 261-304: ""
Inhaltsverzeichnis und teilweise auch Sachregistereinträge Verstehen.
Weisen des V. 251 ff.;
- [Die verständlichen Zusammenhänge des Seelenlebens (Verstehende Psychologie) 205ff]
- a) V. und Erklären 23, 251ff„ 255f.;
- b) Evidenz des V. (V. und Deuten) 252, 255, 260, 296ff„ 598f.;
- c) Rationales und einfühlendes V. 253;
- d) Grenzen des V, Unbeschränktheit des Erklärens 253ff.; 302, 358ff„ 455ff., 583, 591 ff 629f — s. unverständlich;
- e) Verstehen und Unbewusstes 254
- f) „Als-ob-V.“ 254f; 452f„ — s. Psychoanalyse;
- g) Über die Arten des Verstehens insgesamt (geistiges, existenzielles, metaphysisches Verstehen) 255ff
- [Phänomenologisches Verstehen und Ausdrucksverstehen 255]
- h) Wie die psychologische Verstehbarkeit in der Mitte zwischen den verstellbaren Qbjelrtivitäten und dem Unverständlichen sich bewegt 258. —
- i) Die Aufgaben der verstehenden Psychopathologie 260.
Verständliche Zusammenhänge.
§2. Inhaltliche verständliche Zusammenhänge 263
a) Die Triebe, ihre seelische Entfaltung und Verwandlung (Begriff des Triebes,
Ordnung der Triebe,. Abnorme Triebregüngen, Seelisohe Entwicklungen aus Triebvorwandlungen) 263. —
b) Der Einzelne in der Welt (Der Situationsbegriff,
Die Wirklichkeit, Selbstgenügsamkeit und Abhängigkeit, Typische, Grund - Verhältnisse des Einzelnen zur Wirklichkeit, Sich der Wirklichkeit versagen durch Selbsttäusehuhgen, Grenzsituationen) 271
c) Inhalte des Grundwissens, die Symbole; (Das ’Grundwissen, Begriff des Symbols und seine Bedeutung in der Lebenswirkliohkeit, Möglichkeit des Symbolyerstehens, Geschichte der Symbolforschung, Mögliche Aufgaben der Symbolforschung) 275.
§3. Grundformen der Verstehbarkeit 283
a) Die gegensätzliche Spannung der Seele und die Dialektik ihrer Bewegung
(Kategoriale, biologische, psychologische, geistige Gegensätzlichkeiten, Weisen. der Dialektik, Beispiele psychopathologischen Verstehens minder Dialektik der Gegensätze, Verfestigung psyohopathologischer Auffassung in verabsolutierten Gegensätzlichkeiten) 283
b) Leben und Verstehbarkeit in Kreisen 287
§ 4, Selhstreflexion 289
a) Die Reflexion und das Unbewußte 289
b) Die Sclbstreflexion als bewegender Stachel in der Dialektik der Seele 291
c) Gliederung der Selbstreflexion 291
d) Beispiele von Selbstreflexion in ihrer Wirkung (Der Zusammenhang zwischen willkürlichem und unwillkürlichem Geschehen, Das Persönliehkeitsbewußtsein, Das Grundwissen) 292.
§ 5. Grundgesetze des psychologischen Verstehens und der Verstehbarkeit 296
a) Empirisches Verstehen ist Deuten 296.
b) Das Verstehen vollzieht sich im hermeneutischen Zirkel 297
c) Entgegengesetztes ist gleich verständlich 297
d) Das Verstehen ist unabschließbar 298.
e) Die endlose Deutbarkeit 298.
f) Verstehen ist Erhellen und Entlarven 299.
Exkurs über Psychoanalyse 299.
Verständliche Zusammenhänge bei spezifischen Mechanismen,
b) Verstehbarer Inhalt
und Mechanismen 304
c) Allgemeine, ständig gegenwärtige und durch seelische Erlebnisse in Bewegung gebrachte besondere Mechanismen 304. — d) Normale und abnorme Mechanismen 305.
Erster Abschnitt. Normale Mechanismen 305
a) Erlebnisreaktionen 305.
b) Nachwirkung früherer Erlebnisse 307
c) Die Trauminhalte 310.
d) Suggestion 313
e) Hypnose 315.
Zweiter Abschnitt. Abnorme Mechanismen 317
Merkmale der Abnormität der Mechanismen 317.
§ 1. Pathologische Erlebnisreaktionen 319
a) Reaktion im Unterschied von Phase und Schub 320
b) Die dreifache
Richtung der Verstehbarkeit der Reaktionen 321
c) Übersicht über die reaktiven Zustände: nach den Anlässen, nach der Art der seelischen Struktur, nach Art der bedingenden Konstitution. Reaktive Zustände bei Schizophrenie 324
d) Die heilende Wirkung von Gemütsersohütterungen 327
§ 2. Abnorme Nachwirkung früherer Erlebnisse 328
a) Abnorme Gewohnheiten 328
b) Komplexwirkungen 329
c) Kompensationen 330.
d) Auflösungstendenzen und Ganzheitstendenzen 331.
§ 3. Abnorme Träume 332
a) Träume bei körperliehen Erkrankungen 332
b) Abnormes Träumen bei Psychosen 332
c) Inhalt abnormer Träume 333,
§ 4. Die Hysterie 334
§ 5, Verstehbare Inhalte der Psychosen 340
a) Wahnhafte Ideen 340.
b) Wahnideen der Schizophrenen 341
c) Die Unkorrigierbarkeit 342
d) Ordnung der Wahninhalte 342.
Weitere Stichworte zum Verstehen im Sachregister
Quellen des V. 261ff.;
Gesichtspunkte, Richtungen, Beispiele des V. 263ff.;
Grundformen 283ff.;
Grundgesetze 296ff. — S. a.. Charakterologie, Gegensätzlichkeit;
statisches und genetisches V. 23f., 255;
V. und Sprechen 156ff.;
Ausdrucksv. 214ff„ 255;
das geistige V. 256;
das existentielle V. 256f„ 258ff„ 648f., s. Existenz, Existenzerhellung;
das metaphysische V. 257 f — s. metaphysisch; V. und Werten 257f.;
V, als Erhellen oder Entlarven 299f.;
das lebens-geschichtliche V. 583ff.;
v. Psychologie als Charakterologie 357, 360ff.;
Aufgaben der v. Psychopathologie 260ff.;
in der Bearbeitung historischen Materials 596f.;
v. und kausal untersuchende Forschung 596f.;
v. Psychoanalyse 299ff„ 450ff„ 646ff.;
Existenzerhellung und v. Psychologie 648f.;
Zwischensein 258ff., 358ff., 648f.;
Unabschließbarkeit 254f„ 298f
S. a. Existenzerhellung, Philosophie, Psychologie.
Gruhle (1948) Verstehende Psychologie
Warnung: Gruhle bezichtigt in Verstehen und Einfühliung S. 284f Wilhelm von Humboldt unbelegt der Fälschungsbereitschaft.
Das Buch umfasst 622 Seiten. Das Wort "verstehen" - im Gegensatz zu Einfühlung mit vielen Einträgen - wird im Sachregister merkwürdigerweise nicht einmal aufgeführt. Allein aus diesem Befund liegt die Hypothese nahe, dass Verstehen für Gruhle im wesentlichen Einfühlung bedeutet.
Im Abschnitt "III. Psychologisches Verstehen, Einfühlung." (S. 57-148) sollte man erwarten. Erklärungen zum Verstehen zu finden."Bei der Beobachtung eines Hundes, habe ich aus seinem gesamten Gebaren erschließen gelernt, was in ihm vorgeht." Er erörtert dann, wie ein Kind zu solchen Deutungen mit Hilfe von Analogieschlüssen des Hundeverhaltens gelangen kann.
Gruhle-S.60: "Wenn ich als Erwachsener einen Hund sehe, so ist das eben schlechtweg ein Hund, dazu brauche ich keine langen Analogieschlüsse. Wenn das Kind jemand weinen sieht, so ist dieser traurig. Auch das steht dem Kind schlichtweg fest. Die Festlegung dieses Tieres mit Hund und die Festlegung dieses Weinens mit Traurigsein, ist grundsätzlich nicht voneinander unterschieden. Es ist dies ein Wissen um das Traurigsein. Ob ein Teilnehmen an dem Traurigsein dazukommt, ist eine ganz andere Frage, die des Nachfühlens, Mitfühlens, Mitergriffenseins usw. Hier wird oft folgender Gedankengang eingeschaltet: Ich sehe die Ausdrucksbewegungen des Mitmenschen. Da ich von mir her meine eigenen Ausdrucksbewegungen kenne und weiß, wovon sie Ausdruck sind, so nehme ich analogisch an, daß bei dem andern die Ausdrucksbewegungen den gleichen Sinn bergen werden. Das ist irrig. Ich habe meinen eigenen Ausdruck nie gesehen, kann also nicht von mir auf andere schließen. Aber ich hörte ja oft, was der andere sagt und tut, wenn er Ausdruck zeigt. Infolgedessen ist ein Schluß darauf, was in ihm vorgeht, nicht schwer. Einfühlung s. str. ist das nicht. Freilich glaube ich, nicht nur zu wissen, was sich in ihm abspielt, sondern auch die Herkünfte zu kennen, aus denen seine Regungen stammen, also den Zusammenhang zu durchschauen, aus dem diese entspringen. Dies letztere ist Einfühlung im engeren Sinne: das Motivverstehen des Nächsten. Aus ihm entspringt das, was man meist als Taktgefühl bezeichnet. Es handelt sich dabei nicht um ein besonderes Gefühl, sondern um ein sehr geschicktes Erraten der Regungen der Mitmenschen und eine feine voraussehende Einstellung auf diese Innenvorgänge der anderen, wonach sich dann das eigene Benehmen richtet. Derjenige, der kein sog. Taktgefühl hat, begeht Taktlosigkeiten, d. h. er kam gar nicht auf den Gedanken, daß dieses oder jenes im Mitmenschen vorgehen könne, oder er mißdeutete dessen Verhalten und blieb daher selbst unangepasst. Th. Lipps, der der Hauptautor für die Einfühlungstheorie ist, nimmt einen besonderen Instinkt der Einfühlung an. Das ist schon deshalb wahrscheinlich, weil die Einfühlung mit vieler Mühe erlernt werden muß. Lipps nimmt weiter an, daß in der Einfühlung in mir der Gedanke an ein so und so geartetes Geschehen im Mitmenschen „sich regt und in mein gegenwärtiges Erleben sich eindrängt, so daß dasselbe in mir mit dem Akte der Auffassung zusammen ein einziges Bewußtseinserlebnis ausmacht“. Dies ist eine etwas kuriose Formulierung. Wie ich von einem Gefäß annehme, es sei hohl, so nehme ich von einem [>61] Mitmenschen an, er langweile sich. Aber dabei drängt sich nichts in mich ein. Wie ich jenem Gefäß auch noch andere Eigenschaften zuspreche, etwa es sei spröde oder hart oder schon sehr alt u. dgl, so spreche ich auch. dem Mitmenschen eine Anzahl Tendenzen und Eigenschaften zu und habe dann eine Gesamtauffassung von ihm, von seiner Persönlichkeit. Diese Auffassung kann sich so intensivieren, daß „der andere“ dann, wie man zu sagen pflegt, deutlich vor mir steht. Denke ich mir eine Situation, in die der andere geriete, so könnte ich aus dieser Einfühlung heraus Voraussagen, wie er sich verhalten würde. Ich muß ihn freilich lange und gut studieren, ihn In vielen Situationen sehen, ihn über viele sprechen hören, dann rundet sich in mir sein Bild. Wenn Lipps formuliert, die fremden Iche seien das Ergebnis einer Vervielfältigung meiner Selbst, so ist das nicht glücklich gefaßt. Ich weiß ja, daß diese Persönlichkeiten anders gebaut sind. Meine Phantasie gibt mir freien Spielraum, und nur einiges von mir geht in den Fremden ein.
Natürlich hat Simmel7 recht, wenn er sagt: „Alles Verstehen ist eine Hineinverlegung selbsterlebter Innenereignisse. Woher als aus der eigenen Seele soll denn das Material zum Verstehen kommen? ... Das Du und das Verstehen ist dasselbe, gleichsam einmal als Substanz und einmal als Funktion ausgedrückt.“ — Daß ein Gefäß hohl sein wird, weiß ich aus anderen Erfahrungen an Gefäßen; nicht anders weiß ich von mir, daß z. B. in einem Moment der Enttäuschung mir so und so zumute ist. Erlebe ich, daß ein anderer enttäuscht wird, so vermute ich bei ihm die gleichen Innenvorgähge. Zugleich sehe ich seine Mimik und Haltung und erwerbe so Kenntnisse von Enttäuschungsmimik, die ich dann später bei meiner Menschenkenntnis anwende."
Kehrer, F.A. (1951) Das Verstehen und Begreifen in der Psychiatrie. Stuttgart: Thieme.
bei Kehrer g e s p e r r t Geschriebenes ist hier kursiviert.
S. 3f: "Erkenntnistheoretische Erörterungen über Verstehen
und Erklären
Gehen wir sie der Reihe nach durch, so muß aus erkenntnistheoretischen
Gründen an die Spitze die (erste) Frage gestellt werden: Ist „Verstehen"
(weiter abgekürzt: „V.") eine allgemein verbindliche Methodik,
d. h. ist der Maßstab, der von den verschiedenen Psychiatern
im Verfahren des V. jeweils an die gleichen Zustände angelegt wird,
ein einheitlicher, kommen demgemäß alle, die ihn anlegen, zu
annähernd dem gleichen Ergebnis, derart, daß jeder einzelne
Zustand von allen gleichermaßen verstanden wird, oder hängt
es nicht vielmehr von der ganzen psychischen Struktur des Verstehenden
ab, ob und inwieweit dies gelingt?
Die zweite grundsätzliche Frage, die naturgemäß
die positive Beantwortung der ersten zur Voraussetzung hat, lautet: Wieviel
leistet das V. für die Erkenntnis vom Wesen der Psychosen überhaupt?
Leistet sie mehr öder weniger als die andere, grundsätzlich in
Betracht kommende, die genetische Analyse, die Jaspers das „kausale,
objektive Erklären" oder „erklärende Psycho-[> S. 4] loogie"
genannt hat, und die kurz als die Methode des Zurückführens krankhaften
seelischen Geschehens auf dessen körperliche Grund- oder Unterlage
bezeichnet werden kann? Wie weit reicht beider Bereich und insbesondere
(entsprechend dem Thema, das wir uns hier gestellt haben), wie weit können
sich im Gebiete der Psychiatrie die verstehende und die erklärende
Psychologie gegenseitig ergänzen? (Ich sage ausdrücklich: ergänzen,
und nicht: ersetzen; denn beide Verfahren stehen gleichwertig nebeneinander,
sie gehen nur von verschiedenen Standpunkten und mit verschiedenen Verfahren
auf das gleiche Ziel: die kranke Seele, zu, sind also synoptisch zu erfassen.)
Beim Suchen nach Antworten auf diese Frage im Schrifttum bin ich nur auf
drei Aussagen gestoßen, die von Jaspers, Ewald und
Bumke.
Jaspers meint, das V. dürfe nicht das
Erklären, d. i. das (somatologische) Bemühen um Aufdeckung der
körperlichen Grundlagen der Psychosen unterbinden oder ersetzen wollen;
es bedeute lediglich ein Plus, das zu diesem hinzukomme. Wozu dies „Plus"
nützt, sagt er nicht. Ewald schreibt FN1,
der Gewinn der Unterscheidung von homo- und heteronomen Zuständen
scheine ihm nicht sehr bedeutend gegenüber derjenigen in endogene
und exogene und eine reinliche Scheidung damit nicht erreichbar zu sein.
Immerhin will er die „nicht encephalopathisch-exogenen Reaktionen" in einfühlbare
und nicht einfühlbare unterscheiden. Und Bumke schließlich
(1948) gibt der Überzeugung Ausdruck, daß „alle psychologischen
Deutungsversuche der Schizophrenie in dem Augenblick abgetan sein werden,
in dem wir die körperlichen Grundlagen dieser Krankheiten gefunden
haben." Wenn sich dies auch nicht, wie wir später sehen werden, auf
die eigentliche v. P. bezieht, sondern auf die psychoanalytische Deutung,
so scheint es doch, als ob er damit auch erstere im Auge gehabt habe.
Soll man nun etwa schon aus diesen Äußerungen
den Schluß ziehen, daß die, ja alltäglichen, Bemühungen
des praktischen Seelenarztes um ein V. der Psychosyndrome zwar ethisch
und psychotherapeutisch wertvoll, im Grunde aber insofern überflüssig
seien, als sie zu deren nosologischer Einordnung nichts beitrügen
oder womöglich gar zu trügerischen Ergebnissen führten?
Man sieht, hier wird ein für die Theorie wie die Praxis in der Psychiatrie
sehr wichtiges Problem angeschnitten.
Tritt man vorurteilslos an dieses heran, so muß es 1. als an
sich sehr wohl denkbar bezeichnet werden, daß die v. P. gerade in
jenen Fällen zur Erkennung des Aufbaus von Psychosen beitragen könnte,
in denen deren statisch-ikonographische Erfassung zu keinem eindeutigen
Ergebnis bezüglich der Beurteilung ihrer Verursachung führt —
anders ausgedrückt: in denen die nach Jaspers „erklärende"
Psychologie versagt, insofern bei ihnen keine oder keine eindeutigen somatischen
Abweichungen gefunden werden, die als Unterlage der psychischen gedeutet
werden dürfen. Hier also könnte die v. P. vikariierend [RS: ersatzweise,
stellvertretend] für die nicht zum Ziele führende „kausale" eintreten.
2. wäre es an sich wohl denkbar — diesen Gedanken hat Bumke
(1948) in Hinsicht auf die organischen Psychosen geäußert —,
daß verschiedene Grade der Verstehbarkeit vorkämen, entsprechend
der Art, wie eine hirnexogene Noxe auf das Hirn einwirkt. Er schreibt:
„Weil ein Gift, wo es auch entsteht und wie immer es ans Gehirn gelangt,
viel eher der Funktion nach zusammengehörige Teile desselben treffen
und ihre Leistungen im Ganzen dämpfen oder reizen wird als Verletzungen,
Entzündungen usw., die wahl- und (psychologisch) sinnlos ohne Rücksicht
auf ihre funktionelle Verbundenheit alle möglichen Teile des Gehirns
angreifen können, werden die so entstandenen Syndrome . . .
auch dem Verständnis des Gesunden immerhin etwas zugänglicher
sein als die groborganischen, und . . . auch den Äußerungen
der funktionellen Psychosen werden sie näher stehen." Auf diese Frage
soll weiter unten (S. 49) eingegangen werden. Vorläufig sei festgestellt:
So plausibel dieser Gedanke erscheint, die bisherige Erfahrung hat ihn,
so viel ich sehe, nicht als zutreffend bestätigt.
FN 1 in dankenswerter brieflicher Mitteilung
Sachse, Rainer (2013) Persönlichkeitsstörungen verstehen. Zum Umgang mit schwierigen Klienten. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
S. 26
"Das Modell der doppelten Handlungsregulation
Zum Verstehen der Funktionsweise von Persönlichkeitsstörungen
und zur Ableitung therapeutischer Strategien wird hier theoretisch vom
Modell der »doppelten Handlungsregulation« ausgegangen. Dieses
Modell stellt eine allgemeine Theorie darüber dar, wie Persönlichkeitsstörungen
psychologisch funktionieren (zur Vertiefung siehe auch Sachse 1999, 2001a,
2001b, 2004a; SACHSE & SACHSE 2010). Grundannahme dieses Modells ist,
dass Persönlichkeitsstörungen als Beziehungs- oder Interaktionsstörungen
aufgefasst werden. Persönlichkeitsstörungen sind komplexe Störungen,
die Handeln, Denken, Fühlen und spezifische Formen der Informationsverarbeitung
einschließen. Dennoch kann man annehmen, dass dysfunktionale Überzeugungen
über Beziehungen, dysfunkunktionale Intentionen und dysfunktionale
Arten der Beziehungsgestaltung den Kern der Störung bilden. Das Modell
umfasst drei Ebenen:
Die Elemente der authentischen Handlungsregulation oder Motivebene:
Auf dieser Ebene handeln die Personen authentisch und transparent. Interaktionspartner
können ihre Absichten erkennen. Die Personen handeln so, dass zentrale
Beziehungsmotive, z.B. das Motiv nach Wichtigkeit oder das Motiv nach Anerkennung,
befriedigt werden können.
Die Ebene der Schemata: Auf dieser Ebene sind Selbstschemata
der Person lokalisiert, also Überzeugungen der Person von sich selbst.
(z.B. Ich bin ein Versager!« oder »Ich bin kompetent!«),
sowie Beziehungsschemata, also Überzeugungen der Person darüber,
wie [>27] Beziehungen funktionieren oder was sie in Beziehungen zu erwarten
hat (z.B.: »In Beziehungen wird man nicht respektiert!«).
Die Spielebene: Auf dieser Ebene sind die manipulativen Strategien
der Person lokalisiert, die Strategien, die die Person zur Lösung
schwieriger Interaktionen entwickelt. Es handelt sich also um die Ebene
des nicht authentischen, manipulativen Verhaltens. Daher wird diese Ebene
auch »Spielebene« genannt, nach dem Begriff des »Spiels«
in der Transaktionsanalyse, der genau dieses unoffene, manipulative Verhalten
definiert.
Die Befriedigung von Wünschen auf der Motivebene
Die Motivebene beschreibt die »normale« Regulation interaktionellen
Handelns. Es wird hier davon ausgegangen, dass eine Person eine Reihe interaktioneller
Grundbedürfnisse aufweist. Diese zentralen Beziehungsmotive sind:
- das Motiv nach Anerkennung, Wertschätzung, positiver Definition,
- das Motiv nach Wichtigkeit,
- das Motiv nach verlässlicher Beziehung,
- das Motiv nach solidarischer Beziehung,
- das Motiv nach Autonomie,
- das Motiv nach Unverletzlichkeit des eigenen Territoriums und der eigenen Grenzen.
Die Person versucht nun, ein zentrales Beziehungsmotiv in einer
Beziehung zu befriedigen. Hat diese Person ein starkes Bedürfnis nach
Wichtigkeit, dann versucht sie, von einer anderen Person Aufmerksamkeit
zu bekommen, von ihr ernst genommen, von ihr wahrgenommen zu werden. Sie
versucht dann, ihr eigenes Handeln so zu gestalten, dass ihr Gegenüber
ihr all diese Aspekte gibt. Das funktioniert in der Regel, wenn die Person
authentisch handelt, also dem Partner deutlich macht, was sie will und
braucht, und wenn sie kompetent handelt. Ein übergeordnetes Motiv
enthält viele untergeordnete »interaktionelle Ziele«,
die man ganz konkret im Handeln anstreben kann. Zum Beispiel enthält
das Motiv Wichtigkeit Ziele wie:
Aufmerksamkeit erhalten; ernst genommen werden; zugehörig sein;
gehört werden; Rückmeldungen erhalten wie: Ich verbringe gerne
Zeit mit dir; du bereicherst mein Leben.
[S. 28: Abbildung Das Modell der doppelten Handlungsregulation]
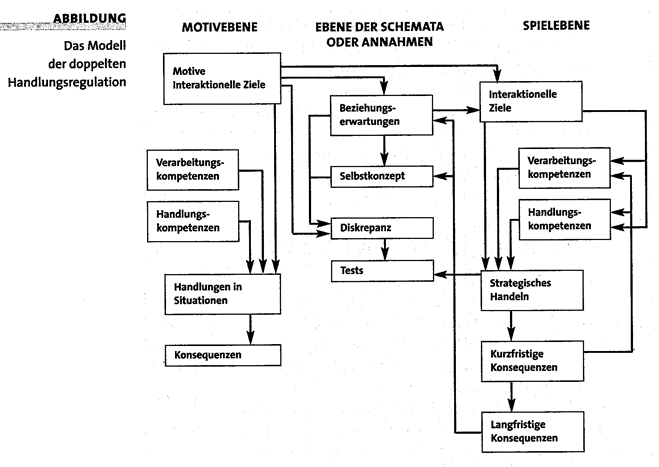
Zur Umsetzung von Intentionen in konkrete Handlungen sind Kompetenzen
notwendig. Die Person weist dabei in mehr oder weniger großem Ausmaß
Verarbeitungs- und Handlungskompetenzen auf, um konkrete Handlungen auszuführen,
die der Erreichung solcher Ziele dienlich sind.
Handlungskompetenzen sind z.B. Kenntnisse über geeignete Strategien
des Handelns, also Wissen darüber, was genau man in bestimmten Situationen
tun kann, um ein Ziel zu erreichen. Verarbeitungskompetenzen sind Fähigkeiten,
Situationen schnell zu analysieren und zu verstehen, z. B. die Fähigkeit,
aus dem Verhalten einer anderen Person auf deren Ziele, Motive und Werte
zu schließen. Hat eine Person hohe Kompetenzen, dann kann sie effektiv
handeln, hat sie solche Kompetenzen nicht, kann sie »in alle Fettnäpfchen
treten«.
Auf dieser Ebene geht man immer davon aus, dass das Handeln Motive
reflektiert, oder »diagnostisch« gesprochen, dass aus dem Handeln
prinzipiell auf die Motive geschlossen werden kann. Es [>29] wird damit
angenommen, dass das Handeln authentisch ist: Die Person hat nicht durchweg
und prinzipiell die Intention, ihre Ziele zu verbergen oder sie zu tarnen,
die Motive sind im Handeln transparent. Die Handlungsregulation auf der
Motivebene ist eine authentische Handlungsregulation."
Heilmann, Christa M. (2011) Körpersprache richtig verstehen und einsetzen. München [u.a.]: Reinhardt.
Obwohl das informative und interessante Buch ausdrücklich vom verstehen im Titel spricht, kommt "verstehen" nicht als Eintrag im Sachregister vor. Das könnte man aber auch damit erklären, weil das ganze Buch vom Verstehen der Körpersprache handelt.
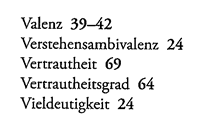
S. 24 (Verstehensambivalenz hervorgehoben von mir): "Zusammenfassung
und Vertiefung
Körpersprache im eigentlichen Sinne sind die körperlichen
Ausdrucksbewegungen, die in einer Sprachgemeinschaft bestimmte festgelegte
Bedeutungen haben. Natürlich besitzen sie eine noch größere
Vieldeutigkeit (Ambiguität) und einen geringeren Festlegungsgrad (Kodifizierungsgrad)
als die Sprache selbst, aber im kontextuellen Zusammenhang sind sie zu
verstehen. Wir müssen nicht aus Erfahrungen heraus eine Bedeutung
vermuten, sondern können sie mit einer gewissen Sicherheit wissen.
Trotzdem hat die Körper-Sprache eine höhere Verstehensambivalenz
(Bedeutungsunklarheit) als die Wort-Sprache und bedarf daher viel intensiver
der Klärung über den sprachlichen und außersprachlichen
Kontext. Spannend wird die Körpersprache im interkulturellen Kontext,
weil in anderen Sprachen natürlich ebenfalls solche festen Verbindungen
bestehen, aber nicht unbedingt in der gleichen Weise wie im Deutschen.
Zufällig (arbiträr) wurde im Deutschen die Verneinung mit dem
mehrmaligen Drehen des Kopfes verbunden. Im Griechischen z. B. gibt es
dafür einen kurzen Schnalzlaut, der mit einer einmaligen kleinen Rückwärtsbewegung
des Kopfes gekoppelt ist. In beiden Sprachen ist die Bedeutung der jeweiligen
Bewegung konventionalisiert, also festgelegt, und muss wie das Erlernen
der Wortbedeutung mit dem Spracherwerb angeeignet werden."
Nachdem das Analoge auch sehr vieldeutig sein kann, wären es natürlich sehr interessante und wichtige Fragen gewesen, wie man sich denn vergewissern, prüfen, kontrollieren, evaluieren kann, dass man versteht. Auch hier keine Einträge im Sachregister.
Winterstein, Alfred (1931) Zur Problematik der Einfühlung und des psychologischen Verstehens. (1931). Imago, 17(3):305-334
I) Die Einfühlung
Einleitung
Der Begriff der Einfühlung taucht zuerst in den metaphysisch-ästhetischen
Spekulationen der romantischen Schule auf. Theodor Lipps hat dann diesen
Gedanken in seiner Bedeutung für unser Wissen um fremde Persönlichkeiten
erfaßt und aus dem engen Bezirk der ästhetischen Fragestellung
in das weite Feld der allgemeinen Psychologie verpflanzt. Verstand man
unter Einfühlung ursprünglich nur die Beseelung des Untermenschlichen,
so ist darunter heute zumeist ein bestimmter psychologischer Prozeß
gemeint, durch den wir fremdes Seelisches so unmittelbar wie eigenes Erleben
zu erfassen trachten. Auf Grund der Einfühlung verstehen wir das Seelenleben
des andern; beide Begriffe hängen also aufs engste zusammen, ohne
natürlich identisch zu sein. Trotzdem werden sie von manchen Autoren
unterschiedslos gebraucht und andersartige Bezeichnungen, wie Vergegenwärtigen,
Anschauen, Hineinversetzen, Nacherleben, ihnen gleichgesetzt. Es ist bemerkenswert,
daß die doch so verwandten Probleme der Einfühlung und des Verstehens
in der wissenschaftlichen Literatur fast völlig getrennt behandelt
werden. Dilthey, Rickert, Jaspers und Spranger erwähnen kaum das Problem
der Einfühlung, während wiederum Volkelt und Lipps dem Problem
des Verstehens so gut wie gar nicht nahetreten.
Brandt, Christian (2010) Soziale Formen psychotherapeutischen Verstehens. Psychotherapeutenjournal 4/2010, 381-388. [PDF im Netz]
In dieser Arbeit wird der Verstehensbegriff vorausgesetzt und nicht näher analysiert, obschon doch im Resümee dargelegt wird, dass Verhaltenstherapie, Psychoanalyse und Gesprächspsychotherapie unterschiedliche Verstehenskonzepte haben. Letztlich bleibt damit dunkel, was psychotherapeutisches Verstehen sein soll und wie es vor sicht geht, funktioniert und kontrolliert wird.
- Textbelege Brandt:
S.381: Titel: Soziale Formen psychotherapeutischen Verstehens
S.383: "Soziale Grundformen des Verstehens
So verschieden die hier betrachteten therapeutischen Grundkonzepte angelegt sind, jedes scheint die störungswertigen Erlebens- und Verhaltensmuster in eine irgendwie verstehbare Form zu bringen; durch möglichst exakte Symbolisierung, durch Klärung der auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen oder durch Integration der störungsrelevanten Impulse in das Ich-Erleben. ..."
S.384a: "Das Verstehen dessen, was in den Symptomen „steckt“ – sei es eine spezifische Lerngeschichte und Verstärkersituation, eine Libidokonstellation oder eine mögliche Selbsterfahrung – erfolgt im Rahmen eines sozialen Prozesses zwischen Therapeut und Patient. ... "
S.384b: "Differentielle Verstehensformen: Wert- und Zweckrationalität
Es scheint so, als seien die therapeutischen Verstehensangebote von Gesprächs- und Verhaltenstherapie mit ihren ursprünglichen Konzepten auf diese beiden Rationalitätsformen ausgerichtet. "
S.385: "Auf dieser Verstehensgrundlage wird im therapeutischen Prozess der Aufbau oder die Aktivierung von funktional günstigerem Alternativverhalten angeboten und erprobt, um das relevante Bedürfnis zu befriedigen (d. h. den objektiven Zweck des Problemverhaltens zu erfüllen), ohne die ungünstigen Nebenfolgen herbeizuführen. "
S.386a: "Die therapeutische Symbolisierung des „heißen“ Handlungsimpulses ermöglicht der Person, diesen als Ausdruck einer von der „kalten“ Bewertungsbedingung abweichenden Werthaltung zu verstehen, soziologisch formuliert bedeutet dies, „dass eine singuläre Handlung (d. i. hier die durch die Aktualisierungstendenz geregelte inkongruente Erfahrung, Anm. d. Verf.), die bislang geltungsfrei vollzogen wurde, nun werthaft aufgeladen wird“ (Döbert, 1989, S. 240). ..."
S.386b: "Welche Vorstellung von Sinn sich im psychoanalytischen Verstehen findet, ist eine Frage, auf die es verschiedene Antwortebenen gibt. ..."
S.387: "Übertragen auf soziale Verstehensformen beinhaltet das psychoanalytische Symptomverständnis zwei Ebenen. ..."
S.388a: "Soziales Verstehen affektuellen Handeln vollzieht sich einfach, indem das Handeln als Befriedigung eines aktuellen affektuellen Bedürfnisses verstanden wird. ..."
S.388b: "Resümee Die konstitutiven, ursprünglichen Konzepte von Psychoanalyse, Gesprächs- und Verhaltenstherapie stellen ihren gemeinsamen Gegenstand, das psychisch störungswertige Erleben und Verhalten, in unterschiedliche Verstehenskontexte. Es lässt sich zeigen, dass die unterschiedlichen Begründungen dieser drei Verfahren mit unterschiedlichen Formen sozialer Sinnzuschreibung in unserem Kulturkreis korrespondieren. Inwieweit die jeweilige therapeutische Praxis den ursprünglich gesetzten Verstehensrahmen möglicherweise generell überschreitet und in welcher Weise die frühen Konzeptionen sich in der weiteren Entwicklung auf andere Sinnkontexte ausgedehnt haben, muss an dieser Stelle offen bleiben. ..."
Cunningham Verstehen in den Sozialwissenschaften
"In der nachfolgenden Abhandlung werden drei Arten des Verstehens unterschieden: Verstehen als Identifizierung eines Sachverhaltes bestimmter Art, als dessen Erklärung und als ein subjektives Gefühl, das sich nach einer solchen Erklärung einstellt."
- Quelle: Cunningham, Frank (1972) Bemerkungen über das Verstehen
in den Sozialwissenschaften. In (227-235) Albert, Hans (1972) Hrsg.)
Verstehen in der Biologie
Verstehen in der Biologie ist mehrdeutig. Es kann bedeuten, wie wir Menschen biologische Prozesse, Ereignisse und Geschehenisse verstehen können. Es kann aber auch bedeutet, wie biologische Geschöpfe, also Lebewesen ganz allgemein verstehen können. Verstehen setzt wahrnehmen und so etwas wie Denken voraus. Lebewesen könnten also nur dann verstehen, sofern sie wahrnehmen und denken können.
Riedl-1985
Riedl, Rupert (1985) Die Spaltung des Weltbildes- Biologische Grundlagen
des Erklären und Verstehens. Berlin: Parey.
Anmerkung: Im Glossar wird Erklären und Verrstehen leider nicht
aufgeführt. Das Sachregister weist folgende Eintraäge auf:
- Verstehen 101, 104, 105, 106, 125, 126
— als zweiseitige Erklärung 128 —, Lehre als -s 212
—, Operationen des -s 132,133 verstehende Methode 211, 295 Verstehensbegriff 105
Verstehen in der Physik
- ”shut up and calculate“.
- Verstehenskriterium Kommunikation in gewoehnliche Sprache.
- Verstehenkriterium Aufgaben lösen können.
- Verstehen der Atome (Auszug aus Weizsäcker 1985).
- Heisenberg: Der Begriff "Verstehen" in der modernen Physik [1920-22].
- Sprache und Verstehen bei Niels Bohr nach Weizsäcker.
- Verstehen der Quantenmechanik (Roll).
- Feynman: Niemand kann die Quantenmechanik verstehen.
- Feynman: Gleichzeitig Welle und Teilchen.
- Festkoerper nur quantentheoretisch "wirklich verstehbar" (dtv-atlas Physik).
- Querverweis: Texte und Gebrauchsbeispiele zu Begriffen und Begriffsbildung in der Physik.
- Carnap, Rudolf (1926) Physikalische Begriffsbildung. [s]
- Bridgman (1932) Der operative Charakter der Begriffe. [m]
- Hund, Friedrich (1969) Grundbegriffe der Physik. [m]
- Jung zum Geltungsbereich von Naturgesetzen.
- Strauss und Torney, Lothar von (1949) Der Wandel in der physikalischen Begriffsbildung. [m]
- Spektrum Lexikon der Physik:
- Atommolekül. [m]
- Definition. [m]
- Endophysik. [m]
- Materie. [m]
Signierungs-Status in den Texten: k:= korrigiert, m:=markiert, s:= signiert, t=teils
"”shut up and calculate“ -Philosophie
vieler Praktiker." (Gasenzer 2014, S. 188).
Auch: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70815-7_10
_
Verstehenskriterium Kommunikation in gewoehnlicher
Sprache
"Auch für den Physiker ist die Möglichkeit einer Beschreibung
in der gewöhnlichen Sprache ein Kriterium für den Grad des Verständnisses,
das in dem betreffenden Gebiet erreicht worden ist." Quelle S. 140: Heisenberg,
Werner (1959) Sprache und Wirklichkeit in der modernen Physik. In (139-156)
Physik und Philosophie. Frankfurt: Ullstein.
> Querverweis Laienkriterien.
_
Verstehenskriterium Aufgaben lösen
können.
Jemand hat einen physikalischen Sachverhalt verstanden, wenn er entsprechende
Aufgaben lösen lann, wenn Zufallstreffer, Spickzettel, abschreiben,
auswendig lernen oder Ähnliches ausgeschlossen werden können.
Zur Illustration und Demonstration sind Schul- und Lehrbücher meist
sehr gut geeignet.
_
Verstehen der Atome nach Weizsäcker
"Heisenberg sagte später über seine Lehrer: »Von Sommerfeld
hab’ ich den Optimismus gelernt, von den Göttingern die Mathematik,
von Bohr die Physik.«** In seinem ersten Gespräch mit Bohr,
in Göttingen 1922 (S. 58-65), lernte er dessen Herantasten an die
Beschreibung der unanschaulichen Realität der Atome kennen. Er fragt
am Schluß: »Werden wir dann die Atome überhaupt jemals
verstehen
()?« Bohr zögerte einen Moment und sagte dann: »Doch.
Aber wir werden dabei gleichzeitig erst lernen, was das Wort >verstehen
()< bedeutet.«
... Entscheidend für Heisenberg wurde hier ein Gespräch mit
Einstein im Frühjahr 1926, in dem dieser seine Kritik an der beabsichtigten
Beschränkung auf beobachtbare Größen in den Satz gefaßt
hatte: »Erst die Theorie entscheidet, was beobachtet werden kann.«
(Der Teil und das Ganze, S. 92) Anders gesagt: Man sieht nur, was man weiß.
Heisenberg hatte den Angelhaken für das Verständnis
dieser Tatsache schon in der Formulierung angebracht, er wolle ausschließlich
Beziehungen zwischen prinzipiell beobachtbaren Größen zugrunde
legen. Prinzipiell Unbeobachtbares sollte ausgeschlossen bleiben, aber
erst die Theorie entscheidet, was prinzipiell beobachtbar ist. Tatsächlich
hatte er sich auf diejenigen Größen gestützt, die faktisch
beobachtet, also fraglos beobachtbar waren; aber wie stand es mit den nicht
faktisch beobachteten Größen, z.B. allen Orten und Impulsen
auf der Bahn eines Teilchens? Waren sie prinzipiell beobachtbar? B.L. v.d.
Waerden hat mich im Zuge seiner Studien zur Geschichte der Quantentheorie
einmal erstaunt nach dem Sinn eines Briefs von Heisenberg an Pauli aus
dem Spätherbst 1926 gefragt, in dem dieser das Problem der Atomphysik
als völlig ungelöst bezeichnet hatte. Die mathematische Theorie
war doch schon abgeschlossen vorhanden; was fehlte denn noch? In der Sprache
des gegenwärtigen Buchs kann man antworten: es fehlte die physikalische
Semantik.
Die Lösung war die Unbestimmtheitsrelation
(1927). Die klassischen Eigenschaften eines Teilchens, Ort und Impuls,
sind prinzipiell beobachtbar, aber sie sind prinzipiell nicht [>] zugleich
beobachtbar. Dies war nicht eine Prämisse, sondern eine Konsequenz
der Quantentheorie. Die Theorie hatte entschieden, was beobachtbar ist.
In der Sprache des Hilbertraums gesagt: die Operatoren Ort und Impuls haben
jeweils Eigenvektoren, aber sie haben keine gemeinsamen Eigenvektoren.
Auf einer klassischen Teilchenbahn aber müßten beide zugleich
bestimmt sein; deshalb existiert die klassische Bahn niemals.
Höchst lehrreich ist Heisenbergs eigener Weg
zu dieser Einsicht (S. 111-112). »Wir hatten ja immer leichthin gesagt:
die Bahn des Elektrons in der Nebelkammer kann man beobachten. Aber vielleicht
war das, was man wirklich beobachtet, weniger. Vielleicht konnte man nur
eine diskrete Folge von ungenau bestimmten Orten des Elektrons wahrnehmen.
Tatsächlich sieht man ja nur einzelne Wassertröpfchen in der
Kammer, die sicher sehr viel ausgedehnter sind als ein Elektron. Die richtige
Frage mußte also lauten: Kann man in der Quantenmechanik eine Situation
darstellen, in der sich ein Elektron ungefähr — das heißt mit
einer gewissen Ungenauigkeit — an einem gegebenen Ort befindet und dabei
ungefähr — das heißt wieder mit einer gewissen Ungenauigkeit
— eine vorgegebene Geschwindigkeit besitzt, und kann man diese Ungenauigkeiten
so gering machen, daß man nicht in Schwierigkeiten mit dem Experiment
gerät?« Die bejahende Antwort auf diese Frage ist die Unbestimmtheitsrelation."
Quelle (S. 499-502) Weizsäcker, Carl Friedrich
von (1985) Aufbau der Physik. München: Hanser.
_
Heisenberg: Der
Begriff "Verstehen" in der modernen Physik [1920-1922]
Heisenberg, Werner (1981; 1969) Der Begriff "Verstehen" in der
modernen Physik. In (45-65) Der Teil und das Ganze. 5.A. München:
Piper.
[muss noch ausgewertet werden]
Textstellen, in denen "verstehen" vorkommt
S. 47f "Wolfgang [Pauli] fragte mich einmal — ich glaube, es war abends imWirtshaus in Grainau — ob ich die Einsteinsdie Relativitäts [>48]theorie verstanden () hätte, die im Sommerfeldschen Seminar eine so große Rolle spielte. Ich konnte nur antworten, daß ich das nicht wisse, da mir nicht klar sei, was eigentlich das Wort »Verstehen ()« in unserer Naturwissenschaft bedeute. Das mathematische Gerüst der Relativitätstheorie mache mir zwar keine Schwierigkeiten; aber damit hätte ich doch wohl noch nicht verstanden () , warum ein bewegter Beobachter mit dem Wort »Zeit« etwas anderes meine als ein ruhender Beobachter. Diese Verwirrung des Zeitbegriffs bleibe mir unheimlich und insofern auch noch unverständlich." ()
S. 52 "Dieser Kritik des Begriffs >Ursache< widersprach Wolfgang aber energisch. »Natürlich kann man immer weiter fragen, darauf beruht alle Wissenschaft. Aber das ist hier kein besonders treffendes Argument. Verstehen () der Natur bedeutet doch wohl: in ihre Zusammenhänge wirklich hineinschauen; sicher wissen, daß man ihr inneres Getriebe erkannt hat. Ein solches Wissen kann nicht durch die Kenntnis einer einzelnen Erscheinung oder einer einzelnen Gruppe von Erscheinungen erworben werden, selbst wenn man in ihnen gewisse Ordnungen entdeckt hat; sondern erst dadurch, daß man eine große Fülle von Erfahrungstatsachen als zusammenhängend erkannt und auf eine einfache Wurzel zurückgeführt hat. Dann beruht die Sicherheit eben auf dieser Fülle. Die Gefahr des Irrtums wird um so geringer, je reichhaltiger und vielfältiger die Erscheinungen sind und je einfacher das gemeinsame Prinzip ist, auf das sie zurückgeführt werden können. Daß man später vielleicht noch umfassendere Zusammenhänge entdecken kann, ist gar kein Einwand.«"
S. 53: "»ja, so etwa meine ich es. Der entscheidende Schritt bei
Newton und bei dem von dir erwähnten Faraday war jeweils die neue
Fragestellung und als eine Folge davon die neue klärende Begriffsbildung.
>Verstehen< heißt doch wohl
ganz allgemein: Vorstellungen, Begriffe besitzen, mit denen man eine große
Fülle von Erscheinungen als einheitlich zusammenhängend erkennen,
und das heißt: >begreifen<, kann. Unser Denken beruhigt sich,
wenn wir erkannt haben, daß eine besondere, scheinbar verwirrende
Situation nur der Spezialfall von etwas Allgemeinerem ist, das eben als
solches auch einfacher formuliert werden kann. Das Zurückführen
der bunten Vielfalt auf das Allgemeine und Einfache, oder sagen wir im
Sinne deiner Griechen: des >Vielen< auf das >Eine<, ist, was wir
mit >Verstehen ()< bezeichnen. Die
Fähigkeit zum Vorausberechnen wird oft eine Folge des Verstehens
(), des Besitzes der richtigen Begriffe sein, aber sie ist nicht einfach
identisch mit dem Verstehen ().«
Otto murmelte: »Der systematische Mißbrauch
einer eigens zu diesem Zwecke erfundenen Nomenklatur. Ich sehe nicht ein,
warum man so kompliziert über dies alles reden muß. Wenn man
die Sprache so benützt, daß sie sich auf das unmittelbar Wahrgenommene
bezieht, so können kaum Mißverständnisse passieren, weil
man dann ja bei jedem Wort weiß, was es bedeutet. Und wenn eine Theorie
sich an diese Forderungen hält, wird man sie immer auch ohne viel
Philosophie verstehen () können.«"
S. 53f: "... Es ist bekannt, daß Mach nicht an die Existenz der
Atome geglaubt hat, weil er mit [>54] Recht einwenden konnte, daß
man sie nicht direkt beobachten kann. Aber es gibt eine große Fülle
von Erscheinungen in Physik
und Chemie, von denen wir erst jetzt hoffen können, sie zu verstehen
(),
nachdem wir die Existenz der Atome wissen. An dieser Stelle ist Mach doch
offenbar durch seinen eigenen, von dir so empfohlenen Grundsatz in die
Irre geführt worden, und ich möchte dies nicht als reinen Zufall
betrachten.«
»Fehler werden von jedem gemacht« meinte
Otto beschwichtigend. »Man soll sie nicht zum Anlaß nehmen,
die Dinge komplizierter darzustellen als sie sind. Die Relativitätstheorie
ist so einfach, daß man sie wirklich verstehen
()
kann. Aber in der Atomtheorie, da sieht es allerdings noch düster
aus.«
S. 58: "... Dann fuhr er nachdenklich fort: »Die Bohrschen Bilder müssen schon irgendwie richtig sein. Aber wie kann man sie verstehen (), und welche Gesetze stehen hinter ihnen?«"
S. 62 [Bohr 1922 in Göttingen auf einem Spaziergang mit Heisenberg] "Nun ist das aber eigentlich eine ganz hoffnungslose Aufgabe; eine Aufgabe ganz anderer Art als wir sie sonst in der Wissenschaft vorfinden. Denn in der bisherigen Physik oder in jeder anderen Naturwissenschaft konnte man, wenn man ein neues Phänomen erklären wollte, unter Benützung der vorhandenen Begriffe und Methoden versuchen, das neue Phänomen auf die schon bekannten Erscheinungen oder Gesetze zurückzuführen. In der Atomphysik aber wissen wir ja schon, daß die bisherigen Begriffe dazu sicher nicht ausreichen. Wegen der Stabilität der Materie kann die Newtonsche Physik im Inneren des Atoms nicht richtig sein, sie kann bestenfalls gelegentlich einen Anhaltspunkt geben. Und daher wird es auch keine anschauliche Beschreibung der Struktur des Atoms geben können, da eine solche — eben weil sie anschaulich sein sollte — sich der Begriffe der klassischen Physik bedienen müßte, die aber das Geschehen nicht mehr ergreifen. Sie verstehen (), daß man mit einer solchen Theorie eigentlich etwas ganz Unmögliches versucht. Denn wir sollen etwas über die Struktur des Atoms aussagen, aber wir besitzen keine Sprache, mit der wir uns verständlich machen könnten. Wir sind also gewissermaßen in der Lage eines Seefahrers, der in ein fernes Land verschlagen ist, in dem nicht nur die Lebensbedingungen ganz andere sind, als er sie aus seiner Heimat kennt, sondern in dem auch die Sprache der dort lebenden Menschen ihm völlig fremd ist. Er ist auf Verständigung angewiesen, aber er besitzt keinerlei Mittel zur Verständigung. In einer solchen Lage kann eine Theorie überhaupt nicht >erklären< in dem Sinn, wie das sonst in der Wissenschaft üblich ist. ..."
S. 64 [Mit Bohr 1922 in Göttingen auf einem Spaziergang mit Heisenberg]
: "Ich fragte Bohr daher: »Wenn die innere
Struktur der Atome einer anschaulichen Beschreibung so wenig zugänglich
ist, wie Sie sagen, wenn wir eigentlich keine Sprache besitzen, mit der
wir über diese Struktur reden könnten, werden wir dann die Atome
überhaupt jemals verstehen ()?«
Bohr zögerte einen Moment und sagte dann: »Doch. Aber wir werden
dabei gleichzeitig erst lernen, was das Wort >verstehen
()< bedeutet.«"
Sprache und Verstehen
bei Niels Bohr
"Die Sprache ist nötig, denn es gibt keine Wissenschaft, wenn
wir nicht sagen können, was wir wissen. Auf Einsteins Satz »Gott
würfelt nicht« antwortete Bohr: »Es kommt nicht darauf
an, ob Gott würfelt oder nicht, sondern ob wir wissen, was wir meinen,
wenn wir sagen, Gott würfele oder er würfele nicht.« Deshalb
erläuterte Bohr die Unvermeidlichkeit komplementärer Begriffe
gern durch die Begrenztheit unserer Ausdrucksmittel. »Wir hängen
in der Sprache« pflegte er in seinen Gesprächen mit Aage Petersen
zu sagen. Er sprach so, lange ehe die linguistische Philosophie Mode wurde.
Freilich hat er nie die Sprachstruktur selbst zum Forschungsobjekt gemacht.
In der sprachlichen Erläuterung der Komplementarität wies er
nur darauf hin, daß wir beim Beschreiben von Phänomenen »stets
darauf angewiesen sind, uns durch ein Wortgemälde auszudrücken«.
Wenn wir kein Wort haben, das ein Phänomen eindeutig beschreibt, müssen
wir mehrere ungefähre Worte gebrauchen, deren Anwendungsbereiche sich
gegenseitig begrenzen. Diese Begrenzung erläuterte er meist nicht
sprachstrukturell (wie z.B. in dem uns heute geläufig gewordenen Gedanken
der philosophischen Vorentscheidungen, die im Gebrauch von Substantiven
und des bestimmten Artikels liegen), sondern in jedem Fragenkreis durch
Beschreibung der dort auftretenden Sachfragen."
Quelle (S. 509) Weizsäcker, Carl Friedrich
von (1985) Aufbau der Physik. München: Hanser.
_
Verstehen der Quantenmechanik
(Roll)
"... Auch die ernüchternde Erkenntnis,
die sich in dem bekannten Bonmot von Richard Feynman spiegelt: »Nobody
understands
(VerstonS?) quantum theory«,
führte erfreulicherweise nicht dazu, daß die Versuche unterblieben,
die Quantenmechanik besser zu verstehen
(VerstonS?). Dabei bedeutet »besser
verstehen« (VerstWbild)
ein über die Fähigkeit der bloßen Anwendung des Formalismus
hinausgehendes Verständnis (VerstWbild)
und Integration der neuartigen Konzepte in so etwas wie ein physikalisches
Weltbild: Es umfaßt also in den Versuchen der Entwicklung einer »Interpretation«
eine Sinngebung oder Deutung, beziehungsweise sogar die Entwicklung eines
physikalischen Weltbildes selbst. Wer sich mit der Interpretation der Quantenmechanik
beschäftigt, sieht demnach in einer physikalischen Theorie mehr als
nur eine Rezeptur zur Anwendung und Lösung gewisser Rechenaufgaben.
In der sprichwörtlich gewordenen Bezeichnung von John S. Bell ist
Quantenmechanik ohne Interpretation gut FAPP; gut »for all practical
purposes« - für alle praktischen Zwecke."
Quelle: Peter O. Roll (1998(99) Quantenmechanik
und ihre Interpretationen Quantenmechanik in [SLdP]
Feynman: Niemand kann die Quantenmechanik
verstehen
Feynman, Richard P. (2007; orig 1967) Vom Wesen physikalischer Gesetze.
München: Piper.
S. 160 "Andererseits kann ich mit Sicherheit behaupten,
dass niemand die Quantenmechanik versteht"
_
Feynman:
Gleichzeitig Welle und Teilchen (Loch1-Loch2 Versuch)
"Zusammenfassend kann man also sagen, die Elektronen
kommen stückweise wie Teilchen, die Wahrscheinlichkeit dagegen, daß
sie Stück für Stück eintreffen, wird auf eine Weise bestimmt,
wie man die Intensität von Wellen berechnen würde. In diesem
Sinne verhalten sich Elektronen manchmal wie Teilchen und manchmal wie
Wellen. Sie verhalten sich gleichzeitig auf zwei verschiedene Arten und
Weisen (Abb. 31)."
Quelle S. 170: Feynman, Richard P. (2007; orig 1967)
Vom Wesen physikalischer Gesetze. München: Piper.
Festkoerper nur quantentheoretisch "wirklich
verstehbar"
"Erst die Erfindung des Transistors 1948 erweckte das Interesse der
Physiker an der Untersuchung der Eigenschaften fester Körper. Die
Festkörperphysik führt das elektron. Zeitalter an. Man kann die
festen Körper phänomenologisch untersuchen, doch wirklich
verstehen lassen sie sich nur mittels quantentheoret. Methoden.
Die Quantentheorie sagte dann auch gänzlich unerwartete Effekte voraus.
Ein instruktives Beispiel dafür zeigte 1980 KLAUS VON KLITZING mit
dem Quanten-Hall- Effekt (Nobelpreis 1985). [dtv-atlas zur Physik
2, S. 329]
Verstehen in der Physik aus psychologischer
und entwicklungspsychologischer Sicht
Verstehen in der Musik
Jourdain (2011), S. 17 (aus der Einführung):
"... zum Verstehen... Obwohl viele Menschen Musik als universelle Sprache
ansehen, haben Kognitionsforscher Zweifel daran, ob Musik überhaupt
als Sprache aufgefaßt werden kann. Wenn Musik Bedeutung trägt,
worauf bezieht sich diese? Gibt es eine musikalische Grammatik? Welches
Vokabular umfaßt diese Musiksprache? Wenn Musik wirklich mit Sprache
vergleichbar ist, müssen wir uns auch der Frage stellen, ob musikalische
Fähigkeiten analog zu sprachlichen Funktionen im Gehirn angelegt sind.
Dabei beschäftigen wir uns mit verschiedenen Formen der Amusie, einem
Ausfall musikalischer Fähigkeiten nach Schädigungen des Gehirns."
Kapitel 9, "zum Verstehen" S. 329-363. Darin die
Abschnitte:
- Endzeitrechnung 3 421 479 (329-330)
- Voyager 2 (330)
- Bedeutung. (331-334)
- Paralellen zwischen Musik und Sprache (334-340)
- Die Abbildung von Musik im Gehirn (340-344)
- Können wir Musik im Gehirn beobachten? (345-348)
- Amusie (348-357)
- Musikalische Bedeutung (357-363)
Beispiele zum Gebrauch des Wortes verstehen
aus Medien, Literatur und Internet
Gebrauchsbeispiele aus dem Internet (Auswahl)
- I01 Verstehen Sie Spaß? (Fernsehsendung Abruf 23.08.18)
- I02 "Du verstehst (Verstfrage) mich einfach nicht" (Freundin 05.05.2017, Abruf 23.08.18)
- I03 "Wie gut verstehst (Verstbezieh) du dich mit deinem Vater?" (testedich ohne Datum, Abruf 23.08.18)
- I04 "Unser Geldsystem – verstehst (Verstwis) (Verstzusam) Du es" (Carsten Stolle ohne Datum, Abruf 23.08.18)
- I05 "Nicht, dass du mich falsch verstehst (Verstfrage): Ich bin zwar allein, aber ich fühle mich nicht einsam" (Gedankenwelt 18.11.12016, Abruf 23.08.18)
- I06 "Verstehst du jetzt, warum ich dich liebe? (Verstfrage), (Verstzusam)" (Gedichte.com-19.11.2006, Abruf 23.08.18)
- I07 "verstehst du mich? (Verstfrage) – Hundetraining und Verhaltensberatung" (diehundeschulen ohne Datum, Abruf 23.08.18)
- I08 Bei "Ich hoffe du verstehst (Verstfrage) mich." Komma?! Wie ist es korrekt? Ich hoffe, du verstehst (Verstfrage) mich." (gutefrage ohne Datum, Abruf 23.08.18)
- I09 "Wer versteht, gewinnt!" (Verstwert) Verstehen ist der Erfolgsfaktor der Zukunft. Wer tief versteht, sieht klarer, erkennt, worum es im Kern geht, und trifft die besten Entscheidungen. ... (die-ratgeber ohne Datum, Abruf 23.08.18)
- I10 "Verstehen (VerstonS?), Nichtverstehen (Verstnicht), Missverstehen (Verstmissv) - Verstehensprozesse (Verstprozess) bei verbaler Kommunikation im Rahmen der Relevanztheorie " (Hausarbeiten, Diplomarbeit 2004, Abruf 23.08.18)
- I11 "Das deutsch-französische Missverstehen" (Verstmissv) (Tagesspiegel 23.05.2018, Abruf 23.08.18)
- I12 "Warum „Verstehen“ (VerstonS?) und „Verständnis haben“ (Verstdif) nicht das gleiche ist. „Kannst du mich nicht verstehen?“ (Verstfrage) oder „Warum hast du dafür kein Verständnis?“ (Verstfrage) haben wir alle schon mal gehört. In den meisten Fällen wird dann „Verstehen“ (VerstonS?) mit „Verständnis haben“ (VerstonS?) gleichgesetzt. Es ist jedoch etwas völlig verschiedenes. Jemanden zu verstehen (VerstonS?), bedeutet nicht, dass ich sein Verhalten oder seine Meinung gut finden muss und Verständnis (Verstbillig) dafür habe." (Mind Hacker ohne Datum Abruf 23.08.18, Abruf 23.08.18)
- I13 "Verstehen (VerstonS?) ist die Ausnahme – Missverstehen (Vertmissv) die Regel. Warum es keine Garantie gibt, dass wir andere wirklich verstehen." (Hans.Jürgen.Walter ohne Datum, Abruf 23.08.18)
Gebrauchsbeispiele aus der Literatur
(Belletristik) (Auswahl)
- B01 Rainer Maria Rilke "Du musst das Leben nicht verstehen" (Verstfrage), (Verstzusam) (Gedicht, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B02 EinFach Deutsch ...verstehen (Verstbedeut) - Interpretationshilfen / Johann Wolfgang von Goethe: Iphigenie auf Tauris von Michael Fuchsö
- B03 "Die Kranke schien durch die Anstrengung, die sie soeben gemacht, ganz erschöpft zu sein und zeigte, ohne den Kopf vom Pfühl zu erheben, mit matter Hand auf einen Sessel, indem sie dem Geistlichen durch diese Gebärde zu verstehen (Versthinweis) gab, daß er sich dem Bette nähern und Platz nehmen solle. Der Priester verstand (Verstkomm) diese Gebärde, näherte sich dem zu Häupten des Bettes stehenden Sessel und setzte sich. ..." (Alexander Dumas Lady Hamilton, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B04 "... »Sie verstehen (Verstkönn) noch nicht zu lügen,« sagte Miß Arabella. »Ich hatte dies buchstäblich erraten.« ... " (Alexander Dumas Lady Hamilton, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B05 "... Amy blieb stehen, bedeckte sich das Gesicht mit ihrem Tuche und sagte mit halberstickter Stimme zu mir: »Sprich, sprich! Mylord wird dich lieber anhören und besser verstehen als mich.« ... " (Alexander Dumas Lady Hamilton, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B06 "... Ich weiß eigentlich nicht, warum ich nicht lieber meine Zofe schicke, und ich werde dies auch tun, wenn Sie sich dazu verstehen (Verstbereit), mich anderswohin zu begleiten.« ..." (Alexander Dumas Lady Hamilton, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B07 "... Sir John hörte mich meine Befehle erteilen, ohne meine Absichten zu verstehen (Verstkomm), und wünschte wahrscheinlich sehnlich, daß ich ihm mein Geheimnis wenigstens zum Teil verraten möchte, aber ich sagte kein Wort. ..." (Alexander Dumas Lady Hamilton, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B08 "... Gestatten Sie mir, Ihnen bloß noch eins zu sagen, nämlich daß, wenn Sie keine Törin sind, Sie Ihr Glück in den Händen haben; verstehen (Verstfrage) Sie mich?« – »Ja, Madame, ich verstehe (Verstnicht), obschon nicht ganz.« – »Nun gut denn, Miß Clarissa, dann wird man Ihnen jemanden schicken, der sich deutlicher erklären wird. ..." (Alexander Dumas Lady Hamilton, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B09 "... Wir haben in England wenig Maler, beinahe alle aber, die wir haben, verstehen (Verstkönn) sich trefflich auf das Kolorit und Romney nimmt unter diesen den ersten Rang ein. ..." (Alexander Dumas Lady Hamilton, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B10 "... Sie sind auch ein Mann von Witz, Mylord. Ich sehe, daß wir uns verstehen (Verstbezieh) werden. ... " (Alexander Dumas Lady Hamilton, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B11 "... Die Platte war von jener Bronze gefertigt, welche nie vom Wasser angegriffen wird und deren Fabrikation nur die Chinesen und Japanesen verstehen (VerstssB). ..." (Karl May: Am Stillen Ozean - Kapitel 4, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B12 "... Was verstehen (Verstfrage) diese Kerls von der Jagd? ... " (Karl May: Am Stillen Ozean - Kapitel 4, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B13 "... Drei Wörter, welche er mir heut fünfzigmal hersagen mußte, hatte er bereits morgen schon wieder vergessen oder gebrauchte sie in einer Weise, welche mir die Lachtränen in die Augen trieb, und als wir Kanton erreichten, war er imstande, eine englisch-chinesische Rede zu halten, von der kein Mensch ein Wort verstehen (Verstnicht) konnte, weil sie aus Redeteilen bestand, welche er für den Augenblick extemporierte. ... " (Karl May: Am Stillen Ozean - Kapitel 4, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B14 "... Zwar hätte ich sehr leicht eine direkte Frage aussprechen können, da er aber meine Andeutungen nicht verstehen (Verstnicht) wollte, so hatte ich dies unterlassen. ... " (Karl May: Am Stillen Ozean - Kapitel 4, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B15 "... Denn zum erstenmal, seit sie hier Dienst tut, sieht sie ihren eigenen Namen auf einem telegrafischen Blatt. Sie liest einmal, zweimal, dreimal die nun schon fertig gehämmerte Depesche, ohne den Sinn zu verstehen (Verstnicht). ..." (Stefan Zweig: Rausch der Verwandlung - Kapitel 2, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B16 "... Zu unerfahren, kann sie nicht begreifen, daß dieser Lord, dieser General, der ihr unnahbar scheint, wolkenweit über ihrer Welt, mit der Mutlosigkeit eines alternden Mannes, der nicht mehr weiß, ob er noch zählt, und von Scham bedrängt ist, sich durch Werbung lächerlich zu machen, auf irgendein winziges Zeichen von ihr, auf ein ermutigendes Wort wartet; aber wie soll sie diese Mutlosigkeit verstehen (VerstonS?) (VerstssB), sie, die selbst keinen Mut hat, an sich zu glauben? Sie spürt die Andeutungen als Zeichen besonderer Sympathie gleichzeitig ängstlich und beglückt, ohne zu wagen, ihnen zu glauben, indes er sich quält, dies ihr verlegenes Ausweichen richtig zu deuten. ... " (Stefan Zweig: Rausch der Verwandlung - Kapitel 2, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B17 "... Alle verstehen (Verstzusam) sofort das Demonstrative dieses Armbindens und seiner betonten Reverenz. ..." (Stefan Zweig: Rausch der Verwandlung - Kapitel 2, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B18 "... Zum erstenmal in ihrem Leben sieht sie die Schwester, der sie immer respektvoll untergeordnet war, mit Verächtlichkeit an und mit Haß, weil sie nicht versteht (Verstnicht), was sie nicht verstehen will (Verstmoti). ..." (Stefan Zweig: Rausch der Verwandlung - Kapitel 2, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- B19 "Der verhängnisvolle Urlaub / Frauen verstehen mehr von Liebe" (Verstwiss), (Verstkönn) von Heinz G. Konsalik.
Gebrauchsbeispiele aus Sachbuechern
(Auswahl)
Sie können alle wie folgt signiert werden: (Verstfrage),
(Verstbedeut), (Verstwiss),
(Verstzusam),
- Andere verstehen von Eva Jaeggi Beltz,
- Antiepileptika verstehen von Pohlmann-Eden, Bernd; Steinhoff, Bernhard J
- Aristoteles verstehen von Sebastian Wendt
- Autorität verstehen von Harrison, Buddy Dr.
- Banker verstehen von Markus Neumann
- Blutwerte verstehen von Vera Zylka-Menhorn
- Chakren verstehen von Ambika Wauters
- Christentum verstehen Autorenkollektiv
- Computer und Internet sehen und verstehen – (Reader's Digest)
- Das große Reader's Digest Länderlexikon - Alle Länder der Erde kennen - erleben - verstehen. Hier fragt man sich, wie das geht, ein Land zu verstehen?
- Deutsches Sprachbuch für höhere Schulen. Wege zum Verstehen und Gestalten der Muttersprache. Erster Band (1. Klasse-Sexta) von Wilhelm Eggerer.
- Duden 8. bis 10. Klasse Chemische Verfahren und Gesetze richtig verstehen und anwenden
- Europa verstehen von Eckart Gaddum
- Film verstehen von James Monaco
- Flüchtlinge verstehen von Rudolf Stumberger
- Frankreich verstehen von Grosse, Ernst U; Lüger, Heinz H
- Glauben verstehen von Uwe Dittmer
- Globalisierung verstehen von Siegler
- Gründlich verstehen. Literaturkritik heute von Görtz, Franz / Ueding, Gert (Hg)
- Homer verstehen.von Mannsperger, Brigitte und Dietrich.
- Inkontinenz verstehen von Kinie Hoogers
- Innere Medizin - Verstehen Lernen Anwenden von Schettler, Gotthard; Greten, Heiner
- Islam verstehen von Sympathie Magazin
- Italien verstehen von Ernst Ulrich Große / Günter Trautmann
- Judentum verstehen Sympathie Magazin
- Kinderängste verstehen von Monika Niederle
- Kinderträume verstehen von Hopf, Hans H
- Kinderwelten verstehen vpn Aster, Sigrid von
- Kinderzeichnungen verstehen von Meike Aissen-Crewett
- Kirche verstehen von Uta Pohl-Patalong
- Körperlogik verstehen von Johannes Randolf
- Körpersprache verstehen von Reutler, Bernd H
- Kritisches Verstehen von Holthusen, Hans Egon
- Laborwerte verstehen von Maria Lohmann
- Leben Verstehen von Markus Klepper
- Leukämie verstehen von Mughal; Goldman; Hehlmann; Berger
- Malerei verstehen von Norbert Wolf
- Mathematik verstehen von Robert Müller
- Marx verstehen von Robert Misik
- Menschenrechte verstehen von Wolfgang Benedek
- Musik verstehen von Hans Heinrich Eggebrecht
- Muslime verstehen von Roland Denner
- Persönlichkeitsstörungen verstehen von Rainer Sachse
- Polyphones Verstehen von Gerd Theißen
- Russland verstehen von Michel, Karl M; Spengler, Tilman; Margolina, Sonja
- Statistik verstehen von Peter Zöfel
- Sterbende verstehen von Heinrich Pera
- Vergangenheit verstehen von Erna Paris
- Verstehen lernen von Peter Müller
- Verstehen und Gestalten Ausgabe B Band 7 - Arbeitsbuch für Gymnasien
- "Wirtschaft und Politik verstehen. Didaktisches Sachbuch zur Vorgeschichte und Geschichte der Bundesrepublik. Hrsg. von Bernewitz, Ernst Heinrich von.
Gebrauchsbeispiele aus der Ratgeber-Literatur (Auswahl)
Sie können alle wie folgt signiert werden: (Verstfrage), (Verstbedeut), (Verstwiss), (Verstzusam),
- Hamster - richtig pflegen und verstehen - Experten-Rat für die artgerechte Haltung.
- Katzen richtig pflegen und verstehen. – Ratgeber von Katrin Behrend.
- Zwergkaninchen richtig pflegen und verstehen von Monika Wegler
- Wellensittiche richtig pflegen und verstehen
- Meerschweinchen richtig pflegen und verstehen
- Ratten als Heimtiere richtig pflegen und verstehen
- Pferde verstehen, Kosmos,
- Hunde verstehen von Horst Hegewald-Kawich und Monika Wegler
- Hundesprache verstehen von Brigitte Harries
Gebrauchsbeispiele aus der Geistesgeschichte
(Auswahl)
- G01 nietzsche verstehen (Verstzusam), (VerstssB - hier Nietzsche) von christian niemeyer
- G02 "... Unter dem Sein eines Menschen verstehen (Verstdef) wir alle selbstverständlich sein unmittelbares Wesen, im Körper seiner Gedanken, Gefühle und Wollungen ausgedrückt; diese weisen, wo Sein bestimmt, unmittelbar auf den Kern der Persönlichkeit zurück, in dem sie organisch verankert sind. ... (Graf Hermann Keyserling: Schöpferische Erkenntnis - Kapitel 8, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- G03 "... Alles Auffassen, Aufnehmen ist schon ein Beleben; allein Verstehen (Verstheorie) ist Gleiches in höherem Grad. Nicht nur deshalb, weil nur Verstandenes (Verstheorie) als assimiliert gelten darf, sondern weil das Verstehen über das Verstandene Macht gibt und die Außenwelt überall den Stempel des Geistes trägt und die von ihm gewollte Gestalt annimmt, wo dieser sie begriff. Hier gilt nun ein weiterer Satz: je tiefer Geist verstehend vordrang, desto mehr hat das Gegenständliche am Leben teil. Die Tiefe der Sinneserfassung scheint dabei der Weite des also durchdrungenen Gebiets geradezu proportional zu sein, so schwer sich dies nachweisen läßt: wie die mathematische Formel, je allgemeiner sie ist, desto mehr Sonderfälle zu beherrschen gestattet, so bedingt jede tiefere Stufe der Einsicht Überlegenheit über entsprechend mehr Kräfte und Situationen. Von hier aus gelingt nun besser zu verstehen (Verstheorie), was wir schon bei anderer Gelegenheit feststellten, daß Verankerung des eigenen Lebens in tieferem Sinn allein den bewußten Lebensprozeß im Gang erhält." (Graf Hermann Keyserling: Schöpferische Erkenntnis - Kapitel 8, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- G04 "... Hier nun beweist vieltausendjährige Erfahrung wiederum, daß Einsicht oder Verstehen(Versteins), wo sie stark genug vitalisiert sind und lange genug das Bewußtsein beschäftigen, unweigerlich eine ihnen entsprechende Wirklichkeit schaffen. ..." (Graf Hermann Keyserling: Schöpferische Erkenntnis - Kapitel 8, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- G05 "... Wir sahen weiter, daß persönliches Verstehen(Verstheorie), (VerstssB - hier persönliches V.) allein das sonst Äußerliche ins Innere hineinbezieht, das alles Leben ein Beleben ist und folglich ein schöpferisches Tun. ..." (Graf Hermann Keyserling: Schöpferische Erkenntnis - Kapitel 8, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- G06 "... Der Schnittpunkt des Winkels, der das Problem dieser Zeit einschließt, muß eine konkretere Fassung finden, als der abstrakte Erkenntnisausdruck ihn bietet, um vom verstehenden (Verstheorie), (VerstssB - hier verst.Bewusstsein.) Bewußtsein der Mehrzahl aufgenommen zu werden. ..." (Graf Hermann Keyserling: Schöpferische Erkenntnis - Kapitel 8, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- G07 "... Es kommt auf Sinn verstehen (Verstzusam) , nicht Fachkenntnisse an; die nötigen Fachleute sind überall zu mieten, wo es ihrer bedarf. ..." (Graf Hermann Keyserling: Schöpferische Erkenntnis - Kapitel 8, Gutenbergprojekt, Abruf 23.08.18)
- G08: "Verstehen (Verstinteraktiv) ist keine statische Anfgelegenheit, sondern ereignet sich - [>38] metaphorisch gesprochen - im Hin- und Hergehen zwischen einem Objekt und einem verstehenden Subjekt. Dieses Hin- und Hergehen ist verschiedentlich als ein »Zwischen«, ein »Zwischenraum« bezeichnet worden. Für Gadamer ist der Ort zwischen Fremdheit und Vertrautheit der wahre Ort der Hermeneutik. Verstehen (Verstprozes) als Prozess kann in der Tat nicht nur bei den Verstehenden selbst angesiedelt werden; wer anderes verstehen () will, muss »aus sich herausgehen«. Auf der anderen Seite lässt sich der Verstehensprozess (Verstprozes) nicht nur bei dem Objekt des Verstehens (VerstonS?) festmachen; denn ich bin es ja, der verstehen will und Fremdes bei sich einlässt. Deshalb ist Verstehen (Verstinteraktiv) immer ein sowohl reproduktives als auch ein produktives Geschehen. Der Prozesscharakter des Verstehens (Verstprozes) verweist auf den Ort »dazwischen«, in dem Sinn entdeckt und Bedeutung zugeschrieben werden können. Dieser »Raum des Verstehens (Verstheorie) « ist durchaus begrenzbar (es lässt sich nicht alles auf jede Weise verstehen (Verstheorie) ); aber abgeschlossen werden kann er nicht. Auch wenn manche, nicht zuletzt religiöse Interpretationen mit definitivem Anspruch auftreten, wäre eine »endgültige Interpretation« doch ein Widerspruch in sich selbst. Interpretation ist immer auf dem Weg, sie ist unabschließbar und prinzipiell offen.
Offen ist sie auch in der Hinsicht, dass sie sich nicht nur rein kognitiv begrenzen lässt. »Ein freischwebendes, rein kognitives Verstehen (Verstheorie) hätte nichts mehr mit dem Verstehenden zu tun, es wäre willkürlich und ohne Anker und damit kein »Verstehen« () Verstehen (Verstheorie), (Verstdef) hat eine pragmatische Komponente, ist rational und emotiv, kognitiv und handlungsorientiert zugleich. Aus diesem Grund ist das Verstehen (Verstnicht) ein so schwierig-lohnendes Geschäft." Quelle S. 37f: Müller, Peter; Dierk, Heidrun & Müller-Friese, Anita (2005) Verstehen lernen. Ein Arbeitsbuch zur Hermeneutik. Stuttgart: calwer.
G09-Dilthey-S.35: "Hiermit ist eine zweite
Eigenthümliclikeit der Auffassung seelischer Zustände gegeben.
Diese Auffassung entsteht aus dem Erlebniss und bleibt mit ihm verbunden.
In dem Erlebniss wirken die Vorgänge des ganzen Gemüthes (Verstganzh)
zusammen. In ihm ist Zusammenhang (Verstzusam)
gegeben, während die Sinne nur ein Mannigfaltiges von Einzelheiten
darbieten. Der einzelne Vorgang ist von der ganzen Totalität (Verstganzh)
des Seelenlebens im Erlebniss getragen, und der Zusammenhang, in welchem
er in sich und mit dem Ganzen des Seelenlebens steht, gehört der unmittelbaren
Erfahrung an. Dies bestimmt schon die Natur des Verstehens
(Verstheorie) unserer Selbst und
Anderer. Wir erklären durch rein intellectuelle Processe, aber wir
verstehen
(Verstganzh) durch das Zusammenwirken
aller Gemüthskräfte in der Auffassung. Und wir gehen im Verstehen
(Verstzirkel)
vom Zusammenhang des Ganzen, der uns lebendig gegeben ist, aus, um aus
diesem das Einzelne uns fassbar zu machen. Eben dass wir im Bewusstsein
von dem Zusammenhang des Ganzen leben, macht uns möglich, einen einzelnen
Satz, eine einzelne Geberde oder eine einzelne Handlung zu verstehen. Alles
psychologische Denken behält diesen Grundzug, dass das Auffassen des
Ganzen die Interpretation des Einzelnen ermöglicht und bestimmt. An
dem ursprünglichen Verfahren des Verstehens
(Verstheorie) muss auch die
Nachconstruction der allgemeinen Menschennatur in der Psychologie festhalten,
wenn sie gesund, lebensvoll, lebenskundig, fruchtbar für das Verständniss
(Verstheorie) des Lebens bleiben
soll. Der erfahrene Zusammenhang des Seelenlebens muss die feste, erlebte
und unmittelbar sichere Grundlage der Psychologie bleiben, wie tief sie
auch in die experimentelle Einzelforschung eindränge. [1343]" Quelle
S. 35: Dilthey, Wilhelm (1894) Ideen über
eine beschreibende und zergliedernde Psychologie. Sitzungsberichte der
königlich preussischen Akademie der Wissenschaften
zu Berlin, 7. Juni 1894, Ausgabe XXVI,
_
G10-BollnowS34.:"Ober
das kritische Verstehen (Verstkritisch)
Man sagt vom Verhalten eines anderen Menschen „Das kann ich verstehen"
V oder „Das kann ich gut verstehen" (Verstbillig)
(nämlich, daß er in einer bestimmten Lage so und nicht anders
gehandelt hat) oder im entgegengesetzten Fall „Das kann ich nicht verstehen".
Man meint damit im ersten Fall: wenn ich mich in die Lage des betreffenden
Menschen hineinversetze, so kann ich mir denken, daß ich genau ebenso
gehandelt haben würde. Oder auf der andern Seite bedeutet „Das kann
ich nicht verstehen (Verstbillig)":
das kann ich nicht billigen; auch bei Berücksichtigung aller beteiligten
Umstände hätte ich nicht ebenso handeln können und muß
auch beim andern Menschen ein solches Verhalten ablehnen. Die Sprache spricht
hier im natürlichen Gebrauch von „verstehen"
() unbefangen in einem bestimmten engeren Sinn, obgleich man das Verhalten,
von dem man hier sagt, daß man es „nicht versteht"
(Verstbillig),
in einem andern, psychologischen Sinn durchaus versteht
(Verstmoti),
d. h. in seiner Motivation und in seinem inneren Zusammenhang begreift.
Das Verstehen (Verstbillig)
in dem hier gemeinten unbefangenen Sprachgebrauch schließt also das
Billigen schon immer ein. Es bedeutet nicht nur eine theoretische Erfassung
des betreffenden menschlichen Verhaltens, sondern immer schon zugleich
eine ganz bestimmte Stellungnahme dazu"
Quelle: Bollnow, Otto-Friedrich
(1949) Das Verstehen. Drei Aufsätze zur Theorie der Geisteswissenschaften,
Mainz: Kirchheim.
G11-Gadamer2-S.57:
"5. Vom Zirkel der Verstehens (Verstzirkel)
1959 Die hermeneutische Regel, daß man das Ganze aus dem Einzelnen
und das Einzelne aus dem Ganzen verstehen (Verstzirkel)
müsse, stammt aus der antiken Rhetorik und ist durch die neuzeitliche
Hermeneutik von der Redekunst auf die Kunst des Verstehens
(Verstkunst)
übertragen worden. Es ist ein zirkelhaftes Verhältnis, das hier
wie dort vorliegt. Die Antizipation von Sinn, in der das Ganze gemeint
ist, kommt dadurch zu explizitem Verständnis, daß die Teile,
die sich vom Ganzen her bestimmen, ihrerseits auch dieses Ganze bestimmen.
Wir kennen das aus der Erlernung
von fremden Sprachen. Wir lernen da, daß wir einen Satz erst konstruieren«
müssen, bevor wir die einzelnen Teile des Satzes in ihrer sprachlichen
Bedeutung zu verstehen suchen. Dieser Vorgang des Konstruicrens ist aber
selber schon dirigiert von einer Sinnerwartung, die aus dem Zusammenhang
des Vorangegangenen stammt. Freilich muß sich diese Erwartung berichtigen
lassen, wenn der Text es fordert. Das bedeutet dann, daß die Erwartung
umgestimmt wird und daß sich der Text unter einer anderen Sinnerwartung
zur Einheit einer Meinung zusammenschließt. So läuft die Bewegung
des Verstehens (Verstzirkel)
stets vom Ganzen zum Teil und zurück zum Ganzen. Die Aufgabe ist,
in konzentrischen Kreisen die Einheit des verstandenen
(Verstzirkel) Sinnes zu erweitern.
Einstimmung aller Einzelheiten zum Ganzen ist das jeweilige Kriterium für
die Richtigkeit des Verstehens. Das Ausbleiben
solcher Einstimmung bedeutet Scheitern des Verstehens
(Verstnicht)."
Quelle Gadamer (1993) Hermeneutik
II., S. 57
- G12-BollnowS93ff: "Der hier auftretende
Begriff des Verstehens (Verstheorie)
ist durch das Verdienst von Dilthey und Heidegger in den Mittelpunkt einer
neuen, lebensphilosophischen Grundlegung der Erkenntnis gerückt wor-[>94]
den. Zunächst ging es Dilthey bei der Bemühung um eine methotdisch
selbständige Begründung der Geisteswissenschaften auf, daß
die hier vorliegende, vom Philologen und Historiker geübte Verfahrensweise
des Verstehens (Verstheorie)
(im einfachsten Falle: eines vorliegenden Textes) eine Erkenntnisweise
eigner Art darstellt, die sich nicht auf andre, bisher stärker beachtete
Erkenntnisformen (vor allem der Naturwissenschaften) zurückführen
läßt. Im Verlauf seiner philosophischen Entwicklung wurde er
dann aber immer stärker dahin gedrängt, zu erkennen, daß
es sich hier nicht um eine besondre Angelegenheit der Geisteswissenschaften
handelt — geisteswissenschaftliches „Verstehen"
(Verstheorie) als nebengeordnet dem
naturwissenschaftlichen „Erklären" etwa —, sondern um ein ursprüngliches,
allen späteren Differenzierungen vorausliegendes Phänomen des
menschlichen Lebens. Der Begriff des Verstehens
(Verstganzh), (Verstheorie)
ist dann nicht mehr auf den Bereich der „geistigen Welt" eingeschränkt,
sondern wird auf die Welt und das menschliche Leben als Ganzes ausgedehnt:
sofern der Mensch überhaupt lebt, versteht er, d. h. alles, was ihm
überhaupt in der Welt begegnet, wird von ihm von vornherein schon
im Horizont eines bestimmten Vorverständnisses
(Verslebvor) als dieses oder jenes,
d. h. immer schon in einer bestimmten Auslegung verstanden.")
Heidegger hat dann diese von Dilthey angelegte, aber im schrittweisen Fortschreiten seiner Arbeit nicht immer scharf durchgehaltene Wendung ausdrücklich herausgestellt. Ein solches Verstehen (Verslebvor) wird nicht erst im Verlauf des Lebens langsam erworben, sondern es bildet einen unablösbaren Wesenszug des menschlichen Daseins: Grade so ursprünglich, wie der Mensch in einer Welt lebt, versteht er auch schon immer diese Welt und was in ihr begegnet. Und alles übrige Erkennen gründet letztlich in diesem ursprünglichen Verstehen (Verslebvor) und baut in hinzukommender Leistung auf ihm auf. Dieses Lebensverständnis ist also nicht etwa eine besondre Form der Erkenntnis neben möglichen andern (etwa neben den Formen einer naturwissenschaftlichen Erkenntnis), son-[>95] dern es bildet die gemeinsame tragende Grundlage aller menschlichen Erkenntnisformen, hinter die nicht zurückgegangen werden kann, und von der her alle andern erst verstanden (Verslebvor) und begründet werden müssen.
Die beiden Leistungen des Erklärens und des Verstehens (Verstdif), (VerstgsozM), (Verstheorie) stehen sich also nicht koordiniert gegenüber, so daß man, wie es im ersten Ansatz hatte scheinen können, Natur- und Geisteswissenschaften als erklärende und verstehende (Verstdif), (VerstgsozM), (Verstheorie) Wissenschaften unterscheiden könnte, sondern in beiden Wissenschaftsgruppen gibt es, wenn auch mit verschiedenem Gewicht verteilt, verstehende (Verstdif), (VerstgsozM), (Verstheorie) und erklärende Leistungen. Immer aber ist das Verstehen (Verstdif), (VerstgsozM), (Verstheorie) die ursprünglichere und elementarere Leistung und erst in sie eingegliedert und auf ihr aufgebaut bildet sich dann das Erklären aus, doch können diese Verhältnisse im gegenwärtigen Rahmen nicht weiter verfolgt werden.
In diesem Lebensverständnis liegt aber jetzt auch die Möglichkeit enthalten, die in unsrer Frage weiterführt. Dilthey wie Heidegger wiesen darauf hin, daß dieses Verstehen(Verslebvor) des Lebens und der Welt stets eine Gemeinsamkeit der Verstehenden (Verstgemein) voraussetzt: Sofern der Mensch überhaupt in eine Welt hineingeboren ist und in dieser Welt verstehend (Verslebvor) sich zurechtfindet, findet er diese Welt als eine gemeinsame mit andern Menschen vor. Und darin ist zugleich enthalten, daß auch das Verstehen (Verstgemein) dieser Welt ein gemeinsames ist, das der Einzelne mit seiner Umgebung teilt. „Alles Verstandene" (Verstgemein), sagt Dilthey, „trägt gleichsam die Marke des Bekanntseins aus solcher Gemeinsamkeit an sich. Wir leben in dieser Atmosphäre, sie umgibt uns beständig", wir sind „eingetaucht" in dieses „Medium".") Alles Verstehen (Verslebvor) dessen, was dem Menschen in der Welt begegnet, ist also ein gemeinsames Verstehen (Verstgemein) und bedeutet daher zugleich ein Sichverstehen () der Menschen in ihrem Verhalten zu dieser gemeinsamen Welt. Oder anders gewendet: Der Träger dieses Verstehens (Verstgemein) ist ursprünglich nicht der einzelne Mensch, sondern es sind [>96] von vornherein Formen der Gemeinschaft, die durch dieses gemeinsame Verstehen (Verstgemein) aneinander gebunden sind.
Und wiederum hat Heidegger hier eingesetzt und das von Dilthey Gesehene in seiner grundsätzlichen Bedeutung scharf herausgestellt. „Die Welt des (menschlichen) Daseins ist Mitwelt" 15), so faßt er das Ergebnis prägnant zusammen, d. h. die Welt, die ich im täglichen Lebensverständnis verstehe (Verstgemein), ist nie meine besondre, sondern von vornherein und ursprünglich eine solche, die mich mit andern verbindet, und in der ich selbst nur einer dieser „andern" bin. Und in dem Verstehen (Verstgemein) ist von vornherein und ungeteilt ein doppeltes enthalten: ein Verstehen (VerstWelt) der Dinge, mit denen ich umgehe, und ein Verstehen (Verstmensch) der Menschen, mit denen ich mich in der gemeinsamen Arbeit in der Welt begegne. „Das In-Sein [des Menschen in der Welt] ist Mit-Sein mit anderen" 15). Das Verstehen (Verstgemein) also, so kann man zusammenfassen, ist dem Menschen von vornherein als ein gemeinsam verbindendes Medium gegeben.
Um ein weitverbreitetes Mißverständnis zurückzuweisen, sei hier ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der Begriff des Verstehens (Verstkönn), so wie er hier zugrunde gelegt wird, in dem ursprünglichen Sinn des Damit-umgehen-könnens, des Sich-auf-etwas-verstehens (Verstkönn) genommen ist, so wie man auch davon spricht, daß jemand ein Handwerk versteht (Verstkönn). Zwar gründet in diesem unmittelbar sachbezogenen Verstehen (Verstkönn) zugleich ein Sich-verstehen (Verstmensch) der Menschen untereinander, aber auch dieses erfolgt nur in dem gemeinsamen Hinblick auf die Sache, die man zusammen betreibt, und erhält von dieser Sache her seine Verbindlichkeit. Ein sogenanntes „psychologisches Verstehen" (Verstpsych), (Verstdif) überhaupt der Hinblick auf das „Innenleben" des andern Menschen kann sich von diesem Boden her erst in einer besondern charakteristischen Wendung erheben, darf aber in keiner Weise mit ihm gleichgesetzt werden. Daraus folgt, daß der hier vollzogene Rückgang auf das Verstehen (Verstdif) mit einem Psychologismus im Sinne auflösen-[97] der Unverbindlichkeit und konturloser Weichheit auch nicht das mindeste zu tun hat."
Quelle: Bollnow, Otto-Friedrich (1949) Das Verstehen. Drei Aufsätze zur Theorie der Geisteswissenschaften, Mainz: Kirchheim.
_
G13-Heidegger-PhilBegrBild-3
Die Problemlage der Philosophie
§ 1. Die Funktion einer »Theorie der philosophischen Begriffsbildung« in der Phänomenologie
Das Thema macht den Eindruck eines Spezialproblems und erscheint als
bewußtes Zugeständnis an die heute modemäßig vielbekämpfte
Spezialistik. Die nächstgegebene Auffassung läge noch in der
Meinung, es handle sich um spezifisch ästhetische Probleme, gar mit
besonderer Beziehung auf expressionistische Kunst. Das Herumrätseln
wäre auch nur scheinbar beruhigt, wenn ich versuchen wollte, gleich
zu Anfang der Reihe nach die Bedeutung der Worte »Phänomenologie«,
»Anschauung« und »Ausdruck« zu »erklären«.
Das würde zu gewissen Sätzen und Bestimmungen führen, die
nur täuschungsweise ein echtes Verstehen (Verstecht),
(Verstdif-), gewährleisteten. Allenfalls
könnte das Haftenbleiben an Worten noch begünstigt werden. Daß
es auf diese Weise in der Philosophie überhaupt nicht geht, soll ja
gerade in diesen Betrachtungen mitgezeigt werden. Es gibt aber doch Wege,
unter Absehen von festen Definitionen auf den Fragepunkt hinzuleiten. Das
in einer konkreten, die Prinzipienfragen der Philosophie mitbeachtenden
Weise durchzuführen, ist das vorläufige und alleinige Ziel der
folgenden Überlegungen."
Quelle: Heidegger, Martin (2007) § 1. Die Funktion
einer »Theorie der philosophischen Begriffsbildung« in der
Phänomenologie in (S.3) GESAMTAUSGABE II. ABTEILUNG: VORLESUNGEN 1919-1944
BAND 59 PHÄNOMENOLOGIE DER ANSCHAUUNG
UND DES AUSDRUCKS. Frankfurt aM: Klostermann.
- Kommentar. Heidegger führt hier die Differenzierung (Verstdif)
echtes Verstehen (Verstecht) ein, was
zweifellos sinvoll erscheint. Er erklärt allerdings nicht, was echtes
Verstehen vom unechten Verstehen unterscheidet.
G14-Heidegger-lebendig-PhilBegrBild-
G15-Heidegger-urpr-PhilBegrBild-
Gebrauchsbeispiele Psychologie, Psychopathologie, Psychotherapie,
- Wege zu uns - Menschen suchen sich selbst zu verstehen und anderen offener zu begegnen von Tausch, Reinhard; Tausch, Anne M
Grundlagen und Gebrauchsbeispiele bei William Stern
- aufgrund des Umfang ausgelagert.
Literatur (Auswahl) > siehe bitte auch Literatur zu: Einfühlung und Empathie, Kommunikation, Selbst, Biographie und Psychopathographie, Medien,
- Abel, Th. (1953) The Operation called »Verstehen«. In: H. Feigl/M. Brodbeck (1953, Hrsg.): Readings in the Philosophy of Science. New York Apel, K. (1955) Das Verstehen. Eine Problemgeschichte als Begriffsgeschichte, Arch. f. Begriffsgeschichte, 1.
- Albert, Hans (1972) Hrsg.) Theorie und Realität. Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre in den Sozialwissenschaften. 2. vA. Tübingen: Mohr (Siebeck)
- Albrecht, Jürg; Huber, Jörg; Imesch, Kornelia ; Karl Jost, Karl & Stoellger, Philipp (2005, Hrsg.) Kultur Nicht Verstehen
- Aschenbach, Günter (1984) Erklären und Verstehen in der Psychologie. Zur methodischen Grundlegung einer humanistischen Psychologie. Bad Honnef: Bock + Herchen.
- Bahr, Reiner (2002) Schweigende Kinder verstehen. Kommunikation und Bewältigung beim elektiven Mutismus. Heidelberg: Ed. S.
- Berger, Peter & Luckmann, Thomas (dt. 1969, engl. 1966). Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt: Fischer.
- Binswanger, Ludwig. (1926) Erfahren, Verstehen, Deuten in der Psychoanalyse, Imago, 12, 119 ff
- Binswanger, Ludwig. (1927) Verstehen und Erklären in der Psychologie. Heidelberg: Springer.
- Bodenheimer, Aron Ronald (1987) Verstehen heißt antworten. Eine Deutungslehre aus Erkenntnissen d. Psychotherapie. Frauenfeld: Im Waldgut.
- Bollnow, Otto-Friedrich (1949) Das Verstehen. Drei Aufsätze zur Theorie der Geisteswissenschaften, Mainz: Kirchheim. Darin:
- I. Was heißt, einen Schriftsteller besser verstehen, als er sich selber verstanden hat? (7-34)
- II. II. Ober das kritische Verstehen. (35-70)
- III. III. Zur Frage nach der Objektivität der Geisteswissenscbaften ... B. Die Gliederung des Verstehens (92-108)
- Brunner, Ewald Johannes (1981) Akzeptieren und Verstehen Zusatz zum Titel: ein Übungsbuch für Lehrer und Schüler. München: Kösel.
- Borsche, Tilman (1998) Blick und Bild im Spannungsfeld von Sehen, Metaphern und Verstehen. München: Fink.
- Broekman, Jan M. & Hofer, Gunter (1974) Die Wirklichkeit Des Unverständlichen. Professor Dr. Med. Hemmo Müller-Suur Zum 60. Geburtstag Gewidmet. Den Haag: Nijhoff.
- Bühl, Walter L. () Einleitung: Die alte und die neue Verstehende Soziologie
- Buijssen, Huub & Grambow, Eva (2003) Demenz und Alzheimer verstehen - mit Betroffenen leben. Ein praktischer Ratgeber. Weinheim [u.a.], Beltz.
- Cunningham, Frank (1972) Bemerkungen über das Verstehen in den Sozialwissenschaften. In (227-235) Albert, Hans (1972) Hrsg.)
- Devereux, George, Heinrichs, Hans-Jürgen (1982) Das Fremde verstehen. Gespräche über Alltag, Normalität und Anormalität. Frankfurt aM: [u.a.], Qumran.
- Dierstein, Jörg-Michael (1995) Erklären oder Verstehen? Zusatz zum Titel: zur Konstruktion einer psychologischen Handlungstheorie. Münster [u.a.]: Waxmann.
- Dittrich, Helmut (1988) Arbeitszeugnisse schreiben und verstehen. München: Humboldt-TB.
- Dilthey, Wilhelm (1894) Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie. Sitzungsberichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 7. Juni 1894, Ausgabe XXVI, Sitzung der philosophisch-historischen Classe. Ausgegeben am 31. Januar 1895. S. 10: "Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir."
- Dilthey, Wilhelm (1900) Die Entstehung der Hermeneutik. [GB] In: Edelstein, Wolfgang (1984) Soziale Interaktion und soziales Verstehen. Beiträge zur Entwicklung der Interaktionskompetenz. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Dilthey, Wilhelm (1900) Verstehen von anderen Personen und ihrer Lebensäußerungen. Ges. Sehr. VII, Stuttgart31958-1962, 203 ff
- Drescher, Karl Heinz (1997) Erinnern und Verstehen von Massenmedien Zusatz zum Titel: empirische Untersuchungen zur Text-Bild-Schere. Wien: WUV-Univ.-Verl.
- Ehrlich, W. (1939) Das Verstehen. Zürich 1939
- Eisler, Rudolf (1904) Wörterbuch der philosophischen Begriffe. [im Netz]
- Elsenhans, Th (1904) Die Aufgabe einer Psychologie der Deutung als Vorarbeit für die Geisteswissenschafcen. Gießen:
- Engelkamp, Johannes (1984, Hrsg). Psychologische Aspekte des Verstehens. Berlin: Springer.
- Erdmann, B. (1912) Erkennen und Verstehen. Berlin 1912 (Sitzber. d. kö nigl, preuß. Akad.)
- Erismann, Th. (1926) Verstehen und Erklären in der Psychologie. Arch, f. d. ges. Psychologie, 55,
- Esser, Hartmut (1991) Alltagshandeln und Verstehen. Zum Verhältnis von erklärender und verstehender Soziologie am Beispiel von Alfred Schütz und "rational choice". Tübingen: Mohr.
- Feynman, Richard P. (2002, eng. 1998) Die Ungewissheit in der Wissenschaft. In (11-41) Was soll das alles? München: Piper.
- Finkeldey, Lutz (2007) Verstehen. Soziologische Grundlagen zur Jugendberufshilfe. Wiesbaden: VS.
- Fricke, Susanne, Hand, Iver (2006) Zwangsstörungen verstehen und bewältigen. Hilfe zur Selbsthilfe. Bonn: Psychiatrie-Verl.
- Fritsch, Herbert, Klingshirn, Edmund (2003) Kinder verstehen. Hilfen zur Reflexion des pädagogischen und therapeutischen Alltags. Regensburg, KJF, Referat Öffentlichkeitsarbeit.
- Fritz, K. (2003) So verstehen wir uns. Die drei Persönlichkeitstypen in der Eltern-Kind-Beziehung. München: dtv .
- Gadamer, Hans-Georg (2010) Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr.
- Gadamer, Hans-Georg (1993) Hermeneutik II, Wahrheit und Methode. Ernänzungen. Register. Tübingen: Mohr.
- Geisler, Linus (1989) Arzt und Patient - Begegnung im Gespräch. Wirklichkeit und Wege. 2.A. Frankfurt: Pharma-Verlag.
- Gier, Renate (2004) Die Bildsprache der ersten Jahre verstehen. München: Kösel.
- Gebauer, Gunter (1973). Verstehen als Erklären aus Sprachregeln. In (335-343): Hübner, Kurt & Menne, Albert (1973, Hrsg-). Natur und Geschichte. X. Kongress für Philosophie. Kiel 8.-12. Oktober 1972. Hamburg: Meiner.
- Goffman, Erving (1991) Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. München: Piper.
- Goffman, Erving (1986) Interaktionsrituale. Über Verhalten in direkter Kommunikation. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Gomperz, H. (1929) Über Sinn und Sinngebildc, Verstehen und Erklären. Tübingen: Mohr.
- Graumann, H.M. (1976) Das Verstehen. Versuch einer historisch-kritischen Einleitung in die Phänomenologie des Verstehens. In: Balmer H (Hrsg) Psychologie des 20. Jahrhunderts, Bd. I. Kindler, Zürich, S 159–271 (Ersterschinung als Inauguraldissertation: München, 1924)
- Greulich, Walter; Harenberg, Michael & Blache, Claudia [Konzept] (1998/99) Lexikon der Physik. Heidelberg: Spektrum.
- Gruhle, Hans W. (1948) Verstehende Psychologie. Stuttgart: Thieme.
- Güdter, Bernd (1976) Verstehen üben. Bilder in Interaktion und Kommunikation. München: Verl. Dokumentation.
- Günther, H. R. (1934) Das Problem des Sich selbstverstehe ns. Berlin: Junker & Dünnhaupt.
- Haering, Th. L, (1963) Philosophie des Verstehens. Tübingen: Niemeyer 1963
- Hampel, H. J. (1933) Überdas Verstehen. Ein Beitrag zur systematischen und kritischen Behandlung des Problems. Diss (Ms). Berlin.
- Hayakawa, Samuel (1979) Durchbruch zur Kommunikation. Vom Sprechen, Zuhören u. Verstehen. Darmstadt: Verl. Darmstädter Blätter.
- Heilmann, Christa M. (2011) Körpersprache richtig verstehen und einsetzen. München [u.a.], Reinhardt.
- Heisenberg, Werner (1981; 1969) Der Begriff "Verstehen" in der modernen Physik. In (45-65) Der Teil und das Ganze. 5.A. München: Piper.
- Heisenberg, Werner (1942, 1989) Die Sprache. In (38-45) Ordnung der Wirklichkeit. München: Piper.
- Henneke, Martin (2012) Gadamers Kritik an Schleiermachers Hermeneutik. Studienarbeit. Grin.
- Heinrichs, Hans-Jürgen (1997) Das Fremde verstehen Zusatz zum Titel: Gespräche über Alltag, Normalität und Anormalität. Giessen, Psychosozial-Verl..
- Henrichs, N. (1968) Bibliographie der Hermeneutik. Düsseldorf: Philosophia Verlag.
- Hermann, E. (1959) Die Grundformen des Pädagogischen Verstehens. München: Barth. [GB]
- Hofmann, Paul (1929) Das Verstehen und seine Allgemeingültigkeit. Jahrbuch der Charakterologie 6. . Berlin: Pan Verlag K, Metzner
- Hofstätter, P. R. (1954) Die beiden Wissensbegriffe und die Psychologie. Jb, f. Psychol, u. Psychother., 2,
- Hollis, Martin (1991) Rationalität und soziales Verstehen. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Hubig, Christoph (1985) Handlung, Identität, Verstehen. Von der Handlungstheorie zur Geisteswissenschaft. Weinheim: [u.a.]: Beltz, [UB 04PA/CM 2200 H878]
- Hörmann, Hans (1976) Meinen und Verstehen Zusatz zum Titel: Grundzüge einer psychologischen Semantik. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Hoogers, Kinie (1993) Inkontinenz verstehen. München u.a.: Reinhardt.
- Jaeggi, Eva (1983) Andere verstehen. Ein Trainingskurs für psychosoziale Berufe. Weinheim [u.a.]: Beltz.
- Jaspers, Karl (1948) Allgemeine Psychopathologie. Berlin: Springer.
- Jourdain, Robert (dt. 2001, engl. 1997) Das wohltemperierte Gehirn. Wie Musik im Kopf entsteht und wirkt. Heidelberg: Akademischer Verlag Spektrum.
- Kafka, G. (1928) »Verstehende Psychologie« und Psychologie des Verstehens. Leipzig:
- Kambartel F (1991) Versuch über das Verstehen. In: McGuiness B, Habermas Apel JK-O et al (1991, Hrsg) Der Löwe spricht . . . und wir können ihn nicht verstehen“ Symposium an der Universität Frankfurt anlässlich des hundertsten Geburtstages von Ludwig Wittgenstein. Suhrkamp, Frankfurt am Main, S121–137
- Kamlah, W., Lorenzen, P. (1967). Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens. Mannheim: Bibliographisches Institut.
- Keller-Bauer, Friedrich (1984) Metaphorisches Verstehen. Eine linguistische Rekonstruktion metaphorischer Kommunikation. Tübingen: Niemeyer.
- Keller, W. (1937) Der Sinnbegriff als Kategorie der Geistes wissen schaften. i. Teil. München: Reinhardt.
- Kehrer, F. A. (1951) Das Verstehen und Begreifen in der Psychiatrie. Stuttgart: Thieme.
- Kempf, Eberhard; Jansen, Gabriele & Müller, Egon (2006, Hrsg.) Festschrift für Christian Richter II Verstehen und Widerstehen. Nomos.
- Kimstedt, Werner (1999) Das Verstehen. Ein Beitrag zur Bildungsdiskussion. Frankfurt aM: R. G. Fischer.
- Klein-Braley, Christine, Sparrow, Penelope J. (1983) Fachzeitschriften verstehen. Erlangen u.a.: FIM-Psychologie, Univ. u.a.
- Kuiper, P. C.: Verstehende Psychologie und Psychoanalyse. Psyche, 18, 1964, 15 ff
- Kübler-Ross, Elisabeth (1982) Verstehen, was Sterbende sagen wollen Zusatz zum Titel: Einführung in ihre symbolische Sprache. Stuttgart: Kreuz-Verl.
- Küng, Zita (2005) Was wird hier eigentlich gespielt? Strategien im professionellen Umfeld verstehen und entwickeln. Heidelberg: Springer.
- Kutschera, Franz von (1982) Verstehen. In (79-149) Grundfragen der Erkenntnistheorie. Berlin: de Gruyter.
- Laucken, Uwe (1976) Verstehen gegen Erklären. Nekrolog auf einen Gegensatz. Zeitschrift Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie VII/1, 113-118.
- Lafeber, Christien (1986) Psychotische Kinder Zusatz zum Titel: wie verstehen und behandeln wir sie? Bern: Haupt. [intern: gesichtet, keinen eigenen Abschnitt zum Thema des Untertitels "verstehen", das Buch hilft aber insgesamt beim Verstehen psychotischer Kinder]
- Landgrebe, L. (1951/52) Vom geisteswissenschaftlichen Verstehen. Zs. f. phüos. Forschung, 6,
- Lin-Huber, Margrith A. (2006) Chinesen verstehen lernen Zusatz zum Titel: wir - die Andern: erfolgreich kommunizieren. Bern: Huber.
- Mäder, Alexander Hendrik (2003) Falsche Überzeugungen verstehen. Begriffliche und methodische Überlegungen zur Erforschung der alltagspsychologischen Praxis. Dissertation Universität Bielefeld, Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie Abteilung Philosophie [PDF]
- Maldiney, Henri (2006) Verstehen. Wien: Turia + Kant.
- Martin, Albert & Drees, Volker (1999) Verstehen und Verständnis. In (165-167) Martin, Albert & Drees, Volker (1999) Vertrackte Beziehungen. Die versteckte Logik des sozialen Verhaltens. Darmstadt: WBG.
- Matschnig, Monika (2007) 30 Minuten für Körpersprache verstehen. Offenbach: GABAL.
- McGuire, Dennis, Chicoine, Brian (2008) Erwachsene mit Down-Syndrom verstehen, begleiten und fördern Zusatz zum Titel: Stärken erkennen, Herausforderungen meistern. Zirndorf: G-&-S-Verl.
- Meyer, E. (1954) Zur Neuorientierung im Bereich der verstehenden Psychologie. Psychol. Beiträge, 426-434
- Mezger, Edmund (1951) Das Verstehen als Grundlage der Zurechnung Vorgetragen am 12. Januar 1951. München: Verl. der Bayerischen Akad. der Wiss.
- Müller, Peter; Dierk, Heidrun & Müller-Friese, Anita (2005) Verstehen lernen. Ein Arbeitsbuch zur Hermeneutik. Stuttgart: calwer. [geht um Theologie]
- Müller-Freienfels, R. (1928) Zur Psychologie des Verstehens. Zs. f. angew. Psychol., 31, 410-470
- Ogden, C. K. & Richards, I. A. (1923) The Meaning of Meaning A STUDY OF THE INFLUENCE OF LANGUAGE UPON THOUGHT AND 0F THE SCIENCE OF SYMBOLISM. New York: Harcourt, Brace & World, Inc. Begründer des semiotischen Dreiecks p. 11:
- Olde, Valeska (2010) "ADHS" verstehen? Phänomenologische Perspektiven. Opladen [u.a.]: Budrich.
- Oslic, Josip (2017) Verstehen und nichtverstehen in der praxisbezogenen Hermeneutik Ludwig Wittgensteins. SYNTHESIS
- Patzig, Günter (1980) Erklären und Verstehen. Bemerkungen zum Verhältnis von Natur und Geisteswissenschaften. In: Tatsachen, Normen, Sätze. Stuttgart: Reclam. 45-75.
- Pauleikhoff, Bernhard () Eine Revision der Begriffe ,,Verstehen" und ,,Erklären". Archiv für Psychiatrie und Zeitschrift Neurologie, Bd. 189, 355-372.
- Pfänder, A. (1933) Die Seele des Menschen. Versuch einer verstehenden Psychologie. Halle a. S.: Niemeyer.
- Putnam, Hilary (1990) Die Bedeutung von "Bedeutung". Frankfurt aM: Klostermann.
- Putnam, Hilary (1991) Repräsentation und Realität. Frankfurt aM: Suhrkamp
- Rehbein, Boike (1997) Was heißt es, einen anderen Menschen zu verstehen? Stuttgart: M & P, Verl. für Wiss. und Forschung.
- Reik, Theodor (1935) Der überraschte Psychologe. Über Erraten und Verstehen unbewusster Vorgänge. Leiden, Sijthoff, 1935
- Renner, Erich (2003) Wie Kinder die Welt verstehen. Erziehung als Vertrauenssache. Wuppertal: Ed. Trickser im Hammer-Verl.
- Reusser, Kurt & Reusser-Weyneneth, Marianne (1994, Hrsg.) Verstehen. Psychologischer Prozeß und didaktische Aufgabe. Bern u.a.: Huber.
- Reusser, Kurt & Reusser-Weyneneth, Marianne (1994) Verstehen als psychologischer Prozess und als didaktische Aufgabe: Einführung und Überblick, In (9-35) Reusser & Reusser (1994, Hrsg).
- Riedl, Rupert (1985) Die Spaltung des Weltbildes- Biologische Grundlagen des Erklären und Verstehens. Berlin: Parey.
- Rüegger, Hans-Ulrich (2008) Verstehen statt Erklären? Zur Logik der Interpretation in den Geisteswissenschaften. Theologische Zeitschrift 64, 49–64.
- Ruff, Wilfried (2002) Religiöses Erleben verstehen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ruhe, Hans Georg (2009) Methoden der Biografiearbeit. Lebensspuren entdecken und verstehen. Weinheim: Juventa-Verl..
- Rumpf, Horst (1994). Das Verstehen und sein lebensweltliches Fundament. In (113-126) Reusser & Reusser (1994, Hrsg).
- Sachse, Rainer (2013) Persönlichkeitsstörungen verstehen. Zum Umgang mit schwierigen Klienten. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
- Schleiermacher, F.D.E. (2012) Vorlesungen zur Hermeneutik und Kritik. [1805-1833] Kritische Gesamtausgabe, II. Abt. Bd. 4. Berlin: De Gruyter.
- Schneider, K. (1921) Versuch über die Arten der Verständlichkeit. Zs, f, ä:. Neurol., 73,
- Schneider, Wolfgang Ludwig (1991) Objektives Verstehen. Rekonstruktion eines Paradigmas: Gadamer, Popper, Toulmin, Luhmann. Opladen: Westdt. Verl.
- Schottlander, F. (1957) Theorie des Verstehens.
- Schurz, Gerhard (1990, Hrsg.) Erklären und Verstehen in der Wissenschaft. München: Oldenbourg.
- Searle, John R. (dt. 1997, engl. 1995). Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Zur Ontologie sozialer Tatsachen. Reinbek: Rowohlt (rde).
- Seel, Martin (2004) Das Verstehen verstehen. Über den Sinn der Geisteswissenschaften. Die Zeit Nr. 18, 22.04.2004
- Seiffert, Helmut (1968) Information über die Information Zusatz zum Titel: Verständigung im Alltag, Nachrichtentechnik, wissenschaftliches Verstehen, Informationssoziologie, das Wissen des Gelehrten. München: Beck.
- Simmel, Georg (1918) Vom Wesen des historischen Verstehens, j. Heft der Vortragsfolge: Geschichte. Abende im Zentralinstitut f. Erziehung u. Unterricht. Berlin: Emst Siegfried Mittler & Sohn.Sinn, Helga (2012) Was heißt verstehen?: Eine Reise durch die Philosophie Ludwig Wittgensteins. Akademikerverlag
- Stegmüller, Wolf gang (1973) Der sogenannte Zirkel des Verstehens. In (21-46): Hübner, Kurt & Menne, Albert (1973, Hrsg-). Natur und Geschichte. X. Kongress für Philosophie. Kiel 8.-12. Oktober 1972. Hamburg: Meiner.
- Stein, Edith (1917) Zum Problem der Einfühlung. Diss. Halle a. S.: 1917 Beiträge zur philosophiscben Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften. In: Jahrb. f. Phil. u. phän. Forschung,
- Stern, William (1917) Die Psychologie und der Personalismus. Zeitschr. f.Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, Bd. 78, 1 und 2, 1-54.
- Spranger, Eduard (1918) Zur Theorie des Verstehens und zur geisteswissenschaftlichen Psychologie. In: Festschrift für Volkelt. München: C, H. Beck.
- Störring, H. (1928) Wider die verstehende Psychologie.
- Störring, H. (1926) Die Frage der geisteswissenschaftlichen oder verstehenden Psychologie. 1928
- Straus, Erwin (1956) Vom Sinn der Sinne. Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie. Berlin: Springer.
- Strube, Werner (1985) Analyse des Verstehensbegriffs. Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie XVI/2, 315-333.
- Tannen, Deborah () Du kannst mich einfach nicht verstehen. Warum Männer und Frauen aneinander vorbeireden
- Taylor, Clifton O. 1906. Über das Verstehen von Worten und Sätzen. Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane 40: 225-251. [Online]
- Toman, Walter (1944). Experimenteller Beitrag zum Verstehen. Dissertation. Universität Wien, Philosophische Fakultät.
- Toman, Walter (1947) Das Verstehen. Ein experimenteller Beitrag. Wiener Zft. Philos. Psychol. Päd., 1, p. 162-204.
- Wach, J. (1926-1933): Das Verstehen. Grundzüge einer Geschichte der hermeneutischen Theorie im 19. Jahrhundert. 3 Bde. Tübingen.
- I. Die großen Systeme (1926).
- II. Die theologische Hermeneutik von Schleiermacher bis Hofmann (1929).
- III. Das Verstehen in der Historik von Ranke bis Positivismus (1933).
- Wagenschein, Martin (1982) Verstehen lehren. Genetisch, sokratisch, exemplarisch. Weinheim: Beltz.
- Waismann, Friedrich (1976) Können, Wissen, Verstehen.- In (492-530) Logik, Philosophie, Sprache. Stuttgart: Reclam.
- Weber, Max (1913) Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie. Logos, 4. Tübingen: Mohr.
- Weidenmann, Bernd (1988) Psychische Prozesse beim Verstehen von Bildern. Bern [u.a.]: Huber.
- Weller, A. (1933) Verstehen, Begreifen, Erklären, Jb. f. Psych, u. Psychother., 1,
- Wendt, C. T. (1936) Grundzüge einer Verstehenspsychologischen Psychotherapie, Heidelberg 1936
- Wettler, Manfred (1980) Sprache, Gedächtnis, Verstehen. Berlin [u.a.]: de Gruyter.
- Windelband, (1894) Geschichte und Naturwissenschaft. Rede zum Antritt des Rektorats der Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg gehalten am 1. Mai 1894. Straßburg: Heitz, 3. Auflage 1904. [Online]
- Winch, Peter (1992) Versuchen zu verstehen Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Wolfersdorf, Manfred (2011) Depressionen verstehen und bewältigen. Heidelberg: Springer.
- Wright, Georg Hendrik von (1974) Erklären und Verstehen. Frankfurt aM: Athäneum.
- Wurmser, Léon (2005) Verstehen statt verurteilen. Gedanken zur Behandlung schwerer psychischer Störungen. Festvorträge anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde. Berlin: Humboldt-Univ.
- Youniss, James (1994) Soziale Konstruktion und psychische Entwicklung. Hrsg. von Lothar Krappmann u. Hans Oswald. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Ziegler, H. W. (1969) Zur Genese des Verstehens. Psychol. Beiträge, 11,
Produktives Nichtverstehen und Verstehen als Gestaltung. Interkulturelle Diskussion über das "Nicht Verstehen"
Ansätze zur Lösung eines Grundproblems moderner Gesellschaften. Wien: Springer.

PHILOSOPHICA 64 (2/2017) pp. (335–348)
Links (Auswahl) > Querverweise.
- Allgemeine und Integrative Symboltheorie
- Überblick Arbeiten zur Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung
- Über den Aufbau einer präzisen Wissenschaftssprache in Psychologie, Psychopathologie, Psychodiagnostik und Psychotherapie
- Die grundlegenden Probleme und Aporie jeglicher Einzelfall- und damit Therapieforschung. Grundzüge einer idiographischen Wissenschaftstheorie
- Überblick der Signaturen: Dokumentations- und Evaluationssystem Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
- Übersicht Wichtige Sozialpsychologische J Heilmittel
- Beziehung, Beziehungen, Beziehungstheorie, Taxonomie und Klassifikation der Beziehungen in der GIPT
- Welten und die Konstruktion unterschiedlicher Wirklichkeiten in der GIPT
- Spezielle Theorie und Praxis der Vergleichbarkeit und des Vergleichens von Psychotherapiesystemen. 13 GIPT-Kriterien und Fehlermöglichkeiten vergleichender Psychotherapieforschung
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Aehnlich, Ähnlichkeit.
Sachverhalte können mehr oder minder ähnlich sein. Haben sie nichts gemein, kann man sagen, die Ähnlichkeit betrage 0. Sind sie gleich, kann man die Ähnlichkeit mit 100% bewerten.
__
deuten (Interpretation)
Mehrdeutige Sachverhalte bedürfen der Deutung oder Interpretation. Damit geht eine Auswahl einher. Deutet jemand beim Bäcker auf ein Objekt von mehreren, die muss die Verkäuferin deuten, welche gemeint ist. Erblickt jemand in einer Wolkenformation einen Pferdekopf, so hat er eine Deutung vorgenommen. Sagt jemand, es gehe ihm nicht gut, so ist das einerseits für die meisten Menschen unmittelbar verständlich, aber der Adressat der Mitteilung kann im einzelnen mehrerlei Gründe deuten. Nachdem die meisten Worte und selbst Begriffe vielfältige Homonyme sind, muss auch in der Alltagskommunikation immer gedeutet werden, was gerade gemeint wird. Je unklarer Sachverhalte sind, desto mehr Deutungsmöglichkeiten gibt es in der Regel.
__
Hempel-Openheim-Schema
__
Hermeneutik Lehre oder Kunst der Ausleguzng.
__
Internetseite
Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren, geben wir nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia, DER SPIEGEL)
__
Interpretation > Deuten.
__
so erleben wir eine unmittelbare Evidenz
Wer ist "wir"? Wie begründet und belegt? Bei mir ist das nicht, wenn ich mir Nietzsches These vergegenwärtige.
__
Evidenz bei Jaspers
bleibt trotz vielfacher Verwendung ungeklärt, was kein guter wissenschaftlicher Stil ist und nicht zu dem vielgerühmten Jahrhundertwerk passr. Was Evidenz bedeutet ist im Verständnis Jaspers offenbar evident ;-)
Jürgen Mittelstraß (2005) leitet seinen Stichwortartikel wie folgt ein: "Evidenz (engl. evidence, franz. evidence), in erkenntnistheoretischen Zusammenhängen Bezeichnung für eine Einsicht ohne methodische Vermittlungen. In seiner lateinischen Form (evidentia) gibt der Ausdruck beiM. T. Cicero (synonym mit perspicuitas) den in der iStoa und im iEpikureismus terminologisch verwendeten Ausdruck ivapyc:ux (Klarheit, Deutlichkeit) wieder. Seine Bedeutung etwa im Sinne voraussetzungsloser Einsicht oder >anschauender >Gewißheit< (I. Kant, KrV B 762) ist in der philosophischen Tradition abhängig von vorausliegenden erkenntnistheoretischen Positionen und entsprechend uneinheitlich. Schwankender terminologischer Gebrauch drückt sich (1) in der Beurteilung der E. entweder als der subjektiven Form der Wahrheitsanerkennung (E. als >Sehen< eines Sachverhaltes) oder als der objektiven Form der Wahrheitsfindung (E. als >Sich-zeigen< eines Sachverhaltes), (2) in Zuordnungen wie >metaphysische<, >logische<, >psychologische<, >physische< und (erneut) >subjektive< bzw. >objektive< E. aus. Gegensatz (ebenso wie beim Begriff der ilntuition) ist in allen Fällen der Begriff der diskursiven bzw. begrifflichen, d. h. der methodisch (durch Beweis, Erklärung etc.) fortschreitenden, Einsicht (idiskursiv/Diskursivität). ... ..."
IP-GIPT-Charakterisierung: Evidenz bedeutet offensichtlich, klar, keiner weiteren Begründung oder Erklärung bedürftig oder auch fähig wie z.B. der Satz vom Widerspruch: ein Sachverhalt kann nicht zugleich bestehen und nicht bestehen. Das setzt
__
Krankeit der Geistes- und Sozialwissenschaften
Das ist das unbekümmerte Drauflosmeinen mit Abstrakten- und Allgemeinbegriffen, oft hypostase-homunculusartig, als ob die Begriffe handelnde Subjekte seien, ohne - operationale oder lebenspraxtische - Beispiele, ohne klare und strenge Protokolle der Bewusstseinstätigkeit, ohne sorgfältig dokumentierte Beobachtungen, ohne gründliche Belege und Beweise. Während die Mathematik den Beweis hat und die Naturwissenschaft das Experiment, hahen Philosophie und Geistwissenschaft nichts dergleichen, obglewich sie es viel nötiger hätten. Viele Lehrstühle sind seit Jahrhunderten falsch besetzt und nichts spricht dafür, dass es besser wird. Kein Wunder, dass es angesichts des extremen und unklaren Schwadronierens einer Hermeneutik bedarf, die ihrerseits wieder auszulegen ist usw. usf. Besser wäre, man würde klarer, prüf-, lehr- und lernbarer schreiben nach dem Vorbild der Mathematik und Naturwissenschaft.
__
Nus des Anaxagoras
Nach der Internetseite textlog: "... Was bedeutet dieser Nus? Schwerlich hat Anaxagoras unter demselben schon ein rein geistiges, persönliches Wesen, eine »von allem Stoffe schlechthin gesonderte, weltenbildende, nach Zwecken handelnde Intelligenz« (Schwegler S. 45) verstanden. ... ."
__
Primzahl und Papagei
Vergleichen lässt sich alles. Es sind zwei Arten (Klassen).
__
Wittgensteins Misstrauen, S. 653f: "Im Frühjahr 1936 veröffentlichte Waismann den Artikel »Über den Begriff der Identität« in Erkenntnis 6 (1936/37) S. 56-64, und von April bis Juni hielt er acht wöchentlich stattfindende Vorlesungen, die als »Einführung in das philosophische Denken« angekündigt waren. Diese Vorlesungen beruhten auf einer vorläufigen Fassung des Ersten Teils von Logik, Sprache, Philosophie (LSP). Dieser Artikel gab Wittgenstein jedoch Anlaß, sich darüber zu beklagen, daß Waismann sich seiner Ideen ohne hinreichenden Hinweis auf ihre Herkunft bedient habe. Waismann antwortete mit einem versöhnlichen Brief vom 27. Mai 1936, in dem er bemerkt, es sei weithin bekannt und auf jeden Fall deutlich, »daß die Grundidee dieser Untersuchungen von Ihnen und die Durchführung von mir stammt«. Eine ausdrückliche Bestätigung von Wittgensteins Verantwortung für die Gedanken dieses [>654] Artikels erschien im nächsten Heft der Erkenntnis (in: Erkenntnis 6, 1936/37). Trotzdem brach Wittgenstein die Verbindung zu Waismann ab, so daß dieser keinen privilegierten Zugang zu Wittgensteins (unveröffentlichten) Schriften mehr hatte noch weitere Diskussionen mit ihm führen konnte."
__
Standort: Verstehen.
*
* Kommunikationsregeln für Nahestehende * Kritik, ein wichtiges soziales Heilmittel *
Allgemeines und Integratives Psychologisch-Psychotherapeutisches Manifest.
Beispiele Lenkungsmittel im Leben, Kommunikation, Beratung, Training und Therapie.
Übersicht wichtige sozialpsychologische Heilmittel.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Kommunikation site: www.sgipt.org. * Therapiekonzept site: www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Verstehen. Mit einer Begriffsanalyse und Gebrauchsbeispielen und der Gretchenfrage: Wie kann man prüfen, ob man sich versteht? IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/kom/versteh.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen, die die Urheberschaft der IP-GIPT nicht jederzeit klar erkennen lassen, ist nicht gestattet. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Mail:_ sekretariat@sgipt.org_ Zwei wichtige Hinweise
korrigiert: irs 20.08.2018 und 21.08.2018
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
17.03.24 LitErg. Riedl
13.12.19 Eintrag Cunningham und zwei neue Kürzel: Verstew, VerstIdSV.
27.11.19 Das Verstehens Paradox - Exaktheit des Ungefähren.
25.11.19 Ergänzungen.
22.11.19 Physik ergänzt und gegliedert.
11.11.19 Verstehen der Quantenmechanik.
08.11.19 Ergänzungen: Verstehen in der Physik.
06.11.19 Verstehen in der Physik.
14.03.19 Verstdir Direkt, unmittelbar verstehen ohne weitere Interpretationsleistungen.
03.02.19 Möglichkeiten des Grundproblems zum Verstehens.
17.09.18 Nach Heidegger Verstecht.
31.08.18 Erg. zu Index Name.
30.08.18 Stegmüller.
27.08.18 Neue Bedeutungen (gemein, lebvor, mensch, psych, zirkel) G12 Bollnw zum Verstehensbegriff, Gadamer Hermeneutik I. und II., G11 Gadamer. G10 Bollnow, G09 (Dilthey), Eisler, G08, Entwicklungspsychologie EP2, Ergänzungen Verstehensbedeutungen.
26.08.18 Entwicklungspsychologie * Prüfmethoden.
24.08.18 Inhaltsverzeichnis, Gebrauchsbeispiele.
23.08.18 Ergänzungen: Gruhle, Jaspers, Wright.
21.08.18 Ergänzungen: Aristoteles, Watts, Wittgenstein.
20.08.18 Zum Geleit.
11.05.18 Wittgensteins Misstrauen.
10.05.18 Waismann.
19.11.16 Überarbeitet.
14.10.13 Änderung nicht dokumentiert.
15.09.13 Änderung nicht dokumentiert.
00.00.13 Irrtümlich, weil noch nicht abgeschlossen, 2013 ins Netz gelangt.