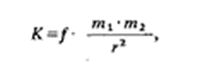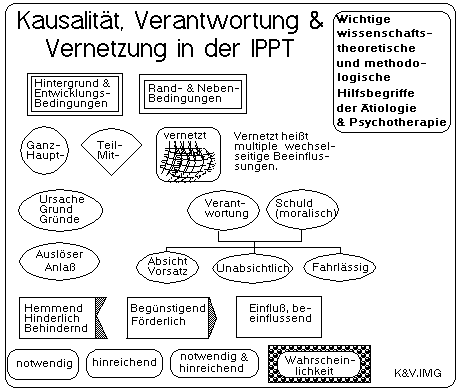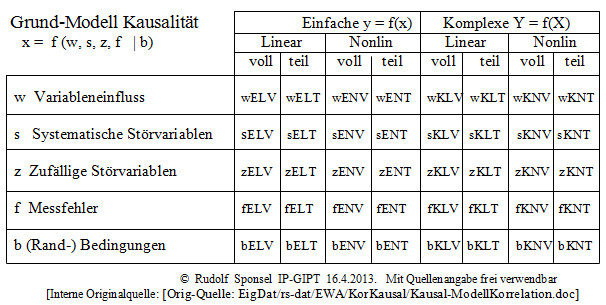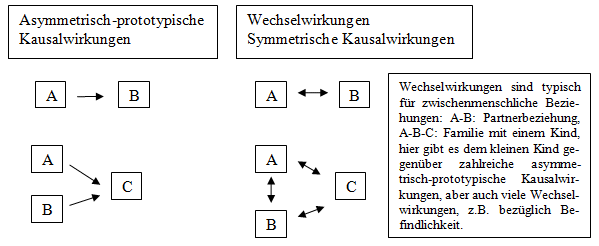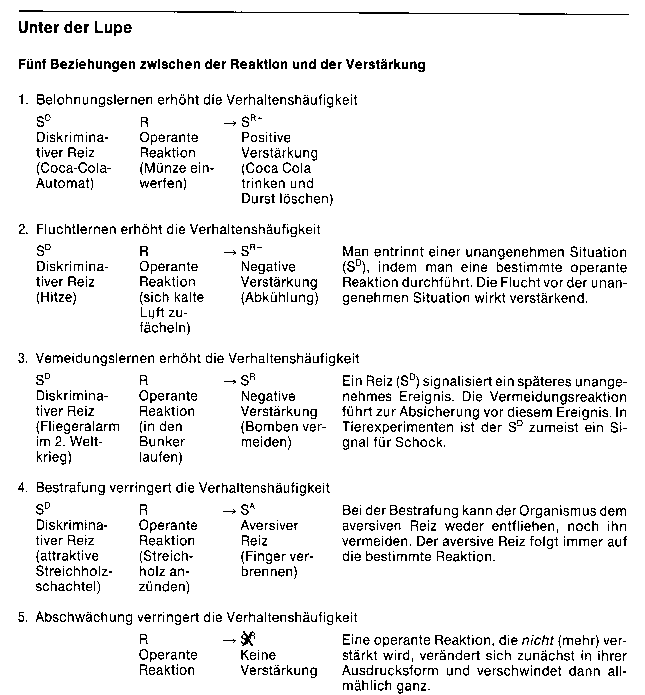Internet Publikation für
Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT
(ISSN 1430-6972)
DAS=08.05.2018 Internet-Erstausgabe,
letzte Änderung: 30.12.23
Impressum:
Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf
Sponsel_
Stubenlohstr.
20 _D-91052
Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_
Zitierung
& Copyright
Anfang_Kausalität
Einführung & Verteilerseite_Datenschutz_
Überblick_Rel.
Aktuelles _Rel.
Beständiges_ Titelblatt_
Konzept_Archiv_
Region__
Service-iec-verlag_
_Wichtige
Hinweise zu Links und Empfehlungen_
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine
und Integrative Psychotherapie, Abteilung Abstrakte Grundbegriffe aus den
Wissenschaften (Analogien, Modelle und Metaphern für die Psychologie
und Psychotherapie sowie Grundkategorien zur Denk- und Entwicklungspsychologie),
und hier speziell zum Thema:
Einführung und Verteilerseite:
Kausal und Kausalität, Ursache
und Wirkung, Grund und Folge
allgemein, in Wissenschaft und
Leben und besonders im Bio-Psycho-Sozialen und im Recht
- 10 Unterscheidungen -
Originalarbeit von Rudolf
Sponsel, Erlangen
Querverweise
zum Definitionsproblem * Was
ist Fragen *
Inhaltsverzeichnis
Einführung.
Die Sachverhalte zur Kausalität
im Allgemeinen und besonders im Bio-Psycho-Sozialen.
Materialien (externe Seiten)
Psychologie der Kausalitätsattribution.
Einfache Kausalitätsversuche im Alltagsleben.
Allgemeine und integrative
Kausalitätstheorie im Psychologischen.
Literatur * Glossar,
Anmerkungen, Endnoten * Querverweise *
Zitierung
* Änderungen.
Einfuehrung
Kausalitaetsfragen spielen in Wissenschaft,
Recht und Leben eine überragende Rolle. Was steckt dahinter, wodurch
kommt etwas zustande, was hat dieses und jenes für Wirkungen? Musste
das so eintreten oder hätte es auch anders kommen können? Das
sind klassische Fragen, die sich uns allen tagtäglich auf vielen Ebenen
und in vielen Lebensbereichen stellen, z.B.: Warum verliebt man sich? Wieso
endet eine Liebe? Wie kann ich mich verändern? Wieso kann man
sich überhaupt verändern? Sind dann nicht zwei Wesen angenommen:
der Veränderer und der Veränderte? Bin ich zwei, Subjekt und
Objekt, womöglich auch noch zugleich? Oder spielt uns die Sprache
einen Streich, wovor Wittgenstein
ja immer wieder so eindringlich gewarnt hat. Warum tut man dies und das
und lässt dies oder das (nicht)?
Leider sind viele PsychologInnen und MedizinerInnen
auf die Signifikanzstatistik
fixiert, die für inhaltliche Erkenntnisse weitgehend bedeutungslos
ist und lediglich eine Inflation nichtssagender Forschungsergebnisse hervorbringt,
die niemand so recht gebrauchen kann und womit sich in der Praxis so gut
wie nichts anfangen lässt. Eine mutige und erfreuliche Ausnahme bildeten
einige Soziologen, die sich sogar trauten, 3 Bde. zum Thema Korrelation
und Kausalität 1976 herauszugeben. In Anerkennung dieser Leistung
gegen den statistischen Zeitgeist, habe ich 20 Korrelationsmatrizen aus
diesem Werk hier auf Fast-Kollinearität analysiert. Hierbei wurden
auch hilfsweise multiple und kanonische Korrelationsanalysen herangezogen.
In der Hauptsache sollte diese Darstellung die Ergebnisse meiner Erkenntnisse
(1984, 1994,
1995,
2002,
2005)
und 2013 mit der Anwendung auf das Thema Korrelation
und Kausalität zu einem vorläufigen Abschluss bringen. Das letzte
Kapitel zur Korrelation wird der Entwicklung eines Modells zur Konstruktion
der relevanten
Merkmalsräume - mit denen ich mich auch schon seit 30 Jahren
immer wieder beschäftige - gewidmet sein.
Warnung Günter Posch
schreibt 1981 in Kausalität. Neue Texte in seiner Einleitung
Zur Problemlage beim Kausalitätsproblem: "Gäbe es auf die
einfache Frage »Was ist Kausalität?« eine einfache Antwort,
dann könnte man viel Mühe und Schweiß sparen. Es gibt jedoch
keine einfache Frage nach der Kausalität und ebensowenig eine einfache
Antwort. Daß dies so ist, liegt daran, daß »ein und dieselbe«
Frage im Rahmen verschiedener Begriffssysteme gestellt werden kann und
daß dann die Antworten entsprechend ausfallen.
Wenn man versucht, mit alltagssprachlichen, untechnischen Mitteln das
(oder ein) Kausalitätsproblem zu formulieren, kann man das Pech haben,
sich in eine solche Vielzahl von Problemen zu verstricken, daß man
nicht mehr angeben kann, worin das (oder dieses) Kausalitätsproblem
eigentlich bestehe. Wenn man andererseits von vornherein mit formal-technischen
Mitteln »das Problem« lösen will, übersieht man leicht
die Vielzahl von Aspekten, die es beim Kausalitätsproblem gibt, und
begnügt sich möglicherweise mit einer einfältigen Lösung."
Wir sind also vorgewarnt. Als erstes sollten wir
so gut es geht begriffliche Klarheit anstreben.
10 Unterscheidungen zum
Kausalitätsbegriff Die ersten drei Kausalitätsfragen betreffen
die Wissenschaftstheorie und die anderen speziell die Psychologie: (1)
allgemeine Kausalität zwischen zwei Sachverhalten; (2) allgemeines
Kausalgesetz zwischen Sachverhalten; (3) allgemeines Kausalprinzip für
alle Sachverhalte; (4) spezielle Kausalität zwischen Bewusstseinselementen,
(5) spezielle Kausalität zwischen Bewusstseinselementen und Handlungen
bzw. Verhalten; (6) spezielle Kausalität eigener Handlungen oder Verhalten
in Bezug auf andere oder die Welt; (7) Die Kausalität zwischen biologischen
Vorgaengen (natcode(bioi)) und (natcode(bioj)). (8)
Die Kausalität zwischen biologischen Vorgaengen (natcode(bio)) und
dem Erleben dieser Vorgänge (natcode(erleben(natcode(bio)))); (9)
Kausalitaet zwischen nichtbewussten Vorgaengen, Erleben und Verhalten;
(10) Kausalität zwischen nichtbewussten und bewussten Vorgängen,
Erleben und Verhalten.
Sehr wichtig und hilfreich ist zudem, zwischen Auslöser,
Anlass, Bedingungen, Grund (Ursache), Wirkung zu unterscheiden (>Ursachenproblem).
ZurEntstehung dieser
Arbeit: In der IP-GIPT ist das Kausalitätsproblem in mehreren
Ausarbeitungen verstreut behandelt. Diese Seite führt diese Ausführungen
zusammen und behandelt das Kausalitätsproblem nunmehr auf einer zentralen
Seite, wobei wir, entsprechend allgemeiner und integrativer Tradition (>
Beweisen
in Wissenschaft und Leben) über den Tellerrand hinausblicken zu
den anderen Wissenschaften und der Physik, die unser Vorbild sind. Schwerpunkt
ist die Kausalität im Bio-Psycho-Sozialen. Grundannahme ist, dass
sämtliche psychischen Erscheinungen naturwissenschaftlich (physikalisch,
chemisch, biologisch) fundiert sind. Dies findet seinen Ausdruck in dem
Kunstbegriff natcode für naturwissenschaftliche
Codierung. (natcode(Angst)) bedeutet die naturwissenschaftliche Codierung
der Angst. (natcode(Wunsch)) bedeutet die naturwissenschaftliche Codierung
eines Wunsches. (natcode(erleben)) bedeutet die naturwissenschaftliche
Codierung des Erlebens. Allgemein bedeutet (natcode(bio)) die Codierung
des biologischen Prozesses. Alles Erleben wird also in folgender Grundformel
gedacht (natcode(erleben(natcode(bio)))), z.B. (natcode(Erleben Hunger(natcode(Hunger)))),
d.h. der biologische Vorgang Hunger wird dem Erleben des Hungers zugänglich
gemacht.
Wissenschaftstheoretische Begriffsanalyse
der Kausalbeziehung
Man kann Kausalität nicht direkt wahrnehmen. Kausalität,
Ursache und Wirkung, Grund und Folge, sind metasprachliche erkenntnistheoretische
Konstruktionen 1. Stufe. Beobachten wir zwei aufeinanderfolgende Ereignisse
E1 und E2 in der Welt, etwa Blitz und Donner, ein fallendes Glas und Scherben,
Harndrang und das Aufsuchen der Toilette, Verspüren von Appetit und
essen, urteilen wir meist, dass E2 eine Wirkung oder eine Folge von
E1 ist. Die Kausalbeziehung ist damit ein metasprachlicher Ausdruck, hier
der ersten Stufe, was wir durch einen Index beim kausalen Beziehungsbegriff
weil
kenntlich machen: E2 weil1 E1. Nun kann
man darüber diskutieren, ob die behauptete Kausalbeziehung z.B. als
wahr oder plausibel betrachtet wird. Dann wird eine Kausalbeziehung (Metasprache
1. Stufe) beurteilt. Wahr2 oder plausibel2 gehören
hier damit dem Metasprache 2. Stufe an.
Die
Sachverhalte zur Kausalitaet im Allgemeinen und besonders im Psychischen
Worte für Kausalitätsvorgänge
Worte und Begriffsraum Kausalitaet im Allgemeinen
Ursache, Wirkung, Grund, Folge, Zusammenhang, (mit-) hervorrufen, (mit-)
verursachen, (mit-) bewirken, (mit-) beeinflussen, herbeiführen, veranlassen,
Bedingungen, Auslöser, Anlass, Katalysator. Erklären
und Verstehen.
Worte und Begriffsraum Kausalitaet im Psychosozialen
Psychologische Ursachenkonstrukte (alphabetisch): Absicht, Antrieb,
Bedürfnis, Begehren, Beweggrund, Entscheidung, Entschluss, Motiv,
Strebung, Wille, Wunsch, Ziel.
Psychologische Wirkungskonstrukte: Handlung, Verhalten, Tun und Lassen.
Zusammenhangskonstrukte: Erklären
und Verstehen.
Erklaeren
und verstehen [Quelle]
Verstehen
ist wie die meisten Worte ein vielfältiges
Homonym
und hat mehrere Grundbedeutungen:
1) kommunikativ: Worte und
Aussagen sprachlich verstehen;
2) verstehen der Bedeutung
der Aussage: geistig nachvollziehen, begreifen;
3) emotionales verstehen:
einfühlen, nacherleben können;
4) verstehen eines Zusammenhanges.
5) billigen, gut heißen.
6) 6a) verstehen als geistes-
und sozialwissenschaftliche Methode
6b)
im Unterschied zum naturwissenschaftlichen erklären.
Erklaeren
hat ebenfalls unterschiedliche Bedeutungen:
1) Einen Zusammenhang erklären:
was hängt wie mit wem zusammen?
2) Gründe G für
einen Sachverhalt S angeben: S wird durch G erklärt.
3) Ursachen U für einen
Sachverhalt S angeben: S wird durch U erklärt.
Anmerkung:
Gründe und Ursachen bedeuten im sachlichen, logischen Kern das Gleiche.
Im sozial- und geisteswissenschaftlichen Bereich bevorzugt man den Ausdruck
"Gründe", im Naturwissenschaftlichen Bereich den Ausdruck Ursache.
Von Windelband (1894) wurde
der wenig hilfreiche und scheinbare Gegensatz zwischen der nomothetischen,
Gesetze und Regeln suchenden, und der idiographischen, den konkreten Einzelfall
verstehenden, Wissenschaft geschaffen. Dilthey (1900) stiftete den scheinbaren
Gegensatz zwischen naturwissenschaftlichem Erklären und geisteswissenschaftlichem
Verstehen.
In der Psychologie, Psychopathologie
und Psychotherapie haben wir es in der Praxis immer mit dem Einzelfall
oder einem individuellen Einzelfall-System (z.B. Familie) zu tun. Gesetzesartiges
oder Regelhaftes gibt es aber nicht nur im Längsschnitt, in Entwicklung
und Verlauf, sondern auch im momentanen Einzelfall. Einen prinzipiellen
Gegensatz zwischen erklären und verstehen vermag ich nicht zu erkennen.
Wenn jemand einen Pullover anzieht, weil ihm zu kalt ist, so können
wir sinnvoll und verständlich sagen, wir erklären das
Pullover anziehen mit unangenehm erlebtem Kälteempfinden, das den
Grund liefert. Sagen wir, wir verstehen, dass er einen Pullover
anzieht, weil ihm kalt ist, schwingt hier mit, dass wir uns einfühlen
können, dass wir selbst Ähnliches schon erlebt haben. Diese Bedeutung
hat sich seit Windelband und Dilthey in den Geisteswissenschaften - und
seit Jaspers
(1913) in der Psychopathologie - eingebürgert, so mag man sie denn
so belassen; hier aber mit der Erweiterung, dass in den Sozial- und Geisteswissenschaften
erklären und Erklärung sowohl erwünscht als auch möglich
und zulässig sind. Die meisten dürften nicht verstehen, wie jemand
auf Befehl von Stimmen einen Angehörigen umbringt, weil die allermeisten
das selbst noch nie erlebt haben, aber dieser Sachverhalt taugt durchaus
als Erklärung für einen Mord durch einen schizophrenen Schub.
Ich werde in meinen forensischen Arbeiten diesen künstlichen und falschen
Gegensatz nicht übernehmen und nicht weiter pflegen. Den Grundfragen
des Verstehens gehe
ich in einer anderen Arbeit nach.
Das Thema erklären und
verstehen spielt auch in der Psychiatrie eine historische Rolle (Jaspers,
Kehrer, Gruhle, Straus). Besonders aber in der forensischen Psychiatrie
(> Beweisfragen-Fehler),
wenn es z.B. darum geht, festzustellen, inwieweit die psychopathologischen
Entsprechungen ("Voraussetzungen") für Einsichts-§
und Steuerungsfähigkeit§, Schuldfähigkeit§,
Gefährlichkeit§ oder Wiederholungsrisiko§
vorliegen. [teilweise aus der Quelle
2.1.4] oder nicht bzw. mangels Informationen oder Daten nicht feststellbar
sind.
Die drei allgemeinen Kausalitaetsbegriffe:
Kausalbeziehung, Kausalgesetz, Kausalprinzip
| Man sollte drei Begriffe streng auseinanderhalten: (1
Kausalität (Beziehung Ursache - Wirkung) allgemein und in den
zahlreichen Einzelfällen (U verursacht=bewirkt W), (2) Kausalitätsgesetz
(U bewirkt unter Normalbedingungen immer W) und Kausalprinzip
(Alles hat eine Ursache, nichts geschieht ohne Grund), das der Wissenschaftsideologie
des Determinismus zugrunde liegt und den Charakter eines Postulats oder
Axioms hat. Diese Arbeit beschäftigt sich auf Basis eines kritischen
erkenntnistheoretischen Realismus im Sinne Galileis und Konzeptualismus
in erster Linie mit der Kausalität und nicht oder nur sehr am Rande
mit dem Kausalitätsprinzip. |
Bedingungen, Normalbedingungen, Makro-
und Mikroperspektive, Auswahl
Besondere Bedeutung kommt der Idee der Normalbedingungen mit definierten
Standards zu, denn viele Kausalitäten gelten "nur" unter gewissen
Bedingungen und nichts ist selbstverständlich (> Normtag).
Eine wichtige methodische Rolle spielt auch die Betrachtungsebene: die
Makro-
und Mikroperspektive. Aber auch die Auswahl der Variablen
können von erheblichem Einfluss auf die Kausalität sein, weil
mit der Auswahl potentielle andere Faktoren ausgeklammert werden. Wenn
wir forschen, dann betrachten wir nahezu immer eine Teilwirklichkeit der
mutmaßlichen Ursache(n) im Hinblick auf eine andere Teilwirklichkeit
der mutmaßlichen Wirkungen. Wir variieren die Bedingungen und Ausprägungen,
um die Zusammenhänge herauszufinden.
10 Unterscheidungen
zum Kausalitätsproblem im Bio-Psycho-Sozialen
(1) Allgemeines Grundmodell
der Kausalität
Das Grundmodell ist einfach formuliert: In der Umgebung
U bewirkt unter den Bedingungen B ein Sachverhalt SU einen
Sachverhalt SW. Verkürzt: ein Sachverhalt SU
bewirkt einen Sachverhalt SW . Diesem Grundmodell entsprechen
viele Alltagserfahrungen der meisten Menschen. So haben auch die meisten
Menschen kaum Probleme mit Kausalitätszuweisungen. Dass die Sachen
vielfach nicht so einfach sind, zeigt sich spätestens bei Rechtsstreitigkeiten
(> Kausalität im Recht), wenn es z.B. um
Verantwortlichkeiten für Schäden geht.
Viele Sachverhalte SU bewirken einen Sachverhalt
SW ohne, dass das immer so wäre oder so sein müsste.
Dann liegt eine einfache kausale Beziehung vor, ohne dass man auf ein Kausalgesetz
oder das Kausalprinzip zurückgreifen
muss.
Elementarer denkpsychologischer Versuch: VV2
Verstehens-Versuch 2 Ursache und Wirkung, Kausalität verstehen.
Beispiele (1): (1.1) Ich winke und das
Auto hält. Im Einzelfall liegt hier eine kausale Beziehung vor, aber
das ist sicher kein Kausalgesetz, denn so und so oft wird das Auto nicht
halten, wenn ich winke. (1.2) Ich frage, wo es zum Rathaus geht und der
Befragte sagt mir den Weg. Die Antwort zeigt eine kausale Beziehung, aber
nicht immer werde ich eine Antwort erhalten. (1.3) Ich grüße
jemand und der grüßt zurück. Das wird nicht immer der Fall
sein, deshalb dürfte es sich nur um eine kausale Beziehung, aber um
kein Kausalgesetz handeln. (1.4) Ich betätige den Anlasser und das
Auto springt sofort an, aber nicht immer. (1.5) Beim Öffnen
des Fensters wirft der Wind die Vase um, was aber nicht immer der Fall
ist.
Anmerkung: Das Kausalitätsprinzip
postuliert, dass
jedes Geschehen dieser Welt seine Ursachen
und Wirkungen hat. |
(2) Allgemeines Grundmodell des Kausalitaetsgesetzes
Das Grundmodell ist einfach formuliert: In der Umgebung
U bewirkt unter den Bedingungen B ein Sachverhalt SU immer
einen Sachverhalt SW. Verkürzt: ein Sachverhalt SU
bewirkt immer einen Sachverhalt SW . Das immer
macht
das Kausalgesetz .
Anmerkung: Das Kausalitätsprinzip
postuliert, dass
jedes Geschehen dieser Welt seine Ursachen
und Wirkungen hat.
Beispiele für Kausalgesetze nach
Stegmüller (1979), S. 90f: "Beispiele für qualitative Gesetzeshypothesen
sind etwa: »Eisen dehnt sich bei Erwärmung aus«; »Reibung
erzeugt Hitze«; »Kupfer leitet Elektrizität«:; »Kork
schwimmt auf dem Wasser«; »Lungenkrebs wird durch übermäßiges
Rauchen verursacht«; »Wirtschaftskrisen entstehen durch Fehlleitung
von Geldkapital«; »Röntgenstrahlen durchdringen nicht
dicke Bleiplatten«; »Wasserstoff und Chlor ergeben zusammen
Salzsäure«; »Alle Protonen haben dieselbe positive Ladung«;
»Alle Elektronen haben dieselbe Masse«. Die Verwendung komparativer
oder topologischer Begriffe ermöglicht nicht nur singuläre Vergleichsfeststellungen
(»Gegenstand a ist wärmer als Gegenstand b«),
sondern gestattet häufig auch eine Verschärfung qualitativer
Gesetze zu komparativen Gesetzmäßigkeiten: »Je stärker
die Reibung, desto größer die erzeugte Hitze«; »je
größer der Abstand zwischen zwei Massen, desto geringer ihre
wechselseitige Anziehung«. In vielen modernen Wissenschaften, insbesondere
in der Physik, werden die meisten, in der Physik sogar alle,
Eigenschaften durch metrische Begriffe charakterisiert, also etwa durch
Begriffe wie den der Temperatur, des Volumens, der Längen der Zeitdauer,
der Geschwindigkeit, der Beschleunigung, der elektrischen Ladung usw. Solche
quantitativen Begriffe gestatten nicht nur viel präzisere Beschreibungen
als qualitative und komparative, sondern sie ermöglichen auch für
die formulierten Gesetze ein Höchstmaß an erzielbarer Genauigkeit,
So etwa lautet, um hierfür ein Beispiel zu geben, das allgemeine Newtonsche
Gravitationsgesetz:
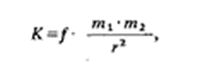
wobei m1 und m2 die Massen zweier Massenpunkte,
r deren Abstand voneinander, f eine Konstante und K die Größe
der wechselseitigen Anziehungskraft darstellt. Da quantitative Begriffe
als mathematische Funktionen einzuführen sind, werden in quantitativen
Gesetzen funktionelle Relationen zwischen derartigen Größen
ausgedrückt."
Die Kausalität zwischen Gegenstaenden
und ihren Bezeichnungen am Beispiel blau
Welche Kausalität besteht zwischen der Zuordnung des Begriffes
blau mit dem Wort "blau" zu blauen Gegenständen? Sofern die Zuordner
nicht blind, farbenblind oder farbenfehlsichtig und korrekt auskunftswillig
sind, sollte die Zuordnungsbeziehung als Kausalgesetz aufgefasst werden
dürfen, weil die Zuordnung fast immer "blau" sein wird.
"Blau" gibt es in der Natur nicht. Die Farben in der Welt entstehen
durch Reflektion der Wellenlängen von Licht gegenüber einem Aufnahmesystem.
Durch den Menschen, sein Sinnesorgan Auge und das verarbeitende visuelle
System wird Licht der Wellenlänge - nach HUG Technik Tabellen - mit
450-482 nm für die Farbempfindung blau ausgewiesen. Dieses Kausalgesetz
gilt nicht allgemein, sondern es ist an die spezifische Verfasstheit des
Menschen und ähnlich funktionierende Systeme gebunden, wenn Licht
auf Körper trifft und reflektiert wird.
Verallgemeinerung: Die Kausalität
zwischen einem Objekt und seiner Bezeichnung
Hat ein Objekt einen allseits bekannten Namen, der von allen gebraucht
wird, so kann man zwischen diesem Objekt und seinem Namen unter Normalbedingungen
(z.B. keine Aphasie) eine kausalgesetzliche Beziehung annehmen. Schaut
man z.B. in den Obstkorb und sieht dort eine Banane, dann wird man unter
Normalbedingungen
(z.B. keine Aphasie) für das Objekt "Banane" immer das Wort "Banane"
benutzen. |
(3) Allgemeines Grundmodell des Kausalprinzips
Jede Wirkung hat eine Ursache oder alles,
ausnahmslos alles, was geschieht, hat eine Ursache. Daraus ergibt sich
keineswegs zwingend der Determinismus, wonach alles, was geschieht, vorherbestimmt
ist. Setzt man voraus, dass alles Geschehen immer den gleichen Kausalgesetzen
unterliegt, kann der Determinismus gefolgert werden.
Anmerkung: Man beachte den Unterschied zum Begriff der Kausalität
und zum Kausalgesetz. |
Exkurs natcode: Formale Darstellung Erleben
und seine biologische Fundierung / Codierung.
Die allgemeine Codierungsvariable heißt allgemein
natcode
(naturwissenschaftliche Codierung). Es gilt - einstweilen per Axiom: -
es gibt kein Erleben ohne biologische Fundierung bzw. Codierung. Jeder
Gedanke, jede Erinnerung, jedes Gefühl, jeder Wunsch, jede Regung
im Erleben hat eine biologische Fundierung/ Codierung. Aber es gibt - wahrscheinlich
sehr, sehr viele biologische Vorgänge ohne eine Codierung für
das Erleben. So dürfte z.B. die einzelne Natrium-Kalium-Pumpe am synaptischen
Spalt dem Erleben nicht zugänglich sein. Für die biologische
Codierung des Erlebens nehmen wir das Kürzel nce (natcode erleben)
und für die Codierung des dem Erleben zugrundeligenden biologischen
Vorgangs ncb (natcode biologischer Vorgang). Ich verwende die Formen ncb
für biologische Vorgänge ohne Erleben und nce(ncb) für biologische
Vorgänge, die auch erlebt werden. Die Form nce alleine ist unvollständig
und unzulässig, weil es per Axiom kein Erleben ohne biologische Fundierung
und Codierung gibt.
Bezieht man auch Handlungen (h := hd) mit ein -
siehe bitte (5) - so können wir noch nch für natcode(handeln)
berücksichtigen, wobei auch hier gilt, dass jedes handeln eine biologische
Basis braucht. Es gibt also kein natcode(handeln: ...) oder nch alleine,
sondern nur zusammen mit seiner biologischen Basis nch(bio: h). Wird das
Handeln erlebt, lautet der Formalismus nce(nch(bio: h)), in Worten: Ich
erlebe mein handeln ... aufgrund der biologischen Basis .... |
(4) Allgemeines Grundmodell der Kausalität
im Psychischen zwischen Bewusstseinssachverhalten derselben Person nce(ncb(S1))
=> nce(ncb(S2)).
In der psychischen Umgebung Upsy bewirkt
unter den Bedingungen B ein Bewusstseinssachverhalt S1|natcode1 einen
Bewusstseinssachverhalt S2|natcode2. , z.B. vorstellen eines
S1= Ertrinkungserlebnis und S2= Aktivierung von Angst.
nce(ncb(S1))
=> nce(ncb(S2)).
Anderes Beispiel Erleben: Eine Erinnerung an ein peinliches Erlebnis
ruft in der Regel ein leichtes Schamgefühl und Unbehagen hervor. nce(Erleben:
Scham, Unbehagen(ncb: Biologischer Vorgang: Scham, Unbehagen))
Anmerkung: Der Eintrag bei Edelmann (2000)
nennt zwar potentielle Faktoren für eine Kausalbeziehung, geht aber
auf die Spezialthematik Kausalität nicht ein. |
(5) Allgemeines Grundmodell der Kausalität
im Psychischen zwischen
Bewusstseinselementen und Handlungen bzw. Verhalten derselben Person
Spezifikation Motivation, Handlung und Handlungsergebnis:
moti => hand => herg.
Der Standardfall in der Lebenspraxis ist die Kausalität zwischen
dem Aufbau einer Motivation (moti), die eine Handlung (hand) bewirkt und
zu einem Handlungsergebnis (herg) führt. Baut sich die Motivation
(moti) zu einem Spaziergang auf, die schließlich spazieren gehen
(hand) herbeiführt, so kann das spazieren gehen als Handlung und der
Spaziergang als fortgesetztes und schließlich abgeschlossenes Handlungsergebnis
(herg) aufgefasst werden: moti => hand => herg.
Ist genügend moti aufgebaut, kommt es, wenn die Fähigkeiten
zum Handeln oder Verhalten vorliegen und wenn die Gelegenheit oder Situation
für günstig erachtet wird, zum Handeln oder Verhalten. Bewusstheit
bzw. vollständige Bewusstheit ist an dieser Stelle noch nicht
zwingend vorausgesetzt, wobei Handeln als Verhalten mit Bewusstheit und
Zielstrebigkeit vom Verhalten oder Reflexen abgegrenzt wird.
Beispiel Erleben und Verhalten:
erleben0 = Ich spüre Durst und möchte etwas trinken.
erleben1 = Frage: Wasser, Tee oder Limo?
erleben2 = Entscheidung für Wasser,
erleben4 = Entschluss Wasser zu trinken
handeln1 = Ich stehe auf und gehe in die Küche UND
erlebe5 = Ich stehe auf und gehe in die Küche.
handeln2 = Ich öffne den Eisschrank UND erlebe6
=
Ich öffne den Eisschrank
handeln3 = Ich entnehme die Wasserflasche UND erlebe7
=
Ich entnehme die Wasserflasche
handeln4 = Ich öffne die Wasserflasche UND erlebe8
=
Ich öffne die Wasserflasche
handeln5 = Ich führe die Wasserflasche zum Mund UND
erlebe9 = Ich führe die Wasserflasche zum Mund
handeln6 = Ich trinke ein paar Schluck UND erlebe10
=
Ich trinke ein paar Schluck
Tatsächlich sind das stetige Vorgänge, die hier in 10 diskrete
Einheiten zerlegt wurden. |
(6) spezielle Kausalität eigener Handlungen
oder Verhalten in Bezug auf andere
oder die Welt.
Dass wir mit unseren Handlungen etwas bewirken können, erleben,
erfahren und wissen schon kleine Kinder. In der Psychologie sind hierzu
vor allem zwei Worte geschaffen worden: Kontrollüberzeugung (dies
und das kann kontrolliert werden) und Selbstwirksamkeit (dies und das kann
ich bewirken). Je nach Definition können die Begriff das gleiche bedeuten
oder teilweise Unterschiedliches.
Die folgenden 20 Diskussionsbeispiele zeigen für die
meisten eine Als-Ob-Kausalität an, also eine Kausalität im Groben
oder Ungefähren. Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass bei
einigen dieser Als-Ob-Kausalitäten Möglichkeiten denkbar sind,
wo es nicht funktioniert. Das Auto springt nicht immer an, z.B. nicht,
wenn die Batterie leer ist (6.12). Ich lasse die Markise herunter
und der Balkon wird nicht nass, obwohl es regnet. (6.3). Ein Gegenstand
fällt nur dann nach "unten", wenn genügend Schwerkraft vorhanden
ist, also nicht überall im Weltraum (6.18).
6.1 Tritt eine positive Erwartung nicht ein, bin ich enttäuscht.
6.2 Ich öffne die Tür und schiebe sie auf.
6.3 Ich lasse die Markise herunter und der Balkon wird nicht
nass, obwohl es regnet.
6.4 Ich drücke auf "Send" und das Mail ist auf dem Versandweg.
6.5 Ich sage zum Nachbar im Treppenhaus "Guten Morgen" und der
grüßt (nicht) zurück.
6.6 Ich sage beim Bäcker ich hätte gern zwei Roggenbrötchen,
deute auf das Fach und bekomme zwei eingepackt.
6.7 Ich mache die Heizung an und es wird (nicht) warm.
6.8 Öffne ich das Haustür-Schloss, kann ich eintreten.
6.9 Öffne ich das Fenster, kommt es zum Luftaustausch.
6.10 Drücke ich auf den Zapfhahn an der Zapfsäule,
fließt Treibstoff in den Tank.
6.11 Spüre ich Hunger, hole ich mir etwas zu essen.
6.12 Drehe ich den Schlüssel im Zündschloss oder dem
Anlasser, springt das Auto (meist) an.
6.13 Drücke ich aufs Gas, fährt der Wagen schneller.
6.14 Gehe ich auf die Bremse, verlangsamt das Auto.
6.15 Raunze ich mein Gegenüber unfreundlich an, erzeuge
ich Unmut.
6.16 Kippe ich ein Glas Wasser um, läuft es aus.
6.17 Lege ich einen Apfel zu den Bananen, reifen sie schneller.
6.18 Lasse ich einen Gegenstand fallen, so fällt er nach
unten.
6.19 Ich zahle Steuern, um Unannehmlichkeiten mit dem Finanzamt
zu vermeiden.
6.20 Stoße ich eine Billardkugel, bewegt sie sich. |
(7) Die Kausalität zwischen
biologischen Vorgaengen natcode(bioi) und natcode(bioj)
Dass zwischen biologischen Vorgängen kausale Beziehungen
bestehen ist sicher von den meisten WissenschaftlerInnen anerkannt, für
viele selbstverständlich, insbesondere für NaturwissenschaftlerInnen
(Physiker-, Chemiker-, Biolog-, Mediziner-, Rechtsmediziner-, TechnikerInnen).
Kausalgesetz im Nervensystem: bioi = Schwellenwert für
das Aktionspotential wird überschritten, bioj = Aktionspotential
wird ausgelöst: natcode(bioi, natcode(bioj)) |
(8) Die Kausalität zwischen biologischen
Vorgaengen natcode(bio) und dem Erleben dieser Vorgänge natcode(erleben(natcode(bio)))
Die allermeisten biologischen Vorgänge in unserem Körper
sind uns nicht bewusst. Aber es gibt auch biologische Vorgänge, die
bewusst qualitativ und quantitativ erlebt werden können. Hier sind
dann zwei Vorgänge zu codieren: natcode(erleben(natcode(bio))) oder
kürzer: nce(ncb).
| Im Psychischen gibt es einige besondere Probleme durch
die Konstruktion des Leiblichen und Seelischen (seelisch-geistige). Wir
erleben unseren Leib und seine Regungen als etwas von unserem seelisch-geistigen
Erleben Verschiedenes. Es erscheint daher ganz natürlich, den Leib
und seine Regungen einer anderen Seinssphäre als unser seelisch-geistiges
Erleben zuzuordnen. Unser Erleben ist uns so eigen und nahe, dass die meisten
Menschen nie auf die Idee kämen, es für etwas Materielles, genauer
Biologisches, zu halten. Heute noch wird von Geist und Materie so geredet
als handele es sich um zwei ganz unterschiedliche Welten ("Seinssphären").
Und so wurde seit Jahrtausenden eine eigene Welt des Seelisch-Geistigen
für nahezu selbstverständlich gehalten und von seiner biologischen
Basis getrennt (Dualismus). Andererseits ist es aber auch verständlich,
erleben von den physikalisch-chemischen Prozessen, die es codieren und
fundieren, als etwas Eigenes und Eigenständiges zu begreifen. Auch
wenn das Erleben physikalisch-chemisch oder naturwissenschaftlich (natcode)
codiert wird, so ist das Erleben doch eine spezifische eigene Erfahrung.
Daran gibt es keinen Zweifel. Ich erlebe keine Moleküle, synaptische
Ausschüttungen oder elektromagnetischen Vorgänge, wenn auch mein
Erleben durch solche naturwissenschaftlichen Vorgänge codiert und
fundiert ist. Seit Jahrtausenden stellt man die Frage nach dem "Verhältnis"
des Leiblichen zum Psychischen, Materie und Geist. Mein Modell wurde angeregt
durch eine Analogie zur Doppelnatur des Lichts, das korpuskulare Materieformen
und nichtmaterielle Wellenfomen annehmen kann. Man könnte aber auch
die unterschiedlichen Aggregatszustände, die Stoffe annehmen können,
heranziehen. Aber ganz greifen diese Analogien nicht, weil Erleben und
seine naturwissenschaftliche Codierung ja gleichzeitig stattfinden. Zwei
Zustände werden sozusagen zugleich und nicht nacheinander oder entweder-oder
realisiert. Sofern man unterschiedliche Seinssphären des Leiblichen
und Seelischen annähme - was ich nicht tue - ergäbe sich die
Frage der Kausalität zwischen Leiblichen und Psychischen: wie bewirkt
Leibliches Psychisches und Psychisches Leibliches? Aber auch wenn man,
wie ich, eine Identitätstheorie bevorzugt, stellt sich die Frage,
wie das Materielle und das Erlebnismäßige zusammen hängen?
Meine Antwort ist: das Erleben ist eine besondere Ausdrucksform der Materie.
Nehmen wir eine einfache Empfindung wie z.B. jucken, die im allgemeinen
das Motiv zu kratzen bewirkt, so können wir feststellen: es gibt die
Empfindung jucken und es gibt das Erleben "es juckt". Die Empfindung selbst
kann naturwissenschaftlich gedacht werden, ich habe dafür die
naturwissenschaftliche Schemavariable "natcode" gewählt. Die Empfindung
selbst kann also als natcode(bio: jucken) beschrieben werden. Kommt es
zum Erleben des Juckens, so kommt natcode(erleben, natcode(bio: jucken))
dazu. Hier kann gefragt werden: wozu brauche ich ein Erleben des Juckens,
um zu kratzen? Ich könnte doch auch einfach so kratzen. Ist also das
Erleben nicht doch ein bloßes Epiphänomen, eine Art Irrtum der
Evolution? |
(9) Kausalitaet zwischen
nichtbewussten Vorgängen, Erleben und Verhalten
Viele psychische Vorgänge sind uns nicht bewusst.
Sofern kausale Beziehungen zwischen nicht bewussten Vorgängen, Erleben
und Verhalten in die Analyse und in unsere psychologische Welt einbezogen
werden sollen, brauchen wir hierfür ein Zeichen, das einen Vorgang
als nicht bewusst kennzeichnet. Es bietet sich das Kürzel nb
an. ncnbe bedeute daher die naturwissenschaftliche Codierung
(nc) für nicht bewusstes (nb) Erleben (e). Hier ist dann die Frage,
welche kausale Beziehung zwischen nicht bewussten Vorgängen ncnbei
= > ncnbej besteht und wie man das zeigen kann? Solche
Vorgänge sind naturgemäß schwierig zu erforschen, wobei
die modernen Methoden (bildgebende Verfahren) in der Hirnforschung (Libet-Experiment)
aber auch Anlass zur Hoffnung geben. Methodologisch bieten sich Experimente
mit Wahrnehmungen unterhalb der Bewusstseinsschwelle an (Beispiel in Columbo
"Ein
gründlich motivierter Tod").
Ist man unterwegs und trifft fremde Menschen, die auf
dem Gehweg vorbeikommen, so hinterlassen diese Vorbeikommenden einen kurzen,
flüchtigen Eindruck, der wie die Faktoren, die diesen Eindruck hervorrufen,
gewöhnlich nicht bewusst ist. Manchmal kann aber auch ins Bewusstsein
dringen; der Mensch kommt mir irgendwie bekannt vor und die Frage aufbringen,
woher ich den wohl kennen könnte? Oder: der sieht interessant aus
oder was ist denn mit dem los? Hier geht es nun darum, welche nicht bewussten
Vorgänge bei der Begegnungswahrnehmung ablaufen? Nachdem hierzu kein
direktes Wissen vorliegt, wäre zunächst ein hypothetisches
Begegnungs Modell zu bilden, wie ein solches Programm konstruiert
sein könnte. |
(10) Kausalitaet zwischen
nichtbewussten und bewussten Vorgängen, Erleben und Verhalten
Manche nichtbewussten Vorgänge können bewusst
werden, so dass sich die Frage stellt, was für eine Beziehung besteht
zwischen dem nichtbewussten Vorgang und dem bewusst gewordenen Vorgang
und wie ist es zur Bewusstwerdung gekommen? Man könnte als eine kausale
Hypothese formulieren: unangenehme Erlebnisse werden vom Bewusstsein ferngehalten.
Mit einer Bewusstwerdungshilfe ncbwh kann das nicht bewusste
Erleben bewusst gemacht werden. Der Formalismus lautet: ncnbe(ncnbb) UND
ncbwh => nce(ncb)
Beispiel: Man spürt ein diffuses Unbehagen und kann
es nicht so recht einordnen. Die Gründe scheinen im Nicht-Bewussten
zu liegen. Hier könnte dann z.B. die Anwendung von
Focusing)
helfen und zu einem Ergebnis führen., z.B.: X hat mich verletzt
und enttäuscht. |
Psychologie
der Kausalitaetsattribution
Die Zuschreibung einer Kausalität bezeichnet man in der Psychologie
als Kausalattribution. Hier geht es nicht darum, welche Kausalbeziehungen
tatsächlich bestehen und wie man diese nachweisen oder begründen
kann, sondern darum, was und wie Kausalität zugeschrieben wird. Solche
Kausalattributionen können bei Menschen ganz unterschiedlich entwickelt
sein und daher auch sehr unterschiedlich angewendet werden. Wo manche eine
Kausalbeziehung sehen, tun es andere nicht. Hier gibt es auch starke Einflüsse
der soziokulturellen Gesellschaft, der jemand angehört und von der
er Kausalattribuieren gelernt hat. Fast die ganze Psychologie und Psychopathologie
ist mit Kausalitätsfragen konfrontiert.
-
Die allgemeine Psychologie
-
Die Entwicklungspsychologie untersucht hierbei die Entwicklung der Kausalattribution.
-
Die kognitive Psychologie untersucht die Kausalitätszuschreibungen
in der Informationsverarbeitung, Wahrnehmung und vor allem im Denken.
-
Die differentielle Psychologie der Persönlichkeit untersucht persönlichkeitsspezifische
Faktoren für Kausalitätszuschreibungen.
-
Die Sozialpsychologie im Verbund mit der Soziologie und Kulturanthropologie
untersucht die Einflüsse der Umgebung, wozu auch Sonderformen und
- faktoren, wie z.B. Animismus, Magie, Zauberei, Wahrsagerei, Religion
u.a. auch in sog. "primitiven" Gesellschaften gehören.
-
Die Psychopathologie untersucht die Kausalität gestörten Erleben
und Verhaltens, etwa, wenn ein Wahn die Kontrolle über das Ich übernimmt
und befiehlt, im Namen des Herren die Mutter zu töten.
Allgemeine
und integrative Kausalitätstheorie
Im Allgemeinen und Alltäglich gibt es keine großen Probleme
mit der Kausalität. Schwierig wird es meist erst dann, wenn man es
genauer wissen will (siehe oben Posch) oder wenn mehrere
Bedingungen und Faktoren zusammenwirken. Selten werden ausdrücklich
berücksichtigt: Auslöser, Anlass, Bedingung, Grund (Ursache).
Das Ursachenproblem
ist wissenschaftstheoretisch problematisch aus zwei prinzipiellen und aus
einem vermeidbaren Grund: (1) Im Kausalitätskonzept gibt es streng
betrachtet nur einen vielfach verzweigten Baum von Ursachen. Jede ausgemachte
Ursache kann prinzipiell wiederum auf andere Ursachen zurückgeführt
oder zumindest auf andere zurückgeführt gedacht werden. Welche
dieser vielen Ursachen soll als die besondere ausgezeichnet werden? In
der Wirklichkeit handelt es sich wohl meist um einen Ursachenkomplex, ein
Netzwerk von Bedingungen. (2) Man muß zwischen Bedingungen (Rahmen-
oder Randbedingungen), Anlässen oder Auslösern, Neben- und Begleiterscheinungen
unterscheiden, was häufig sehr schwierig ist und oft auch durcheinander
gebracht wird.
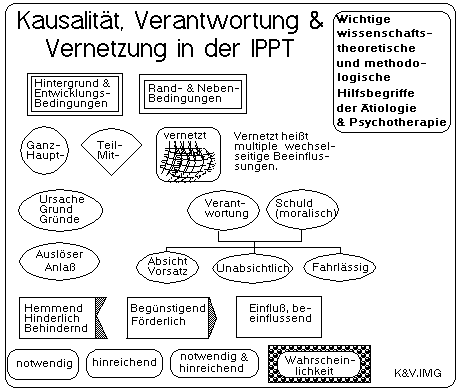
Praktische Anwendung und Veranschaulichung:
Das
Buch Eva -Ticket ins Paradies.
(3) Die psychischen Ereignisse können mehrperspektivisch
betrachtet werden: z. B. physikalisch, biologisch, chemisch, physiologisch,
neurologisch, internistisch, psychopharmakologisch, immunologisch, kybernetisch,
psychologisch, sozial-ökonomisch, sozialpsychologisch, sozial-rechtlich
und kommunikativ. Hinzu kommt, daß in der Computermetapher Hardware
als körperlich und Software als psychisch die Realisation im "Betriebssystem
Mensch" vielfach miteinander verflochten und vernetzt ist. Man kann es
den biokybernetischen Ereignissen im Körper nicht unbedingt ansehen,
ob sie "Hardware" oder "Software" repräsentieren. So finden wir häufig
in den Mitteilungen und Büchern drei Ebenen durcheinander gehend:
a) Perspektive (z. B. physikalisch, chemisch, biologisch, medizinisch,
psychologisch, sozial), b) Hard- oder Software-Repräsentation, c)
Ursache, Neben- und Begleiterscheinung oder Wirkung. Unbeschadet der Probleme,
ist die konzeptionelle Vorsehung einer oder mehrerer Ursachen (Bäume
oder Zweige) natürlich sinnvoll und vernünftig. Die Neigung mancher
SystemikerInnen und VulgärkonstruktivistInnen, das Ursachenproblem
herunterzuspielen oder gänzlich für überflüssig zu
erklären, können wir in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie
weder teilen noch akzeptieren.
Quelle.
Allgemeines und Integratives Bio-Psycho-Soziales
Krankheitsmodell
Quelle.

_
Im allgemeinen Modell wird von einem Systemstörungsmodell
ausgegangen, bei dem wir folgende Entwicklungsstadien unterscheiden: 1)
Ursachen, Bedingungen und Auslöser der Störung. 2) die Bewertung
einer Störung als Krankheit. Zum Wesen der Krankheit definiert
man zweckmäßig mindestens eine - wichtige - (Funktions-) Störung
(nach Gustav von Bergmann [1878-1955] 1932). 3) unterschiedliche Auswirkungen
(lokale, zentrale, allgemeine, spezielle) der Störung. 4) Erfassen
und Informationsverarbeitung der Störung und 5) aus Wiederherstellungsprozeduren:
der Auseinandersetzung zwischen den Kräften der Störung und der
Heilung. Störungen können exogener (ausserhalb des Systems) oder
endogener (innerhalb des Systems) Natur sein. Störungen haben im allgemeinen
Ursachen, womit sich in der allgemeinen Krankheitslehre die Ätiologie
beschäftigt. Entwickelt sich eine Störung in der Zeit, wie meistens,
heißt dieser Vorgang Pathogenese. Unklar ist meist der Symptombegriff,
der eine dreifache modelltheoretische Bedeutung haben kann:
-
es ist ein Zeichen der Störung (z. B. bestimmte
Antigene im Körper; Angst);
-
es ist ein Zeichen der Spontanreaktion auf die Störung
(z. B. bestimmte Antikörper gegen die Antigene; Vermeiden);
-
es ist ein Zeichen der Wiederherstellungsprozedur,
also Ausdruck des "Kampfes" zwischen Krankheit und Heilungsvorgängen
(z. B. Fieber; Ambivalenzkonflikt zwischen Vermeiden und Stellen).
_
Tabelle
1 Allgemeines Grundmodell Kausalität ohne Wechselwirkungen
[Quelle]
Im Prinzip werden nach diesem Ansatz ohne Wechselwirkungen 8
Modelle mit je 5 Variablenklassen unterschieden
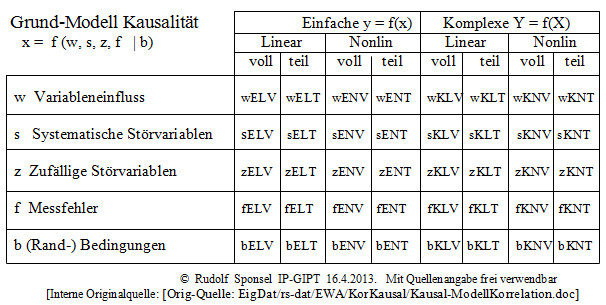
Im Alltag, besonders im zwischenmenschlichen Beziehungsleben gibt es
vielfältige Wechselwirkungen. Kausalität hat hier oft nicht nur
eine Richtung. In einem umfassenderen Modell, das besonders für Kommunikation
und zwischenmenschliche Beziehungen geeignet sein soll, erscheinen entsprechende
Wechselwirkungsmodelle erstrebenswert. Damit würden sich die Modellkomponenten
von 8 auf 16 für das Wechselwirkungs-Grundmodell verdoppeln, indem
jeweils die Möglichkeit mit oder ohne
Wechselwirkung hinzugenommen wird.
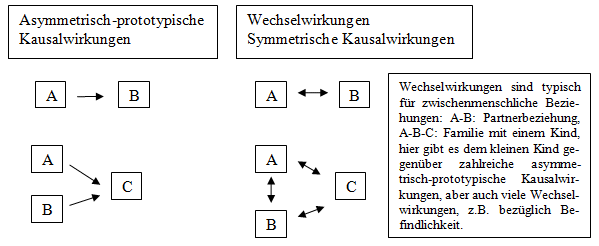 |
Weitere anschauliche Beispiele hier:"
1. Variable x verursacht Variable y.
2. Variable y verursacht Variable x.
3. Die beiden Variablen x und y verur-
sachen sich gegenseitig.
4. Die beiden Variablen x und y werden
von einer Drittvariablen z verursacht.
5. Variable x verursacht Variable y und
die beiden Variablen werden
außerdem
von einer Drittvariablen z verursacht.
6. Variable y verursacht Variable x und
die beiden Variablen werden
außerdem
von einer Drittvariablen z verursacht.
7. Die beiden Variablen x und y verur-
sachen sich gegenseitig. Außerdem
werden die beiden Variablen
von einer
Drittvariablen z verursacht." |
Zur Analyse kausaler Beziehungen sind eine ganze Reihe bekannter
Methoden nützlich: Auf die einfache,
multiple,
partielle
und kanonische
Korrelations- und Pfadanalyse sei hingewiesen.
Hier wird der Eigenwert- und Kollinearitäts-Analyse-Ansatz verwendet:
wenn es in der Korrelationsmatrix fast-funktionale Abhängigkeiten
gibt, dann zeigt sich dies u.a. in fast-linearen Abhängigkeiten und
diese wiederum in "kleinen" Eigenwerten, operational < 0.20.
Einfache Kausalitätsversuche
im Alltagsleben
Man beachte Auslöser, Anlass, Bedingung,
Grund (Ursache).
Konkrete Beispiele
Abschließen
Wenn ich etwas abschließe, dann ist mein Abschließen der
Grund oder die Ursache, dass es abgeschlossen wurde. Anlass und Auslöser
spielen hier keine Rolle. Wohl aber die Bedingung, dass das Schloss funktioniert
und meine Fähigkeit abzuschließen gegeben ist. Anmerkung: abschließen
ist hier mehrdeutig.
Aufstehen
Nach dem Erwachen zur rechten Zeit, stehe ich gewöhnlich auf,
wenn mein Bewegungsapparat funktioniert. Der Grund, die Ursache für
mein Aufstehen ist mein Wille, aufzustehen, unterstützt durch die
Gewohnheit bislang fast immer aufgestanden zu sein. Auslöser ist das
Erwachen; zur rechten Zeit ist der Anlass. Bedingungen sind das Erwachen
zur rechten Zeit und dass mein Bewegungsapparat funktioniert.
Billardstoß
Ein berühmtes Beispieles Humes,
der in Kapitel VII Über den Begriff der notwendigen Verknüpfung
in der Untersuchung des menschlichen Verstanden schreibt (Abruf
29.10.22):
"Wenn man sich unter äussern Gegenständen umsieht und die
Wirksamkeit der Ursachen betrachtet, so kann man für den einzelnen
Fall niemals eine Macht oder nothwendige Verknüpfung entdecken; keine
Eigenschaft zeigt sich da, welche die Wirkung an die Ursache bände
und die eine zur [>58] untrüglichen Folge der andere machte. Man bemerkt
nur, dass das Eine thatsächlich und wirklich dem Andern folgt. Dem
Stosse der einen Billardkugel folgt die Bewegung der zweiten. Dies allein
nehmen die äussern Sinne wahr. Die Seele hat keine Empfindung oder
innern Eindruck von dieser Folge der Gegenstände. Das einzelne Beispiel
einer Ursache und Wirkung hat deshalb nichts an sich, was den Begriff von
Kraft oder nothwendiger Verknüpfung darbieten könnte."
Das stimmt so nicht. Der Auslöser für die Bewegung der einen
Billardkugel ist der Stoß, der an ihr durchgeführt wird. Die
Bewegung der zweiten, die von der ersten getroffen wird, ist Wirkung des
Getroffenseins. Als Ursache gilt die Kraft, die im Stoß enthalten
und auf die erste Kugel ausgeübt wird, die einen Teil auf die zweite
getroffene Kugel überträgt. Vereinfacht gilt: Stoß => Bewegung.
Für das Nacheinander von zwei Vorgängen A und B gibt es verschiedene
Modelle der (Un-) Abhängigkeit wie oben ausdifferenziert.
Außer Hume kenne ich niemanden, der die Kausalität Stoß
=> Bewegung in Zweifel zieht. Richtig ist natürlich, dass man Kausalität
wie Gründe
oder Plausibilität
und vieles andere nicht direkt wahrnehmen oder beobachten kann.
Kartoffel schälen
Schäle ich eine Kartoffel, so ist die Ursache für das Abgeschältsein,
das Ergebnis meiner Tätigkeit des Abschälens. Bedingung: ich
brauche ein funktionierendes Abschälwerkzeug (Messer, Kartoffelschäler),
eine Kartoffel und einen Abschälwilligen und -tüchtigen. Man
kann hier die Ursache auch sehen, nämlich den Abschälenden und
die Wirkung, das Abgeschältsein.
Tür aufmachen / zumachen
Wenn ich die Tür aufmache, dann ist mein Aufmachen der Grund oder
die Ursache, dass sie offen ist. Anlass und Auslöser spielen hier
keine Rolle. Wohl aber die Bedingung, dass sich die Tür mit meinen
Fähigkeiten öffnen lässt.
Verallgemeinerungen
Die Beispiele lassen sich auch verallgemeinern, z.B: irgendetwas öffnen,
schließen oder irgendetwas stoßen oder irgend etwas machen.
Anwendungen der Allgemeinen
und integrativen Kausalitätstheorie im Psychologischen
Kausalitaet im Erleben des Bewusstseinsstroms
> Überblick
über mögliche Bewusstseinsinhalte oder Bewusstseinsfiguren -
erleben
im einzelnen.
Die Kausalität der Bewusstseinsvorgänge
ist schwierig und daher weitgehend unerforscht, weil es sehr viele unterschiedliche
Bewusstseinselemente gibt, die vielseitig - oft nicht bewusst - vernetzt
sind. Deshalb sind experimentelle
Untersuchungspläne zwar schwierig, aber zwingend erforderlich. Das
experimentelle Ideal ist, unabhängige und abhängige Variable
zu isolieren und den Zusammenhang zur abhängigen Variable beobachten,
wenn die unabhängige Variable verändert wird.
Im wesentlichen wird das alltägliche Erleben durch die Erlebensarbeit,
z.B. nachdenken über einen Sachverhalt, bestimmt. Es gibt Themen,
die uns beschäftigen: aktuelle und längerfristige, die bei entsprechenden
Anlässen zu Aktualisierungen führen umso eher und mehr, je wichtiger
sie uns sind. Zum anderen kommen durch den Wahrnehmungsapparat Reize hinzu,
die das mentale Geschehen beeinflussen können. Lärm, Geräusche
oder Stimmen werden gehört, wenn auch oft nicht richtig wahrgenommen,
so dass sie im Bewusstseinsstrom schnell untergehen. Eine Körperregung
oder ein Duft. Der Blick richtet sich dahin oder dorthin, manches Gesehene
wird auch mehr oder bewusst wahrgenommen. Jedes Bewusstseinselement ist
mit Erinnerungen, Vorstellungen, Gefühlen, Wünschen oder Motiven
assoziiert.
PMOe-Psychologisch-Mikro-Ökologische Methode
Kaminskis
Kaminski
hat eine Methode entwickelt, die geeignet erscheint, die Kausalität
von Bewusstseinsvorgängen zu studieren. Er nennt diese Methode Psychologische
Mikro Ökologie (PMÖ). Ich wurde mit der Methode im Kolloquium
Integrative Psychologie durch einen Vortrag Prof. Werbiks (2014) bekannt.
Kaminski (2012), S.8 "Ich nehme in meinen Alltag überall hin eine
bestimmte Hintergrund-Einstellung mit, eine Bereitschaft, offen und sensibel
zu sein für das Beachten irgendwie "spontan" und sehr rasch im Bewusstseinsgeschehen
auftretender, unscheinbarer "Mikro-Phänomene" und diese dann so zu
beachten, dass ich sie möglichst präzis behalten und beschreiben
kann. Geschieht dann tatsächlich irgendwann derartiges, mache ich
mir möglichst sofort über diese Erfahrung eine kurze schriftliche
Notiz, die mich ausreichend präzis und konkret an den Vorgang selbst
erinnern kann. Bei nächster Gelegenheit verfasse ich anhand dieser
Notiz ein mehr oder weniger ausführliches Protokoll. Sofort anschließend
wird dieses Protokoll in bestimmter Weise von mir ausgewertet; wie, das
werde ich sogleich an einigen Beispielen demonstrieren. Ein solches Protokoll
ist im Regelfall folgendermaßen aufgebaut:
- Zuerst wird der Kontext beschrieben, in dem sich der Vorgang abgespielt
hat;
- dann wird der beobachtete Vorgang selbst beschrieben;
- danach folgen des öfteren irgendwelche Interpretationen, zusätzliche
Überlegungen u. ä. m."
Kausalitaet im Denken
(dmod := Denkmodell)
Gibt es eine Kausalität im Denken? Wie könnte man sich eine
solche vorstellen? Denken heißt geistige Modelle bilden oder zueinander
in Beziehung setzen. Diese Definition ist selbst ein Denkmodell. Welche
Beziehung bestand nun zwischen der Frage, die ich mir stellte - gibt es
eine Kausalität im Denken? - und dem Einfall meiner Definition? Denken
kann ein Ziel haben, muss aber nicht, man kann sozusagen frei vor sich
hindenken, einmal diesem Gedanken, dann einem anderen nachgehen. Man könnte
vermuten, dass die große Macht des Denkens auch in seiner Freiheit
besteht. Man kann aber auch vermuten, dass es diese Freiheit in "Wirklichkeit"
gar nicht gibt und die Freiheit des Denkens nur eine Illusion ist. Das
Denken erscheint uns nur frei, vielleicht weil es im einzelnen
auch schwer zu fassen ist.
Bewusstseinselemente des Denkens
Kann jemand etwas Helles oder Dunkles wahrnehmen, ohne dass er dafür
die Namen oder Bezeichnungen "Helles" oder "Dunkles" zur Verfügung
hat und dies auch später vergleichend wiedererkennen, z. als ähnlich,
heller oder dunkler? Das einfachste Argument, dass Worte und Sprache wie
sie die meisten Menschen in ihrer Sozialisation lernen, für das Erkennen
der Welt nicht zwingend gebraucht werden, sind die Tiere.
BeWu-Protokoll 21.02.2018, 17.12 Uhr
Wie denke ich? Ich habe diese Frage in Worte gefasst und drücke
sie sprachlich aus. Zum Denken können Vorstellungen gehören,
Phantasien, Erinnerungen, Wissenselemente, Worte, Begriffe, vorsprachliche
kognitive Schemata, Namen und Bezeichnungen, ... Wozu denke ich überhaupt?
Was hat das Denken für Funktionen? Wozu dient es?
Die Kausalität zwischen Namen
und seinem Begriffsinhalt
"Blume" ist der Name für den Allgemeinbegriff Blume. Das wird
in der Lebenspraxis meist nicht unterschieden. Wenn ich jetzt, in diesem
Augenblick, Mittwoch 21.02.2018, 15.16 Uhr über Blume nachdenke, dann
fällt mir als erstes ein, was ich eingangs schrieb: "Blume" ist der
Name für den Begriffsinhalt Blume. Dazu fällt mir ein Pflanze,
Duftend, Blüte, Stengel, Blatt, Geschenk, Aufmerksamkeit, Verzierung
oder Schmuck bei festlichen Anlässen oder in der Wohnung, schön,
brauchen Licht und Wasser, halten nicht lange, abgestandenes Blumenwasser
riecht schlecht, Orchideen mögen abgekochtes Wasser und nicht zu kalt.
Querverweis: Überblick
Denkpsychologie in der IP-GIPT.
Kausalitaet von Assoziationen
Assoziation bedeutet im Erleben allgemein, dass sich zu einem Erlebensinhalt
erli1 ein Erlebensinhalt erli2 einstellt. Hierbei
gibt es, wie zahlreiche empirisch-experimentelle Untersuchungen gezeigt
haben, gewisse Regelhaftigkeiten, wenn etwa zum erli1=dmod1
:=
Hund
erli2=dmod2 := Katze assoziiert wird. Ein
strenges Kausalgesetz wird man hier in aller Regel nicht finden, nicht
bei einem Menschen und erst recht nicht bei vielen oder gar allen. Dies
könnte leicht damit erklärt werden, dass die Erhebungsumstände
und Situationen sich jeweils unterscheiden.
Edelmann (2000) S. 29 zu:
"2.1.1 Die direkte assoziative Verknüpfung von Bewusstseinsinhalten
Bereits Aristoteles hat drei Assoziationsgesetze genannt. Er nahm an,
dass zwei Gedächtnisinhalte unter folgenden Bedingungen miteinander
verknüpft werden: [>30]
-
wenn sie einander ähnlich sind (Gesetz der Ähnlichkeit)
-
wenn sie einander unähnlich sind (Gesetz des Kontrastes)
-
wenn sie irgendwann gemeinsam in unserem Bewusstsein vorhanden waren (Gesetz
der zeitlichen und räumlichen Berührung oder Kontinuität).
BEISPIEL
-
Auf einem Spaziergang begegnen wir einem uns unbekannten Menschen. Da erinnern
wir uns an einen lieben Freund. Die Ähnlichkeit mag in der Art sich
zu kleiden, im Gang o. ä. liegen.
-
Wir speisen in einer Gaststätte und sind gar nicht zufrieden. Da erinnern
wir uns an die ausgezeichnete Küche, die wir im letzten Urlaub kennenlernten.
Wir kommen am Bahnhof vorbei. Da erinnern wir uns, dass sich hier vor
einigen Wochen ein Verkehrsunfall ereignet hat."
Assoziationen bei Begegnungen
auf dem Gehweg mit fremden Personen
Die Eindrücke, die fremde Menschen bei Begegnungen auf dem Gehweg,
hinterlassen, sind oft flüchtig, vage oder nicht bewusst. Manchmal
aber auch nicht und die eine oder andere Begegnung beschäftigt uns.
Im Hintergrund könnten folgende Prozesse ablaufen, die uns im
allgemeinen nicht bewusst sind:
-
Wem sieht diese Person ähnlich?
-
An wen oder was erinnert mich diese Person?
-
Mit wem könnte diese Person etwas zu tun (gehabt) haben?
Hinsichtlich der Eindrucksbildung könnten folgende meist nicht bewusste
Abfragen gedacht werden:
-
Gefährlich ... ungefährlich?
-
Bekannt .... unbekannt?
-
Interessant .... uninteressant?
Querverweise Assoziation
in der IP-GIPT:
Kausalität des bedingten Reflexes
> Assoziationen.
Der bedingte Reflex kann als kausalgesetzmäßige Beziehung
gelten, wenn sie eingerichtet wurde und aufrecht erhalten wird.
Der bedingte Reflex wurde von Pawlow entdeckt, untersucht
und beschrieben. Er spielt für die Psychologie, insbesondere des Lernens
und die kognitiven Wissenschaften eine große Rolle. Der bedingte
Reflex bei z.B. bedingter Reiz Glockenton stiftet eine Stellvertreterfunktion
für einen unbedingten Reflex, z.B. Speichelfluss bei unbedingtem
Reiz Anblick von Nahrung). Je zeitlich näher bedingter und unbedingter
Reiz beieinander liegen und je öfter diese Kombination erfahren wird,
desto beständiger wird diese bedingte- unbedingte Reflexverbindung.
Mit zunehmendem Ausbleiben des unbedingten Reizes wird die Verbindung zusehends
schwächer, bis sie schließlich ganz unterbleibt. Das nennt man
Löschung oder Exstinktion.
Pawlow schreibt (orig. 1936, dt. 1972) Der bedingte
Reflex. In (203-220) Pawlow, Iwan Petrowitsch (orig. 1936, dt. 1972)
Die bedingten Reflexe. Die grundlegenden Forschungen des russischen Nobelpreisträgers.
München: Kindler.
S. 205f: "... Entsprechend dem Dargelegten wird
die ständige Verbindung eines äußeren Agens mit der es
beantwortenden Tätigkeit des Organismus mit Recht als unbedingter
Reflex, die zeitweilige Verbindung aber als bedingter Reflex bezeichnet.
..."
S. 207f: "Die Hauptbedingung für die Bildung
eines bedingten Reflexes ist im allgemeinen das ein- oder mehrmalige zeitliche
Zusammenfallen eines indifferenten mit einem unbedingten Reiz. Am schnellsten
und mit den geringsten Hindernissen geht diese Bildung vor sich, wenn der
indifferente Reiz dem bedingten unmittelbar vorangeht, wie dies oben am
Beispiel des akustischen Säurereflexes gezeigt wurde.
Der bedingte Reflex entsteht sowohl in seiner elementaren
Form als auch in seinen äußerst komplizierten Komplexen auf
der Grundlage aller unbedingten Reflexe und aus den verschiedensten Agenzien
des inneren und des äußeren Milieus, allerdings mit einer Einschränkung:
aus allem, für dessen Wahrnehmung es rezeptorische Elemente in den
Großhirnhemisphären gibt. Wir haben eine äußerst
umfassende Synthese vor uns, die von diesem Teil des Gehirns verwirklicht
wird.
Aber das ist noch nicht alles! Die bedingte, zeitweilige
Verbindung [>208] spezialisiert sich zugleich bis zu höchster Kompliziertheit
und bis zu feinster Detaillierung der bedingten Reize sowie gewisser Tätigkeiten
des Organismus, besonders der skelett- und der sprech-motorischen Tätigkeit.
..."
Reflexgesetze nach Skinner
Skinner, B. F. (orig. 1953; dt. 1973) Wissenschaft und menschliches
Verhalten. München: Kindler. S. 413f.
"2. Effektgesetz und Reflexgesetze
Effektgesetz (THORNDIKE)
Wenn ein modifizierbarer (Verhaltens-)Zusammenhang zwischen einer Situation
und einer Reaktion hergestellt ist und von einem befriedigenden Zustand
hinsichtlich der Lage der Dinge begleitet oder gefolgt wird, so wird die
Starke dieses (Verhaltens-)Zusammenhangs erhöht: Wenn derselbe durch
einen unangenehmen Zustand entstanden und von einem solchen begleitet oder
gefolgt wird, wird seine Stärke herabgesetzt. (1913)
Die Ergebnisse aller unter verschiedenen Bedingungen zustande gekommenen
Vergleiche besagen ausnahmslos, daß ein positiv verstärkter
Verhaltenszusammenhang beträchtlich verstärkt wird, daß
dagegen bei Bestrafung nur eine geringe oder keine Reduktion des Verhaltens
eintritt. (1932)
Reflexgesetze - respondentes Konditionieren
[Fußnote: "Nach Nach. B. F. SKINNER,
Behaviour
of Organisms, 1938, zit. in der Zusammenstellung von B. WOLMAN in:
Contemporary
Theories and Systems in Psychology, New York 1960,
Zum operantcn Verhalten ist eine Sammlung von Skinnerschen
Definitionen und Grundregeln des Verhaltens wiedergegeben bei C. B. FEKSTEK
und B. F. SKINNER, Schedules of reinforcement, Apple- ton-Century-Crofts,
New York 1957, Anhang."]
Schwellengesetz
Die Intensität eines Stimulus muß einen gewissen kritischen
Wert (genannt Schwelle) erreichen oder überschreiten, um eine Reaktion
auszulösen. Latenzgesetz
Ein Zeitintervall (genannt Latenz) tritt zwischen dem Einsetzen des
Stimulus und dem Einsetzen der Reaktion auf.
Gesetz von der Größe der Reaktion (Stärke-Große-Gesetz)
Die Größe der Reaktion ist eine Funktion der Stimulusintensität.
Gesetz von der zeitlichen Summierung
Verlängerte oder wiederholte Darbietung eines Stimulus innerhalb
gewisser Grenzraten hat denselben Effekt wie eine Steigerung der Intensität.
Gesetz von der respondenten Löschung [>414]
Wenn der durch respondente Konditionierung bestärkte Reflex ohne
Darbietung des verstärkenden Stimulus ausgelöst wird, sinkt die
Stärke."
Kausalitaet von Wissen
Was ist 2 mal 2? Hier sollte das Kausalgesetz greifen und immer
zum selben richtigen Ergebnis 4 führen. Dies wirft die Frage nach
der Kausalität zwischen Aufgaben und Lösungen auf. Was ist, wenn
es zwei oder gar mehr richtige Lösungen gibt, z.B. bei der Aufgabe
oder Frage Quadratwurzel aus 4 (-2 * -2 = 4 und 2 * 2 =4) oder Stadt am
Rhein?
Kausalitätsfragen der Motivation
Zur Psychologie der Motivation und des Handelns bzw. Verhaltens siehe
auch:
Toman's Motivintensitätstheorie
Heckhausen
Literatur (Auswahl)
-
Äqvist, Lennart (1981) Neue Grundlagen der logischen Handlungs- und
Kausalitätstheorie. In (324-349) Posch, Günter (1981, Hrsg)
-
Allers, R.; Bauer, J.; Braun, L.; Heyer, R.; Hoepfner, Th.; Mayer, A.;
Pototzky, C.; Schilder, P.; Schwarz, O. & Strandberg, J. (1925) Psychogenese
und Psychotherapie Körperlicher Symptome. Wien: Springer. [GB]
-
Arnold, Wilhelm;
Eysenck, Hans Jürgen & Meili, Richard (1974 ff).
Lexikon der
Psychologie. Freiburg: Herder.
-
Aristoteles ()
-
Ballweg, Joachim (1981) Experimenteller und alltagssprachlicher Ursache-Wirkungs-Begriff
. In (147-156) Posch, Günter (1981, Hrsg)
-
Bavink, Bernhard (1930, 4. A.) Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften.
Leipzig: Hirzel.
-
Bechterew, W. (1913) Objektive Psychologie, deutsche Ubers., Leipzig und
Berlin: V?
-
Beckermann, Ansgar (1975) Einige Bemerkungen zur statistischen Kausalitätstheorie
von P. Suppes. [Online]
-
Beckermann, Ansgar (1985, Hrsg.), Analytische Handlungstheorie, Bd. 2,
Handlungserklärungen, Frankfurt a. M.:
-
Beetz, Jürgen (2016) Feedback. Wie Rückkopplung unser Leben
bestimmt und Natur, Technik, Gesellschaft und Wirtschaft beherrscht. Berlin:
Springer.
-
Birnbacher, D. (1995) Tun und Unterlassen. Stuttgart: Reclam.
-
Bleuler, E. (1914). Psychische Kausalitat und Willensakt. Philosophical
Review 23:583.
-
Bridgman, Percy W. (1954; orig. 1931) Die neue Einstellung zum Kausalgesetz.
In (67-90) Bridgman, Percy W. (1954; orig. 1931). Wien: Humboldt. Physikalische
Forschung und soziale Verantwortung.
-
Bunge, Mario (1987) Kausalität, Geschichte und Probleme. Tübingen:
Mohr.
-
Burkamp, Wilhelm (1922) Die Kausalität des Psychischen Prozesses und
der Unbewussten Aktionsregulationen. Berlin: Springer. [GB]
-
Carnap, Rudolf (1928, 1961 2.A.) Der logische Aufbau der Welt. 2. Auflage
mit einem zusammenfassenden Vorwort. Hamburg: Meiner.
-
Carnap, Rudolf (1969) Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaft.
München: Nymphenburger Verlagshandlung.
-
Carrier, Martin: Ursache. In (442–444) Jürgen Mittelstraß (1996,
Hrsg.)
-
Davidson, Donald (1981) Kausale Beziehungen. In (79-101) Posch, Günter
(1981, Hrsg)
-
Debler, W. F. (1984) Attributionsforschung. Kritik und kognitiv-funktionale
Reformulierung. Salzburg: AVM.
-
Dreier, Volker (1998) Kausalitätsprobleme in Handlungs- und Entscheidungstheorien.
In (12-33) Druwe, Ulrich & Kunz, Volker (1998, Hrsg.) Anomalien
in Handlungs- und Entscheidungstheorien. Wiesbaden: Springer.
-
Edelmann, Walter (2000) Lernpsychologie. 6. A. Weinheim: BeltzPVU.
-
Eigen, Manfred (1983) Zufall und Gesetz bei der Entstehung des Lebens.
Aulavorträge Hochschule St. Gallen.
-
Eigen, Manfred & Winkler, Ruthild (1975) Das Spiel. Naturgesetze steuern
den Zufall. Neuausgabe 1985 ff. München: Piper.
-
Einstein, Albert (1962) Mein Weltbild. Herausgegeben von Carl Seelig. 2.
erw. Auflage (Erstauflage 1934 Amsterdam). Berlin: Ullstein.
-
Exner, S. (1894) Entwurf z. e. physiol Erklärung d. psych. Erscheinungen,
1. T. Leipzig u. Wien.
-
Faulstich, Peter (2004) Donald Davidsons Ereignisbegriff. Können Gründe
Ursachen von Handlungen sein? (eBook / PDF). Grin.
-
Feigl, Herbert (1927) In (17-187): Haller, Rudolf & Binder, Thomas
(1999)
-
Flammer, August (2008). Entwicklungstheorien.
Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung. Bern: Huber.
-
Frey, Gerhard (1981) Zur Frage der Ursachenfindung. Pragmatische Aspekte
der Kausalforschung. In (55-78) Posch, Günter (1981, Hrsg)
-
Gasking, Douglas (1981) Kausalität und Handlungsanweisungen In (289-303)
Posch, Günter (1981, Hrsg)
-
Gasking, Douglas (1981) Zur Diskussion von »Kausalität und Handlungsanweisungen«
In (316-323) Posch, Günter (1981, Hrsg)
-
Gerhard, Michael (2009) Klassische Handlungstheorien. London: Turnshare.
-
Görlitz, D.; Meyer, W.-U. & Weiner, B. (1978, Hrsg.) Bielefelder
Symposium über Attribution. Stuttgart: Klett-Cotta.
-
Görlitz, Dietmar (1983, Hrsg.) Kindliche Erklärungsmuster. Entwicklungspsychologische
Beiträge zur Attributionsforschung Bd. 1, Weinheim: Beltz. [Überwiegend
auf Leistungsmotivation beschränkt]
-
Haken, Hermann; Plath, Peter J.; Ebeling, Werner & Romanovsky,
Yuri M. (2016) Beiträge zur Geschichte der Synergetik. Allgemeine
Prinzipien der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft. Wiesbaden:
Springer.
-
Haller, Rudolf & Binder, Thomas (1999) Zufall und Gesetz. Drei Dissertationen
unter Schlick: H. Feigl - M. Natkin - Tscha Hung. Amsterdam: Editions Rodopi
B.V.
-
Hartmann, N. (1919) Die Frage der Beweisbarkeit des Kausalgesetzes, in:
Kant-Studien, 24/3,
-
Hartmann, F. (1992) Kausalität als Leitbegriff ärztlichen Denkens
und Handelns, in: Neue Hefte für Philosophie, 32/33 (Themenheft "Kausalität"),
Göttingen 1992, S. 50-81.
-
Heberer, Gerhard (1974, Hrsg.) Die Evolution der Organismen. Ergebnisse
und Probleme der Abstammungslehre. Band II/1 Die Kausalität der Phylogenie.
Stuttgart: G. Fischer.
-
Heberer, Gerhard (1974) Theorie der additiven Typogense. In (395-444)
Heberer, Gerhard (1974, Hrsg.)
-
Heckhausen, H. (1980). Motivation und Handeln. Berlin:
Springer.
-
Heckhausen, Hein (1983) Entwicklungsschritte in der
Kausalattribution von Handlungsergebnissen. In (49-85) Görlitz
(1983, Hrsg.)
-
Heckhausen, H.; Gollwitzer, P. M. & Weinert,
F. E. (1987, Hg.)- Jenseits des Rubikon: Der Wille in den Humanwissenschaften.
Berlin: Springer.
-
Heisenberg, Werner (1955) Das Naturbild der heutigen Physik, Reinbek: Rowohlt
rde.
-
Herkner, Werner (1980, Hrsg.) Attribution. Psychologie der Kausalität.
Bern: Huber.
-
Herzog, Walter (2012) Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie.
Wiesbaden: Springer
-
Herzog, Walter (2012) Psychische Kausalität. In (112-113) Herzog,
Walter (2012) Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie. Wiesbaden:
Springer
-
Heuer, W. (1929, 2. A.) Warum fragen die Menschen Warum? Erkenntnistheoretische
Beiträge zur Lösung des Kausalitätsproblems. Heidelberg:
V?
-
Heyde, Johannes Erich (1957) Entwertung der Kausalität. Für und
wider den Positivismus. Stuttgart: Kohlhammer.
-
Hofler, A. (1895). Psychische Arbeit. Philosophical Review 4:441.
-
Hübl, Philipp (o.J.) Grundwissen. Theorien der Kausalität (pdf
online)
-
Hume, David (1748) Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand.
dt. 1967: Stuttgart: Reclam,. Online bei Zeno.org.
-
Hüttemann, Andreas (2001, Hrsg.) Kausalität und Naturgesetz
in der frühen Neuzeit. Stuttgart: Steiner. [GB]
-
Hung, Tscha (1934) In (303-351): Haller, Rudolf & Binder, Thomas (1999)
-
Jensen, Paul (1934) Kausalität, Biologie und Psychologie. Erkenntnis;
Dordrecht Vol. 4, (Jan 1, 1934): 165-.
-
Joerden, J. C. (1988) Strukturen des strafrechtlichen Verantwortlichkeitsbegriffs:
Relationen und ihre Verkettungen. Berlin 1988, S. 47 ff.
-
Jordan, Pasqual (1947) Physik im Vordringen. Die Wissenschaft Einzeldarstellungen
aus der Naturwissenschaft und Technik, Bd. 99. Braunschweig: Vieweg.
-
Kälble, Karl (1997) Die Entwicklung der Kausalität im Kulturvergleich.
Opladen: Westdeutscher Verlag. [GB]
-
Kaminski, Gerhard (1970) Verhaltenstheorie und Verhaltensmodifikation.
Entwurf einer integrativen Theorie psychologischer Praxis am Individuum.
Stuttgart: Klett.
-
Kaminski, Gerhard (2012) Die Notwendigkeit und die Unnötigkeit
einer psychologischen Ökologie. Um einige Abschnitte und Zusätze
erweiterte Fassung eines Vortrages im Kolloquium der Arbeitsgruppe Kognition
und Wahrnehmung, Fachbereich Psychologie, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Tübingen, 12.01.2012.
-
Kaminski, Gerhard (2013) Psychologische Mikro-Ökologie (PMÖ-Ansatz)
von den Füßen auf den Kopf gestellt. Um einige Abschnitte und
Zusätze erweiterte Fassung eines Vortrages im Gesprächskreis
"Ökologische Ansätze in psychologischer Grundlagenforschung und
Praxis", Fachbereich Psychologie, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
der Universität Tübingen, 21.02.2013.
-
Kaminski, Gerhard (o.J.) Archiv I "Ökologisch-psychologisches Kolloquium"
Entstehung und Geschichte" (bis SS 2002).
-
Kaminski, Gerhard (o.J.) Archiv II Gesprächskreis "Ökologische
Ansätze in psychologischer Grundlagenforschung und Praxis" Entstehung
und bisherige Geschichte (bis 3.8.2017)
-
Kaspar, Robert (1980) Naturgesetz, Kausalität und Induktion. Ein Beitrag
zu theoretischen Biologie. Acta Biotheoretica 29:129-149 (1980).
-
Keil, Geert (2000) Handeln und Verursachen. Frankfurt: Klostermann.
-
Kaiser, Jürgen & Werbik, Hans (2012) Handlungspsychologie.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (UTB).
-
Kim, Jaegwon (1981) Nichtkausale Beziehungen. In (127-146) Posch, Günter
(1981, Hrsg)
-
Kühler, Michael & Rüther, Markus (2016, Hrsg.)
Handbuch Handlungstheorie. Grundlagen, Kontexte, Perspektiven. Stuttgart:
Metzler.
-
Laplace, P.S. de (1812, dt. 1896) Philosophischer Versuch über die
Wahrscheinlichkeiten. Leipzig: Duncker & Humblot.
-
Leibniz, Gottfried Wilhelm () Neue Abhandlungen über den menschlichen
Verstand. [Zeno.org]:
Anmerkungen: Gottfried Wilhelm Leibniz: Neue Abhandlungen über den
menschlichen Verstand. Leipzig
21904, S. 3. Entstanden 1701-1704.
Erstdruck in: Œuvres philosophiques latines et françoises, Amsterdam/Leipzig
1765. Der Text folgt der ersten deutschen Übersetzung durch Carl Schaarschmidt
von 1873. Bei den »Neuen Abhandlungen über den menschlichen
Verstand« handelt es sich um Leibniz' Entgegnung auf John Lockes
»Versuch über den menschlichen Verstand«. Der Aufbau der
»Neuen Abhandlungen« folgt Lockes Schrift bis hin zur Zählung
der Paragraphen]
-
Leinfellner, Werner (1981) Kausalität in den Sozialwissenschaften
In (221-259) Posch, Günter (1981, Hrsg)
-
Lenk, Hans (1980, Hrsg.) Handlungstheorien interdisziplinär
/1: Handlungslogik, formale und sprachwissenschaftliche Handlungstheorien.
München: Fink. [Dig
BSB]
-
Lenk, Hans (1978, Hrsg.) Handlungstheorien interdisziplinär /2,1:
Handlungserklärungen und philosophische Handlungsinterpretation ;
1. Halbband. München: Fink. [Dig
BSB]
-
Lenk, Hans (1979, Hrsg.) Handlungstheorien interdisziplinär /2,2:
Handlungserklärungen und philosophische Handlungsinterpretation ;
2. Halbband. München: Fink. [Dig
BSB]
-
Lenk, Hans (1981, Hrsg.) Handlungstheorien interdisziplinär /3,1:
Verhaltenswissenschaftliche und psychologische Handlungstheorien ; 1. Halbband,
München: Fink. [Dig
BSB]
-
Lenk, Hans (1984, Hrsg.) Handlungstheorien interdisziplinär /3,2:
Verhaltenswissenschaftliche und psychologische Handlungstheorien ; 2. Halbband.
München: Fink. [Dig
BSB]
-
Lenk, Hans (1977, Hrsg.) Handlungstheorien interdisziplinär /4: Sozialwissenschaftliche
Handlungstheorien und spezielle systemwissenschaftliche Ansätze. München:
Fink. [Dig
BSB]
-
Lesch alpha-Centauri Was ist Kausalität? 24.08.2016, 02:00 Uhr
15 Min. Online verfügbar bis 12.01.2022
-
Lewis, David (1981) Kausalität. In (102-123) Posch, Günter (1981,
Hrsg)
-
Lewis, David (1981) Kausalität Nachwort. In (124-126) Posch, Günter
(1981, Hrsg)
-
Lexikon der Neurowissenschaft (online)
-
Lipps, Th (1901). Psychische Vorgange und psychische Causalitat. Philosophical
Review 10:549.
-
Lübbe, Weyma (1994, Hrsg.) Kausalität und Zurechnung: Über
Verantwortung in komplexen kulturellen Prozessen (Philosophie und Wissenschaft,
Band 5) (Englisch) Gebundene Ausgabe – 1. November 1994
-
Mach, Ernst (1900) Kausalität und Erklärung.
In (87-94) „Prinzipien der Wärmelehre“, 2. Auflage. Zusammenfassung:
Ein Anderes ist es, sagt man, einen Vorgang zu beschreiben, ein Anderes,
die Ursache des Vorganges anzugeben. Um hierüber klar zu werden, wollen
wir untersuchen, wie der Begriff Ursache entsteht.
-
Mackie, John L. (1966) The Direction of Causation. In: The Philosophical
Review 75 (1966), 441–466.
-
Meggle, G. (1985, Hrsg.), Analytische Handlungstheorie, Bd. 1, Handlungsbeschreibungen,
Frankfurt a. M. :
-
Meixner, Uwe (2001) Theorie der Kausalität. Ein Leitfaden zum
Kausalbegriff in zwei Teilen. Paderborn: Mentis.
-
Metzger, W. (1966, Hrsg.) Handbuch der Psychologie, I. Der Aufbau des Erkennens.
1. Halbband: Wahrnehmung und Bewußtsein. Göttingen: Hogrefe.
-
Michotte, A. & Thines, Georges-Louis (1966) Die Kausalitätswahrnehmung.
In (954-977) Metzger, W. (1966, Hrsg.)
-
Mittasch, Alwin (1938) Die Stellung der katalytischen Kausalität
zu anderen Kausalitätsformen. In Mittasch, Alwin (1938) (41-103) Katalyse
und Determinismus. Ein Beitrag zur Philosophie der Chemie
-
Münch, Richard (2007) Soziologische Theorie /1: Handlungstheorie.
Frankfurt [u.a.] Campus.
-
Münch, Richard (2003) Soziologische Theorie /2: Handlungstheorie.
Frankfurt [u.a.] Campus.
-
Musgrave, Alan (1993) Alltagswissen, Wissenschaft und Skeptizismus. Tübingen;
Mohr (Siebeck), UTB.
-
Natkin, Marcel (1928) In (188-301): Haller, Rudolf & Binder,
Thomas (1999)
-
Nentwig, Christian G. (1976) Untersuchungen zur Kausalattribution bei Verhaltensmodifikationen.
Dissertation Math-Nat-Fak Uni Düsseldorf.
-
Oeser, Erhard (1981) Kausalität und Wahrscheinlichkeit In (190-220)
Posch, Günter (1981, Hrsg)
-
Otto, H. (1998) Kausalität und Zurechnung. In (395-416): Zaczyk R.,
Köhler M., Kahlo M. (eds) Festschrift für E. A. Wolff. Berlin:
Springer.
-
Pauli, Wolfgang (1984) Raum, Zeit und Kausalität in der modernen
Physik. In (64-75) Physik und Erkenntnistheorie. Springer.
-
Pawlow schreibt (orig. 1936, dt. 1972) Der bedingte Reflex. In (203-220)
Pawlow, Iwan Petrowitsch (orig. 1936, dt. 1972) Die bedingten Reflexe.
Die grundlegenden Forschungen des russischen Nobelpreisträgers. München:
Kindler.
-
Pearl, Judea (2000) Vausality Models, Reasoning, and Inference. Cambridge
University Press.
-
Piaget, Jean (fr. 1950, dt.1975) Realität und Kausalität. In
(257-337) Die Entwicklung des Erkennens II. Das physikalische Denken. Gesammelte
Werke 9. Stuttgart: Klett.
-
Planck, Max (1937) Der Kausalbegriff in der Physik. Leipzig: Barth.
-
Planck, Max (1932) Die Kausalität in der Natur. Vortrag in London
am 17.6.1932. Abgedruckt in: (250-269) Planck, Max (1970) Vorträge
und Erinnerungen. Darmstadt: WBG.
-
Posch, Günter (1981, Hrsg) Kausalität. Neue Texte. Stuttgart:
Reclam.
-
Posch, Günter (1981) Zur Problemlage beim Kausalitätsproblem.
In (9-29) Posch, Günter (1981, Hrsg)
-
Reichardt, Jan-Ole & Friedrich, Daniel (2016) Handlungsursachen.
In (83-90) Kühler, Michael & Rüther, Markus (2016,
Hrsg.) [RS: an einigen Stellen problematisch]
-
Rosenberg, Alexander (1981) Kausalität und Handlungsanweisungen. Ein
Beitrag zur Begriffsklärung In (304-315) Posch, Günter (1981,
Hrsg)
-
Reichardt, Jan-Ole & Friedrich, Daniel (2016) Handlungsursachen.
In (83-90) Kühler, Michael & Rüther, Markus (2016,
Hrsg.)
-
Reichenbach, Hans (dt. 1968, engl. 1951) Der Aufstieg der wissenschaftlichen
Philosophie. Braunschweig: Vieweg.
-
Riedl, Rupert (1981, 3.A.) Biologie der Erkenntnis. Die stammesgeschichtlichen
Grundlagen der Vernunft. Berlin: Parey.
-
Russell, Bertrand (1912) On the Notion of Cause, in: Proceedings of the
Aristotelian Society 13, 1912/13, 1-26.
-
Russell, Bertrand (dt. 2004, engl 1926) Unser Wissen von der Außenwelt.
Hamburg: Meiner. SR: Kausalgesetz, allgemeines;
246 allgemeines Schema des ~ es; 240 f. Definition des ~ es; 237-240
~, nicht a priori 249, 259f. Kausalgesetze 122,
236-241, 249 f. ~, Wahrscheinlichkeit der; 241-245 ~, in der Psychologie
244f.
-
Russell, Bertrand (dt. 1927; engl. 1921) Die Analyse des Geistes.
SR: kausale Gesetze 23,104f., 5. Vorl. 110—128, 142, 147, 168—170, 216t,
243, 250t, 263, 299, 367t, 377, 388, 391—395 Kausalität 111 —, mnemische
97—109 —, physikalische 106 —, psychische 104, 261
-
Saner. L. (2014, Hrsg.), Determinismus und Kausalität
Studium generale, DOI 10.1007/978-3-658-04158-8_5, © Springer
Fachmedien Wiesbaden.
-
Schlick, Moritz (1932 engl.) Kausalität im täglichen Leben und
in der neueren Naturwissenschaft. In (131-155) Krüger, Lorenz (1970,
Hrsg.) Erkenntnisprobleme der Naturwissenschaften. Texte zur Einführung
in die Philosophie der Wissenschaft. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
-
Schulz, Winfried (1970) Kausalität und Experiment in den Sozialwissenschaften
: Methodologie und Forschungstechnik. Mainz: v. Hase &
Koehler.
-
Schwarz, Oswald (1925, Hrsg.) Psychogenese und Psychotherapie körperlicher
Symptome. Wien: Springer.
-
Schrödinger, Erwin (1947) Die Besonderheit des Weltbildes der
Naturwissenschaft [Abschnitt 15: Verzichte und Konventionen: Induktion,
Kausalität, Anfangsbedingungen]. In (27-85) Schrödinger, Erwin
(1967) Was ist ein Naturgesetz. Beiträge zum naturwissenschaftlichen
Weltbild. Darmstadt: WBG.
-
Seebohm, Thomas M. (1981) Historische Kausalerklärung In (260-288)
Posch, Günter (1981, Hrsg)
-
Siegler, Robert; Eisenberg, Nancy; DeLoache, Judy & Saffran,
Jenny (2016) Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter.
4. Auflage. Deutsche Ausgabe herausgegeben von Sabina Pauen. Berlin: Springer.
[GB]
-
Simmert, Sebastian (2017) Probabilismus und Wahrheit. Eine historische
und systematische Analyse zum Wahrscheinlichkeitsbegriff. Wiesbaden:
Springer.
-
Simmert, Sebastian (2017) 22.4 Der Wille als motivierte veränderliche
Ursache. In (244-250) Simmert, Sebastian (2017) Probabilismus und
Wahrheit.
-
Spohn, Wolfgang (1983) Eine Theorie der Kausalität. Habilitationsschrift
eingereicht bei der Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie
und Statistik der Ludwig-Maximilians-Universität in München im
Oktober 1983. [Online]
-
Stegmüller, Wolfgang (1979) Kausalgesetze und kausale Erklärungen.
In (87-107) Rationale Rekonstruktion von Wissenschaft und ihrem Wandel.
Stuttgart: Reclam.
-
Stegmüller, Wolfgang (1983) Erklärung Begründung Kausalität.
Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie
Band I. Berlin: Springer.
-
Stein, Edith (1922). Psychische Realität und Kausalität: Der
psychische Mechanismus. Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische
Forschung 5:22.
-
Streminger, Gerhard (1981) Die Kausalanalyse David Humes vor dem Hintergrund
seiner Erkenntnistheorie. In (163-189) Thienen, Julia von (2013) Kausalniveaus.
Eine Methodenanalyse zur Kausalforschung in der Psychologie. Lengerich:
Pabst.
-
Suppes, Patrick. (1970) A Probabilistic Theory of Causality Amsterdam:
North-Holland Publishing Company
-
Thomae, Hans (1966) Die Bedeutungen des Motivationsbegriffes. In (3-47)
Thomae, Hans (1966, Hrsg.)
-
Thomae, Hans (1966, Hrsg.) Handbuch der Psychologie 2. Band Allgemeine
Psychologie II. Motivation. Göttingen: Hogrefe.
-
Titze, Hans (1981) Das Kausalproblem und die Erkenntnisse der modernen
Physik. In (30-54) Posch, Günter (1981, Hrsg)
-
Vester, Frederic (1983) Ballungsgebiete in der Krise. Vom Verstehen und
Planen menschliucher Lebensräume. München: dtv.
-
Wagner, Gerhard (2015) Kleine Ursachen, große Wirkungen Zum Einfluss
Julius Robert Mayers auf Max Webers neukantianische Kausalitätstheorie
M. Endreß et al. (Hrsg.), Zyklos 2, DOI 10.1007/978-3-658-09619-9_1,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
-
Wal, Koo van der (2017) Die Wirklichkeit aus neuer Sicht. Für eine
andere Naturphilosophie. Wiesbaden: VS (Springer).
-
Weber, Edgar (1981) Rückkehr der Zeitmaschine? Eine Bemerkung
zu »Experimentellem und alltagssprachlichem Ursache-Wirkung-Begriff«
In (157-162) Posch, Günter (1981, Hrsg)
-
Waisman, Friedrich (1983) Wille und Motiv. Zwei Abhandlungen über
Ethik und Handlungstheorie. Stuttgart: Reclam.
-
Walther, Philip & Brukner, Caslav (2019) Kausalität in der Quantenwelt.
Spektrum der Wissenschaft, 4.19, 12-19.
-
Werbik, Hans (1978) Handlungstheorien. Stuttgart: Kohlhammer.
-
Werbik, Hans (1984) Über die nomologische Auslegung von Handlungstheorien.
In (633-651) Lenk, Hans (1984, Hrsg.)
-
Weyl, Herrmann (1966) Kausalität (Gesetz, Zufall, Freiheit) in (239-276)
Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft. Darmstadt: WBG.
-
Wölk, W. (2001) Trauma, psychische Krankheit und Kausalität.
MedSach Ausgabe: 04-2001, Seite 143
-
Wright, G. H. von (1977) Handlung, Norm und Intention, Untersuchungen
zur deontischen Logik, hrsg. von H. Poser, Berlin/New York 1977.
-
Wuketis, Franz M. (1981) Biologie und Kausalität. Berlin: Parey.
Links (Auswahl: beachte)
Glossar,
Anmerkungen und Endnoten: > Eigener
wissenschaftlicher Standort.
GIPT= General and Integrative
Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative
Psychotherapie.
__
Bestrafung
lernpsychologisch betrachtet: In der Lernpsychologie und Verhaltenstherapie
gilt als Strafe bereits der sog. Verstärkerentzug. Das ist sozusagen
die mildeste und pädagogischste Form einer Strafe: nicht
das direkte Zufügen von Schmerz, Leid oder eines Schadens - das nennt
man aversiver Reiz - , sondern das Nichtgewähren oder Entziehen einer
Begehrlichkeit. Macht ein Kind seine Hausaufgaben nicht, so darf es z.B.
nicht Fernsehen. Zahlt einer seine Steuern nicht, wird sein Autozugang
entzogen. Hält jemand nachhaltig die Straßenverkehrsordnung
nicht ein, wird der Führerschein für eine Zeit lang entzogen.
Wirtschaftet ein Vorstand eine Aktie in den Keller, sollten wenigstens
Prämien und Boni entfallen. [Quelle]
__
Belohnung und Verstärkung
in der Verhaltenstherapie. Belohnung existiert nicht nur in der Form, daß
eine Begehrlichkeit erhalten wird, sondern auch darin, daß etwas
Unangenehmes vermieden werden kann. Flucht und Vermeiden können daher
wie Belohnungen wirken. Beispiel: Jemand steigt aufs 3 Metersprungbrett,
traut sich infolge Angst aber dann doch nicht springen. Die Vermeidung
geht mit Angstrückgang einher und wird so gesehen belohnt. So kann
man vermeiden lernen. Dieses Phänomen heißt negative Verstärkung:
aus der Situation wird etwas entfernt, das mit einem angenehmen oder erleichternden
Gefühlszustand einhergeht. Wegsehen, unterdrücken, ausblenden
aus der Wahrnehmung und dem Bewußtsein können wie negative Verstärkungen
wirken: schaue ich meine Fehler nicht an, kann ich nach der Regel verfahren:
was
ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. [Quelle]
__
dmod := Denkmodell
__
erli := Erlebensinhalt
__
Epiphaenomen
__
erkenntnistheoretischer
Realismus im Sinne Galileis
__
Erkenntnisse [Quelle]
1984 Dis
...
In meinem Dissertationsfazit
(methodologischen) habe ich aufgrund der Erfahrungen mit meinen umfangreichen
Partialisierungsanalysen, aus denen praktisch die Beliebigkeit von Korrelationskoeffizienten
hervorging, neben der Bedeutung der Partialisierungstechnik die Idee des
relevanten
Merkmalsraumes entwickelt. Ein solcher kann nur mit Hilfe von Theorie
auf der Basis von Erfahrungswissen erstellt werden.
1994 Numerisch instabile
...
1995
Kausalität, Verantwortung und Vernetzung in der IP-GIPT (Aus Sponsel
1995, S. 96)
2002
Korrelationsseiten für das Internet aufbereitet:
2005 Fast-
Kollinearität in Korrelationsmatrizen mit Eigenwertanalysen erkennen.
Im Zuge der Aufarbeitung der Ergebnisse von 1994
schälte sich immer mehr heraus, wie sinnvoll und nützlich Fast-Kollinearitätsanalysen
sind. Sie bedeuten, wenn sie nicht artefiziellen oder fehlerhaften Ursprungs
sind, die Entdeckung von Gesetz- oder Regelhaftigkeiten, also genau
das, was sich WissenschaftlerInnen so sehr wünschen. Durch die unheilvolle
und unkritische Anwendung der Faktorenanalyse ist dieser wichtige Gesichtspunkt
völlig untergegangen.
2013 Korrelation, Kausalität,
Eigenwert- und Fast-Kollinearitätsanalyse
Aus der Auseinandersetzung mit dem 3bändigen
Werk von Hummell & Ziegler und seinem zentralen Thema Korrelation
und Kausalität wurde nun die Idee der Eigenwert- und Fast-Kollinearitätsanalyse
erfolgreich auf das Thema angewandt. Ein langer Weg von 30 Jahren hartnäckiger
- numerisch-mathematischer, empirisch-praktischer - Korrelationsforschung
erweist sich zunehmend als außerordentlich ergiebig. Mit Korrelationsmatrizen
ist viel mehr möglich als die signifikanzstatistische Fixierung sieht.
__
intermittieren, intermittierend.
mit Unterbrechungen erfolgen. Vom Lateinischen: inter =: dazwischen,
mittere=: schicken, senden. Bei der intermittierenden Verstärkung
wird nicht jedes erwünschte Verhalten verstärkt
(belohnt), sondern mit Auslassungen nach einem Plan vorgegangen. [Quelle]
__
Nicht nur Belohnung verstärkt
ein Verhalten, wie folgende Übersicht aus Zimbardo (1983, S. 195)
zeigt:
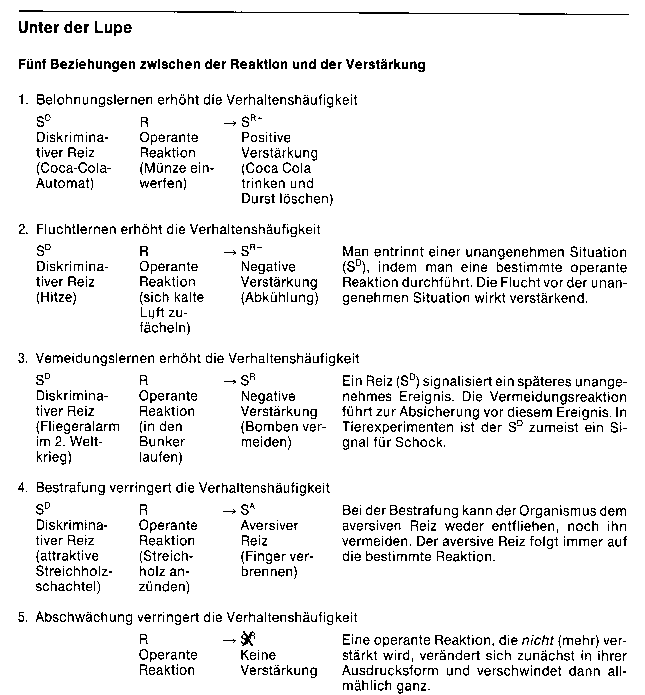
[Quelle]
Auswahl
Lernpsychologie und Verhaltenstherapie im Internet (beachte)
Literaturliste:
Lernen: http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/LERNEN/default.shtml
Behaviorismus: http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/LERNEN/Behaviorismus.shtml
Literatur (Auswahl)
Links (Auswahl: beachte)
KI:
-
https://chat.deepseek.com/
-
https://chat.openai.com/
-
Qwen 2.5: https://qwen.readthedocs.io/en/latest/getting_started/quickstart.html
Glossar,
Anmerkungen und Endnoten: > Eigener
wissenschaftlicher Standort * Eigener
weltanschaulicher Standort.
GIPT= General and Integrative
Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative
Psychotherapie.
__
Querverweise
Standort: Einführung und Verteilerseite
Kausalität.
*
*
*
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS).
Kausal und Kausalität, Ursache und Wirkung, Grund und Folge - allgemein
und besonders im Psychischen und Recht. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/gb/Kausal/Kausal0.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen
Ende
Kausalität Einführung & Verteilerseite_Datenschutz_Überblick_Rel.
Aktuelles _Rel.
Beständiges _
Titelblatt_
Konzept_
Archiv_
Region_Service_iec-verlag
Mail: sekretariat@sgipt.org__Wichtiger
Hinweis zu Links und zu Empfehlungen
korrigiert irs Nachträge 29.10.2022
/ 06.05.2018
Aenderungen Kleinere
Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet
und ergänzt.
29.10.22 Einfache
Kausalitätsversuche im Alltagsleben. Korrektur gelesen irs am
29.10.22
29.10.21 Wissenschaftstheoretische
Begriffsanalyse der Kausalbeziehung.
17.08.21 Link aufgenommen: VV2
Verstehens-Versuch 2 Ursache und Wirkung, Kausalität verstehen.
17.05.18 Unter (9) den Satz eingebaut:
"Methodologisch bieten sich Experimente mit Wahrnehmungen unterhalb der
Bewusstseinsschwelle an (Beispiel in Columbo "Ein
gründlich motivierter Tod")." irs kor 17.05.18
16.05.18 Zitat
Edelmann zu Assoziationen. * Reflexgesetze
nach Skinner.
11.05.18 Verallgemeinerung:
Die Kausalität zwischen einem Objekt und seiner Bezeichnung. * Kausalität
des bedingten Reflexes. irs kor
10.05.18 Die
Kausalität zwischen Gegenstaenden und ihren Bezeichnungen am Beispiel
blau. irs kor 10.05.18
09.08.18 5 Beispiele für
kausale
Beziehungen, die aber keine Kausalgesetze sind. irs korr 09.05.18
08.05.16 Durchgesehen (kann so erstmals
ins Netz und wird weiter ausgearbeitet)
07.05.18 Neu bearbeitet: (2) Beispiele
für Kausalgesetze nach Stegmüller (1979), S. 90f: Exkurs natcode.
(4), (5), (7), (9) (10). irs korr. 07.05.2018
00.09.16 angelegt im September 2016.
Seither Material gesammelt und sporadisch daran gearbeitet, intensiver
dann im Oktober und November 2017 und fortgeführt im Februar 2018.
[Intern:
* Allers, R. (1883-1963) * Bauer, Joachim * Braun, L. * Heyer, R. *
Hoepfner, Th. * Mayer, A. * Pototzky, C. * Schilder, P. * Schwarz, Oswald
(1949) * Strandberg, J.] *