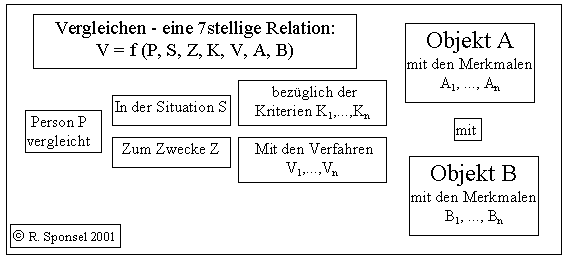Vergleichen führen wir als eine mindestens 7-stellige Relation ein: |
Obwohl die elementare kognitive Funktion Vergleichen die Grundlage für das Messen bildet, kommt sie im menschlichen Alltag praktisch ununterbrochen vor. Da wird sie aber gewöhnlich nicht untersucht, warum bleibt ein Geheimnis akademischer Forschung. Dies könnte uns auf die Idee bringen, ob messen nicht etwas ist, das sich auch im Alltag der Menschen ununterbrochen nachweisen läßt. Und dies könnte uns ein völlig neues Verständnis von Messen erschließen, das uns vielleicht aus der Sackgasse herausführen kann, in der die Meß- und Testtheorie seit Jahrzehnten steckt. Hierzu zunächst einige praktische Beispiele zur Nützlichkeit dieser mindestens 7stelligen Relation vergleichen.
Zunächst ein kleiner Ausflug in die Küchenmeßtheorie ;-)
Kartoffeln
kochen, Kartoffel-Meßverfahren
P kocht Kartoffeln zum Oberzwecke der Ernährung (Z1)
und möchte zum Unterzwecke der Genießbarkeit (Z2)
wissen, ob die Kartoffeln genügend weich gekocht sind. Hierzu wird
man sich in den meisten Fällen des Verfahrens V (V1, ...,
Vn ) mit einer Gabel pieksen oder stechen bedienen, man
wird also in wenigstens eine Kartoffel stichprobenweise hinein stechen
und den aktuellen Wahrnehmungseindruck A (A1, ..., An
) mit den gespeicherten Wahrnehmungseindrücken (B1, ...,
Bn ) vergleichen. Vorgegeben sei folgende verinnerlichte Ordnungsskala:
K1 = zu weich, K2 = weich genug, K3 =
unklar, K4 = noch etwas zu hart, K5 = noch zu hart,
K6 = viel zu hart. Angenommen, es ergibt sich das Resultat "noch
zu hart", dann steht zunächst eine Entscheidung an, wann wieder gemessen
= gestochen bzw. gepiekst werden soll. Es muß also eine Zeitschätzung
erfolgen, die Härte der Kartoffel ist in weitere notwendige Kochzeit
zu übersetzen. P wird sich also z. B. sagen, in 2 - 3 Minuten piekse
ich nochmal. Falls P nicht auf die Uhr schaut, ergibt sich abermals ein
Vergleichs- und Schätzproblem: es ist dann nämlich nach einiger
Zeit zu prüfen, ob die ausgewählte Zeit vermutlich schon vergangen
bzw. erreicht ist oder nicht.
| Als ein Ergebnis erhalten wir eine gekochte Kartoffel-Skala ;-):
K1= zu weich, K2= weich genug, K3= unklar, K4= noch etwas zu hart, K5= noch zu hart, K6= viel zu hart. |
Bleiben wir noch kurz bei der Küchenmeßtheorie, wo es leider kein Verfahren zu geben scheint, wie man folgendes Problem alltagspraktisch einfach lösen kann:
Wie
weich sind die gekochten Eier?
Ich mag gelegentlich zum Frühstück am liebsten solche gekochten
Eier, bei denen der Dotter innen weich und außen im Grenzbereich
zum Eiweis schon fest ist. Leider ist mir kein Verfahren bekannt, das einigermaßen
sicher zum gewünschten Ergebnis führt. Vermutlich müßte
man Volumen, Gewicht und Kochzeit zueinander in Beziehung setzen und die
entsprechenden Werte in eine Tabelle eintragen. Von jedem zu kochenden
Ei wäre dann erstmal Volumen und Gewicht zu bestimmen, um in der Tabelle
die vermutlich angemessene Kochzeit für diesen oder jenen Frühstückseityp
abzulesen.
Wagen wir uns nun auf psychologischeres Gebiet vor.
Einen Baum wahr-nehmen
P sieht in der Situation Spazieren gehen (S) einen Gegenstand A und
verfolgt den automatisierten, d. h. nicht ausdrücklich bewußten
Zweck der Wahrnehmung (Z). Sein Wahrnehmungssystem vergleicht mit den (Wahrnehmungs)
Verfahren V1, ..., Vn bezüglich
der Merkmale A1, ..., An mit den gespeicherten Merkmalen
B1, ..., Bn und kommt anhand der Kriterien K1,
..., Kn zu dem Ergebnis „Baum“. Die Prüfmethode in der
Praxis, etwa, wenn man wissen möchte, ob ein Kind schon über
den Baumbegriff verfügt, wäre, darauf hinzudeuten und zu fragen:
Wie heißt das? Streng genommen kann wahrnehmen also auch als messen
begriffen werden. In und mit dem Wahrnehmen wird etwas erkannt, was einer
inneren Kognition (Schema, Begriff, Bild, Modell) entspricht. Ein sinnlich
empfundenes Modell wird einem kognitiven Modell gleichgesetzt und es entsteht
- im Gegensatz zum bloßen Sehen - : wahr-nehmen. Wir
wissen aus der modernen Computerforschung, daß die Mustererkennung,
eine Meisterleistung des menschlichen Gehirns, sehr schwierig ist. Wahr-nehmen
ist eine außerordentlich komplizierte und hochentwickelte Leistung.
Wir bewerten sie deshalb häufig so gering, weil sie uns vielfach so
selbstverständlich gegeben ist und ohne jede Anstrengung angewandt
und genutzt werden kann.
Beschäftigen wir uns nun mit einer ganz wichtigen und sehr häufigen alltäglichen Messung der Menschen, die auch in der Psychodiagnostik und Psychotherapie eine große Rolle spielt:
Befindensauskunft
durch vergleichen
Frage ich mich selbst oder fragt mich meine PsychotherapeutIn, wie
es mir geht, so ist mein Zweck (Z), Auskunft über mein Befinden zu
erhalten oder / und zu erteilen. Hierzu halte ich inne (V1)
und ‘schaue’ nach innen (V2). Mit dem Verfahren innehalten,
nach innen schauen und nach meinem Befinden spüren (V3),
vergleiche ich die Befindlichkeit (A), die ich vorfinde, mit solchen, die
ich schon erlebt habe (B1, ..., Bn), kenne und abgespeichert
habe, worauf ich zu einem Urteil gelange, das lauten kann: es geht. Die
verschiedenen Kriterien K1, ..., Kn, die hier zur
Anwendung gelangen könnten sind z. B., daß ich mich frage, wie
war das die letzte Zeit (K1), gab es Höhepunkte (K2),
gab es Tiefpunkte (K3), wie war meine Stimmung (K4),
was fühlte ich (K5), wie oft (K6), wie lange
(K7), wie sehr (K8) fanden diese Erlebnisse statt?
Allerdings: Je mehr solche Wissensfragen eine Rolle spielen, desto erschlossener
und weniger gefühlsbezogen und spontan kann die Befindensauskunft
sein. Und: je spontaner die Auskunft erfolgt, desto augenblicksbestimmter
kann sie ausfallen. [FN03]
Betrachten wir nun eine einfache zwischenmenschliche soziale Situation:
Die
Handlung Grüßen als Ergebnis von Vergleichsprozessen
Vorausgehend: P sieht einen Menschen A. Sein Wahrnehmungssystem V erfaßt
an A die Merkmale A1, ..., An . Aus den Merkmalen
A1, ..., An von A wählt das Wahrnehmungssystem
von P die Kriterien K1, ..., Kn aus, die an
einer Stelle gut mit den Merkmalen B1, ..., Bn
von B (Merkmale der NachbarIn) übereinstimmen: P erkennt seinen Nachbarn.
Nun spielt sich ungefähr folgendes ab: Angenommen im Nachbarschaftsleben
des A spielen vier Klassen von NachbarInnen eine Rolle: (1) welche, die
er zuerst grüßt; (2) welche, wo er erst auf den Gruß durch
der NachbarIn wartet, um ihn sodann zu erwidern; (3) welche, wo es mal
so oder so ist und schließlich (4) welche, die er im allgemeinen
nicht beachtet, weil sie zu weit entfernt, unbekannt oder unwichtig erscheinen.
Im Handlungssystem wird nach einer Verfahrensregel gesucht, wie mit dieser
NachbarIn zu verfahren ist. Hierzu muß die erkannte NachbarIn einer
der vier Klassen zugeordnet werden. Auch dies erfordert natürlich
wieder einen Vergleich. Das alles spielt sich natürlich im wirklichen
alltäglichen Leben sehr schnell ab. Diagnostisch praktische Anwendungsmöglichkeit:
Eine allgemein selbstunsichere und abhängige (dependente) Persönlichkeit
wird solche Unterscheidungen nicht brauchen, weil sie nach ihrem Selbstwertverständnis
jemand ist, die immer zuerst grüßt.
Kommen wir nun zu einem sehr wichtigen Problem in den zwischenmenschlichen Beziehungen:
Liebt B A?
Die Frage stellt sich für nicht wenige Menschen als recht wichtig
für das Leben. Um die Frage beantworten zu können, brauche ich
Kriterien K1, ..., Kn wie lieben sich ausdrückt
und darstellt. Das sind zunächst einmal mehr oder minder subjektive
Kriterien. Eine Eifersüchtige, eine EgoistIn oder eine EgozentrikerIn
wird hier andere Maßstäbe anlegen als ein gesunder und sich
selbst maßvoll wertvoller Mensch. A wird B mit den Verfahren V1,
..., Vn (z. B. V1wie oft lächelt B in
Gegenwart von A, V2 wie oft sucht B Nähe, V3 wie
oft mag B zärtlich sein, usw.) auf die Merkmale B1, ...,
Bn prüfen und stimmen die Kriterien K1, ...,
Kn mit den Merkmalen B1, ..., Bn hinreichend
überein, wird A zu dem Schluß kommen: B liebt mich, also ziehen
wir zusammen oder gar nach einiger Zeit: heiraten wir. Woran A vermutlich
nicht so oft denken wird, ist, zu überprüfen, wie sich das für
B aus dessen Perspektive darstellt, also: A fühlt sich in B ein, versucht
dessen Perspektive einzunehmen und beurteilt aus der Sicht von B sich selbst:
stimmen die Liebes-Kriterien K1, ..., Kn von B mit
den Merkmalen A1, ..., An , die A zeigt, hinreichend
überein? Für eine zukunftsträchtige Partnerschaft wäre
die Symmetrie des wechselseitigen Vergleichs wichtig. Man ahnt hier, welche
Probleme bereits in einer Zweierbeziehung liegen.
Wenden wir uns nun der Frage zu, welche Vergleiche nötig sind, um die Frage zu beantworten, ob eine Therapie erfolgreich verlaufen ist.
Therapieerfolg?
Zunächst muß man klären, welche Kriterien K1,
..., Kn einen Erfolg darstellen sollen. Sodann wird verglichen,
ob diese Kriterien sich an den PatientInnen P1, ..., Pn
erhoben durch die Verfahren V1, ..., Vn wiederfinden
lassen und auf mittlere Sicht stabil bleiben.
Die Probleme der Therapieerfolgsmessung sind aus
verschiedenen Gründen, von denen einige angeführt werden sollen,
sehr schwierig. [FN04] Manchmal täuschen
sich die Menschen über ihren Zustand und ihre Befindlichkeit, weil
sie bestimmte Wünsche und Erwartungen haben oder erfüllen wollen
(Rosenthaleffekt). Fragt man die TherapeutInnen, so haben diese ein natürliches
Interesse, ihre Therapie als Erfolg wahrzunehmen. Sie neigen dann vielleicht
eher dazu, Problemfelder auszublenden und positive Entwicklungen über
Gebühr wahrzunehmen. Dies könnte man vielleicht so lösen,
daß man mehrere Informationsquellen zur Therapieerfolgsbeurteilung
nutzt: T, die TherapeutIn; P, die PatientIn; A, eine Angehörige;
G, eine unabhängige GutachterIn oder andere neutrale Personen (z.
B. ArbeitskollegIn, wenn das Problem dort bekannt war); O, objektive Kriterien
wie z. B. Anzahl der Krankheitstage, Anzahl der Arztbesuche oder Medikamentenverbrauch
nach der Therapie.
Manchmal kann man auch beobachten, daß Menschen
zwar ein Symptom oder ein Problem verlieren, dafür aber ein anderes
produzieren. Das nennt man intrapsychische Symptomverschiebung. Ähnliches
kommt aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungs- und Sozialsystemen
als interpsychische Symptomverschiebung vor: gesundet eine Person im System,
so wird eine andere krank. Die Kontrolle solcher interpsychischen Symptomverschiebungen
ist sehr schwierig, zeitaufwendig und kostenintensiv; sie wird daher meist
gar nicht gemacht oder auch nur erwogen.
Manchmal spielen auch äußere Ereignisse
eine wichtige Rolle. So mancher Therapieerfolg kann durch widrige äußere
Umstände (z. B. Ehescheidung, Verlust des Arbeitsplatzes, Streitigkeiten,
Unfall, Unglück) verschwinden. Ebenso können positive äußere
Umstände einen Therapieerfolg vorgaukeln, der gar nicht auf das Konto
"Therapieerfolg" verbucht werden dürfte; so verlieren manche schlagartige
alle Symptome, sobald sie sich geliebt fühlen oder sehr starkes Interesse
an ihrer Genesung und Gesundung haben.
Eine weitere nicht unwichtige Fehlerquelle sind
periodische, rhythmische und phasische Prozesse, die öfter mit biologischen
Gegebenheiten zusammen hängen (z. B. bei Depressionen). Nicht zu vergessen
ist auch, daß oft mehrere Heilkundige mit einem "Fall" befaßt
sind, so daß man gar nicht genau sagen kann, auf wessen Konto nun
welcher Erfolg oder Erfolgsanteil geht.
Eine gute Möglichkeit, mit allen diesen vielfältigen
Problemen fertig zu werden, wäre, große Stichproben zusammenzustellen,
aus denen sich dann die verschiedenen Fehlerquellen "herausmitteln" könnten.
Solche großen Stichproben stehen aber nicht zur Verfügung. Außerdem
ergibt sich das sehr schwierige und bislang ungelöste Problem, wann
zwei Stichproben bezüglich welcher Kriterien K1, ..., Kn
"gleich" und damit vergleichbar sind. Das Problem ist grundsätzlich
nicht lösbar, weil es keine zwei gleichen Menchen gibt, nicht einmal
eineiige Zwillinge. In der Forschungspraxis wird man also beim Stichprobenvergleich
viele Abstriche machen müssen. Welche Kriterien mindestens erfüllt
sein sollten,
erfahren Sie hier.
"Die Vielfalt und Vielschichtigkeit der k. O. {R.S.: kognitiven Operationen} macht unterschiedliche Ansätze zu ihrer Analyse und Klassifikation möglich und notwendig, wobei der Anforderungs-, Ziel- und Bedingungsbezug grundlegend ist. Auf der Informationsverarbeitungsebene (> Tätigkeit) werden Elementaroperationen identifiziert. Auf der Handlungsebene lassen sich k. O. unterschiedlicher Komplexität unterscheiden. Analyse und Synthese sind Grundoperationen, die in allen anderen k. O. enthalten sind, aber auch relativ selbständig - auf unterschiedlichem Niveau - vollzogen werden können. Sie sind darauf gerichtet, gedanklich ein Ganzes in seine Teile (Gegenstände, Eigenschaften, Beziehungen) oder ein System in seine Struktur und Funktionen zu zergliedem bzw. bestimmte Teile und Strukturelemente auszugliedem und Teile zu einem Ganzen oder Elemente und Relationen zu einem System zu verknüpfen. Beim Vergleichen werden mindestens zwei Objekte gedanklich in Beziehung gesetzt, um hinsichtlich ihrer Merkmale und Relationen Ähnlichkeiten, Unterschiede oder Gemeinsamkeiten nach bestimmten Aspekten zu bestimmen. Auf dieser Grundlage lassen sich z. B. Ordnungen bilden, d. h. Gruppierungen oder Rang- bzw. Reihenfolgen nach einem oder mehreren inhaltlichen oder formalen Merkmalen. Dabei können Klassen gebildet werden, die in bestimmten Beziehungen der Neben-, Über- oder Unterordnung stehen (> Klassifizierung). Das setzt Abstraktionen voraus, durch die bestimmte Merkmale oder Komponenten eines Erkenntnisgegenstands gegenüber anderen hervorgehoben, als für eine bestimmte Ziel- oder Fragestellung wesentlich erfaßt und andere als unwesentlich vernachlässigt werden. Verallgemeinerungen hängen damit sehr eng zusammen. Sie führen die durch die vorgenannten k. O. ausgegliederten und z. B. für eine Klasse von Objekten oder Ereignissen als zutreffend erkannten Merkmale zusammen und ermöglichen ihre Übertragung auf eine umfassendere Klasse oder deren Repräsentanten. Die Umkehroperationen zum Abstrahieren und Verallgemeinern sind Konkretisieren und Spezifzieren. Damit wird das gedankliche Erfassen eines Erkenntnisgegenstands in seiner Totalität mit Hilfe der bereits erarbeiteten Abstraktionen bzw. das Schließen von den Merkmalen einer Klasse auf die einer Teilklasse bezeichnet. Mit Hilfe der genannten k.O. werden die inhaltlich unterschiedlichen sachlichen und personalen Beziehungen in der Wirklichkeit - quantitative, strukturelle, räumliche, zeitliche, kausale, funktionale, konditionale u. a. - erfaßt, bewertet und in der Handlungsregulation berücksichtigt. Beim Verstehen mündlicher oder schriftlicher Äußerungen (> Textverstehen) werden Inferenzen erzeugt, die es ermöglichen, den Textinhalt zu rekonstruieren, mit den eigenen Kenntnissen in Übereinstimmung zu bringen, Mitgedachtes bzw. Nichtgesagtes zu ergänzen.Eine weitere Quelle habe ich unter dem Stichwort "Gedächtnis" gefunden, bearbeitet von Friedhart Klix: Digitale Bibliothek Band 23: Handwörterbuch Psychologie, S. 995 (vgl. HWB Psych., S. 216 ff.) (c) Psychologie Verlags Union]. Ich zitiere im Kontext (fett kursive Hervorhebungen von mir):
Der Vollzug k. O. hängt wesentlich von Inhalt und Struktur der objektiven Anforderung, von der Motivation und Zielbildumg des Menschen, seinen Vorkenntnissen u. a. ab. Die k. O. entwickeln sich auf der Grundlage neurophysiologischer Voraussetzungen in der Tätigkeit, sind Ergebnisse des Lernens und Komponenten kognitiver Fähigkeiten. Sie ermöglichen die Aneignung neuen Wissens und Könnens und die Bewältigung vielfältigster kognitiver Anforderungen."
"3.2 Kognitive Aktivitäten und Strukturen(2) Entwicklungspsychologie: In der Entwicklungspsychologie von Oerter & Montada (1982) gibt es keinen Eintrag zur elementaren kognitiven Funktion des Vergleichens. Auch nicht im Handbuch der Entwicklungspsychologie (1958). Selbst in den Gesammelten Werken des Altmeisters der kognitiven Entwicklungspsychologie, Jean Piaget, bei dem man fast immer etwas findet, erfährt das "Vergleichen" keine monografische Aufmerksamkeit, auch nicht im Meßband, Bd. 7 (Die natürliche Geometrie des Kindes), obwohl es in seiner gesamten kognitiven Entwicklungspsychologie implizit eine ganz zentrale Rolle spielt. Zu meiner Freude habe ich aber eine recht interessante Monographie zum Thema aus der ehemaligen DDR entdeckt: Weigl, Irina (1973). Vergleichen. Ordnen. Zuordnen. Transfervorgänge bei Vorschulkindern und Schulanfängern. Berlin: Volk und Wissen. Hieraus (S. 26):
des LangzeitgedächtnissesNeben diesen stationären Vernetzungen zwischen Begriffen gibt es in jedem Gedächtnis potentiellen Wissensbesitz. Er ist nicht explizit gespeichert, sondern muß durch kognitive Prozeduren, durch Vergleichs- und Inferenzprozesse aktualisiert werden. Dies bezieht sich nach dem Schema von Abb. 1 auf Wechselwirkungen zwischen operativen (5) und gespeicherten Strukturen (4).
Unter operativen Strukturen verstehen wir Prozesse, die an den perzeptiven Eigenschaften eines Wahrnehmungsbildes oder an den Merkmalsbildungen begrifflichen Gedächtnisbesitzes angreifen, sie vergleichen (und dabei Erkennung ermöglichen) oder transformieren (und dabei Verwandtschaften oder Verschiedenartigkeiten festzustellen gestatten). Das Ergebnis solcher kognitiver Prozesse ist nicht nur feststellbar, sondern es kann selbst wieder explizit gespeichert werden und damit den verfügbaren Wissensbesitz vergrößern. Zwei Beispiele dafür:
1. Ähnlichkeitsbestimmungen beruhen auf Vergleichsprozessen. Rosch et al. (1976) haben gezeigt, daß der Vergleich dominierender Merkmalseigenschaften eine bedeutsame Rolle beim Zustandekommen von Ähnlichkeitsurteilen spielt. Hirsch, Löwe, Katze, Kaninchen, Maus werden als zunehmend unähnlicher beurteilt. Hier spielt das Merkmal Größe eine dominierende Rolle. Auch das Komplexmerkmal »Wildheit« beeinflußt Ähnlichkeitsurteile dieser Art. Es wäre ganz absurd anzunehmen, daß alle möglichen Ähnlichkeiten zwischen Begriffen oder Begriffspaaren noch einmal gespeichert sind. Nein: Ähnlichkeitsbestimmungen sind Urteile, die über der perzeptiven oder über der Datenbasis des Gedächtnisses gebildet werden. Daher können verschiedene Aspekte gegenüber derselben Objektmenge verschiedene Merkmale akzentuieren und dadurch zu verschiedenen Ähnlichkeitsurteilen führen (z. B. Pflanzen nach Aussehen, Genießbarkeit, Heilkraft usf.). Davon abgesehen, können besonders bedeutsame oder gebrauchshäufige Ähnlichkeitsurteile auch fest gespeichert werden.
2. Prozeduren des Merkmalsvergleichs liegen auch den Ober-Unter-Begriffsbildungen zugrunde. Zunächst gilt: Je differenzierter ein Merkmalssatz für die Beschreibung der internen Struktur eines Begriffs, um so weniger Objekte gehören als Begriffsinhalt dazu - und umgekehrt: je weniger Merkmale zur Klassifizierung herangezogen werden, um so »abstrakter« ist die Kategorie und um so mehr Objekte (oder Gedankeninhalte) gehören zur Klasse. In diesem Sinne ist die Begriffsserie Birke-Baum- Pflanze-Lebewesen von links nach rechts eine Unter-Ober-Begriffsbeziehung und eine Ober- Unter-Begriffsbeziehung in umgekehrter Richtung. Nun ist bekannt, daß der kognitive Aufwand für die Erkennung von Unter-Ober-Begriffsbeziehungen wesentlich kleiner ist als der in umgekehrter Richtung. Dies spricht gegen eine feste Speicherung dieser Begriffsbeziehung. Einen wichtigen Beleg dafür hat Preuß (1986) erbracht. Er stellte fest, daß die Zeiten bei der Erkennung einfacher Unter-Oberbegriffsbeziehungen von den sog. Distraktoren abhängen. (Das sind Begriffspaare, die als negative Beispiele in die Versuchsserie eingebaut sind.) So ist die UB/OB-Erkennung stark erschwert, wenn als negative Beispiele Begriffspaare mit stark überlappenden Merkmalssätzen gewählt werden. Umgekehrt ist die Erkennung maximal erleichtert, wenn als Distraktoren Begriffe ohne gemeinsame Merkmale gewählt werden. Dies ist mit der Annahme einer festen UB/OB-Speicherung nicht vereinbar. Daß dabei tatsächlich Merkmalsvergleichsprozesse stattfinden, konnte Karzek (1986) am Beispiel der Erkennung von Synonyma nachweisen. Die Feststellung hochgradiger Bedeutungsähnlichkeit zwischen Begriffen nimmt mit der Anzahl unterschiedlicher Merkmalsanteile zwischen den zu vergleichenden Begriffen zu. (Z. B. ist die Erkennungszeit für SCHRIPPE - BRÖTCHEN signifikant kürzer als bei SCHWUNG - ELAN.)
Die zwei Beispiele betreffen sehr einfache kognitive Prozeduren, die sich der stationär gespeicherten Begriffsstrukturen als Informationsquelle bedienen. Es gibt natürlich sehr viel komplexere kognitive Strukturen. Schon bei der Ausnutzung von Transitivitätseigenschaften in Merkmalssätzen von Begriffen (A>B, B>C, C>D usf.) für Schlußfolgerungen sind Zwischenresultate, also Fixierungen abgeleiteter Informationen, zum Zwecke der weiteren Verarbeitung erforderlich. Dafür sind Zusammenhänge zwischen den Instanzen (6) und (5) einerseits sowie (5) und (4) andererseits anzunehmen und zu betrachten."
"Das Vergleichen bildete die Hauptoperation, da es eine wichtige Voraussetzung sowohl für die logisch-mathematische Bildung als auch für die Entwicklung von Denkverfahren überhaupt ist. Schon K.D. USCHINSKI führte aus, daß der Vergleich die Grundlage jeglichen Verstehens und Denkens bildet: "Und sollten wir es einmal mit einem Gegenstand zu tun haben, den wir mit keinem anderen vergleichen oder von keinem anderen zu unterscheiden vermöchten (wenn es einen solchen Gegenstand überhaupt gäbe), dann könnten wir Keinen Gedanken über ihn fassen und kein Wort über ihn aussagen." (USCHINSKI, K.D., 1945, S.448, Zit. bei BOGOJAWLENSKI, D.H. und N.A. MENTSCHINSKAJA, 1962.)Anmerkung: die Bedeutung des Vergleichens scheint in der russischen Psychologie und der Ex-DDR mehr erkannt und erfaßt worden zu sein als in der "westlichen" Psychologie.
Die ausgewählten Aufgaben erforderten neben dem Vergleich das Ordnen und Zuordnen. Nachdem die Gegenstände verglichen wurden, erfolgten verschiedene Tätigkeiten, in denen geordnet und zugeordnet werden mußte.
Die Gegenstände wurden in einer Reihe angeordnet, angefangen z. B. mit dem, der größer als die anderen, bis zu dem, der kleiner als jeder andere war. In verschiedenen Aufgaben wurden die Mengen nach 2 Merkmalen geordnet: Größe, Länge usw. der einzelnen Elemente jeder Menge und Anzahl der Elemente.
Mengen wurden untereinander verglichen und nach der Anzahl der Elemente geordnet. Die natürlichen Zahlen wurden ebenfalls verglichen und in der Folge 1 bis 10 geordnet.
Die Operation des Zuordnens entwickelten wir in ähnlicher Weise. Gleichmächtige oder unterschiedliche Mengen wurden durch das eindeutige umkehrbare Zuordnen der Elemente einer Menge zu den Elementen anderer Mengen verglichen.
Die Aufgaben, die das Bilden von Vereinigungs- und Differenzmengen forderten, gingen auch von dem Vergleichen derAusgangsmenge mit den Teilmengen aus. Auf das Vergleichen stützten sich auch die Aufgaben, die das Bilden von Gleichheiten und Ungleichheiten zum Inhalt hatten."
(3) Denkpsychologie, Gedächtnispsychologie
und Kognitive Psychologie: Oerter, obschon auch Entwicklungspsychologe,
hat im Register seiner Psychologie des Denkens (6. A. 1980) keinen
Registereintrag "vergleichen". Auch im Wörterbuch der Kognitionswissenschaft,
hrsg. von Strube et al. (1996) findet sich ein solcher nicht. Ebenso
nicht in Wessels (dt. 1994) Kognitive Psychologie. Selbst Herbert
Stachowiak erfaßt in seiner "Allgemeinen Modelltheorie" (1973) "vergleichen"
nicht in seinem Register.
(4) Differentielle Psychologie: Erwartungsgemäß
läßt sich bei den Alten [s.a. FN05],
die noch ein richtiges Verständnis von Psychologie hatten, hier bei
William Stern etwas finden. In seiner
Differentiellen Psychologie
(3. A. 1921) weist er auf den Seiten 372-378 ein Kapitel XXV mit der Überschrift
aus: Komparation. Das Handbuch der Psychologie, 4. Bd. Persönlichkeitsforschung
und Persönlichkeitstheorie (1960) weist keinen Eintrag "vergleichen"
auf. Aber Conrad (in Jäger,1988, Hg.) behandelt im Lehrbuch Psychologische
Diagnostik den Begriff "Vergleich", handelt ihn aber erwartungsgemäß
oberflächlich und unkritisch (S.1996) im Kapitel "Diagnostik als Messung"
unter nomothetischer Flagge ab.
(5) Testpsychologie, meßtheoretische Literatur
und Skalierungsmethoden: Im profunden 2-bändigen Handwörterbuch
der pädagogischen Diagnostik, hrsg. von Klauer (1982) weist das Register
keinen Eintrag "vergleichen" auf. Eine "klassische" Skalierungsmethode
von Thurstone, die Methode des Paarvergleichs, enthält unseren Leitbegriff
direkt im Namen der Methode. Die gesamte sog. "klassische Testtheorie"
ist oftmals psychologielos, oberflächlich und unkritisch angewandte
Mathematik und Statistik. Sie könnte auch ebenso in der Agrarwirtschaft
oder in der Biologie eingesetzt werden. Die profunden und fundierten MeßtheoretikerInnen
- obschon auch die einem grundlegenden Mißverständnis der einzelfallpsychologischen
Situation aufsitzen - wie z. B. Orth wissen das auch und schreiben es,
hier in Einführung in die Theorie des Messens (1974, S. 31):
"So wird in der Testtheorie die Annahme einer Intervallskala vorausgesetzt,
wie z.B. bei der Standardisierung von Tests. Diese Annahme kann nicht durch
die einer Normalverteilung der zu messenden Eigenschaft (Variablen) ersetzt
werden". Jedes einigermaßen dem Problem realistisch gegenüberstehende
Meßtheoriebuch sollte mit der Grundlegung einer psychologischen Theorie
des Vergleichens beginnen. So schnell kann man aber meist gar nicht schauen,
wie die in der Regel bei der Mathematik sind; als wären die Fundamente
und Inhalte Furien, vor denen sie sich schleunigst in Sicherheit bringen
müssen. Betrachten wir hierzu einen deutschen 'Klassiker', den Bd.
Messen
und Testen aus der Reihe Forschungsmethoden der Psychologie
aus dem inzwischen wohl schon wieder veralteten Jahrhundertwerk Enzyklopädie
der Psychologie. Auch dieses von Feger und Bredenkamp herausgegebene
814-Seiten Buch enthält im Sachregister den Begriff "vergleichen"
nicht, obwohl ja die moderne Auffassung des Messens nichts anderes als
ein Vergleich zwischen einem empirischem und numerischen Relativ mit dem
Ziel ist, zu zeigen, daß sich aus dem empirischen Relativ das numerische
Relativ abbilden läßt. Sehr psychologisch hört sich
das nicht an und praktisch anwenden kann man diese abstrakten Theoriegebilde
ebenfalls nicht. Die neueren Lehrbücher zur Testtheorie erscheinen
auch weitestgehend psychologielos. Der elementare Sachverhalt, daß
jede Testperson, damit sie valide und angemessen Auskunft geben kann, erst
einmal in sich selbst hineinschauen und mehrfach vergleichen muß,
spielt da nicht die geringste Rolle. So nicht im Lehrbuch Messen und
Testen von Steyer und Eid (1993), nicht im Lehrbuch Testtheorie
und Testkonstruktion von Jürgen Rost (1996), nicht im Lehrbuch
Testkonstruktion
und Testtheorie von Joachim Krauth (1995). In allen drei Werken kommt
"vergleichen" als grundlegende Kategorie nicht vor. Daß jede Art
von psychologischer Messung bei Menschen zunächst einmal eine Messung
der ProbandIn bei sich selbst ist, wird gerade von der Wissenschaft
souverän umgangen, deren ureigendstes Aufgabengebiet es wäre,
dies gründlich zu erforschen und anwendungsfähig zu evaluieren.
Fazit:
Die
elementare kognitive Funktion vergleichen scheint in der
gesamten psychologischen Literatur so gut wie keine Rolle zu spielen. Das
ist fatal, denn wir PraktikerInnen arbeiten nämlich draußen
in der wirklichen Welt, in wirklichen Situationen mit wirklichen Menschen.
Von der Wissenschaft erhalten wir so gut wie keine Unterstützung.
Zu was brauchen wir sie dann? Zum bestimmen, bevormunden und supervidieren
lassen?
Querverweis: Testtheorie der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie.
FN02. Mathematik und Logik: So sehr ich die Mathematik schätze und bewundere, so erscheint sie andererseits oft ebenso weitgehend unverständlich. Sobald sich MathematikerInnen eines Sachverhalts bemächtigen, ist er für mich bereits nach wenigen Sätzen völlig unverständlich geworden und gelegentlich hat es den Anschein, als ob die MathematikerInnen in der Kunst, das Trivialste unendlich kompliziert auszudrücken, MeisterInnen wären. Andererseits ist vielleicht das scheinbar Einfachste oft das Schwierigste, z. B. die angemessene Beantwortung der Frage: was ist eine "Zahl"?
FN03 Für die Test- und Befindlichkeits- Skalen- Konstruktion entstehen hier große Probleme, die im allgemeinen in den Testtheoriebüchern - das wäre denn doch zu inhaltlich, relevant und realistisch - nicht abgehandelt werden. Die Skalierung der Befindlichkeit ist außerordentlich schwierig, weil hier sehr viele Faktoren eine Rolle spielen. Im Grunde wurde bei den meisten Befindlichkeitsskalen nie geprüft, was sie eigentlich genau "messen". Das Validitätsproblem ist weitgehend ungelöst und so lange der Oberflächenempirismus und die numerologischen SzientistInnen das Sagen in der Wissenschaft haben, wird sich daran auch nicht viel ändern.
FN04: Vgl. bitte:
Die
kombinatorische Variablen-Vielfalt in der wirklichen Welt.
Die
grundlegende Forschungsaporie der Heilmittelprüfung
FN05 Eine Umschau bei Eisler, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, vgl. Eisler-Begriffe Bd. 2, S. 627 ff., S. 3761 ff., hier aus der Digitalen Bibliothek Band 3: Geschichte der Philosophie, S. 16023], ergab folgenden nicht nur historisch interessanten Eintrag zum Begriff Vergleichung, wie das von den Alten genannt wurde, vgl. auch "Vergleichung", in Fr. Giese (1920). Psychologisches Wörterbuch. Leipzig: Teunber. Hier aus Eisler:
"Vergleichung ist die Findung, Constatierung von Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten durch Apperception (s. d.) zweier Inhalte. Sie ist eine ursprüngliche Function der Aufmerksamkeit, kommt in einem Urteil zum Ausdruck, ist durch Gefühle bedingt. Auf der Grundlage identischer Reaction des eigenen Ich gegenüber den Reizen (s. d.) setzt das Denken Eindrücke, Inhalte als »gleich«, »ähnlich« oder als »ungleich«, »verschieden« (s. Unterscheidung). Sowohl für die Classification der Qualitäten als auch für die quantitative Messung ist der Act des Vergleichens Grundbedingung. er ist eine Quelle von Kategorien (s.d.). Vgl. Abstraction, Begriff, Urteil.Literatur/Monographien zum Vergleichen
BONET definiert: »Comparer différentes sensations, c'est donner son attention à differentes sensations.Mais l'attention est un exercice de la force motrice de l'âme et cet exercice est une modification de son activité. Comparer, c'est donc mouvoir, et mouvoir, c'est agir« (Ess. analyt. XVII, 361). Auf die Aufmerksamkeit führt das Vergleichen und Beziehen auch LAROMIGUIÈRE zurück (Leçons de hilos.).
Nach H. S. REIMARUS ist Vergleichen »nichts anderes, als sich bemühen einzusetzen, ob und wie weit Dinge miteinander einerlei sind oder nicht. und wenn sie nicht einerlei sind, ob und wie weit sie sich widersprechen oder nicht« (Vernunftlehre, § 12). Nach FRIES ist Vergleichung »das Bewußtsein vom Verhältnis mehrerer Vorstellungen zueinander« (Syst.d. Log. S. 92). Die allgemeinsten »Vergleichungsbegriffe« beruhen auf Einheitsvorstellungen (l. c. S. 99).Nach CALKER ist Vergleichung »das gleichzeitige Zusammenfassen mehrerer Vorstellungen und die Wahrnehmung des Ähnlichen und Gleichen in denselben« (Denklehre S. 270). SUABEDISSEN bestimmt: »Das Vergleichen ist ein vervielfachtes Aufwerken, mit dem Zwecke, das, was in mehrerem einerlei und was darin verschieden ist, zu bemerken« (Grdz. d. Lehre von d. Mensch. S. 114). ULRICI bemerkt: »Zwei Dinge vergleichen, heißt nur für das Bewußtsein feststellen, in welchen Beziehungen zu unterschieden, in welchen dagegen gleich seien« (Log. S. 137). Nach HÖFFDING heißt Vergleichen »Ähnlichkeiten oder Unterschiede oder beides finden« (Üb. Wiedererk., Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. 14. Bd., S. 194). Nach SULLY ist das Vergleichen (comparison) zweier Dinge »ein Entdecken durch geistiges Beleuchten derselben der Reihe nach, ob sie sich und in welchen Beziehungen sie sich ähnlich sind oder voneinander unterscheiden«. Die Vergleichung ist »das aufeinander folgende Richten der Aufmerksamkeit auf zwei (oder mehrere) Wahrnehmungen oder Vorstellungen, um zu sehen, in welchen Beziehungen dieselben stehen« (Handb. d. Psychol. S. 236 f.. Hum. Mind ch. 11. vgl. STOUT, Analyt. Psychol. II, ch. 9 f., p. 168 ff.. W. JAMES, Princ. of Psychol. I, 483 ff.. BRADLEY, On the analysis of Comparison, Mind XI, 1886, p. 83 ff.. RIBOT, L'évolut. des idées général., u. a.). Nach OSTWALD ist das Vergleichen die grundlegende Eigenschaft des Geistes (Vorles. üb. Naturphilos.2, S. 17). Nach WUNDT ist die Vergleichung eine »einfache Apperceptionsfunction«. Die Beziehung (s. d.) verbindet sich mit der Vergleichung, »sobald die aufeinander bezogenen Bewußtseinsinhalte deutlich gesonderte Vorgänge sind, die zugleich einer und derselben Klasse psychischer Erlebnisse angehören«. »Die Beziehung ist demnach der weitere, die Vergleichung der engere Begriff. Eine Vergleichung ist nur dadurch möglich, daß die verglichenen Inhalte zueinander in Beziehung gebracht werden. Dagegen können Bewußtseinsinhalte aufeinander bezogen werden..., ohne daß sie miteinander verglichen werden« (Gr. d. Psychol.5, S. 304). Die Vergleichung setzt sich aus der Function der Übereinstimmung und der der Unterscheidung (s. d.) zusammen (l. c. S. 305. vgl. Empfindung, Intensität, Qualität). Logisch ist Vergleichung Verbindung des Ähnlichen und Unterscheidung des Widerstreitenden. Es gibt individuelle und generische Vergleichung. Die vergleichende Methode besteht darin, »daß die vergleichende Beobachtung, die Sammlung übereinstimmen der Erscheinungen und die Abstufung der nicht übereinstimmen den nach den Graden ihres Unterschieds zur Gewinnung allgemeiner Ergebnisse benützt wird« (Log. II, 280 ff.). - R. AVENARIUS erklärt: »Treffen zwei E- Werte (s. d.) zusammen unter Hinzutritt der 'erwarteten' und 'gesuchten' 'Gleichheit', so nimmt das 'Denken' seinerseits die bestimmte Modification des 'Vergleichens' an« (Krit. d. rein. Erfahr. II, 99). Vgl. Unterscheidung, Ähnlichkeit, Gleichheit, Methoden (psychophysische), Wiedererkennen."
_
Änderungen, Nachträge und Ergänzungen
22.04.05 Aufnahme: Jacobs, Alfred (1957). Der internationale Vergleich der Lebenshaltungsksoten.
26.11.04 Aufnahme: Brunswig, A. (1910). Das Vergleichen und die Relationserkenntnis. Leipzig: Teubner.
30.01.04 Aufnahme: Link Titelblatt und Inhaltsverzeichnis zu Georg Katonas Psychologie der Relationserfassung ...
31.08.03 Ich danke Herrn U. Frick für den folgenden wichtigen Literaturhinweis aus dem Bereich gestaltpsychologischer Forschung: Katona, Georg (1924). Psychologie der Relationserfassung und des Vergleichens. Leipzig: Barth. Ich werde nach Einsichtnahme über das Werk berichten.
L-Nachtrag-2: Hensel, K. Paul (1977). Systemvergleich als Aufgabe. Stuttgart: G. Fischer.
L-Nachtrag-1: Berstecher, Dieter (1970). Zur Theorie und Technik des internationalen Vergleichs. Texte und Dokumente zur Bildungsforschung. Stuttgart: Klett.
Zitierung
Sponsel, R. (DAS). Allgemeine Theorie und Praxis des Vergleichens und der Vergleichbarkeit. Grundlagen einer psychologischen Meßtheorie. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/verglbk0.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. In Streitfällen gilt der Gerichtsstand Erlangen als akzeptiert.