(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=03.10.2018 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 01.01.20
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_LLautes Denken Duncker 1935_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Bereich Denkpsychologie, und hier speziell zum Thema:
Protokolliertes lautes Denken
bei Duncker (1935)
Zur Haupt-
und Verteilerseite Protokolliertes Denken.
Ausgelagert von der Hauptseite
Denken (Kap 4.3.2).
Originalarbeit von Rudolf
Sponsel, Erlangen
_
Duncker Lautes Denken (1935)
S. 2: "§ 2. Versuchsverfahren.
Die Experimente gingen so vor sich: den Versuchspersonen (Vpn) — im allgemeinen
waren es Studenten oder Gymnasiasten — wurden allerlei Denkaufgaben gestellt
mit der Bitte, laut zu denken. Diese Instruktion „laut denken“ ist
nicht identisch mit. der bei Denkexperimenten sonst üblichen Aufforderung
zur Selbstbeobachtung. Während der Selbstbeobachtende sich selbst
als Denkenden zum Gegenstand macht, also — der Intention nach — verschieden
vom denkenden Subjekt ist, bleibt der laut Denkende unmittelbar auf die
Sache gerichtet, läßt sie nur gleichsam „zu Worte kommen“. Wenn
jemand beim Nachdenken unwillkürlich vor sich hin spricht „da müßte
man doch einmal zusehen, ob nicht ...oder „es wäre schön, wenn
man zeigen könnte, daß ....“, so wird man das nicht „Selbstbeobachtung“
nennen wollen; und doch zeichnet sich in solchen Äußerungen
das ab, was wir weiter unten als „Entwicklung des Problems“ kennen lernen
werden. — Die Versuchsperson (Vp) wurde nachdrücklich ermahnt, keine
noch so flüchtigen oder törichten Einfälle unverlautbart
zu lassen. Wo sie nicht hinreichend orientiert zu sein glaube, dürfe
sie ruhig Fragen an den Versuchsleiter (VI) richten. Doch seien an und
für sich zur Lösung der Aufgaben keine speziellen Vorkenntnisse
nötig.
_
§
3. Ein Protokoll der „Bestrahlungs“aufgabe. Beginnen wir mit der „Bestrahlungs“aufgabe
(S. 1). Gewöhnlich wurde dieser Aufgabe die in Abb. 1 abgebildete
schematische Skizze beigegeben.
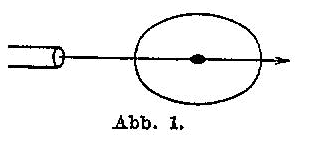
So etwa habe sich’s jemand im allerersten Moment vorgestellt (Querschnitt
durch den Körper, in der Mitte die Geschwulst, links der Strahlenapparat).
Aber so ginge es ja offenbar nicht.
Aus den mir vorliegenden Protokollen wähle
ich das eines Lösungsprozesses, der an typischen Einfällen besonders
reich, dafür aber auch besonders lang und umständlich war. (Der
durchschnittliche Prozeß verlief weniger unstet und konnte erheblich
mehr sich selbst überlassen bleiben.) ,
Protokoll:
2. Die gesunden Gewebe durch chemische Einspritzung unempfindlich machen.
3. Freilegen der Geschwulst durch Operation.
4. Man müßte die Strahlenintensität unterwegs herabsetzen, z. B. — ginge das ? — die Strahlen erst dann voll einschalten, wenn die Geschwulst erreicht ist (VI: falsches Modell, ist doch keine Spritze).
5. Etwas Unorganisches (Strahlenundurchlässiges) zu sich nehmen zum Schutz der gesunden Magenwände (VI: es sind nicht bloß die Magenwände zu schützen).
6. Entweder müssen doch die Strahlen in den Körper hinein oder aber die Geschwulst muß heraus. — Man könnte vielleicht den Ort der Geschwulst ändern, aber wie ? Durch Druck ? Nein.
7. Eine Kanüle einsetzen. — (VI: Was tut man denn ganz allgemein, wenn man mit irgend einem Agens an einer bestimmten Stelle einen Effekt erzielen will, den man auf dem Weg bis zu jener Stelle vermeiden möchte ?)
8. (Antwort): Man neutralisiert unterwegs. Das habe ich aber schon die ganze Zeit versucht.
9. Die Geschwulst nach außen bewegen (vgl. 6). (Der VI wiederholt die Aufgabe und betont „bei genügend großer Intensität“.)
10. Die Intensität müßte verändert werden können (vgl. 4).
11. Abhärtung des gesunden Körpers durch vorausgehende schwache Bestrahlung. (VI: Wie ließe sich erreichen, daß die Strahlen nur das Gebiet der Geschwulst zerstören?)
12. (Antwort): Sehe eben nur zwei Möglichkeiten: entweder den Körper schützen oder die Strahlen unschädlich machen. (VI: Wie könnte man die Intensität unterwegs herabsetzen? [Vgl. 4]).
13. (Antwort): Irgendwie ablenken — diffuse Strahlung — zerstreuen — halt: ein breites und schwaches Strahlenbündel so durch eine Linse schicken, daß die Geschwulst in den Brennpunkt und also unter intensive Bestrahlung fällt . (Gesamtdauer etwa 1/2 Stunde.)
§ 4. Nichtpraktikable „Lösungen“.
Aus dem mitgeteilten. Protokoll ist zunächst einmal folgendes zu ersehen:
der ganze Prozeß, wie er von der ursprünglichen Problemstellung
zur endgültigen Lösung führt, stellt sich dar als eine Reihe
mehr oder weniger konkreter Lösungsvorschläge. Praktikabel (wenigstens
dem Prinzip nach) ist allerdings nur der letzte. Alle vorausgehenden werden
dem Problem in irgendeiner Hinsicht nicht gerecht, weswegen der Lösungsprozeß
bei ihnen nicht halt machen kann. Sie mögen nun aber noch so primitiv
sein, das eine ist sicher, von sinnlosen, blinden „Probierreaktionen“ kann
dabei keine Rede sein. Nehmen wir z. B. den ersten Vorschlag: „die Strahlen
durch die Speiseröhre schicken“. Der Sinn dieses Vorschlags ist klar.
Die Strahlen sollen über einen gewebefreien Weg in den Magen geleitet
werden. Nur liegt dem Vorschlag offensichtlich ein unzutreffendes Modell
der Situation zugrunde (als ob die Strahlen eine Art Flüssigkeit wären,
als ob die Speise-[>4]röhre einen gradlinigen Zugang zum Magen darstellte
usw.). Jedoch — innerhalb dieses gewissermaßen versimpelten Situationsmodells
wäre der Vorschlag eine wirkliche Erfüllung der Aufgabeforderung.
Er ist also in der Tat die Lösung eines Problems, nur freilich nicht
des faktisch gestellten. — Ähnlich verhält es sich mit den übrigen
Vorschlägen. Der zweite setzt voraus, es gäbe ein — z. B. chemisches
— Mittel, organische Gewebe für die Strahlen unempfindlich zu machen.
Gäbe es so etwas, dann wäre alles in Ordnung und der Lösungsprozeß
schon hier zu Ende. Auch der vierte Vorschlag (die Strahlen erst voll einschalten,
wenn die Geschwulst erreicht ist), zeigt sehr deutlich seine Abkunft von
einem falschen Modell, etwa dem einer Spritze, die erst nach Einführung
in das Injektionsobjekt in Tätigkeit gesetzt wird. Der sechste Vorschlag
schließlich behandelt den Körper gar zu sehr nach Analogie eines
Gummiballs, der sich ohne Schaden deformieren läßt. — Kurz,
man sieht, solche Vorschläge sind alles andere als völlig sinnlose
Einfälle. Nur in der faktisch vorliegenden Situation scheitern sie
an gewissen vorher noch nicht bekannten bzw. beachteten Situationsmomenten.
— Manchmal ist es nicht so sehr die Situation wie die Forderung, auf deren
Entstellung, Versimpelung die praktische Untauglichkeit eines Vorschlags
beruht. Beim dritten Vorschlag z. B. („Freilegung der Geschwulst durch
Operation“) scheint dem Denkenden abhanden gekommen zu sein, wozu die Strahlentherapie
eigentlich eingeführt wurde. Eine Operation sollte ja gerade vermieden
werden. Ähnlich wird im fünften Vorschlag vergessen, daß
ja nicht nur die gesunden Magenwände, sondern der ganze von den Strahlen
durchquerte gesunde Körper zu schützen ist.
Hier dürfte eine prinzipielle Bemerkung am
Platze sein. Den nach der Lösungsentstehung und nicht nach dem Wissensschatz
fragenden Psychologen interessiert nicht primär, ob ein Lösungsvorschlag
tatsächlich praktikabel ist, sondern nur, ob er formal, d. h. im Rahmen
der gegebenen Voraussetzungen des Denkenden „praktikabel“ ist. Wenn ein
Ingenieur bei einem Entwurf mit falschen Formeln oder mit nicht-existenten
Materialien rechnet, so kann dieser Entwurf dennoch ebenso klug aus seinen
falschen Voraussetzungen hervorgehen wie ein anderer aus seinen richtigen.
Er kann ihm „denkpsychologisch äquivalent“ sein. Kurz, es kommt uns
darauf an, wie ein Lösungsvorschlag aus dem System seiner subjektiven
Voraussetzungen hervorgeht und diesem gerecht wird
- 2- FN1 Vgl. die einschlägigen Protokolle in meiner
früheren (übrigens theoretisch noch sehr unentwickelten) Arbeit
„A qualitative study of productive thinking“, The Pedagogical Seminary,
Vol. 33, 1926.
3-FN1 Dieser Vorschlag ist eng verwandt mit der „besten“ Lösung: Kreuzung mehrerer schwacher Strahlenbündel in der Geschwulst, so daß nur hier die zur Zerstörung nötige Strahlenintensität erreicht wird. — Daß übrigens die in Frage kommenden Strahlen nicht durch gewöhnliche „Linsen“ gebrochen werden, ist ebenso wahr wie für uns (denkpsychologisch) belanglos. Vgl. u. § 4."
Duncker ueber Protokolle (S. 12 f)
"Hier ist der Ort, um einiges Grundsätzliche über Protokolle zu sagen. Ein Protokoll ist — so könnte man es formulieren — nur für das, was es positiv enthält, einigermaßen zuverlässig, nicht dagegen für das, was in ihm fehlt. Denn auch das gutwilligste Protokoll ist nur eine höchst lückenhafte Registrierung dessen, was wirklich geschieht. Die Gründe für diese Unzulänglichkeit eines auf lautem Denken beruhenden Protokolles interessieren uns gleichzeitig als Eigenschaften des Lösungsgeschehens. Häufig werden vermittelnde Lösungsphasen dort nicht extra zu Protokoll gegeben, wo sie sofort ihre konkrete Endgestalt finden, wo also zwischen ihnen und ihren Endlösungen keine deutliche Phasengrenze besteht. Sie verschmelzen dann zu sehr mit ihren Endlösungen. Dort hingegen, wo sie eine Weile lang als Aufgaben existieren müssen, ehe sie ihre endgültige „Anwendung“ auf die Situation finden, sind die Chancen für ihre Verlautbarung größer. — Ferner treten viele übergeordnete Phasen deshalb nicht im Protokoll auf, weil die Situation dem Denkenden nicht versprechend genug für sie ausschaut. Sie werden deshalb sofort wieder zurückgezogen. M. a. W. sie sind zu flüchtig, zu provisorisch, zu tastend, u. U. auch zu „töricht“, um über die Schwelle des gesprochenen Wortes zu treten. — In sehr vielen Fällen werden vermittelnde Phasen deswegen nicht genannt, weil die Vp gar nicht merkt, wie sie die ursprüngliche Problemforderung bereits modifiziert hat. Sie hat gar nicht das Gefühl, bereits einen Schritt zurückgelegt zu haben — so selbstverständlich kommt ihr die Sache vor. (Dies ist besonders bei ,,Bereichbestimmungen“ der Fall, vgl. o. S. 11). Das kann so weit gehen, daß die Vp sich selbst auf eine gefährliche Weise die Bewegungsfreiheit raubt, indem sie unversehens der gestellten eine viel engere Aufgabe unterschiebt und daher im Rahmen dieser engeren Aufgabe verbleibt — eben weil sie sie mit der ursprünglichen verwechselt."
Literatur (Auswahl) > Literaturliste Hauptseite.
Links(Auswahl: beachte)
- Zur Haupt- und Verteilerseite Protokolliertes Denken.
- Hauptseite Denken.
- Überblick Denken in der IP-GIPT.
- Kann die literarische Erzählform "Bewusstseinsstrom" den Bewusstseinsprozess repräsentieren?
- Das Bewusstseinsthema in der IP-GIPT.
Glossar, Anmerkungen und Endnoten: > Eigener wissenschaftlicher Standort.
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Neue Krankheiten Blech, Jörg (2003). Die Krankheitserfinder: Wie wir zu Patienten gemacht werden. Frankfurt: S. Fischer.
__
Standort: Lautes Denken Duncker.
*
Hauptseite Denken.
Überblick Denken in der IP-GIPT.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Inhaltsverzeichnis site: www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Protokolliertes lautes Denken Duncker 1935. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/allpsy/denk/DPr_Duncker.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet. Zitate und Links sind natürlich erwünscht.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert: irs 03.10.2018
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
03.10.18 Nach einigen Tagen Vorarbeit eingestellt.