(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=08.09.2003 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 02.09.23
Impressum: Diplom-Psychologe und Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail: sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang _Beweis in PPP_Datenschutz_Überblick_Rel. Aktuelles _Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_Service_iec-verlag__Wichtiger Hinweis zu Links und zu Empfehlungen
Beweis und beweisen in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie
Blicke über den Zaun zum Auftakt für eine integrative
psychologisch-psychotherapeutische Beweislehre
aus allgemein integrativer psychologisch-psychotherapeutischer
und einheitswissenschaftlicher
Sicht
Einführung, Überblick, Verteilerseite Beweis und beweisen
von Rudolf Sponsel, Erlangen
Hinweis: Wenn nicht ersichtlich werden (Externe Links) in runden und [interne IP-GIPT Links] in eckige Klammern gesetzt, direkte Links im Text auf derselben Seite sind direkt gekennzeichnet. In dieser Übersichtsarbeit wird das Thema im Überblick gesamtheitlich aus einheitswissenschaftlicher Perspektive dargestellt. Im Laufe der Zeit folgen weitere Ausarbeitungen. Ausarbeitungsgrad 1-(2)
Inhaltsübersicht
- Einstieg Beweis und beweisen in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie mit einigen Einstiegs- und Beispielfragen.
- Vorbemerkung zur Begrifflichkeit Psychologie, Psychopathologie und Psychiatrie.
- Das Leib-Seele-Problem und seine Lösung in der allgemein-integrativen Psychologie.
- Einige psychologische Einstiegsfragen.
- Grundlegende psychologische Beweisfragen.
- Allgemeine wissenschaftliche Beweisstruktur und beweisartige Begründungsregel.
- [Beweisparadigma Elementare denkpsychologische Untersuchung des Verstehensprozesses.]
- [VV0 Verstehens-Versuch 0]
- [VV1 Verstehens-Versuch 1 Vorgang verstehen]
- [VV2 Verstehens-Versuch 2 Ursache und Wirkung, Kausalität verstehen.]
- [VV3 Verstehen Versuch 3 wesentlich und unwesentlich unterscheiden lernen]
- Die zentrale Beweisfrage der Psychologie lautet: wie kann eigenes und fremdes Erleben bewiesen werden?
- Das individuelle Erlebensproblem.
- Kennzeichnen des Erlebens.
- Unterscheidung innere Wahrnehmung und Selbstbeobachtung (Wundt 1888).
- Meta-Ich und zweie ICHe-Modell.
- Indizien für Selbstbeobachtungen.
- Erfassen und Verstehen fremden Erlebens.
- Wie ist Kommunikation möglich?
- Paradigmatische Beweismethoden und Beweismittel in der Psychologie.
- Allgemeiner Diagnosenbegriff: Feststellung von Tatsachen.
- (1a) Ein Sachverhalt liegt (nicht) vor ( Tatsache liegt vor bzw. nicht).
- (1b) Ein Sachverhalt liegt (nicht) in dieser oder jener Ausprägung vor.
- Beweis Paradigma Tatsachen-Diagnose.
- Beweis Paradigma Symptom Diagnose.
- Beweis Paradigma Syndrom Diagnose.
- Beweis Paradigma Krankheits-Diagnose.
- Beweis Paradigma Wirkungen der Krankheit.
- Beweis Paradigma Prüfung von Mitteilungen über das Erleben.
- Kommunikations- und Denkebene.
- Gegenbeispiele für nur scheinbare Einwendungen als Ausdruck für ungewöhnliche, kaum glaubliche Ereignisse.
- Umschreibungen emotionaler Ebene (schwer in Worte zu fassen).
- Entstehen von Zweifel und Irritationen.
- Beweis-Paradigma Ausführung nach Aufforderung oder - allgemeiner - Reiz-Reaktions-Schemata.
- Beweis-Paradigma Bio-Aktivitätsspur.
- Beweis-Paradigma Anlage-Umwelt.
- Unterscheidungen im Erleben und die Bewusstseinselemente.
- Überblick über mögliche Bewusstseinsinhalte oder Bewusstseinsfiguren.
- Normierung der verschiedenen Bewusstseinsinhalte oder Bewusstseinsfiguren.
- Praktisch-Systematische und psychotherapiepraxisrelevante Terminologievorschläge.
- Unterscheidung innere Wahrnehmung und Selbstbeobachtung (Wundt 1888).
- Ein 7-Phasen-Modell einfacher Bewusstseinsvorgänge bei freischwebender Aufmerksamkeit.
- Methodische Anleitungsskizze zum 7-Phasen-Modell einfacher Bewusstseinsvorgänge:
- (1) Freischwebende Aufmerksamkeit.
- (2) Bemerken, abrufen oder Erzeugen einer Bewusstseinsfigur aus dem Hintergrund oder der Vielfalt der Bewusstseinsinhalte
- (3) Auswählen und Richten der Aufmerksamkeit auf die bemerkte Bewusstseinsfigur, wodurch zugleich ein erstes, grobes Klassifizieren stattfindet.
- (4) Näheres Klären der ausgewählten und grob klassifizierten Bewusstseinsfigur.
- (5) Identifikationsfunktion des Denkens.
- (6) Arbeiten bzw. Weiterarbeiten mit dem identifizierten geistigen Modell (Denkinhalt).
- (7) (Vorläufige) Beendigung und (Zwischen-) Ergebnis der Weiterverarbeitung.
- Die Notwendigkeit international ratifizierter operationaler Normierungen.
- Beweisbeispiele und Sätze der Psychologie:
- Beispiel: Erinnerungsbild und Wiedererkennen (Ziehen 1924).
- Beispiel: Beweis-Versuch Wiedererkennen.
- Beispiel: Sich selbst erkennen.
- Beispiel: Was beweisen die Vergessenskurven von Ebbinghaus ?.
- Beispiel: Was beweist das Milgram Experiment ?
- Beispiel: Was beweist der Zeigarnik-Effekt?
- Beispiel: Was beweist die Ausführung eines posthypnotischen Befehls ?
- Beispiel: Was beweisen die Worte, die ein dreijähriges Kind aussprechen kann ?
- Beispiel: Wie kann man einen "freien Willen" beweisen ?
- Beispiel: [>Differentialdiagnostik zwischen Wunsch und Wille]
- Beweisgrundlagen, -fragen und Beispiele Forensische Psychologie und Psychopathologie.
- (1) Rechtliche und kriminologische Beweisprinzipien und Regeln.
- (2) Zuordnungsproblem Rechtsbegriffe und Bereichsbegriffe.
- (3) Mindestanforderungen an forensisch-wissenschaftliche Gutachten.
- (4) Beweisbeispiele Forensische Psychologie, Psychopathologie und Psychiatrie.
- Beispiel: Wie beweist man, was für eine Bindung ein Kind an Bezugspersonen hat?
- [> Kindeswohl-Kriterien]
- [> Über Bindung, Beziehung und das Messen inder Psychologie.]
- [> Grundprobleme der Bindungsforschung. Eine allgemeine und integrative Forschungshypothese zur Bindung. Bindungsforschung im Internet (Auswahl).]
- [> Bindungs-Paradoxa, pathologische Bindungen und andere nicht ohne weiteres verständliche Bindungserscheinungen - auch im Alltag.]
- Beispiel: [> Zur Psycho-pathologischen Beurteilung der Geschäfts-un-fähigkeit]
- Beispiel: wie beweist man die Glaubhaftigkeit einer Aussage? [> Aussagepsychologie]
- Beispiel: [> Zur Psycho-pathologischen Beurteilung der Geschäfts-un-fähigkeit]
- Beispiel: Wie beweist man, ob im Zeitraum t eine Hörigkeitsbeziehung vorlag ? [> Kommentierte Literaturübersicht Hörigkeit.]
- Beispiel [> Schuld-un-fähigkeit]
- Beispiel [> Einsichtsfähigkeit]
- Beispiel [> Polygraph]
- Beweisbeispiele Psychopathologie.
- Beweisbeispiele Psychotherapie
- Zustand der Psychowissenschaften.
- Literatur.
- Querverweise.
Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen verschiedenen Erlebensstufen.
Überblick der bearbeiteten Themen:
- Überblick der bearbeiteten Beweis-Themen:
Einstieg
Beweis und beweisen in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie
mit einigen Einstiegs- und Beispielfragen
_
(Dedekind Was sind und sollen die Zahlen? 1872, Vorwort erster Satz).
Diese Seite dient der Vorbereitung für die Seiten Sätze der Psychologie, die aus Übersichtsgründen extra angelegt werden. Die Formulierung Sätze der Psychologie sind in Wortlaut und Begriff bewusst der Mathematik entlehnt. Satz heißt: es muss bewiesen werden, sonst bleibt es eine Behauptung, Meinung, Vermutung, Phantasie. Die Seiten Sätze der Psychologie sollen zeigen wie es geht.
Der allgemeine und alltägliche Beweisbegriff
Ein Beweis liefert sicheres und abschließendes Wissen zu einem
Sachverhalt.
Vorbemerkung
zur Begrifflichkeit Psychologie, Psychopathologie und Psychiatrie
Die treffliche Kurzdefinition der Psychologie besagt: Psychologie ist
die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. Die Psychopathologie kann entsprechend
als die Wissenschaft vom gestörten oder kranken Erleben und Verhalten
definiert werden. Historisch gibt es einen medizinischen, psychiatrischen
Zugang zur Psychopathologie und einen in den letzten Jahrzehnten u.a. durch
die Entwicklung der psychologischen Psychotherapie deutlich zugenommenen
psychologisch-psychotherapeutischen, was sich auch durch entsprechende
Kooperation in der Praxis zeigt. Die Voraussetzungen des § 63 wurden
traditionell und in der Hauptsache von (forensischen) PsychiaterInnen bearbeitet,
ihr Anteil dürfte an die 90% liegen mit abnehmender Tendenz, besonders
bei Prognosegutachten. Aber die MedizinerIn ist natürlich immer dann
die HauptansprechpartnerIn, wenn organische Störungen zu untersuchen
oder zu behandeln sind.
Das Leib-Seele-Problem und seine
Lösung in der allgemein-integrativen Psychologie
Seele und Geist sind "nur" eine besondere Perspektive oder Dimension
hochentwickelter körperlicher Organisation, besonders des Gehirns.
Man kann körperliche Vorgänge physikalisch, chemisch, biologisch,
medizinisch oder psychologisch beschreiben. Körperlichkeit ist in
diesem Modell fünfdimensional (> Axiome
I, II, III, ... ). Siehe hierzu bitte weiter: Die
Realität des Psychischen und die Theorie der zwei Welten.
Einige psychologische
Einstiegsfragen
Wie gehts? "Gut." Stimmt das wirklich oder
ist das nur eine oberflächliche Floskel? Wie prüft man das? Man
sollte denken, die Frage: [Wie
geht es Ihnen?] ist ganz einfach. Doch dies täuscht. In dieser
simplen Frage stecken viele Grundprobleme der Psychologie.
Lieben. Ein junger Mensch sieht in den
Medien des öfteren, daß sich zwei näherkommen, Zärtlichkeiten
austauschen und dann sagen, sie liebten sich. Tun sie das wirklich? Was
heißt das lieben? Wie wird das erlebt, gefühlt, erfahren? Wie
unterscheide ich 'echte' Liebe von bloßer Begierde, einem Gesellschaftsspiel
oder von '[Verliebtheit]'?
Vergessen. Ein Mensch beklagt sich,
daß er sich Namen so schwer merken kann? Stimmt das? Und falls es
stimmt, woher rührt das? Und wie könnte es verbessert werden?
Verlegen. Eine andere lästige Variante
des Vergessens - nicht nur, wenn man an [AD-H-D]
leidet - ist das Verlegen wichtiger Gegenstände, wie z.B. Schlüssel,
Brieftasche, Führerschein u.ä. Wie kann man sich das erklären?
Was kann man dagegen tun?
Verlernen. Jemand habe sich durch Lernen
eine Fertigkeit angeeignet und merke zwischenzeitlich, daß diese
Fertigkeit mit mangelnder Anwendung nachläßt. Ist dieses Phänomen
bekannt? Wie kommt es zu diesem 'verlernen'? Warum vergessen Menschen?
Kann dieses Vergessen aufgehalten werden? Wie geht das?
Depressiv. Ein Mensch kommt in die
Therapie, weil, wie er sich ausdrückt, depressiv sei. Was meint er
damit? Wie können wir überprüfen, wie diese Depression erlebt,
erfahren und gelebt wird?
Identität. Woher weiß ich,
wer ich bin und daß ich der bin, der ich schon immer war? Diese Frage
mag idiotisch finden, der noch nie das Problem hatte, an seiner Identität
zu zweifeln und sich darüber noch nie Gedanken machte (muß man
auch nicht). Trotzdem ist Frage, wie es kommt, daß die Menschen sich
als immer dieselben erleben, obschon sie sich doch dauernd verändern
und älter werden, psychologisch sehr interessant und gemahnt sogar
in gewisser Weise an ein [Wunder
II]. Gibt es so etwas wie einen Identitäts-'Chip' im Gehirn, der
z.B. durch eine fortschreitende Alzheimer'sche Erkrankung zerstört
wird? Wie ist das mit der Identität bei posthypnotischen Befehlen,
bei multiplen Persönlichkeiten, dissoziativen Störungen und schizophrenen
"Bewußtseinsspaltungen" (was korrekter Identitätsaufspaltungen
heißen sollte)?
Nicht gewollt. Jemand fährt
einen anderen Menschen tot und sagt, daß er das nicht gewollt habe.
Jemand vergißt einen Termin und entschuldigt sich, dies sei nicht
seine Art, und schon gar nicht seine Absicht gewesen. Nicht-gewollt haben
spielt eine wichtige Rolle im Strafrecht, wenn es um die Frage - verminderter
- Schuldfähigkeit geht. Soll man auch Verantwortung tragen, wenn man
etwas tatsächlich nicht gewollt hat? Gibt es ein [unbewußtes]
Wollen? Und sind wir dafür verantwortlich? Was heißt das? Wie
prüft und beweist man das? Was bedeutet es, zu sagen, wir hätten
einen [freien
Willen]?
Grundlegende psychologische Beweisfragen
Die Psychologie ist eine ziemlich junge Wissenschaft und ihr 'Geburtsjahr' wird gewöhnlich mit 1879 angegeben als Wilhelm Wundt (Arzt, Philosoph, Psychologe) das erste psychologische Laboratorium an der Leipziger Universität - zunächst mit privaten Mitteln - einrichtete.
Wie oben ausgeführt ist die Psychologie die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten (Bühler 1927). Während das Verhalten für sich genommen einfach zu beweisen ist, man beobachtet es oder zeichnet es auf (Video, Film), ist das mit dem Erleben unvergleichlich schwieriger. Hier kann aber der Zusammenhang zwischen Erleben und Verhalten sehr hilfreich und nützlich sein, wie man durch Beispiele einfach verstehen kann. Sagt A etwa zu B: "Hast Du mich gehört?" und B antwortet: "Ja", dann dürfen wir annehmen, B hat A verstanden (seine Frage erlebt) und B hat ein Motiv, A zu antworten, sonst hätte er nicht "Ja" gesagt. Wissen wir noch, was dieser Nachfrage vorausging, A fragte B: "Ist der Kaffee schon fertig?", so wissen wir, dass die Bestätigung, dass B A gehört hat, noch keine Antwort ist. Es steht noch aus ein: "Ja", "Nein", "Ich weiß es nicht", "bald", "gleich" ...
Das Beweisthema spielt in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie grundsätzlich eine vielfältige und schwierige Rolle: vom wissenschaftlichen Beweis psychischer Sachverhalte - z.B. lernen, [fühlen], [wünschen, wollen], [lenken], [bewußt sein], fähig sein = können, vergessen, wahrnehmen - Gesetzmäßig- und Regelhaftigkeiten bis hin zu den Fragen, welche subjektiven Überzeugungsgrade man unterscheiden könnte und sollte und wie man ihre Existenz und Anwendung in Abhängigkeit dieser oder jenen subjektiven Bedingungen beweisen kann? Aber in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird der psychologische Beweis faktisch so gut wie nicht bearbeitet.
Die Probleme einer intersubjektiv kommunizierbaren wissenschaftlichen
Erforschung des Erlebens sind in der Tat objektiv extrem schwierig, so
daß es nicht so verwunderlich ist, daß viele daran scheiterten
und manche verzweifelten - am radikalsten und nachhaltigsten der Behaviorismus,
der sogar versuchte, eine Psychologie ohne Seele und Geist aufzubauen -
ein paradoxer Widerspruch in sich.
Hinzu kommt, dass das Beweisthema in den empirischen
Wissenschaften und ihren Wissenschaftstheorie unangemessen bearbeitet wurden
(> Falsifikationsprinzip,
Induktion).
Dabei kann man die Leitidee allgemeinen Beweisens ganz einfach verstehen:
Vorbild für Beweis und beweisen sind Mathematik und Logik. Das gilt für alle Wissenschaften und natürlich auch für die Psychologie, denn es gibt keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Beweisen in Mathematik oder Logik und den empirischen Wissenschaften. Denn für alle wissenschaftliche Erkenntnis gilt Dedekinds oben zitiertes Prinzip und die allgemeine wissenschaftliche Beweisstruktur. Leider beschäftigt man sich in der Psychologie bislang mehr mit nichtssagenden Signifikanztests oder dubios-läppischen Faktorenanalysen, statt endlich die wissenschaftliche Fundamente zu entwickeln und zu beweisen.
| Wissenschaft [IL] schafft Wissen und dieses hat sie zu beweisen, damit es ein wissenschaftliches Wissen ist, wozu ich aber auch den Alltag und alle Lebensvorgänge rechne. Wissenschaft in diesem Sinne ist nichts Abgehobenes, Fernes, Unverständliches. Wirkliches Wissen sollte einem Laien vermittelbar sein (Laien-Kriterium). Siehe hierzu bitte das Hilbertsche gemeinverständliche Rasiermesser 1900, zu dem auch gut die Einstein zugeschriebene Sentenz passt: "Die meisten Grundideen der Wissenschaft sind an sich einfach und lassen sich in der Regel in einer für jedermann verständlichen Sprache wiedergeben." |
| Allgemeine
wissenschaftliche Beweisstruktur und beweisartige Begründungsregel
(Quelle)
Sie ist einfach - wenn auch nicht einfach durchzuführen - und lautet: Wähle einen Anfang und begründe Schritt für Schritt, wie man vom Anfang (Ende) zur nächsten Stelle bis zum Ende (Anfang) gelangt. Ein Beweis oder eine beweisartige Begründung ist eine Folge von Schritten: A0 => A1 => A2 => .... => Ai .... => An, Zwischen Vorgänger und Nachfolger darf es keine Lücken geben. Es kommt nicht auf die Formalisierung an, sie ist nur eine Erleichterung für die Prüfung. Entscheidend ist, dass jeder Schritt prüfbar nachvollzogen werden kann und dass es keine Lücken gibt. Dies kann man auch methodisches Vorgehen nennen, was nichts anderes heißt, als Schritt für Schritt, ohne Lücken, von Anfang bis Ende, Wege und Mittel zum (Erkenntnis-) Ziel anzugeben . |
LK. Laien-Kriterium. Wünschenswert
ist weiterhin, dass wissenschaftliche Erkenntnisse Laien erklärbar
sein sollten. Psychologisch steckt dahinter: wer einem Laien etwas erklären
kann, sollte es wohl selbst verstanden haben. Siehe
hierzu bitte auch das Hilbertsche
gemeinverständliche Rasiermesser 1900, zu dem auch gut die Einstein
zugeschriebene Sentenz passt: "Die meisten Grundideen der Wissenschaft
sind an sich einfach und lassen sich in der Regel in einer für jedermann
verständlichen Sprache wiedergegeben."
- Behauptung (die man beweisen will) und, falls bewiesen, in einen Satz mündet.
- Axiome, die für den Beweis gebraucht werden
- Schon bewiesene Sätze, auf die man beim Beweis zurückgreift. Satz hat in der Mathematik die Bedeutung, das der in dem Satz ausgedrückte Sachverhalt bewiesen ist.
- Weitere oder sonstige Voraussetzungen, die für den Beweis nötig sind.
- Korrekte Definitionen der Begriffe, die in dem Beweis verwendet werden.
- Schlussregeln, die man beweisen benutzt.
Beispiele Beweisskizzen
Namen bedeutet im folgende nicht nur Eigennamen, sondern allgemeiner,
Namen für Begriffe, die Sachverhalte kennzeichnen, z.B. Hund, Baum,
finster, Angst, ....
Wahrnehmungen identifizieren
- Beispiel: Der Hund des Nachbarn
Satz (Behauptung): Um Wahrnehmungen wieder zu erkennen, bedarf es keiner
Namen für die Wahrnehmungen. Das ist ein ziemlich allgemeiner und
grundlegender Satz. Wie beweist man diesen? Betrachten wir zunächst
das
Beispiel: Um den Hund des Nachbarn als den Hund
des Nachbar zu identifizieren braucht man keine Namen. Man muss nicht wissen
wie der Hund heißt, falls er einen Namen hat.
Axiom: es gibt Wahrnehmungen
Voraussetzungen:
- das Wahrnehmungssystem ist intakt und funktioniert.
- Es gibt den Hund des Nachbarn.
- Der Wahrnehmende hat den Hund des Nachbarn mehrfach gesehen.
- Der Wahrnehmende sieht den Hund des Nachbarn.
- Man braucht eine Präsentationssituation.
- Man braucht eine Prüffrage zum Wiedererkennen, z.B. zu wem gehört dieser Hund, den Sie gerade gesehen haben?
Anmerkung: Ein starkes Indiz, dass man zum wahrnehmenden Identifizieren keine Sprache braucht (ausgenommen die Sprache des Geistes: das Denken), sind die Tiere in der Natur, die sich ihrer Umgebung ja orientieren müssen, um zu überleben.
Namen fuer Erlebenssachverhalte
Voraussetzung für das Sprechen ueber sein Erleben
Satz (Behauptung): Um über sein Erleben zu sprechen, braucht man
Namen, die Erlebenssachverhalte beschreiben. Hier kann man fragen, ob diese
Behauptung nicht allgemein für alles Sprechen gilt. Wenn das so wäre,
dann gälte es natürlich auch für das Sprechen über
Sachverhalte des Erlebens.
Erlebenssachverhalte
verstehen
heißt ihre Namen und Bedeutung kennen
Satz (Behauptung): Damit man von anderen in Bezug auf Mitteilungen
seines Erlebens verstanden wird, müssen diese die Namen der Erlebenssachverhalte
und ihre Bedeutung kennen. In der Regel muss das zumindestest in wissenschaftlichen
Zusammenhängen geprüft werden, eine uralte, aber immer noch aktuelle
und gültige Forderung
von Aristoteles. Im Alltag versteht man sich meistens - oder
glaubt es zumindest (> Die
Sicherung des Verstehens zum Zwecke forschender Kommunikation).
Die zentrale
Beweisfrage der Psychologie lautet: wie kann eigenes und fremdes Erleben
bewiesen werden?
Weitere, sich daraus ergebende Fragen betreffen den Existenzbeweis
der elementaren psychologischen Erlebenselemente: erleben von wahrnehmen,
erleben von empfinden, erleben von wünschen, erleben
von denken, erleben von erinnern, erleben von vorstellen,
erleben von fantasieren, erleben von fühlen, erleben
von Stimmung, erleben von Befindlichkeit und Verfassung,
erleben von Ruhe und Bewegung, erleben von Lage und
Gleichgewicht,
erleben von Konflikt, erleben von Bedürfnissen,
Absichten,
Zielen
und Plänen, erleben des Abwägens, erleben des Entscheidens
und Entschließens, erleben des Wollens und des Handelns,
erleben der eigenen Identität, erleben der eigenen Fähigkeiten
und Fertigkeiten, erleben des Verhaltens ...
Im engen Zusammenhang mit dem Erleben der Menschen
steht die Beweisfrage, wie dieses Erleben biologisch fundiert ist bzw.
in welchem Zusammenhang das Seelisch-Geistige mit dem Biologischen steht?
Sind es "nur" zwei Erscheinungsformen ein- und desselben? Erleben oder
allgemeiner das Leben ist an den Körper, an die Materie gebunden,
genauer an den Leib als beseelter Körper. Ist der Mensch tot, ist
sein Er-Leben und sein Leben erloschen.
Ist das Erleben "nur" eine besondere Ausdrucksform
oder Funktion biologischer Organisation oder wird durch die biologische
Organisation eine "eigene", psychologische
Welt
erzeugt? Wie soll man sich diese vorstellen? Und was heißt eine "eigene"
Welt? Geistesgeschichtlich ist hier das sog. Leib-Seele-Problem angesprochen.
In welcher Beziehung stünde diese "eigene psychologische" Welt zur
biologischen Welt?
Die Grundprobleme der Erlebenspsychologie sind einfach
zu formulieren, aber sehr schwierig zu lösen.
Das individuelle Erlebensproblem
Wie erfahre, erkenne, bemerke ich mein Erleben?
- Das Erleben ist sehr unscharf und flüchtig,
- Sobald wir uns Erlebensinhalten zuwenden, werden diese durch eben diese Zuwendung beeinflusst und verändert.
- Der zweite Punkt bedeutet ein Spaltungs-Modell vom Typ Erlebender und Beobachter in einem. Die bewusste Reflexionsmöglichkeit, sein eigenes Erleben zum Gegenstand einer Betrachtung zu machen, beinhaltet sowohl eine Spaltung als auch (mindestens) einen 2-Ebenenprozess (multi-tasking Typ 2).
- Wie kann ich selber sicher sein über mein Erleben? Hier wird einerseits angesprochen das Identitätsproblem und anderseits das Icherleben, das in der Psychopathologie und bei manchen Störungen eine wichtige Rolle spielen kann. Es kommt aber auch im psychologischen Normal- oder Grenzbereich vor, wenn sich z.B. jemand fragt: "wer bin ich eigentlich?" oder "Was will ich eigentlich?" Hier ist dann das Selbstbewusstsein im psychologisch engeren Sinne angesprochen.
Unterscheidung
innere Wahrnehmung und Selbstbeobachtung (Wundt 1888)
Ein allgemeines Hauptproblem der Erlebens- wie speziell auch der
Denkforschung
ist, dass Erleben und Denken teilweise nicht bewusst, schwer genau wahrzunehmen,
unscharf und flüchtig und meist schnell erfolgt. Geht man von einer
Bewusstseinseinheit aus, die Frage scheint mir wissenschaftlich noch nicht
geklärt, scheint es zudem so als wäre es nicht möglich zu
erleben und zugleich dieses Erleben meta-zu-erleben, was sowohl
eine Spaltung (Objekt- und Metaebene) als auch Erkennensprozesse voraussetzt.
Das ist der Kern des alten und im Prinzip noch aktuellen Streites um die
Introspektion: wie kann Selbstbeobachtung möglich sein? Die innere
Wahrnehmung ist das Fundament der Psychologie, wie schon Wundt 1888 - in
Selbstbeobachtung
und innere Wahrnehmung - eine Auseinandersetzung mit Volkelt - in Philosophische
Studien 4, S. 299. - sehr deutlich gemacht hat:
- „Es braucht ja die innere Wahrnehmung darum, weil man ihr die wesentlichen
Eigenthümlichkeiten der Beobachtung abspricht, deshalb noch nicht
niedrig gestellt oder verächtlich behandelt zu werden. Letzteres wäre
gewiss um so weniger gerechtfertigt, weil, vor allem in der vorhin beschriebenen
Verbindung mit der Reproduction, die innere Wahrnehmung nicht nur ein unerlässliches
Hülfsmittel, sondern sogar das Fundament der ganzen Psychologie ist..“
Ich halte fest: Wundt sieht die Fähigkeit der inneren Wahrnehmung
als Fundament der ganzen Psychologie. Direkte Beobachtung des eigenen Erlebens
hält Wundt nicht für möglich. Aber es gibt die Möglichkeit
über das kurzfristige Erinnern eine Selbstbeobachtung zu konstruieren.
Erleben -> innere Wahrnehmung -> merken -> erinnern als Selbstbeobachtung.
Grundsätzlich muss aber auch noch untersucht werden, ob nicht ein
Meta-Ich
und damit zwei ICHe denkbar und und vielleicht auch möglich sind.
Damit wäre die Selbstbeobachtungsfrage einfach gelöst: Das Meta-Ich
beobachtet in diesem Modell das ICH-Erleben.
Meta-Ich und zweie ICHe-Modell
Aus der Technik, aber auch aus der Biologie wissen wir: es gibt Vorgänge
und ihre Beobachtung Kontrolle (Regelungstechnik, Steuerungstechnik). So
gesehen sollten problemlos zwei Ich-Systeme, ein Ich des Erlebens und ein
Meta-Ich, das dieses Erleben beobachtet und kontrolliert, gedacht werden
können.
Indizien für Selbstbeobachtungen
Es gibt einige gute Gründe aus unser aller Alltagserleben
für die Möglichkeit, dass es meta-erleben und -denken gibt: Wir
scheinen nämlich - wenigstens gelegentlich - zu merken:
- ob wir richtig denken oder nicht, wir halten dann inne und prüfen
- ob wir an einem Problem hängen, ob wir vorwärts kommen oder nicht,
- ob wir noch bei der Sache oder einer Ablenkung gefolgt sind
Das alles sind Metaphänomene. Aber es ist nicht ganz klar:
stellen diese sich nach dem Erlebensvorgang ein oder schon während
des
Erlebens. Beide Varianten gibt es wohl. Eine andere Möglichkeit ist,
dass das Bewusstsein aus mehreren hierarchischen Ebenen besteht oder dass
es mehrgleisiges erleben und denken ("multi-thinking" analog "multi-tasking")
gehen kann, obschon wir durch die Hypnoseforschung und Hypnosepraxis eigentlich
darauf eingestellt sein sollten, dass das Bewusstsein mehrere Formen annehmen
kann und mehrere Ebenen oder Schichten hat. Auch das Phänomen mehrfach
in- oder hintereinandergeschachtelter Erlebnisketten geht in die genannte
Richtung: ich nehme wahr - ich denke über die Wahrnehmung nach - ich
nehme wahr, was ich denke - ich denke weiter - ich merke ich komme nicht
vorwärts. Was ist das, wenn ich wahrnehme, was ich denke oder eröffnet
diese Frage nur ein neues Scheinproblem?
Anmerkung: das grundsätzlichere erkenntnistheoretisch-existenzielle Problem sei nur am Rande erwähnt: Die Frage, 'bin' ich, weil ich denke und zweifeln kann? ([Descartes]), beschäftigte jahrtausende lang die Philosophen, die es allerdings ganz überwiegend am Schreibtisch und durch nachdenken zu lösen versuchten und wahrscheinlich schon deshalb scheitern mußten. Denn Wissenschaft treiben ist ein dialogischer, kommunikativer, interaktiver und handlungsorientierter Prozeß mit Kommunizieren von beobachten, experimentieren, dokumentieren und vorhersagen, um Tatsachen, Gesetz- und Regelhaftigkeiten zu finden, zu bestätigen oder zu verwerfen.
Anmerkung: [> Beweis,
daß Empfindungen eine eigene Erlebniskategorie sind und nichts mit
denken zu tun haben]
Erfassen und Verstehen fremden Erlebens
- Die Grundfrage lautet: wie funktioniert verstehen fremden Erlebens? Im Grunde gibt es bislang keinen exakten Zugang zum subjektiven fremden Erleben: was im anderen letztlich und wirklich vorgeht, ist uns - derzeit - nur ungefähr erschließ-, nach- und miterlebbar mit allen objektiven Schwierigkeiten und Fehlermöglichkeiten, die dieser Sachverhalt und die Sprache, die ihn zu erfassen sucht, mit sich bringen.
- Unmittelbar an die Grundfrage ergibt sich: Wie kann ich sicher sein über fremdes, mitgeteiltes Erleben? Wie kann fremdes Erleben evaluiert und bewiesen werden? Das ist z.B. sehr wichtig in der Psychodiagnostik, Psychotherapie und in der forensischen Psychopathologie.
Rudolf Carnaps Analyse der
Zugangswege zum fremden Erleben.
In seinem berühmten Büchlein Scheinprobleme in der Philosophie.
Das Fremdpsychische und der Realismusstreit, erste Auflage 1928 (2.
1962) analysiert Carnap die Bedingungen und Möglichkeiten einer Erkenntnis
des Fremdpsychischen:
"Die folgenden Überlegungen sollen den Nachweis für die These führen: der erkenntnistheoretische Kern jeder konkreten Erkenntnis von Fremdpsychischem besteht ans Wahrnehmungen von Physischem; oder: das Fremdpsychische tritt nur als (erkenntnistheoretischer) Nebenteil von Physischem auf. Zum Zwecke dieses Nachweises ist zunächst eine logische Zerlegung, dann die erkenntnistheoretische Zerlegung vorzunehmen.
Wenn ich ein "Wissen um ein konkretes Fremdpsychisches habe, d. h. um bestimmte Bewußtseinsvorgänge (oder auch Unbewußtes) eines anderen Subjektes A, so kann ich dieses Wissen auf verschiedene Weise erworben haben. Erstens erfahre ich Fremdpsychisches, wenn A mir seine Bewußtseinsvorgänge mitteilt (mein Erlebnis dabei heiße E1); ferner aber auch ohne Mitteilung, wenn ich Ausdrucksbewegungen (Mienen, Gesten) oder Handlungen des A wahrnehme (E2). Zuweilen kann ich auch (vermutungsweise) ein Wissen um die Bewußtseinsvorgänge des A haben, wenn ich seinen Charakter kenne und außerdem weiß, unter welche äußeren Bedingungen er jetzt geraten ist (E3). Einen anderen Weg zur Erkennung von Fremdpsychischem gibt es nicht. (Von der Telepathie sei hier abgesehen, da sie zumindest [>32] im wissenschaftlichen Verfahren nicht als Erkenntnismittel für Fremdpsychisches angewendet wird.)"
Carnap bestimmt damit aber nur grob die Bedingungen und Möglichkeiten.
Ungeklärt bleibt die praktisch wichtige und entscheidende Frage richtiger
Interpretation und Verständigung. Die Frage bleibt: wie ist - wechselseitiges
- verstehen möglich? Was genau heißt verstehen? Und wie lässt
sich verstehen evaluieren, absichern?
Wie ist Kommunikation möglich ?
Vorbereitender Exkurs
Homonyme:
Die Worte können metaphorisch als die Kleider der Begriffe
angesehen werden. Begriffe sind Merkmalseinheiten oder Bedeutungen. Bei
psychologisch strenger Betrachtung hat ein Wort so viele unterschiedliche
Begriffe, wie es Subjekte gibt, die es benutzen, wobei sich die Bedeutungen
im zeitlichen Verlauf auch noch mehr oder minder ändern können.
Deshalb behält Aristoteles Empfehlung
auch seine zeitlose Richtigkeit:
|
|
"Nun müssen diejenigen, welche ihre Gedanken untereinander austauschen wollen, etwas voneinander verstehen; |
Aristoteles formuliert das Problem sehr klar, aber er gibt keine Lösung. Denn es stellt sich natürlich die Frage, wie man das macht, sich auf genau eine Bedeutung zu verständigen. Mit anderen Worten: wie genau geht praktisch erklären der einen Bedeutung, in der man das Wort zu gebrauchen wünscht?
Grundproblem Begriffsverständnis:
Verstehen
ist ein grundlegender Begriff, der nur auf dem ersten Blick klar scheint.
Tatsächlich dürfte es in den meisten Situationen so sein, dass
wir zwar meinen oder glauben, zu verstehen - aber verstehen wir "wirklich"?
Wie können wir prüfen, ob wir "wirklich" verstehen? Wie macht
man das? Die einfachste Möglichkeit, verstehen zu prüfen, geht
über das Verhalten oder Handeln.
Wie kann man feststellen und ermitteln, welchen Begriff
ein Kommunikator mit der bildlichen oder lautlichen Ausdruckshülle
eines Wortes verbindet? Das Problem hat in allen Wissenschaften, die mit
Erleben und Verhalten zu tun haben, eine kaum zu überschätzende
Bedeutung.
Aus dieser Fragestellung ergibt sich sofort die
nächste und noch grundlegendere Frage: was können oder sollen
wir unter einem
Begriff verstehen? Eine Idee, eine Vorstellung,
ein kognitives Schema, eine mehr oder minder deutliche Merkmalskombination
in dieser oder jener Kommunikationssituation? Auf den ersten Blick scheint
intuitiv klar, was wir unter einem Begriff verstehen können, etwa
dadurch, dass wir Beispiele und Gegenbeispiele für Begriffe angeben
können, z.B. Baum, Anfang, und, .... Tatsächlich geben wir beim
Kommunizieren aber
nur Worte an. Worte sind aber nur die
"Kleider" der Begriffe. Sie repräsentieren oder bezeichnen
einen Begriff, aber welchen nun genau? Man könnte auch sagen, mit
Worten
rufen wir in unserem Geist, in unserem Gedächtnis, in unserer Erfahrung
Begriffe auf. Aber welche? Wie geschieht das? Wie können wir prüfen,
welcher Begriff sich bei diesem oder jenen Menschen, in dieser oder jener
Situation, mit diesem oder jenem Wort verbindet? Fragen wir nach und ausführlicher,
erhalten wir als Antwort wiederum Worte, so dass sich ein sog. unendlicher
Regress, ein nicht endender Frage- und Wortkreislauf anbahnt. Aus empirisch-
operational- wissenschaftlicher Sicht sind daher vor allem solche Methoden
erwünscht, die nicht nur eine Prüfung gestatten, sondern auch
ein Ende haben. Beispiel: Es bestehe die Aufgabe darin, aus drei Gegenständen,
die blau, rot und gelb sind, einen auswählen. Aus der Wahl lässt
sich bei farbtüchtigen Probanden und ehrlichen schließen, ob
z.B. die Begriffe blau, rot, gelb zur Verfügung stehen. Relativ einfach
erscheinen hierbei Begriffe, die Äußeres, Wahrnehmbares, Zeigbares
betreffen. Sehr viel schwieriger wird es, wenn die Begrifflichkeit von
Innerem, Erleben, Gefühlen oder Stimmungen, Wünschen, Bedürfnissen
oder Zielen zu überprüfen sind.
Fuzzy-Begrifflichkeit
im Alltag. In alltäglichen kommunikativen Situationen begnügt
man sich meist mit einem ungefähren Verständnis, d.h. man prüft
hier meist gar nicht, was gemeint ist, sondern nimmt eine Bedeutung einfach
an. In der Psychodiagnostik und Psychotherapie kann dies sehr problematisch
werden, weil man möglicherweise nur meint, sich zu verstehen.
Fragt man etwa:
Welche Gefühle kennen Sie? und fragt nicht:
Welche
Gefühle kennen Sie vom eigenen Erleben her? kann man Antworten
bekommen, die nur den Wortschatz der Gefühle einer Person repräsentieren,
aber nicht das Erleben. Fühlprobleme werden so vielleicht übersehen.
Andererseits ist die Idee reizvoll, dass die Alltagswelt
vielleicht gerade deshalb praktisch so gut funktioniert, weil man sich
mit dem Ungefähren begnügen kann. Man konnte oben schön
sehen, dass die Dinge vielleicht erst dann richtig schwierig werden, wenn
man sie genau und ausdrücklich zu erfassen sucht. Vielfach gibt es
keinerlei Probleme zu verstehen, was jemand meint, auch wenn viele objekt-
und metasprachliche Ebenen ineinander verschachtelt sind. Erst wenn man
genauer einzudringen versucht, stellt man fest, dass es dann kompliziert
und schwierig werden kann. Kaum ein des Rechnens mächtiger Mensch
hat ein Problem mit den natürlichen Zahlen, jeder weiß, wie
sie aufeinander folgen und wie man ihnen umgeht, zählt und rechnet
- bis man sich fragt: gibt es alle?
Und was bedeutet hier alle? Und was heißt geben? Gibt
es Dinge, die sich selbst enthalten? Gibt es Unvollendbares als Vollendetes?
Gibt es Teile eines Ganzen, die genau so groß sind wie das Ganze?
Allgemein-Psychologisches-Referenz-Modell
>
Referenz
und Erkenntnistheorie.
Psycho-Ontologisch sind zunächst zwei Wirklichkeiten zu unterscheiden:
erstens die, die es auch ohne die Menschen gibt und zweitens die Wirklichkeiten,
die erst mit dem Menschen in die Welt kommen. Weiterhin kann Psycho-Modal
unterschieden werden: Existenz (da sein) und Abwesenheit (nicht da sein),
Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, Phantasie, Wunsch und Norm (>
Welten).
 |
Referierender - Referenz - Referenzierte. Die Graphik zeigt vier Grundmodellle der Referenzierung aus denkpsychologischer Sicht: Ich (Aussagen über mich), Anderer (Aussagen über andere), Natur (Aussagen über die Natür), Kultur (Aussagen über Soziokulturelles). Am einfachsten ist zweifellos das Referenzieren auf äußere Dinge, die der Wahrnehmung und gemeinsamer Handlungs- und Lebenspraxis zugänglich sind. So fängt die Sprach- entwicklung auch weitgehend an: Mama, Papa, Auto, Handy, Wauwau, ... Schwieriger kann es werden, wenn es um das Erleben und nicht direkt beobachtbare seelisch-geistige Prozesse eines ich oder selbst oder gar um "höhere" Wahrnehmungsebenen (Laing) geht. Die Referenz der Innenwelt kann den Objekten des Personalpronomens
"ich" (bzw. seinen Entsprechun- gen) zugeschrieben werden.
Bemerkt ein Mensch, was in ihm vorgeht, so heißt "ich"
das Referierende und das, was bemerkt wird, das Referenzierte. Z.B. wenn
sich jemand fragt, wie es ihm geht, dann heißt ergehen so
und so das Referenzierte. Wenn sich jemand fragt, wie sein Partner
meint, dass es ihm geht, gibt es zwei Referenzierungen, nämlich erstens
mein
Ergehen so und so wie ich das zweitens in das Erleben meines
Partners projiziere. Die Referenzierungen des Erlebens können
als unterscheidbare Bewusstseinsinhalte angesehen werden.
|
- Lit > Quine,
Ulrich,
Kripke.
- Selbstreferenz
Sich auf sich selbst beziehen. Typisch: Ich-mich-Bezug. Ich-mich-Bezüge charakterisieren die Subjekt-Objekt-Referenz, etwa, wenn ein Mensch Betrachtungen zu sich selbst anstellt. Hier wird man dem Subjekt (ich)
Psychologische Beweistheorie
Die psychische Realität und die psychologischen Gegebenheiten: Objekte (Gegenstände des Erlebens und Verhaltens), Eigenschaften und Relationen (Beziehungen) der psychologischen Gegebenheiten (des Erlebens und Verhaltens), Zeichen und Bezeichnungen für die psychologischen Gegebenheiten (des Erlebens und Verhaltens).
Viele psychologische Objekte sind sehr unscharf, flüchtig, schwer begrifflich und methodologisch zu fassen. Beweise des psychischen Erlebens sind daher schwierig, leicht hingegen die des Verhaltens, was schon die Behavioristen sehr zu schätzen wussten. Eine ausgearbeitete, geschweige denn eine allgemein anerkannte Beweislehre des psychischen Erlebens gibt es nicht. Daran kranken die Psychologie und Psychopathologie des Erlebens. Sie soll hier entwickelt werden in enger Anlehnung an meine Arbeit über das Denken.
Paradigmatische
Beweismethoden und Beweismittel in der Psychologie
Paradigma soll hier für Muster, typisches Beispiel, Prototyp stehen.
Ich verwende den Begriff für wiederkehrende, typische Fälle,
so dass die Beweismethodik für jeden einzelnen Fall angewendet werden
kann. Gelingt das nicht mehr, muss das Paradigma erweitert, verändert
werden.
| Allgemeiner
Diagnosenbegriff
(1a) Ein Sachverhalt liegt (nicht) vor. (1b) Ein Sachverhalt liegt (nicht) in dieser oder jener Ausprägung vor. |
Es ist zwar ungewöhnlich, den Diagnosebegriff auf beliebige Sachverhalte zu verallgemeinern, aber in diesem Themenumfeld nicht abwegig und grundsätzlich, nach der ursprünglichen Wortbedeutung, ohnehin sinnvoll und begründet. Denn die ursprüngliche griechische Bedeutungswurzel: dia als unter- oder entscheiden, und gnosis, die Erkenntnis, trifft das, was Diagnostiker tun, sehr gut. Ursprungswörtlich ergibt sich demnach als sinnvolle Wortbedeutung unterscheidendes Erkennen.
Obwohl man auch davon sprechen könnte, Sachverhalte zu diagnostizieren, redet man nicht so. In Bezug auf allgemeine Sachverhalte benutzt man das Wort feststellen - ob etwas der Fall ist oder nicht. Von Diagnosen spricht man, wenn es um um das Auffinden von Störungen geht, im engeren Sinne in der Heilkunde. Eine Diagnose haben bedeutet gewöhnlich, die Krankheit kennen, die vorliegt.
Allgemeine äußere Sachverhaltsfeststellung sind z.B.: Da steht ein Tisch. Das Licht ist an. Die Tür ist auf. Es zieht. Die Glühbirne geht nicht mehr. Hier ist beweisen einigermaßen einfach. Aber das Innere, direkt Unsichtbare, Erlebensinhalte zu beweisen ist schwierig. Warum eigentlich? Auch die äußere Welt erleben wir doch durch Wahrnehmen, ist also durch "Inneres" vermittelt. Das werden wir herausfinden, indem wir die Beweisschritte für Äußeres und Inneres sorgfälig durchführen und vergleichen.
Die einfachste Unterscheidung betrifft elementare Sachverhalte, die vorliegen oder nicht vorliegen können:
- P sagt, er höre Stimmen, die sein Verhalten, Tun und Lassen kommentieren. An der Decke winkt ein Engel.
- P. kann die Aufgabe, was 17 x 13 ergibt, in fünf Minuten nicht lösen.
- P. sagt, er habe letzte Woche 3x starke Angst erlebt.
- P. sagt, er habe Einschlafschwierigkeiten.
- P. sagt, manchmal habe er auch Durchschlafprobleme.
- P. sagt, er habe heute nacht einen Alptraum gehabt.
- P. sagt, er habe sich morgen nach dem Erwachen wie gerädert gefühlt.
- P. sagt, er oft keine Lust auf Sexualität.
- P. glaubt, dass es viele Steuerhinterzieher gibt.
- P. fühlt sich ungerecht behandelt.
- P. gibt an, die Grundschule in G. von t1 bis t2 besucht zu haben.
- P. sagt, er habe leicht gelernt und sei gut mitgekommen in der Berufsschule.
- P. erzählt, gestern sei es ihm viel zu heiß gewesen.
- P. gibt an, das Leben mache ihm nur noch selten Freude.
| Beweis Paradigma Tatsachen Diagnose (positiv: = Sachverhalt ist wahr, negativ := Sachverhalt ist nicht wahr. |
Wir fragen uns nun, wie wir die obigen Aussagen beweisen können. Beginn wir mit 1. P sagt, er höre Stimmen, die sein Verhalten, Tun und Lassen kommentieren. Wir können derzeit grundsätzlich nicht prüfen, ob P. Stimmen hört, die sein Tun und Lassen kommentieren. Wir können es ihm glauben, wenn er es uns erzählt. Doch wie können wir eine bewusste Täuschung (Simulation), einen Irrtum oder von der Tatsache unterscheiden? Was berechtigt uns, anzunehmen, die Aussage, jemand höre Stimmen, die sein Tun und Lassen kommentieren, sei wahr oder falsch aus diesen oder jenen Gründen? Hierzu findet man in der psychopathologischen Literatur so gut wie keine Arbeiten, obwohl es im forensischen Bereich öfters vorkommen sollte, wenn jemand z.B. wegen einer Straftat einen Strafnachlass über die Diagnose vermindert schuldfähig anstrebt.
- Exkurs
Begründungs- und Überzeugungsgrade des Glaubens im Sinne von
für wahr halten
Glauben ist nicht gleich glauben. Das soll besagen, dass es unterschiedliche Grade des - mehr oder minder nachvollziehbaren, begründeten oder berechtigten - Glaubens gibt. Eine rational nachvollziehbare und begründete Taxonomie des Glaubens im Sinne von für wahr halten wurde in der Psychologie und Psychopathologie bislang nicht entwickelt. In dieser Seite soll eine solche Taxonomie (Grade von Begründetheit) Zug um Zug entwickelt werden.
| Beweis Paradigma Symptom Diagnose := einer Tatsache kommt Symptomwert zu. |
Symptomwert := Anzeichen für, z.B. Erröten oder Erblassen
für einen emotionalen Prozeß; Fieber oder
erhöhte Temperatur als Krankheitszeichen für viele Krankheiten.
Meist sind Symptomwerte nicht ein- sondern mehrdeutig, so dass sich das
Problem einer differentialdiagnostischen Entscheidung ergibt, für
welchen der in Frage kommenden Sachverhalte der Symptomwert besteht.
| Beweis Paradigma Syndrom Diagnose := einer Symptomkonfiguration kommt Syndromwert zu. |
Der Medizin verdanken wir den Syndrombegriff. Darunter ist eine Konfiguration
von Zeichen zu verstehen, die durch unterschiedliche Krankheiten hervorgebracht
werden kann. Aus dieser Bestimmung geht schon hervor, wie wichtig es ist,
zwischen Syndrom und zugrunde liegender Krankheit zu unterscheiden.
| Beweis Paradigma Krankheits-Diagnose := Ein Syndrom kann einer Krankheit zugeordnet werden. |
Das ist eine wesentliche Aufgabe in der Heilkunde. Oft gilt eine richtige
Diagnose als Voraussetzung für eine richtige Behandlung. Das ist aber
nicht zwingend, wie auch der Placeboeffekt
nahelegt.
| Beweis Paradigma Wirkungen der Krankheit (z.B. arbeits-, geschäfts-, schuldunfähig; beeinträchtigt ...) |
Viele Erkrankungen haben Wirkungen auf Erleben und Verhalten. Eine der
bekanntesten in unserem sozialen Kulturkreis sind z.B. die Wirkungen Behandlungsbedürftigkeit,
Schonungsbedürftigkeit bis hin Arbeits- oder (vorübergehenden)
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit. Der sozialrechtliche Status "krankt"
schützt und behütet auch, befreit vorübergehend von bestimmten
Pflichten und verleiht besondere Rechte, die mit dem Krankenstand verbunden
sind. So weit die soziologische Beschreibung. Sehr viel schwieriger ist
aber ein Beweis der Arbeitsunfähigkeit. In der Praxis begnügen
ÄrztInnen und Kranke meist mit glaubhaft machen, manchmal wird gar
nicht sorgfältig untersucht und geprüft. Krankschreiben gehört
sozusagen zum Service der ÄrztInnen und wer nicht mitmacht, wird mitunter
ganz schnell gewechselt.
| Beweis
Paradigma Prüfung von Mitteilungen über das Erleben
> Wie geht es Ihnen?
Wie können wir prüfen, ob das, was ein Mensch über sein Erleben mitteilt, richtig ist? Wie macht man das im Beziehungs- und Kommunikationsalltag? Die wesentliche und grobe Antwort lautet: 1) Der Wahrheitsgehalt einer Mitteilung über das Erleben wird im Alltagsleben bewiesen durch - meist nichtbewusste - Abwesenheit von emotionalen oder mentalen Regungen des Zweifels oder Irritationen. 2) Durch Auflösen von auftretenden emotionalen oder mentalen Zweifeln oder Irritationen (neudeutschpsychologisch: durch Validieren oder Evaluieren von Mitteilungen. |
Im üblichen Alltag erfolgen solche Prüfungen meist nicht ausdrücklich,
sondern nicht bewusst, intuitiv, d.h. man prüft intuitiv, aber man
weiß nicht, wie man es (genau) macht. Die einfachste und übliche
positive intuitive Prüfung ergibt sich daraus, dass sich kein Zweifel
oder eine Irritation einstellt. Durch die Abwesenheit von
emotionalen oder mentalen Regungen des Zweifels oder von Irritationen kommt
man meist nicht-bewusst zur positiven Prüfung des Wahrheitsgehaltes
von Mitteilungen.
Erst dann, wenn sich emotionale oder mentale Regungen
von Zweifel oder Irritationen einstellen, können diese zu einer bewussten
Prüfung führen. Doch wie sieht dies aus, wie kann sie aussehen?
Alltagsformulierungen des Zweifels an Mitteilungen können z.B. sein:
- Ausgesprochen: "Wie meinst Du das?" Unausgesprochen, nur gedacht: wie meint sie das?
- Ausgesprochen: "Versteh ich nicht." Unausgesprochen, nur gedacht: versteh ich nicht.
- Ausgesprochen: "Kann ich kaum glauben." Unausgesprochen, nur gedacht: Kann ich kaum glauben.
- Ausgesprochen: "Meinst Du das wirklich?" Unausgesprochen, nur gedacht: meint sie das wirklich?
- Ausgesprochen: "Na. na, übertreibst Du nicht ein bißchen" Unausgesprochen, nur gedacht: übertreibt sie nicht?
- Ausgesprochen: "Stimmt das wirklich?" Unausgesprochen, nur gedacht: stimmt das wirklich?
- Ausgesprochen: "Das glaub ich Dir nicht." Unausgesprochen, nur gedacht: das glaub ich ihr nicht.
- Ausgesprochen: "Geht es Dir wirklich so?" Unausgesprochen, nur gedacht: geht es ihr wirklich so?
Gegenbeispiele
für nur scheinbare Einwendungen als Ausdruck für ungewöhnliche,
kaum glaubliche Ereignisse:
- Ausgesprochen: "Was, das gibts doch nicht!" Unausgesprochen, nur gedacht: das gibts doch nicht?
- Ausgesprochen: "Donnerwetter, kaum zu glauben!" Unausgesprochen, nur gedacht: Donnerwetter, kaum zu glauben!
- Ausgesprochen: "Unglaublich!" Unausgesprochen, nur gedacht: unglaublich!
- Ausgesprochen: "Das darf doch wohl nicht wahr sein!" Unausgesprochen, nur gedacht: Das darf doch wohl nicht wahr sein!
Umschreibungen
emotionaler Ebene (schwer in Worte zu fassen)
- Regungen des Zweifelns
- zweifelndes Unbehagen
- Irritationserleben
- Fragliches Erleben
- Gefühl des Nicht einfühlen, nachvollziehen, einfühlen könnens
Entstehen
von Zweifel und Irritationen
- Zweifel und Irritationen durch den Inhalt der Mitteilung
- Zweifel und Irritationen durch die Art und Weise der Mitteilung (Form, Stil, Ausdrucksverhalten)
- Zweifel und Irritationen durch den Situationszusammenhang
- Zweifel und Irritationen durch Erfahrungen
- Zweifel und Irritationen durch Erwartungen
- Zweifel und Irritationen durch Wünsche, Bedürfnisse, Interessen
| Beweis-Paradigma Ausführung nach Aufforderung oder - allgemeiner - Reiz-Reaktions-Schemata |
Fragt man z.B. jemand, ob er seine Hand heben kann und er hebt seine
Hand, so kann man schließen, dass er die Frage verstanden und angenommen,
weil er sie ausgeführt hat. Dieses Paradigma kann weiter
verallgemeinert werden auf Reiz-Reaktions-Schemata. Jemand konfrontiert
ein Erlebens-System, mit einem Reiz, das mit einer Reaktion antwortet.
Hieraus lässt sich im Prinzip schließen, dass der Reiz
das Erlebens-System erreicht hat, weil es reagiert.
| Beweis-Paradigma Bio-Aktivitätsspur [Ideale Experimente] |
Erleben ist an den Körper, an die Materie, genauer an das Gehirn
und Nervensystem gebunden. Eine Projektion des Erlebens ist das sog. bewusste
Erleben. Ein Teil des Ereignisstroms
wird zum Erlebnisstrom, wenn das biologische System auf den
Ereignisstrom reagieren kann. Und von dem Erlebnisstrom kann wiederum ein
Teil bewusst und damit zum Bewusstseinsstrom werden. Damit
stellt sich die Frage, ob es eine direkte biologische Repräsentation
der Bewusstseinsvorgänge gibt. Hier ist man mit Hilfe der bildgebenden
Verfahren (PET,
fMRT,
AGT)
seit einiger Zeit deutlich weitergekommen. Hierzu kann man auch die Biofeedback
und die Neurofeedbackverfahren rechnen. So geht etwa eine Emotionalisierung
mit verstärkter Erregung und Schweißabsonderung einher, was
mess- und sichtbar gemacht werden kann. Ein großes Problem ergibt
sich aber durch das terminologisches Durcheinander, weil meist nicht operational
differenziert und klar unterschieden wird, von welcher Repräsentationsebene
gesprochen wird.
| Beweis-Paradigma Anlage - Umelt |
Das Anlage-Umwelt-Problem ist ein "Klassiker" im Spannungsfeld Biologie
und Psychologie. Und eine klassische Untersuchungsmethode ist der Vergleich
zwischen verschiedenen Verwandtschaftsgraden, wobei der Zwillingsstudie
besondere Bedeutung zukommt. Merz
& Stelzl (1977), S. 68, sind nach Auswertung von eineiigen Zwillingsstudien
zu dem Ergebnis gekommen, dass 80% der Intelligenzleistung vererbt wird.
Die Idee aus Erbähnlichkeiten z.B. über
Zwillingsstudien Aufschlüsse über die Bedeutung der Erbfaktoren
z.B. für Charakter- oder Persönlichkeitsmerkmale zu gewinnen,
ist auf den ersten Blick überzeugend, nach dem zweiten Blick aber
nicht ganz so einfach, wie es vielleicht zunächst scheint.
Hinsichtlich des Erbgutes kann die Rangreihe Eineiiger
Zwilling, Zweieiiger Zwilling, Geschwister
aufgestellt werden. Hinsichtlich der Aufwuchs- und Erziehungsumgebungen
bieten sich gleiche, ungleiche oder mehr
oder minder ungleiche an, etwa wenn eineiige Zwillinge nach der
Geburt getrennt und in verschiedenen Umgebungen (Familien) aufwuchsen,
was aber noch nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass eine formal ungleiche
Umgebung auch inhaltlich ungleich zu bewerten ist. M.W. ist das Problem
der Gleichheit bzw. Ungleichheit von Umgebungen bislang noch nicht richtig
angegangen worden.
Allgemeiner Versuchsplan Erblichkeitsforschung mit Verwandtschaftsgraden

Mit Hilfe der Tabelle lassen sich nun typische Konfigurationen und Hypothesen deuten:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispiel-Deutungen für Konfigurationen und Hypothesen:
- M1 zeigt einen hohen Erbfaktor, der unabhängig von Umgebungen abnehmend mit dem Verwandtschaftsgrad auftritt.
- M2 zeigt einen hohen Erbfaktor, der mit ungleichen Umgebungen und geringerem Verwandtschaftsgrad abnimmt.
M3 zeigt einen generellen Erbfaktor ("Grundbedürfnis"), der unabhängig vom Verwandtschaftsgrad und von Umgebungen auftritt, z.B. atmen, schlafen, trinken, essen, ausscheiden.
Unterscheidungen
im Erleben und die Bewusstseinselemente [von Quelle
5.1]
Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen verschiedenen Erlebensstufen [von Quelle 5.2]
- das Erleben, wie es in uns stattfindet.
- das Erleben wie es subjektiv erlebt wird.
- das Erleben, wie es bewusst erkannt wird. Hier kommt das Denken ins Spiel, etwa wenn wir ein Gefühl erkennen und mit einem Namen belegen, z.B. Freude, Lust oder Angst. So gesehen wird verständlich, dass kommunizierbare Bewusstseinsinhalte auch mit denken bezeichnet werden, obwohl ihr ursprünglicher und primärer Gehalt z.B. affektiver Natur ist. Einem Affekt, einer Befindlichkeit, einem Wunsch, Bedürfnis, Gefühl oder einer Stimmung einen Namen geben, bedeutet dass Denken zum Affekt hinzugekommen ist, genauer: identifizierendes, erkennendes Denken.
- das Erleben, wie es anderen gegenüber zum Ausdruck gebracht, also kommuniziert werden kann. Hier wird bei höheren Entwicklungen die Sprache benötigt.
- das Erleben, wie es von anderen aufgefasst und verstanden wird. Sprechen wir über das Erleben eines anderen, sollten wir dies sprachlich als Eindruck formulieren. Also nicht: du hast Angst, freust Dich, möchtes etwas, sondern: ich habe den Eindruck, Du hast Angst, freust Dich, möchstest etwas. Damit wird das Gegenüber nicht festgelegt. Über meine eigenen Eindrücke kann ich natürlich immer sprechen und man sollte es auch tun, weil hierdurch viele Konflikte und Streiterien über das Erleben anderer vermieden werden können.
Nicht alles, was in uns stattfindet, wird auch subjektiv erlebt.
Nicht alles, was subjekt erlebt wird, wird bewusst erkannt. Nicht alles,
was bewusst als subjektives Erlebnis erkannt wird, kann auch ausgedrückt
und kommuniziert werden. Nicht alles, was ausgedrückt und kommuniziert
werden kann, wird auch so verstanden wie es gemeint ist. Damit sind die
Hauptprobleme der Kommunikation über das Erleben beschrieben.
Richtet oder verdichtet sich unsere Aufmerksamkeit auf einen Bewusstseinsinhalt, so stellt die Frage: um was für einen Bewusstseinsinhalt handelt es sich? Fokussiere ich auf eine Wahrnehmung, versuche ich etwa zu hören, was sich im Treppenhaus abspielt, oder was im Hof los ist? Versuche ich, die Nachrichten zu hören? Bemerke ich ein Ziehen im Bein, eine Missempfindung im Rücken oder eine Spannung in den Gliedern?
Ueberblick über mögliche Bewusstseinsinhalte oder Bewusstseinsfiguren - erleben im einzelnen
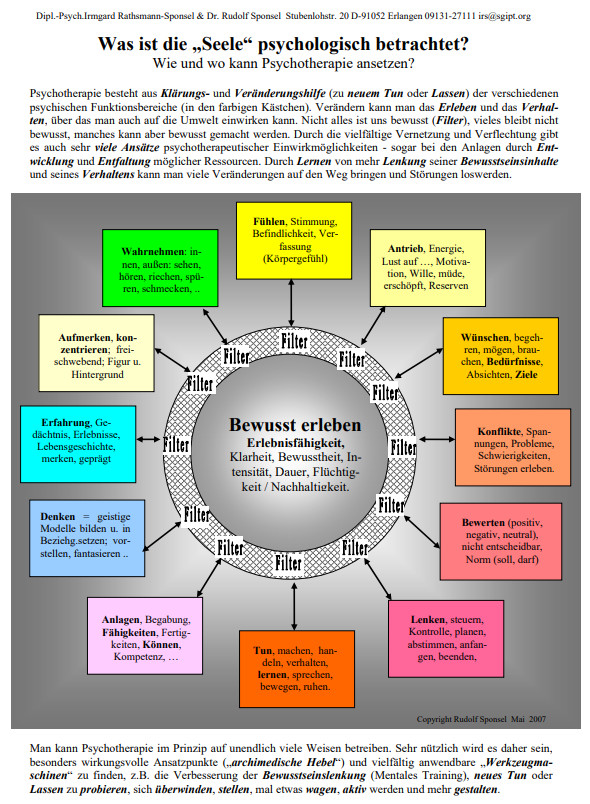
Anmerkung Brentano: Die Konzeption
der Funktionseinheiten findet sich schon bei Franz Brentanos (1874) "Psychologie
vom empirischen Standpunkt" - ein Buch zu einer angeblich empirischen Psychologie,
die ohne Experiment, Beobachtung, Exploration, Protokolle ... auskommt
(> Vorurteile
der Nur-Denker-Zunft), im Grunde eine Paradoxie - wenn er Z. im Ersten
Band, S. 8 ausführt:
- "Unter Seele versteht nämlich der neuere Sprachgebrauch
den substantiellen Träger von Vorstellungen und anderen Eigenschaften,
welche ebenso wie die Vorstellungen nur durch innere Erfahrungen unmittelbar
wahrnehmbar sind, und für welche Vorstellungen die Grundlage bilden;
also den substantiellen Träger einer Empfindung z. B. einer Phantasie,
eines Gedächtnisaktes; eines Aktes von Hoffnung oder Furcht, von Begierde
oder Abscheu pflegt man Seele zu nennen. [FN4 Hrsg.] Auch wir gebrauchen
den Namen Seele in diesem Sinne. Und es scheint darum nichts im Wege zu
stehen, wenn wir, trotz der veränderten Fassung, den Begriff der Psychologie
auch heute noch mit den gleichen Worten wie einst Aristoteles bestimmen,
indem wir sagen, sie sei die Wissenschaft von der Seele."
Normierung
der verschiedenen Bewusstseinsinhalte oder Bewusstseinsfiguren
Normieren hört sich schrecklich bürokratisch, für manche
sogar regelrecht abstoßend, an. Es heißt hier aber nur, dass
man versucht, Standardsituationen zu finden, die eine hohe Gewähr
dafür bieten, dass der gemeinte Bewussstseinsinhalt, auch tatsächlich
erlebnisnahe erkannt und wiederbelebt wird. Manchmal genügt es hierzu,
sich Erfahrungen und Situationen der Vergangenheit ins Bewusstsein zu rufen.
Aber auch gezielte Fantasien und gelenkte Tagträume können hierbei
hilfreich sein. Die wichtigsten Bereiche sind:
- Antrieb (Betätigungslust, Energie, Kraft, Wille, Motivation, Aktivitätsdrang).
- Aufmerken (auswählen, auswählen, richten, verdichten, konzentrieren)
- Bewerten (gut, schlecht, nützlich, richtig, falsch, un/ angemessen, schön, interessent, wertvoll, schädlich ...)
- Denken (geistige Modelle bilden und zueinander in Beziehung setzen; Begriff, Sachverhalt, Problem lösen, vorstellen, Fantasieren, tagträumen)
- Erfahrung (erinnern, aktivieren, gelernt, angeeignet, erlebt, erfahren)
- Fühlen (Stimmung, Befinden; positiv: Lust, Freude, Interesse, Wohlbehagen, Zufriedenheit, Stolz; negativ: Angst, Enttäuschung, Ärger, Trauer)
- Konflikte (Zweifel, Hemmungen, hin- und hergerissen, Spannung, ...)
- Lenken (anfangen, dabei bleiben, unterbrechen, fortsetzen, prüfen, kontrollieren, aufhören und beenden).
- Tun (machen, handeln, verhalten) oder Lassen (nicht tun, sein lassen)
- Wahrnehmen (nach außen: sehen, hören, riechen, schmecken; nach innen: empfinden, spüren, Spannung, Entspannung).
Praktisch-Systematische und psychotherapiepraxisrelevante Terminologievorschläge
In den meisten Psychotherapien ist die Sprache das wesentliche Medium, um Erleben und Verhalten zu untersuchen und zu verändern. Es ist daher sehr wichtig, dass man sich - wirklich - versteht. Daher stellt sich in nahezu jeder Psychotherapie natürlich die Grundfrage: wie kann den PatientInnen geholfen werden, über ihr Erleben und Verhalten so zu sprechen, dass die Psychotherapie wirken kann und gut vorankommt? Die folgende Bewusstseinsinhaltsanalyse ist analytisch-künstlicher Natur, d.h. mit Hilfe der Erfahrung, Praxis, Vernunft und Wissen konstruiert.
Einige Stichworte:
- Die Registrationsfunktion des Bemerkens eines Erlebnisinhaltes (Erlebnisfigur) gehört zuerst nicht zum Denken, sondern zur Aufmerksamkeits- und Bewusstseinslenkung, die durch das Motivations- und allgemeine Lenkungssystem bestimmt sind.
- Erkennensfunktionen des Denkens. Hier gibt es enge - mir noch nicht klare - Zusammenhänge zum Gedächtnis und zur Wahrnehmung. Wahr-nehmen kann im Sinne von erkennen gedeutet werden.
- Auswahlfunktion. Sobald etwas bemerkt wird - hierzu muss es grob erkannt worden sein -, stellt sich für die Bewusstseinlenkung die Frage, ob das eben Bemerkte stärker in den Brennpunkt des Bewusstseins vorrücken soll oder nicht, was im letzeren Fall dann hieße, es wird an den Rand des Bewusstseins gedrängt, verharrt dort oder verschwindet wieder - mit oder ohne Spuren im Gedächtnis (was, wann und wie im Gedächtnis Spuren hinterlässt ist eine Frage der Gedächtnisforschung).
Das Denken scheint auch ganz unterschiedliche Klarheit und Schärfe
annehmen zu können. Meist erscheint es wenig greifbar, diffus, ungefähr,
flüchtig, schnell. Eine gute Metapher sind unklare, unscharfe und
flüchtige Wahrnehmungen, die durch Fokussierung und Konzentration
an Klarheit und Schärfe gewinnen können. Man kann nun verschiedene
Modelle entwickeln, um die Bewusstseinsvorgänge und speziell das Denken
zu untersuchen. Hierbei kann man drei Ausgangspunkte unterscheiden.
- Das Subjekt befindet sich im Zustand freischwebender Aufmerksamkeit und wendet sich keinen besonderen Bewusstseinsinhalten zu. Es fließt, kommt, geht, zieht vorüber, bleibt, verschwindet, verändert sich oder nicht.
- Die Aufmerksamkeit verweilt mehr bei einem Bewusstseinsinhalt und wählt ihn damit zu einer Bewusstseinsfigur aus. Das Subjekt befindet sich im Zustand gelenkter oder zielgerichteter Aufmerksamkeit für ein besonderes Thema.
- Verdichtet sich die zielgerichtete Aufmerksamkeit, sprechen wir auch von Konzentration. Das ist der Fall, wenn man versucht, den Typ der Bewusstseinsfigur näher zu klären und grob einzuordnen: Wahrnehmung, Gefühl, Stimmung, Empfindung, Erinnerung, Vorstellung, Fantasie, Tagtraum, Wunsch, Bedürfnis, Plan, Ziel, Konflikt, ...?
Diese hinführenden Vorüberlegungen erlauben nun, ein realistisches
und praxistaugliches 7-Phasenmodell zu entwerfen:
Ein
7-Phasen-Modell einfacher Bewusstseinsvorgänge bei freischwebender
Aufmerksamkeit
- 1. Phase: Zustand freischwebender Aufmerksamkeit ohne besondere Fokussierung. Man erlebt alles Mögliche, ohne bei einem Bewusstseinsinhalt besonders zu verweilen, geistige Objekte steigen auf und verschwinden wieder, man bemerkt mal dieses, mal jenes, ohne es besonders zu fokussieren.
- 2. Registrieren und bemerken. In dieser Phase ist die entscheidende Frage, welche der registrierten und bemerkten Bewusstseinsfiguren für eine nähere Betrachtung ausgewählt werden. Wodurch kommt es zum Bemerken einer Bewusstseinsfigur?
- 3. Phase: Auswahl nach Bemerken einer Bewusstseinsfigur (da ist etwas) und richten bzw. sogar verdichten der Aufmerksamkeit auf diese Bewusstseins-Figur (bewusstes auswählen). Erstes, grobes, ungefähres klassifizieren. Aufmerksamkeit richten, zuwenden und gegebenenfalls verdichten (konzentrieren) auf eine Bewusstseinsfigur.
- 4. Phase: Klären und grobe Einordnung der Bewusstseinsfigur zu einer (Haupt-) Erlebniskategorie. Nach erfolgreicher Klärung kann der Bewusstseinsinhalt identifiziert oder erkannt werden:
- 5. Phase: Identifikation der Bewusstseinsfigur (erkannt). Das kann durch einen Namen, eine Charakterisierung, oder kennzeichnende Um- oder Beschreibung erfolgen. Mit der Identifikation hat die Bewusstheit ihren Höhepunkt erreicht. Und es stellt sich nun die Frage, ob mit dem identifizierten Bewusstseinsinhalt weiter gearbeitet werden soll:
- 6. Phase: Weiterverarbeitung mit der identifizierten Bewusstseinsfigur weiter machen? Welche Weiterverarbeitungen schließen sich nun an? Was taucht als nächstes auf?
- 7. Phase: Der kognitive Strang kommt nach einer Weile mit diesem oder jenem (Zwischen-) Ergebnis zu einem (vorläufigen) Ende.
Methodische
Anleitungsskizze zum 7-Phasen-Modell einfacher Bewusstseinsvorgänge
(1) Freischwebende Aufmerksamkeit. Versetzen Sie sich bitte in einen Zustand frei schwebender Aufmerksamkeit. Lassen Sie die Bewusstseinsinhalte kommen und gehen, wie sie wollen. Greifen Sie nicht ein. Lassen Sie sie geschehen. Versuchen Sie zunächst nicht, sich einem Bewusstseinsinhalt besonders zuzuwenden. Lassen Sie bitte einfach nur geschehen und Ihr Bewusstsein treiben, wie es gerade mag. Alles oder auch gar nichts darf kommen, bleiben oder wieder gehen. Versuchen Sie keinerlei Einfluss zu nehmen. Seien Sie nur ein teilnehmender Beobachter Ihrer Bewusstseinsvorgänge. Es spielt an dieser Stelle keinerlei Rolle, welche Bewusstseinsinhalte auftauchen, verweilen, sich verändern, wieder gehen oder nicht. Hierzu ist es wichtig, typische und wiederkehrende Erlebnisinhalte zu unterscheiden.
(2) Bemerken,
abrufen oder Erzeugen einer Bewusstseinsfigur aus dem Hintergrund oder
der Vielfalt der Bewusstseinsinhalte
Während in Ihrem Bewusstsein diese oder jene Figuren mehr oder
minder schemenhaft, flüchtig, so oder so auftauchen, kurz da bleiben,
wieder in den Hintergrund treten oder hin und wieder auch wieder zum Vorschein
kommen, bemerken Sie mehr oder weniger grob, was da alles erscheint und
vorüberzieht. Aus diesem flüchtigen und schemenhaften Bewusstseinsstrom
haben Sie vielleicht das eine oder andere bemerken oder registrieren können.
Diese Übungen können Sie systematisch auf verschiedene Weisen
durchführen, z.B.:
Übungsvariante-1: Damit äußere visuelle
Wahrnehmungen nicht stören können, schließen Sie bitte
für ungefähr eine Minute lang die Augen und lassen den Bewusstseinsstrom
vorüberziehen. Nach einer Minute versuchen Sie sich bitte zu erinnern,
was Sie bemerkt und registriert haben.
Übungsvariante-2: Damit äußere visuelle
Wahrnehmungen nicht stören können, schließen Sie bitte
für ungefähr eine Minute lang die Augen und nehmen sich z.B.
ein Tonaufnahmegerät. Sehen Sie sich bitte ein wenig wie einen Reporter,
der Ihren Bewusstseinsstrom beobachtet, und geben Sie hin und wieder an,
was Sie gerade bemerkt haben.
Übungsvariante-3: Legen Sie sich ein Blatt
Papier vor sich hin. Notieren Sie stichwortartig, was Sie in Ihrem Bewusstseinsstrom
bemerkt haben.
(3)
Auswählen
und Richten der Aufmerksamkeit auf die bemerkte Bewusstseinsfigur, wodurch
zugleich ein erstes, grobes Klassifizieren stattfindet.
Versuchen Sie, eine Bewusstseinsfigur festzuhalten und näher zu
klären, was sie für ein Typ ist. Hierbei können Sie z.B.
auf folgendes Bewusstseinsfigurtypen-Angebot zurückgreifen, wenn Sie
versuchen, die eine oder andere Bewusstseinsfigur nach ihrem Typus näher
zu klären: Wunsch, Bedürfnis, Gefühl, Stimmung, Befindlichkeit,
Gedanke, Erinnerung, Fantasie, (innere) Empfindung, (äußere)
Wahrnehmung, Konflikt, Körperregung, Vorsatz, Vorstellung, Plan, Frage,
Aufgabe, Einfall (Idee), Irritation (Störung), Entscheidung, Entschluss,
Handlungsimpuls, Handlungshemmung.
_
(4) Näheres
Klären der ausgewählten und grob klassifizierten Bewusstseinsfigur.
Bewusstseinsinhalte werden mit Hilfe der Erfahrungen, die im Gedächtnis
gespeichert sind und des Denkens geklärt. Die zum näheren Klären
ausgewählte Bewusstseinsfigur wird näher untersucht, bestimmt,
ein- und abgegrenzt und dadurch mehr und mehr geklärt.
- Falls es ein Wunsch ist: was ist das für ein Wunsch?
- Falls es ein Bedürfnis ist, was ist das für ein Bedürfnis?
- Falls es ein Gefühl ist, ist, was ist das für ein Gefühl?
- Falls es eine Stimmung ist, was ist das für eine Stimmung?
- Falls es eine Befindlichkeit ist, was ist das für eine Befindlichkeit?
- Falls es ein Gedanke ist, was ist das für ein Gedanke?
- Falls es eine Erinnerung ist, was ist das für eine Erinnerung?
- Falls es eine Fantasie ist, was ist das für eine Fantasie?
- Falls es eine (innere) Empfindung ist, was ist das für eine Empfindung?
- Falls es eine (äußere) Wahrnehmung ist, was ist das für eine (äußere) Wahrnehmung?
- Falls es eine Körperregung ist, was ist das für eine Körperregung?
- Falls es ein Vorsatz ist, was ist das für ein Vorsatz, was habe ich mir vorgenommen?
- Falls es eine Vorstellung (in diesem oder jenem Sinnesbereich) ist, was ist das für eine Vorstellung?
- Falls es ein Plan ist, was ist das für ein Plan?
- Falls es eine Frage ist, was ist das für eine Frage?
- Falls es eine Aufgabe ist, die ich erledigen will, was ist das für eine Aufgabe?
- Falls es ein Einfall (Idee) ist, was ist das für ein Einfall (Idee)?
- Falls es eine Irritation (Störung) ist, was ist das für eine Störung?
- Falls es ein Konflikt ist, was ist das für ein Konflikt?
- Falls es eine Entscheidung ist, was ist das für eine Entscheidung?
- Falls es ein Entschluss ist, was ist das für ein Entschluss?
- Falls es ein Handlungsimpuls ist, was ist das für ein Handlungsimpuls?
- Falls es eine Handlungshemmung ist, was ist das für eine Handlungshemmung?
Das (subjektiv) erfolgreiche Klären führt
zur Identifikation der Bewusstseinsfigur durch einen Namen oder eine Kennzeichnung
(Be- oder Umschreibung), der der Bewusstseinsfigur zugeordnet wird.
(5) Identifikationsfunktion des Denkens:
- Name oder Beschreibung des Wunsches?
- Name oder Beschreibung des Bedürfnisses?
- Name oder Beschreibung des Gefühls?
- Name oder Beschreibung der Stimmung?
- Name oder Beschreibung der Befindlichkeit?
- Name oder Beschreibung des Gedankens?
- Name oder Beschreibung der Erinnerung?
- Name oder Beschreibung der Fantasie?
- Name oder Beschreibung der (inneren) Empfindung?
- Name oder Beschreibung der (äußeren) Wahrnehmung?
- Name oder Beschreibung der Körperregung?
- Name oder Beschreibung des Vorsatzes?
- Name oder Beschreibung der Vorstellung?
- Name oder Beschreibung des Plans?
- Name oder Beschreibung der Frage?
- Name oder Beschreibung der Aufgabe?
- Name oder Beschreibung des Einfalls (der Idee)?
- Name oder Beschreibung der Irritation (Störung)?
- Name oder Beschreibung der Entscheidung?
- Name oder Beschreibung des Konflikts?
- Name oder Beschreibung des Entschlusses?
- Name oder Beschreibung des Handlungsimpulses?
- Name oder Beschreibung der Handlungshemmung?
(6) Arbeiten bzw. Weiterarbeiten mit dem identifizierten geistigen Modell (Denkinhalt)
Nach der Identifizierung der Bewusstseinsfigur kann man nun mit dem geistigen Modell weiter arbeiten: Man kann Verbindungen suchen, mit früheren Erfahrungen und mit Wissen Verknüpfungen herstellen.
(7) (Vorläufige)
Beendigung und (Zwischen-) Ergebnis der Weiterverarbeitung.
Am - vielleicht vorläufigen - Ende der Verarbeitung stellt sich
die Frage nach einem - vielleicht vorläufigen - Ergebnis der Verarbeitung.
Man kann sich nun fragen, was das nun für einen insgesamt bedeutet,
was zu tun oder zu lassen ist, ob der Sachverhalt weiterhin im Auge behalten
werden soll oder nicht bzw. unter welchen Umständen?
Wird die Verarbeitung als insgesamt nicht sehr bedeutungsvoll
eingeschätzt wird sie vielleicht zur weiteren Nichtbeachtung oder
zum Vergessen freigegeben und sie verschwindet dann unter Umständen
für immer.
Die Notwendigkeit international ratifizierter operationaler Normierungen
Damit die psychologischen Wissenschaften ihr prä-galileiisches Niveau nachhaltig überwinden und aufeinander [aufbauen] können, müssen sie [terminologische] intersubjektive Klarheit und Zuverlässigkeit in ihre begriffliche Grundlagen bringen, damit nicht jede Generation erneut bei Adam und Eva anfängt und immer wieder ihre eigenen neuen Systeme erfindet. Wissenschaft kann nur auf vielen Schultern [Kekulé 1890] entstehen. Und weil dies in der Psychologie so besonders schwierig ist, sind operationale Normierungen umso notwendiger.
Hierzu gehören besonders die elementaren [psychischen Funktionen], die Konstruktion der [Psyche], des [Bewußtseins] und der Bewußtseinselemente: was können und sollten wir erlebensmäßig unterscheiden und wie läßt sich das sowohl wissenschaftlich als auch praktisch normieren? Da eine empirische Erforschung der Psyche unmöglich ist, wenn nicht andere Menschen zu ihrem Erleben und Verhalten beobachtet und befragt werden, fragt sich: Wie ist einfühlen, mitfühlen (Empathie) und verstehen möglich? Welche Fehlerquellen erwarten uns hier und wie können wir sie bestmöglich kontrollieren? Ganz wichtig ist auch die Konstruktion der Persönlichkeit, der relativ stabilen und überdauernden Persönlichkeitskerne gegenüber den eher situativen und leichter veränderungsmöglichen Erlebens- und Verhaltensweisen. Hier ist also eine differentielle Psychologie der Persönlichkeit nötig. Voraussetzung für eine über einer Generation hinausgehende Persönlichkeitsforschung, die aufeinander aufbauen kann, ist abermals eine klare normierte Terminologie.
Beispiel: Unterscheidungen zu [Glauben] und Überzeugungsgraden
Zunächst wäre bei der folgenden Tabelle von Glaubens- oder
Überzeugungsgraden zu klären, ob die Unterscheidungen sinnvoll
sind. Dazu gehörte auch, zu zeigen, daß sie operational normierbar
sind, also experimentell als gesichert angesehen werden könnten.
| Kürzel | Überzeugungsgrad/ Glaube | Sachverhaltsbezug 1. Metastufe "X ist ..." |
| 5+ | absolute Gewißheit | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |
| 4+ | Gewißheit, überzeugt daß ... | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |
| 3+ | ziemlich sicher glauben | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |
| 2+ | gewisse Wahrscheinlichkeit | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |
| 1+ | für möglich halten | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |
| 0 | ungewiß, unsicher, unklar | keine Ahnung, keine Meinung, völlig offen |
| 1- | kaum für möglich halten | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |
| 2- | gewisse Unwahrscheinlichkeit | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |
| 3- | ziemlich sicher nicht glauben | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |
| 4- | unmöglich | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |
| 5- | absolut Unmöglich | X. ist wahr; falsch; möglich; wahrscheinlich mit p |
Querverweis: Sprachstudie-01.
Beweisbeispiele und Saetze der Psychologie
Beispiel
Erinnerungsbild und Wiedererkennen (Ziehen 1924).
Im Leitfaden der Physiologischen Psychologie von Th. Ziehen
(1924, S. 295) wird ausgeführt:
- "Wir nehmen zunächst den einfachsten Fall an, daß eine zusammengesetzte
Empfindung, z.B. die Gesichtsempfindung einer Rose, zum erstenmal parallel
einer Erregung unserer Hirnrinde aufgetreten ist. An eine solche Empfindung
schließt sich nun das bewußte Spiel der Motive oder die Assoziation
an. Zugleich aber wird ein Erinnerungsbild der gesehenen Rose niedergelegt,
oder, physiologisch gesprochen, eine Spur der stattgehabten Hirnrindenerregung
bleibt in der Hirnrinde zurück. Wir schließen dies und müssen
es schließen aus der Tatsache, daß wir die Rose wiedererkennen,
wenn wir sie wiedersehen, daß wir uns derselben zu erinnern vermögen,
daß wir ihr Bild zu reproduzieren imstande sind."
Die Schlußfigur Ziehens ist offenbar: Aus der Tatsache der
Wiedererkennung
folgt, daß es eine Erkennung gegeben haben muß. Wir
wissen aber andererseits aus der Gerichts- und Zeugenpsychologie, daß
es falsche Wiedererkennungen gibt. Zudem kann man einwenden, daß
eine Rose, die später wiedergesehen wird, sich sehr leicht verändert
haben kann. Diese Argumente können aber z.B. durch folgenden Versuch
außer Kraft gesetzt werden:
Beispiel: sich selbst erkennen
Wie kann man beweisen, dass ein Mensch oder ein Trier sich selbst erkennt? Was heißt "sich selbst erkennen"?
Literatur sich selbst erkennen im Spiegel
- Bard, Kim A. et al. (2006) Self-Awareness in Human and Chimpanzee Infants: What Is Measured and What Is Meant by the Mark and Mirror Test? In: Infancy. Band 9, Nr. 2, 2006, S. 191–219, doi:10.1207/s15327078in0902_6
- Beckoff, M.; Allen, C.; Burghardt, G. M. (2002, Hrsg.): The Cognitive Animal. Empirical and Theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press.
- Binder, Alexandra (2014) Auch wer sich im Spiegel nicht erkennt, kann Ich-bewusst sein. In: Vet-Journal. 02/2014, S. 46–49.
- Chang, Liangtang et al. (2015) Mirror-Induced Self-Directed Behaviors in Rhesus Monkeys after Visual-Somatosensory Training. In: Current Biology. Band 25, Nr. 2, S. 212–217, doi:10.1016/j.cub.2014.11.016< br /> Monkeys can learn to see themselves in the mirror. Auf: eurekalert.org vom 8. Januar 2015 (mit Video der Testanordnung)
- Epstein, Robert; Lanza, Robert P. & Skinner, B. F. (1981) „Self-Awareness“ in the Pigeon. In: Science. Band 212, Nr. 4495, 8. April 1981, S. 695 f., doi:10.1126/science.212.4495.695.
- Gallup, Gordon G. Jr. (1970) Chimpanzees: Self-Recognition. In: Science. Band 167, Nr. 3914, 1970, S. 86 f., doi:10.1126/science.167.3914.86.
- Gallup, Gordon G. Jr. (1977) Self-recognition in primates: A comparative approach to the bidirectional properties of consciousness. In: American Psychologist. Band 32, Nr. 5, S. 329–338, doi:10.1037/0003-066X.32.5.329.
- Nielsen, Mark ; Suddendorf, Thomas & Slaughter, Virginia (2006) Mirror Self-Recognition Beyond the Face. In: Child Development. Band 77, Nr. 1, S. 176–185, doi:10.1111/j.1467-8624.2006.00863.x.
- Povinelli, Daniel J.; Landau, Keli R. & Perilloux, Helen K. (1996) Self-Recognition in Young Children Using Delayed versus Live Feedback: Evidence of a Developmental Asynchrony. In: Child Development. Band 67, Nr. 4, S. 1540–1554, doi:10.2307/1131717
- Prior, H.; Pollok, B. & Güntürkün, O. (2000) Sich selbst vis-à-vis: Was Elstern wahrnehmen. In: Rubin. Nr. 2, 2000, S. 26–30 (dazu ein Artikel der Ruhr-Universität Bochum (Archivversion vom 24. Juli 2001)).
- Prior, H.; Schwarz, A. & Güntürkün, O. (2008) : Mirror-Induced Behavior in the Magpie (Pica pica): Evidence of Self-Recognition. In: PLoS Biology. Band 6, Nr. 8, S. e202, doi:10.1371/journal.pbio.0060202.
- Rahde, Tobias (2014) Stufen der mentalen Repräsentation bei Keas (Nestor notabilis). Dissertation Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie
- Rochat, Philippe & Zahavi, Dan (2014) Der unheimliche Spiegel. Eine Neubewertung der Spiegel-Selbsterfahrungsexperimente als Test für das Vorliegen von begrifflichem Selbstbewusstsein. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Band 62, Nr. 5, 2014, S. 913–936, DOI:10.1515/dzph-2014-0060
- Suarez, Susan D. & Gallup, Gordon G. Jr. (1981) Self-recognition in chimpanzees and orangutans, but not gorillas. In: Journal of Human Evolution. Band 10, Nr. 2, S. 175–188, doi:10.1016/S0047-2484(81)80016-4
- Suddendorf, Thomas & Collier-Baker, Emma (2009) The evolution of primate visual self-recognition: evidence of absence in lesser apes. In: Proceedings of the Royal Society B. Band 276, S. 1671–1677, doi:10.1098/rspb.2008.1754.
- Uchino, Emiko & Watanabe, Shigeru (2014) Self-recognition in pigeons revisited. In: Journal of the Experimental Analysis of Behavior. Band 102, Nr. 3, S. 327–334, doi:10.1002/jeab.112.
- Walraven, Vera; Elsacker, Linda van & Verheyen, Rudolf (1995) Reactions of a group of pygmy chimpanzees (Pan paniscus) to their mirror-images: Evidence of self-recognition. In: Primates. Band 36, Nr. 1, S. 145–150, doi: 101007/BF02381922.
der Freien Universität Berlin.
"Kurzfassung: Anhand des kognitiven Modells der Philosophin Joëlle Proust (2000) als theoretische Basis dieser Forschung wurden drei Versuchsreihen mit in Zoologischen Gärten gehatenen Keas (Nestor notabilis) durchgeführt, um hiermit Rückschlüsse auf eine mentale Repräsentation dieser Papageienart schließen zu können. Es zeigte sich, dass Keas die höchste getestete Stufe der Objektpermanenz (Stufe 6b „unsichtbares Verstecken“) erreichen, wobei die Männchen signifikant bessere Leistungen als die Weibchen zeigten. Sechs der neun Versuchstiere waren in der Lage nach einer kurzen Trainingsphase eine Kategorie für Keas anhand von Bildern auf einem Touchscreenmonitor von unbelebten Gegenständen zu unterscheiden. Hierbei wurden, unabhängig von der Größe des Bildes, bei den Keabildern signifikant häufiger der Flügel oder die Füße des Bildes berührt als dieses aufgrund der Fläche zu erwarten war. In der dritten Versuchsreihe verhielten drei der sieben Tiere sich in einerVariation des von Gallup erdachten Spiegeltests (Gallup 1970) so, dass man davon ausgehen kann, dass sie sich selbst im Spiegel wahrnahmen. Aus diesen Ergebnissen wird geschlossen, dass Keas die höchste Stufe des kognitiven Modells erreichen und zumindest über eine einfache Art der mentalen Repräsentation ihrer Selbst verfügen. Welche Schlüsse hieraus auf ein mögliches Bewusstsein gezogen werden können, muss jedoch offen bleiben. Schlagwörter: Nestor notabilis, Objektpermanenz, ategorienbildung, Selbsterkennung, Spiegel, mentale Repräsentation"
Beispiel: Was beweisen die Vergessenskurven von Ebbinghaus ?
Ebbinghaus hat drei auch heute noch grundlegende Vergessensmaße entwickelt: Reproduktion, Wiedererkennen und die Ersparnismethode. Lernt jemand 100 Worte und kann nach n Versuchsdurchgängen 30 richtig reproduzieren (Reproduktionsmethode), so dürfte die Rate für das richtige Wiedererkennen bei Vorlage bei gut dem Doppelten oder mehr liegen (Wiedererkennungsmethode). Brauchte jemand zum Erlernen der 100 Worte zwei Stunden, so wird die betreffende Versuchspersonen zu einem späteren Zeitpunkt deutlich weniger Zeit benötigen, z.B. nur eine Stunde (Ersparnismethode). Ebbinghaus hat damit sehr schöne operationale 'Vergessensgrößen', im Prinzip international normierte, Methoden zur Lern-, Behaltens- und Vergessensforschung vorgelegt, die den Verlauf von Vergessensprozessen erfassen. Zugleich hat er gezeigt, daß Vergessen als kontinuierlicher Prozeß verstanden werden kann.
Beispiel: Was beweist das Milgram Experiment ?
Kurzfassung: Das Milgram-Experiment beweist, dass viele Menschen in einem autoritären Situationsrahmen ohne kritische Rückfragen, Hemmungen oder besondere Widerstände zur Folter, einige sogar bis zum Tod der Probanden, fähig sind.
Die Fähigkeit zu Mord und Grausamkeit des Menschen sind allerdings längst durch das Verhalten der Menschen im Kriege oder in kriegsähnlichen Situationen als bewiesen anzusehen.
Milgram-Experiment und Kriegsverhalten liefern nur gruppenstatistische Beweise für bestimmte Häufigkeiten.
Beispiel: Was beweist der Zeigarnik-Effekt ?
| Der Zeigarnik-Effekt besagt, dass unerledigte Handlungen
doppelt so gut im Gedächtnis behalten werden als erledigte.
Der Beweis hat folgende Struktur: ProbandInnen werden hinsichtlich unerledigter und erledigter Handlungen befragt. Ihre Kooperation und subjektiv wahrheitsgemäße Mitwirkung wird vorausgesetzt. Die unterschiedlich vielen und mehr oder minder richtigen Erinnerungen werden hinsichtlich der beiden Ausgangsbedingungen erledigt/ unerledigt ausgezählt. Es wird angenommen, dass die Definitionen für erledigte, unerledigte Handlungen und Güte der Erinnerungen zutreffend vorgenommen wurden. Aus dem Ergebnis, dass im Durchschnitt nahezu doppelt so viele unerledigte als erledigte erinnert wurden, schließt Zeigarnik das nach ihr benannte Ergebnis. |
Bluma Zeigarnik fasst ihre Ergebnisse (1927) wie folgt zusammen (PDF, S. 84f): "Zusammenfassend ergibt sich:
- Die unerledigten Handlungen werden besser, und zwar durchschnittlich
nahezu doppelt so gut behalten wie die erledigten.
Dabei ist in unseren Versuchen nicht die Gefühlsbetonung oder die Eindringlichkeit der Aufgabe, aber auch nicht die Schockwirkung beim Unterbrechen maßgebend, sondern der Umstand, ob im Zeitpunkt des Abfragens ein Quasibedürfnis besteht, das durch die Vornahme oder im Verlauf der Arbeit entstanden ist.
Dies Quasibedürfnis entspricht einer Spannung, die sich nicht nur in der Richtung der ursprünglichen Vornahme (die Aufgabe zu erledigen), sondern auch beim Reproduzieren auswirkt.
Wie sehr das Quasibedürfnis beim Reproduzieren in Erscheinung tritt, hängt von der Intensität und Struktur der Spannung ab, ferner von der Stärke und Art des Reproduktionswillens, der im Moment des Abfragens entsteht. Da nämlich der Rp.-Wille gleichgerichtet mit den Quasibedürfnissen ist, kann er deren Wirkungen vollkommen verdecken, falls er stark genug ist. Das ist der Fall, wenn die Vp. das Abfragen als selbständige ,,Gedächtnisprüfung" auffasst, nicht aber, wenn sie beim Abfragen frei dem V1. über die Versuche Bericht erstattet.
Entscheidend für das Fortbestehen des Quasibedürfnisses ist nicht das äußerliche Fertig- oder Unfertigsein der Arbeit, sondern das innerliche Unerledigtsein der Handlungen (Aufgaben, bei denen die Vp. mit ihrer Leistung nicht zufrieden ist, oder die mehrere Lösungsmöglichkeiten enthalten, werden auch als ,,erledigte" gut behalten. Das gleiche gilt von interessanten Aufgaben). Ähnlich liegt der Sachverhalt bei den unerledigten Aufgaben: äußerlich unfertige Handlungen, bei denen aber das Erledigungsbedürfnis gestillt oder verschwunden ist, werden schlecht behalten (Aufgaben, bei denen Teilerledigung eintritt, ,,zerstörte" und ,,aufgegebene" Aufgaben haben ein kleines BU).
Wenn hinter dem Quasibedürfnis ausgeprägte echte Bedürfnisse stehen, wenn die zentrale ,,Ichsphäre" des Menschen berührt wird, so sind die bedürfnisartigen Spannungen starker. (Für ehrgeizige Vpn. überwiegen die unerledigten Handlungen beim Aufzählen in besonders hohem Maße ebenso für Handlungen, die besonders stark den Ehrgeiz erwecken.)
Der Unterschied zwischen erledigten und unterbrochenen Handlungen beim Behalten ist für Endhandlungen sehr viel ausgeprägter als für 'fortlaufende' Handlungen. Das hängt damit zusammen, in welchem Grade diese verschiedenen Handlungsstrukturen zur Ausbildung besonderer selbständiger Spannungssysteme führen.
Die gespannten Systeme wirken sich nur dann in Reproduktionen aus, wenn sie voneinander genügend getrennt sind. Haben die einzelnen Handlungen für die Vp. kein ausgeprägtes Gesicht, so entspricht dem Gesamtversuch nur ein einziges Spannungssystem. (Bei Vpn., denen man alle Versuchsarbeiten schon am Anfang des Versuches bekannt gibt, oder bei Vpn., die die einzelnen Arbeiten nur als nebensächliche ,,Beschäftigung" betrachten, tritt kein Überwiegen der unerledigten Handlungen ein.)
Für das Entstehen der gespannten Systeme ist ferner eine genügende Festigkeit des dynamischen Gesamtfeldes notwendig. Im Falle eines ,,Flüssigwerdens" (bei Müdigkeit) oder bei zu großen Druckschwankungen im psychischen Gesamtfeld, z. B. bei zu großer Aufgeregtheit, kommt es nicht zur Ausbildung von Spannungen. Bereits bestehende Spannungssysteme werden durch Situationsänderung (,,Durchschütteln" oder Durchkreuzen mehrerer Situationen) aufgelöst.
Die Stärke, in der sich solche bedürfnisartigen Spannungen herausbilden und erhalten bleiben, scheint individuell verschieden und für jedes Individuum in hohem Maße konstant zu sein.
Je ungebrochener die Bedürfnisse des Menschen sind, je weniger er auf die Stillung des Bedürfnisses verzichten kann, je ,kindlicher" and natürlicher er im Versuch steht, desto starker ist bei ihm das Überwiegen der unerledigten Handlungen."
Beispiel: Was beweist die Ausführung eines posthypnotischen Befehls ?
Kurzfassung: Die Ausführung eines posthypnotischen Befehls, von dem der Ausführende nichts weiß, beweist dass es eine nichtbewusste Steuerung gibt. Mit welcher Reichweite und Tiefe ist an dieser Stelle offen.
In der Kriminologie und forensischen Psychopathologie ist stellt die wichtige Frage, ob im Zustand der Trance durch Hypnose Befehle erteilt werden können, die die Ausführung von Verbrechen zum Inhalt haben. Und falls, würde die Ausführung zur Schuldunfähigkeit führen.
Wie kann man einen freien Willen beweisen ?
- Beispiel: [> Psychologisches Beweisexperiment zum freien Willen]
Zunächst sind einige Grundfragen im Vorfeld zu lösen:
(1) Was soll unter freiem Willen verstanden werden. (2) Was soll unter
freiem Willen operational verstanden werden? (3) Welcher
Hypothesenraum (z.B. vollständige, totale Freiheit oder teilweise,
partielle Freiheit, also Freiheitsgrade unter dieser oder jenen Bedingungen?)
soll für freien Willen zugrunde gelegt werden?
Beispiel: Was beweisen die Worte, die ein dreijähriges Kind aussprechen kann ?
Ganz allgemein wird durch die Worte, die ein dreijähriges Kind ausspricht bewiesen, dass die Sprachentwicklung im Gange ist.
Eine speziellere Fragestellung zu diesem Thema wäre: Wie ist der sprachliche Entwicklungsstand eines Kindes?
Andere Fragestellungen: Welche Worte kann es? Einwortsatz? Richtiger Satz? Wie stellt man fest, ob ein Kind ein Wort versteht?
Beweisgrundlagen, -fragen und Beispiele Forensische Psychologie und Psychopathologie
(1) Rechtliche und
kriminologische Beweisprinzipien und Regeln
Allgemein und übergeordnete Gesichtspunkte zu Beweisfragen im
forensischen Bereich ergeben sich durch Gesetz, Rechtsprechung und Entwicklung
der kriminologischen Wissenschaft:
(2) Zuordnungsproblem
Rechtsbegriffe und Bereichsbegriffe
Eines der größten und bislang von der Rechtswissenschaft
ungelösten Probleme betrifft die Bedeutung der Rechtsbegriffe und
ihre Übersetzung- und Zuordnungsregeln in Fachbegriffe. Wie man es
lösen kann und vielleicht auch sollte, habe ich hier dargelegt:
(3) Mindestanforderungen
an forensisch-wissenschaftliche Gutachten
Weiter ist von großer Bedeutung für die praktische Gutachtenarbeit,
was überhaupt unter einem wissenschaftlichen Gutachten zu verstehen
ist, welche allgemeinen Mindestanforderungen an sie zu stellen sind:
(4)
Beweisbeispiele Forensische Psychologie, Psychopathologie und Psychiatrie.
- Überblick der
bearbeiteten Beweis-Themen:
- Beispiel: Wie beweist man, was für eine Bindung ein Kind an Bezugspersonen hat?
- [> Kindeswohl-Kriterien]
- [> Über Bindung, Beziehung und das Messen inder Psychologie.]
- [> Grundprobleme der Bindungsforschung. Eine allgemeine und integrative Forschungshypothese zur Bindung. Bindungsforschung im Internet (Auswahl).]
- [> Bindungs-Paradoxa, pathologische Bindungen und andere nicht ohne weiteres verständliche Bindungserscheinungen - auch im Alltag.]
- Beispiel: [> Zur Psycho-pathologischen Beurteilung der Geschäfts-un-fähigkeit]
- Beispiel: wie beweist man die Glaubhaftigkeit einer Aussage? [> Aussagepsychologie]
- Beispiel: [> Zur Psycho-pathologischen Beurteilung der Geschäfts-un-fähigkeit]
- Beispiel: Wie beweist man, ob im Zeitraum t eine Hörigkeitsbeziehung vorlag ? [> Kommentierte Literaturübersicht Hörigkeit.]
- Beispiel [> Schuld-un-fähigkeit]
- Beispiel [> Einsichtsfähigkeit]
Wie
beweist man, was für eine Bindung ein Kind an Bezugspersonen hat
?
Der Bindungsbegriff ist einerseits ein Rechtsbegriff
vom Typ Generalklausel, also offen und unvollständig,
in Entwicklung und Veränderung. Es gibt demnach rechtlich keine Definition,
sondern nur Charakterisierungen und Bestimmungsmerkmale. Das ist rein rechtlich
und forensisch die erste Schwierigkeit. Denn um feststellen zu können,
was für eine Bindung eines Kindes an seine Bezugspersonen vorliegt,
muss der Bindungsbegriff fachlich geklärt sein.
Ganz allgemein ergeben sich für den Bindungsbegriff
folgende Bedeutungsbereiche, die jeweils durch einen entsprechenden Index
spezifiziert werden:
- Bindung? unklar Bedeutungsbereich, der Bedeutungsbereich kann bestenfalls aus dem Zusammenhang erschlossen werden
- Bindunga im Sinne des Alltagssprachgebrauch
- Bindungb im Sinne des Bildungssprachgebrauch.
- BindungFamR im Sinne des Familienrechts
- Bindungfpsy(FamG) im Sinne der Entwicklungs- und Familienpsychologie.
- Bindungfpsy(FamG) im Sinne der Entwicklungs- und Familienpsychologie orientiert an den Bestimmungsmerkmalen des Familienrechts.
- Bindungpsychiat im Sinne der Psychiatrie
- Bindungpsypath im Sinne allgemeiner Psychopathologie, wobei hier besonders pathologische Bindungen (dependente, paradoxe) interessieren könnten.
- Bindungpfl im Bereich der Pflege und Betreuung.
- Bindungstat. im Sinne statistischer Erfassung (falls die Bindung statistisch erfasst würde, sei es offiziell oder im Rahmen von Forschungen).
- Bindungx sonstig interessierender Bereich, hier nicht erfasst (z.B. Theologie, Bindung an Götter, Geister, ...)
Für die praktische Begutachtung ist hier wünschenswert
eine theoriegeleitete operationale Begriffsanalyse, die auf nachvollziehbaren
Forschungsdaten beruht. Im Gutachten wird oder sollte stehen, welche Bindungsbegrifffpsy(FamG)
dem Gutachten zugrunde liegt und welche Methodenfpsy angewandt
wurden, um die Bindungfpsy(FamG) im vorliegenden Einzelfall
festzustellen. Dazu gehören dann auch Ausführungen zur Sicherheit
der Befundergebnisse.
Beweisbeispiele Psychopathologie
Beispiel Autismusforschung
Spektrum der Wissenschaft berichtete im April 2007 zum Autismus über
einige neuere Hypothesen:
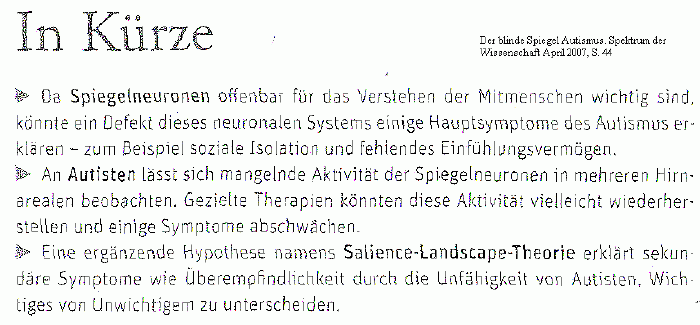
Unter anderen wird von einem interessanten Versuch berichtet, der die Hypothese einer Spiegelneuronenstörung sehr stark unterstützt und damit einen besonderen Beweisindizwert hat.
Spiegelneuronen-Defizit-Hypothese:
Lernen durch Beobachtung anderer bei Autisten gestört ?
Führen Versuchspersonen eine kontrollierte Bewegung aus, z.B.
eine geschlossene Hand öffnen, so kommt es während der Muskelbewegung
zur Unterdrückung des relativen Amplitudenausschlages - bei Gesunden
und auch bei Autisten. Bei Beobachtung einer solchen Handlung kommt es
aber nur bei "Gesunden" zur gleichen Reaktion: die sog. m-Welle
wird unterdrückt, was man so deutet: ob diese Handlung selbst ausgeführt
oder "nur" bei anderen beobachtet wird ist für "Gesunde" einerlei.
Beobachten hingegen Autisten eine solche Handlung, kommt es zu keiner
m-Wellen
Unterdrückung.
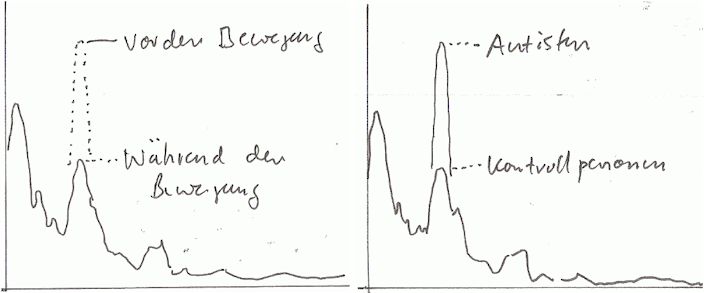
Daraus zogen die Forscher den Schluss, dass das Spiegelneuronensystem bei Autisten "gestört" ist. Vom autistischen Standpunkt aus betrachtet kann man natürlich eben so gut sagen, dass das Spiegelneuronensystem der sog. "Gesunden" "gestört" ist, abermals ein Beleg dafür, wie sehr die Merkmalsdeutung "gestört" oder "gesund" von der Perspektive oder von der Beurteilerbasis abhängt.
Die Frage, die sich hier stellen, sind:
1) Trifft das auf alle Autisten zu?
2) Trifft es es nur auf Autisten zu?
3) Trifft es immer bei Autisten zu oder gibt es Bedingungen, wo es
nicht zutrifft?
Diese Fragen beantwortet der Versuch nicht. Es ist natürlich durchaus möglich, vermutlich sogar eher naheliegend, dass es mehrere und unterschiedliche Störungen gibt, zu denen dieses Symptom gehört.
Metapher-Verständnis-Defizit:
Der Buba-Kiki-Test
Die Zuordnung von Formen und Klängen funktioniert bei Autisten
anders als bei Kontrollpersonen (Nicht-AutistInnen). Während Kontrollpersonen
mit dem Klangbild von "Buba" rund und mit dem Klangbild von "Kiki" eher
etwas Spitzes verbinden, gelingen solche Zuordnungen bei AutistInnen nicht.
Die örtliche Zuständigkeit wird beim Gyrus angularis (Kreuzung
Sehzentrum, Hören und Tastempfinden) vermutet, wobei aus solchen neuroanatomischen
Zuordnungen meist nichts wirklich Strenges folgt. Die Argumentation der
AutorInnen ist selbst sehr metaphorisch, wenn sie ausführen, dass
in diesem Hirngebiet Neuronen lokalisiert sein sollen, die ähnlich
wie Spiegelneuronen funktionieren. Nichtautistische Personen mit Schädigungen
in diesem Hirngebiet sollen beim Buba-Kiki ähnlich ausgeprägt
"versagen" wie AutistInnen. So bleiben auch die spekulativen Phantasien
der AutorInnen sehr im entwertenden Dunkeln (die, mangels Spiegelneuronen,
nur nach Erdnüssen, statt nach den Sternen greifen können) .
In diesem Zusammenhang wird auch mitgeteilt, dass AutistInnen Probleme
mit dem Imitieren haben, so etwa die Mutter nach machen, wenn sie die Zunge
herausstreckt. Dunkel bleibt auch, wie eine Verhaltenstherapie vor Auftreten
der ersten Symptome möglich sein soll, noch dazu, wenn diese sich
zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr ausbilden sollen. Wieso sollte
man jemand behandeln, der keine Symptome zeigt? Wogegen denn?
Störung
des emotionalen Bewertungssystems: Salience-Landscape-Theory.
"UM GEWISSE SEKUNDÄRE AUTISMUSSYMPTOME ZU ERKLÄREN - Überempfindlichkeit,
Vermeiden von Blickkontakt, Abneigung gegen bestimmte Geräusche -
wurde die so genannte Salience-Landscape-Theorie entwickelt. Bei einem
gesunden Kind wandern die Sinnesdaten zum Mandelkern, dem Tor zum limbischen
System, das Emotionen verarbeitet. Der Mandelkern nutzt gespeichertes Vorwissen,
um zu bestimmen, wie das Kind emotional auf jeden Reiz reagieren soll.
Auf diese Weise entsteht eine Art Wichtigkeitslandschaft (salience landscape)
der kindlichen Umwelt. Doch bei Kindern mit Autismus sind die Verbindungen
zwischen den sensorischen Arealen und dem Mandelkern offenbar verändert;
darum reagieren Autisten auf unbedeutende Ereignisse oder Objekte mit extremen
Emotionen"
Diese Interpretation ist in sich widersprüchlich
und entwertend. Für Autisten sind "Nebensächlichkeiten" von "Gesunden"
eben keine Nebensächlichkeiten. Ihr Bewertungssystem funktioniert
anders.
Die AutorInnen vermuten spekulativ, dass Schläfenlappenepilepsien,
die bei jedem 3. autistischen Kind ausgemacht werden konnten, für
die "autistische Erregung" verantwortlich sein könnten.
Literaturhinweise im Spektrum Artikel:
- Hirstein, William; Iversen, Portia & Ramachandran, V.S. (2001). Autonomic responses of autistic children to people and objects. Proceedings of the Royal Society of London B, 268, pp 1883-
- Oberman, Lindsay M. (2005). EEG evidence for mirror neuron dysfunction in autism spectrum disorders. Cognitive brain research, 24, pp 190-
- Ramachandran, Vilayanur & Oberman, Lindsay M. (2007). Der blinde Spiegel Autismus. Spektrum der Wissenschaft, April 2007, 43-49.
- Info bei "Quarks" [Adresse, PDF zur Sendung, Selbsttest, ]
Allgemeines
Beweisprinzip dieses Experimentiertyps
| Experimentiergruppe | Kontrollgruppe | |
| Bedingung 1 | Merkmal so vorhanden oder nicht | Merkmal so vorhanden oder nicht |
| Bedingung 2 | Merkmal so vorhanden oder nicht | Merkmal so vorhanden oder nicht |
| Es gibt dann die Möglichkeiten:
(1) B1_M(E) gleich B1_M(K) (2) B1_M(E) ungleich B1_M(K) (3) B2_M(E) gleich B2_M(K) (4) B2_M(E) ungleich B2_M(K) |
(1) und (3) erlauben wie (2) und (4) keine Schlussfolgerungen: beide
reagieren entsprechend.
Aber (1) und (4) erlauben wie (2) und (3) Schlussfolgerungen.
|
Beweisbeispiele Psychotherapie
Eines der wichtigsten und umstrittensten Beweisthemen der Psychotherapie ist die Frage ihrer Wirksamkeit.
Zustand der Psychowissenschaften
Der Wissenschaftsbetrieb außerhalb der Mathematik und Naturwissenschaft erscheint in beachtlichen Teilen ziemlich verwahrlost. Nichtssagende Oberflächlichkeit (Beispiel Signifikanztest) und tiefgreifende Korruptheit beherrschen die psychologische Mess-, Skalen- und Testtheorie. Masse statt Klasse gilt in den die Psychowissenschaften, wenn auch nicht nur dort. Die allgemeine nomothetische Orientierung hilft in so gut wie keinem Einzelfall. Ordentliche wissenschaftliche Begründungen sind Mangelware. Veröffentlichungen auf Teufel komm raus führen auch dazu, dass der Teufel wirklich rauskommt. Verantwortlich ist in Deutschland im wesentlichen die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, die weitgehend unfähig oder unwillig ist, für eine saubere, solide und wahrhaftige psychologische Forschung und ihre wissenschaftliche Grundlegung zu sorgen. In der psychosomatischen Medizin und Psychiatrie - ganz extrem in der forensischen Psychiatrie - sieht es nicht besser aus. Die Psychowissenschaften sind unter Führung der amerikanischen Psychologie hochgradig angefault, wie z.B. auch der in der Psychologie so verbreitete Hochstapler-Zitierstil zeigt.
Medien-Material zum Zustand der Psychowissenschaften
"Psychologie Auf zwei von drei Studien ist kein Verlass Replizierbarkeit
ist in der Wissenschaft so etwas wie ein Naturgesetz: Wenn man ein Experiment
unter den gleichen Versuchsbedingungen wiederholt, sollte auch dasselbe
herauskommen, wenn die Ergebnisse vertrauenswürdig sein sollen. 270
Forscher von fünf Kontinenten haben versucht, 100 psychologische Studien
zu replizieren, die in Fachjournalen veröffentlicht worden waren.
Das vernichtende Ergebnis: Während in 97 Prozent der Originalstudien
ein statistisch auffälliger Zusammenhang zwischen den gemessenen Größen
gefunden worden war – ein „überzufälliger“ Zusammenhang –, waren
es bei replizierten Untersuchungen nur 36 Prozent. ..." [Berliner
Morgenpost 31.08.2015]
Literatur (Auswahl) > Lit. Beweis und Beweisen in Wissenschaft und Leben.
Vorbemerkung: Beweis und beweisen ist in der psychologischen Wissenschaftstheorie meist kein eigenes Thema. So kommt das Wort "Beweis" in den Methodologischen Grundlagen der Psychologie der Enzyklopädie für Psychologie im Sachregister gar nicht vor. Am nächsten kommt der Problematik das Kapitel "Theorienbewertung" von Gadenne.
- Bunge, Mario & Ardila, Ruben (dt. 1990, 1987 engl.) Wissenschaftliche Psychologie. In (85-92) Philosophie der Psychologie. Tübingen: Mohr (Siebeck). Im Sachregister kommt das Wort "Beweis" nicht vor.
- Bunge, Mario (dt. 1983, 1980 engl.) Psychologie. In (105-114) Epistemologie. Aktuelle Fragen der Wissenschaftstheorie. Mannheim: BI. Das Buch enthält kein Sachregister. Im Inhaltsverzeichnis kommt das Wort "Beweis" nicht vor.
- Enzyklopädie der Psychologie (Gesamtübersicht PDF Abruf 24.11.2019)
- Bd. 1 Methodologische Grundlagen der Psychologie hrsg. von Herrmann & Tack (1994, Hrsg.) Im Sachregister kommt das Wort "Beweis" nicht vor.
- Bd. 2 Datenerhebung
- Bd. 3 Messen und Testen
- Bd. 4 Strukturierung und Reduzie-rung von Daten
- Bd. 5 Hypothesenprüfung
- Hartmann, Dirk (1998) Philosophische Grundlagen der Psychologie. Darmstadt: WBG. Im Sachregister kommt das Wort "Beweis" nicht vor.
- Hartmann, Dirk (1993) Naturwissenschaftliche Theorien. Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie. Mannheim: BI. Im Sachregister der im Buch normierten Begriffe kommt das Wort "Beweis" nicht vor.
- Mikulinskij, S. R. & Jaroševskij, M. G. (1970) Psychologie des wissenschaftlichen Schaffens und Wissenschaftslehre., Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie March 1970, Volume 1, Issue 1, pp 83–103
- Rüssmann: Literatur zum Beweisrecht.
- Walach, Harald (2013) Psychologie : Wissenschaftstheorie, philosophische Grundlagen und Geschichte: ein Lehrbuch
- Wolf, Rainer (1993). Sinnestäuschung und "New Age"-Esoterik: aktuelle Parawissenschaft kritisch betrachtet. Skeptiker, 6, 4, 88-100.
- Wundt, Wilhelm (1896) Über die Definition der Psychologie. (Separatabdruck aus Wundt, Philosophische Studien. XII. Bd. l. Heft.). In der Arbeit kommt das Wort "Beweis" drei mal vor: (1) "Hiernach beweist auch die tatsächliche Entwicklung der naturwissenschaftlichen Abstraktionen und Begriffsbildungen überzeugend die Fehlerhaftigkeit der besprochenen Definition. (2) "Der entscheidende Beweis liegt aber darin, dass eine unbefangene und voraussetzungslose Behandlung einer empirischen Wissenschaft sich stets ohne die Geltendmachung irgend eines bestimmten metaphysischen Standpunktes durchführen läßt." (3) " Das Prinzip der "Aktualität des Geschehens" will zunächst nicht eine Voraussetzung ausdrücken, die der Interpretation der psychischen Vorgänge zu Grunde zu legen sei, sondern eine tatsächliche Eigenschaft, die diesen zukommt. Demjenigen, der diese Eigenschaft leugnen wollte, der also behauptete, unsere Vorstellungen z. B. seien nicht Vorstellungsakte, die einen bestimmten Verlauf haben, sondern Objekte mit bleibenden Eigenschaften, dem ließe sich natürlich nicht das Gegenteil beweisen. Sobald man aber die Tatsache zugesteht, was, wie ich meine, Jeder tun muß, der überhaupt einmal auf sie aufmerksam gemacht worden ist, so hat der Ausdruck "Aktualitätstheorie" nur noch darin seine Berechtigung, dass er zugleich einen Gegensatz gegen die Substantialitätstheorie ausdrückt."
_
Links (Auswahl)
- Müllers Science Links zum Thema Psychologie als Wissenschaft.
- Haas: Abgrenzungen von Wahrheit, Wissen, Beweis, Redlichkeit und Glaubwürdigkeit - eine Methodendiskussion in der forensischen Psychologie.
Glossar, Anmerkungen, Endnoten: > Eigener wissenschaftlicher Standort.
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Dedekind - Was sind und sollen die Zahlen?
"Vorwort zur ersten Auflage.
Was beweisbar ist, soll in der Wissenschaft nicht ohne Beweis geglaubt werden. So einleuchtend diese Forderung erscheint, so ist sie doch, wie ich glaube, selbst bei der Begründung der einfachsten Wissenschaft, nämlich desjenigen Teiles der Logik, welcher die Lehre von den Zahlen behandelt, auch nach den neuesten Darstellungen *) noch keineswegs als erfüllt anzusehen. Indem ich die Arithmetik (Algebra, Analysis) nur einen Teil der Logik nenne, spreche ich schon aus, daß ich den Zahlbegriff für gänzlich unabhängig von den Vorstellungen oder Anschauungen des Raumes und der Zeit, daß ich ihn vielmehr für einen unmittelbaren Ausfluß der reinen Denkgesetze halte. Meine Hauptantwort auf die im Titel dieser Schrift gestellte Frage lautet: die Zahlen sind freie Schöpfungen des menschlichen Geistes, sie dienen als ein Mittel, um die Verschiedenheit der Dinge leichter und schärfer aufzufassen. gewonnene stetige Zahlen-Reich sind wir erst in den Stand gesetzt, unsere Vorstellungen von Raum und Zeit genau zu untersuchen, indem wir dieselben auf dieses in unserem Geiste geschaffene Zahlen-Reich beziehen *). Verfolgt man genau, was wir bei dem Zählen der Menge oder Anzahl von Dingen tun, so wird man auf die Betrachtung der Fähigkeit des Geistes geführt, Dinge auf Dinge zu beziehen, einem Dinge ein Ding entsprechen zu lassen, oder ein Ding durch ein Ding abzubilden, ohne welche Fähigkeit überhaupt kein Denken möglich ist. Auf dieser einzigen, auch sonst ganz unentbehrlichen Grundlage muß nach meiner Ansicht, wie ich auch schon bei einer Ankündigung der vorliegenden Schrift ausgesprochen habe **), die gesamte Wissenschaft der Zahlen errichtet werden. Die Absicht einer solchen Darstellung habe ich schon vor der Herausgabe meiner Schrift über die Stetigkeit gefaßt, aber erst nach Erscheinen derselben, und mit vielen Unterbrechungen, die durch gesteigerte Amtsgeschäfte und andere notwendige Arbeiten veranlaßt wurden, habe ich in den Jahren 1872 bis 1878 auf wenigen Blättern einen ersten Entwurf aufgeschrieben, welchen dann mehrere Mathematiker eingesehen und teilweise mit mir besprochen haben. Er trägt denselben Titel und enthält, wenn auch nicht auf das beste geordnet, doch alle wesentlichen Grundgedanken meiner vorliegenden Schrift, die nur deren sorgfältige Ausführung gibt; als solche Hauptpunkte erwähne ich hier die scharfe Unterscheidung des Endlichen vom Unendlichen (64), den Begriff der Anzahl von Dingen (161), den Nachweis, daß die unter dem Namen der vollständigen Induktion (oder des Schlusses von n auf n 1) bekannte Beweisart wirklich beweiskräftig (59, 60, 80), und daß auch die Definition durch Induktion (oder Rekursion) bestimmt und widerspruchsfrei ist (126). Diese Schrift kann jeder verstehen, welcher das besitzt, was man den gesunden Menschenverstand nennt; philosophische oder mathematische Schulkenntnisse sind dazu nicht im geringsten erforderlich."
__
Fieber = "Reizung des Wärmezentrums im Hypothalamus durch Bluttoxine, körperfremdes Eiweiß oder verminderte Wärmeabgabe. Noch normal sind (bei körperl, und seel. Ruhe) Temperaturen axillar bis 37,2° und rektal bis 37,7°. Der Körper-Kerntemperatur (= in der Aorta) am nächsten kommt die sublinguale = 0,4 ° niedriger. Axillar liegt die T. bis l ° unter, rektal 0,5° über der Kern-T. Einteilung: bis 38°C subfebrile Temp., bis 38,5 °C mäßiges Fieber, über 39 °C hohes F." (nach Bärschneider) Tritt auf bei Infektionen (z.B. "Grippe") auch als Folge oder Begleiterscheinung anderer Erkrankungen (z.B. "Krebs")
__
Generalklausel
Wortschöpfung des Rechtswesens. Eine Generalklausel repräsentiert einen unbestimmten Rechtsbegriff. Hierzu einige Ausführungen am Beispiel der Generalklausel oder des unbestimmten Rechtsbegriffs KindeswohlFamG.
Der Begriff des KindeswohlsFamG ist nicht abschließend und vollständig definiert [FN1]. Es gehört zum Wesen der juristischen Methodologie, dass sie, da sie es mit Lebendigem, Wachsendem, sich Veränderndem des Soziallebens aber auch der Wissenschaft zu tun hat, diesen Veränderungen auch in ihrer Begrifflichkeit Rechnung tragen muß [FN2]. Greift man die Formel Kindeswohl mit Argumenten an, diese Formel sei völlig unbestimmt, so ist das - mittlerweile - schlicht und einfach falsch. Richtig ist vielmehr: die Formel Kindeswohl ist nicht völlig bestimmt, aber es gibt viele Kennzeichnungen und Definitionsmerkmale sowohl positiver (was zum Kindes-wohl gehört) als auch negativer Art (was nicht unbedingt zum Kindeswohl gehört). Die JuristInnen arbeiten sozusagen mit wachstumsfähigen und änderungsfreundlichen Begriffen und tragen damit der Flexibilität des Lebens, Soziallebens und dem Stand der Wissenschaft und des Wissens Rechnung.
- FN1 Im Grußwort des Präsidenten des deutschen
Familiengerichtstages, Dr. Gerd Brudermüller, wird ausgeführt:
„Wie schwer der Begriff Kindeswohl in der Praxis umzusetzen ist, zeigt
etwa ein Blick in die Kommentierung des kürzlich erschienenen 8. Bandes
des Münchener Kommentars. Dort werden beispielsweise zu § 1671,
Abs. 2 Nr. 2 BGB insgesamt 37 Entscheidungskriterien zur Begriffsausfüllung
erörtert. Und damit nicht genug, denn wenn es um die Entscheidung
im Einzelfall geht, sind wieder die Psychologen gefragt.“ Praxis der Rechtspsychologie
13 (Sonderheft 1), Januar 2003, Tagungsbericht: Das Kind bei Trennung und
Scheidung, S. 5
FN2 Zippelius, R. (1974). Einführung in die juristische Methodenlehre, Abschnitt "Logischer Kalkül und Datenverarbeitung im Recht". München: C. H. Beck. S. 113f:
- "Übrigens ist es sehr zweifelhaft, ob man - selbst dann, wenn
es möglich wäre - eine völlig exakte Rechtssprache
anstreben sollte. Es ginge nämlich mit dem Bedeutungsspielraum auch
die Elastizität der Rechtsnormen, also die Anpassungsfähigkeit
der generellen Normen an die Vielgestaltigkeit der konkreten Umstände
verloren."
Quasibedürfnis Ausdruck Kurt Lewins und seiner Schule. Im Dorsch (1994) wird ausgeführt: "Quasibedürfnis, eine von LEWIN (1926) eingeführte Bez. für abgeleitete Bedürfnisse, die gewöhnlich von den ursprünglichen B. abhängig bleiben: Wirkungen von Vornahmen, Vorsätze. Nach ZEIGARNIK sind Q. Nacheffekte unerledigter Handlungen. > ZEIGARNIK-Effekt"
___
Rechtsbegriff
Die Worte in den Gesetzen bedeuten meist Rechtsbegriffe. Praktisch-forensisch ist sehr wichtig, zu wissen und zu berücksichtigen, dass Beurteilung und Beweiswert von Rechtsbegriffen der Justiz obliegt. Da es keine Sprachregelungen (Zuordnungsregeln Rechtsbegriffe und Fachbegriffe), gibt, ist dieses Feld weitgehend chaotisch desorganisiert und eine extreme und nicht akzeptable Quelle ständiger Missverständnisse, für die im wesentlich die Rechtswissenschaft die (Un-) Verantwortung trägt.
___
Selbstbewusstsein. In der Alltags- und Bildungssprache wird Selbstbewusstsein meist in der Bedeutung von positivem Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen oder Selbstsicherheit gebraucht. Ich verstehe unter Selbstbewusstsein im engeren, rein psychologischen Sinne, das Wissen, das ein Mensch von sich selber hat, z.B.: ich weiß wer ich bin und wer nicht bin; ich weiß, was ich kann und nicht kann; ich weiß, was ich möchte und nicht möchte. > Selbst.
___
Stichworte für ergänzende und vertiefende Themen
Simulieren * Dissimulieren * Erkenntnisinteresse * Tendenzinteresse * Abwehr * Lügen * Verleugnen * Irrtum * Illusion * Gewißheit * Überzeugung * Glauben * Wahn * wähnen *
Standort Beweis und beweisen in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie.
*
Beweis und beweisen in Metaphysik, Esoterik und Grenzwissenschaften.
Wissenschaft in der IP-GIPT.
Überblick: Abstrakte Grundbegriffe aus den Wissenschaften.
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Beweis beweisen site: www.sgipt.org * Logik site: www.sgipt.org |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Beweis und beweisen in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie. Blicke über den Zaun zum Auftakt für eine integrative psychologisch-psychotherapeutische Beweislehre. Abteilung Abstrakte Grundbegriffe aus den Wissenschaften: Analogien, Modelle und Metaphern für die allgemeine und integrative Psychologie und Psychotherapie sowie Grundkategorien zur Denk- und Entwicklungspsychologie. Internet Publikation - General and Integrative Psychotherapy. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/gb/beweis/b_ppp.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
kontrolliert (rsp): irs 25.01.2013
Änderungen - Wird gelegentlich vervollständigt, ergänzt überarbeitet - Anregungen und Kritik erwünscht.
02.09.23 Genaue Quellenangabe Dedekind-Zitat.
14.11.20 Neugestaltung Das individuelle Erlebensproblem, Korrektur und Überarbeitung Selbstbeobachtung und innere Wahrnehmung.
20.07.20 Modell des Erlebens und der Bewustseinsfunktionen.
19.11.19 Einfaches Beweisverfahren für Ursache, Wirkung und Kausalität u.a. erfasst und verlinkt.
01.10.18 Ankündigung Sätze der Psychologie integriert.
10.08.18 Zustand der Psychowissenschaften.
25.06.18 Neuer Abschnitt eingeschoben: Vorbild (bis Die zentrale Beweisfrage der Psychologie lautet:)
15.05.18 Beispiel: Sich selbst erkennen.
12.02.17 Allgemein-Psychologischen-Referenz-Modell.
27.07.15 Hinweis auf die Realität des Psychischen und die Theorie der zwei Welten.
25.07.15 Das Leib-Seele-Problem und seine Lösung in der allgemein-integrativen Psychologie.
11.03.14 Beweis-Paradigma Anlage - Umwelt mit Allgemeinem Versuchsplan zur Erblichkeit über Verwandtschaftsgrade.
19.08.13 Den wichtigen Unterschied zwischen innerer Wahrnehmung und Selbstbeachtung nach Wundt (1888) eingefügt. Ergänzungen und Korrekturen.
25.01.13 Ausführliche Neubearbeitung, u.a. Zu einigen bedeutsamen Beweisfragen in der Psychologie gelöscht und in Grundlegende Beweisfragen der Psychologie eingearbeitet Paradigmatische Beweismethoden und Beweismittel in der Psychologie.
08.06.08 Grundlegende psychologische Beweisfragen, Paradigmatische Beweismethoden und Beweismittel in der Psychologie.
30.04.07 Beispiele Autismusforschung.
12.09.04 Beispiel Erinnerungsbild Ziehen. Versuch zum Beweis für das Wiedererkennen.