(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=07.04.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 24.07.24
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Beweis und beweisen in der Psychologie, besonders zu Erleben und Erlebnis_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Abteilung Wissenschaftstheorie in der Psychologie, Bereich Beweistheorie, und hier speziell zum Thema:
Beweis und beweisen in der Psychologie,
besonders zu Erleben und Erlebnis
Beweisregister
Psychologie.
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
„Was beweisbar ist, soll in der Wissenschaft nicht ohne Beweis geglaubt
werden.“
(Dedekind Was sind und sollen die Zahlen? 1872, Vorwort
erster Satz).
Beweisregister Psychologie * Übersicht Beweisseiten * Wissenschaftliches Arbeiten * Aristoteles Zum Geleit * Definition und definieren * Begriffscontainer (Containerbegriff)
Editorial
Zum Thema Beweis habe ich 2003 begonnen Internetseiten zu erstellen, die ich unregelmäßig ergänzt habe. Aber schon vorher spielte das Beweisthema in meiner Testentwicklung (>Summenscorebeweis Rührig 1982/83; Zuf13) und forensisch-psychologischen Arbeit (Aussagepsychologie, Familienrecht) eine wichtige Rolle. Auch mein Interesse für den Grundlagenstreit in der Mathematik förderte das Thema beweisen. Einen neuen und sehr kräftigen Schub bekam das Beweisthema durch mein Projekt Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse. Diese Seite markiert - nach der Kreation der Idee des natcodes 2018 - einen zwischenzeitlichen Höhepunkt der Neubelebung der Beweisidee in der Psychologie. Aufgrund der Vielzahl der Beweisthemen und Beweise erschien mir die Errichtung eines Beweisregisters nützlich, wobei diese Seite erst der Anfang ist und vermutlich nur einen kleinen Teil der Beweiserwähnungen in der Psychologie erfasst (für ergänzende Hinweise bin ich dankbar). Auch das methodische Instrumentarium ist entwicklungsbedingt sicher verbesserungsfähig. Immerhin zeigt das Beweisregister mit den Signierungen der ausgewerteten Beweiserwähnungen, dass das Instrumentarium praxistauglich und anwendbar ist. Die ersten fünf Monographien Beweis und beweisen bei Wundt direkt verglichen mit Galliker; sowie Tetens, Lotze, Volkelt erschienen mit dieser Seite.
Im Allgemeinen wird von vielen WissenschaftlerInnen und WissenschaftstheorikerInnen bestritten, dass es in den empirischen Wissenschaften "richtige" Beweise geben kann. Hauptargument ist, dass man empirisch immer nur endlich viele Fälle zur Verfügung hat und dass mit jedem neu hinzukommenden Fall, also n+1, es anders sein kann. Das betrifft aber nur den empirischen Induktionsbeweis, den es so nicht streng gibt, denn empirisch ist es nicht möglich von n auf n+1 zu schließen. Das ist in Mathematik und Logik nicht anders. Man kann aber sehr wohl von n auf n+1 schließen, wenn man die Voraussetzung trifft, dass sich an den Bedingungen für n+1 nichts geändert hat, für n+1 also die gleichen Bedingungen gelten wie für n. Auch in Mathematik und Logik erfordert jeder Beweis seine Voraussetzungen. Es gibt keinen Beweis ohne Voraussetzungen. Und wenn man die Bedingungen für einen Beweis in Mathematik oder Logik ändert, dann kann es natürlich sein, dass der Beweis nicht mehr führbar ist und nicht mehr gilt. Der idealistische Fundamentalismus einiger bedeutender Wissenschaftstheoretiker ist wissenschafts- und realitätsfremd, denn das Thema Beweis spielt in vielen wissenschaftlichen Arbeiten eine Rolle, auch in der empirischen Psychologie seit 1751, also derzeit der letzten rund 270 Jahre, wie dieses Beweisregister beweist ;-). Es ist daher an der Zeit, diesen hyperskeptischen Spuk zu beenden und das Beweisthema wieder dort hinzustellen, wo es hingehört: in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Arbeit.
Neu auf dieser Seite ist, dass, dass es auch um den Einzelfallbeweis geht. Hierzu haben die PsychologInnen m.E. bislang nicht geforscht, aber die JuristInnen (Bender/Nach/Treuer 2014). Denn dort geht es immer um Einzelfälle mit dem vereinfachten Paradigma: Sachverhalt wahr oder falsch? Hierzu lege ich erste Ideen für eine Wahrscheinlichkeitstheorie des Einzelfalles vor (in Arbeit).
_
Zusammenfassung
- Beweise folgen dem allgemeinen Beweisschema. Es ist einfach - wenn auch nicht einfach durchzuführen - und lautet: Wähle einen Anfang und begründe Schritt für Schritt, wie man vom Anfang (Ende) zur nächsten Stelle bis zum Ende (Anfang) gelangt. Ein Beweis oder eine beweisartige Begründung ist eine Folge von Schritten: A0 => A1 => A2 => .... => Ai .... => An, Zwischen Vorgänger und Nachfolger darf es keine Lücken geben. Gibt es Lücken, sind diese mit Annahmen zu füllen und zu kennzeichnen (Beweislückenhandhabung). Es kommt nicht auf die Formalisierung an, sie ist nur eine Erleichterung für die Prüfung. Entscheidend ist, dass jeder Schritt prüfbar nachvollzogen werden kann und dass es keine Lücken gibt. Dies kann man auch methodisches Vorgehen nennen, was nichts anderes heißt, als Schritt für Schritt, ohne Lücken, von Anfang bis Ende, Wege und Mittel zum (Erkenntnis-) Ziel anzugeben. Das gilt auch für den Einzelfallbeweis.
- Es gibt zwei Hauptbeweisklassen: (1) Beweis für Gesetz- und Regelhaftigkeiten, z.B. jede Frustration erzeugt Aggression oder so lange ich lebe, bin ich erlebnisfähig und (2) Beweise für den Einzelfall, z.B. ob ein Fenster offen ist durch in Augenscheinnahme oder ob ich wach und erlebnisfähig bin.
- Beweisen geschieht in der Sprache, meint aber wahre Sachverhalte, also Tatsachen. Man will ja nicht Worte und Sätze beweisen, sondern Feststellungen von Tatsachen oder wie sie zusammenhängen. Dazu braucht man aber die Sprache, wenigstens die Sprache des Geistes, also das Denken. Ohne Sprache gibt es keine Beweise. Damit der Beweis für die Tatsachen gilt, muss man voraussetzen oder zeigen, dass die sprachliche Fassung des Beweises den Tatsachen entspricht .Beweisen ist immer etwas Kommunikatives, selbst wenn man sich nur selbst etwas beweist.
- Das Erleben ist sehr kompliziert, daher kann man mit der Beweischeckliste gar nicht umsichtig und gründlich genug sein, insbesondere was die Begriffe betrifft, die im Beweis verwendet werden. Das gilt für jeden Beweis und damit auch für Beweise in der Psychologie und erst recht für Erlebensbeweise.
- Ganz allgemein wurden 9 Beweis-Fallunterscheidungen vorgeschlagen, die 36 Paarvergleiche erzeugen, die auf Unterschiede (26) und Ähnlichkeit (10) untersucht wurden.
- Zusätzlich schien es mir sinnvoll, bei Erlebensbeweisen 4 Fälle zu unterscheiden:
- A. will sich selbst einen Erlebenssachverhalt beweisen.
- A. will anderen einen Erlebenssachverhalt von sich beweisen.
- A. will für jeden anderen einen Erlebenssachverhalt von sich beweisen.
- A. will einen Erlebenssachverhalt ganz allgemein beweisen.
- Ausführlich wurde das Konzept natcode - die naturwissenschaftliche Codierung des Erlebens - dargestellt, weil es den objektiven psychologischen Erlebensbeweis für andere wahrscheinlich erst ermöglicht. Alles beweisen mit rein psychologischen Mitteln hängt von der Glaubhaftigkeit und Akzeptanz der Beweisadressaten ab. Für die Entwicklung des natcode wurde eine eigene Seite, das natcode Register eingerichtet.
- Es wurde am Beispiel Wundt (1896) im Vergleich mit Galliker (2016) die Methodik der Beweisthemasuche in wissenschaftlichen Texten entwickelt und in den zugehörigen Beweismonografien ausführlich dargestellt und belegt. Die analysierte Schrift Wundts Die Definition der Psychologie umfasst 66 Textseiten. Dort finden sich 713 Fundstellen von 60 aus 70 beweisthemarelevanten Suchwortlkürzeln. Das ergibt eine Seitenrate von 10.80 (713/66). Zum Vergleich wurde eine moderne Arbeit von Galliker (2016): Ist die Psychologie eine Wissenschaft? analysiert (Seitenrate 11.79). Klassifiziert man die 70 Suchkürzel wie folgt, so entfallen auf
- ARGUMENT (7 Suchkürzel): Wundt 1896: 56 Fundstellen 0.85 pro Seite (Galliker 2016: 217 Fundstellen, 0.89 pro Seite)
- BEDINGUNG/VORAUSSETZUNG (6 Suchkürzel): Wundt 1896: 151 Fundstellen, 2.29 pro Seite; (Galliker 2016: 777 Fundstellen, pro Seite 3.17)
- GRUND (11 Suchkürzel): Wundt 1896: 165 Fundstellen, 2.50 pro Seite (Galliker 2016: 534 Fundstellen, pro Seite 2.18
- BEHAUPTUNG: (12 Suchkürzel): Wundt 1896: 152, 2.30 pro Seite (Galliker 2016: 500 Fundstellen, pro Seite 2.04
- BEWEIS (34 Suchkürzel): Wundt 1896: Wundt 1896: 189, 2.86 pro Seite (Galliker 2106: 860 Fundstellen, pro Seite 3.51)
- Für die Beweiserwähnungsbeurteilungen in wissenschaftlichen Texten wurde ein Signierungssystem entwickelt und die Anwendungstauglichkeit an über 30 Beispielen belegt - mit bislang folgenden Kategorien:
- Auf der Hauptseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse wurden zur differenzierten Untersuchung, Analyse und Erfassung von Erlebens- und Erlebnisbegriffen 13 unterschieden und zum Gegenstand der Beweise gemacht, die hier dargestellt wurden:
- Es wurden zum Beweisthema in der Psychologie neben dieser Hauptseite mehrere zusätzliche Seiten eingerichtet:
- Beweis Register Psychologie:
- Chronologisches Beweisregister.
- Alphabetisches Beweisregister nach AutorInnen.
- Alphabetisches Beweisregister nach Sachverhalten.
- natcode Register: naturwissenschaftlich fundierte Beweisseite.
- Das hier entwickelte System hat zwar seinen ersten Anwendungstest bestanden, ist aber weiterhin in der Entwicklung, es kann und wird sich daher im Zuge weiterer Auswertungen ziemlich wahrscheinlich verändern. So wurde am 7.11.23 ein Abschnitt eingefügt Zweiklassenbeweise: richtige und ungefähre. Ungefährbeweise ein Widerspruch in sich?
- Be-Beweis-Erwähnungen "Beweis, beweisen, beweist, bewiesen"
Bb-Beweisbehauptung
Bs-Beweiserwähnung-mit-Spezifikationen worum es geht
Ba-Beweis-Annahmen, Bedingungen, Voraussetzungen, Forderungen (Postulate)
Bm-Beweismittel, Art, Verfahren, Methode
BB-Beweisbelege, Bestätigungen, Indizien
BE-Beweis-Erörterung-Diskussion:
Bd-Beweisdurchführung wird spezifiziert oder nicht
Bf-Falscher-Beweis
Bo-Beweis-ohne-Ausweisung
BN-Beweisnamen Der Beweis hat einen - oder mehrere - Namen
Ze-Zeig-Erwähnungen
We-widerleg-Erwähnungen
Ae-ableit-Erwähnungen
Ee-erfüll-Erwähnungen
- erleben0 wach, erlebnisfähig.
erleben1 dabei sein, etwas mitbekommen (Zeuge).
erleben2 innere Wahrnehmung.
erleben3 besondere, nicht alltägliche innere Wahrnehmung.
erlebenr reines Erleben (theoretische Konstruktion).
erlebenpr praktisch reines Erleben.
erlebens spezifisches Erleben (z.B. Flow).
erlebenL Erleben in der Literatur
erleben? unklare Bedeutung.
erlebeng sachlich-gegenständliches Erleben (Lipps 1905).
erlebena affektives Erleben.
erlebenk kognitives Erleben.
erlebenak sowohl affektiv als auch kognitiv.
erlebenz auf den Erlebnischarakter zentriert.
Zur Möglichkeit und Problematik empirischer Beweise:
- Gibt es richtige Beweise in den empirischen Wissenschaften?
- Der Niedergang des Beweisens durch den Popperismus und wissenschafttheoretischen idealistischen Fundamentalismus.
- Beweisen lernen (Hauptseite Beweis)
- Idiographisches Beweisen (Hauptseite Beweis)
- Wissenschaft schafft Wissen und dieses hat sie zu beweisen, damit es ein wissenschaftliches Wissen ist (Hauptseite Beweis)
- Allgemeine wissenschaftliche Beweisstruktur und beweisartige Begründungsregel (Hauptseite Beweis)
- Falsifikationsprinzp (Beweis und beweisen in Logik, Erkenntnis-, Wissenschaftstheorie und Philosophie).
- Kritik der Kritik an der empirischen Induktion. (Beweis und beweisen in Logik, Erkenntnis-, Wissenschaftstheorie und Philosophie).
- Hauptsatz der Erkenntnistheorie. (Beweis und beweisen in Logik, Erkenntnis-, Wissenschaftstheorie und Philosophie).
- Dreiwertige Logik für die Praxis angemessener. (Beweis und beweisen in Logik, Erkenntnis-, Wissenschaftstheorie und Philosophie).
_
Ende Zusammenfassung Beweis
und beweisen in der Psychologie
Beweis und beweisen
Bevor ich mich dem Thema Beweis und beweisen, zunächst allgemein, dann in der Psychologie und hier speziell zu Erleben und Erlebnis zuwende, möchte ich kurz auf meine erkenntnistheoretische Position eingehen.
Erkenntnistheoretische
Position - Erkenntnistheorie
| Zunächst gilt der erkenntnistheoretische Hauptsatz: Jede Erkenntnis irgendeines Sachverhalts erfolgt durch ein erkennendes System und seine Filter. Erkennen gibt es nur relativ zu einem erkennenden System. |
Das Ding an sich gibt es nicht, daher sollte man es erst gar nicht erst suchen, weil man es nicht finden kann. Aber auch wenn es das Ding an sich nicht gibt, ändert das nichts am grundlegenden und berechtigten Interesse objektiver Erkenntnis. Und genau darum geht es in der Wissenschaft. Aber wie gelangen wir zu objektiver Erkenntnis? Und was soll das überhaupt heißen "objektive Erkenntnis"? Dieser Frage wird in einer eigenen Arbeit nachgegangen.
Erkennen und Erkennensbegriffe Erkennen ist ein grundlegender Begriff in Wissenschaft und Leben, aber auch ein mehrdeutiges Homonym. Es seien daher einige wichtigere Bedeutungen erfasst, die sich auch zum Signieren von Positionen eignen:
- _ErkD Kürzel für die allgemeine Definition von erkennen: Erkennen liegt vor, wenn ein Sachverhalt ausgewählt werden kann. Die Auswahl erfolgt non-verbal durch Markieren, deuten, zeigen oder verbal durch beschreiben. Erkennen erfordert keine Namen oder namenähnliche Bezeichnungen, wenngleich diese die Kommunikation erheblich erleichtern, wenn die Begriffe hinreichend klar sind. Aber auswählen erfordert die Verfügbarkeit der kognitiven Funktionen des Unterscheidens und Vergleichens und der Aufmerksamkeitslenkung.
- _IP-GIPT Kürzel für erkennen in der IP-GIPT: erkennen heißt, einen erlebten Sachverhalt so beschreiben können, dass der Erkennende sagen kann, die Beschreibung des Sachverhalts passt ungefähr. Also zwischen dem Erleben des Sachverhalts und der Beschreibung des Sachverhalts besteht eine hohe Ähnlichkeit. Zum Beschreiben gehört eine Sprache. Die primäre und originäre Sprache des Geistes heißt Denken. Sie geht der Kommunikationssprache voraus. Vieles Erkannte im Alltagsleben wird mit anderen nicht kommuniziert, aber mit sich selbst, wenn z.B. gedacht wird.
- _ErkW Erkennen, wiedererkennen und Begriff > Erkennen und phantasieren. [Wiedererkennungsbeweisbeispiel]
- _EHS Kürzel für den erkenntnistheoretischen Hauptsatz: Jede Erkenntnis irgendeines Sachverhalts erfolgt durch ein erkennendes System und seine Filter. Das Ding an sich gibt es nicht. Es ist eine falsche Idee, die den Hauptsatz nicht berücksichtigt. Das sah auch Nicolai Hartmann in seiner Metaphysik der Erkenntnis, 4. A. 1949, S. 17 so: "Daß alles Erkennen an ein erkennendes Subjekt gebunden ist, läßt sich wohl nicht im Ernst bestreiten. Es gehört mit zur Urtatsache des Erkenntnisphänomens." Weitere Fundstellen zum Thema:
- Jahn schreibt in Logik, Methodenlehre und Erkenntnistheorie (1920). S. 235: "Zum Erkennen genügt das erkennende Subjekt nicht; es muß ein Etwas da sein, das erkannt wird. Zum Erkennen gehört ein Inhalt, den sich das Subjekt auf irgendeine Weise zu eigen macht."
- Bei Juhos (1950) Die Erkenntnis und ihre Leistung und Pap (1955) Analytische Erkenntnistheorie habe ich keine entsprechenden Ausführungen gefunden.
- Schlick erläutert in seiner Allgemeinen Erkenntnislehre (1935): "Ehe eine Wissenschaft ihre Arbeit beginnen kann, muß sie sich einen deutlichen Begriff von dem Gegenstande machen, den sie untersuchen will. Man muß an die Spitze der Betrachtungen irgendeine Definition des Objektes stellen, dem die Forschungen gewidmet sein sollen, denn es muß ja zunächst einmal klar sein, womit man es eigentlich zu tun hat, auf welche Fragen man [>141] Antwort erwartet. Wir müssen uns also zu allererst fragen: Was ist denn eigentlich Erkennen? [FN13]
- Die Enzyklopädie für Philosophie und Wissenschaftstheorie (2005), 2. A. ergeht sich im Eintrag Erkenntnistheorie in breiten Darlegungen ab Platon ohne klare Position.
"Gibt" es ein Ersterkennen? Oder "ist" erkennen immer ein wiedererkennen? Was soll erkennen - ein vieldeutiges Homonym - überhaupt heißen? Erkennen ist etwas Geistiges, bei dem meist wahrnehmen und denken dabei ist. Sehe ich eine Landschaft zum ersten Mal und habe ich so eine noch nie gesehen, so habe ich doch unzweifelhaft eine Wahrnehmung, auch wenn diese Landschaft noch keinen Namen hat und in ihrer Gesamtdarstellung mir bislang unbekannt war. In aller Regel werde ich sie ungefähr beschreiben können: Hintergrund, Vordergrund, Horizont, Landschaftselemente und ihre Anordnung (z.B. Bach, Bäume, Berge, Buchten, Felder, Fluss, Gräser, Himmel, Höhen, Hügel, Licht, Moor, Sand, Schatten, Sonne, Sträucher, Wald, Wasser, Wege, Wolken) und auch wieder erkennen können.
So selbstverständlich, so einleuchtend es scheint, daß mit dieser Frage der Anfang gemacht werden muß, [so merkwürdig]' ist es, wie selten sie an der richtigen Stelle und mit der richtigen Sorgfalt behandelt worden ist [FN14], wie wenige Denker darauf [>142] eine klare, sichere und vor allem brauchbaredAntwort gegeben haben. [FN15] ..." [>145]
"... Hierher gehört auch die große Frage, die in der Geschichte der Philosophie so viel bedeutet: Vermögen wir die Dinge zu erkennen, wie sie an sich selbst sind, unabhängig davon, wie sie unserer menschlichen Auffassung erscheinen? Gibt man sich Rechenschaft darüber, was in dergleichen Problemen das Wort Erkennen allein bedeuten kann, so hören sie auf, welche [>146] zu sein, denn es zeigt sich alsbald, daß entweder die Fragestellung verfehlt war, oder daß der Weg offen daliegt, auf dem die Frage eine präzise, wenn auch vielleicht unerwartete oder unerhoffte Antwort finden kann. [FN20]-"
d A: (zutreffende)
Was ist ein Beweis? [Quelle]
Vorbild für Beweis und beweisen sind Mathematik und Logik. Das gilt für alle Wissenschaften und natürlich auch für die Psychologie, denn es gibt keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Beweisen in Mathematik oder Logik und den empirischen Wissenschaften. Denn für alle wissenschaftliche Erkenntnis gilt Dedekinds zitiertes Prinzip und die allgemeine wissenschaftliche Beweisstruktur. Leider beschäftigt man sich in der Psychologie bislang mehr mit nichtssagenden Signifikanztests oder numerologisch-szientistischen bzw. dubios-läppischen Faktorenanalysen, statt endlich die wissenschaftlichen Fundamente zu entwickeln, weiter zu entwickeln und zu beweisen.
| Wissenschaft [IL] schafft Wissen und dieses hat sie zu beweisen, damit es ein wissenschaftliches Wissen ist, wozu ich aber auch den Alltag und alle Lebensvorgänge rechne. Wissenschaft in diesem Sinne ist nichts Abgehobenes, Fernes, Unverständliches. Wirkliches Wissen sollte einem Laien vermittelbar sein (Laien-Kriterium). Siehe hierzu bitte das Hilbertsche gemeinverständliche Rasiermesser 1900, zu dem auch gut die Einstein zugeschriebene Sentenz passt: "Die meisten Grundideen der Wissenschaft sind an sich einfach und lassen sich in der Regel in einer für jedermann verständlichen Sprache wiedergeben." |
| Allgemeine
wissenschaftliche Beweisstruktur und beweisartige Begründungsregel
(Quelle)
Sie ist einfach - wenn auch nicht einfach durchzuführen - und lautet: Wähle einen Anfang und begründe Schritt für Schritt, wie man vom Anfang (Ende) zur nächsten Stelle bis zum Ende (Anfang) gelangt. Ein Beweis oder eine beweisartige Begründung ist eine Folge von Schritten: A0 => A1 => A2 => .... => Ai .... => An, Zwischen Vorgänger und Nachfolger darf es keine Lücken geben. Gibt es Lücken, sind diese mit Annahmen zu füllen und zu kennzeichnen (Beweislückenhandhabung). Es kommt nicht auf die Formalisierung an, sie ist nur eine Erleichterung für die Prüfung. Entscheidend ist, dass jeder Schritt prüfbar nachvollzogen werden kann und dass es keine Lücken gibt. Dies kann man auch methodisches Vorgehen nennen, was nichts anderes heißt, als Schritt für Schritt, ohne Lücken, von Anfang bis Ende, Wege und Mittel zum (Erkenntnis-) Ziel anzugeben. |
Laien-Kriterium (LK) Wünschenswert ist weiterhin, dass wissenschaftliche Erkenntnisse Laien erklärbar sein sollten. Psychologisch steckt dahinter: wer einem Laien etwas erklären kann, sollte es wohl selbst verstanden haben. Siehe hierzu bitte auch das Hilbertsche gemeinverständliche Rasiermesser 1900, zu dem auch gut die Einstein zugeschriebene Sentenz passt: "Die meisten Grundideen der Wissenschaft sind an sich einfach und lassen sich in der Regel in einer für jedermann verständlichen Sprache wiedergeben."
Beweis, Sprache und wahre Sachverhalte (Tatsachen)
Beweisen geschieht in der Sprache, meint aber wahre Sachverhalte, also Tatsachen. Man will ja nicht Worte und Sätze beweisen, sondern Feststellungen von Tatsachen oder wie sie zusammenhängen. Dazu braucht man aber die Sprache, wenigstens die Sprache des Geistes, also das Denken. Ohne Sprache gibt es keine Beweise (wie beweist man das?;-)). Beweisen ist immer etwas Kommunikatives, selbst wenn man sich nur selbst etwas beweist.
_
Beweismittel
Ausgehend von Mathematik und Logik nutzt man beim Beweisen folgende Beweismittel:
- Behauptung (die man beweisen will) und die, falls bewiesen, in einen Satz mündet.
- Axiome, die für den Beweis gebraucht werden.
- Annahmen, die für einen lückenlosen Beweis gebraucht werden.
- Schon bewiesene Sätze, auf die man beim Beweis zurückgreift. Satz hat in der Mathematik die Bedeutung, das der in dem Satz ausgedrückte Sachverhalt bewiesen ist.
- Weitere oder sonstige Voraussetzungen, die für den Beweis nötig sind.
- Korrekte Definitionen der Begriffe, die in dem Beweis verwendet werden.
- Schlussregeln, die man beim Beweisen benutzt.
- Schritt für Schritt vorgehen ohne Lücken
Beweislückenhandhabung
Im Psychologischen und Psychosozialen Bereich gibt es viele Beweislücken.
Die einfachste Handhabung, damit man weitermachen kann, ist, die Lücke
durch eine Annahme zu schließen und entsprechend zu kennzeichnen.
Das große Problem der Ausnahmen
Die Menschen zeigen ;-) eine große Vielfalt in ihrer Anlage,
in ihrer Entwicklung und aktuellen Konstitution, wie z.B. eine Betrachtung
des Geschlechterproblems
eindrücklich belegt. Aussagen, die für jeden
Menschen gelten, haben daher nicht selten gute Chancen, widerlegt zu werden,
weil dafür ja ein einziges Gegenbeispiel genügt, was das weite
Feld der sog. Exhaustion oder Exhaurierung eröffnet.
All-Sätze erfordern daher sehr sorgfältige Angaben hinsichtlich
ihrer Bedingungen und Voraussetzungen.
Exhaustion:
Die Beurteilung von Ausnahmen und Abweichungen.
Behält man Hypothesen bei, obwohl empirische Daten dagegen sprechen,
nennt man dies exhaurieren - ein problermatisches, aber weit verbreitetes
Verfahren.
Gibt es in den empirischen Wissenschaften überhaupt Beweise?
Im Allgemeinen wird von vielen WissenschaftlerInnen und WissenschaftstheorikerInnen bestritten, dass es in den empirischen Wissenschaften Beweise geben kann. Hauptargument ist, dass man empirisch immer nur endlich viele Fälle zur Verfügung hat und dass mit jedem neu hinzukommenden Fall, also n+1, es anders sein kann. Das betrifft aber nur den empirischen Induktionsbeweis, den es so nicht streng gibt, denn empirisch ist es nicht möglich von n auf n+1 zu schließen. Das ist in Mathematik und Logik nicht anders. Man kann aber sehr wohl von n auf n+1 schließen, wenn man die Voraussetzung trifft, dass sich an den Bedingungen für n+1 nichts geändert hat, für n+1 also die gleichen Bedingungen gelten wie für n. Auch in Mathematik und Logik erfordert jeder Beweis seine Voraussetzungen. Es gibt keinen Beweis ohne Voraussetzungen. Und wenn man die Bedingungen für einen Beweis in Mathematik oder Logik ändert, dann kann es natürlich sein, dass der Beweis nicht mehr führbar ist und nicht mehr gilt. Der idealistische Fundamentalismus einiger bedeutender Wissenschaftstheoretiker ist wissenschafts- und realitätsfremd, denn das Thema Beweis spielt in vielen wissenschaftlichen Arbeiten eine Rolle, auch in der Psychologie, wie das Beweisregister belegt. Es ist daher an der Zeit, diesen Spuk zu beenden und das Beweisthema wieder dort hinzustellen, wo es hingehört: in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Arbeit.
Beweisarten
Sinnvoll unterscheidet man zwischen Beweisen, die Gesetze oder Regeln
betreffen und Feststellungsbeweisen, dass irgend etwas so oder so ist oder
nicht ist.
- Existenz- oder Feststellungsbeweise: Hier geht es allgemein um die Frage, ob und wie ein Sachverhalt besteht oder nicht besteht. Liegt ein Sachverhalt vor, ist er eine Tatsache und es ist seine Existenz für den Ort ... und die Zeit ... bewiesen.
- Punktbeweise: Ein Sachverhalt befand sich am Ort .... zur Zeit ... in dem Zustand. Beispiel: Heute am tt.mm.jjjj ist am Standort .... um hh:mm:ss die Sonne aufgegangen.
- Verlaufsbeweise: ein Sachverhalt S hat am Ort ... in der Zeit ... den Verlauf ... genommen.
- Zusammenhangsbeweise: Zwischen zwei oder mehreren Sachverhalten gibt es einen Zusammenhang.
- Gesetzesbeweise: Unter den Bedingungen B besteht zwischen S1 und S2 ein gesetzmäßiger Zusammenhang heißt: S1 = f(S2)
- Auch hier spielen die Bedingungen eine wichtige Rolle. Gilt das Gravitationsgesetz immer und überall, in allen möglichen Welten?
- Regelbeweise: Eine Regel duldet Ausnahmen. Ein Regelbeweis ist daher schwächer als ein Gesetzesbeweis.
- Statistische Beweise und Gesetze: [>Eigen/Winkler]
- Sonstige Beweise (Rest- und Auffangkategorie)
Bei einem empirischen Feststellungsbeweis, sollten verschiedene
Gültigkeitsvarianten unterschieden werden:
- Der Beweis soll für einen bestimmten Zeitpunkt gelten.
- Der Beweis soll für einen bestimmten Zeit-Raum gelten.
- Der Beweis soll unabhängig von einem bestimmten Zeitraum oder Zeitpunkt gelten, z.B. alles ist ständig in Bewegung oder ein Körper nimmt immer einen Raum ein.
Zwei große und verschiedene Beweisaufgaben
Es ist ein Unterschied, ob es um einen Beweis im Alltag, in der Psychotherapie
oder in der Wissenschaft geht. Die strengsten Anforderungen an Beweise
werden natürlich in der Wissenschaft gestellt. Aber mit wissenschaftlichen
Beweisanforderungen kann man keinen Alltag bestreiten oder eine Psychotherapie
durchführen. Daher ist es sinnvoll, die Beweisanforderungen in verschiedenen
Lebensgebieten zu unterscheiden. Da bieten sich zunächst die zwei
Hauptkategorien wissenschaftliche und praktische Beweise an. Man sollte
also beim Beweis und beweisen am Anfang klarstellen, ob man einen wissenschaftlichen
oder praktischen Beweis durchführen möchte.
Zweiklassenbeweise: richtige und
ungefähre. Ungefährbeweise ein Widerspruch in sich?
Schaut man sich die Psychologie genau an, sucht man klare und genau
definierte Begriffe vergebens. Damit stellt sich die Frage, wie es bei
nur ungefähren Begriffen "richtige", also strenge Beweise kann?
Der ungefähre Beweis wäre dann so eine Art Beweis 2. Klasse.
Dieses Thema bedarf weiterer Erörterung.
Beweis,
Sprache und wahre Sachverhalte (Tatsachen)
Beweisen geschieht in der Sprache, meint aber wahre Sachverhalte, also
Tatsachen. Man will ja nicht Worte und Sätze beweisen, sondern Feststellungen
von Tatsachen oder wie sie zusammenhängen. Dazu braucht man aber die
Sprache, wenigstens die Sprache des Geistes, also das Denken.
Wissenschaftliche Beweise
Hier gelten die oben ausgeführten der allgemeinen Beweisstruktur.
Checkliste-Beweisen
Man tut sich leichter, wenn man eine Beweischeckliste, z.B. folgende
verwendet:
Beweisbehauptung
- Behauptung: Welchen Beweisfall möchte ich beweisen, was ist meine Behauptung, was ist mein Beweisziel?
- Welche Begriffe kommen in meiner Behauptung vor?
- Sind die Begriffe in meiner Behauptung allesamt klar, definiert oder hinreichend klar beschrieben mit Beispielen und Gegenbeispielen?
- Habe ich daran gedacht, Begriffsverschiebebahnhöfe zu vermeiden?
- Habe ich auf Containerbegriffe/Begriffscontainer geachtet?
- Habe ich Grundbegriffe, die sich nicht definieren lassen, wie z.B. innere Wahrnehmung, klar ausgewiesen?
Beweisskizze: Skizze des Beweisweges.
Beweisvoraussetzungen:
- Setze ich voraus, dass jemand sein Erleben erzählen, beschreiben kann?
- Setze ich voraus, dass jemand sein Erleben wie es sich ereignet hat erzählt oder beschreibt?
- Für welche Bedingungen soll der Beweis gelten?
- Sind Normalbedingungen - und was heißt das genau - vorausgesetzt?
Hilfssätze: auf welche schon bewiesenen Sätze kann ich mich stützen?
Beweisschritte 1, 2, 3, ...i ... n
Wie gelange ich von 1 nach 2, von 2 nach 3, ... bis zur Behauptung, zum Beweisziel?
Welche Lücken gibt es, die ich mit welchen ausgewiesenen Annahmen überbrücken muss?
Prüfen
- Was kann ich gegen mein Beweisen einwenden?
- Wo vermute ich Schwächen?
- Wie ist mein Beweisgefühl?
- An welchen Stellen spüre ich Unbehagen?
Formal sichere Methode der Kontrolle
- Man gibt an, wie man von Nr. 1 zu Nr. 2 bzw. zur Nr.i kommt.
Hierzu stehen die drei Beweiswerkzeuge A := Annahmen (die erste als Anfang),
S := Sätze und R := Regeln zur Verfügung.
- 1. Anfang.
- 2. Angaben wie man von Nr.1 zu Nr.2 kommt mit Hilfe von: A1 ... i ...n, S1 ... i ...n, R1 ... i ...n .
- 3. Angaben wie man von Nr.2 zu Nr.3 kommt mit Hilfe von: A1 ... i ...n, S1 ... i ...n, R1 ... i ...n .
- ...
- j Angaben wie man von Nr.j-1 zu Nr.j kommt mit Hilfe von: A1 ... i ...n, S1 ... i ...n, R1 ... i ...n .
- ...
- m Angaben wie man von Nr.m-1 zu Nr.m kommt mit Hilfe von: A1 ... i ...n, S1 ... i ...n, R1 ... i ...n .
- Jeder Mensch ist sterblich. Anfang.
- X. ist ein Mensch. Annahme A1
- X. ist sterblich. Nach Nr.1 und Nr. 2 und der Regel Was für jeden gilt, gilt auch für einen belieben.
- Jeder Mensch ist sterblich. Anfang.
- X. ist ein Avatar. Annahme A1
- Es ist unklar, ob X. sterblich ist, denn: Nach Nr. 2 wissen wir, dass X. kein Mensch ist. Aus Nr. 1 geht nicht hervor, ob Avatare sterblich sind oder nicht. Regel: Wenn es keine Verbindung zwischen Nr.1 und Nr. 2 gibt, dann gibt es auch keine Schlußfolgerung.
Praktische Beweise - Alltagsbeweise
Praktische Beweise sind wie Alltagsbeweise gewöhnlich einfacher und nicht so streng.
Beweise in Beratung, Coaching und Psychotherapie
Das gleiche gilt für Beweise in Beratung, Coaching oder Psychotherapie.
Hauptsatz der Psychotherapie: Eine Psychotherapie oder Psychotherapiemaßnahme
wirkt, wenn sich etwas (positiv, negativ) nachhaltig verändert.
Beweis und beweisen in der Psychologie
Wie die Beweisregister zeigen, wird in der Psychologie viel mehr von Beweis und beweisen gesprochen als ich dachte. Bislang habe ich aber noch keine Stelle gefunden, wo ein Beweis so richtig Schritt für Schritt mit ausgewiesenen Voraussetzungen und Regeln durchgeführt wird. Meist sind es nur Beweiserwähnungen oder Beweisbehauptungen.
Der psychologische Beweis
Gelegentlich hat man in der Literatur, vor allem in der forensischen
Aussagepsychologie auch vom psychologischen Beweis gesprochen, so vor allem
Curt
Leonhardt in seinen Arbeiten von 1930-1941. Es stellt sich daher
Frage, was mit psychologischem Beweis gemeint ist: a) ein Beweis mit psychologischen
Mitteln oder b) ein Beweis für psychische Sachverhalte und Zusammenhänge?
Leonhardt formiliert den allgemeinen Satz, wenn jemand ein Erlebnis gehabt
hat, dann finden sich in seiner Aussage über dieses Erlebnis spezielle
gefühlsmäßige Merkmale [allgemeiner Kriterium 12 bei Köhnken
& Steller 1989: Schilderung eigenen psychischer Vorgänge], die
er auch "Wahrheitsgefühle" nennt. Das ist nun sicher kein Beweis,
aber ein Indiz (>Definition).
_
Typische Beweisfragen zum Erleben
in der Psychologie
Die zentrale Beweisfrage
der Psychologie lautet: wie kann eigenes und fremdes Erleben bewiesen werden?
[Quelle]
Weitere, sich daraus ergebende Fragen betreffen den Existenzbeweis
der elementaren psychologischen Erlebenselemente: erleben von wahrnehmen,
erleben von empfinden, erleben von wünschen, erleben
von denken, erleben von erinnern, erleben von vorstellen,
erleben von fantasieren, erleben von fühlen, erleben
von Stimmung, erleben von Befindlichkeit und Verfassung,
erleben von Ruhe und Bewegung, erleben von Lage und
Gleichgewicht,
erleben von Konflikt, erleben von Bedürfnissen,
Absichten,
Zielen
und Plänen, erleben des Abwägens, erleben des Entscheidens
und Entschließens, erleben des Wollens und des Handelns,
erleben der eigenen Identität, erleben der eigenen Fähigkeiten
und Fertigkeiten, erleben des Verhaltens ...
Im engen Zusammenhang mit dem Erleben der Menschen
steht die Beweisfrage, wie dieses Erleben biologisch fundiert ist bzw.
in welchem Zusammenhang das Seelisch-Geistige mit dem Biologischen steht?
Sind es "nur" zwei Erscheinungsformen ein- und desselben Erlebens oder
allgemeiner, ist das Leben an den Körper, an die Materie gebunden,
genauer an den Leib als beseelter Körper. Ist der Mensch tot, ist
sein Er-Leben und sein Leben erloschen.
Ist das Erleben "nur" eine besondere Ausdrucksform
oder Funktion biologischer Organisation oder wird durch die biologische
Organisation eine "eigene", psychologische Welt
erzeugt? Wie soll man sich diese vorstellen? Und was heißt eine "eigene"
Welt? Geistesgeschichtlich ist hier das sog. Leib-Seele-Problem angesprochen.
In welcher Beziehung stünde diese "eigene psychologische" Welt zur
biologischen Welt?
Die Grundprobleme der Erlebenspsychologie sind einfach
zu formulieren, aber sehr schwierig zu lösen.
Erlebensbeweise
Methodik-Erlebensbeweise: Bevor
man ans Beweisen geht, sollten einige Probleme geklärt sein: Das Grundproblem
der Erlebenskommunikation und die Fallunterscheidungen, für die etwas
bewiesen werden soll.
Das Grundproblem der Erlebenskommunikation
Wenn man erleben streng als gegenwärtiges Augenblickserleben nimmt,
kann man nichts erfassen, kommunizieren und beweisen. Denn Erleben, über
das kommuniziert wird, ist immer schon vorbei und Vergangenheit. Insofern
ist mit erleben das vergangene und das erzählte gemeint.
Ich kann mein Erleben, das, was in mir vorgeht,
zwar beschreiben, aber die Beschreibung meines Erlebens ist nicht mein
Erleben, sondern eben die Beschreibung.
Zwischendurch: Was ist nun der grundlegende Unterschied
zwischen (1) ich sehe einen Baum und (2) ich spüre Hunger?
(1) bezieht sich auf eine äußere Wahrnehmungsquelle und (2)
bezieht sich auf eine innere Wahrnehmungsquelle. Äußere Wahrnehmungsquellen
sind anderen zugänglich, jeweils innere für andere nicht, zumindest
nicht so direkt wie in (1). Auch die Mitteilung (1) ist nicht das Wahrnehmungserlebnis,
sondern eben die Mitteilung. So ist auch die Wahrnehmung einer äußeren
Wahrnehmungsquelle so wenig zugänglich wie die einer inneren Wahrnehmungsquelle,
was ja auch Schlicks Farbenbeispiel klar zum Ausdruck bringt.
Wie lässt sich nun für eine Kommunikation
des Erlebens argumentieren?
Die Menschen sind sehr ähnlich aufgebaut: genetisch, Entwicklung
der grundlegenden körperlichen und psychischen Funktionen, Sozialisation,
Erfahrungen, Lebensformen und Standardsituationen.
Nun ist z.B. Hunger spüren ein Phänomen,
das alle Menschen kennen dürften und aufgrund ihrer Ähnlichkeit
daher auch verständlich kommunizieren können sollten. Ob das
Hungererleben des A sich vom Hungererleben des B unterscheidet mag so lange
unwichtig sein, wie sich beide verstehen, wenn sie vom Hunger spüren
sprechen.
Sofern man Erleben auf gemeinsam bekannte Situationen
oder Erfahrungen beziehen kann, wird ein gemeinsames Verständnis leichter
und wahrscheinlicher.
Beweis-Fallunterscheidungen
Zunächst muss man sich darüber klar werden, für wen
ein Erlebensbeweis erbracht werden soll. Daraus ergibt sich wahrscheinlich,
wie er geführt werden kann oder muss. Hier gibt es folgende Konfigurationen:
Die allgemeinen Beweis-Fallunterscheidungen gelten natürlich auch für das Erleben.
| Beweis Subjekt/Objekt
Wer beweist wem etwas? |
1 Selbst | 2 Andere | 3. irgendeine Tatsache |
| 1 Selbst | 11 ich will mir etwas beweisen (Descartes Cogito Situation) | 12 ich will anderen etwas von mir beweisen | 13 ich will allgemein irgendeine Tatsache beweisen |
| 2 Andere | 21 andere wollen mir etwas von mir beweisen | 22 andere wollen anderen von sich etwas beweisen | 23 andere wollen allgemein irgendeine Tatsache beweisen |
| 3. Jemand | 31 jemand will mir irgend eine Tatsache beweisen | 32 jemand will anderen irgendeine Tatsache beweisen | 33 jemand will allgemein irgendeine Tatsache beweisen |
Danach haben wir mit diesem Ansatz neun Beweisfälle.
11 Ich will mir etwas von mir beweisen. (Selbst-Selbst)
Anlass- oder Anwendungsfälle: Ich will mir beweisen: 11.1 Bin
ich aufgewacht, erlebnisfähig? 11.2 Bin ich wach? 11.3 Ist das wirklich
oder nur eingebildet? 11.4 Träume ich? 11.5 Real und keine Illusion?
11.6 Real und keine Halluzination? 11.7 Ist meine Wahrnehmung in Ordnung,
kann ich ihr vertrauen? 11.8 Nehme ich mein Befinden, meine Verfassung
richtig wahr? 11.9 Ist mein Erleben klar und ungetrübt? 11.10 Bin
ich fit und leistungsfähig?
12 Ich will anderen etwas von mir beweisen.
(Selbst-Andere)
Anlass- oder Anwendungsfälle: Ich will anderen etwas von mir (über
mich) beweisen: 12.1 Ich bin aufgewacht, erlebnisfähig. 12.2 Ich bin
wach. 12.3 Das ist wirklich und nicht nur eingebildet. 12.4 Ich träume
nicht. 12.5 Real und keine Illusion. 12.6 Real und keine Halluzination.
12.7 Meine Wahrnehmung ist in Ordnung, ich kann ihr vertrauen. 12.8 Ich
nehme mein Befinden, meine Verfassung richtig wahr. 12.9 Mein Erleben ist
klar und ungetrübt. 12.10 Ich bin fit und leistungsfähig.
13 Ich will allgemein irgendeine Tatsache
beweisen. (Selbst-allgemein irgendeine Tatsache)
Anlass- oder Anwendungsfälle: Ich will allgemein irgendeine Tatsache
beweisen: 13.1 Tatsache: Wer aufwacht, ist erlebnisfähig. 13.2 Tatsache:
Ein beliebiger ist wach. 13.3 Die Tatsache ist wirklich und nicht nur eingebildet.
13.4 Die Tatsache ist nicht geträumt. 13.5 Die Tatsache ist real und
keine Illusion. 13.6 Die Tatsache ist real und keine Halluzination. 13.7
Tatsache: Die Wahrnehmung ist in Ordnung, man kann ihr vertrauen. 13.8
Tatsache: Das Befinden, die Verfassung von X. wird richtig wahrgenommen.
13.9 Tatsache: Das Erleben ist klar und ungetrübt. 13.10 Tatsache:
X. ist fit und leistungsfähig.
21 Andere wollen mir etwas von mir beweisen. (Andere-Selbst)
Anlass- oder Anwendungsfälle: Andere wollen mir etwas von mir
beweisen: 21.1 Dass ich aufgewacht, erlebnisfähig bin. 21.2 Dass ich
wach bin. 21.3 Dass das wirklich ist und nicht nur eingebildet. 21.4
Dass ich nicht träume. 21.5 Dass es real ist und keine Illusion. 21.6
Dass es real ist und keine Halluzination. 21.7 Dass meine Wahrnehmung in
Ordnung ist und ich ihr vertrauen kann. 21.8 Dass ich mein Befinden, meine
Verfassung richtig wahrnehme. 21.9 Dass mein Erleben klar und ungetrübt
ist. 21.10 Dass ich fit und leistungsfähig bin.
22 Ein anderer will einem anderen von sich
etwas beweisen. (Andere-Andere)
Anlass- oder Anwendungsfälle: Ein anderer will einem anderen etwas
von sich beweisen: 22.1 Ein anderer will einem anderen beweisen, er sei
aufgewacht, erlebnisfähig. 22.2 Ein anderer will einem anderen beweisen,
dass er wach sei. 22.3 Ein anderer will einem anderen beweise, dass das
wirklich sei und nicht nur eingebildet. 22.4 Ein anderer will einem anderen
beweisen, er träume nicht. 22.5 Ein anderer will einem anderen beweisen,
es sei real und keine Illusion. 22.6 Ein anderer will einem anderen beweisen,
es sei real und keine Halluzination. 22.7 Ein anderer will einem anderen
beweisen, seine Wahrnehmung sei in Ordnung, er könne ihr vertrauen.
22.8 Ein anderer will einem anderen beweisen, er nehme sein Befinden, seine
Verfassung richtig wahr. 22.9 Ein anderer will einem anderen beweisen,
sein Erleben sei klar und ungetrübt. 22.10 Ein anderer will einem
anderen beweisen, er sei fit und leistungsfähig.
23 Andere wollen allgemein irgendeine Tatsache
beweisen
Anlass- oder Anwendungsfälle: Andere wollen allgemein irgendeine
Tatsache beweisen: 23.1 Andere wollen allgemein beweisen, wer aufwacht,
ist erlebnisfähig. 23.2 Andere wollen allgemein beweisen: Ein beliebiger
ist wach. 23.3 Andere wollen allgemein beweisen: Die Tatsache ist wirklich
und nicht nur eingebildet. 23.4 Andere wollen allgemein beweisen: Die Tatsache
ist nicht geträumt. 23.5 Andere wollen allgemein beweisen: Die Tatsache
ist real und keine Illusion. 23.6 Andere wollen allgemein beweisen: Die
Tatsache ist real und keine Halluzination. 23.7 Andere wollen allgemein
beweisen: Die Wahrnehmung ist in Ordnung, man kann ihr vertrauen. 23.8
Andere wollen allgemein beweisen: Das Befinden, die Verfassung von jemand
wird richtig wahrgenommen. 23.9 Andere wollen allgemein beweisen: Das Erleben
ist klar und ungetrübt. 23.10 Andere wollen allgemein beweisen:
Jemand ist fit und leistungsfähig.
31 Jemand will mir irgend eine Tatsache
beweisen
Anlass- oder Anwendungsfälle: Jemand will mir irgendeine Tatsache
beweisen: 31.1 Jemand will mir beweisen: wer aufwacht, ist erlebnisfähig.
31.2 Jemand will mir beweisen: Ein beliebiger ist wach. 31.3 Jemand will
mir beweisen: Die Tatsache ist wirklich und nicht nur eingebildet. 31.4
Jemand will mir beweisen: Die Tatsache ist nicht geträumt. 31.5 Jemand
will mir beweisen: Die Tatsache ist real und keine Illusion. 31.6 Jemand
will mir beweisen: Die Tatsache ist real und keine Halluzination. 31.7
Jemand will mir beweisen: Die Wahrnehmung ist in Ordnung, man kann ihr
vertrauen. 31.8 Jemand will mir beweisen: Das Befinden, die Verfassung
von jemand wird richtig wahrgenommen. 31.9 Jemand will mir beweisen: Das
Erleben ist klar und ungetrübt. 31.10 Jemand will mir beweisen: Jemand
ist fit und leistungsfähig.
32 Jemand will anderen irgendeine Tatsache
beweisen
Anlass- oder Anwendungsfälle: Jemand will anderen irgendeine Tatsache
beweisen: 32.1 Jemand will anderen beweisen: wer aufwacht, ist erlebnisfähig.
32.2 Jemand will anderen beweisen: Ein beliebiger ist wach. 32.3
Jemand will anderen beweisen: Die Tatsache ist wirklich und nicht nur eingebildet.
32.4 Jemand will anderen beweisen: Die Tatsache ist nicht geträumt.
32.5 Jemand will anderen beweisen: Die Tatsache ist real und keine Illusion.
32.6 Jemand will anderen beweisen: Die Tatsache ist real und keine Halluzination.
32.7 Jemand will anderen beweisen: Die Wahrnehmung ist in Ordnung, man
kann ihr vertrauen. 32.8 Jemand will anderen beweisen: Das Befinden, die
Verfassung von jemand wird richtig wahrgenommen. 32.9 Jemand will anderen
beweisen: Das Erleben ist klar und ungetrübt. 32.10 Jemand will
anderen beweisen: ein anderer ist fit und leistungsfähig.
33 Jemand will allgemein irgendeine Tatsache
beweisen.
Anlass- oder Anwendungsfälle: Jemand will allgemein irgendeine
Tatsache beweisen: 33.1 Jemand will allgemein die Tatsache beweisen:
wer aufwacht, ist erlebnisfähig. 33.2 Jemand will allgemein die Tatsache
beweisen: Ein beliebiger ist wach. 33.3 Jemand will allgemein die Tatsache
beweisen: Die Tatsache ist wirklich und nicht nur eingebildet. 33.4 Jemand
will allgemein die Tatsache beweisen: Die Tatsache ist nicht geträumt.
33.5 Jemand will allgemein die Tatsache beweisen: Die Tatsache ist real
und keine Illusion. 33.6 Jemand will allgemein die Tatsache beweisen: Die
Tatsache ist real und keine Halluzination. 33.7 Jemand will allgemein die
Tatsache beweisen: Die Wahrnehmung ist in Ordnung, man kann ihr vertrauen.
33.8 Jemand will allgemein die Tatsache beweisen: Das Befinden, die Verfassung
von jemand wird richtig wahrgenommen. 33.9 Jemand will allgemein die Tatsache
beweisen: Das Erleben ist klar und ungetrübt. 33.10 Jemand will
allgemein die Tatsache beweisen: irgendwer ist fit und leistungsfähig.
Diskussion zu Fragen der neun Fälle
Welche sind (fast) gleich und brauchen daher nicht gesondert ausgewiesen
und behandelt werden? Nachdem wir 9 Fälle haben, könnte rein
formal kombinatorisch jeder Fall mit jedem verglichen werden. Es gäbe
dann 9/2(9-1) = 36 Paarvergleiche, nämlich (Ä = ähnlich;
U
=
Unterschied):
- 11-12 U Ich will mir etwas beweisen verglichen mit ich will anderen etwas von mir beweisen. U: ich mir selbst verglichen ich anderen.
- 11-13 U Ich will mir etwas beweisen verglichen mit ich will allgemein irgendeine Tatsache beweisen. U: ich mir selbst verglichen mit ich allgemein.
- 11-21 U Ich will mir etwas beweisen verglichen mit andere wollen mir etwas von mir beweisen. U: ich mir selbst verglichen mit andere mir.
- 11-22 U Ich will mir etwas beweisen verglichen mit andere wollen anderen von sich etwas beweisen. U: ich mir selbst verglichen mit andere anderen.
- 11-23 U Ich will mir etwas beweisen verglichen mit andere wollen allgemein irgendeine Tatsache beweisen. U: ich mir selbst verglichen mit andere allgemein.
- 11-31 U Ich will mir etwas beweisen verglichen mit jemand will mir irgendeine Tatsache beweisen. U: ich mir selbst verglichen mit jemand.
- 11-32 U Ich will mir etwas beweisen verglichen mit jemand will anderen irgendeine Tatsache beweisen. U: ich mir selbst verglichen mit jemand anderen.
- 11-33 U Ich will mir etwas beweisen verglichen mit jemand will allgemein irgendeine Tatsache beweisen. U: ich mir selbst verglichen mit jemand allgemein.
- 12-13 U Ich will anderen etwas von mir beweisen verglichen mit ich will allgemein irgendeine Tatsache beweisen. U: ich anderen verglichen mit ich allgemein.
- 12-21 U Ich will anderen etwas von mir beweisen verglichen mit andere wollen mir etwas von mir beweisen. U: ich anderen verglichen mit andere mir.
- 12-22 U Ich will anderen etwas von mir beweisen verglichen mit andere wollen anderen von sich etwas beweisen. U: ich anderen verglichen mit andere anderen.
- 12-23 U Ich will anderen etwas von mir beweisen verglichen mit andere wollen allgemein irgendeine Tatsache beweisen. U: ich anderen verglichen mit andere allgemein.
- 12-31 U Ich will anderen etwas von mir beweisen verglichen mit jemand will mir irgendeine Tatsache beweisen. U: ich anderen verglichen mit jemand mir.
- 12-32 U Ich will anderen etwas von mir beweisen verglichen mit jemand will anderen irgendeine Tatsache beweisen. U: ich anderen verglichen mit jemand anderen.
- 12-33 U Ich will anderen etwas von mir beweisen verglichen mit jemand will allgemein irgendeine Tatsache beweisen. U: ich anderen verglichen mit andere mir.
- 13-21 U Ich will allgemein etwas beweisen verglichen mit andere wollen mir etwas von mir beweisen. U: ich allgemein verglichen mit andere mir.
- 13-22 U Ich will allgemein etwas beweisen verglichen mit andere wollen anderen von sich etwas beweisen. U: ich allgemein verglichen mit andere anderen.
- 13-23 Ä Ich will allgemein etwas beweisen verglichen mit andere wollen allgemein irgendeine Tatsache beweisen. U: ich allgemein verglichen mit andere allgemein.
- 13-31 Ä Ich will allgemein etwas beweisen verglichen mit jemand will mir irgendeine Tatsache beweisen. ich allgemein verglichen mit jemand mir.
- 13-32 Ä Ich will allgemein etwas beweisen verglichen mit jemand will anderen irgendeine Tatsache beweisen. ich allgemein verglichen mit jemand anderen.
- 13-33 Ä Ich will allgemein etwas beweisen verglichen mit jemand will allgemein irgendeine Tatsache beweisen. ich allgemein verglichen mit jemand allgemein.
- 21-22 U Andere wollen mir etwas von mir beweisen verglichen mit andere wollen anderen von sich etwas beweisen. ich allgemein verglichen mit andere anderen.
- 21-23 U Andere wollen mir etwas von mir beweisen verglichen mit andere wollen allgemein irgendeine Tatsache beweisen. andere mir verglichen mit andere allgemein.
- 21-31 U Andere wollen mir etwas von mir beweisen verglichen mit jemand will mir irgendeine Tatsache beweisen. andere mir verglichen mit jemand mir.
- 21-32 U Andere wollen mir etwas von mir beweisen verglichen mit jemand will anderen irgendeine Tatsache beweisen. andere mir verglichen mit jemand anderen.
- 21-33 U Andere wollen mir etwas von mir beweisen verglichen mit jemand will allgemein irgendeine Tatsache beweisen. andere mir verglichen mit jemand allgemein.
- 22-23 U Andere wollen anderen von sich etwas beweisen verglichen mit andere wollen allgemein irgendeine Tatsache beweisen. andere anderen verglichen mit andere allgemein.
- 22-31 U Andere wollen anderen von sich etwas beweisen verglichen mit jemand will mir irgendeine Tatsache beweisen. andere anderen verglichen mit jemand mir.
- 22-32 U Andere wollen anderen von sich etwas beweisen verglichen mit jemand will anderen irgendeine Tatsache beweisen. andere anderen verglichen mit jemand anderen.
- 22-33 U Andere wollen anderen von sich etwas beweisen verglichen mit jemand will allgemein irgendeine Tatsache beweisen. U: von sich verglichen mit allgemein.
- 23-31 U Andere wollen allgemein irgendeine Tatsache beweisen verglichen mit jemand will mir irgendeine Tatsache beweisen. U: allgemein verglichen mit mir.
- 23-32 Ä Andere wollen allgemein irgendeine Tatsache beweisen verglichen mit jemand will anderen irgendeine Tatsache beweisen: Ä: andere wollen allgemein verglichen mit jemand will anderen.
- 23-33 Ä Andere wollen allgemein irgendeine Tatsache beweisen verglichen mit jemand will allgemein irgendeine Tatsache beweisen. Ä: allgemein irgendeine Tatsache. U: andere gegenüber allgemein.
- 31-32 Ä Jemand will mir irgendeine Tatsache beweisen verglichen mit jemand will anderen irgendeine Tatsache beweisen. Ä: irgendeine Tatsache. U: mir gegenüber anderen.
- 31-33 Ä Jemand will mir irgendeine Tatsache beweisen verglichen mit jemand will allgemein irgendeine Tatsache beweisen. Ä: irgendeine Tatsache. U: mir gegenüber allgemein.
- 32-33 Ä Jemand will anderen irgendeine Tatsache beweisen verglichen mit jemand will allgemein irgendeine Tatsache beweisen. Ä: irgendeine Tatsache. U: anderen gegenüber allgemein.
Bei den 10 als Ä = ähnlich beurteilten kommen vor:
- 13-23 Ä Ich will allgemein etwas beweisen verglichen mit andere wollen allgemein irgendeine Tatsache beweisen
- 13-31 Ä Ich will allgemein etwas beweisen verglichen mit jemand will mir irgendeine Tatsache beweisen
- 13-32 Ä Ich will allgemein etwas beweisen verglichen mit jemand will anderen irgendeine Tatsache beweisen
- 13-33 Ä Ich will allgemein etwas beweisen verglichen mit jemand will allgemein irgendeine Tatsache beweisen.
- 23-31 Ä Andere wollen allgemein irgendeine Tatsache beweisen verglichen mit jemand will mir irgendeine Tatsache beweisen
- 23-32 Ä Andere wollen allgemein irgendeine Tatsache beweisen verglichen mit jemand will anderen irgendeine Tatsache beweisen
- 23-33 Ä Andere wollen allgemein irgendeine Tatsache beweisen verglichen mit jemand will allgemein irgendeine Tatsache beweisen
- 31-32 Ä Jemand will mir irgendeine Tatsache beweisen verglichen mit jemand will anderen irgendeine Tatsache beweisen
- 31-33 Ä Jemand will mir irgendeine Tatsache beweisen verglichen mit jemand will allgemein irgendeine Tatsache beweisen
- 32-33 Ä Jemand will anderen irgendeine Tatsache beweisen verglichen mit jemand will allgemein irgendeine Tatsache beweisen
- 13: 4x beteiligt
23: 4x beteiligt
31: 4x beteiligt
32: 4x beteiligt
33: 4x beteiligt
Zusammenfassung
Beweisvergleiche Psychologie
(1) Bei den 9 zugrunde gelegten Vergleichen gibt es 36 Paarvergleiche.
(2) Von den 36 Paarvergleichen wurden 10 als ähnlich beurteilt und
26 als unterschiedlich. (3) Demnach könnte man die 36 Beweisvergleiche
auf 26 verringern. (4) Fazit: Es gibt mit diesem Ansatz beachtlich viele
(26/36=72.2%) unterschiedliche Beweissituationen in der Psychologie.
Beweise, dass die Unterscheidungen des Erlebens existieren und referenzierbar sind
Beweise sind wichtig und wertvoll, weil sie bei Erfolg zu sicherem Wissen
führen auf das man bauen kann. Daher sind Beweise das zentrale und
grundlegende Thema und Anliegen jeder Wissenschaft, die in dem Maße
als wissenschaftlich entwickelt gelten kann, wie ihr Beweisreservoir entwickelt
ist. Wissenschaften ohne Beweise sind eigentlich keine - bestenfalls Anwärter.
Das wirkliche Erleben, wie es in der Gegenwart eines
Menschen stattfindet, lässt sich derzeit nicht beweisen. Hierzu müssen
erst die natcodes für das
Erleben erfasst, erkannt und verstanden sein. Sofern Erleben kommuniziert
wird, ist es geschehen und vorbei. Und die Beschreibung des Erleben ist
nicht das Erleben, sondern eben die Beschreibung. Im allgemeinen beziehen
sich Beweise daher auf nachträgliche Beschreibungen. Man muss also
sehr aufpassen, wenn man von Erlebensbeweisen spricht, um was es da eigentlich
genau geht.
Exkurs natcode:
Formale Darstellung Erleben und seine biologische Fundierung / Codierung.
Den folgenden Ausführungen liegt eine Identitätstheorie
von Leib und Seele zugrunde. Die Grundannahmen sind: Jedes psychische
Erleben und auch alles Geistige hat eine physikalisch-chemisch-biologische
Basis (Schneider & Dittrich 1990, S.41), hier
natcode genannt.
natcode-Beweisschema
Unter der Voraussetzung, dass natcodes einer Person A. bekannt sind,
z.B. die Qualifikation des Befindens "gut", kann das Erleben gutes Befinden
über den zugehörigen natcode aus dem Erlebensregister dieser
Person A. auf Übereinstimmung geprüft werden. Zeigt der natcode
des aktuellen Erleben eine hohe Ähnlichkeit mit dem registrierten
natcode im Erlebnisregister, so kann diese hohe Ähnlichkeit als Beweis
oder starkes Beweisindiz dafür dienen, dass A. tatsächlich das
Erleben hatte, das er angab.
Erlebensbeweise unter der Annahme, dass der natcode
für ein Erleben festgestellt werden kann
Beweise unter der Annahme, dass der natcode vorliegt, können ganz
allgemein unter Beweis mit Voraussetzungsannahmen bezeichnet werden.
Signierungssystem erleben (Quelle) 6. Version 18.04.2023 (neu: erleben/Erlebnis in der Literatur)
|
|
< Erleben Differenzierung Erlebnis > |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ohne nähere Spezifikation erlebenLd Dargestellt. Erleb./Erlebnis im Werk erlebenLK Erleb./Erlebnis der Konsumentin der dargestellten Erlebnisse. erlebenLeg Eingefühltes Erleben in der Literatur. erlebenLn Nacherleben einer liter. Darstellung erlebenLm Miterleben einer liter. Darstellung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anmerkung Carnap: hier ist
EE für Elementarerlebnis
vorgesehen, obwohl unklar ist, was ein Elementarerlebnis
von einem Erlebnis unterscheidet.
Unterscheidungsbeweise
erleben0 = X. ist
wach
erleben0 als wach, aufnahme- oder erlebensfähig
(>Landgrebe). Erleben in dieser
grundsätzlichen, elementaren Bedeutung heißt so viel wie ein-
oder angeschaltet; an ("on", "online"), offen, bereit, mich diesem oder
jenen Erlebensinhalt zuzuwenden (intentionsfähig), leere Bühne,
Projektionsraum,
Projektor
eingeschaltet.
Widerspricht dem phänomenologischen Intentionalitätsdogma, denn
erleben0 ist gerade nicht gerichtet - wie die
freischwebende Aufmerksamkeit
auch nicht.
- F1-erleben0 A. will sich selbst
beweisen, dass er mit dem Erwachen bewusst erlebnisfähig ist. Zunächst:
A. muss sich natürlich nicht beweisen, dass er mit dem Erwachen erlebnisfähig
ist, weil es für ihn schlicht und einfach so ist: er erlebt erwachen,
tagtäglich, meist so lange er lebt. Aber es gibt durchaus Lebenssituationen,
wo es nicht so klar ist, so dass sich die Frage stellt: wie könnte
sich A. beweisen, wenn er es bräuchte und wollte, dass er mit dem
Erwachen erlebnisfähig ist? Wie kann er sicher sein, dass er erwacht
ist? Woher weiß er, dass er erwacht ist? Und wie kann er sicher
sein, dass er mit dem Erwachen erlebnisfähig ist? Praktisch interessieren
die Fragen niemand, aber wissenschaftlich sind sie sinnvoll, um das Beweisen
möglichst gut zu verstehen.
- Am Leben, lebendig
- Tägliches schlafen und erwachen
- Nicht im Koma
- Nicht bewusstlos
- Nicht in Trance oder in Hypnose
- Keine bewusstseinsbeeinträchtigenden Zustände
- Keine sonstigen das Erwachen behindernden Faktoren
- Erleben des Erwachens: ich erlebe, ich bin erwacht, wach.
- Augen sind geöffnet
- Ich kann mich bewegen
- Ich kann handeln, z.B. in der Regel aufstehen.
- Ich kann mich fragen: bin ich wach?
- Ich bin orientiert, weiß, wer ich bin, wo ich bin und dass ich wach geworden bin
- Wenn ich mich kneife, spüre ich das
- Ich kann andere fragen
- EEG: Mit Hilfe des Elektroenzephalogramms können Bewusstseinszustände wie u.a. meines Wachseins erfasst werden.
- Erlebnisfähig bin ich dann, wenn meine innere Wahrnehmung eingeschaltet ist, das ist unter Normalbedingungen nach dem Erwachen oder wach sein der Fall.
- Meine innere Wahrnehmung ist eingeschaltet, wenn ich aktive Dimensionen des Erlebens wahrnehmen kann.
- natcodes-Kriterien-Normalbedingungen [Allgemein Normalbedingungen]
- natcodes-Kriterien-wach (EEG)
- natcodes-Kriterien-Erlebnisfähigkeit
- natcode wach (EEG)
- natcode innere Wahrnehmung eingeschaltet (EEG)
- natcode Dimensionen des Erlebens aktiv (EEG)
- Liegen Normalbedingungen vor?
- Ist Erwachen erfolgt?
- Ist die innere Wahrnehmung eingeschaltet?
- A. weist auf die drei F1-erleben0 Kriterien hin.
- Der Beweis für einen anderen ist erbracht, wenn dieser die drei Kriterien als erfüllt oder die natcodes als erbracht akzeptiert.
- Beweisen ist ein sozial-kommunikativer Akt und jeder andere hat die Möglichkeit, einen Beweis anzuerkennen oder nicht.
- Bei aktuell mehr als 8 Milliarden Menschen ist es faktisch nicht möglich mit jedem in einen Beweisdialog einzutreten.
- Aber man kann argumentieren, dass man die Methode F2-erleben0 bei Sprachfähigen und Auskunftswilligen grundsätzlich anwenden kann. Die Methode ist nur technisch, praktisch begrenzt, aber nicht grundsätzlich.
- Auch der Weg über repräsentative Stichproben ist praktisch-technisch unrealistisch.
- Man könnte sich einigen, dass der Beweis als erbracht gilt, so lange Einzelfall-Stichproben ihn erfüllen, also kein Gegenbeispiel gelingt. Im Sinne Poppers könnte man auch sagen; so lange Falsifikationsversuche misslingen darf der Beweis als erfüllt angesehen werden.
- Die All-Aussage F4-erleben0 lautet dann: Jeder, der erwacht, ist erlebnisfähig bzw. genau: Jeder Mensch, der unter Normalbedingungen erwacht, ist erlebnisfähig. Das könnte man so definieren. Hier ist aber gemeint und gewollt, zu beweisen, dass mit dem Erwachen bewusste Erlebnisfähigkeit einhergeht. Mit dem Beweis wäre eine allgemeine Gesetzmäßigkeit gefunden, dass nämlich Erwachen bewusste Erlebnisfähigkeit mit sich bringt. Das sollte sich für jeden gesunden Menschen unter Normalbedingungen zeigen lassen. Das sollte auch für jeden neu hinzukommenden Menschen gelten, so dass hier der Induktionsvorbehalt nicht gilt.
- Man könnte sich einigen, dass der Beweis als erbracht gilt, so lange Einzelfall-Stichproben ihn erfüllen, also kein Gegenbeispiel gelingt. Im Sinne Poppers könnte man auch sagen; so lange Falsifikationsversuche misslingen darf der Beweis als erfüllt angesehen werden.
- unterschiedliche Interessen und Motive
- unterschiedliche Aufmerksamkeit
- unterschiedliche Perspektive bei der Wahrnehmung
- unterschiedlich Informationsverarbeitung
- unterschiedliches Erinnerungsvermögen
- unterschiedliches Geschehen bei unterschiedlichen Zeitpunkten
- sonstige Faktoren
- Hatte A. die Möglichkeit, da zu sein?
- Gibt es Belege, Dokumente dagewesen zu sein?
- Zeugenwissen, also Wissen, das nur derjenige haben kann, der da oder dabei war
- Zeugen, andere fragen
- Belege (z.B. Fahrkarte, Parkschein, Überwachungsvideo, Foto, ...)
- Gibt es Belege, dass A. nicht da war?
- Subjektive Gewissheit oder Wissen, ich (A.) war da
- Rekonstruktion der Ereignisse und des Geschehens zum fraglichen Zeitpunkt
- Erinnerungen an das Dagewesen- und Dabeisein.
- Aussageanalyse.
Beweisidee F1-erleben0 Vorbereitende Überlegungen [Nach Checkliste]:
- 1. Behauptung: Unter Normalbedingungen gilt für jedes Erwachen
A.s, dass A. erlebnisfähig ist.
2. Beweisskizze:
- 2.1 Normalbedingungen bei A.
2.2 Erwachen bei A.
2.3 A. kann innerlich wahrnehmen.
- 3.1 Normalbedingungen
3.2 erwachen
3.3 innerlich wahrnehmen
3.4 Dimensionen des Erlebens
3.5 Aktive Dimensionen des Erlebens
5. Beweisschritte:
- 5.1 Zeige: Es liegen Normalbedingungen vor.
5.2 Zeige: Wenn A. erwacht, nimmt A. innerlich wahr, dass er erwacht ist: erleben0 heißt; ich bin wach.
5.3 Zeige: Mit der Einschaltung der inneren Wahrnehmung durch das Erwachen kann A. die aktiven Dimensionen des Erlebens innerlich wahrnehmen.
Kriterien
- Kriterien-Normalbedingungen
[Allgemein
Normalbedingungen]
natcodes-Kriterien-Normalbedingungen-wach-erlebnisfähig
_____
F1-erleben0 A. will sich selbst
beweisen, dass er mit dem Erwachen erlebnisfähig ist.
_____
F2-erleben0 A. will anderen beweisen,
dass er mit dem Erwachen erlebnisfähig ist.
_____
F3-erleben0 A. will jedem
anderen beweisen, dass er mit dem Erwachen erlebnisfähig ist.
F4-erleben0 A. will allgemein beweisen, dass jeder unter Normalbedingungen mit dem Erwachen erlebnisfähig ist.
erleben1
erleben1 als noch zu Lebzeiten mitbekommen oder ein Ereignis oder Geschehen (mit) erleben, zugegen, dabei sein (Zeitzeuge). Kaum ein Mensch dürfte daran zweifeln, dass ein Mensch unter Normalbedingungen gewisse Orte aufsuchen kann und das Geschehen an diesem Ort miterleben kann. Ebenso dürfte kaum jemand daran zweifeln, dass verschiedene Menschen das Geschehen unterschiedlich wahrnehmen und erinnern können. Und das kann auch verschiedene Gründe haben:
- Kriterien-erleben1 für
zugegen, dabei und Zeitzeuge sein.
F1-erleben1 A. will sich selbst beweisen, dass er zugegen, dabei war. Vielleicht weil es aus irgendwelchen Gründen wichtig ist und A. unsicher ist. Er wendet also die Kriterien-erleben1 an.
_____
F2-erleben1 A. will anderenbeweisen,
dass er zugegen, dabei war. Das ist die klassische Zeugensituation und
A. wendet die Kriterien-erleben1 an. Werden die Argumente und
Belege als Beweis anerkannt, ist der Beweis erbracht. Anmerkung: Vor Gericht
können Aussagen auch beschworen werden, was ihnen zusätzliches
Gewicht verleiht.
_____
F3-erleben1 A. will jedem
anderen beweisen, dass er zugegen, dabei war. Beweisen ist ein sozial-kommunikativer
Akt und jeder andere hat die Möglichkeit, einen Beweis anzuerkennen
oder nicht. Bei aktuell mehr als 8 Milliarden Menschen ist es faktisch
nicht möglich mit jedem in einen Beweisdialog einzutreten. Aber A.
kann argumentieren, dass er die Methode F2-erleben1 bei Sprachfähigen
und Auskunftswilligen grundsätzlich anwenden kann. Die Methode ist
nur technisch, praktisch begrenzt, aber nicht grundsätzlich.
_____
F4-erleben1 A. will allgemein
beweisen,
dass er zugegen, dabei war.
Die All-Aussage F4-erleben1 lautet dann: Für
jeden, der mehrere Kriterien-erleben1 für ein Dabei sein
erfüllt und keines dagegen spricht, kann dies als Beweis gelten.
- Man kann beim inneren Wahrnehmen meist nicht alles erfassen, zumal das Geschehen im Bewusstsein in ständigem Fluss ist. In aller Regel erfasst man nur Teile.
- Was erfasst wird hängt ab von der Bedeutung,
- der Ausprägung der Dimension
- und wie sehr die Aufmerksamkeit auf sie gerichtet ist.
- Dazu richtet A. den Blick nach innen und erfasst das Geschehen im Bewusstsein mit der inneren Wahrnehmung. Hilfsweise geht A. die Dimensionen des Erlebens durch und erfasst die aktiven. Aber hat er alle? Und sind sie auch richtig? A. kann diejenigen als Beweis für sich selbst akzeptieren, für die er Gewissheit hat.
- Hier ist fraglich, ob das grundsätzlich möglich ist. A. kann es vielleicht verständlich, glaubhaft oder wahrscheinlich machen. Aber ein Beweis wird höchstens dann möglich sein, wenn die natcodes seiner Erlebnisaussagen darstell- und prüfbar sind.
- Wie F2-erleben2
- Wie F2-erleben2 und F3-erleben2.
- Um das Besondere zu erfassen richtet A. den Blick in F1-erleben2 nach innen und erfasst das Geschehen im Bewusstsein mit der inneren Wahrnehmung. Hilfsweise geht A. die Dimensionen des Erlebens durch und erfasst die aktiven. Aber hat er alle? Und sind sie auch richtig? A. kann diejenigen als Beweis für sich selbst akzeptieren, für die er Gewissheit hat.
- Hier ist wie bei F2-erleben2 fraglich, ob das grundsätzlich möglich ist. A. kann es vielleicht verständlich, glaubhaft oder wahrscheinlich machen. Aber ein Beweis wird höchstens dann möglich sein, wenn die natcodes seiner Erlebnisaussagen darstell- und prüfbar sind.
- Wie in F2-erleben3 und schon in F3-erleben3
- Wie in F2-erleben3 und F3-erleben3 wie schon in F2-erleben2 und F3-erleben2.
- Erkenntnisarbeit ist ausgeschaltet
- denken ist ausgeschaltet
- beim Erleben kommen keine Namen für Begriffe oder Sachverhalte vor
- wissen ist ausgeschaltet
- Erfahrungen sind ausgeschaltet
- Probleme spielen keine Rolle
- Wenn A. in der Nachbetrachtung zu sich sagen kann, dass alle 6 Kriterien ausgeschaltet waren, wenn (entkognitivieren) gelungen ist.
- Hier ist sehr fraglich, ob das grundsätzlich überhaupt möglich ist, weil entkognitivieren nicht vollständig gelingen kann.
- Falls es aber theoretisch möglich wäre, fehlen ja die Worte zum Kommunizieren, weil reines Erleben gerade so definiert wurde.
- Und es ist auch fraglich, wenn die natcodes reines Erleben theoretisch möglich wären, sofern nicht völlig neue Wege der Kommunikation gefunden werden. Derzeit sind wir zu sehr auf traditionelle Kommunikationswege fixiert.
- Wie F2-erlebenr.
- Wie F2-erlebenr und F3-erlebenr.
- Erkenntnisarbeit ist weitgehend ausgeschaltet
- denken ist weitgehend ausgeschaltet
- beim Erleben kommen weitgehend keine Namen für Begriffe oder Sachverhalte vor
- wissen ist weitgehend ausgeschaltet
- Erfahrungen sind weitgehend ausgeschaltet
- Probleme spielen weitgehend keine Rolle
- Wenn A. in der Nachbetrachtung zu sich sagen könnte, dass alle 6 Kriterien weitgehend ausgeschaltet waren, wenn (entkognitivieren) gelingt. Praktisch reines Erleben gelingt in dem Maße, wie es gelänge, die 6 Kriterien weitgehend zu minimieren.
- Aber schon hier zeigt sich die Paradoxie, wenn nicht sogar Antinomie, wie man das mit sich selbst kommunizieren soll. Beweisen ist ein kommunikativer Akt, hier mit sich selbst und dazu braucht es eine Sprache, Worte, Begriffe. Die sollen aber gerade weitgehend minimiert werden, weil Kognitionen das praktisch reine Erleben "verunreinigen".
- Es ist sogar fraglich, ob die natcodes für praktisch reines Erleben überhaupt gefunden werden können, weil dazu ja auch Kommunikation erforderlich ist. Man bräuchte also völlig neue Wege der Kommunikation, was derzeit wenigstens paradox, eher antinomisch und aporetisch anmutet.
- Hinzu kommt, dass man ja auch das Erlebenpr kognitiver Elemente studieren möchte, was aber nicht geht, wenn man kognitive Elemente im Erleben weitgehend ausschalten will.
- Wie F1-erlebenpr. Außerdem:
- Beweisen ist ein sozial-kommunikativer Akt und jeder andere hat die Möglichkeit, einen Beweis anzuerkennen oder nicht. Sofern zum Beweisen Worte benötigt werden, was in der Regel der Fall ist, ist ein Beweis praktisch reinen Erleben nicht möglich.
- Ein Beweis wird höchstens dann möglich sein, wenn die natcodes der Erlebnisaussagen von A, darstell- und prüfbar sind oder neue Wege der Kommunikation gefunden werden. Derzeit sind wir zu sehr auf traditionelle Kommunikationswege fixiert.
- Wie F2-erlebenpr.
- Wie F2-erlebenpr und F3-erlebenpr
- Flow entsteht aus einem Tun
- Dieses Tun ist hingebungsvoll
- Beim Flow ist man ganz im Hier und Jetzt
- Beim Flow ist man ganz bei der Sache
- Das Tun geschieht um seiner selbst willen
- Das Tun ist ausschließlich intrinsisch (aus sich selbst heraus) motiviert
- Das Tun beschert ausgeprägte positive Gefühle (z.B. Befriedigung, Euphorie, Freude, Glück, Lust)
- Wenn A. Flow schon kennt, dann kann er sein augenblickliches Erleben als Flow wiedererkennen (auch ohne Benennung).
- A. kann im Nachhinein auch prüfen, ob die Flow-Kriterien bzw. hinreichend viele oder welche erfüllt waren.
- A. kann seinen Zustand, den er für Flow, hält beschreiben und von Flow-Kennern auf seine Flowness bewerten lassen.
- Falls man den natcode von Flow kennt, kann man über den natcode prüfen, ob und wie sehr ein Flow vorlag.
- Ein Beweis ist hier schwieriger als bei erleben2, weil das besondere Flow-Erleben einige oder sogar viele andere nicht kennen und sich daher viel schwerer tun, einen Beweis anzuerkennen. Meint man ein Erleben aus eigenem Erleben zu kennen, tut man sich leichter, es auch einem anderen zuzubilligen (wie beweist man das?).
- Hier ist fraglich, ob das grundsätzlich möglich ist. A. kann es vielleicht verständlich, glaubhaft oder wahrscheinlich machen. Aber ein Beweis wird höchstens dann möglich sein, wenn die natcodes seiner Erlebnisaussagen darstell- und prüfbar sind oder neue Kommunikationswege gefunden wurden. Derzeit sind wir zu sehr auf traditionelle Kommunikationswege fixiert.
- wie F2-erlebensF.
- wie F2-erlebensF und F3-erlebensF.
- Es stellt sich der Eindruck oder das Gefühl unklar ein
- Es ist schwierig zu erkennen und damit unklar, ob es sich um welches erleben oder sachliches Befassen (erlebeng) es sich handelt
- Das Erleben wird nicht klar wieder erkannt als schon Erlebtes (déjà-vu), es erscheint neu
- Man erkennt zwar, dass man das Erleben schon (déjà vu) hatte, aber man kann es nicht greifen, es bleibt ein unklares Gefühl
- Das Erleben ist nur schwer in Worte zu fassen und zu beschreiben
- Das Erleben ist nur sehr grob und ungefähr zu umschreiben.
- Das Erleben bedarf zu seiner Charakterisierung Analogien, Bilder, Gleichnisse, Metaphern, ...
- ...
- Hier ist fraglich, ob das grundsätzlich möglich ist. A. kann es vielleicht verständlich, glaubhaft oder wahrscheinlich machen. Aber ein Beweis wird höchstens dann möglich sein, wenn die natcodes seiner Erlebnisaussagen darstell- und prüfbar sind, wobei fraglich ist, ob es natcodes von unklarem Erleben gibt. Hier ist weitere Klärung erforderlich.
- wie F2-erleben?
- wie F2-erleben? und F3-erleben?.
- Einnehmen einer sachlichen Perspektive, auch wenn persönliches, subjektives Erleben kommuniziert werden soll
- Gefühle und Wertungen sollen keine Rolle spielen
- Erregung oder Aufregung sind nicht ausgeprägt
- Aufmerksamkeit und Konzentration gelten einer Sache, einem Sachthema
- Persönliches Befinden spielt keine Rolle
- Hier ist fraglich, ob das grundsätzlich möglich ist. A. kann es vielleicht verständlich, glaubhaft oder wahrscheinlich machen. Aber ein Beweis wird höchstens dann möglich sein, wenn die natcodes seiner Erlebnisaussagen darstell- und prüfbar sind.
- Kopfarbeit verrichten
- den Verstand bemühen und gebrauchen
- mit Rationalem beschäftigen
- Gegebenheiten und Zusammenhänge analysieren
- denken, überlegen
- mit Problemen beschäftigen
- mit Vorsätze beschäftigen
- mit Zielen beschäftigen
- planen
- lernen
- üben
- Prüfung der affektiven Dimensionen > erlebena.
- Prüfung der kognitiven Dimensionen > erlebenk.
- Wie F1-erlebena.
- Wie F1-erlebenk.
- Wie F2-erlebena.
- Wie F2-erlebenk.
- Wie F3-erlebena.
- Wie F3-erlebenk.
- Wie F4-erlebena.
- Wie F4-erlebenk.
- F1-erleben0 ist erfüllt, d.h. A. ist wach.
- ezK1 Ichbezug: die Perspektive richtet sich auf mein persönliches, subjektives Erleben und nicht auf den Sachgehalt, d.h. es gibt einen Ichbezug. Ich frage nicht, worum es geht, was ist, sondern wie es mir dabei ergeht; es geht gerade nicht um das Objektive, sondern wie es mir ergeht. Beispiele 01 bis 10.
- ezK2 Affektive Dimensionen. Wie empfinde, fühle ich gerade unabhängig vom sachlich-objektiven? Ich gehe z.B. die affektiven Dimensionen des Erlebens durch: I01 Antrieb, Energie; I02 Bedürfnisse, Begehren, Interesse, Motive, Neugier, Sehnen/Sehnsucht, Wünsche, Verlangen Wollen; I03 Befindlichkeit, Stimmung; I04 Empfinden, Empfindung (Teil oder gleichbedeutend mit einer Wahrnehmung); I05 Fühlen, Gefühl(e); I11 Spüren ( Körperregungen). Eine Sonderstellung nehmen werten und Werterleben ein I14, wo sich oft eine affektive Komponente findet. Beispiele 01 bis 10.
erleben2
erleben2 als innere Wahrnehmung, was in mir geschieht, also erleben von etwas. Das ist sozusagen das eigentliche psychologische Erleben.
Probleme beim erleben2:
_____
F1-erleben2 A. will sich selbst
beweisen, was in ihm geschieht.
_____
F2-erleben2 A. will anderen
beweisen, was in ihm geschieht.
Wie könnte A. anderen unter der Annahme, dass die natcodes
für sein Erleben vorliegen oder erstellt werden können, beweisen,
was in ihm geschieht? Es muss, was er sagt, dass in ihm geschah mit den
natcodes(erleben(natcode(bio))) überzeugend übereinstimmen. Wenn
die Angabe A.s zu seinem Befinden erleb2=gut(Befinden) mit dem
natcode(erleben2=(natcode(befinden(bio))))=gut übereinstimmt,
dann liesse sich A.s Befinden auch ohne das er es verbal ausdrückt
mit Hilfe des festgestellten natcodes erfassen. Damit sollte A. anderen
beweisen können können, dass sein Befinden am tt.mm.hh mm:ss
als "gut" zu bezeichnen ist.
_____
F3-erleben2 A. will jedem
anderen beweisen, was in ihm geschieht.
F4-erleben2 A. will allgemein beweisen, was in ihm geschieht.
erleben3
erleben3 als besondere nicht-alltägliche innere Wahrnehmung
Der psychologische Erlebnisbegriff hat nur insofern etwas mit als besonders empfundenem oder herausragendem erleben3 ("events") zu tun, als diese eben auch Erlebnisse sind. In der Psychologie des Erlebens geht es um grundsätzlich jedes Erleben ungeachtet seiner besonderen emotionalen Bedeutung. Zur Verdeutlichung des psychologischen Erlebnisbegriffes findet man hier einige Beispiele. Viele Menschen verbinden mit Erleben oder Erlebnis solche besonderen inneren Wahrnehmungen. Und die allermeisten Menschen kennen das auch, haben solche besonderen inneren Wahrnehmungen erlebt und streben danach. An dieser Stelle ist es vielleicht nützlich anzumerken, dass die allermeisten Menschen mit Erleben ein affektiv angereichertes und nicht sachlich-gegenständliches "Erleben" meinen.
_____
F1-erleben3 A. will sich selbst
beweisen, dass er eine besondere
nicht-alltägliche innere Wahrnehmung hatte. Besondere innere Wahrnehmungen
ragen aus dem Durchschnitt des Erlebens meist deutlich hervor. Das
kann einerseits zu besonderer Deutlichkeit und Klarheit des Erlebens
führen, andererseits kann es aber auch irritieren und Unsicherheiten
auslösen. Nicht immer ist das Herausragende eine Beweiserleichterung,
wenn man das Erleben zu fassen versucht.
_____
F2-erleben3 A. will anderen
beweisen, dass er eine besondere nicht-alltägliche innere Wahrnehmung
hatte.
_____
F3-erleben3 A. will jedem
anderen beweisen, dass er eine besondere nicht-alltägliche innere
Wahrnehmung hatte.
_____
F4-erleben3 A. will allgemein
beweisen, dass er eine besondere nicht-alltägliche innere Wahrnehmung
hatte.
erlebenr
erlebenr Reines Erleben, eine Konstruktion der PhänomenologInnen von der noch ziemlich unklar ist, ob oder wie sie möglich und sinnvoll ist. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Aporie, um etwas Unlösbares. > Nur_empfinden.
- Kriterien-erlebenr: alles Kognitve (erkennen, verstehen,
erklären, denken, wissen, ...) ausschalten (entkognitivieren)
_____
F1-erlebenr A. will sich selbst beweisen, dass er ein reines Erleben hatte.
F2-erlebenr A. will anderen beweisen, dass er ein reines Erleben hatte.
F3-erlebenr A. will jedem anderen beweisen, dass er ein reines Erleben hatte
F4-erlebenr A. will allgemein beweisen, dass er ein reines Erleben hatte
| Anmerkung: (1) Erlebenr, reines Erleben, eine Konstruktion der PhänomenologInnen, unterscheidet sich vom praktisch reinen Erlebenpr durch den fehlenden Einschub weitgehend bei Erlebenpr. (2) Es gibt allerdings viele Sachverhalte, die so gut gelernt und konditioniert sind, dass wir uns gar nicht dagegen wehren können, dass mit der Präsentation sofort, ohne dass wir etwas dagegen tun können, Namen, Wissen, Erfahrungen da sind. (3) Es gibt wahrscheinlich weitgehend praktisch reines Erleben, aber es ist beim Stand der Wissenschaft im März 2023 nicht kommunizierbar. |
erlebenpr
Erlebenpr Praktisch reines Erlebenpr Diese Kategorie ist eine bewusste Abmilderung des gedachten idealen reinen Erlebens, eine Konstruktion der PhänomenologInnen, von der aber auch ziemlich unsicher ist, ob und wie es praktisch reines Erleben gibt. Einigermaßen sicher ist, dass es ein mehr oder minder von Störelementen freies Erleben gibt. Den Index "pr" kann man lesen als praktisch rein (so gut es eben in der Wirklichkeit geht) aber nicht als phänomenologisch rein. Beispiel: wenn ich mich auf ein Telefonat konzentrieren will, schalte ich das Störelement Radio aus.
- Kriterien-erlebenpr: alles Kognitve (erkennen, verstehen,
erklären, denken, wissen, ...) weitgehend ausschalten
(entkognitivieren)
_____
F1-erlebenpr A. will sich selbst beweisen, dass er ein weitgehend praktisch reines Erleben hatte.
F2-erlebenpr A. will anderen beweisen, dass er ein praktisch reines Erleben hatte.
F3-erlebenpr A. will jedem anderen beweisen, dass er ein praktisch reines Erleben hatte
F4-erlebenpr A. will allgemein beweisen, dass er ein praktisch reines Erleben hatte.
erlebens
Erlebens mit spezifischer Bedeutung, z.B. déjà-vu (schon erlebt), Zeitlupe-Erleben, Horror-Trip-Erleben; Flow-Erleben nach Csikszentmihalyi [Indizierung: Flow-ErlebensF]. Es schien mir sinnvoll, eine solche Möglichkeit vorzugeben, weil ich zu Beginn und in der ersten Zeit meiner Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse noch nicht absehen konnte, wie viele und welche spezifischen Bedeutungen vorgesehen werden sollten. Ein Erlebens spezifischer Bedeutung ist in der Regel auch ein besonderes Erleben3, genau genommen eine Teilklasse davon. Also Erleben2 umfasst Erleben3 umfasst Erlebens.
- Kriterien-spezifisches-Erlebens:
Es sollten Kriterien für das jeweilige spezifische Erleben angegeben
werden können. Zum Beispiel
Kriterien-Flow-ErlebensF .
F1-erlebensF A. will sich selbst beweisen, dass er ein spezifisches Erleben "Flow" hatte.
F2-erlebensF A. will anderen beweisen, dass er ein spezifisches Erleben "Flow" hatte.
F3-erlebensF A. will jedem anderen beweisen, dass er ein spezifisches Erleben "Flow" hatte.
F4-erlebensF A. will allgemein beweisen, dass er ein spezifisches Erleben "Flow" hatte.
erleben?
Erleben? ein Erleben mit unklarer Bedeutung.
In Beweisen zur Unklarheit liegt für den einen oder anderen eine gewisse Paradoxie, wenn man zugesteht, dass zum Beweisen klare Begriffe gehören, also auch Erlebensbegriffe. Nun, hier ist nach den eingeführten Unterscheidungen unklar, welches Erleben (1, 2, 3, s, r, pr, a, k, ak, z, X) vorliegt. Diese Unklarheit soll bewiesen werden.
Kriterien-Erleben?-unklar
_____
F1-erleben? A. will sich selbst
beweisen, dass er ein Erleben mit unklarer Bedeutung hatte. A. wendet die
Kriterien-Erleben?-unklar an.
_____
F2-erleben? A. will anderen beweisen, dass er ein Erleben mit unklarer Bedeutung hatte.
_____
F3-erleben? A. will jedem
anderen
beweisen, dass er ein Erleben mit unklarer Bedeutung hatte.
_____
F4-erleben? A. will allgemein
beweisen, dass er ein Erleben mit unklarer Bedeutung hatte
erlebeng evtl. eine Umbenennung erwägen (z.B. erfahren oder befassen).
Erlebeng sachlich, gegenständliches Erleben (Lipps 1905), hauptsächlich denken. Diese Konstruktion mutet widersprüchlich an, was zeigt ;-), dass sachlich und erleben irgendwie vom Sprachgefühl und Sprachgebrauch her nicht zusammenpassen. Dieses Grundproblem hat Theodor Lipps in Bewusstsein und Gegenstände 1905 gut und mehr als ausführlich herausgearbeitet: es gibt die sachlich-gegenständliche und die Erlebens-Perspektive. Die Paradoxie liegt darin: obwohl die sachlich-gegenständliche Perspektive vom subjektiven Erleben absieht (abstrahiert), ist es doch auch wieder Erleben insofern es innerlich wahrgenommen werden kann. Und hier verstrickt sich die Wortwahl der Begrifflichkeit: obwohl sachlich-gegenständliches Erleben kein Erleben nach dem Sprachgefühl ist, wird es doch so genannt. Streng und überspitzt heißt das doch: es gibt ein Erleben, das kein Erleben ist, nämlich das sachlich-gegenständliche. Hier ist unsere Sprechweise ein einzigartiger Fallstrick. Wie kommen wir da raus? Am einfachsten wäre, erlebeng nicht mehr erleben zu zu nennen, sondern z.B. sachlich-gegenständliches befassen (aktiver Aspekt) oder erfahren (passiver Aspekt). Im Bewusstsein fänden damit zwei Hauptprozesse statt: erleben und befassen. Das gleiche könnte für erlebenk, also für die kognitiven Prozesse, gelten. Andererseits ist aber durchaus so, daß bei der kognitiven Arbeit Dimensionen des Erlebens berührt sein und hervorgerufen werden können. Man kann an einem Problem, das sich nicht lösen lässt, verzweifeln und dann sind wir voll im Erleben. Vielleicht wäre eine sowohl theoretisch wie praktisch brauchbare Lösung, vom erleben nach dem Sprachgefühl und Sprachgebrauch zu verlangen, dass affektive Dimensionen beteiligt sind.
Exkurs: Persönlicher Beweis durch Erlebenag, dass erlebeng mit erlebena einhergehen kann
Ich habe am 21.04.2023 im alhabetischen Beweisregister einige Nachträge
- 21.04.23 Ins alphabetische
Beweisregiste eine Reihe wichtiger Beweise erfasst: Assoziationsbeweis,
Aufmerksamkeitsbeweis, Beweglichkeitsbeweis, Denkbarkeitsbeweis, Denkbeweis,
Konzentrationsbeweis, Möglichkeitsbeweis, Vorstellungsbeweis, Wahrnehmungsbeweis,
Willensbeweis.
| Hypothese: Sacherleben erlebeng kann als befriedigend erlebta
werden.
Die Zeitbeziehung kann gleichzeitig (parallel) oder nacheinander (hierarchisch-sequentiell) sein. Inwieweit das Sacherleben selbst unabhängig vom Ergebnis - wie etwa beim Flowerleben - oder erst das Ergebnis befriedigend erlebt wird, bedarf weiterer Klärungs und Forschungsarbeit. |
Das allermeiste alltäglicher Kommunikation,
erst recht in sachlichen oder wissenschaftlichen Äußerungen
ist Informationsaustausch sachlich gegenständlicher Natur. Eine neue
Schwierigkeit und Paradoxie taucht auf, wenn Erleben und Erlebnisse sachlich
übermittelt werden sollen, z.B. (1) "X. fühlte sich hundeelend."
oder Y. fühlt sich "himmehochjauchzend und dann wieder zu Tode betrübt."
Die meisten Menschen haben kaum Probleme sachlich zu kommunizieren, etwa:
(1) "Der Busch dort drüben, hat sich soeben ganz schön bewegt.
Ob wohl Sturm aufkommt? Da könnte man glatt frösteln."
(2) "X. war außer Rand und Band und nicht zu beruhigen". (3) "Ich
hätte gern das 2. Brot von links nach rechts in der obersten Reihe."
(4) Von A. nach B. braucht man mit dem Auto vielleicht eine, mit dem Fahrrad
2-3 und zu Fuß 5-6 Stunden." (5) "Die Vase ist runtergefallen." (6)
"Scheiße, jetzt ist mir die Vase runtergefallen!"
- Kriterien-Erlebeng
_____
F1-erlebeng A. will sich selbst
beweisen, dass er ein sachlich, gegenständliches Erleben hatte. A.
befragt seine Erinnerung, er sagt es sich noch einmal vor oder schreibt
es auf. Für sachlich-gegenständliches Erleben gibt es eine Unzahl
von Belegen und Dokumenten (Bücher, Artikel, Aufzeichnungen).
Aber es bleibt die Frage, ob die Aufschreibungen richtig wiedergegeben,
also authentisch und vollständig sind. Da dürfte so gut wie fast
nie der Fall sein, weil fast alle Texte nachbearbeitet und verändert
werden.
_____
F2-erlebeng A. will anderen beweisen,
dass er ein sachlich, gegenständliches Erleben hatte. Er erzählt
es oder schreibt es auf. Aber auch hier fragt sich, ob die Erzählung
oder der aufgeschriebene Text richtig wiedergegeben, also authentisch und
vollständig sind (>Aussagepsychologie).
Das lässt sich ohne natcodes
des gegenständlichen Erlebens kaum beweisen. Wohlgemerkt: es geht
hier nicht darum, ob das Erzählte oder aufgeschriebene so oder so
richtig oder falsch ist, sondern ob das sachlich-gegenständliche Erleben
richtig und vollständig erzählt oder aufgeschrieben wurde. So
oder so richtig oder falsch ist natürlich auch interessant, aber an
dieser Stelle eine andere Fragestellung.
_____
F3-erlebeng A. will jedem
anderen beweisen, dass er ein sachlich, gegenständliches Erleben hatte
Siehe bitte F2-erlebeng.
_____
F4-erlebeng A. will allgemein
beweisen, dass er ein sachlich, gegenständliches Erleben hatte
Siehe bitte F2-erlebeng .
erlebena
Erlebena affektives Erleben mit mindestens einer der affektiven Dimensionen: I01 Antrieb, Energie; I02 Bedürfnisse, Begehren, Interesse, Motive, Neugier, Sehnen / Sehnsucht, Wünsche, Verlangen Wollen; I03 Befindlichkeit, Stimmung; I04 Empfinden, Empfindung (Teil oder gleichbedeutend mit einer Wahrnehmung); I05 Fühlen, Gefühl(e); I11 Spüren ( Körperregungen). Eine Sonderstellung nehmen werten und Werterleben ein I14, wo sich oft eine affektive Komponente findet.
_____
F1-erlebena A. will sich selbst beweisen, dass er ein affektives Erleben hatte. A. geht die affektiven Dimensionen durch und prüft, welche davon er innerlich wahrgenommen hat.
_____
F2-erlebena A. will anderen beweisen, dass er ein affektives Erleben hatte.
Wie könnte A. anderen unter der Annahme, dass die natcodes
für sein affektives Erleben vorliegen oder erstellt werden können,
beweisen, was in ihm affektiv geschieht? Es muss, was er sagt, dass in
ihm geschah mit den natcodes(erleben(natcode(bio))) überzeugend übereinstimnmen.
Wenn die Angabe A.s zu seinem Befinden erleb2=gut(Befinden)
mit dem natcode(erleben2=(natcode(befinden(bio))))=gut übereinstimmt,
dann liesse sich A.'s Befinden auch ohne das er es verbal ausdrückt
mit Hilfe des festgestellten natcodes erfassen. Damit sollte A. anderen
beweisen können können, dass sein Befinden am tt.mm.hh mm:ss
als "gut" zu bezeichnen war.
_____
F3-erlebena A. will jedem
anderen beweisen, dass er, A., ein affektives Erleben hatte
Wie F2-erlebena.
_____
F4-erlebena A. will allgemein
beweisen, dass er ein affektives Erleben hatte
Wie F2-erlebena.
erlebenk
Erlebenk kognitives Erleben mit mindestens einer der kognitiven Dimensionen I07 Gedanken, denken; I10 Pläne, Vorsätze, Ziele; I21 Lernen, üben.
Doch wie erlebt man Kognitives? Ist kognitives Erlebenk nicht sogar ein Widerspruch in sich? Was kann man bei (1) "2x2 =4", (2) "dort parkt ein Auto" oder (3) "X. ist 37 Jahre alt" erleben? Es stellt sich wie schon beim Erlebeng die Frage, ob erlebenk nicht gleichbedeutend mit erlebeng ist? Und wenn nicht, was unterscheidet beide? Zunächst unterscheiden sich bei erlebenk underlebeng, nur die Perspektive: erlebenk zielt auf das Subjektive (wie geht es mir dabei, wie ist es für mich?), weg vom Objektiven underlebeng zielt auf das Objektive, weg vom Subjektiven. Eine Sonderstellung nehmen werten und Werterleben ein I14, wo sich oft sowohl affektive als auch eine kognitive Komponenten finden.
Anmerkung Grenzfragen: wohin gehört bewusst, wach, aufmerksam, überrascht, in sich gekehrt, vertieft, versunken (mystisches Erleben)?
- Kriterien für ein kognitives erlebenk:
F1-erlebenk A. will sich selbst beweisen, dass er ein kognitives Erleben hatte. A. erinnert und wiederholt noch einmal, was er gedacht, geplant, beabsichtigt, gelernt oder geübt hat: und er kann es aufschreiben. Das muss nicht gelingen, denn Denken ist sehr flüchtig und manches geht unter.
_____
F2-erlebenk A. will anderen beweisen, dass er ein kognitives Erleben hatte.
Hier ist fraglich, ob das grundsätzlich möglich ist. Grundsätzlich kann A. alles mögliche erzählen, was in ihm kognitiv vorgegangen sein soll, aber ob es richtig ist, ist eine andere Frage. A. kann es vielleicht verständlich, glaubhaft oder wahrscheinlich machen. Aber ein Beweis wird höchstens dann möglich sein, wenn die natcodes seiner kognitiven Erlebnisaussagen darstell- und prüfbar sind.
_____
F3-erlebenk A. will jedem anderen beweisen, dass er ein kognitives Erleben hatte
Wie F2-erlebenk.
_____
F4-erlebenk A. will allgemein beweisen, dass er ein kognitives Erleben hatte.
Wie F2-erlebenk.
erlebenak sowohl affektives als auch kognitives Erleben. Es sind demnach zwei Prüfungen vorzunehmen:
_____
F1-erlebenak A. will sich selbst
beweisen, dass er ein sowohl affektives als auch kognitives Erleben hatte
_____
F2-erlebenak A. will anderen
beweisen, dass er ein sowohl affektives als auch kognitives Erleben hatte
F3-erlebenak A. will jedem anderen beweisen, dass er ein sowohl affektives als auch kognitives Erleben hatte
F4-erlebenak A. will allgemein beweisen, dass er ein sowohl affektives als auch kognitives Erleben hatte
erlebenz
Erlebenz auf den Erlebenscharakter zentriert und damit sicher kein g := sachlich-gegenständliches Erleben. z und g schließen sich aus. Die Grundfrage ist: wie geht zentrieren auf den Erlebnischarakter? Was ist der Unterschied zum sachlich-gegenständlichen befassen? Ein z liegt vor, wenn die Erlebenz-Kriterien ezK1 und ezK2 erfüllt sind.
- Erlebenz-Kriterien ezK1 und ezK2
Sätze stehen für Aussagen, Wertungen, Fragen oder Ausrufe.
Muss Oberfläche und Intention, Schein und Sein, unterschieden
werden?
Wie steht es um metaphysische, religiöse, weltanschauliche Aussagen?
Auch wenn man nicht jeden Satz klar zuordnen kann, so gibt es doch
genügend, die sich für das Beweisen eignen.
| Beispiele für erlebenz
Es gibt einen Ichbezug |
Gegenbeispiele erlebenz
Es gibt keinen Ichbezug |
Grenzfälle für erlebenz
Es kann Ichbezüge geben |
| 01 Es geht mir nicht besonders gut
02 Ich fühle mich ganz ausgezeichnet 03 Ich bin sehr zuversichtlich, ... 04 Irgendwie zieht es im linken Bein 05 Ich bin neugierig, wie ... 06 Es gefällt mir nicht, ... 07 Ich spüre .... 08 Ich fühle .... 09 Ich fühle mich (nicht) gewachsen 10 Ich möchte (nicht) ... |
11 Es ist kurz nach 12
12 Kant lebte in Königsberg 13 Die Energiepreise sind gefallen 14 Die Erde dreht sich um die Sonne 15 16*4 ist 64 16 Newton war ein Physikpionier 17 Ein Taxi ist ein mietbares Auto 18 Man weiß nicht, ob das geht 19 Am Sonntag wird gewählt 20 Es regnet |
21 Es könnte auch schief gehen
22 Es ist unsicher, ob das geht 23 Ich war auf der Kirchweih 24 Das Wetter ist nicht besonders 25 Das muss ich mir überlegen 26 Gott ist tot 27 Erlebensforschung ist schwierig 28 Mystik ist so eine Sache 29 Wie man es nimmt 30 Ich kann es nicht |
| Was haben Fragen für
einen Erlebensbezug? |
Wohin gehören Ausrufe? | Gruß, Wunsch Höflichkeit |
| 31 Bin ich wirklich der Auffassung?
32 Wie erkläre ich es dem Freund? 33 Muss das denn sein? 34 Wie wird das Wetter morgen? 35 Wie kommst Du dazu? 36 Warum tust du das? 37 Schmeckts? 38 Was soll denn das? 39 Wie geht es Ihnen? 40 Heute schon gelebt? |
41 So was aber auch!
42 Au Weia! 43 So ein Mist! 44 Niemals! 45 Hallooo! 46 Sie sind mir so einer! 47 Hoppla! 48 Donnerwetter! 49 Das ist selten doof! 50 Tausendsassa! |
51 Guten Morgen
52 Guten Abend 53 Gute Nacht 54 Mahlzeit 55 Frohe Feiertage 56 Alles Gute 57 Herzl.Glückwunsch 58 Gute Besserung 59 Gute Erholung 60 Schönen Urlaub |
| Gehören alle Wertungen zu erlebenz? | Fragen mit Vorwurf sind Wertungen | Grenzfälle für Fragen mit Vorwurf | Ironie, Schreien, Gri- massieren, Nachäffen |
| 61 Das ist ein schönes Angebot
62 Das ist wirklich Scheiße 63 Das geht so nicht 64 Das haben Sie gut gemacht 65 Niemand ist perfekt 66 Das ist wunderbar 67 Besser geht es nicht 68 Da kann ich nicht mitgehen 69 Das ist sehr gut 70 Das ist aber sehr teuer |
71 Musst Du das immer so ...?
72 Geht's denn gar nicht anders? 73 Was hast Du Dir nur gedacht? 74 Warum um Himmelswillen...? 75 Wie kommst Du denn dazu? 76 Kannst Du nicht zuhören! 77 Hast Du das noch nicht verstanden? 78 Wie kann man nur so dumm sein? 79 Wer hat diesen Mist gemacht? 80 Warum hilfst Du mir nicht? |
81 Wieso machst Du das so?
82 Warum hast du das gemacht? 83 Wie kommst Du darauf? 84 Kann man das anders machen? 85 Machst Du das immer so? 86 Geht das nicht auch anders? 87 Geht das nicht auch einfacher? 88 Wieso denkst Du so? 89 Warum soll ich das machen? 90 Wer hat das gemacht? |
91 schreit
92 grimassiert 93 verdreht die Augen 94 äfft nach 95 da wäre ich nie drauf gekommen 96 so was aber auch 97 Nein, wirklich ...? 98 Das ist nicht Dein Ernst! 99 betont abwenden 100 übersehen/ nicht reagieren |
F1-erlebenz A. will sich selbst beweisen, dass er ein auf den Erlebenscharakter zentriertes Erleben hatte
Beweis für 03: Ich fühle mich ganz ausgezeichnet.
- 1. Beweisidee: A. muss zeigen, dass die Kriterien F1-erleben0
(enthalten Normalbedingungen), ezK1, ezK2 erfüllt
sind.
2. Behauptung: Ich fühle mich ganz ausgezeichnet.
3. Voraussetzung: A. kennt sich ganz ausgezeichnet fühlen und kann das Gefühl identifizieren.
4. Definition: Für zentriertes Erlebenz gelten die Kriterien ezK1 (Ichbezug) und ezK2 (affektive Dimension aktiv).
5. Erster Schritt: A. ist wach (F1-erleben0).
6. Zweiter Schritt: Ichbezug ezK1 ist mit 5. bereits hergestellt:
7. Dritter Schritt A. richtet seine innere Wahrnehmung im
8. Vierten Schritt auf ezK2, die affektive Grundimension I05,
9. Fünfter Schritt und identifiziert diese als sich ganz ausgezeichnet fühlen.
10. Aus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 folgt 2 nach der Beweisidee 1.
F2-erlebenz A. will anderen beweisen, dass er ein auf den Erlebenscharakter zentriertes Erleben hatte
- A. will anderen beweisen, dass er sich ganz ausgezeichnet gefühlt
hat.
A. könnte seine Methode-erlebenz schildern, also sagen, wie er es sich selbst beweist. Aber das ist ja noch kein Beweis für andere. A könnte lügen, sich irren oder übertreiben.
Hier ist fraglich, ob das grundsätzlich möglich ist. A. kann es vielleicht verständlich, glaubhaft oder wahrscheinlich machen. Aber ein Beweis wird höchstens dann möglich sein, wenn die natcodes seiner Erlebnisaussagen darstell- und prüfbar sind.
_____
F3-erlebenz A. will jedem anderen beweisen, dass er ein auf den Erlebenscharakter zentriertes Erleben hatte. g := sachlich-gegenständliches Erlebnis. z und g schließen sich aus.
Wie F2-erlebenz.
_____
F4-erlebenz A. will allgemein beweisen, dass er ein auf
den Erlebenscharakter zentriertes Erleben hatte. g := sachlich-gegenständliches
Erlebnis. z und g schließen sich aus.
Ende der Beweiserörterungen zu den Unterscheidungen des Erlebens und der Erlebnisse
Weitere Beweise zur Psychologie
Existenz - und Einzelfall-Beweis dass Selbstbeobachtung
bei Vorstellungen Vorstellungsfähiger möglich ist
Vorbemerkung: Verstellungsversuche gehen natürlich nur bei Menschen,
die vorstellen können, also im Gedächtnis gespeicherte
Wahrnehmungen im Bewusstsein präsentieren können, was nicht bei
jedem der Fall ist, wie ich bei der Therapie eines Depressiven 1997zufällig
herausfand. Bei allen Vorstellungsversuchen muss also zunächst
gesichert werden, dass die Versuchsperson vorstellen kann. Vorstellen können
ist also eine Bedingung oder Voraussetzung für den Einzelfall- und
Existenzbeweis.
Versuchsgeschichte
11.12.2022, 17:58: Ich schließe die Augen und stelle mir die
Ziffern 1,2,3 vor. Ich kann diese vorgesetellten Ziffern in meinem
Bewusstsein direkt wahrnehmen und beobachten Daraus ziehe ich den Schluss,
dass Selbstbeobachtung in diesem Fall funktioniert. 18:00 Uhr. Am späteren
Abend habe ich den Versuch noch einmal gemacht und auch meine Frau hat
ihn durchgeführt und bestätigt, wobei damals nicht protokolliert
wurde, ob alle drei Ziffern zugleich oder nacheinander vorgestellt wurden.
26.04.2023 Wiederholung des Versuchs vom 11.12.2022 gegen 10:20-10:21
Uhr. Was habe ich erlebt? Ich habe die Augen geschlosen und mit nacheinander
in einer Reihe die Ziffern 1, 2, 3, 4, 5 vorgestellt. Dabei habe ich die
die Zifferen 1, 2, 3, 4, 5 in der Vorstellung "gesehen".
- 11.12.2022-RS1
11.12.2022-RS2
26.04.2023
27.04.2023-1 Ging nicht
27.04.2023-2
30.01.2023-1
30.01.2023-2
- Behauptung: Selbstbeobachtung ist für Vorstellungsfähige beim Vorstellen von Ziffern möglich. Typ Existenzbeweis: es gibt Selbstbeobachtung von Vorstellungen bei Vorstellungsfähigen.
- Begriffsbasis Selbstbeobachtung: Selbst, Beobachtung, Selbstbeobachtung, Bewusstsein, vorstellen, vorstellungsfähig, Ziffern 1, 2, 3, 4, 5.
- Sind die Begriffe in meiner Behauptung allesamt klar, definiert oder hinreichend klar beschrieben mit Beispielen und Gegenbeispielen?
- Selbst (ich)
- Beobachtung heißt mit Hilfe der Wahrnehmung Ereignisse oder Geschehen erfassen
- Selbstbeobachtung heißt ich kann etwas, das in mir geschieht, mit Hilfe nach innen gerichteter Wahrnehmung (innere Wahrnehmung)beobachten.
- vorstellen heißt im Gedächtnis gespeicherte Wahrnehmungen, genauer Wahrnehmungserinnerungen, abrufen und im Bewusstsein darstellen, was vorstellen genannt wird.
- vorstellungsfähig heißt ich verfüge über die Fähigkeit im Gedächtnis gespeicherte Wahrnehmungen, genauer Wahrnehmungserinnerungen, abrufen und im Bewusstsein darstellen.
- Ziffern 1, 2, 3, 4, 5.
- Habe ich daran gedacht, Begriffsverschiebebahnhöfe zu vermeiden? Ja
- Habe ich auf Containerbegriffe/Begriffscontainer geachtet? Ja.
- Habe ich Grundbegriffe, die sich nicht definieren lassen, wie z.B. innere Wahrnehmung, klar ausgewiesen? Ja, hier verlinkt zum Grundbegriff innere Wahrnehmung.
- Beweisidee: Wie könnte der Beweis gehen? Zeigen, dass ich eine Vorstellung beobachten kann.
- Beweisskizze: Skizze des Beweisweges. Vorstellungsobjekte auswählen, hier die Zifferen 1, 2, 3, 4 , 5, vorstellen und feststellen, ob das, was vorgestellt wird, von mir beobachtet werden kann, nehme ich innerlich wahr, was ich vorstelle?
- Beweisvoraussetzungen:
- Setze ich voraus, dass jemand sein Erleben erzählen, beschreiben kann? Ja
- Setze ich voraus, dass jemand sein Erleben wie es sich ereignet hat erzählt oder beschreibt? Ja
- Für welche Bedingungen soll der Beweis gelten? Dass die Versuchsperson vorstellungsfähig ist und wahrheitsmäß berichtet, was sie tut und was in ihr geschieht.
- Sind Normalbedingungen - und was heißt das hier genau - vorausgesetzt? Die Versuchsperson ist gesund, wach, mitwirkungsbereit und es gibt in der Umgebung der Versuchssituation keine Störungen.
- Beweismittel, gewöhnlich Regeln R1, R2, ... Ri .... Rn
- R1: Anweisung verstehen
- R2: Anweisung befolgen
- R3: Vorgehen berichten können
- R4: Innere Versuchsvorgänge nachvollziehbar berichten können.
- R5: Bericht über innere Vorgänge ist glaubhaft.
- Hilfssätze: auf welche schon bewiesenen Sätze kann ich mich stützen? Es gibt Erleben durch innere Wahrnehmung.
- Beweisschritte 1, 2, 3, ...i ... n
- Schritt 1: Versuch erläutern: was genau soll gemacht werden?
- Schritt 2: Die Vorstellungsfähigkeit muss gegeben sein wird aber in Schritt 3 geprüft.
- Schritt 3: Durchführung: bei geschlossenen Augen vorstellen der Ziffern 1, 2, 3, 4 , 5
- Schritt 4: Konnte ich bei geschlossenen Augen innerlich wahrnehmen, wie die Zifferen 1, 2, 3, 4 , 5 in meinem Bewusstsein aufgetaucht sind?
- Schritt 5: Konnte ich die Ziffern 1, 2, 3, 4 , 5, die in meinem Bewusstsein aufgetaucht sind, in meiner Vorstellung anschauen?
- Wie gelange ich von 1 nach 2, von 2 nach 3, ... bis zur Behauptung, zum Beweisziel? Die Schtitte der Reihe nach durchführen. Falls Schritt 5 glaubhaft durchgeführt werden konnte, ist die Behauptung bewiesen, weil eine Vorstellung anschauen einer Beobachtung gleichgestellt werden kann.
- Welche Lücken gibt es, die ich mit welchen ausgewiesenen Annahmen überbrücken muss? Aktuell keine aufgefallen.
- Prüfen
- Was kann ich gegen mein Beweisen einwenden? Der Beweis ist von der Glaubhaftigkeit und Richtigkeit meiner Angaben abhängig.
- Wo vermute ich Schwächen? Möglicherweise beim Selbstbeobachtungsbegriff und der Gleichsetzung innerlich anschauen mit Beobachtung.
- Wie ist mein Beweisgefühl? Ganz gut, aber noch nicht 100%, nicht volkkommen rund.
- An welchen Stellen spüre ich Unbehagen? > Schwächen.
- Andere Meinungen einholen.
Allgemeine Versuchsanleitung Ende April
2023
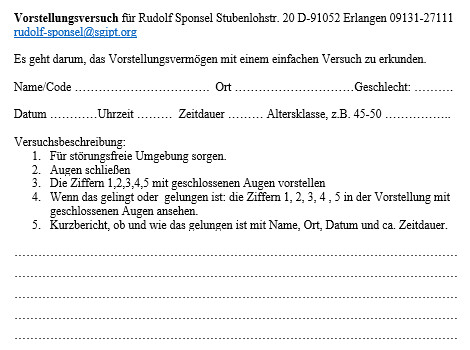
_
Sich an diesen Beweis anknüpfende Überlegungen
(1) Sind die Wahrnehmung äußerer Wahrnehmungsquellen,
nicht auch ein Beweis für die Selbstbeobachtung? Denn ich nehme ja
äußere Wahrnehmungsquellen auch nicht direkt wahr, auch wenn
es uns meist so vorkommt, sondern über das Gehiorn und die innere
Wahrnehmung in meinem Bewusstsein.
(2) Ist Selbstbeobachtung bei jeder
Vorstellung möglich? Wie könnte eine entsprechende Behauptung
bewiesen werden?
Da es potentiell unendlich viele Vorstellungen gibt, kann man nicht
jede prüfen. Doch muss man das? Reicht nicht schon die Definition
einer Vorstellung?
- Brainstorming: Wie könnte
ein Beweis gehen?
Vorstellen ist definiert als mit innerer Wahrnehmung im Bewusstsein anschauen
Wie, wenn man voraussetzt, dass jede Vorstellung mit inneren Wahrnehmung angeschaut werden kann, was mit Selbstbeobachtung gleichzusetzen ist?
| wird bei Gelegenheit fortgesetzt (27.04.23) |
Beweis, dass die Wahrnehmung äußerer Wahrnehmungsquellen über die innere Wahrnehmung erfolgt
oder Es gibt keine direkte und unmittelbare äußere Wahrnehmung
Ob und wie solch ein Beweis möglich ist, sollen die folgenden Ausführungen
auch mit Hilfe der Checkliste beweisen
klären helfen.
Vielfach wird ungenau und eigentlich falsch von
äußerer Wahrnehmung gesprochen, wenn tatsächlich die Wahrnehmung
äußerer Wahrnehmungsquellen
gemeint ist. Das ist
ein wichtiger Unterschied. Richtig ist, dass die meisten Menschen fälschlich
formulieren, wenn sie von äußeren Wahrnehmungen sprechen, wenn
sie etwa einen Baum sehen oder ein Auto vorbeifahren hören.
Tatsächlich haben sie die Wahrnehmung einer äußeren Wahrnehmungsquelle.
Wahrnehmungen sind Verarbeitungen von Signalen, äußeren oder
inneren. In jedem Fall werden sowohl die äußeren als auch die
inneren Signale innerlich verarbeitet.
- Behauptung: Welchen Beweisfall möchte ich beweisen, was ist meine Behauptung, was ist mein Beweisziel? Wahrnehmungen äußerer Wahrnehmungsquellen werden über die innere Wahrnehmung wahrgenommen, eine direkte, unmittelbare Wahrnehmung äußerer Wahrnehmungsquellen gibt es nicht.
- Welche Begriffe kommen in meiner Behauptung vor? Wahrnehmung, innere Wahrnehmung, Wahrnehmungsquelle, äußere, direkt, unmittelbar, gibt es nicht.
- Sind die Begriffe in meiner Behauptung allesamt klar, definiert oder hinreichend klar beschrieben mit Beispielen und Gegenbeispielen? Nein. Etwas wahrnehmen, ist sehr allgemein, so sehr allgemein, dass damit fast nichts ausgesagt wird. Man könnte daher auch gar nicht sagen, ob der Satz wahr oder falsch ist, so lange man das "etwas" nicht kennt. Etwas wahrnehmen kann man nicht wahrnehmen, greifen oder anfassen, es ist also mindestens ein allgemeiner Begriff besser noch ein abstrakt-allgemeiner Begriff. Damit stellt sich die Frage, ob und wie Beweise über oder mit allgemein-abstrakten Begriffen gehen?
- Habe ich daran gedacht, Begriffsverschiebebahnhöfe zu vermeiden? Ja.
- Habe ich auf Containerbegriffe/Begriffscontainer geachtet? Ja. Und dass wahrnehmen vieles bedeuten kann, weil man vieles wahrnehmen kann, so dass sich hier die Frage stellt, ob Sätze über oder mit Containerbegriffen/Begriffscontainern überhaupt bewiesen werden können, weil eine Grundregel des Beweisens klare Begriffe verlangt und ein Containerbegriff/ Begriffscontainer eben gerade nicht klar ist.
| Abbruch Beweisversuch 27.04.2023. Spätestens an dieser Stelle ist mir klar geworden, dass für diesen Beweis viel mehr zu klären ist als mir eingangs am 26.04.2023 klar war. |
Habe ich Grundbegriffe, die sich nicht definieren lassen, wie z.B. innere Wahrnehmung, klar ausgewiesen?
- Beweisidee: Wie könnte der Beweis gehen?
- Beweisskizze: Skizze des Beweisweges.
- Beweisvoraussetzungen:
- Setze ich voraus, dass jemand sein Erleben erzählen, beschreiben kann?
- Setze ich voraus, dass jemand sein Erleben wie es sich ereignet hat erzählt oder beschreibt?
- Für welche Bedingungen soll der Beweis gelten?
- Sind Normalbedingungen - und was heißt das genau - vorausgesetzt?
- Beweismittel, gewöhnlich Regeln R1, R2, ... Ri .... Rn
- Hilfssätze: auf welche schon bewiesenen Sätze kann ich mich stützen?
- Beweisschritte 1, 2, 3, ...i ... n
- Wie gelange ich von 1 nach 2, von 2 nach 3, ... bis zur Behauptung, zum Beweisziel?
- Welche Lücken gibt es, die ich mit welchen ausgewiesenen Annahmen überbrücken muss?
- Prüfen
- Was kann ich gegen mein Beweisen einwenden?
- Wo vermute ich Schwächen?
- Wie ist mein Beweisgefühl?
- An welchen Stellen spüre ich Unbehagen?
Beweis, dass Begriffe nicht zwingend einen Namen brauchen: wiedererkennen genügt.
Im Zuge der Auseinandersetzung mit Moritz Schlicks Thesen zum Erleben, Kennen, Erkennen, Erkenntnis, seiner und anderen Begriffslehren ist mir noch einmal sehr klar geworden, dass die sprachlich und rationalistisch fixierte Begriffslehre, die auf Namen für Begriffe fixiert ist, nicht angemessen ist. Definiert man Begriff als etwas Unterscheidbares, dessen charakteristische Merkmale wiedererkannt und referenziert werden können, dann sind sämtliche nichtsprachlichen Begriffsbildungen (Bilder, Geräusche, Klänge, Töne, Musik, Düfte und Gerüche, Berührungen, ...) miterfasst.
Beweisidee: Man muss zeigen, dass Menschen Sachverhalte, die noch keine Namen haben, wiedererkannt werden können.
Beweis zum Wiedererkennen
von Sachverhalten noch ohne Namen
Materialien
und Dokumente (Auswahl) zum Beweisthema in der Geschichte der Psychologie
und zu den in den Literatur genannten Beweisen (Beweisregister)
Aufgrund des abzusehenden Umfanges in eine eigene Seite ausgelagert.
Methodik
der Beweisthemasuche in Texten
Literatur (Auswahl) im Text.
- Schneider, Klaus & Dittrich, Winand (1990). Evolution und Funktion von Emotionen. In (41-114) Scherer, Klaus R. (1990, Hrsg.) Enzyklopädie der Psychologie C, IV, 3 Psychologie der Emotion. 1. A. Göttingen: Hogrefe.
Links (Auswahl: beachte)
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
aktive-Dimensionen-des-Erlebens
Aktiv heißt in diesem Zusammenhang, dass die Dimension empfangsbereit, aufnahmefähig, eingeschaltet ist. Hören ist z.B. aktiv, wenn Geräusche wahrgenommen werden können. Die Dimensionen sind eingeteilt nach äußeren Wahrnehmungsquellen, inneren Wahrnehmungsquellen und inneren psychischen Wahrnehmungsquellen. Ist Hören aktiv, dann höre ich etwas. Ist sehen aktiv, dann sehe ich etwas. Ist vorstellen aktiv, dann stelle ich mir etwas vor. Ist denken aktiv, dann denke ich etwas. Ist ein Motiv aktiv, dann merke ich es, ...
__
Besonderes Erleben, besondere Erlebnisse ("event")
Zum Beispiel positive oder negative Überraschungen, Besuche, Veranstaltungen, ausgehen, Ausflüge, Reisen, Erfolge, Misserfolge, ausgeprägte Gefühle.
__
Beweisglossar
- Ableitung
- Allgemeines Beweisschema
- Annahmen
- Augenscheinbeweis
- Aussage
- Axiome
- begründet, Begründung
- Behauptung
- belegt
- Beweis
- Beweislücke > Lücke
- Beweismittel.
- Beweispflicht: wer behauptet muss beweisen.
- Direkter Beweis
- Existenzbeweis
- Feststellungsbeweis
- Folgerung
- Hilfssatz
- Indirekter Beweis.
- Indiz: Definition: Ein Indiz ist ein Sachverhalt S1, der mehr oder minder für oder gegen das Vorliegen eines anderen Sachverhalts S2 spricht.
- Induktionsbeweis
- Lücke > Beweislücke
- Urkundenbeweis
- Vollständige Induktion (Beweisverfahren in der Mathematik)
- Voraussetzung(en)
- Zeugenbeweis.
Bewusstsein
Bewusstsein ist der Ort, wo sich das Erleben abspielt. Bewusstsein kann man analog / metaphorisch als einen Projektionsraum, eine Bühne, einen Film oder als einen Behälter ansehen.
__
EEG Elektroenzephalogramm.
Mit Hilfe des EEGa \g kann man über die Gehirnstrommessung unterschiedliche Bewusstseinszustände durch die verschiedenen Wellenmuster erfassen (>Wikipedia-Funktionsphasen):
- Alpha: entspannte Wachheit
- Beta: mehrdeutig.
- Delta: niedrige Frequenz, typisch den traumlosen Tiefschlaf (NREM)
- Gamma: Ausdruck intensiver geistiger Arbeit
- Sharp-Waves: z.B. bei Epilepsie
- Theta: Schläfrigkeit.
Lebenssituationen
Es gibt Lebenssituationen, in denen der Bewusstseinszustand unklar sein kann (alphabetisch geordnet):
- Anästhesie
- Anfälle
- Belastung
- Betäubung
- Bewusstseinsstörungen
- Bewusstseinsverlust
- Dämmerzustand
- Depersonalisation
- Derealisation
- Desorientierung
- Dösen
- Einbildung
- Einnicken
- Einschlafen
- Entfremdungsgefühl
- Erwachen
- Erwachen aus der Narkose, ...
- Extremsituationen
- Geistesabwesenheit
- Halbschlaf
- Halluzination
- Illusion
- Irritation
- Koma
- Krisensituation,
- Meditieren
- Nahtoderfahrung
- Phantasieren
- Psychische Erkrankung
- Schlaf
- Schlafentzug
- Schlafwandeln
- Sekundenschlaf
- Schock
- Stress
- Tagträumen,
- Trance
- Träumen
- Trauma
- Selbstentfremdung
- Übermüdung
- Unsicherheit (allgemeine)
- Unsicherheit bei der Orientierung
- Wachsein-Frage
- Wahn.
- Wahrnehmungsunsicherheiten: war da was? Was war da?
- Wahrnehmungsstörung (z.B. drogenbedingt)
- Wirklichkeitsfrage: ist das so?, ist das jetzt wirklich geschehen?
mittelbar
indirekt, über Zwischenglieder, über andere(s). [Duden]
__
schon Erlebtes
Streng bedeutet déjà-vu, dass man das Gefühl hat, etwas schon einmal gesehen zu haben, obwohl es nicht sein kann. Es handelt sich um eine Erinnerungs-Illusion. Peters (1984) unterscheidet in seinem Wörterbuch der Psychiatrie und medizinischen Psychologie, S. 109f, eine ganze Reihe ähnlicher Phänomene:
- "Déjà-entendu-Erlebnis (n). »Schon gehört, wahrgenommen«. Phänomen falscher Bekanntheitsqualität, das einem Erlebnis anhaften kann. Das Individuum erlebt »eine akustische Wahrnehmung, als wenn sie diese schon einmal gehört hätte. ...
- Déjà-éprouvé-Erlebnis (n). »Schon erfahren«. Gefühl, eine Handlung schon einmal unternommen, ein Erlebnis schon einmal erlebt zu haben. ...
- Déjà-pensé-Erlebnis (n). »Schon gedacht«. Gefühl, denselben Gedanken schon einmal in gleicher Form gedacht zu haben. ...
- Déjà-raconté-Erlebnis (n). (S. FREUD), »Schon erzählt.« In Analogie zu den »déjà-vu«-Erlebnissen benanntes Phänomen in der Psychoanalyse, wenn ein Kranker überzeugt ist, seinem Analytiker etwas schon erzählt zu haben, es aus einem Widerstand heraus aber nicht getan hat. Die Absicht wird in der Erinnerung für den Akt des Erzählens genommen. ...
- Déjà-vécu-Erlebnis (n). »Schon erlebt.« Gefühl, die gleiche Situation schon einmal durchlebt zu haben. ...
- Déjà-vu-Erlebnis (Phänomen) (n). »Schon gesehen«. Gefühl, etwas schon einmal gesehen zu haben, obwohl man sich z.B. in einer noch nie besuchten Stadt befindet. - Das bekannteste der Erlebnisse falscher Bekanntheitsqualität (fausse reconnaiscance). Die Bez. wird deshalb auch für gleiche Erlebnisse auf anderen Sinnesgebieten oder in anderen Vorstellungsbereichen verwandt. Charakteristisch ist das Bekanntheitsgefühl einer Situation und ihr urteilsmäßiges Verwerfen im gleichen Erlebnis. Wahrscheinlich schon im Altertum bekannt. Von AUGUSTIN unter der Bezeichnung »falsae memoriae« behandelt. Das Phänomen diente vielfach zu Ausdeutungen i. S. der Wiedergeburt. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts in psychologischer und belletristischer Literatur erwähnt. In die psychiatrische Literatur von JENSEN (1868) als »Doppelwahrnehmungen« eingeführt. Wurde zunächst als ungleichmäßiges Funktionieren der beiden Gehirnhälften erklärt. S. FREUD sah darin Assoziationen zu unbewußten Erlebniskomplexen.
Tritt auf im Traum, bei Erschöpfung, toxischen Zuständen, im Beginn von Psychosen, als Symptom der Psychasthenie, in der epileptischen Aura, im Beginn einer [>110] Dämmerattacke. S. a. vorangehende Stichworte. ... Syn.: identifizierende Erinnerungstäuschungen (E. Kraepelin). Erinnerungstäuschungen (W. Sander), Bekanntheitstäuschung."
- "Déjà-vu: Wie es entsteht und welche Erklärungen es dafür gibt. Ein bestimmter Geruch, Satz oder Ort täuschen dir plötzlich vor, genau diese Situation schon erlebt zu haben: ein Déjà-vu. Doch ist das normal und was passiert dabei im Gehirn? Erfahre hier, wie sich Forscher:innen das Phänomen erklären. Im Video: So funktioniert das Gehirn." [galileo 4.10.2021 Abruf 28.03.2023]
- "Wie entsteht ein Déjà-vu-Erlebnis? ... Hier geht es aber um die Déjà-vu-Erfahrungen im engeren Sinn: Wenn man das Gefühl hat: "Das hab ich doch schon mal gesehen" – obwohl man weiß, dass das gar nicht sein kann. Man läuft durch eine Gegend und hat plötzlich das Gefühl: "Hier war ich doch schon mal?" [swr 8.7.2022 Abruf 28.03.2023]
Zeitschrift für Psychologie 1907. Geht aus der Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, 1890 gegründet, hervor und wird ausgewiesen als "I. Abteilung Zeitschrift für Psychologie".
__
Zeugenbeweis
Nach Bender, Röder & Nack (1981), S. 173, Rn388
- "Einführung
a) Zeugenbeweis ist ein Indizienbeweis
Der Zeugenbeweis ist nicht, wie die herrschende Meinung mißverständlich behauptet (BGHZ 63/245), ein unmittelbarer Beweis, auch dann nicht, wenn der Zeuge unmittelbar eine rechtsrelevantc Tatsache wahrgenommen und bekundet hat.
Wirklich unmittelbare Beweise können im Einzelfall einmal eine Urkunde sein (die den streitigen Kaufvertrag wiedergibt) oder ein Augenschein (wenn er ein gesetzliches Tatbestandsmerkmal zum Gegenstand hat).
Alle anderen Beweise sind Indizienbeweise. Insbesondere der (von der herrschen-den Lehre) als Musterbeispiel für einen direkten Beweis oft zitierte Augenzeuge ist in Wahrheit ein - besonders schwieriger - Indizienbeweis.
Indiztatsachcn sind:
- (1) Die Aussage als solche
(2) Alle tatsächlichen Anhaltspunkte dafür, daß sich der Zeuge nicht irrt: Aufmerksamkeit, Bcobachtungsposition, Lichtverhältnisse usw.
(3) Alle tatsächlichen Anhaltspunkte dafür, daß der Zeuge nicht lügt: Persönliche Glaubwürdigkeit, Motivlage, Aussagesituation, (Körpersprache), Aussagenanalyse usw.
- Indiz 553
- abhängiges 606, 668
- belastendes 568
- Beweiskraft 576, 656 ff.
- Beweiswert 566
- deliktstypisches 679
- entlastendes 568
- mehrere Indizien 596
Indizfamilic 610,668
Indizienbeweis 553 ff.
Indiztatsache 563
__
_
Standort: Beweisregister zu Erleben und Erlebnis.
*
Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben * Beweis und beweisen in de, Psychowissenschaften
Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse
Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse. * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Inhaltsverzeichnis site: www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Beweis und beweisen in der Psychologie, besonders zu Erleben und Erlebnis. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/BeweisRegister/BeweisePsy.htm
https://web.archive.org/web/20241004092321/https://www.sgipt.org/gipt/erleben/BeweisRegister/BeweisePsy.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert: irs 02.04.2023 Rechtschreibprüfung / irs 03.04.2023 und 04.04.2023 gelesen
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
08.01.25 Ergänzung Checkliste Beweise Formal sichere Methode der Kontrolle
24.07.24 Ergänzung Editorial: Neu auf dieser Seite ist, dass, dass es auch um den Einzelfallbeweis geht. Hierzu haben die PsychologInnen m.E. bislang nicht geforscht, aber die JuristInnen. Denn dort geht es immer Einzelfälle mit dem vereinfachten Paradigma: Sachverhalt wahr oder falsch? Hierzu lege ich erste Ideen für eine Wahrscheinlichkeitstheorie des Einzelfalles vor (in Arbeit). * Neu Ziffer 2 Zusammenfassung: Zwei Hauptklassen von Beweisen ...
23.07.24 Der psychologische Beweis: was heißt das eigentlich?
07.11.23 Zweiklassenbeweise: richtige und ungefähre. Ungefährbeweise ein Widerspruch in sich? * Das große Problem der Ausnahmen* Exhaustion.
31.10.23 Linkssammlung Zur Möglichkeit und Problematik empirischer Beweise ans Ende der Zusammenfassung genommen.
27.04.23 Abbruch Beweisversuch Beweis, dass die Wahrnehmung äußerer Wahrnehmungsquellen über die innere Wahrnehmung erfolgt oder Es gibt keine direkte und unmittelbare äußere Wahrnehmung.
26.04.23 Neue Themen: Exhaustion: Die Beurteilung von Ausnahmen und Abweichungen für den Beweis, Ungefährbeweise - ein Widerspruch in sich? * Weitere Beweise in der Psychologie. Selbstbeobachtungsbeweis zu Vorstellungen vollständig nach der Checkliste beweisen durchgeführt.
22.04.23 Exkurs bei erlebeng eingebaut: Persönlicher Beweis durch erlebenag, dass erlebeng mit erlebena einhergehen kann
04.04.23 irs fertig gelesen
03.04.23 irs angefangen zu lesen
02.04.23 irs Rechtschreibprüfung
01.04.23 Aufgrund des Umfang gesplittet in:
- Beweis und beweisen in der Psychologie, besonders zu Erleben und Erlebnis
- Beweisregister Psychologie: Chronologisch, nach AutorInnen, nach Sachbeschreibungen und Sachbegriffen.
10.03.23 Beginn Beweise zu den Unterscheidungen des Erlebens, Erleben0
00.03.23 Gelegentliche Bearbeitungen
00.02.23 Gelegentliche Bearbeitungen
00.01.23 Gelegentliche Bearbeitungen.
00.00.22 Eintragungen meiner Einfälle.
03.12.22 Angelegt.