(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=26.08.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 06.01.26
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Erlebnisregister_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Abteilung Allgemeine Psychologie, Bereich Erleben, und hier speziell zum Thema:
Erlebnisregister
Erlebnisprotokoll
Vorschläge zur Durchführung von Erlebens- und Erlebnisprotokollen
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
Haupt- und Verteilerseite Erlebnisregister * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse
Methode der Fundstellen-Textanalyse. * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Signierungssystem * Zusammenfassung Hauptseite * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhof »«
Inhalt:
Editorial.
Zusammenfassung Erlebnisprotokoll.
Rahmenbedingungen und Situationen
der Erlebniserkundung.
Erleben
Innere Wahrnehmung.
Aufwachprotokolle (sämtlich
gescheitert).
Chronologische Erlebensberichte EB (Beginn
05.11.2022 ... aktuell=letzter verlinkter):
- EB01, EB02, EB03, EB04, EB05, EB06, EB07, EB08, EB09, EB10.
- EB11, EB12, EB13, EB14, EB15, EB16, EB17, EB18, EB19, EB20.
- EB21, EB22, EB23, EB24, EB25, EB26, EB27, EB28, EB29, EB30.
- EB31, EB32, EB33, EB34, EB35, EB36, EB37, EB38, EB39, EB40.
- EB41, EB42, EB43, EB44, EB45, EB46, EB47, EB48, EB49, EB50.
- EB51, EB52, EB53, EB54, EB55, EB56, EB57, EB58, EB59, EB60.
- EB61, EB62, EB63, EB64, EB65, EB66, EB67, EB68, EB69, EB70.
- EB71, EB72, EB73, EB74, EB75, EB76, EB77, EB78, EB79, EB80.
- EB81, EB82, EB83, EB84, EB85, EB86, EB87, EB88, EB89, EB90.
- EB91, EB92, EB93, EB94, EB95, EB96, EB97, EB98, EB99, EB100.
- EB101, EB102, EB103, EB104, EB105, EB106, EB107, EB108, EB109, EB110.
- EB111, EB112, EB113, EB114, EB115, EB116, EB117, EB118, EB119, EB120.
- EB121, EB122, EB123, EB124, EB125, EB126, EB127, EB128, EB129, EB130.
- EB131, EB132, EB133, EB134, EB135, EB136, EB137, EB138, EB139, EB140.
- EB141, EB142, EB143, EB144, EB145, EB146, EB147, EB148, EB149, EB150.
Lebens-Schnitte (Beginn 09.06.2024):
- LS01, LS02, LS03, LS04, LS05, LS06, LS07, LS08, LS09, LS10,
Dimensionen des Erlebens.
Beispiele: Auf der Hauptseite wurden einige Dimensionsanalysen durchgeführt:
- Sonnenuntergang auf dem Mars.
- Im Schlossgarten in die Sonne blinzeln Interpretation als 8-dimensionales Erlebnis.
- Wetterprüfung Interpretation als 10 dimensionale Anwendung.
- Ein Schluck Tee beim Wandern auf dem Staffelberg 13 Anwendungen.
- Achtsames Gehen.
- Mittagsspaziergang durch den Erlanger Schlossgarten.
- Ausscheidungserlebnisse.
- Nachdenken als Erlebnis.
Beziehungsfragen zum Erleben.
Vermischung, Neben und Durcheinander von erlebena und erlebeng
Relation erleben, kennen und erkennen.
ChatGPT: Was weißt Du über Erlebnisprotokolle?
Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen
Editorial
Für die Erlebens- und Erlebnisforschung sind Protokolle sehr wichtig. Ein einheitliches Format, wie es in der Zusammenfassung vorgeschlagen wird, kann - speziell für die Vergleichbarkeit der Erlebnisprotokolle verschiedener Personen - sehr hilfreich sein, wobei man wichtigere Ergänzungen der Rahmenbedingungen und Situationen berücksichtigen sollte. Ich habe mit meinen eigenen Erlebnisprotokollen am 05.11.2022 begonnen und führe sie seitdem unregelmäßig fort.
Zusammenfassung Erlebnisprotokoll
Zu einem Erlebnisprotokoll gehören: 1. Erlebender, 2. Datum, 3. Wochentag, 4. Uhrzeit ca. Anfang, 5. Uhrzeit ca. Ende des Erlebens, 6. Datum der Aufzeichnung, 7. Wochentag der Aufzeichnung, 8. Uhrzeit ca. Anfang, 9. ca. Ende der Aufzeichnung, 10. Themen und Erlebnisinhalte. 11. Nacharbeit (Interpretation, Kommentar), 12. Sonstiges (z.B. Begrifferklärungen, Querverweise, Literatur).
Rahmenbedingungen und Situationen
der Erlebniserkundung
Nachdem es potentiell unendliche viele Erlebnisse oder Erlebnisobjekte
gibt, ist es wichtig, das betrachtete - sei es vorgefunden oder hergestellt
- genauer zu beschreiben. Will man z.B. das Erleben der Farbe blau erkunden,
so sollte einigermaßen genau angegeben werden, in welcher Weise die
Farbe blau dargeboten wird, am besten durch ein Bild.
Erlebniserkundungen können unter ganz verschiedenen
Bedingungen oder Situationen erfolgen. Es kann daher wichtig sein, Bedingungen
und Situationen näher zu beschreiben.
- Datum, Uhrzeit Erkundungsbeginn - Erkundungsende
- wach
- klar
- Aufmerksamkeit
- Körperstellung (sitzen, liegen, stehen, gehen, ...)
- spüren, Körperempfindungen
- sehen (Augen auf, Augen zu?)
- hören (Radio, Fernsehen, Musik, Nachbargeräusche, Straßengeräusche, Wind, Donner, Fluglärm, ...)
- riechen (riecht es nach etwas?)
- schmecken (habe ich einen Geschmack im Mund?)
- fühlen
- Stimmung
- Befinden / Verfassung
- Licht (Licht an, Licht aus, hell, dunkel, ...)
- Motivation
- Zweck des Erkundungsversuchs (Neugier, Interesse, tue ... einen Gefallen, ...)
Erleben heißt die Grund- und Zentralfunktion des Bewusstseins.
Erlebt wird durch die innere Wahrnehmung von Bewusstseinsinhalten.
Querverweise: Definition bewusstes Erleben, Definition bewusstes Erlebnis, 14 Unterscheidungen erleben, Erlebnis.
Innere Wahrnehmung
Seit Wundt kann man die innere Wahrnehmung als die Grundlage
der Psychologie betrachten. Durch die innere Wahrnehmung erhalten
wir Zugang zu unserem Erleben und zu unseren Erlebnissen. Innere Wahrnehmung
lässt sich als Grundbegriff der Psychologie nicht definieren, es sei
denn man weicht auf Begriffsverschiebebahnhöfe
aus, was natürlich keine Alternative ist. Man muss sich also mit Beschreibungen,
Beispielen und Gegenbeispielen begnügen, was aber auch für hinreichende
Klarheit reicht.
Beispiele und Gegenbeispiele für innere Wahrnehmung
| Beispiele für innere Wahrnehmung (+)
man kommuniziert - mit sich oder anderen - was in einem stattfand. |
Gegenbeispiele für innere Wahrnehmung (-)
Man kommuniziert über Sachverhalte unabhängig vom eigenen Erleben. |
| 01+ Ich schaue in den blauen Himmel.
02+ Ich sehe dort ein Buch. 03+ Ich erinnere, mein Schreibtisch ist voll. 04+ Ich fühle mich gut. 05+ Vielleicht guck ich mir heute Abend den Film an 06+ Ich weiß, dass die Natur keine Farben kennt 07+ Ich überlege, wie Farben entstehen und wie es zur Wahrnehmung von Farben kommt 08+ Ich überlege, die Natur kennt keine Farben. 09+ Ich frage mich, woher das Sprichwort kommt. 10+ Ich frage mich, ob das Sprichwort, von nichts kommt nichts, ein volkstümliches Kausalitäts- prinzip ausdrückt? 11+ Mir geht gerade durch den Kopf, dass Carnap den logischen Aufbau 1928 veröffentlicht hat 12+ Ich las gestern, die Energiepreise sinken. 13+ Könnte ich 2x2=4 beweisen? 14+ Was könnte mir jetzt schmecken? 15+ Der Stein ist zu schwer für meine Kräfte. |
01- Der Himmel ist blau.
02- Auf der Anrichte steht ein Buch. 03- Der Schreibtisch ist voll. 04- Fühlen können ist wichtig fürs Leben. 05- Blau ist eine Farbe. 06- Heute Abend läuft der Film. 07- Farben entstehen durch Lichtreflexion und einem geeigneten erkennenden System (Auge, Gehirn) 08- Die Natur kennt keine Farben, nur Wellenlängen 09- Alle guten Dinge sind drei 10- Von nichts kommt nichts. _ _ 11- Rudolf Carnap hat Der logische Aufbau der Welt 1926 in seiner Habilschrift verfasst 12- Die Energiepreise sind wieder gefallen. 13- 2x2 = 4. 14- Es geht nichts über ein gutes Getränk. 15- Der Stein wiegt bestimmt 2 Zentner |
Übersicht Erlebensprotokolle [Quelle 5.6 Protokolle und Berichte]
Frühstück * Tasse Kaffee mit Genuss * aufgestanden. Guter Dinge * Einarbeitung von Schlicks "kennen" und wiederkennen * Kieser Training fertig * Nach dem Erwachen - Bewusstseinserleben * Erlebeng * Experience.
Die meisten anfangs erfassten Protokolle haben noch nicht das in der Zusammenfassung vorgeschlagene vollständige Format, woran man auch die Entwicklung sehen kann. Zur realen Erforschung des Erlebens ist es wichtig und hilfreich, Erleben zu protokollieren. Im Folgenden einige Beispiele (chronologisch absteigend geordnet).
Anfang der Protokolle und Berichte während und zu dieser Arbeit Die Erforschung des Erlebens
EB01-05.11.2022 ca. 09:30 bis 10:06. Am Sa. den 05.11.2022
bin ich um 8:56 wach geworden. Ich habe mein Wachsein
nicht erlebt. Ich war einfach wach. Nachdem ich meine Hauskleidung angezogen
hatte, fragte ich mich, wie es mir geht. Ich hielt inne und versuchte mein
Befinden in Worte zu fassen: Befinden in Ordnung, keine Beschwerden, ausgeglichene
Stimmung, tendenziell positiv, weil die Arbeit am Erleben vorangeht. Es
fiel mir noch ein, dass ich zum Erleben in einer Arbeit über Bewusstsein
vor Jahren, eine interessante Graphik erstellt habe, die ich auch auf dieser
Seite präsentieren wollte. So habe ich mich im Ordner gipt/allpsy/bewu
auf die Suche gemacht. Zunächst bin ich auf die Seite Introspektion
gestoßen, die aber noch in Arbeit und nicht abgeschlossen ist, wenn
auch schon weit gediehen. Ich habe die Graphik dann in dem Ordner auf der
Seite Psychologie
des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit unter der Überschrift
Warum
und wie geschieht gelenkte Bewußtseinstätigkeit?
gefunden:
- "Für die meisten Erlebenden geschieht ihr Bewußteinserleben
quasi wie von selbst. Die wenigsten erleben sich als bewußtseins-lenkend.
Das hat wohl auch damit zu tun, daß man im Erleben
sein Lenken schlecht mitbekommt, weil man sozusagen drinnen ist. Ja, man
kann sogar sagen, daß eine bewußte Lenkung, so lange man sich
im Bewußtseinsstrom befindet und erlebt, nicht oder nur eingeschränkt
möglich ist. Dies wirft die spannende Frage auf, ob nicht-bewußte
("unbewußte") Lenkungsprozesse angenommen werden sollen oder gar
müssen. Lenken bedeutet zwingend das Einnehmen einer Meta-Perspektive.
Und das bedeutet, ich trete aus dem Bewußtseinsgeschehen heraus und
betrachte es aus anderer Perspektive. Dies äußert sich z.B.
auch in der Erfahrung, daß Gefühle sich leicht verflüchtigen
können
(auch
das Gegenteil ist möglich bei Mißempfindungen oder Angst), sobald
man die Aufmerksamkeit auf sie richtet, daß also die Beobachtung
das Beobachtungsobjekt verändert.
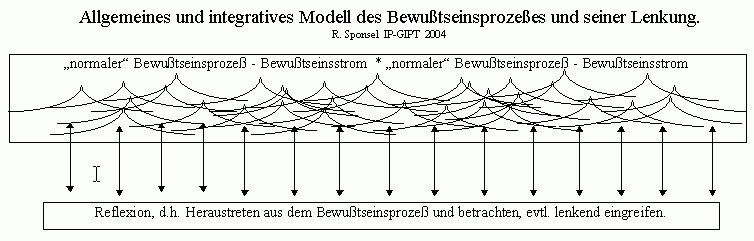
Dieses Modell hat eine Entsprechung und ein Vorbild im Modell des Sehens, das eine ständige Bewegung der Augen erfordert, die der Mensch gewöhnlich aber nicht bemerkt. Ähnlich kann man sagen, Bewußtheit kommt durch eine ständige Bewegung, einem Wechsel zwischen Erleben und Reflexion des Erlebens, einem ununterbrochenen Hin und Her zwischen diesen beiden Ebenen zustande."
Dabei wurde mir wieder einmal klarer, wie eng die beiden Themen
Bewusstsein und Erleben miteinander zusammen hängen. Nun ja, das Erleben,
zumindest das bewusste, findet im Bewusstsein statt. Und die zentrale Hauptfunktion
des Bewusstseins habe ich dem Erleben zugewiesen.
Jetzt, wo ich vor dem Computer sitze und diese Zeilen,
das erste Erlebensprotokoll von heute geschrieben habe, erlebe ich mich
voll im Thema. Ich versuche mich zu organisieren, wie ich weiter mache.
Neben dem Generalthema erleben bin ich auch noch mit der
Frage beschäftigt, wie man abstrakte und allgemeine Begriffe voneinander
unterscheiden kann. Dazu habe ich auf der Seite Sachverhalts-
und Begriffsanalyse konkret, allgemein, abstrakt Kriterienfragen
entwickelt und an bald 30 Beispielen erprobt. Aber mein Erleben sagt mir,
die Arbeit ist noch nicht "rund", ich bin noch nicht zufrieden. "Rund"
steht hier bei mir für ein Gefühl. Bei abgeschlossenen Arbeiten,
mit denen ich zufrieden bin, sollte sich ein Gefühl, das ich "rund"
nenne, einstellen.
- Ende Protokoll 221105-01 10:06 Uhr.
EB02-12.05.2023 11:40 Uhr. Ich wurde soeben mit Kieser Training fertig (eine knappe Stunde) und fühlte mich aktiviert, lebendig, vital. Ich war gut drauf und zufrieden mit der Durchführung.
EB03-12.05.2023 Später Abend. (1) Die Einarbeitung vonSchlicks "kennen" und wiederkennen für das Erleben, das nach ihm scharf zu unterscheiden von erkennen und wiedererkennen ist, erlebte ich mit Freude und Befriedigung als beachtlichen Fortschritt in meiner Erlebensforschung. Intellektuell fühlte sich das "rund" an (so ist es und so kann es bleiben). (2) Diese Freude und Befriedigung wurde unterstützt durch die Formulierung der Forschungsfrage wie aus kennen erkennen wird.
EB04-13.05.2023 Um 8:24 Uhr aufgestanden. Guter Dinge, weil es gestern Abend mit der wissenschaftlichen Psychologie des Erlebens gut vorwärts ging. Sicherheitshalber hatte ich auf einem Zettel noch notiert: "Beispiele für unverarbeitetes Erleben und wie aus kennen wiederkennen und erkennen wird; Sätze des Erlebens formulieren". Heute steht allerdings große Corona-Auswertung an, da ist eine Stunde fürs Erleben weg. Na ja, einmal in der Woche. Vielleicht schaffe ich es, bis Pfingsten mit den Grundzügen fertig zu werden.
EB05-13.05.2023 Gegen 9:30 erste frische und gut heisse Tasse Kaffee mit Genuss (schmeckt gut, angenehm), in ca. 25 Schlucken bei unterbrochener Arbeit an dieser Seite bewusst getrunken. (> Fragebogen F10)
EB06-13.05.2023 Gegen 10:00 gab es Frühstück, drei Töpfchen Linsensuppe mit Kartoffeln und Wiener Würstchen, der Rest vom traditionellen Freitagsessen. Es schmeckte wie gewöhnlich köstlich.
EB07-19.08.2023-7:05-7:55
Uhr Erlebeng
Aus dem Halbschlaf und Erwachensprozess heraus bemerkte ich, dass ich
mich anscheinend intensiv - vermutlich auch in der Nacht während des
Schlafes mit der Scorierung von Erlebensvorgängen beschäftigte:
0.25, 0.50 und sogar eine negative Scorierung in der Richtung -0.43. Ich
versuchte beim Bemerken nicht, die Gedanken loszuwerden, sondern begrüßte
sie im Grunde als Zeichen, dass im Nichtbewussten einige Klärungen
am Werke sind mit der Grundeinstellung, das wird schon seinen Sinn haben,
obwohl ich jetzt, wo ich es gegen 8:02 Uhr erfassend niederschreibe, nicht
mehr orten kann, worum es konkret geht. Der Sinn ist mir inzwischen verloren
gegangen. Gänzlich unverständlich ist mir diesem Zusammenhang
auch, dass ich meine Frau Irmgard mit dem Fahrrad zu einem Hangeingang
fahren "sah".
Die zweite Sache, die mich noch beschäftigte
war, ob ich meine Reise in die Forschungsgeschichte des Erlebens und der
Erlebnisse nicht auch ein wenig quantitativ auswerten sollte, etwa wie
oft ich fand, dass eine Definition oder Erklärung des Erlebens nicht
erfolgt, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis..
- Das erste und Teile des zweiten Kapitels wurden
gestern fertig, schneller als ich dachte, das war ein recht angenehmes
Gefühl und sehr zufriedenes Erleben. Bis zu meinem Geburtstag Ende
November dieses Jahres könnte das Buch fertig sein und zu meinem 80.
gedruckt vorliegen. 7:58 bis 8:10 Uhr.
EB08-26.08.2023, gegen 7 Uhr Aufwachphase: Experience.
Ständiges umeinander Geistern zum Erfassens von experience, werden
welche und wie viele werden gefunden. Es ist mir im Nachhinein nicht gelungen,
herauszufinden, warum mich das - wahrscheinlich - den Nachtschlaf über
und in der Aufwachphase so beschäftigt hat. Klar ist: es ging um die
Suche und Dokumentation nach experience in englischsprachigen Arbeiten.
Da hat in der letzten Woche am Rande zwar auch eine Rolle gespielt, aber
mir fällt kein konkreter Fall ein.
EB09-26.08.2023 Erlanger Poetenfest Friedrich Degenerierte
Vernunft, Sa 12.00-13.00 Margrafentheater, Foyer.
Die Veranstaltung begann mit einer beeindruckenden Vorstellung von
Persönlichkeit und Werk.
Der Autor las, eingeleitet und nachgefragt durch die Moderatorin, in
zwei Blöcken: Kapitel 2 Künstlich oder natürlich? und Kapitel
7 Degenerierte Vernunft aus seinem Buch. Bei den Begrifflichkeiten
natürlich und künstlich - exemplarisch Aroma, Blume, Schnee,
- zeigte der Autor interessante und teilweise paradoxe Entwicklungen auf,
wenn z.B. am Ende das Künstliche als das Natürliche erlebt wird.
Seine These KI wird niemals eine menschliche Intelligenz sein überzeugte
mich, angesichts seiner Intelligenzdefinition als die Fähigkeit, Probleme
zu lösen, gerade nicht. Denn genau das kann KI ziemlich gut. Vernunft
ist nach Friedrich mehr als Intelligenz, hier kommt Bedeutung, Sinn
und Wert hinzu. Ständiges Räsonieren und Selbstreflexion macht
den Menschen aus, wobei Friedrich - ein bißchen selbstwidersprüchlich
- nicht ausschließt, dass die Maschinen auch das lernen können.
Der Saal war voll, die Atmosphäre bis auf zwei
nervige Handystörungen, gut, die Kapitel klar und verständlich
vorgetragen. Ich erlebte die Veranstaltung als anregend und interessant,
auch wenn mich Friedrichs kritische Ausführungen nicht überzeugten.
Geschrieben 14.45-15.15 Uhr.
- Buch: Friedrich, Jörg Phil (2023) Degenerierte Vernunft. Künstliche
Intelligenz und die Natur des Denkens. München: claudius.
- Kapitel 1 Besser als Menschen?
Kapitel 2 Künstlich oder natürlich?
Kapitel 3 Intelligenz und Vernunft
Kapitel 4 Wie arbeitet Künstliche Intelligenz?
Kapitel 5 Der Turing-Test
Kapitel 6 Schwache und starke Künstliche Intelligenz
Kapitel 7 Degenerierte Vernunft
Kapitel 8 Die wilde Schönheit der natürlichen Vernunft
Kapitel 9 Ein Ausblick auf die starke Künstliche Intelligenz
Querverweis: KI - Künstliche Intelligenz. * ChatGPT in der IP-GIPT. *
EB10-27.08.2023 Erlanger Poetenfest Becker
& Dabrock Wie KI unsere Gesellschaft verändert,
So, Orangerie, 16:00 Uhr
Ein sehr wichtiges Thema, moderiert von Nana Brink, so dass der Andrang
auch sehr groß und der Saal viel zu klein war. Glücklicherweise
hörte der Regen gerade auf, so dass man auch vor der Orangerie sitzen
und teilnehmen konnte. Die Übertragung über die Lautsprecher
war sehr gut, klar und vernehmlich.
Jenifer Becker begann mit einem authentischen Anwendungsbeispiel.
An einem Vormittag schrieb sie mit ChatGPT einen ganzen Roman. Sie schilderte
eindrucksvoll die Möglichkeiten über sog. "Prompts" oder "Tools"
(Anweisungen für ChatGPT zur spezifischen Textgenerierung und
-modifizierung), z.B. Einbau von Konflikten, Einbau vom Humor, Stimmung,
u.a.m. Diese Möglichkeiten sind gewaltig und nach meiner Einschätzung
wird davon künftig vielfach Gebrauch gemacht werden. Es dürfte
in Zukunft wenig Literatur oder Sachtexte geben, die nicht durch ChatGPT
(oder analoge Programme) unterstützt wurden. Unterstützung von
Texten gab es zwar schon immer, aber die neue KI-unterstützten Möglichkeiten
übertreffen alles bisher Dagewesene vor allem durch die extreme Geschwindigkeit,
mit der die Texte erzeugt werden. Das ist mir zu wenig thematisiert worden.
Ich war auf eine kritische Darstellung und Auseinandersetzung voreingestellt
(Vorurteil, was mich erwartet) und von daher eher enttäuscht, auch
von Peter Dabrock, Sozialethiker und Theologe mit Schwerpunkt "Ethik technischer
und (bio) wissenschaftlicher Durchdringung menschlicher Lebensformen".
ChatGPT werden nicht alle gleich gut nutzen können (worin ich keinen
Nachteil sehe). Und es wird schwieriger, Wahrheit und Realität zu
erkennen, fake News erhalten enormen Auftrieb. Die Kennzeichnungsfrage
ist mir zu lasch behandelt worden. M.E. ist völlig klar, dass bei
Texten, die mit KI-Hilfen erzeugt wurden, angegeben werden muss, welche
Hilfen das waren. Auch die Grauzone Plagiat wurde angesprochen.
Insgesamt kam aber doch einiges Sprache, das uns
als Mensch, Produzent, Konsument und Gesellschaft alle angeht. So gesehen
eine wichtige und geglückte Veranstaltung.
Geschrieben nach der Veranstaltung am 28.08.2023,
ca. 9-9:30 Uhr. Hilfsmittel erleben1,
Notizen, Programmheft, Rechtschreibprüfung
Querverweis: KI
- Künstliche Intelligenz. * ChatGPT
in der IP-GIPT * EPF:
Degenerierte Vernunft *
EB11-Freitag, 03.11.2023, 12:37 [Quelle: Erlebensberichte
zur Arbeit an der Seite D_Fühlen]
Komme gerade vom Kiesertraining zurück und möchte dokumentieren,
was mir so durch den Kopf ging. Bin seit gestern am Thema Fühlen,
entschlossen es netzfähig abzuschließen. Es ist ein großes,
wichtiges aber auch sehr schwieriges Thema. Inzwischen sind zwei Def
fertig: Energie und Denken. Die nächsten sind fühlen, Motivfeld,
Wahrnehmen, dann wären ein halbes Dutzend und einige wichtige "fertig"
im Sinne von grundaufbereitet. Beim fühlen bin ich mir unsicher, ob
"ich fühle" überhaupt etwas sagt? Und falls: was? Sieht man es
analog zu "ich erlebe", dann bedeutet es, mein Gefühlsapparat ist
eingeschaltet, ich bin fühlfähig. Fühlen ist ein Containerbegriff/Begriffscontainer.
Ich fürchte, es wird keine genaue Definition geben. Die verschiedenen
Gefühle sind sehr schwierig abzugrenzen. Es könnte sein, dass
sich erstmals klar zeigt, dass beweisen im Ungefähren nötig ist.
Was besagen eigentlich die vielen Worte für Emotionen und Gefühle?
Nachdem man die Hirnregionen kennt, in denen fühlen erzeugt wird,
sollte ein Beweis, dass gefühlt wird, nicht so schwierig sein. Wohl
aber welches Gefühl, da nach Schachter und Singer einige Grunderregungsmuster
des Fühlens kognitiv unterschiedlich interpretiert werden können.
Man kann vielleicht den allgemeinen Satz aufstellen: wenn Erleben
erkannt wird, muss Denken dabei sein. Man muss vielleicht auch noch überlegen,
wozu scharfe Gefühlsbegriffsdefinitionen nötig sind. Was sind
die Folgen der Unschärfe? Die Grundregel besagt: Beweisen kann man
nur mit klaren Begriffen. Will man also für das Gefühlsleben
etwas beweisen, muss man für klare Begriffe sorgen. - Und jetzt gibt
es erst mal was zu essen! 12:49 Uhr, 12 Minuten.
EB12-20.11.2023 Versuch Wahrnehmungsquelle Körper
RS 20.11.2023, 14:20 Die Handflächen aneinander legen wie beim
Gebet, Finger zu Finger. Ich spüre die Handflächen aufeinander,
aber nicht die einzelnen sich berührenden Finger bis ich mich auf
die Finger nacheinander konzentriere. Daumen/Daumen; Zeigefinger/Zeigefinger;
Mittelfinger/Mittelfinger; Ringfinger/Ringfinger; Kleiner Finger/Kleiner
Finger.
IRS: 14:27. Wie RS.
EB13-20.11.2023, 17:32. Ich sitze an der Seite zum Fühlen und habe mich soeben gefragt, was ich fühle. Ich hielt inne und versuchte mein aktuellen Fühlen zu erfassen und fand nichts. Ich bin wach, am Thema interessiert, ein identifizierbares Gefühl stellt sich aktuell nicht ein. Ich hole mir die Liste mit den 301 Gefühlsworten und gehe sie durch.
- A-B nichts dabei 17:38.
- Bei G gesund, gewachsen, 17:40.
- I: Interesse 17:41
- K: klar 17:42
- R: ruhig 17:43
- S: sicher 17:43
- W: wach 17:44
_
EB14-Dienstag 05.12.2023, 09:01-09:21 Uhr [Quelle: Erlebensberichte zur Arbeit an der Seite D_Fühlen]
Ich habe die Seite noch einmal durchforstet und festgestellt, dass sich unter der Überschrift Elementare Prädikationen des Fühlens keine Bearbeitung findet. Vermutlich hat das auch etwas mit der merkwürdigen Definitionssituation zu tun, die ich herausgearbeitet habe. Die Arbeit an dieser Seite zieht sich nun sehr lange hin, ich hatte öfter das Gefühl ;-), sie wird und wird nicht fertig und es braucht und braucht. Ich habe den Aufwand für die Ausarbeitung dieser Seite ziemlich unterschätzt. Ich merke, dass ich "fertig" werden möchte, um endlich das zweite Kapitel des Buches fortzusetzen. Bedenke ich, dass ich 29 elementare Dimensionen des Erlebens erfasst habe, aber bislang nur drei Definitionsseiten - Denken, Energie und nun die Gefühle - erstellen konnte, wird mir klar, dass ich nicht mehr viele Beispielseiten durchführen kann, wenn ich weiter kommen will. Auf jeden Fall noch die Motivfeldseite, die ebenfalls sehr schwierig ist. Aus der Bearbeitung der Energieseite und den Fragebogenauswertungen hat sich ergeben, dass ich auch das Quellenproblem Körperlich oder psychisch noch einmal gründlich angehen muss. Hierzu habe ich schon eine Seite angelegt, aber in der Psychologie so gut wie kein praktisch brauchbares Material gefunden. Im Wesentlichen gibt es drei Wahrnehmungsquellen: Außenweltquellen, Körperquellen und psychische Quellen. Wie so oft hat der Mensch im Alltag keine Probleme, seine Wahrnehmungsquellen zu erkennen und zu benennen, aber wissenschaftlich sieht es nicht gut aus. Aufgehalten hat die Entwicklung des Gefühlsfragebogens mit Auswertungskonzeption und die Phänomenologie der Gefühle, die aber sehr wichtig war. Kurzum: ich möchte mit der Seite zum Fühlen und der Gefühle fertig werden, wobei ich natürlich weiß, dass nur der Rahmen und Schwerpunkte "fertig" werden. Gestern habe ich mich intensiv mit den Abgrenzungen und Unterscheidungen von 11 Begriffen beschäftigt. Von den 55 möglichen Vergleichen habe ich nur einen, Gefühl / Emotion mit Stimmung, nach einem entwickelten allgemeinen Vergleichsschema durchgeführt. Inzwischen muss ich eingestehen, dass ich das gesamte Projekt mit seinen Anforderungen und seinem Aufwand nicht richtig eingeschätzte habe, was vielleicht sogar gut war, weil ich mich sonst gar nicht ran getraut hätte. So, jetzt aber an die elementaren Prädikationen des Fühlens und der Gefühle! 9:21 Uhr.
EB15-Dienstag 05.12.2023, 18:11-18:16 Uhr, 5 Minuten.
[Quelle: Erlebensberichte
zur Arbeit an der Seite D_Fühlen]
Es sieht so aus, als wäre die Seite soeben "erst-fertig" geworden.
Ich mache diese Notiz, weil ich aktuell zu meiner Verwunderung nicht mehr
nachvollziehen kann, was ich heute morgen zum lange Hinziehen und dem Vielen,
Vielen, Allzuvielem geschrieben habe. Im Moment kommt es mir nicht mehr
so vor. Dieser Widerspruch scheint mir eine Erfassung wert. Als Nächstes
geht es an die elementare Dimension Motivfeldbegriffe. Das wird aller Voraussicht
nach noch schwieriger und aufwendiger. 18:16 Uhr.
EB16-12.2023, 10:13 Beginn der Arbeit 05.12.2023
- überraschend glänzender Start
Ich habe gestern, nachdem ich die Seite Definition des Fühlens
und der Gefühle bis auf die Rechtschreibprüfung im Wesentlichen
"erst-fertig" gestellt habe, diese Seite angelegt und konnte zu meiner
Überraschung sofort sehr gut in das in das Thema einsteigen. Allerdings
beschäftige ich mich mit dem Motivationsthema seit meinem Studium,
durch die Motivationsarbeiten von Walter Toman und durch die in
memoriams angeregt und gefördert; zuletzt hat meine Motivbegriffsfelduntersuchung
mit 20 Motivfeldbegriffen im August 2022, erstmals am 20.08.2023 ins Netz
gestellt, sehr viel vorbereitet. Das Konzept Motivfeldbegriff wurde in
dieser Untersuchung kreiert, aber noch nicht definiert. Daher wußte
ich nicht, ob es mir gelingen wird, hier einen überzeugenden Definitionsansatz
zu finden. Das gelang aber sehr überraschend bereits gestern zu Beginn
der Arbeit, was zu einer großen Erleichterung, Entlastung und Zuversicht
führte. 13.23 Uhr.
_
EB17-07.12.2023, 10:26.
Im Zuge der Arbeiten zu Definitionen einiger elementarer Dimensionen des
Erlebens, bislang Energie, Denken, Fühlen und Motivfeld habe ich Kriterien
entwickelt, die die elementaren Dimensionen des Erlebens zu unterscheiden
gestatten sollen. Dabei entwickelte sich gestern die Idee, dass ich
solche Kriterien für alle psychischen Sachverhalte suchen könnte.
Damit habe ich Neuland betreten, das ich heute bearbeiten möchte.
Gelingt es, wäre das ein enormer wissenschaftlicher Fortschritt. Diese
Idee beflügelt mich und stimmt mich sehr positiv. 10:32 Uhr.
EB18-08.12.2023, 09:13-09:34
Uhr, 21 Min. Gestern Abend ist mir noch einmal unter dem Eindruck die Kriterienanalyse
bei den elementaren Dimensionen intensiv die Frage gekommen: was genau
ist Erleben? Ich habe heute morgen daher einen Abschnitt
4.3
Was genau ist erleben? eingebaut. Insgesamt habe ich den Eindruck,
dass ich mit der Entwicklung der Kriterien für die elementaren Dimensionen
des Erlebens und dem Auswertungs- und Vergleichsschema einen großen
Schritt gemacht habe. Es lassen sich nach bislang 28 entwickelten Kriterien
alle bislang 27 elementaren Dimensionen des Erlebens vergleichen, insgesamt
27*28=756 Zellen. Sie sollten sich alle voneinander unterscheiden, d.h.
jede Ergebniszeile mit den 28 Signierungen der Kriterien sollte von allen
anderen verschieden sein. Als erstes habe ich I01a Antrieb und I02b Energie
durchsigniert und verglichen. Das Ergebnis gibt meiner ersten Zusammenfassung
von Antrieb und Energie recht. Sie sind gleich bis auf I11 und I14. Die
Definitions-Logik ist bislang die: Alle elementaren Dimensionen des Erlebens
müssen sämtliche Kriterien für das Erleben, die ich heute
entwickeln werde, erfüllen. Der Begriffscontainer Erleben ist der
Überbegriff für die elementaren Dimensionen des Erlebens. Sämtliche
Spezifikationen der elementaren Dimensionen müssen die Kriterien für
die elementare Dimension erfüllen. Z.B. gilt das für alle Gefühle
der elementaren Dimension I05 Fühlen. Mores habe ich vor Veränderungen
der Kriterien, weil ich für alle elementaren Dimensionen des Erlebens
einen Ordner und eine Seite mit 27 Zeilen für die elementaren
Dimensionen und 28 Spalten für die Kriterien angelegt habe. Jede Veränderung,
Herausnahme oder Hinzufügen eines Kriteriums, bedeutet 27 Tabellen
verändern. Ich sehe aber keinen anderen Weg. Um die Tauglichkeit der
Kriterien zu erkunden, muss ich sie bearbeitend anwenden. Nur dabei merke
ich, ob etwas fehlt oder zu viel ist. Das Projekt nimmt immer umfangreichere
Formen an. Angenehm war die Erfassung des mimischen Ausdrucks von I07-Denken.
09.34 Uhr.
_
EB19-09.12.2023 09:47-10:06,
19 Min. Nachdem ich gestern bis ca. 0:30 an den Kriterien gearbeitet habe,
bin ich heute um 8:37 aufgestanden und gleich wieder ran. Gestern ging
mir noch durch den Kopf, ob mir die Systematik klar und die Übersicht
noch da ist, wo ich bin der Arbeit stehe. Ausgangspunkt war die erste Definitionen
der elementaren Dimensionen des Erlebens und die Gretchenfrage: woher
weiß ich, was das gerade für ein Erleben ist, zu welchen elementaren
Dimensionen gehört es und wie kann ich die verschiedenen elementaren
Dimensionen des Erlebens - im Erleben, nicht nur theoretisch - unterscheiden?
Haben zwei Dim die gleichen Signierungen in allen 28 Kriterien, dann sollten
sie gleich sein. Das ist fast der Fall zwischen Antrieb und Energie, was
meine erste Zusammenfassung in I01 Antrieb und Energie bestätigte.
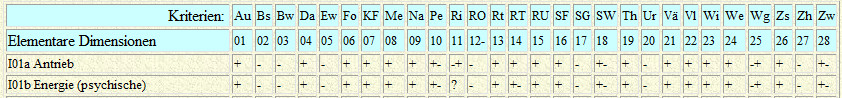
Aufgrund der Überlegung, dass Antrieb Energie benötigt und damit voraussetzt, habe ich den Definitionsansatz differenziert in I01a Antrieb und in I01b Energie. Obwohl ich nach wie vor denke, dass die Interpretation Antrieb setzt Energie voraus und sollte daher nicht gleich gesetzt werden, hat sich nach der Kriterienanalyse und dem Vergleich herausgestellt, dass sie aufgrund der fast gleichen Signierungen erlebensmäßig als fast gleich anzusehen sind. Wissenschaftlich geht es also darum, die Kriterien festzustellen, die für die elementaren Dimensionen des Erlebens zur Anwendung gelangen können. Ich fürchte den Organisationsaufwand bei Veränderungen und suche nach einer Lösung, wenn Veränderungen nötig sind, nicht immer wieder die Systematik der Kürzel und Unterscheidungen völlig neu zu erstellen. Bei den elementaren Dimensionen des Erlebens hänge ich neue Unterscheidungen einfach hinten an, so dass alle bisherigen Unterscheidungen bleiben können. Überschneidungen können ja vermerkt, erörtert und kommentiert werden. Zusammengefasst: Es geht um die Unterscheidungen der elementaren Dimensionen des Erlebens nach prüf-, kontrollier-, nachvollzieh- und kritisierbaren Kriterien. 10:06 Uhr.
EB20-12.12.2023 Standreflexion 07:40-08:11 Uhr, 31 Min. Wiederaufnahme der Ausarbeitung nach Arbeiten. Durchsicht des bisherigen Standes, kleine Klärungen. Im Wesentlichen wurden bislang drei Kriterien für Motivfeldbegriffe entwickelt und bei den 27 elementaren Dimensionen geprüft. Hier stellte sich heraus, dass I09 Phantasieren, Tagträume; I10 Pläne, Vorsätze, Ziele; I19 entschließen, Impuls zur Handlung die 3 Motivfeldkriterien erfüllen und damit den Motivfeldbegriffen zuzuordnen sind. 08:11 Uhr.
EB21-14.12.2023, 11:08-11:23 Uhr, 15 Min. Ich möchte mir noch einmal klar werden, wie es zu den Definitionsseiten kam. Als erstes habe ich mich mit den Bedeutungen und den elementaren Dimensionen des Erlebens beschäftigt. Als zweites kam hierbei die Frage auf, wie man die elementaren Dimensionen des Erleben erlebnismäßig voneinander unterscheiden kann. Damit stellt sich die Frage nach Kriterien für das Erlebnishafte der elementaren Dimensionen des Erlebens, inzwischen auf 27 herangewachsen. Dies führte zu einem ersten brainstorming von Kriterien, inzwischen sind es 28 geworden. Zwei elementare Dimensionen des Erlebens kann man als erlebnismäßig gleich ansehen, wenn sie dieselben Signierungen in den 28 Zellen der Kriterien aufweisen. Also stand an, die 27 elementaren Dimensionen des Erlebens in Bezug auf die 28 Kriterien zu untersuchen, zu beurteilen und entsprechend zu signieren. Bei I02, ursprünglich 5 Motivfeldworte, später 20, aktuell 26, stellt sich dann als erste Frage, bezüglich welcher Kriterien diese 26 Motivfeldbegriffe bzw. Motivfeldworte als gleich angesehen werden dürfen. Dies führte zum ersten Definitionsvorschlag: Motivfeldbegriff sind dann gleich, wenn sie Ausprägung, Richtung und eine Realisierungstendenz aufweisen. Offen blieb, wie sie sich sonst unterscheiden oder nicht. Hierzu muss man die 26 Motivfeldbegriffe nach den 28 Kriterien für Erlebnisinhalte untersuchen, beurteilen und signieren. 11:23 Uhr.
EB22-19.12.2023, 19:20-19:45,
25 Min.
Ich habe heute die 705 Gefühlsworte von ca. 230 an bis 705 nach
Gefühlsverwandtschaft fertig klassifiziert. Die Arbeit war notwendig,
um mit der Gefühlsbegriffsverwandtschaft voran zu kommen. Hierbei
habe ich folgende Methodik angewandt:
- Theoretisch gibt es unendlich viele Gefühle. Aber es gibt wahrscheinlich
nur 1000 bis 2000 Gefühlsworte (im Deutschen).
Insgesamt wurden für den Gefühlsfragebogen 705 Gefühlsworte zur Beurteilung wie viel Gefühl steckt in dem Gefühlswort ... alphabetisch gelistet? ausgegeben. Ein Problem ist, dass viele ähnliche bis synonyme vorkommen. Daher stellt sich mir die Frage, ob sich nicht Gefühlsverwandtschaften oder Gefühlsfamilienbegriffe oder Gefühlsfeldbegriffe analog den Motivfeldbegriffen finden lassen, die die große Vielfalt der Gefühle auf einige wenige Dutzend reduzieren lässt (hierzu ChatGPT).
Ich begann mit ersten Gefühlsverwandtschaften und klassifizierte sie mit einer Zahl, um sie nach Klassifizierung leichter sortieren zu können, um zu prüfen, ob die Gefühlsworte in der zugeordneten Klasse zusammen passen.
Dabei können mehrere Fehler, Mängel oder Schwächen auftreten:
1. ein Gefühlswort ist keiner der bis dahin erstellten Verwandtschaftsklassen zuzuordnen.
2. Dann muss eine neue Klasse geschaffen werden.
3. Ein Gefühl kann zwar zugeordnet werden, der Klassenbegriff ist aber sehr weit.
4. Es können neue, speziellere Klassen geschaffen werden.
5. Es können auch mehrere Klassen nach Rängen zugeordnet werden: 1. Wahl, 2. Wahl, ...i.te Wahl
Iterationen
Nach Klassenzuordnungen wird neu sortiert und anschließend nachgesehen, ob die Zuordnungen so passen oder ob Änderungen zur Verbesserung der Klassenzuordnung vorzunehmen sind. Das macht man so lange, bis keine Änderungen mehr erforderlich erscheinen.
Liegen die Verwandtschaften fest, ist zu analysieren, was bei Gefühlsverwandtschaftsbegriffen gleich ist und was sie von den anderen Gefühlsverwandtschaftsbegriffen unterscheidet. 19:45 Uhr.
EB23-20.12.2023, 09:06-09:24, 18 Min
Ich bin weiter dabei, die Gefühlsverwandtschaftsbegriffe zu entwickeln und zu überprüfen. Aktuell sind es 41. Aufgefallen ist mir, dass einige Gefühlsworte in die Persönlichkeit hineinreichen und eher überdauernde Persönlichkeits- oder Charaktermerkmale bedeuten, z.B. 355 kalt, 59 asexuell , 493 skrupellos, 575 unnahbar. Andere berühren den geistigen Bereich, z.B. 416 nachdenklich, wie andere sehr stark den Bereich Antrieb, Energie. Sehr schwierig zu beurteilen sind die sexuellen Identitäten 385 lesbisch, 59 asexuell, 151 bisexuell, 342 homosexuell, 522 transsexuell (vergessen: hetero, intersexuell, quer), weil man in der Regel nicht weiß außer GV04 anders, wie sich eine sexuelle Identität fühlt. Schwierig sind auch die mehrdeutigen wie z.B. 58 arm. Eine andere Schwierigkeit ist der unterschiedliche Allgemeinheits- oder Differenzierungsgrad. Ein anderes Problem ist, dass viele Gefühlsworte mehreren Verwandtschaftsbereichen zugeordnet werden können. Ich habe das aktuell so gelöst, dass ich 1. Wahl, 2. Wahl, ... i.te Wahlen signiert habe. Ein weiteres Problem ist die grundsätzliche Bewertung des Gefühls, weil doch einige dabei sind, sowohl positiv (1) als auch negativ (0), je nach Situation und Perspektive eingeordnet werden können, die ich dann mit 2 signiert habe. Zu klären ist auch die Frage der Bipolarität vieler Gefühlsworte. Die Grundidee, verwandte Gefühlsworte in Gefühlsverwandtschaftsbegriffe zusammenzufassen, erscheint mir nach wie vor sehr sinnvoll. Was sich damit machen lässt, wird man erst nach der Untersuchung und Analyse genauer wissen. Ich bin jedenfalls guter Dinge. 09:24 Uhr.
EB24-29.12.2023, 16:04-16:05, 1 Min. atmen, beim Achten bemerke ich das Heben und Senken des Bauches, aber kein Gefühl dabei. 16:05. [Quelle: Fühlprotokolle]
EB25-29.12.2023, 12:46-12:48, 2 Min. Habe bemerkt, dass ich keine Lust habe, den Gefühlsfragebogen noch einmal auf Richtigkeit zu überprüfen. Ich kann zwar klar sagen, dass ich dazu keine Lust habe, aber ich habe kein Gefühl dazu. Ein Beispiel für ein "kognitives Gefühl" (neu: erlebengk). 12:48 [Quelle: Fühlprotokolle]
EB26-26.01.2024, 10:13-10:21 Uhr, 8 Min.
Bin heute wieder dabei, an der Fortsetzung im Kapitel 2 - wissenschaftliche
Psychologie - zu arbeiten. Gestern hatte ich das Gefühl, dass
es unübersichtlich und sehr viel geworden ist, so dass ich mir über
den grundsätzlichen Stand wieder klar werden möchte. Erleben
- elementare Dimensionen des Erlebens - Definition einiger wichtiger elementaren
Definitionen (Energie, Gefühl, Motivfeldbegriffe) - Kriterien
für die jeweiligen elementaren Dimensionen des Erlebens - Fragen und
Kriterien ganz allgemein für psychische Sachverhalte, (kurzer, längerer,
einfacher oder komplexer Natur). Ich habe gestern die 28 Kriterien überarbeitet
und neu geordnet und nach Zusammengehörigkeit gruppiert. Es sind jetzt
ca. 32 und die Arbeit muss sozusagen aktualisiert werden. Das ist mir ein
wenig über dem Kopf zusammengeschlagen und ich habe bemerkt, dass
es mir nicht leicht fällt, das Viele zu organisieren und zu verwalten,
vor allem, wenn es wie gestern Veränderungen gibt. 10:21 Uhr
(unterbrochen wegen Kieser Training und zu erwartendem Regen).
EB27-26.01.2024, 21:57-22.07 Uhr, 10 Min
Nachmittags habe ich, so weit es ging alle Erlebens-Protokolle in E-Berichte
auf dieser Seite zusammengestellt (und dokumentiert wo ich überall
nachgeschaut habe), damit ich das Material zusammen habe. Ich bin nicht
sicher, ob der Ansatz, nach Fragen und Kriterien zu suchen, die sich an
psychische Erlebenssachverhalte stellen lassen, wirklich richtig und ergiebig
ist und nicht aus dem Ruder läuft. Ich sollte vermutlich mehr Beispielanalysen
dazwischen schalten. Da merke ich dann ziemlich schnell, ob sich die Sache
rund anfühlt, ob sie klar ausführbar ist oder welche Probleme
auftreten. Die entscheidende Frage ist, wie sich Erlebenssachverhalt erlebensmäßig
erfassen lassen. Es wächst und wächst und wächst - und ich
befürchte über den Kopf. 22:07 Uhr.
EB28-10.02.2024 Korrelationstrauma nach 40 Jahren
beendet (Nachtrag 16.02.2024)
Am Samstag den 10.02.2024 habe ich das partielle Korrelationskoeffiziententrauma
Uauf01-20.2,3,...19=1.388 mit der erfolgreichen numerischen Therapie der
"Korrelations"koeffizientenmatrix mit einem negativen Eigenwert von -0.0114
nach rund 40 Jahren Jahren endgültig beenden können. Das bescherte
mir ein außerordentlich positives Erleben, eine tiefe Genugtuung
und große Befriedigung.
EB29-16.02.2024, 10:58-11:06, 8 Min. Motivfeldbegriff
und Ausdehnung von PSV im Erleben
Ich arbeite derzeit am Motivfeldbegriff. Dabei bekam ich auch wieder
Anregungen durch die Reaktivierung des CST-SYSTEMS, das nun seinen 3. Umzug
(Alphatronic > Atari > Win10 vollzieht, weil dort die Motivgruppenbeziehungen
für die Interpretation des CST eine große Rolle spielen und
im Handbuch sehr ausführlich und detailreich beschrieben wurden. Ein
Motivfeldbegriff liegt nach aktuellem Stand vor, wenn die drei Kriterien
Ausprägung, Ziel und Realisierungstendenz vorliegen. Beim Nachdenken
kam mir die Frage: ob Ausdehnungen von psychischen Sachverhalten erlebt
werden können. Was soll eine Ausdehnung eines psychischen Sachverhaltes
im Erleben sein? Ist Ausdehnung eins psychischen Sachverhaltes erlebbar?
Ich bin ganz guter Dinge, aber das Motivfeld als elementare Dimension des
Erlebens erscheint mir immer wieder als ein sehr überbordendes Thema,
das ich nicht so richtig in den Griff bekomme. Mal sehen, wie es heute
läuft. 11:06 Uhr.
EB30-19.02.2024, 15:38-15:45, 7 Min.
Habe die Arbeit an der Asthma-Stichprobe unterbrochen und wende mich
wieder dem Motivfeldbegriff zu. Ich bin aktuell nicht sicher, ob tatsächlich
alle drei Kriterien gebraucht werden: Ausprägung, Realisierungstendenz,
Ziel. Ist im Zielbegriff nicht schon die Realisierungstendenz enthalten?
In Bezug auf mathematische Vektoren stellt sich auch noch die Frage nach
dem Angriffspunkt. Wo greift ein Motiv an? Ist die Richtung automatisch
mit dem Ziel schon gegeben? Diese Ausführungen repräsentieren
kein Erleben, allenfalls erlebeng,
weil es hier um geistige Arbeit und Probleme geht. Unsicherheit und kognitive
Dissonanz und ein gewisses Unbehagen mit der ungeklärten Situation
könnte man allerdings erlebensmäßig geltend machen.
EB31-20.02.2024, 09:08-09:24, 16 Min.
Nach der Aufklärung der Probleme in der Asthmagruppe ein starkes
und anhaltendes, auch noch heute morgen, Gefühl der Erleichterung,
Befreiung und Befriedigung. Ich kann mich nun völlig frei und unbelastet
dem Grundproblem des Motivgruppenfeldbegriffs zuwenden und die gestern
angesprochenen Probleme versuchen zu klären. Ziele können auch
sehr theoretisch und utopisch sein, wodurch es schwierig sein dürfte,
hier Realisationstendenzen empirisch zu fundieren. So gesehen wären
ZIEL und Realisationstendenzen nicht gleichbedeutend. Nicht in JEDEM ZIEL
muss eine Realisationstendenz erlebbar oder postulierbar (erlebeng)
sein. Realisierungstendenzen, da bin ich sicher, können unterschiedliche
Ausprägungen haben, wobei noch nicht sehr klar ist, wie Realisationstendenzen
erlebt werden. Sich anschicken, eine Handlung auf den Weg zu bringen, sollte
erlebbar sein, vielleicht aber auch nur überwiegend kognitiv (erlebeng,
erlebenk).
Wenn ich mich z.B. in Position bringe, um eine Nackenübung aus dem
Kiesertraining (G4: Kinn auf die Brust und langsam hoch gehen), so merke
ich die dabei auftretenden Körperempfindungen im Nacken. Ich erwäge
hierfür eine eigene Signatur körperliches empfinden als erlebeneK
und entsprechend ErlebenisEK einzuführen. Das ist wahrscheinlich
auch für die Differenzierung zwischen körperlicher und psychischer
Energie nützlich. 09:24
EB32-21.02.2024, 09:49-10:05, 16 Min. Vorläufiger
Abschluss der Grundversion fürs Netz
Ich bin gestern mit der Seite deutlich vorwärtsgekommen, was mich
erleichtert, erfreut und befriedigt hat. Ich habe alle Themen, die nicht
den Kern betreffen auf eine Hilfsseite ausgelagert und dadurch viel Überblick
gewonnen. Land in Sicht! Ich nähere mich einer vorläufigen
Präsentationsform. Im Nachhinein verstehe ich nicht mehr so recht,
wieso die Bearbeitung so lange gedauert hat. Na ja, ich habe ziemlich viel
Zeit damit verbracht, bei mir selbst zu erkunden, welche Kriterien des
Erlebens ich tatsächlich wie erleben kann. Außerdem haben die
Gefühle gedauert. Und die Entwicklung der Kriterien für ein Motiv
oder Motivfeld hat auch länger gedauert, was man der kurzen Definition
in einem Satz von zwei Zeilen nicht mehr ansieht. Und ich habe einige Zeit
für die Unterstützung des Programmierers der Neuimplementierung
des CST-SYSTEMS auf Win10 gebraucht. Dabei ist ein großes Problem
in der vor ca. 40 Jahren durchgeführten und noch nicht veröffentlichten
Asthma-Studie aufgetaucht, da auch einen Tag gebunden hat. Mit der Seite
Motiv- und Motivfeld habe ich nun ausführlich und gründlich vier
elementare Dimensionen des Erleben untersucht (Motiv, Energie, Denken,
Fühlen). Diese vier Beispiele sollten genügen, um zu zeigen,
wie man es angehen und machen kann. Nach Einbindung in die Seite Wissenschaftliche
Psychologie des Erlebens kann ich dann mit dem Schreiben der Buchversion
fortfahren. Es geht weiter und das ist ein gutes Gefühl, Befinden
und Erleben. 10:05
EB33-23.02.2024, 08:47-08:58 Uhr, 11 Min. Zweifel
in die Unterscheidung wissenschaftliche u. praktische Psychologie
Nachdem die großen Arbeitsbeispiele, bislang vier, für das
Definitionsregister Energie, Denken, Fühlen, Motivfeld neben den sie
unterstützenden Fragebogenauswertungen ausgearbeitet wurden, wende
ich mich wieder dem Buchprojekt zu. Mit den zwei geschaffenen Bereichen
- wissenschaftliche Psychologie und praktische Psychologie des Erleben
- tue ich mich schwer, weil die beiden Bereiche so ineinandergreifen. Ich
bin mir nicht mehr sicher, ob diese Unterscheidung sinnvoll ist und durchgehalten
werden kann. Das muss aber hier nicht theoretisch entschieden werden, sondern
es wird sich beim Ausarbeiten und Schreiben ergeben. So betrachtet muss
ich mir an dieser Stelle keinen Kopf machen. Oft kommen Lösungsideen
bei und mit der Arbeit. Diese Erfahrung habe ich schon oft gemacht. Tatsache
ist: wenn wir mit Versuchspersonen und ForschungspartnerInnen arbeiten
- und das müssen wir empirisch - dann sind wir notwendig sowohl in
der wissenschaftlichen als auch in der praktischen Psychologie. Ich denke,
das wird mich heute und vielleicht sogar die nächsten Tage beschäftigen.
Rund fühlt sich die Sache keineswegs an, eher ein Hauch von kognitiver
Dissonanz. 08:57 Uhr.
Auswertung Erlebensmerkmale EB33: schwer tun, unsicher,
keinen Kopf machen müssen, Vertrauen durch Erfahrung, nicht rund anfühlen,
kognitive Dissonanz. 2 Min.
Originalquelle
Erlebensprotokoll/bericht.
_
EB34-26.02.2024, 15:36-15:47 Uhr, 11 Min.
Energieerleben. Gestern hatte ich, wie schon einmal vor 2-3 Wochen,
ein unterschiedliches Energieerleben von Körper und Psyche, und zwar
ein normales körperliches Energieerleben und gleichzeitig aber ein
beeinträchtigtes psychisches Energieerleben. Es war ziemlich deutlich,
obwohl ich es nicht genauer beschreiben kann. Heute war es nach dem Spaziergang
wieder gleich, also kein Unterschied zwischen körperlichem und psychischen
Energieerleben. Jedenfalls für mein Erleben ein klarer Beleg für
die Unterscheidung zwischen körperlichem und psychischen Energieerleben.
Die Pilotfragebogenentwicklung zum Verständnis von Psyche und Psychologie
von Nicht-PsychologInnen und Psychologen oder Psychotherapeuten hat große
Fortschritte gemacht und könnte noch in diesem Frühjahr etwas
werden. Insgesamt bin für mein Erlebensprojekt guter Dinge, obwohl
es immer größere Dimensionen angenommen hat. Mir hilft die Gliederung
sehr. Die Erweiterung des Kiesertrainings auf den Nackenbereich (G4, G5)
bewährt sich bislang. Das war wohl eine gute Entscheidung. Für
attac habe ich wahrscheinlich das Evaluationsproblem gelöst und damit
in eine Aufgabe gewandelt. Jeder Mensch, da bin ich sicher, ist von Natur
aus ein Psychologe, weil er seit der frühen Kindheit erlebt und erfährt
wie er selbst und andere funktionieren. Bin schon gespannt, was bei meinem
Pilotfragebogen herauskommt. 15:47 Uhr.
Auswertung Erlebensmerkmale EB34:
EB35-27.2024, 09:10-09:38, 28 Min. (mit Nachdenken)
Ich bin bei den Themen (1) Schnittstelle Wissenschaftliche und praktische
Psychologie und (2) die Seele und wie sie funktioniert im Verständnis
von Nichtpsycholog-/NichtpsychotherapeutInnen. Zur Erforschung des 2. Themas
entwickle ich auch einen Pilotfragebogen, für den ich inzwischen 36
Items formuliert habe. Was sind die Paradigmen und Grundfragen beider Themen?
In diesem EB sollte eine erste Klärung erfolgen. Erlebensmäßig
liegt also eine gewisse Unklarheit, ein Klärungsbedürfnis und
ein gewisses kognitives Unbehagen vor. Will man von Menschen wissen, was
für sie die Seele ist und wie sie funktioniert, muss man mit ihnen
sprechen. Sofern man psychologische (Fach-) Worte und Begriffe braucht
und gebraucht, die die meisten Menschen so nicht kennen, muss man sie erklären
und sicher stellen, dass die Menschen sie verstanden haben. Gebraucht man
die "normale", natürliche Sprache sollte ein Verständnis im Wesentlichen
möglich sein. Es empfiehlt sich aber trotzdem, Begriffssicherungen
vorzunehmen, weil der persönliche Wort- und Begriffsgebrauch sehr
unterschiedlich sein kann.
- (1) Schnittstellen Kernaufgabe: Kommunizieren mit Nichtpsycholog-/PsychotherapeutInnen über psychologische und psychische Sachverhalte.
- (2) Verständnis Kernanliegen Begriff der Seele und wie sie funktioniert bei NichtpsychologInnen. Auch hier ist natürlich Kommunikation mit Nichtpsycholog-/PsychotherapeutInnen erforderlich.
Auswertung Erlebensmerkmale EB35: gewisse Unklarheit, kognitives Unbehagen, Klärungsbedürfnis, Nach erster Klärung gewisse Erleichterung und Befriedigung.
EB36-28.02.2024. [Uhrzeit nicht erfasst]
Für das Erlebnisregister den Ordner Psychotherapie eingerichtet.
Als erste Analyse für das Erleben von Psychotherapie wurde die Spieltherapie
mit Dibs von Virginia Mae Axline angelegt. Beim erneuten, vertieften Lesen
dieser Arbeit fiel mir zu meiner Überraschung auch ein interessanter
Gebrauch des Wortes "Beweis" auf, den ich ins Beweisregister
aufgenommen habe.
Beim Mittagsspaziergang gestern habe ich auf dem Rückweg zum Ende
hin keinen Unterschied zwischen psychischer und körperlicher Energie
gespürt. Es kam mir auf dem Spaziergang auch die Idee, die Dibs Erlebens
Analyse für jede Stunde anzulegen und da die Erlebensmerkmale bei
Dibs und seiner Spieltherapeutin zu erfassen. [Uhrzeit nicht erfasst]
EB37-04.03.2024, 15:58-16:04, 6 Min.
Beim Nachmittagsspaziergang fiel mir auf, dass faul sein wollen erleben
und körperliche und psychische Energie spüren nicht zusammenhängt,
jedenfalls nicht zwingend und immer. Das spricht dafür, dass faul
sein wollen nur heißt, wenig oder keine Energie aufwenden wollen,
aber nicht, sie nicht haben. Ein interessanter Befund. Meine Frau konnte
ihn für sich nicht bestätigen. Vielleicht hat es auch mit dem
Kieser-Training zu tun (beobachten). Auch heute konnte ich keinen Unterschied
zwischen körperlicher und psychischer Energie spüren. Ich habe
heute die numerische Therapie von Todt 1978-56 abgeschlossen und ins Netz
gestellt. Vielleicht ist deshalb ein wenig die Luft draußen. Mit
dieser Arbeit bin ich recht zufrieden. Ist schon was, die Auswirkungen
eines minimalen negativen Eigenwertes von -0.0005 so schön demonstrieren
zu können. Jetzt ist wieder Dibs dran. 16:04
EB38-05.03.204, 15:56-16:07, 11 Min.
Während und nach dem Spaziergang keine Unterschiede zwischen psychischer
und körperlicher Energie bemerkt.
Das unterscheidende Erleben beschäftigt mich fast täglich.
Körperliches hat einen Ort, Psychisches nicht. Körperliche Merkmale:
Ziehen, spannen, drücken, ziehen, schlaff, matt, Körperliches
strengt mich an, kalt, warm, heiß, müde unklar. Psychische Merkmale:
Lust, motiviert, interessiert, gut drauf, will und kann Gefühl,
Gleichermaßen Merkmale: ausgeruht, Luft ist draußen, müde,
schlaff, matt, nicht aufraffen können. Weiter Todt Korrelationstabellen
Todt 1978 Das Interesse ausgewertet bis fast um 2 heute Nacht. Zu meiner
großen Überraschung war eine kleine 5er Matrix mit relativ großen
negativen Eigenwert -0.1601 mit 4 von 6 Verfahren numerisch therapiebar.
Damit hatte ich nicht gerechnet, bislang dachte ich, bei -.02 ist Schluss.
Immer und immer wieder mache ich die Erfahrung: man muss rechnen, man kann
es einfach nicht sehen, mutmaßen, erraten. Habe mich gestern auch
mit Polanyis personalem Wissen beschäftigt und hierzu auch ChatGPT
befragt. Mutet paradox an: man weiß viel, von dem man nicht weiß,
wie das Wissen zustande kommt. Habe die Auswertungsseite Dibs aufgeschlagen.
16:07.
EB39-07.03.2024, 9:30-, Erlebnisbericht Klimaaufbruch
Erlangen 06.03.2024
Das war ein interessanter und kurzweiliger Abend mit echten lokalen
Koryphäen zu allen Belangen des Klimas und was wir vor Ort, jeder
von uns, alles tun können, um die drohende Katastrophe noch zu stoppen
oder zu mildern. Trotz der Brisanz des Themas herrschte eine interessierte,
lockere und positiv freundliche Stimmung.
Kurzer Überblick über den Verlauf
- Sehr informativer Einführungsvortrag von Frau Prof. Gisela Anton, Astro-Physikerin an der FAU zu den Klimafakten (ca. 30 Min bis ca. 18:40)
- Kurzvorstellung Teilerei (Johanna, ca. 10 Min)
- Kurzvorstellung Lesecafé, Treff für Nachhaltigkeit (Julia ca. 15 Min)
- Wasser ist Leben, Begrünung, Bäume, Wald (Karin Depner, ca. 20 Min)
- Energiewende (Stefan Jessenberger), insbesondere Mythen zu Wärmepumpen (ca. 10 Min)
- Steckersolargerät (Niko), sehr praktische Möglichkeiten für Kleinanlagen (ca. 15 Min)
- Verkehrswende und Mobilität
- Konsum, Ernährung, aktuell Landschaft hinzugefügt
- Energie
Nach ca. einer Viertelstunde wurden die TeilnehmerInnen gewechselt, so dass jeder einmal bei jedem der drei großen Themen dabei war.
Gegen 20:30 Uhr kamen wir wieder alle zusammen in der Großrunde, um die Ergebnisse noch einmal zusammenfassend vorzustellen:
- Verkehrswende und Mobilität (ca. 5 Min)
- Konsum, Ernährung, Landschaft (ca. 4 Min)
- Energie (ca. 5 Min)
Dank an die Organisator*innen (Moderator Helmut Zapf), gut geplant,
gut gemacht. So sollte Kommunalpolitik mit Bürgerbeteiligung laufen!
| Wie geht es weiter: Dienstag, den 26.03.2024, 18: 00 Uhr Klimastammtisch: Wir kommen! (Irmgard & Rudi) |
Erlebens- und Erlebniselemente: interessant, informativ, anregend, kurzweilig, lockere, einfallsfördernde Atmosphäre, Kompetenzerleben, Dabeiseingefühl, Gemeinschaftsgefühl, Kontakterlebnis, Sinngefühl (bin bei etwas Nützlichem, Gutem und Wichtigem dabei). Identifikation mit dieser Art Kommunalpolitik und den Zielen. Allgemein ein Beispiel für kommunales Engagementerlebnis (eingetragen ins Erlebnisregister).
EB40-07 11:45-12.02, 17 Min.
Gestern konnte ich eine indefinite Matrix von Todt (1978), S. 56, Berufsinteresse
für Wärmelehre, Mädchen, 5.-9. Klasse mit einem relativen
großen negativen Eigenwert von -0.2142 zwar erfolgreich numerisch
therapieren, d.h. der Matrix ihre positive Semidefinitheit zurückgeben
(Überraschung, Verwunderung, nicht damit gerechnet, Freude).
Aber der Preis ist hoch, wie ich durch eine vollständige partielle
Korrelationsanalyse aller 6 numerisch therapierten Matrizen feststellen
konnte und musste, weil die partiellen Korrelationskoeffizienten sehr unterschiedlich
ausfielen (Ernüchterung, Enttäuschung). Die Matrizen
waren im sichtbaren Bereich zwar wieder in Ordnung, alle geprüften
Kennwerte im Normbereich: keine komplexen Faktorenladungen mehr, keine
multiplen Korrelationskoeffizienten > 1, alle partiellen Korrelationskoeffzienten
zwischen -1 und 1, aber deutlich voneinander verschieden. Zwar ergaben
die Korrelationen der partiellen Korrelationen einen mächtigen Generalfaktor
("numerisch therapierter partieller Korrelationsfaktor") mit 78.4%. Dieser
große Generalfaktor zeigt trotz der sehr deutlichen Unterschiede
bei den partiellen Korrelationen je nach angewandter numerischer Therapiemethode
eine gewisse Gesetzmäßigkeit an. Es gibt also, wieder einmal,
viel zu tun ... Die Gretchenfrage lautet: welche numerisch therapierte
Matrix soll interpretierbar sein? Lassen sich Kriterien finden (Grundspannung
durch das gegenwärtig offene Problem)
Mit Dibs bin ich auch vorangekommen und habe das 4. Kapitel ausgewertet
und mir für heute auf jeden Fall Kapitel 5 vorgenommen. Habe die GwG
angeschrieben, weil ich nicht glauben kann, dass es zu Axlines Tod kein
einziges Obituary (Nachruf) gab (kopfschütteln, betroffen, Unverständnis,
empört, wütend). Ich machte mich auch daran, zu
klären, wie Entwicklung in der Psychotherapie festgestellt werden
kann. Ein erstes brain storming ergab: Etwas ist da, was vorher nicht da
war, z.B. lachen - dessen Entwicklung über alle 18 Spieltherapiestunden
ich schon erfasst und ausgewertet habe - in der Stunde
- Etwas ist nicht mehr da, was vorher da war, z.B. weinen in der Stunde
- Etwas ist stärker als vorher, z.B. ausgelassener
- Etwas ist nicht mehr so stark als vorher, z.B. vermiedener Blickkontakt
- Etwas ist anders als vorher, hat sich gewandelt, nutzt 1. Person ich statt 2. oder 3. Person
- Etwas nimmt zu
- Etwas nimmt ab
EB41-08.02.2024, 18:11-18:17, 6 Min.
Beim heutigen Spaziergang habe ich keinen Unterschied zwischen
meiner körperlichen und psychischen Energie bemerkt. Aber es fiel
mir wieder auf, dass ich nach dem Kieser Training fauler war, ca. 2-3 h
hinterher. Faul hat in meinem Erleben nichts oder nur wenig mit Energie
zu tun. Schon eher nach meinem Sprachgefühl mit Antrieb, wodurch sich
vielleicht auch Energie und Antrieb bei mir unterscheiden lassen. Ich
kann also sagen: mir war ein wenig nach faul sein zu Mute, aber das heißt
nicht, dass mir die Energie fehlte, ich mag sie bloß nicht einsetzen.
Zum Verständnis der Zusammenhänge, Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zwischen faul, Energie, Antrieb gibt es noch einiges zu tun.
Habe vorhin mal in 42 Die Antwort auf fast alles zur Frage,
prägt uns die Sprache reingeschaut, nach einer Weile bin ich aber
wieder rausgegangen, weil mir die Differenzierung zwischen Name, Wort und
Begriff zu kurz kam. Das hat mir nicht gefallen." 18:17
EB42-09.03.2024, 11-11:30, ca. 30 Minuten. Erleben zu meinen EU-Anfragen bezüglich Finanztransaktionssteuer, übernommen von der entsprechenden Seite.
- Erleben-0 bei Kenntnisnahme dieses Ergebnisses: Enttäuschung, Irritation, Verwunderung, Kopfschütteln, Ärger, Empörung, Wut, nicht glauben können (besser wohl nicht glauben wollen).
- Erleben-1 nach erster Anfrage: erfreut durch die prompte Bestätigung meiner Anfrage zuversichtlich, dass Aufklärung in Kürze erfolgt.
- Erleben-2 nach einer Woche Warten: unsicher, unklar, was da los ist, etwas ratlos, nachfassen oder nicht? Ich entschloss mich dann, höflich und sachlich ein zweite Mal nachzufassen.
- Erleben-3: Fast vier Wochen nach meiner ersten Anfrage erschien mir schon sehr lange. Ich war hochgradig irritiert, weshalb noch nicht einmal eine Zwischenorientierung erfolgte und ärgerte mich darüber ziemlich. Ich begann zu phantasieren, ob da nicht System dahinter steckt, einfach aussitzen, einfach ignorierend hinhalten. Ich beschloss daher, meine Anfrage über X (Twitter) öffentlich zu machen, auch um vielleicht die eine oder andere Mitstreiterin zu gewinnen.
- Erleben-4: Erster Tweed. Genugtuung und Erleichterung, nicht mehr ganz alleine dazustehen. Hoffnung auf MitstreiterInnen.
- Erleben-5: Entschlossen, Entschlossen, täglich den Tag zu tweeden, der seit meiner ersten Anfrage vergangen ist, in der Hoffnung allmählich auch MitstreiterInnen zu gewinnen, die sich meinen Anfragen anschließen oder diese übernehmen. Ich habe mich auf einen langen Atem eingestellt. Nach weiteren Möglichkeiten gebrainstormed.
- Erleben-6: 30 Tage Tweed-Info mit Entschlossenheit auf den Weg gebracht. Nach weiteren Möglichkeiten gebrainstormed.
- Erleben 7: Zwischenmitteilung
Erleben-8 Dritter Tweed: Weiterhin entschlossen, am Ball zu bleiben. Neue Aktivitäten in der Sache geplant.
EB43-09.03.2024, 23:44 Uhr.
Neue Idee, Axlines von mir so bezeichnete Therapie Reflexionen vollständig zu paraphrasieren und damit zur perfekten Doku entwickeln. Die so gefundene Therapietheorie kann dann mit den 8 Grundsätzen auf Kongruenz (mir sind nämlich einige Widersprüche aufgefallen) verglichen werden. Die Therapietheorie besteht aus Tatsachenbehauptungen, wie die - hier - kindliche Psyche organisiert ist. Dabei werden Ziele, was das Kind will und nicht will, unterstellt. Außerdem werden Therapiemittel behauptet, wie die Ziele realisiert werden können. Kurz Notiz, damit die Idee nicht verloren geht. Es bahnte sich auch ein Auswertungsschema an.
_
EB44-10.03.2024, 14:32-14.39, 7 Min.
Es hat seit gestern Abend und vermutlich auch in der Nacht noch nachgearbeitet in mir: wie die Erfassung der Spielstunden der Dibs Spiel-Therapie erlebensmäßig schlussauswerten? Ich habe für die Auswertung der 4. Spielstunde (6. Kapitel) folgendes allgemeines Schema entwickelt und durchgeführt:
| Auswertung Gespräch mit der Mutter | a) verbaler Erlebensaus- druck | b) nonverbaler Erlebensaus- druck | c) Erlebensausdruck durch Verhalten | d) Erleben durch A.s Interpretation |
|
Zusammenfassung: z verbales Erleben z nonverbales Erleben z Erleben durch Verhalten |
Das ist für die Dibs-Auswertung ein Durchbruch, der mich sehr zufrieden macht. Aber es ist viel, sehr viel Arbeit worüber ich nicht sehr glücklich bin.
EB45-11.03.2024, 18:38-18:46 Uhr, 8 Minuten.
Ich bin mit der Dibs Auswertung ganz gut vorangekommen, das ist einerseits
schön und angenehm, andererseits ist es sehr viel Arbeit. Im Zug der
Dibsarbeit kam mir die Idee, dass die Beziehung zwischen Therapeut und
Klient vielleicht von entscheidender Bedeutung ist. Ich denke an das Atmosphärische,
das man gar nicht so in Wort fassen kann. Ich bin am Überlegen, wie
man das besser erforschen könnte. Beziehung ist zwar der richtige
Begriff, aber auch sehr allgemein. Das Spüren, wie einem der andere
gegenübersteht, eingestellt ist, könnte von großer Bedeutung
für
die Entwicklung in der Therapie sein. Axline hatte wahrscheinlich mit Dibs
großes Glück, dass sie gerade im richtigen Moment, zum Einsatz
gelangte. Das ist aber noch einmal eine andere Komponente als das Atmosphärische
der Beziehung, aber auch wenig erforscht wie mir scheint. Der richtige
Zeitpunkt oder Zeitraum für eine Therapie mag auch ein sehr wirkmächtiger
Faktor sein. Ich merke, die Faktoren, die ein Therapie fördern, hemmen
oder stören können, beschäftigen mich, angeregt durch die
Dibs-Auswertung, wieder mehr. Jetzt habe ich die Ideen wenigstens aufgeschrieben,
so dass sie nicht mehr verloren gehen können, auch ein befriedigendes
Gefühl und gutes Erleben. 18:46.
_
EB46-15.03.2024, 23:50:00:05, 15 Min.
Das Kiesertraining (ca. 11-12), inzwischen 10 Jahre dabei, hat heute
eine Stimmungsverbesserung bewirkt, nicht viel, aber doch merklich. Für
die Dibs Auswertung habe ich nun eine endgültige Form gefunden, die
mich sehr zufriedenstellt: Zusammenfassung, Erfassen der Erlebenselemente
und Einordnung der Erlebenselemente in die vier Kategorien a) direkt verbal,
b) non-verbal, c) Erleben durch Verhalten und Erleben nach d) Eindrücken
und Interpretationen von anderen, hier hauptsächlich von Axline. Die
einheitliche Form erleichtert das Verständnis und die Auswertung.
Habe mich auch wieder mit Rogers befasst. Fand es merkwürdig,
dass erleben nicht in seinem Register in Die nicht-direktive Beratung
vorkommt. Der Selbst insbesondere
das wahre Selbst spielt eine große Rolle bei Rogers und auch bei
Axline. Rogers zitiert in Entwicklung der Persönlichkeit S. 167 einen
Ausspruch von Kierkegaard (1924 [Die Krankheit zum Tode], S.17) "Das Selbst
zu sein, das man in Wahrheit ist". Das ist ein interessanter wie schwieriger
Ausspruch. Ich habe ihn auf Anhieb nicht finden können. Eine Idee
bei Rogers und Axline könnte sein, wer sich selbst lebt, so wie er
ist, ist gesund, brütet keine Symptome aus. Das Selbst kann sich frei
verwirklichen. Mir scheint, da gibt es eine Menge Erklärungsbedarf.
EB47-16.03.2024, mit Texte suchen ca. 60 Min: Auseinandersetzung
mit dem wahren Selbst
Ich habe das Kierkegaard-Zitat in meiner fünfbändigen Rowohlt
Ausgabe, in Bd. 4, Die Krankeit, zum Tode, S. 20 erfreulicherweise heute
Nacht noch gefunden [pt 14 fett-kursiv hervorgehoben], ein schwieriger
und kaum verständlicher Text (>Zum
Geleit):
- "Über sich verzweifeln, verzweifelt sich selbst
loswerden wollen ist die Formel für alle Verzweiflung, so daß
deshalb die zweite Form der Verzweiflung, verzweifelt man selbst sein wollen,
auf die erste zurückgeführt werden kann, verzweifelt nicht man
selbst sein wollen, ebenso wie wir in dem Vorhergehenden die Form, verzweifelt
nicht man selbst sein wollen, auflösten in die, verzweifelt man selbst
sein wollen (vgl. 'A). Ein Verzweifelnder will verzweifelt er selbst sein.
Aber wenn er verzweifelt er selbst sein will, dann will er sich ja nicht
los sein. Ja, so scheint es; aber wenn man näher hinsieht, erkennt
man doch, daß der Widerspruch der gleiche ist. Das Selbst, das er
verzweifelt sein will, ist ein Selbst, das er nicht ist (denn
das Selbst sein wollen, das er in Wahrheit ist, ist ja gerade
das Entgegengesetzte der Verzweiflung), er will nämlich sein Selbst
von der Macht losreißen, die es setzte. Aber dies vermag er trotz
allen Verzweifelns nicht; trotz aller Anstrengung der Verzweiflung ist
jene Macht die stärkere und zwingt ihn, das Selbst zu sein, das er
nicht sein will. Aber so will er ja sich selbst loswerden, das Selbst,
das er ist, loswerden, um das Selbst zu sein, wonach er selber getrachtet
hat. Ein Selbst zu sein, wie er das will, würde, wenn auch in einem
anderen Sinne ebenso verzweifelt, seine höchste Lust sein; aber gezwungen
zu werden, Selbst zu sein, wie er es nicht sein will, das ist seine Qual,
die ist, daß er sich selber nicht loswerden kann."
Anmerkung: Verzweiflung versteht Kierkegaard als Krankheit,
nicht als Heilmittel (S.13). Zum Begriff des Selbst gibt es einen Eintrag
im Glossar, S. 145f:
- "SELBST — oder Geist wird in
der <Krankheit zum Tode> von Kierkegaard als das Verhältnis
bezeichnet, das sich zu sich selbst verhält. Zu dieser Formel kommt
er durch folgenden Gedankengang: Der Mensch ist zusammengesetzt aus Seele
und Leib. Beide gehören der endlichen, zeitlichen Sphäre an,
die der Notwendigkeit der Natur unterworfen ist. Aber es existiert ein
Verhältnis zwischen ihnen, und das gehört einer anderen Welt
an, der unendlichen, ewigen Welt der Freiheit im Gegensatz zur Notwendigkeit.
Die Bestandteile sind sterblich, aber ihr Verhältnis ist unsterblich.
Wären die Teile das Primäre, so wäre das Verhältnis
etwas Äußeres und negativ. Da jedoch das Verhältnis das
Primäre ist, da die Teile zusammengesetzt sind, gerade um dies Verhältnis
zu bilden, so ist das Verhältnis positiv. Der Mensch besteht also
aus einem negativen, sterblichen Teil (Seele und Leib) und einem positiven,
unsterblichen Teil: dem Verhältnis zwischen ihnen. Es muß also
eine Beziehung bestehen zwischen dem Irdischen (der Teilkombination Seele
— Leib) und dem Ewigen im Menschen (dem Verhältnis Seele — Leib).
Dies wird dadurch ausgedrückt, daß das Verhältnis sich
zu sich selbst verhält. Dies ist das Selbst des Menschen oder der
Geist. Dieses Selbst kann nun von etwas außer sich abhängen
oder von sich selbst abhängen. Letzteres wird als unmöglich bewiesen,
da wir unser Selbst in bestimmten Formen der Verzweiflung abschütteln
wollen. Also ist es von etwas anderem gesetzt: von Gott. Indem der Mensch
zugleich aus Zeitlichem und Ewigem besteht, [>146] ist es möglich,
daß ein Mißverhältnis zwischen beiden Teilen entsteht:
die Sünde. Dieser Zustand der Sünde, einmal eingetreten, kann
immer wieder von vorne beginnen, ein fortdauerndes Umschlagen von Möglichkeit
zu Wirklichkeit. Diese Möglichkeit der Sünde hängt mit dem
ewigen, konstanten Teil im Menschen zusammen und ist die Wurzel der Verzweiflung,
die nötig ist, damit das Ich sich seines ewigen Selbst bewußt
wird (s. <das Ewige> und im Glossar des 3. Bds. <ewiges Bewußtsein>).
Dies ist ein Aspekt des Paradox, daß der Mensch als Existenz das
Zugleichsein von Ewigem und Zeitlichem ist, und Angst und Verzweiflung
sind der Ruf des Ewigen in unser irdisches Dasein (s. bes. S. 13 ff, 73
ff)."
- "VERZWEIFLUNG — Der psychologische
Begriff Verzweiflung hat seine weitgehende Bedeutung für Kierkegaard
und bildet bei ihm fast das Gegenstück zur «Wiederholung»
(s. Glossar des 2. Bds.). Der Begriff wird bei ihm im weitestgespannten
Sinne verstanden. Er bedeutet die unser Wesen erfassende [>148] <Krankheit
zum Tode> und entspringt unserem ewigen Bewußtsein, unserem Selbst
als Geist. Dieses Selbst ist eine Synthese von Immanenz (Endlichkeit) und
Transzendenz (Ewigkeit), von Leib und Seele, Möglichkeit und Notwendigkeit
(s. dort). Die Einheit der Synthese ist der Geist. Dieses Selbst aber ist
nicht durch sich selbst gesetzt, sondern von einem transzendenten Selbst:
Gott (s. dort), dem es allein sein Dasein verdankt. Gesundheit und Krankheit
hängen von der Natur dieses Selbst ab. Seine Gesundheit besteht darin,
gerade das volle und ganze Selbst zu sein, das von Gott so bestimmt wurde,
und so in Ruhe und Klarheit in seiner Macht zu ruhen. Die Krankheit entsteht
durch eine verkehrte Haltung gegenüber dieser Urgegebenheit. Der Mensch
will dann nicht dieses gottgegebene Selbst sein, sondern ein anderes, geteiltes
Selbst, das in Widerspruch zu sich selbst und Gott steht. Immanenz und
Transzendenz sind dann nicht mehr in einer Synthese vereint. Ihr rechtes
Verhältnis wird zu einem Mißverhältnis. Es gibt innerhalb
dieses Rahmens viele Möglichkeiten und Varianten des Verzweifelns.
Verzweiflung ist eine Bestimmung des Geistes. Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
sich zu der ewigen Komponente in sich selbst zu verhalten. Gerade weil
das menschliche Selbst die Ewigkeit in sich schließt, ist die Verzweiflung
ein radikales Ewigkeits-Unglücke, ein lebendiger Tod, dessen Unglück
darin besteht, nicht sterben zu können. Diese Krankheit ist allgemein.
Jeder trägt sie von Natur in sich. Auch der Christ ist nur unter ständigen
Glaubenskämpfen zeitweilig von ihr befreit. Am schlimmsten steht es
um den Menschen, der frei davon zu sein glaubt, weil er sich diese Krankheit
verhehlt. Wenn Verzweiflung zusammen mit der Gottesvorstellung im Menschen
ist, wird sie zur Sünde. Der Mensch hat kein Vertrauen und keinen
Glauben zu Gott, was eine potenzierte Form von Verzweiflung ist (s. S.
73 ff)."
Die Auseinandersetzung hier hat zu einem neuen Eintrag auf der Seite
"Selbst" geführt.
Obwohl Dibs sehr aufwändig ist, finde ich diese Wahl zum Einstieg
in das Erleben von Psychotherapie richtig und wichtig. Inzwischen sind
die Auswertungen fortgeschritten. 14 von 24 Kapiteln sind fertig. Es zeichnet
sich ab, dass die Präsentation sehr befriedigend für mich sein
wird. Damit sollte der letzte große und offene Posten im Erlebnisregister
in ein bis zwei Woche abgeschlossen werden können.
EB48-23.03.2024, 7:50-8:18, 28 Min.
Gestern nach dem Kiesertraining zum zweiten Mal nach Extradaraufachten
merkliche Stimmungsverbesserung. Überlegt eine persönliche Stimmungsskala
einzuführen. 5stufig oder 7 stufig? Meine Frau meinte gestern 5stufig.
Wichtig ist, dass man erlebensmäßig tatsächlich gut erfassen
und unterscheiden kann ETWA WIE FOLGT:
- schlecht drauf, schlechte Stimmung (Schätzscore 1)
- gedämpfte Stimmung unter dem Normalerleben (Schätzscore 2)
- normale Stimmung (Schätzscore 3).
- leicht gehobene Stimmung (Schätzscore 4).
- Hochstimmung (Schätzscore 5)
Bei einigen Spaziergängen konnte ich während und danach keine Unterschiede zwischen körperlicher und psychischer Energie spüren. Aber des öfteren ein leichtes Bedürfnis nach Ruhe oder langsamer. Es könnte sein, dass durch mein verstärktes Achten Differenzierungserlebnisse zunehmen. Das mit dem Achten ist erlebenspssychologisch so eine Sache:
- Es könnte das Erleben stören oder gar zum Verschwinden bringen
- es könnte ein differenziertes Erleben fördern durch aufmerksamere Erfahrung
- es könnte das Erleben verfälschen, etwa autosuggestiv
- es könnte das Erleben verunsichern
- ...
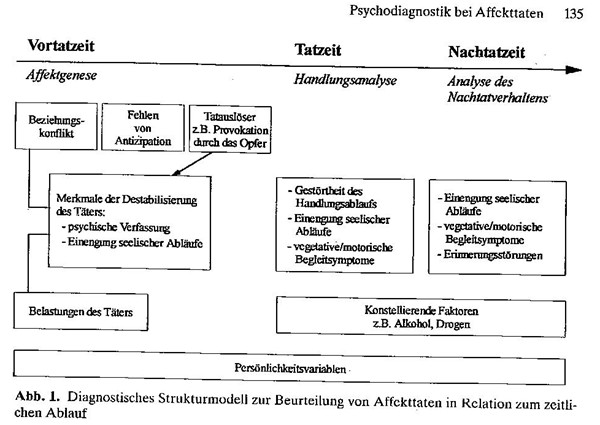
Aufgefallen ist mir, dass Steller eigene Forschungsarbeiten zitiert,
die öffentlich nicht zugänglich sind. Die Beschäftigung
mit den Affekten im Rahmen Affektdelikt und tiefgreifende Bewusstseinsstörung
ist für die Erlebensforschung sehr interessant. 08:18.
_
EB49-24.03.2024, ca. 10 Min.
(1) In den Sternstunden Philosophie zum Stammtisch-Thema Digital
Detox: Das Smartphone, ein Gift? sagt der Medienwissenschaftler Bernhard
Pörksen am 24.03.2024 in 3sat je nach Format zwischen ca. 45 und 48:25:
"Und ich erlebe da einen Wertekonflikt". Dieser seltene Fund
einer authentischen Aussage über das Werterleben hat mich begeistert,
so dass ich ein Videozitat als Beleg geschnitten habe (Wertekonflikt.m2ts.
Wertekonflikt.mpeg),
mit dem es keine Copyrightprobleme geben sollte. Ich habe daraufhin eine
Seite zum Werterleben im Erlebnisregister und dieses Videozitat als erste
Materialie aufgenommen. Zur Einführung muss ich aber noch etwas schreiben.
Werten ist nach meinen bisherigen Erfahrungen und Forschungen eine Kombination
aus affektiven und kognitiven Elementen (erlebeneak),
wobei im Regelfall die kognitiven Komponenten überwiegend dürften
und manchmal vielleicht auch nur erlebeneg
vorliegt.
(2) Auf unserem Sonntags-Spaziergang habe ich meine Frau gefragt, ob
und wie sie Werterleben kennt. Da fiel ihr spontan der Refrain vom Kneipen
Chor Erlangen der Kundgebung "Bunt gegen Rassismus" am Freitag, den 22.03.24,
ein: "Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es ist
nur deine Schuld, wenn sie so bleibt."
(3) Befragt nach Unterschieden im körperlichen oder psychischen
Energieerleben, konnte sie nach Introspektion keine Unterschiede bei sich
feststellen.
(4) Bei mir war es gestern so, dass ich mein körperliches Energieerleben
normal (3) empfand, aber das psychische Energieerleben etwas schlechter
(2.5-2.8).
(5) Jahresmitgliederversammlung BfG ermüdend, das Bürokratische
ist nicht meines.
_
EB50-25.03.2024. Ca. 20 Min. Merkmale bei
Affekttaten.
(1) Ich habe mich letzte Woche intensiv mit Affektdelikten beschäftigt.
Dabei haben Merkmale, die auf eine Affekttat hinweisen können, eine
große Rolle gespielt. Die klassische Arbeit hierzu hat Saß
1983 im Nervenarzt verfasst:

Wie werden Affekte erlebt? Werden sie überhaupt erlebt, wenn sie uns gefangen nehmen? Wie merken wir, dass wie uns in einem affektiven Zustand befinden? Wie können wir unsere Affekte beschreiben?
- Aggression, Angst, Ärger, alles kurz und klein schlagen wollen,
Grauen, Gefühlswallungen erleben, Lust spüren, überflutet
werden, in Wallung geraten, hochgradige Erregung, vor dem explodieren,
explodieren, die Kontrolle verlieren, rasen vor Zorn, alles andere tritt
in den Hintergrund, nicht mehr klar denken können, fluchen, schreiben,
toben, Schaum vorm Mund, außer sich sein, voller Leidenschaft, Ekstase,
Trance, Blut kocht, Herz pocht, Herz rast, starkes, heftiges atmen, hingerissen,
zittern, nicht mehr beherrschen können, nicht mehr aufzuhalten, überschäumen,
Dammbruch, nicht mehr aufzuhalten, wild, erregt, überdreht, aufgeregt,
eingeengt, taumelnd, von Sinnen, Wut, Zorn, ....
(2) Nach dem Kiesertraining gewisses Spüren, leichtes Bedürfnis nach ruhen, faul sein.
(3) Spaziergang keine Unterschiede im Erleben körperlich oder psychische Energie.
(4) Gewisse leichte Spannung, wie meine methodenkritische Hauptprüfung aufgenommen wird.
(5) Später und morgen geht's mit Dibs weiter. Habe da noch die Idee gehabt, dass es mit Dibs auch deshalb mit seinen Eltern vorwärts ging, weil sich herausstellte, dass er intelligent und begabt war (therapeutischer Heilfaktor). Wäre Dibs tatsächlich geistig behindert gewesen, wäre ein Therapieerfolg wahrscheinlich sehr viel schwerer geworden, wenn nicht gar ganz unmöglich. In jeder Hinsicht, ein sehr berührender Fall.
_
EB51-27.03.2024, 09:10-09.19, 9 Min. Am Dienstag ein Freitagsgefühl - Rohracher verneint Werterleben
Merkwürdig, ich hatte gestern des öfteren das Gefühl als ob es Freitag wäre. Solche Tagesverschiebungsgefühle habe ich manchmal, aber jetzt wollte ich es doch einmal aufschreiben, damit diese Merkwürdigkeit nicht verloren geht. Wie das kommt, dazu habe ich derzeit keine Idee. Mit dem Werterleben habe ich weitergemacht und die Einführung vervollständigt. Bei Rohracher 1963, 8. A., S. 466, fand ich eine ausdrucksstarke Stelle zum Werterleben: "Noch nie habe ich jemanden sagen hören »ich erlebe dies als Wert«, und noch nie ist es mir eingefallen, ein eigenes Erleben so zu formulieren." Diese Aussage findet sich auch in der bislang letzten Auflage 1983, S. 512. Das ist inzwischen durch das Videozitat aus den Sternstunden Philosophie widerlegt. Immerhin, Rohracher ist einer der ganz wenigen, die sich tatsächlich mit dem Werterleben beschäftigt haben. Dibs hat sich durch die Bearbeitung des Werterlebens erneut verzögert.
_
EB52-29.03.2024, 21:50-22.15, ca. 25 Min
(1) Gestern war es im Schlossgarten ziemlich kühl, vor allem der Wind war sehr frisch. Meine Frau hat gestern sogar erlebt, dass ihre Nasenspitze kalt war. Das hat sie schon einige Male erlebt. Ich selbst saß zwar neben ihr gestern im Schlossgarten auf der Bank, ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich meine Nasenspitze kalt fand.
(2) Seit gestern suchten wir Bunge Das Leib-Seele-Problem. Ich meine meinte, es sei ein Kopie und geringt. Wir stellen alles auf den Kopf, fanden aber keinen Ring, keine Kopie im Ring von Bunge. Heute Abend kam mir dann die Idee, wenn ich Bunge als Buch habe und mich täuschte, dass es eine Kopie im Ring sei. Das war schließlich der Schlüssel zum Erfolg. Tatssächlich fand ich Bunge an einem von vier möglichen Plätzen, wo er sein musste, wenn er richtig abgelegt und einsortiert war. Es war eine großer Erleichterung, Befriedigung und Freude, Bunge endlich gefunden zu haben, da ich u.a. wieder verstärkt an meiner Identitätstheorie gearbeitet habe, angeregt durch Rohrachers Einführung ... und die Arbeitsweise des Gehirns.
(3) Zunächst ärgerte ich mich sehr über die unwissenschaftliche und nachlässige Zitierweise von Rohracher vor allem in Bezug auf Spinozas Identitätslehre. Mein Ärger weitere sich aus, je mehr Zitate zu Spinoza ich prüfte. Bis auf Hofstätter stimmte da fast nichts. Bei Rohracher stieß ich dann auf den Hinweis auf die 5 Axiome G.E. Müller 1896. Rorchacher gab nur den Fundort, nicht den Namen des Artikels an. Als ich den gefunden hatte, suchte ich die Originalquelle, die Nr. 10 der Zeitschrift für Psychologie 1896, aber die von Wikipedia zusammengestellten Quellen begannen erst 1903. Ich schrieb sogar die Bibliothek an, wurde dann aber doch noch fündig. Als ich mir die 5 Axiome ansah, S.1-5 bis S. 15f. Es ist mir nicht klar geworden, was genau Müller mit psychophysischer Parallelismus S. 3f meint; ich verstehe darunter, dass Körper und Seele unterschiedliche Seinsformen sind, die nebeneinander - parallel - herlaufen und unabhängig von einander sind - ein mir sehr unsinnig erscheinende Theorie. Mal wieder geriet ich in einen Zustand halber Verzweiflung über den Zustand der Wissenschaft. Aber ich bin mir subjektiv sicher, der Schlüssel liegt im Verständnis des Erlebens, also genau in dem, woran ich seit August 2022 fast täglich intensiv arbeite.
Auswertung Erleben EB52: ziemlich kühl frisch, Nasenspitze kalt gefühlt. Suchfrust, Täuschung, Schlüssel zum Erfolg, große Erleichterung, Befriedigung und Freude nach Finden, Anregung, Ärger, Unklarheit, unsinnige Theorie, halbe Verzweiflung, subjektive Sicherheit Erleben als Schlüssel.
EB53-11.04.2024-23:20-23:28, 8 Min Affekt und
Leidenschaft bei Descartes und Spinoza
Ich hatte die letzten Tage u.a. an Spinozas Ethik (48 Affekte erfasst)
und Descartes Leidenschaften gearbeitet (Sachregister zu den Leidenschaften
Descartes nach seinen 212 Artikeln abgeschlossen). Das Definitionionsniveau
bei beiden ist extrem dürftig. Dabei kam mir die Idee, Standardfragen
an psychologische Themen zu entwickeln, die grundlegende Vergleich ermöglichen.
Bei den Affekten und Leidenschaften ist mir sofort eingefallen, dass ein
wichtiges gemeinsamen Merkmal die Stärke sein könnte. Sowohl
Affekt als auch Leidenschaft haben für mich etwas Starkes. Ein Standardfrageschema
wäre daher: hat der psychische Sachverhalt etwas Quantitatives? Ein
anderes wäre: ist der psychische Sachverhalt gerade aktiviert oder
nicht? Vielleicht sollte ich die bislang entwickelten Kriterienliste noch
einmal diesbezüglich durchsehen. Wird Zeit, dass ich wieder zu Dibs
zurückkehre.
EB54-13.04.2024, 17:27-17:40, 13 Min. Automatisches
Verhalten, Definition, Theologie, Philosophie.
Gestern fiel mir beim Spazierengehen die Bewegung meiner Arme. Mein
Erleben war, sie bewegen sich von selbst, ich tue nichts dazu, will es
nicht ausdrücklich bewusst. Ist das ein Beispiel auf automatisches
Verhalten? Ähnlich, fällt mir soeben ein, sollte es mit den Bewegungen
der Beine und der Füße sein. Ist die Abwesenheit von wollen
und bei der inneren Wahrnehmung das Kennzeichnen für die Einordnung
als automatisches Verhalten?
In der Auseinandersetzung mit Descartes schält sich heraus, wie
wichtig eine genaue Definition von Körperlichem und Seelisch-Geistigem
ist.
Inzwischen habe ich den Briefwechsel zwischen Descartes und der Kurfürstin
von der Pfalz eingesehen. Der Übersetzer und Herausgeber Wohlers hat
die Entstehungsgeschichte sehr gut dargestellt und genau belegt. Das Drama
mit dem Definitions"niveau" bei Descartes und Spinoza hat mich inzwischen
veranlasst zwei neue Einträge auf der Definitionsseite vorzunehmen:
Descartes
Regeln, die er nicht einhält und ein Hinweis auf die Definitionslehre
der Logik von
Port Royal, die sich um das Thema sehr verdient gemacht hat. Immer
mehr wird mir zum Rätsel, warum die Philosophen seit Aristoteles so
extrem versagen. Mehr und mehr wird mit klar, dass die vom wissenschaftlichen
Arbeit gar nichts verstehen und deshalb gibt es auch seit Aristoteles keinen
Fortschritt in der Philosophie. Man sollte sie wie die Theologie aus den
Universitäten entfernen. Sie tragen nicht zum Fortschritt der Wissenschaften
bei. Dann muss man sie auch nicht ständig subventionieren.
EB55-16.04.2024, 11:30-11:34, 4 Min
Habe gestern nach über 14 Tage Arbeit endlich Descartes' Leib-Seele-Theorie
und Spinoza eingestellt. Darüber Zufrieden. Heute wollte ich mich
noch einmal an Spinozas Descartes begeben mit einer Recherche zur "geometrischen
Methode", die ich im Moment einigermaßen gut überblicke. Auch
darüber zufrieden. Aber ich habe mich geärgert, dass ich über
die Meditationen und die Prinzipien der Philosophie con Descartes noch
keine bibliographische Klarheit gewinnen konnte. Die Meditationen
sind von 1641 bzw. 1642, die Prinzipien von 1644.
EB56-25.04.2024, 16:00-16.11, 11 Min. Ich habe heute das allgemeine Sachverhaltsmodell um die Erfassungsbasis E erweitert und die ersten 16 von 24 Kapitel Dibs (Erlebnisregeister Psychotherapie), woran ich seit mehreren Wochen arbeite, ins Netz gestellt. Auerßdem einen Exkurs über Falschzitate. Das hat mich sehr befriedigt und positiv gestimmt. Unserer Mittagsspaziergang haben wir zur Autowerkstatt gemacht un den "Friedrich II" dort mit neuer Batterie abgeholt. Keine Unterschieden zwischen körperlicher und psychischer Energie erlebt. Zur Differenzierung körperlicher Energie habe ich mir vorgenommen, beim Kiesertraining konzentrierter zu erfassen, ob die Maschine aktuelle leichter, schwerer oder gleichbleibend anstrengend verläuft. Aktuell beschäftigen mich Beweisthemen, was macht einen Beweis zu einem Beweis, was ist "zwingend" oder was genau bedeutet eine Beweisregel? Diese Fragen werden sicher dazu führen, dass die Beweisseiten weiter gewinnen werden. Möchte eine Sammlung zwingender Schlussregeln anlegen und über diese dann besser zu verstehen, was das Wesen des Zwingenden ist oder sein könnte.
EB57-29.04.2024, 18:17-18:25, 8 Min.
Beim Kiesertrainung hatte ich heute bei 2-3 Geräten das Gefühl,
als wären sie leicht schwieriger und bei einem als wäre er etwas
leichter als sonst. Ich hatte gestern begonnen, eine Seite mit Sachtexten
anzulegen, um diese erlebensmäßig auszuwerten. Das habe ich
heute begonnen, wobei der Bericht aus dem magazin am Wochenende über
die Referendarzeit reichlich Erlebenselemente enthielt. Dabei stellte sich
die Frage, was gegenständliches erlebeng vom kognitiven
erlebenk eigentlich gernau unterscheidet? Ist es allein der
Metagesichtspunkt, dass im kognitiven erlebenk das Erleben innerlich
wahrgenommen wird, sozusagen zusätzlich zum kognitiven Inhalt? Ich
habe im Moment den Eindruck, dass das noch nicht zufriedenstellend geklärt
ist. Das gefällt mir nicht. 18:25.
EB58-08.05.2024, 15:44-15.53, 9 Minuten.
Seit Montag ist Dibs abgeschlossen und ich fühle eine große
Befreiung, Erleichterung und Befriedigung. Das war eine arge Maloche, die
erlebensmäßige Auswertung der 24 Kapitel, die sich über
6 Wochen hinzog. Einen Dämpfer erlitt ich gegen Ende, als ich feststellen
musste, dass meine Auswertungen nicht richtig vergleichbar waren, so dass
ein valides Urteil über den Entwicklungsverlauf nicht möglich
war. Ich habe mich dann dazu entschlossen, dies klar zu dokumentieren.
In gewisser Weise war es schon Schock, als ich meine zwei Auswertungen
der 18 Spielstunde
verglich. Wenn der Entwicklungsverlauf valide und zuverlässig beurteilbar
sein soll, dass müssen die Texte die Therapie nicht nur richtig repräsentativ
wiedergeben, sondern es muss auch die erlebensmäßige Auswertung
möglichst genau und vergleichbar sein. Das geht eigentlich nur, wenn
die Texte nach aussagepesychologischem Vorbild in Elementaussagen
zerlegt werden. Ich habe heute mit Seite 119 begonnen. Damit hat sich gezeigt,
dass nicht nur verbal, non-verbal und das Verhalten als Signierungsketagorie
zu berücksichtigen sind, sondern auch eine Ereigniskategorie geschaffen
werden werden, z.B. bei dem Text, Dibs S. 119, "Jemand kam den Gang herunter".
Es sollten jedenfalls mit der Anwendung der aussagepsychologischen Elementaraussagenanalyse
die meisten der bislang vielleicht nich nicht operational befriedigenden
Signierung deutlich werden. Sehr froh war ich auch, dass die Geburtagsvorbereitungen
und insbesondere mein Geburtstagsbrief noch gut hingehauen haben. Beim
letzte Kriestrainung meinte ich den einen Ausfall gespürt zu haben.
Es war etwas anstrengender als gewöhnlich. Bei einigen Spaziergängen
der letzten Zeit schien mir die körperliche Energie besser als die
psychische, was ich nicht so recht verstehe.
EB59-11.05.2024, 09:35-09.:52, 17 Min.
Gestern konnte ich die Erlebenanalyse mit aussagepsychologischen Mittel
für Dibs S. 119
abschließen, was mir ein ziemlich positives Gefühl an Zufriedenheit
beschwerte. Allerdings haben sich beim Korrekturlesen meiner Frau noch
einige Unklarheiten herausgestellt, die einer Überarbeitung bedurften.
Dadurch konnte die Arbeit nur gewinnen. Der Beweis ist erbracht, wie man
Therapieberichte so auswerten kann, dass sie ziemlich genau verglichen
werden können und damit ein Entwicklungsvergleich möglich ist.
Das Gewichtungsproblem bei den Zählungen ist noch nicht gelöst.
Hier quält der Satz: man kann nicht nicht-Gewichten. Gewichtet man
scheinbar nicht, so hat man gleich gewichtet.
Zusätzlich habe ich noch an der Sammlung für
das Erleben in Trance oder Hypose gearbeitet und einige interessante Quellen
(Bleuler, Forel, Wundt) gefunden. Dabei ist mir gekommen, dass eine grundlegende
Theorie wie der Mensch funktioniert durch die Psychologie noch aussteht.
Auch wurde mir deutlich, dass auch das Bewusstseinsproblem und wie Veränderungen
möglich sind noch besser verstanden und aufbereitet werden muss. Die
Behauptung, dass der Hypnosetheoretiker, dass Veränderungen beim Menschen
nicht willentlich und rational möglich sein sollen und nur rechtshemisphärisch
funktionieren, halte ich in ihrer apodiktischen Ausschließlichkeit
für falsch. M.E. ehrrscht in der Hypnoseforschung ein großer
Durcheinander, schon die (operationale) Begrifflichkeit ist unterentwicklung
und wenig brauchbar.
Was braucht man für Veränderungen? Motiv,
Fähigkeit, Gelegenheit.
Was braucht man zum Leben? Funktionstüchtigkeit,
Lebensraum mit Möglichkeiten der Verwirklichung.
Kiesertraining durchschnittliche Anstrengung. Sopaziergang: körperliche
und psychische Energie ausgeglichen.
Gibt es Qualitäten des Erlebens (tieferen,
reicheres, besseres,. )?
Neues Thema (Vermächtnis II?): wie funktioniert
der Mensch, Kernthemea der Psychologie.
EB60-12.05.2024,
14:56-14:58 Im Rahmen des Thema Hypnose spukt mir seit gestern die
Idee durch den Kop, das uns unsere Bewusstsein zwar eine Einheit erscheint,
aber ist es eine? Wie wenn wenn es aus mehreren Schichten oder Bereichen
besteht? Wenn es so wäre, warum nehmen wir dieses dann nicht wahr?
Wachzentrum, Schlafzentrum, Trancezentrum?
EB61-14.05.2024, 22:53-23.06, 13 Min.
Ich denke mittlerweile, dass viele hypnotische
Phänomene sehr vieles darüber sagen, wie der Mensch und sein
Bewusstsein funktionieren müssen. Besonders eindrücklich ist
mir eine Stelle aus Pierre Janet (1894), S. 7 haften geblieben:
- "Das untersuchte Individuum kann beispielsweise
alle in einem Zimmer anwesenden Personen sehen, aber eine bestimmte ihm
bezeichnete Person, weder sehen noch hören; es wird Gegenstände,
Papiere, die ihm vorgezeigt werden, sehen können, bestimmte Papiere
aber, die mit einem Kreuz oder einer ungeraden Zahl bezeichnet sind, wird
es nicht sehen können. Die Analyse dieser Erscheinung war für
mich der Ausgangspunkt des Studiums der hysterischen Anästhesien,
welche mehr als man es auf den ersten Blick glauben möchte, dieser
Grundform ähneln.1"
Der Hypnotiseur muss also direkten Kontakt zum System der Wahrnehmungssteuerung des Hypnotisanten haben, vom dem der Hypnotisant nach der Hypnose nichts mehr weiß. Nicht bewusst weiß er, was er wahrnehmen darf und kann, aber bewusst weiß er es nicht. Hier gibt es sehr viel zu erklären. Die Phänomen faszinieren mich und ein bißchen werfe ich mir vor, dass ich mich früher intensiver darum hätte kümmern sollen.
EB62-19.05.2024, 14.45-15.03, 18 Minuten.
Die sehr interessante Sendung 42 - die Antwort auf fast alles zum Leben
der Pflanzen hat mich angeregt, das Erlebnisregister mit einer entsprechenden
Seite
auszustatten. In diesem Zusammenhang kam die Frage auf, ob sich Erleben
wohl programmieren lässt? Da fiel mir Dörners
Bauplan für eine Seele ein und ich legte Seite zu dem Problem
an. Spontan meine ich, dass sich Erleben programmieren lässt. Erste
Ideen keimen. Pfingsten ist in Erlangen durch die Bergkirchweih eine besondere
Zeit, für uns besonders, weil wir zum Berganstich geheiratet haben.
Auf diese Weise haben wir zwei Hochzeitstage, den Donnerstag vor Pfingsten
und den 23. Mai, also nächste Woche. Die Dibs Korrektur nähert
sich dem Ende und damit eine ziemliche Maloche Tour. Na ja, ich wollte
unbedingt das Erlebnisregister Psychotherapie mit etwas ganz Besonderem
eröffnen, dass das bald 6 Wochen dauerte, hatte ich nicht vorgesehen,
weil sich daraus auch noch die Analyse des Erlebens von Sachtexten entwickelte.
Das Projekt ist gewaltig. Die letzten Tage habe ich überwiegend am
Erleben in Hypnose gearbeitet. Die Phänomene helfen sehr dabei, zu
verstehen, wie der Mensch funktioniert, was mich motiviert. Auch wenn es
sehr viele gute und informative Bücher zur Hypnose gibt, ich selbst
habe früher auch zwei Kurse mitgemacht, so ist das begriffliche und
theoretische Niveau meist unbefriedigend. Schon die Terminologie ist mitunter
sehr schlecht, so z.B. Baudouin, wenn auch die Praxis oft beeindruckende
und interessante Resultate liefert.
EB63-21.05.2024, 00:05-00.18, 13 Minuten: Augen schließen
Ich schließe die Augen und eine dunkle Wand, auf der sich nichts
findet. Ich schaue mit geschlossenen Augen auf die dunkle Wand und da ist
immer noch nichts. Ich frage mich, was in meinem Bewusstsein geschieht.
Ich habe die Augen stärker zusammengekniffen und es wurde schwärzer.
Wenn ich die Fläche mit geschlossenen und nicht zusammengekniffenen
Augen länger betrachte, dann wird das Dunkle strukturierter mit helleren
und dunkleren Teilen, ungefährt wie eine Landkarte. Die helleren Stücke
erscheinen mir wie Wasser, die dunkleren wie Land. Die visuelle Aufmerksamkeit
für meine Umgebung ist weg, wenn ich die Augen schließe, für
meine Aufmerksamkeit ist das Sehen ausgeblendet. Ich habe sozusagen visuellen
Sinneskanal geschlossen. Aber es ist nur sehen und wahrnehmen der Umgebung
weg. Das Schwarze, das sich bei längerer Betrachtung strukuriert,
ist ja auch eine visuelle Wahrnehmung, obwohl sich das bei geschlossenen
Augen widersinnig anhört. Ist es eine Vorstellung oder ist es tatsächlich
eine visuelle Wahrnehmung? Soeben hat es den Eindruck einer schwärzlich
strukurierten Milchglasscheibe gemacht. 00:18.
EB64-22.05.2024,
11:13-11:15, 2 Minuten. Es dringt ein rumorendes Geräusch
von außen zu mir, das meine Arbeit gestört hat. Nach ca. einer
halben Minute war es aber vorbei. Ich habe meine Aufmerksamkeit nicht auf
dieses Geräusch gerichtet. Es schien so, als ob sich dieses Geräusch
aufdrängte, ich musste es zwangsläufig erdulden. Das Ger#usch
fragte nicht nach meiner Aufmerksamkeit, es drängt sich einfach in
mein Bewusstsein. Da ich gerade über Aufmerksamkeit arbeite, habe
ich die Gelegenheit für diese Notiz genutzt. 11:15
11:19-11:21 Jetzt ist es wieder da und und ich versuche, es auszublenden.
Ich bin jetzt auf diesen Text konzentriert, aber die Ausblendung gelingt
nicht. Das Geräusch ist da und lässt sich nicht ignorieren, vielleicht
ein wenig an den Rand drängen.
EB65-24.05.2024 Traum I.R.-S. vom 23.05.2024 auf den 24.05.2024:
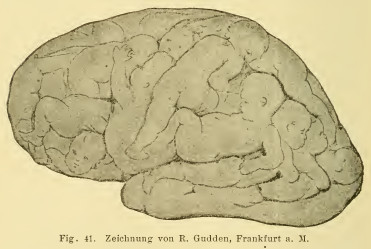
Titchener, E.B. (1910) Lehrbuch der Psychologie. Erster
Teil. Leipzig: Barth. S. 278
Am Abend des 23.05.2024 habe ich von R. S. eine Mail bekommen mit dem Titel: „Was meinst Du?“ mit dem Bildnis eines menschlichen Gehirns von einem R.(udolf) Gudden. Ich sah, dass die Gehirnwindungen aus ca. einem Dutzend Babies bestanden und sagte dies Rudi. Wir recherchierten im Netz und fanden, dass Rudolf Gudden Maler war und der Sohn von Bernhard von Gudden, dem Psychiater von Ludwig II.
In der Nacht träumte ich, dass ich ein Gehirn gesehen habe in dem die Gehirnwindungen aus lauter Hunden bestanden und hatte den sicheren Eindruck, dass ich so ein Gehirn früher schon mal im Wachzustand gesehen habe.
EB66-04.06.2024-10:10-10.21, 11 Min. Aufmerksamkeit
[Kopie]
Ich bin gerade in die Küche, um mir einen Kaffee heiß zu
machen. Der Weg von der Verwaltung, wo ich saß, um an der Aufmerksamkeit
zu arbeiten, führte mich über den Flur in die Küche. Ich
blickte im Flur beiläufig auf das helle, kahle Baumbild, kam in die
Küche, sah dort die Zeitungen auf dem Tisch liegen, überflog
kurz die Titelzeilen, der heutigen Ausgabe, erblickte in dem kleinen Keramiktopf
kalten Kaffe, goß ihn weitgehend in die Tasse, öffnete die Mikrowelle,
stellte die Tasse ein, drückte auf die Einstelltaste, wählte
Mikrowelle, dann 100 Sekunden und betätigte den Einschalter. Die Mikro
brummte und fiepte nach 100 Sekunden. Ich nahm die Tasse raus, gab Zucker
und Milchpulver dazu, rührte um und kehrte zurück an den Computer.
Ich sehe den Bildschirm, höre von draußen ein Geräusch,
das ich nicht einordnen kann, beginne zu überlegen, wo bei dieser
Aktion die Aufmerksamkeit und was da sonst noch war. Beim Aufschreiben
ist mir die Frage gekommen, was ist wirklich mit Aufmerksamkeit belegt
oder gemacht worden und was ist Wissen, wie es gewesen sein muss? Der Kaffee
ist inzwischen schon geleert und hat gemundet. 10:21
Auswertung/Reflexion: Eindruck: ich habe
vieles gesehen, manches auch gemacht, aber nicht besonderes betrachtet,
nur das Bild im Flur habe ich angeschaut und die Zeitung. Das meiste war
automatisch. Es war auch etwas Alltägliches, Gewöhnliches und
nichts Besonderes. Und natürlich ist mir die Wohnung und sind mir
die Räumlichkeiten vertraut. Ich könnte sie ziemlich gut mit
geschlossenen Augen in meiner Vorstellung entstehen lassen. Wenn ich mir
das vorstelle, dann brauche ich auch Aufmerksamkeit. Ich gehe durch die
Wohnung, betrete in der Vorstellung jedes Zimmer und stelle mir die einzelnen
Gegebenheiten vor: Vorstellungsblick auf die Wohnfläche, z.B. in Wohnhobby
Fensterwand, Gemäldewand, Schrankwand, Bücherregalwand mit Gemäldeteil.
Mit jeder Vorstellung ist Aufmerksamkeit verknüpft, das ist die Lenkung
und Betrachtung der verschiedenen Teile. Es scheint, als wäre Aufmerksamkeit
mit vorstellen oder Vorstellungen vollständig gekoppelt. Vieles bemerke
ich, aber ohne besondere Beachtung, mehr im Nebenbei.
EB67-09.06.2024 Lebens-Schnitte; Kombinationen
von Grundfunktionen
Es gibt Querschnitte und Längsschnitte. Die Idee von Lebensschniitten
kam mir bei der Frage, wie die einzelnen Erlebenselemente zusammenhängen,
mehr oder minder ab- oder unabhängig voneinander sind.
Einige Grundfunktionen des Erleben lassen sich unterschiedlich, aber
sinnhaft kombinieren, z.B.
Lenken (Lernen(Denken)) Lenken wie man denken lernt
Lernen(Lenken(Denken) Lernen wie Lenken des Denkens geht
Denken(Lernen(Lenken) darüber nachdenken, wie Lenken gelernt werden
kann
EB68-11.06.2024, 18:50 betreffend den 04.06.2024,
ca. 9:30 Uhr Weglenken
Am Dienstag, den 04.06.2024 hatte ich kurz nach dem Aufstehen das "Ohrwurmwort"
Vokuhila (eine Frisur: vorne kurz, hinten lang; am Abend vorher einen Bericht
darüber gelesen) im Kopf. Es kam mehrere Male wieder, obwohl es mich
störte und ich es abzustellen (aus meinem Kopf wegzulenken) versuchte.
Richtig verschwunden war es erst kurz bevor um 9.30 Uhr mein erster Patient
kam. Als wir in der Mittagspause, nach dem Mittagessen beim Walk, unseren
täglichen Spaziergang durch den Schlossgarten machten, fragte R.S.
mich ob ich weglenken kenne. Da fiel mir ziemlich schnell das Beispiel
Vokuhila ein. Ich erzählte es R.S. und er bat mich, es aufzuschreiben,
was ich heute, 1 Woche später, am 11.06.2024, 18.50 - 19.00 endlich
erledige. irs.
EB69-13.06.2024, 18:15-18:24, 9 Min Beweisarbeiten.
Beweisaufgaben: Dispositionsbeweise, Konfundierungsbeweise. Ich habe
heute die Zusammenfassung im Beweisregister durch ZBR0
ergänzt:
- Das Thema Beweis und beweisen ist fälschlicherweise meist auf
Mathematik und Logik beschränkt, die zentrale Krankheit der Wissenschaftstheorie,
woran der Popperismus, der Wiener Kreis und Wolfgang Stegmüller in
Deutschland wesentlichen Anteil haben. Das spiegelt sich auch in den wissenschaftstheoretischen
Arbeit der Psychologie wieder wie sie etwa Westmeyer 2004 in einem eindringlichen
Plädoyer für die Wissenschaftlich der Psychologie dargelegt hat.
Dabei sollte es für jeden auf der Hand liegen, dass es die zentrale
Aufgabe der Wissenschaftstheorie sein muss, Methoden und Regeln für
die Wahrheit/Falscheit wissenschaftlicher Aussagen zu begründen. Es
ist daher auch von grundlegender Bedeutung, logisch und empirisch wahr
zu unterscheiden. (eine Sondervariante könnte wahr/Wahrheit in den
Geisteswissenschaften spielen). Dazu war die Wissenschaftstheorie den 20.
Jhds. nicht in der Lage; sie ist daher zu Recht in den Hintergrund gerückt
und muss von grundauf erneuert werden.
EB70-14.06.2024, mehrere Zeiten über den Tag,
ca. 30 Min. Def, BeWu-Lenkung.
Die Arbeit den wichtigen Grundbegriffen der elementaren Dimensionen
des Erlebens schreitet voran, was mir natürlich gefällt. Gestern
habe ich mit Genugtun VORSTELLEN
und VORSTELLUNG eingestellt und damit einen weiteren wichtigen Grundbegriff
für die Psychologie des Erlebens etabliert. Das ging leichter als
gedacht. Hilfreich war, dass die Psychologie hier seit gut einem halben
Jahrhundert einigermaßen konsistente Auffassungen entwickelt hat
(AEM,
Dorsch).
Heute habe ich eine neue Seite angelegt zum Thema: die Bedeutung der Begriffsnormierung
für den wissenschaftlichen Fortschritt und im Editorial umrissen,
worum es auf dieser Seite gehen soll. Inzwischen habe ich das das Gefühl,
dass die wichtigsten Grundbegriffe (Aufmerksamkeit
(I09), Bewusstheit (I17), Denken
(I07), Energie (I01b), Erinnern
(I06), Erleben (I17) [Erwachen, wach sein],
Fühlen
(I05), Handeln, Machen, Tun und Lassen (I15), Lenken (I22), Lernen (I21),
Motivfeldbegriffe
(I02), Vorstellen
(I13), Wahrnehmen (I12) [Einstweilen]),
für das Buch fertig werden. Ich möchte heute am Lenken weitermachen.
Dazu kam mir der Gedanke, ob die Supervision der Bewusstseinsvorgänge
nicht beim Grundbegriff LENKEN, der in der Psychologie so gut wie nicht
entwickelt ist, anzusiedeln ist. Hier wäre die Beziehung zwischen
LENKEN und Bewusstseins-SUPERVISION zu klären. Hierzu habe ich schon
im IPPT-Handbuch
1995,
S.183 ein Modell gefunden. Lenken ist erlebengk.
Vielleicht kommt gelegentlich noch erlebens hinzu (ich bin bin
fähig, ich kann es).
EB71-30.06.2024, 8.48-8.58, 10 Min. Lenken (steuer,
regeln) Grundversion fertig! Toll!
Gestern war ein großen Tag für das Projekt: Ich habe die
Grundversion Lenken (Steuern,
Regeln) fertiggestellt. Vermutlich die erste Monographie zu dem Thema
in der Psychologie überhaupt. Es ist jetzt doch mehr und gründlicher
geworden als konzipiert und hat über eine Woche gedauert. Aber mit
dem bisherigen Resultat bin ich trotz einiger Probleme (Konfundierung)
sehr zufrieden. Ich hatte gestern mehrere Stunden ein stark positives Gefühl
und gute Stimmung. Meine Frau hatte beim Korrekturlesen der Hauptseite
die Idee, dass man Lenken (steuern, regeln) dann vermehrt spürt, wenn
man sich zu etwas zwingen oder Entscheidungen treffen muss. Ich machte
noch einmal darauf aufmerksamen, dass man Lenen (steuern, regeln) zwar
merkt, erlebeng,
aber nicht eigens erlebt. Hier bedarf es noch klärender Selbstversuche.
_
EB72-02.07.2024, 09:30-, Lernen im Netz, Unvollstängige
Bestimmungen
Lernen ging gestern ins Netz. Große Erleichterung und Befriedigung.
Vor dem Thema habe ich mich rund 10 Jahre gedrückt, weil es mir so
riesengroß und unüberschaubar erschien. Dabei wurde mir noch
einmal sehr bewusst: je allgemeiner die Grundbegriffe, desto schwieriger
scheinen Definition zu sein. Seit der Arbeit an den Definitionen der grundlegenden
Dimensionen des Erlebens, aktuell fehlt "nur" noch die Wahrnehmung, ist
mir ein merkwürdiges Phänomen aufgefallen, das ich noch mal gründlich
untersuchen will: Aufmerken, denken, fühlen, empfinden, Motivfelder,
erleben, lenken, lernen, wahrnehmen sind unvollständige Bestimmungen,
weil das WAS fehlt: WORAUF merke ich auf, WAS denke ich, WAS fühle
ich, WAS empfinde ich, WAS möchte ich, WAS erlebe ich, WAS lenke ich,
WAS lerne ich, WAS nehme ich wahr? Heute organisiere ich die Wahrnehmungsseite
und ergänze beim Lernen noch Skinner. Dass HULL in seinem großen
Werk (1943) keine Definition liefert, hat mich total überrascht; es
hielt mich bis heute Nacht um 1:15 fest und heute morgen habe ich es noch
einmal überprüft. Über die unvollständigen Bestimmungen
will ich einen Abschnitt auf der Definitionsregisterseite einfügen.
Ich bin froh, dass sich die Arbeit an den Definitionen einiger sehr wichtiger
elementaren Dimensionen des Erlebens mit der Wahrnehmung dem Ende nähert.
Denn allmählich wird es Zeit, die Printausgabe fortzuschreiben, wenn
sie zu meinem 80. fertig werden soll.
EB73-05.07.2024-00.01-00:14, 13 Min
Ich habe gestern mit großer Zufriedenheit und Freude wahrnehmen
abgeschlossen und ins Netz gestellt. Jetzt stehen noch zwei Arbeiten an:
Körper und Psyche und phantasieren. Mit Erleichterung und Freude konnte
ich feststellen, dass die Seite Körper und Psyche schon ziemlich gut
vorgearbeitet ist. Hier geht es um die Frage, die sich aus den Bearbeitungen
des Energiefragebogens ergab, woher weiß ich, welche Erlebenselemente
vom Körper, welche von der Psyche rühren? Allmählich sehe
ich wieder Land (Print Schreibe-Land). Sehr merkwürdig war, dass ich
das Thema für mein zweites Vermächtniswerk vergessen hatte. Wie
kann man so etwas vergessen? Das ist mir immer noch nicht klar. Ich habe
dann hier in meinen Erlebensberichten gesucht, weil ich dachte, dass ich
etwas so Wichtiges wie ein zweites Vermächtniswerke sicher aufgeschrieben
habe. Es sollte bei den letzten 10-15 dabei sein. Tatsächlich fand
ich nach einigen Minuten suchen einen Eintrag in EB59-11.05.2024
"Neues Thema (Vermächtnis II?): wie funktioniert der Mensch, Kernthema
der Psychologie." Das sollte doch ein ewiges Kern- und Dauerthema der Psychologie
sein. Ich habe dazu aber so gut wie nichts gefunden. So keimte die Idee
eines Vermächtnis II Werkes zum Thema wie funktioniert der Mensch?
EB74-05.07.2024,13:10-13:20, 10 Min Besondere Achtsamkeit
beim Kiesertrainung heute.
Weil ich gerade an der Seite Körper-Psyche arbeite, habe ich heute
beim Kiesertraining besonders auf meine Empfindungen geachtet. Es sind
11 Geräte mit ingesamt 24 Minuten reiner Trainingszeit. Die bei jedem
Gerät spürbaren Empfindungen bei Trainieren habe ich nahezu sämtlich
der Körperquelle zugeordnet. Die gelegentlichen Reflexionen, wie es
geht ordne ich der Psychequelle zu, wobei es aber um die körperlichen
Empfindungen geht. Bin ich zu schnell, in einer oder in beiden Richtungen?
Ist die Ausführung sauber? Schaffe ich die 120 bzw. bei einer Maschine
die 240 Sekunden? Merke mit zunehmender Ausführungszeit, dass es schwerer
wird? Inwieweit spielt das Wissen, ich betätige mich körperlich
und strenge mich an, eine Rolle? Es ist ja klar, wenn ich körperlich
etwas mache, dann merke ich das an Körperempfindungen. Zum Kiessern
muss ich micht überwinden. Meine positive Einstellung ist gefestigt.
Ich weiß und erfahre es auch immer wieder, dass das Kiesetraining
wichtig und gut für Körper und Geist ist.
EB75-06.07.2024,
Gibt es so etwas wie ein Zugehörigkeitserleben. Diese Erleben
hat seine Quelle in meinem Körper; dieses in meinen Gedanken und jenes
kommt von einem Ereignisse. Der Knall, den ich hörte, kommt nicht
aus meinem Mköpßfer, nicht aus meine Psyche, sondern von außen,
von der Straße. Zugehörigkeit hört sich für eher kognitiv,
wie ein Urteil an, aber nicht wie ein Erleben, allenfalls erlebenk
oder erlebeng., ein "es-ist-so-Erleben".
EB76-07.07.2024, 8:40-08:50, 10:10-10:25; 11:55-12:00,
25 Min. Wechselbad der Gefühle.
Am Vormittag erlebte ich ein Hochgefühl, das mich stundenlang
beflügelte, als ich feststellte, dass die IP-GIPT Seiten in dem Wayback
Archiv ziemlich vollständig erfasst sind. Das ist insofern sehr wichtig
und hilfreich, weil ich für die print Ausgabe Die Psychologie des
Erlebens und der Erlebnisse konstante URLs für meine Dokuverweise
brauche, damit, wenn ich in ein paar Jahren nicht mehr lebe, und die Seiten
über allinklusive nicht mehr zur Verfügung stehen, die Zugriffe
noch funktionieren. Ich habe dem Internetarchiv gleich mal 100 $
gespendet. Merkwürdigerweise hatte ich gegen Abend mal wieder einen
"Blues" (negatives Erleben), weil es gar so viel ist und kein Ende zu nehmen
scheint. Vielleicht aus Kontrast zum überaus positivem Vormittagserleben,
wo ich auf einer Welle der Erleichterung und Freude schwamm?
Ich entdeckte, dass ich Baudouin
noch gar nicht im Netz hatte, was ich nicht verstand, weil er seit ca.
6 Wochen fertig war. Im Lauf des Ergründens dämmerte mir, dass
ich mit der Definitionsseite zur Aufmerksamkeit, die ich für die wichtigste
Grundfunktion bei der Hypnose halte, noch nicht fertig war. Ich sah dann
sehr erfreut, dass ich zur Haupt- und Verteilerseite Erleben der Hypnose,
schon einiges zusammengetragen hatte (Bleuler,
Wundt,
Forelüber
ihre Eigenerlebnisse in der Hypnose), aber die Seite noch nicht fertig
war. Da die Baudouin Seite aber auf die Hauptseite der Hypnose verweist,
war nun klar, weshalb die Baudouinseite noch nicht im Netz war. Ich nutzte
die Gelegenheit, Baudouin
zu um das Thema Aufmerksamkeit zu ergänzen. Es fehlen noch die
Seiten Körper und Psyche, Phantasieren (Definitionsregister), Ruhe
und Ruhen, Hypnose, Baudouin, (Erlebnisregister). Die sollten bis zur
Wochenmitte abgeschlossen werden können und dann gehts (endlich weieder)
ans Weiterschreiben für die print-Ausgabe.
Der philosophische Stammtisch
der Sternstunde Philosophie auf 3sat war heute sehr interessant. Er
hatte mich angeregt, die Seite das Erleben der Ruhe und des Ruhen
im Erlebnisregister einzurichten.
So und jetzt gehen wir zum Bismarckstraßenfest,
auf dem wir gestern schon zwei Kurzbesuche abstatteten (Irmgard hatte mit
ERRoR Sambaauftritt) und freuen uns auf das Klezmaniaxx-Konzert (11-12),
weil wir die Klezmermusik so mögen. Der "Blues" von gestern Abend
ist wieder vorbei und ich bin guter Dinge für mein Werk. 11:55: Zurück
von Klezmaniaxx, die machen gerade Pause, notierte assoziative Eindrücke
zum Musikerleben: lebending, furios, leicht, flott, beschwingt, schnell,
fröhlich, Lebensfreude, unverkennbar, typisch, anregend, heiter, Stimmung
(11:35), gelegentlich aufheizend, sehr rhythmisch (11:45).
_
EB77-25.07.2024, insgesamt ca. 30 Min
Notizen beim Warten auf das Mittagessen:. Gewundert, weil Befinden
nicht definierbar. Scheint ein Grundbegriff zu sein. Grundbegriff? Wann
ist ein Begriff ein Grundbegriff? Was macht einen Begriff zu einem Grundbegriff?
Steht am Anfang, geht vielen anderen voraus, wird von vielen anderen gebraucht.
Befinden stellt praktisch kein Verständnisproblem. Sich befinden deutet
auf eine Orientierungsfrage hin. Befinden ist die letzte Definition die
für mein Buch gebraucht wird. Wenn diese fertig sind, bietet sich
ein Vergleich an nach Kriterientabelle.
Notizen auf dem Balkon. Erleben liefert direkt und unmittelbar, wie
es einem geht. Sich in einem Irrtum befinden. Sich im Aufwind befinden.
Sich im Abstieg befinden. Mit geht es gut. Gehen. Manchmal sagt man auf
die Frage, wie es gezht: es geht oder es geht so. Befinden scheint nicht
nur ein punktueller Zustand zu meinen, sondern auch einen Verlauf oder
Vorgang. Aber man sagt nicht, man befinde sich im Jucken oder in einem
Juckzustand, sondern man sagt: es juckt. Kann man mit Befinden doppeln,
ohne das sich am Sachverhalt etwas ändern? Ich befinde mich in einem
guten Zustand. Zub was braucht man hier befinden - außer vielleicht
grammatikalisch.
Definition schwierig. Aber über Prädikatorenregeln mit Beispielen
und Gegenbeispielen sollte sollte befinden für fast alle verständlich
einführbar sein.
Die letzte Zeit habe einige Zeit neben Körper
und Psyche (Abschluss 15.7.24), dem Empfinden
(Abschluss 19.7.24) und mit dem Beweisthema verbracht, u.a. mit Bender/Röder/Nack
1981. Ich wundere mich, dass der letzte Bericht über zwei Wochen
her isr.
Gestern habe ich mein erstes graphisches Modell für einen Einzelfallbeweis
entwickelt. Das war ein großer Schritt zum Thema Einzelfallbeweis
und Einzelfallwahrscheinlichkeit. Das wird noch einige Zeit kosten.
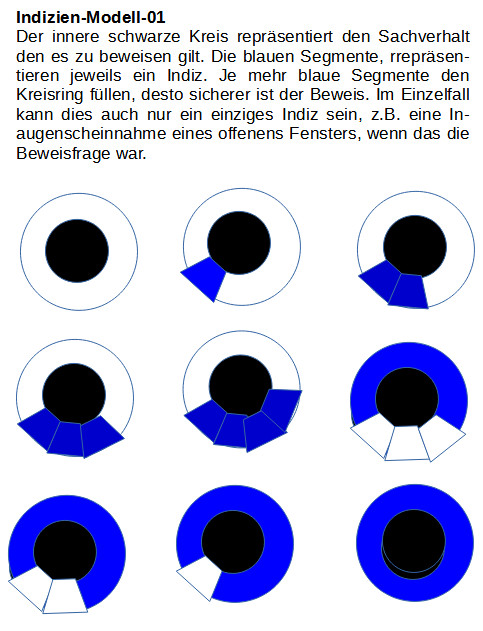
Die letzten dreieinhalb Wochen sind gut gelaufen für das Projekt,
fast jeder Tag ein Erfolg. Aktuell muss ich nach der Empfindung nur noch
eine Definition, das Befinden, ausarbeiten. Das sollte in Kürze zum
Abschluss kommen. Auch mit der Sammlung aller 26 Arbeiten von Leonhardt
zum psychologischen Beweis könnte ich zum Wochenende fertig werden.
Leonhardt gibt mir eine Rätsel auf, warum der Suchbegriff "sugges"
Auch das Wetter und der Balkon haben mitgspielt. Es gibt mir gut, ich war
zufrieden, manchmal sogar außerordentlich. Aber ich werde den Titel
Die
Psychologie des Erlebens ergänzen mit Ein Entwurf.
EB78-01.08.2024, 14:35-14:52, 17 Minuten. Dissoziation,
Leonhardt, Schlaf.
Gedanken beim Warten aufs Essen beim Griechen im Garten: Dissoziationsmerkmale:
- bewusst - nicht bewusst.
- aktivierbar - nicht aktivierbar.
- wirksam - nicht wirksam
- absichtlich - unabsichtlich.
- im selben System - anderes System
- vollständig - unvollständig
Ich bin mit der Erstellung der Seiten Bewusstsein und Dissoziation beschäftigt.
Bei Fiedler ist mir aufgefallen, dass er beim allgemeinen Dissoziationsbegriff keine Definition im Sachregister anführt, bei den speziellen aber schon.
Ich ganz guten Mutes, dass die Ausarbeitungen zum Bewusstsein und zur Dissoziation gut werden.
Die Sammlung Leonhardt mit 26 Arbeiten zum psychologischen Beweis in PDF wurde gestern abgeschlossen und steht zur vollständigen Analyse zur Verfügung.
Nachtschlaf 31.7-1.8.2024: Gegen 0:15 zum Schlafen gelegt. Nach kurzer Zeit eingeschlafen. Durchgeschlafen bis ca. 7:30, entschlossen Blase zu leeren und noch ein gutes 3/4 Stündchen weiter zu schlafen oder zu dösen. Gegen 8:15 aufgestanden. An keinen nennenswerten Traum erinnert. Gute Einstellung zum Tag vorgefunden.
EB79-11.08.2024-14:30-14:41, 10 Min.
Heute Arbeit an der Bewusstseinsseite. Neurobiologische Grundlagen
des Wachseins. ARAS, French, Lindsley, Moruzzi, Magoun. Aktualisieren der
Beweisseite, natcode-Register, Erwachen und diese Seite. Damit recht zufrieden.
Einheit des Bewusstseins. Kommt bei Fiedler (1999) Dissoziationen merkwürdigerweise
nicht im Sachregister vor, aber im Handbuch der Psychologie, wenn auch
dünn, aber immerhin einen Sachregistereintrag 616. ChatGPT zum Bewusstsein
befragt. Schwierig in das Begriffschaos der Psychologie eine Grundordnung
rein zu bringen. Heute vormittag schon Spaziergang durch den Schlossgarten
zum Beck (zwei Sansibar-Stangen ggeholz) am Bahnhof gemacht. Recht schön
wie nahezu immer. Ein Hauch von müde umweht die Arbeit. Ich gehe bin
nun fast zwei Jahre intensiv dabei, fast jeden Tag 8 Stunden. Wird Zeit,
dass ich zur print Version vorrücke. Ich würde das Buch gern
zu meinem 80. Geburtstag Ende November in den Händen halten. Ziel:
Ende September sollte es fertig sein ...
EB80-15.08.2024, 09:37-9:45, 8 Min
Am Di, den 13.08.2024, 18:11 konnte ich in den Kalender eintragen:
Definitionsseiten vorläufig abgeschlossen mit den Seiten Bewusstsein,
Dissoziation
und Gedächtnis.
Erleben: Erleichterung, Befreiung und Befriedigung. Habe nun ins Auge gefasst,
die print Version in vier Wochen runter zu schreiben. Irmgard hat auf ihrer
Reise nach Oberhausen Haffners Anmerkungen zu Hitler gelesen und alle erlebnisrelevanten
Einträge erfasst. Darunter so interessante wie Erweckungserlebnis
und Durchbrucherlebnis, die in meiner Liste noch nicht erfasst hatte. Ich
habe daraufhin gestern die Seite Haffner
gefertigt und ins Netz gestellt. Das hat mich angeregt, Hitlers
Mein Kampf nach erlebnisrelevanten Kürzeln zu durchsuchen (ich
fand 30 "erleb" ohne Pseudos. Heute habe ich bei ChatGPT nach Untersuchungen
zur völkischen Persönlichkeit nachgefragt. In meinem eigenen
Denken spielen eine Rolle: dumpf; irrational; einerseits verhärtet,
andererseits sentimental; grob; schlicht; total egoistisch; brutal, alles
verachtend, was nicht das eigene ist oder zu ihm gehört.
EB81-26.08.2024, 22:40-23:15, 35 Min.
Ich arbeite an der print-Ebook-Version. Dabei wurde deutlich, dass
die Tabelle überarbeitet werden muss, um die Erwähnung erleben,
erlebt, Erlebnis besser (vergleichbarer und auswertungsleichter) signieren
zu können. Das drückte erstmal die Stimmung, weil nicht eingeplante
zusätzliche Arbeit anstand. Im Zuge der Überarbeitung ergab sich
die praktische Notwendigkeit, Text klar kennzeichnende Kriterien zu entwickeln.
Hilfreich schien mir in diesem Zusammenhang auch, eine entsprechende Beispielsammlung
für Textanalysen zum Gebrauch der Begriffe erleben, erlebt, Erlebnis
anzulegen. Als ersten Text habe ich die Arbeit mit 12 Fundstellen "Erleben"
von Landsberg über Ibsen ausgewählt. So war ich den ganzen Tag
ab Mittag mit der Entwicklung der Kriterien beschäftigt. Mit zunehmend
gelingender Arbeit besserte sich auch meine Stimmung wieder, wobei inhaltlich
klar war, dass an der Verbesserung der Tabelle aus Dokumentations- und
Auswertungsgründen kein Weg vorbeiführt. Einen weiteren Dämpfer
erhielt ich, als ich bei der Landsberg-Ibsen-Analyse 02 merkte, dass mir
bei den elementaren Dimensionen des Erlebens zwei wichtige fehlen: nonverbaler
Ausdruck und nonverbales Verhalten, obwohl das ja seit der Dibs-Analyse
bekannt war. Störend ist hier, dass der Ausdruck von Erleben ja kein
Erlebensinhalt im Bewusstsein ist, wenn ich etwa die Stirn runzle, die
Augen zusammen kneife, lächle oder zum Fenster gehe. Störend
ist auch, dass manche Kürzel eigentlich Unterpunkte von einem anderen
sind: I25 anfangen und I26 aufhören gehören im Grunde zu I22
Lenken. Nun, die Arbeit hat sich natürlich dynamisch entwickelt. Und
wenn ich immer wieder neue und bessere Signatursysteme entwickelt und angewendet
hätte, hätte ich sehr viel Zeitaufwand in die Indizierungsarbeit
stecken müssen. Das wollte ich nicht, ich braucht Zeit für die
inhaltliche Arbeit. Wichtigstes Kriterium für eine elementare Dimension
des Erlebens war und ist:
| Definition elementare Dimension des Erlebens: Eine elementare Dimension des Erlebens liegt genau dann vor, wenn ein durchschnittlicher Mensch unter Normalbedingungen einen Erlebensinhalt erkennen/wiedererkennen und von anderen unterscheiden kann. |
Die Systematik lässt sich auch später noch vereinheitlichen (homogenisieren).
EB82-29.08.2024 IRS
Zeitdehnung einer Erinnerung * Bäume ausreißen Gefühl
Am Dienstag, den 27.08.2023, ging ich nach dem
Mittagessen mit meinem Kaffee auf den Balkon und mir fiel ein, dass ich
vor genau 2 Wochen den Tag im Zug und auf Bahnhöfen verbracht hatte.
Es kam mir aber vor, als sei das nicht erst vor 2 Wochen sondern vor 2
Monaten gewesen. Das sagte ich Rudi, der mit seinem Kaffee schon auf dem
Balkon war. Rudi bat mich, dieses Erleben aufzuschreiben, was ich heute,
am Donnerstag, den 29.08.2023 tue.
Wir waren heute, Donnerstag,
den 29.08.2023, wegen der großen Hitze, erst relativ spät (nach
18:00 Uhr) auf unserem täglichen Schlossgartenspaziergang. Als wir
auf einer Bank saßen fragte Rudi, ob ich den Erlebensbericht schon
notiert habe, was ich verneinte. Da ich heute Vormittag aber den 2. und
3. Teil unserer Steuererklärungen 2023 versendet habe, erwähnte
ich, dass ich an solchen Tagen immer energiegeladen sei und Bäume
ausreißen könne und die paar Zeilen vom Dienstag heute noch
schreiben werde, was hiermit geschehen ist.
EB83-31.08.2024, 8:50-8.05
Uhr Überprüfen der Tabelleneinträge.
Als ich für die Printversion zur Zusammenfassung
der Forschungsgeschichte des Erlebens kam, wurde mir klar, dass ich die
Tabelle überprüfen, überarbeiten (korrigieren), differenzieren
und vereinheitlichen muss. Ich fasste den Entschluss, für das Auszählen
"erleben" und "erlebt" zusammenzufassen, da es sich bei "erleben" und "erlebt"
nur um zwei unterschiedliche grammatikalische Formen aber nicht um unterschiedliche
psychologische Sachverhalte handelt. Es gefiel mir einerseits nicht, dass
mein Schreibfluss durch diese Arbeit unterbrochen wurde, andererseits völlig
war klar, dass die tabellarische Forschungsgeschichte (1641-20224) ein
Herzsstück der Psychologie des Erlebens ist und stimmen muss. Aber
sämtliche Einträge noch einmal überprüfen, überarbeiten,
korrigieren ist natürlich viel Arbeit, allerdings Arbeit, wenn sie
richtig gemacht wird, für die "Ewigkeit", d.h. einmal richtig gemacht,
kann man sich darauf verlassen und muss sie nicht mehr ändern. Das
ist auch ein sehr schönen Arbeitsgefühl. Und es war klar, dass
die Überprüfung sein muss, also alternativlos ist. Das erleichtert
es. Also keine falsche Müdigkeit und ran!
Ich mehr die letzten Tage, dass gegen 22:00 Uhr
nicht mehr viel geht, dass ich arbeitsmüde bin.
EB84-06.09.2024, 15 Min.
Heute ging die 12. Version der Hauptseite Psychologie des Erlebens
mit dem Axiom des Erlebens ans Netz (Zufriedenheit, Freude, gutes Gefühl):
die Grundtatsachen werden klarer.
.
Aber auch Verwunderung und ein leichtes Unbehagen, weshalb die Einsichten
dieser Tage so lange gedauert haben. Lipps habe ich ja schon im Oktober
2022 ausgewertet und erst jetzt operational ganz klar vorliege: untersuche
jeden ausgewählten Erlebensinhalt auf ee und eg.
Sowie: jeder Text oder jedes Sprechen beeinhaltet Erleben. Hier stehen
jetzt einige Beispiel- und Musteranalysen an.
An einer Beispielauswertung Papillon,
S.138 wurde die Methodik der direkten Erfassung spezifischen Erlebens
nach elementaren Dimensionen, die im Zuge dessen auch erweitert
wurden.
Erleben := Wertung eines Sachverhaltes.
Fragen: Ist alles was geschrieben ist oder gesagt wird Ausdruck von
Erleben?
Auch mit derTabelle ist es vorwärts gegangen und es zeigte sich,
dass eine Übeprüfung der Tabelleneinträge notwendig ist.
Aktuell bin ich bei Ditlhey18. Nachher hole ich aus UB Band 24.
_
EB85-19.09.2024, 11:32-11:44, 12 Min
Tabellenprüfung gestern abgeschlossen
Gestern haben ich die Einträge in die Tabelle zur Forschungsgeschichte
Erleben und Erlebnis um 19:35 Uhr abgeschlossen. Nach mindestens 14 Tagen
Maloche Erleichterung, Befriedigung und Zufriedenheit. Die Überprüfung
zwar sprichwörtlich alternativlos. Und es zeigte sich auch, dass die
Einträge sehr viele Fehler und Lücken enthielten, die so
nicht bleiben durften. Da es sich schätzungsweise zwischen 200 und
300 Einträgen handelt. habe ich überall, wo ich die Übersicht
zu verlieren drohte, mit Datum eingetragen, wann ich die Prüfung vorgenommen
habe. Die Prüfung der ersten Tabelle hat ca. ein Woche gebraucht,
die Tabellen 2-5 gingen dann schneller. Meine Frau wird auch noch einmal
drüber schauen, so dass am Ende eine solide, prüfbare und weitgehend
fehlerfreie Dokumentation der Forschungsgeschichte von 1641-2024 vorliegend
sollte, die auch formal gut ausgewertet kann. Hierzu will ich aus der Tabelle
der Internetseite eine ergänzungsfähige Exceltabelle erstellen,
die man dann auch sortiert auswerten kann, damit die Printversion Psychologie
des Erlebens - Ein wissenschaftlicher Entwurf eine solide und fundierte
empirische Datenbasis hat. Es wird zeitlich eng, aber die zentralen Ausarbeitungen
immer "runder".
Nachtrag: Neulich fiel mir in der Hochsommerphase
mal auf, dass die vorgangegenangen Regenwochen weitgehend aus meinem Bewusstsein
und der Erinnerung verschwunden waren.
EB86-21.09.2024, erleben3
16 Kneipenchöre auf dem Schlossplatz zum Abschlusssingen: FREIHET!
In Erlangen fand im E-Werk am 20.09.2024 ein Kneipenchorfestival statt
(wayback):
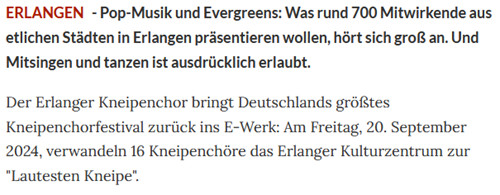
Wir hatten uns zwei Karten für Freitag besorgt besorgt und
freuten uns über die informelle Ankündigung, dass am Samstag
alle 16 Chöre auf dem Schlossplatz zum Abschied singen sollten. Nach
unserer ersten Information sollte dies um 11 Uhr sein. Wie es scheint,
wir waren um 11 Uhr da, war das eine Fehlinformation, konsistent damit,
dass in der Zeitung auch nichts stand. So war es nur ein vorgezogener Mittagsspaziergang,
aber auch eine Enttäuschung. Dann hieß es, um 14 Uhr, aber auch
da war das Abschlusssingen noch nicht. Schließlich sagte uns Ingrid,
die ein Programm dabei hatte, dass der Abschluss um 17:15 Uhr auf dem Schlossplatz
sein werde. Und das stimmte dann auch. Mit dem Lied FREIHEIT
schlossen die 16 Kneipenchöre das Festival ab. Ein kurzes, aber intensives
Erlebnis. FREIHEIT ist ein hoher Wert,
aber ganz sicher nicht der einzige, der zählt - und es wird auch viel
Missbrauch
betrieben. Schön war zu hören, dass die Kneipenchöre für
die Grundwerte unserer Gesellschaft stehen und auch eintreten..
Das Kneipenchorfestival ist ein schönes und
typisches Beispiel für erleben3,
also ein besonderes Erlebnis (ein event), worauf manche ihren Erlebnisbegriff
beschränken. In der Psychologie ist erleben aber alles, was bewusst
oder nicht bewusst innerlich wahrgenommen wird (erleben2)
und nicht nur auf besondere Erlebnisse beschränkt. Der hohe Wert des
Singens für das Erleben wurde von den 16 Kneipenchören unterschiedlich,
aber eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht. Ich nahm das Festival zum Anlass,
eine Seite Singen im Erlebnisregister einzurichten und für die Tabelle
auch Einträge von Gedichten und Liedern vorzusehen mit einer entsprechenden
Bezugsseite im Erlebnisregister Literatur, weil das ja auch mächtige
Quellen für das Erleben sind. Singen wird gelegentlich sogar als Heilmittel
gegen Angst und mehr noch bei Depression erfolgreich angewendet. ChatGPT
äußert sich am 21.09.2024 wie folgt:
- "Singen als Therapie, auch bekannt als Stimm- oder Gesangstherapie,
wird zunehmend als therapeutische Methode anerkannt, um sowohl psychische
als auch körperliche Gesundheitsprobleme zu behandeln. Hier sind einige
der wichtigsten Erkenntnisse und Ansätze dazu:
- Atem- und Lungengesundheit: Das kontrollierte Atmen während des Singens verbessert die Lungenkapazität, die Atemmuskulatur und die Sauerstoffversorgung. Menschen mit Atemwegserkrankungen wie COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) können durch Singen ihre Atemkontrolle verbessern .
- Herz-Kreislauf-System: Studien zeigen, dass Singen den Blutdruck senken und den Herzschlag regulieren kann. Es reduziert Stresshormone wie Cortisol und fördert Entspannung .
- Immunsystem: Es gibt Hinweise darauf, dass Singen das Immunsystem stärkt, indem es die Produktion von Antikörpern wie Immunglobulin A fördert.
- Stressabbau: Singen kann Stress und Angst abbauen, da es Endorphine (Glückshormone) freisetzt. Viele Menschen berichten, dass sie sich nach dem Singen emotional befreit und entspannt fühlen.
- Depression und Angst: Gesangstherapie wird auch verwendet, um Depressionen und Angstzustände zu lindern. Das Singen in Gruppen, wie in Chören, kann ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit fördern und so soziale Isolation bekämpfen.
- Emotionsregulation: Das Singen hilft oft, Emotionen auszudrücken und zu verarbeiten, die sonst schwer zu kommunizieren wären. Dies kann besonders für Menschen mit Traumata oder emotionalen Blockaden hilfreich sein.
- Stimulation des Gehirns: Singen aktiviert mehrere Bereiche des Gehirns gleichzeitig, insbesondere die Regionen, die mit Sprache, Bewegung, Emotion und Gedächtnis in Verbindung stehen. Es hat sich gezeigt, dass Singen bei Patienten mit Demenz oder Alzheimer positive Effekte auf Gedächtnis und Kommunikationsfähigkeit hat .
- Neuroplastizität: Das regelmäßige Singen kann die neuronale Plastizität fördern, also die Fähigkeit des Gehirns, neue Verbindungen zu schaffen, was bei neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfällen hilfreich sein kann.
- Musiktherapie ist ein breiteres Feld, das verschiedene Formen des Musizierens umfasst (Instrumente, Zuhören usw.), während Stimm- oder Gesangstherapie speziell auf die Stimme und das Singen fokussiert ist. Beide können therapeutisch eingesetzt werden, um emotionale, kognitive und physische Herausforderungen zu bewältigen.
- Chor für Parkinson-Patienten: Es gibt spezielle Gesangsgruppen für Menschen mit Parkinson, da Singen helfen kann, Sprach- und Schluckstörungen, die durch die Krankheit verursacht werden, zu lindern.
- Gesangsgruppen in der Altenpflege: In Pflegeeinrichtungen werden häufig Gruppen eingerichtet, in denen ältere Menschen durch gemeinsames Singen ihre geistige Gesundheit fördern können.
- Traumatherapie: Singen wird auch in der Traumatherapie eingesetzt, um den Heilungsprozess von Menschen zu unterstützen, die schwere emotionale Verletzungen erlebt haben.
1. Physische Effekte
2. Psychische und emotionale Effekte
3. Neurobiologische und kognitive Effekte
4. Musiktherapie vs. Stimmtherapie
5. Anwendungen und Beispiele
Fazit
Singen hat vielfältige positive Wirkungen auf Körper und
Geist, sei es durch die Verbesserung der Lungenfunktion, die emotionale
Verarbeitung oder die Förderung sozialer Bindungen. Es ist eine einfache,
aber kraftvolle Form der Therapie, die von vielen Fachkräften im Bereich
der Gesundheitsförderung empfohlen wird."
EB87-30.09.2024 16:05-16:15, 10 Min. Datenbank, Paraphrase innere Wahrnehmung.
Die Übertragung der Tabellen zur Forschungsgeschichte des Erlebens in die Exceldatenbank, eine elende Maloche, neigt sich glücklicherweise allmählich dem Ende zu. Vorhin habe ich den 300. Übertrag (von 323), Suabedissen und seine Preisschrift von 1808 gemacht. Dabei kam mir der Gedanke, innere Wahrnehmung als Paraphrase für erleben zu nehmen. Nicht immer wird das Wort verwendet, aber der Begriff. So gebraucht Desccartes 1641 denken für Erleben oder Hume 1739/40 (nach T. Lipps) feelings. Dem Phänomen der Paraphrase muss ich noch einen Abschnitt widmen. Ich freue mich jedenfalls auf die vielen Möglichkeiten der Auswertung, die die Übertragung der Tabelleneinträge in die Exceldatenbank mit sich bringt. Mindestens drei volle Arbeitswochen dürfte mich das gekostet haben. Anlass war, die Zusammenfassung der Forschungsgeschichte. Ein paar Spezifikationen stehen auch noch an: man sollte sorieren können, ob die Anzahlen von e und E nur auf Sachregistereinträgen beruhen, auf einem Abschnitt oder aus einem Gedicht oder Lied stammen (in der Regel nur eine Zeile).
_
EB88-03.10.2024 20:58-21:08, 10 Min. TDSB (Tabelle, Datenbank, Seiten, Printausgabe) Abgleiche erforderlich. Axiomatik, Lyrik, ew = ee finden..
Beim Schreiben an der Printausgabe hat sich gestern herausgestellt, dass noch Unterschiede zwischen den spezifischen Seiten eines Autors und den Tabellen bzw. Datenbankeintrag noch Ungereimtheiten bestehen (z.B. bei Hume). Das war ein schwerer Dämpfer, heißt es doch dass noch Abgleiche zu allen Einzelseiten durchgeführt werden müssen. Insbesondere wurde früher oft erlebt nicht einzeln ausgewiesen. Das wird wieder dauern, aber es ist alternativlos, das erleichtert es. Sehr positiv erlebte ich die Fortschritt bei Axiomatik und beim Lyrik-Thema (Erleben von Gedichten). Da ist es vorwärts gegangen. Nachdem Erleben auch als Urtei (Objektsprache) und Wert (Metasprache) interpretiert werden, stellt sich die Frage wie man die Wertungen in Äußerungen finden kann. Das sind alle affektiven Regungen und alle kognitiven Werturteile (gut, schlecht, richtig, wahr, falsch, nützlich, brauchbar, ...).
EB89-06.10.2024,21:47-21:56 Uhr 9 Min.
Abgleiche fertig. Gestalterleben. Axiome.
Die Abgleiche zwischen Tabelle, Datenbank, Seite und Printversion sind
fertig. Vermutlich die letzte große und alternativlose Maloche Das
hat mir höchst positive Gefühle, gute Stimmung und Optimismus
verschafft. Habe heute über Gestalterleben selber nachgedacht nachdem
die Arbeit von Sander 1927 diesbezüglich enttäuschend war. Außerdem
habe ich die Printversion neu konzipiert nachdem das erste große
Kapitel mit der Wort-, Begriffs- und Forschungsgeschichte grob abgeschlossen
war. Die ersten 110 Seiten sind fertig. Ich habe auch einen Abschnitt Axiome
vorgesehen. Da stehen einige Grundsatzfragen an: zu was braucht man überhaupt
Axiome? Die meisten Menschen scheinen dauerhaft ohne solche auszukommen.
Allerdings stellt sich die Frage, ob wie wirklich ohne Axiome auskommen
oder es nur nicht wissen und sie implizit so und so oft gebrauchen. Das
wird sehr spannend werden.
EB90-19-10-2024, Abschlussauswertung Wort-,
Begriffs- und Forschungsgesicht. ACCESS-Datenbank.
L. hat angeboten, eine ACCESS-Datenbank "Erleben" zu erstellen, die
bessere Auswertungsmöglichkeiten als Excel bietet, was mich sehr gefreut
hat, weil die Zählerei für die verschiedenen Kriterien und Bedingungen
von Hand extrem fehleranfällig ist und viel Zeit braucht. Aber auch
der Umgang mit ACCESS braucht Zeit. Manches ist noch nicht gelöst.
Ich habe bislang die Spezifikationen (Schulen und Richtungen) von Psychotherapie
unter den beruflichen Klassifikationen parallel eingeordnet, was mir nicht
gefällt, weil Spezifikation nicht parallel sondern untergeordnet ist.
Das Ganze kam mit der Auswertung nach Berufsgruppen auf. Ich erwäge
nun, die psychotherapeutischen Spezifikationen (Gestalt, GT, Systemisch,
VT, ...) herauszunehmen und eigens einzurichten, habe aber dafür noch
keine Lösung. Ein weitere Problem ist, dass ich von einigen die Spezifikation
nicht kenne und wie Mehrfachspezifikationen gehandhabt werden können.
Das Problem stellt sich nicht für psychotherapeutische Spezifikationen
sondern auch für die Spezifikationen, die die Psychologie bereit stellt
(Allgemeine, Biologische, Differentielle, Entwicklung, Methodenlehre/ Statistik,
Sozial, ...). Außerdem habe ich eine Seite zu Klassifikationsfragen
eingerichtet.
EB91-01.12.2024, Es ist vollbracht, ein tolles
Gefühl!

Foto (Ausschnitt) Uli am 26.11.2024 |
Der Traum, zu meinem 80. Geburtstag die Buchversion Psychologie des Erlebens - Ein wissenschaftlicher Entwurf in den Händen zu halten ging dank kräftiger Unterstützung meiner Frau am 26.11.2024 gegen 11:00 Uhr in Erfüllung. Nach 27 Monaten konzentrierter Arbeit, fast täglich 6-8 Stunden, 30 Tage abgezogen, also rund 7*790 = 5550 Stunden. Hinzu kommen ca. 600 Stunden Lektoratsarbeiten von Irmgard, ohne die es nicht gegangen wäre. Ihr Germanistik- und Psychologiestudium wie ihre psychotherapeutischen Erfahrungen waren sehr hilfreich. Erst im Verlauf der Arbeit wurde mir klar, auf was ich mich da eingelassen habe, was auch im Nebentitel mittlerweile zum Ausdruck kommt: ein Entwurf. Vieles wurde nur angerissen. Trotzdem bin ich zufrieden: endlich hat die Psychologie eine Monographie zum Erleben! Ob und wie sie sich durchsetzt bleibt freilich abzuwarten. |
Endlich wieder frei! Kein Druck mehr. Ich genieße es, wieder Beschäftigungen
und Aktivitäten nachgehen zu können, die mir spontan einfallen.
So löchere ich seit gestern ChatGPT mit Fragen zur Materie und
Haupt- und Grundkategorien zum Aufbau der Welt.
Auch das Geburtstags- und Buchausgabefest im Starclub
mit einigen WeggefährtInnen war bis auf die Akustik eine schöne
Sache, die ich gestern mit meiner kommentierten Bild-Doku zum Abschluss
brachte.
Vorbei! Erstmal durchschnaufen, erholen, faulenzen, nach Lust und Laune
leben und erleben ... Danach vielleicht etwas ergänzen und vertiefen
und vielleicht auch das neue Ufer Wie funktioniert der Mensch? ins
Auge fassen.
Maloche hat für das Erleben auch was für sich - wenn sie
vorbei ist ;-)
EB92-03.12.2024, 11:12-11:18 Uhr
Ästhetisches und Kunsterleben
Nach dem Abschluss der Printversion konnte ich meinen Neigungen freien
Lauf lassen, und das ist ein feines oder schönen Gefühl. Es ergab
sich zwanglos durch das das Eintreffen in der UB der Dissertation Harcour
zum ästhetischen Erleben, dieses Thema noch einmal fundamentaler aufzugreifen.
Was ist ästhetisches oder Kunsterleben genau? Wie könnte man
es fundiert definieren oder hinreichen erklären und beschreiben? Dieses
Thema habe ich gestern intensiv bearbeitet und ich denke, ich bin ein ganzes
Stück weiterkommen als die erste
Version in wayback. Ich bin guter Dinge ästhetisches und Kunsterleben
in den Grundlagen abschließen zu können. Wiederum ein schönes
und befriedigendes Gefühl.
_
EB93-10.12.2024 12:35:12:40, 5 Minuten.
Ästhetisches erleben schreitet voran, langsam aber unaufhörlich
Es geht zwar langsam, aber stetig vorwärts. Die letzten zwei Probleme
könnte ich beim Spaziergang gelöst haben. Ästhetisches Erleben
ist fast überall dabei und ästhetisches gestalten kann den Zweck
haben, eben ästhetisch zu gestalten, so dass es gefällt. Es zeichnet
sich ab, dass ein Thema, das mich seit fast 60 beschäftigt, schon
in meiner Wertheimer und Stockholmer Zeit, nunmehr seinen befriedigenden
Abschluss findet. Das ist ein gutes Gefühl und gefällt ;-) mir.
_
EB94-17.12.2024, 16:00-16:25
Ästhetisches- und Werterleben abgeschlossen.
Nach 58 Jahren Ästhetisches
Erleben abschließend zufriedenstellend gelöst, ein
feines und sehr befriedigendes Gefühl. Das war gar nicht geplant.
Ich hatte einfach Lust nach der Maloche mit Buch Psychologie des Erlebens,
das Thema noch einmal zu bearbeiten. Ich nutzte dabei die Gelegenheit,
einige "neuere" psychologische Arbeiten zur Ästhetik, die in meiner
Sammlung fehlten, zu sichten (z.B. Allesch, Boesch, Halcour, Janker, Leder,
Schurian). Ästhetische Fragen beschäftigen mich seit ca. 1967
stärker und damit auch die Frage: was ist Kunst? Ich hatte seinerzeit
begonnen ästhetische Werke zu sammeln. Das setzte sich noch fast 20
Jahre bis in die Zeit des Offenen
Ateliers fort. Danach herrschte ca. 20 Jahre bis ca. 2003 relative
Ruhe. 2001 wurde das Thema durch die Seite "Galerie"
vorbereitet und 2003 erschien meine Seite "Kritik
moderner Kunst und Ästhetik Oligarchie Grundlagen
und Einführung aus allgemein-psychologischer und integrativer Perspektive",
die 2006 und 2013 jeweils aktualisiert wurde. Im Zuge unserer Theaterrezeption
kristallisierte sich die Idee der reinen
Werk-Interpretation mit einem radikalen Abschied vom Bildungsplunder,
heraus, die wir in unserer Besprechungen der Theaterstücke auch umsetzten.
Dies gipfelte 2016 in meinem Modell zur Psychologie der Werk-Wirkungen.
Das Thema flammte dann bei meinen Studien zur Psychologie des Erlebens
2022-2024 wieder mächtig auf mit der Gretchenfrage: was ist eigentlich
ästhetisches
Erleben genau? Wie lässt sich das wissenschaftlich fassen?
Nachdem ästhetisches Erleben als Wertung aufgefasst werden muss, stellte
sich auch die Frage den Werten, Wertungen, Werterleben und den Werttheorien
erneut. Auch dieses Thema konnte ich im Rahmen der Psychologie des Erlebens
zufriedenstellend abschließen.
_
EB95-18.12.2024 Auf dem Weg zu einer
allgemeinen psychologischen Definitionslehre
_
EB96-23.12.2024 Englische Übersetzung
bei Translated auf den Weg gebracht
Um das Thema Erleben weltweit zu fördern habe ich mich für
eine Übersetzung (maschinelle mit leichter Revision) ins Englische
entschieden. Sie soll bis Ende Januar fertig sein.
_
EB97-29.12.2024 Axiomeseiten Psychologie
ins Netz
Es war etwas eng um die Zeit der Fertigstellung der Printausgabe. Dort
wurde das Thema Axiome in der Psychologie zwar präsentiert, aber es
gab noch keine entsprechenden Internetseiten. Das habe ich diese Woche
nachgeholt und bin vor allem mit dem Axiomregister sehr zufrieden.
- Axiome in der Psychologie (Haupt- und Verteilerseite), darin noch die Checkliste Axiome in der Psychologie.
- Axiomregister Psychologie (fehlt in der Printausgabe).
- ChatGPT zu Axiomen in der Psychologie.
- ChatGPT allgemein zu Axiomen.
EB98-30.12.2024 Neuordnung der Internetseiten nach der Organisation im Buch * Befundregister angelegt * Methodenregister angelegt.
- Teil-1 Die Erforschung des Erlebens und
der Erlebnisse.
Teil-2 Praktische Psychologie des Erlebens.
Teil-3 Wissenschaftliche Psychologie des Erlebens.
- Teil-4 Die Register der Psychologie
- 4.1 Erlebnisregister.
- 4.2 Definitionsregister Psychologie.
- 4.3 Axiomregister in der Psychologie.
- 4.4 Beweisregister der Psychologie.
- 4.5 Methodenregister Psychologie.
- 4.6 Befundregisterr der Psychologie (angelegt, soll 2025 entwickelt werden).
- 4.7 Teil natcode-Register.
EB99-31.12.2024 Fortsetzung Neuordnung
Bei der Neuordnung ist mir aufgefallen, dass es zwar ein Definitionsregister gibt, aber keine spezielle Seite Definitionen in der Psychologie, nur eine allgemeine. Das ist ein Mangel und muss nachgeholt werden, weil fast alle psychologischen Arbeiten hier mehr oder minder starke Defizite erkennen lassen. Das hat ja gerade dazu geführt, das Definitionsregister einzuführen. Eine spezielle Seite Natcodes in der Psychologie fehlt auch. Die Seiten Befunde und Methoden gibt es noch gar nicht, sind aber vorgesehen. Nach dem großen Anstregung der 27 Monate für die print-Ausgabe soll es nunmehr aber ruhiger weiter gehen. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Werk ziemlich zufrieden, auch wenn ich die ersten beiden kleiner Fehler der Buchausgabe entdeckt und dokumentiert habe.
_
EB100-01.01.2025
Aufgaben 2025 Psychologie des Erlebens
- Definitionen in der Psychologie
- Befunde in der Psychologie, Befundregister, Checkliste Befunde, ChatGPT zu Befunden.
- Methoden in der Psychologie, Methodenregister, Checkliste Methoden, ChatGPT zu Methoden.
- Überarbeitung Dimensionen des Erlebens
- Links prüfen und korrigieren.
- Waybackseiten prüfen, insbesondere ob die Bilder alle da sind.
- Englischausgabe Ende Januar auf den Weg bringen.
Wohnhobby kontakfreundlicher gestalten.
Theaterbesuche reaktivieren.
Kleine Ausflüge.
EB101-05.01.2025 a priori unabhängig
von der Erfahrung: was soll das heißen? - Erleben als Meßgerät
Anläßlich der Dokumentation von "Axiom" in Bühler 1933
habe ich in der UB über 70 Kant-Studien runtergeladen, die allerdings
noch richtige Kennzeichnung zu Autor und Titel erhalten müssen. Dabei
ist mir vorhin bei Peters die Formulierung "... sie sind a priori, unabhängig
von aller Erfahrung ... " - wie schob öfter - über den Weg gelaufen,
wo ich mich frage, was das eigentlich genau heißen soll. Erleben:
aufgemerkt, für unklar befunden, Klärungsbedürfnis bemerkt.
Ich dieser Tage eine neue Seite angelegt "Erleben als Messgerät",
wo geklärt werden soll, welche Formen und Varianten des Quantitativen
es im Erleben gibt, was mich ziemlich befriedigt, weil es ein uraltes und
immerwährendes Thema (messen oder schätzen in der Psychologie)
betrifft.
EB102-06.01.2025 Quantitative Unterscheidungen
der elementaren Dimensionen des Erlebens
Die Idee Erleben als Messgerät gesondert zu behandeln hat
heute dazu geführt, dass ich die Seite Elementare Dimensionen des
Erlebens neu in zweite strukturieren: I. Qualitative Unterscheidungen der
elementaren Dimensionen des Erlebens und II. Quantitative Unterscheidungen
der elementaren Dimensionen des Erlebens. Letztere beinhaltet dann auch
die Messtheorie des Erlebens.
EB103-12.01.2025 11:20-11:47
Messtheorie Register angelegt - quantitatives Schätzen im Erleben
Mit der neuen Seite Quantitatives Erleben ist mein altes Thema Messtheorie
wieder reaktiviert worden und ich bin mit großem Interesse dabei.
Die Frage der Messung beschäftigt mich seit meinem Studienbeginn 1971
und jetzt steht sie wieder im Mittelpunkt. Wie zeigen sich quantitative
Schätzungen - messen gibt es ja streng betrachtet nicht - im Erleben,
d.h. ein mehr oder weniger? Es sieht so aus, als gäbe es für
viele Schätzungen nichtbewusste, verinnerlichte "Maßstäbe",
die es uns erlauben sofort, d.h. sehr schnell eine quantitative Einschätzung
abzugeben. Wir messen oder schätzen so schnell, dass wir meist gar
nicht bemerken, wie wir das machen. Klar oder unklar, laut oder leise,
mehr oder weniger vernehmlich, mehr oder weniger intensiv oder stark, all
diese Urteile scheinen mühelos zu gelingen. Eine Art intuitives, spontanes
messen, von dem wir nicht wissen, wie es zustande kommt und funktioniert.
Messfragen sind oft naturwissenschaftlich, physikalisch und objektiv(istisch)
orientiert. Über das quantitative Schätzen im Erleben wissen
wir wenig bis nichts. Hierbei sind mir auch einige neue Frage gekommen:
Brauch wir zum Messen oder weniger genau schätzen unbedingt Zahlen?
Müssen Messungen zwingend auf Gesetzen beruhen? Wir könnte untersucht
un bewiesen werden, dass es nichtbewusste innere Maßstäbe gibt?
Was brauchen wir in jedem Fall, auch ohne Zahlen oder Gesetze, wenn wir
- vor allem im Psychischen - messen oder schätzen? Modelle sind also
gefragt. Das Kern- und Grundmodell könnte ungefähr so lauten:
Aktuelles Erleben verglichen mit entsprechenden Erfahrungen, z.B. Erleben
der momentanen Ausgeruhtheit und Fitness vergleichen mit im Gedächtnis
abgespeicherten Erfahrungen der Zustände ausgeruht und fit. Ae(...)
Vergleich mit Erf(Ae(...)). Eine Forschungsfrage könnte demnach sein,
was kann man für " ... " einsetzen und was nicht? Den Sachverhalt
könnte man in Beziehung setzen zur Ausarbeitung Vom
Signal zum Erleben.
EB104-14.01.2025 Parameter von Bewusstseinselementen
- die "Vermessung" des Bewusstseins
Das Bewusstsein kann als Matrix der Informationskanäle ungefährt
der Ordnung 50-100 dargestellt werden.
- Bewusstseinselement heißt alles, was sich im Bewusstsein befindet und unterscheidend innerlich wahrnehmen lässt (erleben heißt, merken was in einem vorgeht).
- Präsenzzonen im Bewusstsein und Dominanz. Man kann das Bewusstsein z.B. in drei Zonen aufteilen: Zentrum, Umgebung und Rand. Erlebenselemente die sich im Zentrum befinden, kann man auch als dominant bezeichnen.
- Erlebensquerschnitt. Bezeichnet man einen Erlebensquerschnitt als Ganzes, kann man dieses Ganze in Teilganze und Teile differenzieren: G, Tg, T.
- Erkennbarkeit
- Erkennbare Teile mit Namen
- Erkennbare Teile ohne Namen: Wiedererkennung
- Nicht erkennbare Teile
- Komplexität. Eine Erlebensganzheit heißt umso komplexer, aus je mehr Tg und T sie besteht.
- Qualität Die Qualitätsbestimmung für ein Erlebenselement kann je nach Komplexität unterschiedlich sein.
- Quantität Zu jeder Qualität gehört eine Quantität, eine Ausprägung (grundlegende Annahme vom Typ Axiom)
- Jedes Erleben hat eine bestimmte Intensität oder Stärke
- Ausprägungsbestimmung erfordert einen Vergleich mit einem Maßstab.
- Ein solcher Vergleich kann aktuell durchgeführt werden (ist das blau heller als das rot? Ist die Idee neu oder neuer als ...? Hat a Vorrang vor b, ist es nachgeordnet oder nicht entscheidbar?)
- Oder ein solcher Vergleich kann auf gespeicherte Maßstäbe zurüclgreifen
- Modell Nichtbewusste gespeicherte Maßstäbe für den schnellen, spontanen Vergleich.
- Bedeutung und Wichtigkeit.
EB105-25.01.2025, 14:20-14:35 Anregungen zur Wahl 2025, Alles Lügner, Englisch Übersetzung Psychologie des Erlebens, Lage, ChatGPT zu Fragen der Physik u. Wissenschaftstheorie ...
Die letzten 14 Tage habe ich mich überwiegend um Anregungen zur Wahl für attac Erlangen gekümmert an denen sich ca. ein halbes Dutzend Aktive beteiligt haben. Insgesamt sind nun 25 Karten fertig, wovon ich bis zur Wahl täglich einige in Twitter (X) posten will.Heute habe ich mich mit dem Buch "Alles Lügner" beschäftigt, ein Thema das ich seit rund 40 Jahre pflege; zwei Seiten Fragen an ChatGPT zur Physik und Wissenschaftstheorie habe ich ins Netz gestellt. Ein Schock war die von Translated gelieferte englisch Übersetzung von Psychologie des Erlebens mit hunderten von teils unerträglichen Fehlern, völlig unakzeptabel; ich war entsetzt, enttäuscht, verärgert und hege Zweifel, ob die das überhaupt können. Deshalb habe ich Storno angeboten, weil ich nicht mehr damit rechne, dass die das Werke ordentlich übersetzen können. Trump hatte angekündigt, den Ukrainekrieg in 24 Stunden zu beenden, also bis spätestens MEZ 18:00 Uhr (12:Uhr Washingtoner Zeit) 21.01.2021 und heute sind bereits 5 Tage vergangen waren, habe ich mit dem Tweed begonnen: "Trump wanted to end the Ukraine war within 24 hours. It has now been 120 hours. Big mouth?", den ich nun täglich um 24 Stunden angepasst bei X (Twitter) zu senden gedenke. Nunmehr will ich mich wieder verstärkt den wichtigen Ergänzungen (>EB100) der Psychologie des Erlebens zuwenden.
_
EB106-27.01.2025, 18:55-19:10. Eigenes, Fremdes, Erleben des Eigenen und Fremden
Vorhin fiel mir ein, dass Eigenes und Fremdes gar keine richtig eigenständigen, sondern unvollständige Begriffe sind ähnlich wie die meisten elementaren Dimensionen des Erlebens (z.B. wahrnehmen, lenken, aufmerken, erinnern, wünschen, wollen, ...), da man ja nicht weiß, was? Spricht von vom Eigenen und Fremden, was ist da gemeint? Meine Nase ist meine eigene. Mein Erleben ist mein Eigenes. Mein denken ist mein Eigenes. Wie ist es, wenn ich den Satz des Pythagoras denke? Das ist ja nicht meiner, aber, wenn ich ihn denke, ist es mein Gedanke. Ist mein Wünschen auch mein Eigenes oder kann es übernommen sein? Allport spricht von funktionell autonomen Motive, also ursprünglich fremde, die man sich zu eigen gemacht hat und die inzwischen als eigene angesehen werden können. Man spricht von sich zu eigen machen, also etwas ursprünglich anderes oder gar Fremdes mache ich mir zu eigen. Was ist mit einem einfachen Diebstahl, passt da die Formulierung? Schon das Wort aneignen unterstützt dieses Frage. Hier fällt nun auf, es gibt anscheinend Inneres, das mein Eigen ist und es gibt Äußeres, das mein Eigen sein kann, wie etwa mein Fahrrad oder meine Schule. Aber gibt es auch ein Erleben von "Eigenem" bzw. "Fremden"? Woran kann man im Erleben das Eigene oder das Fremde erkennen? Ist die Prädikation Eigenes nicht etwas Kognitives, also erlebenk? Oder gibt es auch ein affektives Erlebena, etwa bei Kindern, wie ihr Spielzeug als ihr eigenes ansehen und wütend werden, schreiben, mitunter toben, wenn es ihnen jemand wegnimmt? Was erlebe ich bei diesem Erleben zum Eigenen und Fremden? Es sind meine Gedanken und damit Eigenes. Aber ein Eigenes-Erleben kann nicht erkennen. Merkwürdig oder ganz normal? Eigenes hat für mich aktuelle keine eigene ;-) Erlebensqualität.
_
EB107-28.01.2025, 10:16-10:30 Psychologische Sachverhaltstheorie des Erlebens
Gestern spät Abends fiel mir auf, dass auf der Seite Allgemeine und psychologische Sachverhaltstheorie bislang nur eine allgemeine Sachverhaltstheorie entwickelt wurde, aber keine Psychologische Sachverhaltstheorie des Erlebens. (27.01.2025, 23:45 Uhr), also keine systematische Theorie oder kein Modell des Erlebens. Erleben und Erlebnisse kann man auch als Sachverhalte aufassen. Vielleicht ergeben sich Ansätze, wenn ich mich zunächst frage: Was sollte eine systematische Theorie leisten? Brainstorming:
- erklären, was erlebt wird.
- erklären, wieso oder warum es erlebt wird.
- wie kann man das Erleben ordnen / sortieren, bezüglich welche Zwecke und Ziele?
- erklären, was das Erleben bedeutet, z.B. für die verschiedenen Funktionsbereiche:
- was bedeutet z.B. das Erleben von Hunger?
- was bedeutet z.B. erleben, wie es heller wird?
- was bedeutet z.B. das Erleben von Freude?
- wie lässt sich Erleben verdichten, z.B. das Erleben eines Tages oder einer Nacht. Gut, schlecht, gemischt, schwer zu bestimmen wären z.B. solche Kurzverdichtungen. Kann das Erlebenssystem integrieren und mitteln? (>ZUF13)
EB108-29.01.2025-KI Vergleich deepseek/ChatGPT Was weißt Du über das Erleben?
Die Nachricht, dass China eine mindestens ebenso leistungsfähige KI wie ChatGPT mit dem Bruchteil der Kosten - angeblich nur 6 Millionen Dollar gebenüber Zig-Milliarden in den USA - auf den Weltmarkt mitsamt dem Quellcode gebracht hat, schlug weltweit wie eine Bombe ein. Nvidia verlor an einem Tag 600 Milliarden an Börsenwert, der höchste Börsenverlust in der Geschichte der USA, Das regte mich an, einen Vergleich zwischen deepseek und ChatGPT zu starten, und zwar mit Fragen zum Erleben, wo ich mich ja besonders gut auskenne. KI finde ich ohnehin sehr spannend (meine Einstellung zur KI), so dass ich mich an die Arbeit machte, die Antworten der beiden Systeme auf die gleiche Frage: Was weißt Du über das Erleben? zu vergleichen. Ich entwickelte an den Antworten zu dieser Frage die Methode. Das war interessant und nicht vorhersehbar, ob das überhaupt gelingt bzw. befriedigend gelingt. Soeben lese ich eben, dass auch Alibaba ein neues KI-System vorgelegt haben soll, dass besser als deepseek und ChatGPT sein soll.
EB109-02.02.2025 Aufnahmestopp,
Wirklichkeitsbilder,
Lüge
und Manipulation, Ändern, Wandel und Stabilität,
Die Wirklichkeitsfrage spielt besonderes im Ideologischen und Politischen
eine wichtige Rolle. Gerade zu Wahlzeiten wird um die politische und gesellschaftliche
Wirklichkeit sehr gerungen und gestritten. Verschärft wird diese Auseinandersetzung
durch Lügen, Fake News, manipulative Behauptungen. Mit Trump und Musk
ist eine neue Macht der angeblichen freien Behauptung entstanden, wonach
jeder meinen und sagen kann, was er will. Der Faktencheck scheint in den
USA gänzlich untergegangen zu sein, was Hand in Hand mit den Erfolgen
der rechtsorientierten Populisten geht. Es steht nicht gut um die Welt.
Das spielte sich heute auch in den Sternstunden Philosophie wieder mit
dem Thema: "Müssen wir Angst vor der Zukunft haben?
- Bange Fragen bestimmen die Gegenwart: Wie stabil sind liberale Demokratien?
Kommt der Krieg auch nach Westeuropa? Was wird aus dem Wohlstand, dem Klima,
den Renten? Soziologe Andreas Reckwitz über den Siegeszug der Moderne,
und warum sich Verlustängste und Fortschrittsglaube nicht ausschliessen.
Trug die Zukunft einst das Versprechen eines besseren Lebens in sich, trauen derzeit immer weniger Menschen dem Fortschrittsversprechen der Moderne. Vielmehr prägen Verlustängste den Zeitgeist. Sie betreffen die Furcht vor Wohlstands- und Statusverlust, vor dem Verlust der ökologischen Grundlagen unserer Lebensform, nicht zuletzt vor dem Verlust der liberalen Demokratie im Angesicht populistischer Manipulation und autoritärer Kriegslust. Welche faktische Basis haben diese Ängste? Welche politischen Auswirkungen? Und nicht zuletzt: welche möglichen Therapien?
Fragen, die der Soziologe Andreas Reckwitz zum Ausgangspunkt einer umfassenden Theorie des Verlusts gemacht hat. In seinem jüngsten, viel gepriesenen Buch «Verluste – Ein Grundproblem der Moderne», analysiert er die Bedingungen derzeitiger Verlusterfahrungen. Und legt gleichzeitig einen Grundwiderspruch frei, der die westlichen Fortschrittsgesellschaften seit mehr als 250 Jahren prägt und belastet. Im Gespräch mit Wolfram Eilenberger zeigt Reckwitz, weshalb Fortschrittsglaube und Verlustängste einander keineswegs ausschliessen. Und deren Analyse sogar den Weg in eine geklärte, lebenswertere Moderne weisen können."
Den halben Tag durcheinandergebracht haben Probleme mit der Elster-Zertifikatserneuerung. Die Vergleiche von deepseek und ChatGPT führe ich fort. Es ist 14:54 Uhr, die Sonne scheint, daher steht jetzt erstmal unser Sonntagsspaziergang an.
_
EB110-06.02.2025 11:31-11:42 Wachstumsfragen, Lang-Beweis
In dieser Woche habe mich sehr mit Wachstumsfragen beschäftigt, angeregt durch die Arbeit Rainer Langs, der m.E. einen klaren und überzeugenden ökonomisch-statistischen Beweis erbracht hat, dass das (BIP) Wachstum 1987-2009 nur den Unternehmensgewinnen und Vermögenden, aber nicht den ArbeitnehmerInnen genutzt hat. Solche. Daten hatte ich schon lange gesucht. Ich habe diese Daten dann der KI von deepseek und ChatGPT zur Analyse vorgelegt, insbesondere was die Gründe für diese Entwicklung waren. Sehr zufrieden war ich mit meinen bisherigen Arbeiten zum Wachstum. Ich habe nun begonnen, die Basisdaten langer Zeitreihen selbst zu organisieren und zu besorgen und diesbezüglich auch destatis angeschrieben. Von denen kam heute ich informative Mail. Ich bin sicher, dass die gebetsmühlenartige Wachstumspeitsche reine Propaganda der LobbyistInnen der Reichen und Besitzenden ist. Es gehört eine grundsätzliche Neuorientierung her. Das Mantra des immer mehr, der Wachstumswahn hat uns die Klimakrise und die drohende Vernichtung der Lebensgrundlage der Erde eingebrockt unter maßgeblicher Führung der Wirtschaft und ihrer PropagandistInnen. Er Kampf um die Erde könnte schon verloren sein, weil die Kipppunkte erreicht sind.
_
EB111-22.02.2025, 09:05-09.20 "Befundologie" des Erlebens, Beweisskizzen * Tag vor der Wahl, Trump,
Ich habe die Woche über am Befundthema gearbeitet, die Haupt- und Verteilerseite eingerichtet, die Checkliste ausgearbeitet, das Befundregister angelegt und hier als erste Präsentation Johann Gottlob Krügers Versuch einer Experimental-Seelenlehre 1756 für das Befundregister erarbeitet. Am Anfang war es schwierig, aber es wurde immer besser bis gestern schließlich 32 Befundkriterien so ausgearbeitet waren, dass jeder Befund mit oder an ihnen dokumentiert werden kann. Zunächst habe ich für den Anhang der 133 Fallberichte ein Inhaltsverzeichnis erarbeitet, um einen Überblick zu bekommen, welche Befunde sich aus den Berichten ergeben könnten. Gestern machte ich mich dann an die Befunde der 14 Kapitel des Hauptbuches. Hier ergaben sich nach einigen Bearbeitungen erste Beweisfragen: Wie lässt sich erinnern oder vorstellen beweisen? Für einige dieser Beweistypen scheint das Schema der Beweisskizze 1) definieren, 2) zeigen, dass der Definitionsinhalt existiert zu gelten. Damit war ich dann wieder beim Beweisthema angelangt und habe in der Checkliste Beweis und beweisen die zwei Beweisskizzen Erinnerungsbeweis, Vorstellungsbeweis eingefügt. Zwischendurch hatte ich einen leichten "Befundologie-Blues" (Beeinträchtung des Erlebens), weil das Thema so ausufernd ist. Bei genauer Überlegung können alle Ereignisse und Geschehnisse als befundfähig betrachtet werden. Das wäre täglich Aber-Billionen. Alles, was erlebt werden kann, kann im Prinzip zu einem Befund formuliert werden. Ich hoffe, dass ich da eine Grundordnung rein bekommen.
Ansonsten nahm die Wahl großen Raum (Wahlkartenaktion) ein. Sehr erschreckend auch die Verbrüderung Trumps mit Putin.
_
EB112-23.02.2025 10:46-10:53 Wahlsonntag * Wort und Begriff *
Anläßlich der Auswertung von Johann Gottlob Krügers Versuch einer Experimental-Seelenlehre 1756 am 22.02.2025 einige Ergänzungen bei den elementaren Dimensionen des Erlebens nachgetragen und neue Version vom 22.02.2025 gebildet: wissen bei I06 (Gedächtnis, Erfahrung), abwägen bei I07 (denken) und neue I45 (auswählen, Auswahl, Wahl). Krüger gebraucht das Wort Erleben nicht, aber natürlich in vielfacher Weise den Begriff. Um auf diesen wichtigen Sachverhalt leicht verweisen zu können, habe ich in meiner Grundlagenarbeit Begriff des Begriffs eine Zwischenüberschrift Wort und Begriff eingefügt. Für die Bearbeitung Krügers habe ich ein gutes Gefühl, die Arbeit wird immer "runder", meine Metappher für besser oder gut. Im Zug der Begriffsarbeit und Beweisen hat sich erneut die Frage gestellt, wie gezeigt werden kann, wie Allgemeinbegriffe existieren. Der Univeralienstreit, der mich nun schon seit Jahrzehnten begleitet, lässt abermals grüßen. Hier steht ein neuer Abschnitt auf der Definitions- und Beweisseite an.
Wahl: Unser Wunschergebnis, für das wir Sekt mit Orangensaft bereit gestellt haben, ist: Die beiden ICH-Parteien, FDP und Wagenknecht draußen, Linke rein. 18: Uhr: sieht gut aus, hoffentlich hält es. Die CumEx SPD hat bekommen, was sie verdient hat. Wenn sie so weitermachen, das nächste Mal einstellig.
_
EB113-26.02.2025, 08:20-8:30 Uhr. Umorganisation Definitionsseiten, Translaetd Flop, SPD,
Bei der Umorganisation der Definitionsseiten ist die wichtigste Änderung die Trennung des Definitionsregister in zwei (methodisch und material). Insgesamt sieht die Neuorganisation nun wie folgt aus:
- Haupt- und Verteilerseite mit grundlegenden Ausführungen, Zusammenfassungen und Links zu den Definitionsthemen.
- Methodisches Definitionsregister (Definitionslehren der PsychologInnen).
- Materiales (inhaltliches) Definitionsregister, Sammlung von Beispielen. (Basis Wörterbuch oder Lexikon)
- Checkliste Definitionen in der Psychologie.
- KI zu Definitionsfragen in der Psychologie.
- KI zu allgemeinen Definitionsfragen.
SPD. Es ist mir unbegreiflich, dass die gesamte SPD Spitze nach dem Debakel mit CumEx Scholz, die verantwortet, dass Pistorius nicht zum Zuge kam, nicht zurückgetreten ist. Die haben keinerlei Anstand und nichts begriffen. Anscheinend wollen sie einstellig werden. Unglaublich!
11:55-12:00: Referenzierungsbeweis Beweis, dass ein Sachverhalt in der Welt existiert, wo und wie man ihn finden kann. Zwischen referenzieren und beweisen gibt es einen engen Zusammenhang. Referenzieren bedeutet in der Begriffs- und Definitionslehre, dass man angibt, ob ein Sachverhalt in der Welt existiert und wie man ihn finden kann. Zeigen, ob es diesen Sachverhalt gibt und wie man ihn finden kann, ist nichts anderes als ein Beweis. Das ging mir die letzten Tage ab und zu durch den Kopf. Und heute war es denn so weit, dass ich einen Eintrag im Wissenschaftsglossar gemacht habe. Muss auf den Definitions- und Beweisseiten noch einen eigenen Abschnitt bekommen.
_
EB114-03.03.2025, 09.10-09.20 Neuorg Defseiten, Hamburgwahl
Gestern habe ich Neuorganisation der Definitionsseiten durchgeführt. Die Neuorganisation fühlt sich ziemlich rund an. Das Grundgerüst steht für alle, aber bei der materiale Definitionsregisterseite muss noch nachgearbeitet und ergänzt werden. Ich habe noch folgendes an den Abschnitt Referenzieren angehängt:
- natcode Formel: (natcode bewusst(natcode erleben(natcode Sachverhalt)))
- natcode Neuorobiologische Grundlagen:
- Erleben:
- Konfundierung:
Die Hamburgwahl sehe ich nach dem AfD-Schock der Bundestatswahl sehr positiv.
EB115-14.03.20225 Befundregisterseiten *
Grundgesetzänderung Schuldenbremse.
Die Definitionsregisterseiten sind abgeschlossen. Ich arbeite nun an
den Befundregisterseiten. Hier soll idealiter das gesamte Wissen zum Erleben
erfasst und geordnet werden. Hierzu sind verschiedene Seiten sinnvoll:
- Theorie Befundologie: Befunde, Theorien, Theoreme und Sätze des Erlebens in der Psychologie.
- Erfassung/ Dokumentation: Register der Befunde, Theorien, Theoreme und Sätze des Erlebens in der Psychologie.
- Checkliste zu Befunde, Theorien, Theoreme und Sätze des Erlebens in der Psychologie.
- Befunde des Erlebens im Versuch einer Experimental-Seelenlehre 1756 von Johann Gottlob Krüger.
- KI zu Befunden des Erlebens.
CDU/CSU, SPD & Grüne zur Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse geeinigt. Ich bin kein Grüner (sondern ein "Weißer"), aber hier verdienen sie große Anerkennung.
EB116-16.03.2025 Die Erlebenskette:
Vom Sachverhalt zur Kommunikation
 |
Bei der Arbeit am Befundregister gab es gestern einen Durchbruch. Das Schema scheint nach meinem ersten Eindruck auf alle Erlebenspro- zesse anwendbar. Im Moment fühlt es sich ziemlich rund an, muss aber noch an einigen Beispielen genau geprüft werden. |
Politisch-psychologisch habe ich mir einige
Essentials zu Trump vorgenommen und als Tweedgraph aufbereitet.
_
EB117-18.03.2025 Erlebensmodelle - Nachträgliche
Übertragung meiner kurzen Notizen auf dem Balkon.
Wie Kann Erleben modellhaft beschrieben und dargestellt werden (Flußmodell;
Wurst- und Scheibenmodel; Pizzamodell)? Ich habe heute Nachmittag auf dem
Balkon einige Übungen gemacht: Augen zu - Augen auf. Bei Augen auf
dominiert die Wahrnehmung der Umgebung. Bei Augen zu ist erstmal nichts.
Ich höre Umgebungsgeräusche, ob ich die Augen zu oder auf habe.
Ich habe mit geschlossenen Augen mein Atmen bemerkt. Erlebe meine Stimmung
als neutral, weder gehoben noch gedämpft, weder positiv noch negativ.
Meine Gedanken kreisen um die Erfassunng und Beschreibung des Erlebens,
um ein einsichtige Modell. Vogelgezwitscher. Eine Krähe. Ein
Fahrad fährt unter em Balkon vorbei. Schritt. Blauer Himmel. Sonne
zurückgezogen, es wird kühler. Zeit allmählich einzupacken.
Gibt es Hintergrunderleben? Was ist Schritte hören, eine kurze Figur
im bewussten Erlebensstrom? Erlebensfiguren können sich ausbreiten
und zunehmen, verdünnen und wieder verschwinden. Informationskanäle
zentral oder am Rand positionieren? Ich denke praktische Modell mit Beispielen
sind wichtig für den weiteren Zugang zum Erleben.
Sonstige wichtige Ereignisse: Abstimmung im Bundestag (Grundgesetzänderung).
Trump-Putin-Telefonat, gegen 19:00 noch nichts Inhaltliches gehört.
EB118-03.04.2025, 21:32-21.44 Vertiefte
Arbeit und neue Einsichten zum Befunderleben
Die Arbeit am Befundregister gestaltet sich viel schwieriger und unfangreicher
als gedacht. Aber es gab die Woche über einige wichtige Fortschritte,
so dass ich insgesamt für das Projekt einigermaßen optimistisch
bin. Die systematischer Erschließung eines Erlebensbefundes ist gut
vorwärts gekommen. Heute habe ich mir ein Signiersystem von Worten
in Texten überlegt:
- Wortw in der Bedeutung Wort wird überlicherweise in Anführungszeichen gesetzt, also "Wort"
- Worte in der Bedeutung Erlebensaspekt
- Wortg in der Bedeutung Gegenstands- oder Sachaspekt
- Wortb in der Bedeutung Begriff oder Bedeutungsträger wird in der Regel einfach als Wort gebraucht, z.B. wenn man von einem Baum spricht, sagt man einfach Baum ohne jede besondere Kennzeichnung.
- Grundlegende
Kriterien zur Erlebenscharakteristik
Die Kriterien sollten sich beliebiges Erlenen, einfach oder komplex, anwenden lassen.
aktivierend ........ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- ...... gar nicht, hemmend
angenehm ......... 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- ...... unangenehm
befriedigend ...... 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- ...... unbefriedigend
bewegend ......... 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- ...... gleichgültig
erregend .......... 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- ...... beruhigend
gefallend ............3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- ...... missfallend
intensiv ............. 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- ...... gar nicht
interessant ......... 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- ...... uninteressent
vertraut ............. 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- ...... fremd
wichtig .............. 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- ...... unwichtig
_
EB119 05.04.2025 Bedeutung Allgemeinbegriffe in der Psychologie
Spricht man über z.B. über Wahrnehmung, Gefühle oder Fähigkeiten ist das in der Regel abgehoben von konkreten Individuen aus dem Reich der Lebewesen, Raum und Zeit, Bedingungen und Situationen und spezifischen Wahrnehmungen, Gefühlen oder Fähigkeiten. Es sind extrem weite Allgemeinaussagen die die ganze Menschenheit, Tier und Pflanzenwelt von Anfang bis jetzt und in alle Zukunft betrefffen, im Grunde Aussagen mit einem ungehreuren Anspruch, der in aller Regel nicht begündet wird, so dass sich die Frage stellt, ob und warum man solche Aussagen aus dem Geisterreich der Allgemeinbegriffe überhaupt anerkennen sollte. Bei genauerer Betrachtung erscheint es nämlich reine Phantasterei. Allgemeinbebriffe sind geistige Konstruktionen und als solche gibt es sie natürlich, aber nicht als eigenstänige und unabhängige Geisterwelt reiner Ideen wie Platon meinte.
Merkwürdige ich ich in einigen als bedeutend gelten Sprachpsychologiebüchern (z.B. Karl Bühler, Hörmann, Kainz, Miller, Rapoport) im Sachregister keinen Eintrag "Allgemeinbegriff" fand
Vorgenommen: KI fragen, welche Sätze (beweisbare Aussagen) es zu Wahrnehmungen, Gefühlen oder Fähigkeiten gibt.
Frage der lückenlosen ontologische Einordnung eines Erlebens: HE4 > HE3 > HE2 > HE1 > Individuum > Gruppe > Gesellschaft > Volk/Nation > Erdteil > Zeit > Raum > Ort > Lage > Bedingungen > Situation >...
Frage lückenlose Sachverhaltsabfrage > Zeit > Raum > Körper > Energie > anorganisch > organisch > Mikroorganismen > Pflanze > Tier > Mensch > ...
Balkon 16:24 Uhr: Nachdenken und Notizen über erleben; Erlebenscharakteristika ergänzen. Einfälle: ergreifend, tief, klar, durchsichtig, klärend, klar, gären, brodeln, rumoren, pulsiert, ausbrütend, arbeitet, irritierend, störend, verstörend; Zustand, Prozess, Zentralerleben, Randerleben; steigend, fallend, schwankend, konstant; stark, schwach, gering, wenig;
Mir wird immer klarer: die meisten Aussagen in der Psychologie sind keine Befunde, sondern abgehobene Allgemeinaussagen deren Bedeutung und Gültigkeit sehr fraglich. Ganz wichtig erscheint, die "Befunde" solcher Allgemeinaussagen von den Metbefunden, wie diese Allgm,einaussagen nämlich zu bewerten sind, zu unterscheiden. Aktuelle gibt es mehrere grundlegende Bausstellen. Die einfachste dürfte noch sein, die Aussagen, die die verschiedenen AutorInnen zum Erleben verfasst haben, zu analysieren. Unklar ist mir noch, welche Befundkriterien dokumentiert und geprüft werden sollen.
_
EB120-07.4.2025 wissenschaftliche Aussage und Befund
Im Rahmen der Befundologie hat sich die Vergleichsfrage zwischen wissenschaftlicher Aussage und Befund gestellt. Intuitiv konnte ich da keinen rechten Unterschied erkennen. Ich habe 20 Kriterien für eine wissenschaftliche Aussage entwickelt und dann die KI gefragt, ob sich die Kriterien auch auf den Befund übertragen lassen, was sowohl von DeepSeek als auch von ChatGPT bejaht wurde. Das berührte mich positiv und ich sah meine Intuition bestätigt. Wenn ich aber diese Kriterien an die Psychologie anlege, dann gibt es keine wissenschaftlichen Aussagen, weil die meisten Aussagen nur einen kleinen Bruchteil der Kriterien dokumentieren. Erneut verschlechterte sich mein Bild von der akademischen Psychologie und der in der Psychologie praktizierten Wissenschaftstheorie. Eine kurze Umschau ergab, dass die Wissenschaftstheorie der Psychologie das Thema Was ist eine wissenschaftliche Aussage gar nicht kennt und behandelt. Wie beweist man das (Stichprobe Titel, Inhaltsverzeichnisse, Sachregister/Glossare)?
Weitere Einfälle zu den Kriterien: Für und Wider Erörterung; Gegenargumente; Falsifikation, Sützung, Schwächung, Beziehung zu anderen Aussagen;Beweisskizze; Bedeutung, Interpretation; Anlass für die Aussage oder den Befund; Gewinnung der Aussage (Beobachtung, Exploration, Experimente, Literatur, ...)
Was ist Wissenschaft. Fragen. Was ist das? Woraus besteht es? Wo kommt es her? Wie ist es enstanden? Was kann man damit machen? Welche Eigenschaften hat es?
Einteilung der Methoden: Beobachtung, Experiment, Analyse; trennen (wegnehmen), verbinden (hinzufügen); zusammengesetzt
_
EB121-10.04.2025 Erörterung und 2. Version Kriterien für Aussage und Befund. Besseres Gefühl
ChatGPT hat meine 20 Kriterien für Aussagen (und Befund) in einer Checkliste der 1. Version vom 06.04.2025 wie folgt gruppiert:
- Checkliste zur Bewertung wissenschaftlicher Aussagen über Menschen
[1.Version
06.04.2025]
A. Kontext der Aussage
1. Wer äußert die Aussage? (Name, Institution, Qualifikation)
2. Wann wird die Aussage getroffen? (Datum/Zeitpunkt)
3. Wo wird die Aussage getroffen? (Ort/Institutioneller Rahmen)
4. Was ist das Ziel oder der Zweck der Aussageermittlung?
5. Werden Interessenkonflikte offengelegt?
6. Wird auf ethische Fragestellungen eingegangen?
B. Geltungsbereich der Aussage
7. Zeitraumgültigkeit: Für welchen Zeitraum ist die Aussage
gedacht?
8. Räumlicher Bezug: Für welche Region gilt die Aussage?
9. Für welche Personengruppen ist die Aussage gedacht?
10. Sicherheit: Wird die Unsicherheit oder Konfidenz benannt?
C. Inhaltliche Substanz
11. Welcher Sachverhalt wird ausgesagt? Ist er klar beschrieben?
12. Werden Gründe oder Ursachen für den Sachverhalt genannt?
13. Werden mögliche Fehlerquellen benannt?
14. Werden die Bedingungen der Erhebung mitgeteilt?
15. Wird die spezifische Situation der Datenerhebung beschrieben?
D. Methodische Rückverfolgbarkeit
16. Originalquelle des Aussageinhalts angegeben?
17. Primärquelle der Aussage genannt?
18. Sekundärquelle korrekt angegeben (falls verwendet)?
19. Methode der Aussagegewinnung beschrieben?
20. Wird die Aussage nachvollziehbar begründet?
Es stellen sich aktuell zu dieser Checkliste die Fragen: (1) Gesamteindruck.
(2) Ist die Gruppierung so akzeptabel? (3) Passen die Gruppierungsnamen?
(4) Sind die 20 Kriterien vollständig und ausreichend?
- Zu (1) Gesamteindruck: Die Klassifikationkriterien werden nicht genannt, ziemlich unrundes Gefühl.
- Zu (2) 16, 17, 18 gehören zu A. 4, 5, 6 Eigene Gruppe Interessen
- Zu (3) Hier passt mir nur B. 13, 14, 15 gehören zu B.
Neugruppierung mit Ergänzungen
Weitere Einfälle zu den Kriterien: Für
und Wider Erörterung; Gegenargumente; Falsifikation, Sützung,
Schwächung, Beziehung zu anderen Aussagen; Beweisskizze; Bedeutung,
Interpretation; Anlass für die Aussage oder den Befund; Gewinnung
der Aussage (Beobachtung, Exploration, Experimente, Literatur, ...)
- Neugruppierung
mit Ergänzungen Checkliste zur Bewertung wissenschaftlicher Aussagen
über Menschen [2.Version 10.04.2025]
- Wird der Anlass der Anlass der Aussageermittlung mitgeteilt?
- Was ist das Ziel oder der Zweck der Aussageermittlung?
- Werden Interessenkonflikte offengelegt?
- Wird auf ethische Fragestellungen eingegangen?
- Wird die Methode der Aussagegewinnung beschrieben?
- Werden mehre Möglichkeiten des methodischen Zuganges erörtert (Exploration, Beobachtung, Experiment, Analyse?
- Werden die Bedingungen der Erhebung mitgeteilt?
- Wird die spezifische Situation der Datenerhebung beschrieben?
- Welcher Sachverhalt wird ausgesagt? Ist er klar beschrieben?
- Wird die Aussage nachvollziehbar begründet?
- Werden Gründe oder Ursachen für den Sachverhalt genannt?
- Wird der theoretische Rahmen, die Theorie, in die der Aussage-Sachverhalt fällt, erörtert?
- Wird auf den Stand der Forschung bezüglich der Aussage eingegangen?
- Bedeutung und Interpretation der Aussage
- Wer äußert die Aussage? (Name, Institution, Qualifikation)
- Wann wird die Aussage getroffen? (Datum/Zeitpunkt)
- Wo wird die Aussage getroffen? (Ort/Institutioneller Rahmen)
- Wird die Originalquelle des Aussageinhalts angegeben?
- Wird die Primärquelle der Aussage genannt?
- Wird die Sekundärquelle korrekt angegeben
- Wird korrekt und vollständig zitiert mit Seitenzahl Fundstelle?
- Zeitraumgültigkeit: Für welchen Zeitraum ist die Aussage gedacht?
- Räumlicher Bezug: Für welche Region gilt die Aussage?
- Für welche Personengruppen ist die Aussage gedacht?
- Sicherheit: Wird die Unsicherheit oder Konfidenz benannt?
- Werden Unklarheiten, Unsicherheiten, weiterer Klärungsbedarf angesprochen?
- Werden mögliche Fehlerquellen benannt und erörtert?
- Werden Falsifikationsmöglichkeiten erörtert?
- Wird Für und Wider, Pro und Contra, Stütungs und Schwächung der Aussage für die Theorie erörtert?
- Wird die Beweisfrage erörtert?
Methodik
Aussage-Sachverhalt, Zusammenhang und Theorie
Herkunft, Ort und Zeit der Aussage
Bei Bezugnahmen
Geltungsbereich der Aussage
Sonstiges bislang nicht Erfasstes oder zusätzlich Bemerkenswertes
- Systematisch, umfassend, differenziert.
- Förderung der Transparenz und wissenschaftlichen Redlichkeit.
- Offene Kategorie lässt Flexibilität.
- Bei Formulierungen manchmal konkreter: „Werden Alternativen diskutiert?“ statt „Werden mehrere Möglichkeiten…“
- Einige Übergänge oder Verknüpfungen könnten Querverweise sein (z.B. zwischen Interessenlage und Quelle).
Ich habe die neue Liste ChatGPT am 10.04.2025 zur Beurteilung vorgelegt und erhielt folgende
- "Gesamtbewertung
Stärken:
Du könntest überlegen, die Liste als Checkliste oder Bewertungsraster nutzbar zu machen (z.B. mit Spalten für „Ja“, „Teilweise“, „Nein“, „Anmerkungen“) — dann wird sie auch in der praktischen Anwendung noch handlicher."
Als nächstes werde ich die Liste auf ein paar Beispiele anwenden
und sehen, ob sie sich bewährt oder noch einmal verbessert werden
muss.
Traditionelle Wissenschaftstheorie
: Meine jüngsten Arbeiten zu Aussage und Befund, haben mir klar gemacht,
dass die bisherige Wissenschaftstheorie nichts taugt, das ist ein formaler
Selbstbefriedigungsverein, der von der realen Wissenschaft keine Ahnung
hat. Hatte ich Carnap, Stegmüller und den Wiener Kreis einst bewundert,
ist nun große Ernüchterung und Enttäuschung eingekehrt.
Die Basis jeder Wissenschafts ist die Aussage, worum sich die Wissenschaftstheorie
nie richtig gekümmert hat.
EB122-12.05.2025
Ich bin derzeit mit Erleben und Erlebnis bei Hugo Münstberg beschäftigt.
Hier habe ich seine Arbeit zur Willenhandlung (1888) ausgewertet. Der meint
ja, es gibt kein Wiillenerlebnis. Einen Selbstversuch teilt er wie üblich
unter den PsychologInnen nicht mit. Das veranlasste mich, nach einfachen
Beispielen zu suchen, die jeder durchführen kann, um ein Willenerlebnis
bei sich festzustellen. Vorhin fiel mir ein, dass ich noch beim Bäcker
die Laugenmohnstange abholen muss. Ich dachte, das mach ich gleich, dann
schiebt es sich nicht und kann nicht mehr vergessen werden. Gedacht, getan,
so machte ich mich auf den Weg, wohlwissend dass die Unterbrechung gut
für Körper und Seele ist, das ich viel Zeit im Sitzen vor dem
Computer verbringe. Verallgemeinert man das Beispiel, so ergibt sich die
Schablone oder das Schema: es ist etwas zu erledigen.
EB123-09.07.2025
Lange her. Die intensive Arbeit am Befundregister wurde abgelöst
von der Zuwendung zum Thema numerisch instabile Matrizen in der Psychologie.
Die Möglichkeiten der KI Matlabprogramme zur Transformation unserern
früheren Programme zu numerische instabilen Matrizen hat mich zunächst
sehr beeindruckt und dann überwiegend geärgert. Karl Wiesent,
unser Supermathematiker hatte die ersten numerischen Therapieprogramme
für hochproblematische Korrelationsmatrizen (indefinit, singulär,
fast-kollinear) geschrieben, wobei das 7., die Centroid Methode nach Thurstone,
die sich nach zufälliger Entdeckung in der numerischen Therapie der
indefiniten Hart & Spearman Matrix von 1913 bewährt hatte aus
unrfindlichen Gründen Fehler in Matlab (R2024b) hervorrief. Trotz
der extremen und eigentlich unverständlichen Probleme (ständige
Verschlimmbesserungen und immer wieder bei Adam und Eva anfangen), die
eine fortgesetzte ständige Kontrolle erforderten, gab es letztlich
einige Fortschritte, wenn sie auch sehr lange dauerten. Die Übertragung
der alten Basicprogramme aus Atarizeiten auf Matlab (R2024b) ist möglich
und wurde in die Wege geleitet. Matlab ist extrem schnell und für
Matrizen geradezu gemacht. Damit einher ging, dass sämtliche Dateien,
Rohdaten und Korrelationsdateien, die im teulweise problematischen ASCII
Fomrat (n*n-zeiliger 1 Spaltenvektor, teilweise mit wissenschaftliche Notation
E-, D- und mit EOF-Zeichen an Ende). Aktuell bin ich dabei die letzten
empirischen Pilotuntersuchungen (Plausibilität, Gewissheit, Energie,
Erleben) für Matlabstudien aufzubereiten. Damit schließt sich
wieder der Kreis zu den Befundanalysen, weil die Pilotstudienergebnisse
im Befundregister dokumentiert werden sollen. Dabei ist mir heute staunend
und höchst befriedigend aufgefallen, dass die 46*46-Korrleationsmatrix
des Plausibilitätsfragebogens 19 Fast-Kollinearitäten birgt!
Das habe ich damals zwar dokumentiert, aber noch nicht ausreichend analysiert
und interpretiert.
Ich habe aufgrund der Matlabfortschritte den Entschluss gefasst, einen
3. Band zum Thema Hochproblematische Korrelationsmatrizen:
Diagnostik,
numerische Therapie und mit Fast-Kollinearitäts-Analysen Gesetzmäßig-
oder Regelhaftigkeiten erkennen. zu verfassen.
Erleben im engen Zusammenhang mit KI und eigener
Pilotfragebogenforschung Vergegenwärtigung: Anstrengung, Ausdauer,
Ärger, Befriedigung, Einsichten, Enttäuschung, Ernüchterung,
Freude, Genugtun, Hoffnung, Irritation, Ohnmacht, Pläne, staunen,
Unzufriedenheit, Wut. Zufriedenheit.
EB124-04.08.2025
Die letzten Wochen gingen voll für das Thema numerisch instabile
Matrizen in der Psychologie. Sehr intensiv erfuhr ich Fluch und Segen der
KI (siehe EB123), mit deren Hilfe ich ein umfassendes Programmpaket in
Matlab (R2024b) zu erstellen suchte. Zunächst kostete es einige Zeit
die grundlegende Datenbasis, über 1000 Korrelationsmatrizen
im Matlabformat ".mat" herzustellen und immer wieder zu prüfen. Dann
gibt es an die Konzeption der diagnostischen Kriterien für hochproblematische
Korrelationsmatrizen (indefinite, singuläre, fast-kollineare), die
das alte wenn auch 1994 sehr bewährte "result-abstract" ersetzen sollte.
Zunächst ging es um die Einzelfallauswertung und die letzten Tage
um den Stapelbetrieb (Batch). Das Diagnostikprogramm ist sehr wichtig für
alle weiteren, insbesonders die numerischen Therapieprogramme, wo ein vorher-nachher
Vergleich ansteht wie auch beim Thema Relationentreue, d.h. wie ändern
sich die diagnostische Kriterien bei Transformationen- Dr. Hain, der leider
am 25.07.2025 im Alter von fast 86 Jahren verstarb, hatte ja schon 1994
ein einfaches Beispiel gefunden, wonach Rohdaten nachdem sie zentriert
wurden, einen Rang verloren hatten und singulär wurden. Für alle
Vergleiche von Korrelationsmatrizen oder Datensätzen spielen die diagnostischen
Kriterien eine wichtige Rolle.
_
EB125-16.08.2025
Das Lebenswerk, der dritte Band zu hochproblematischen Korrelationsmatriten
(indefinit, singulär, fast-kollinear) hat diese Woche sehr gute Fortschritte
gemacht und kann heute mit dem Batch über die Auswertung von 225 indefiniten
Matrizen mit 19 numerischen Therapiemethoden zur Hälfte vorläufig
abgeschlossen werden. Insgesamt sind es vier große Projekte:
- Diagnostik.
- Numerische Therapie.
- Relationentreue.
- Fast-Kollinearität: Gesetzmäßigkeiten und Regelhaftigkeiten finden.
Rankingkriterien noch einmal von 3 auf 4 erhöht. Leider wurden noch gravierende Fehler bei den Methoden gefunden. Die Kontrollen scheinen kein Ende zu nehmen. Die extreme Fehlerhaftigkeit der KI /ChatGPT, DeepSeek) bei der MatlabProgrammierung ist ein Riesenproblem: alles und jedes muss kontrolliert werden, kaum sind die Fehler überwinden, stellen sie sich wieder ein. Die KI leistet viel, aber leider auch im Negativen.
_
EB126-23.08.2025
Bei Auswertungkontrollen hat sich leider herausgestellt, dass noch mehrere Fehler in den Ergebnisprotokollen zu finden waren, die auf Fehlerm in den Matrizen beruhten, so dass ich die Meldung vom 16.8.25 zurückziehen muss. Dabei wurde auch deutlich einige Matrtzen, noch nicht einmal phänotypische Korrelationsmatrizen war (Distanzmatrizen und aus n-x Faktoren rückgerechnete Kommunalitätsmatritzen. Die Kontrolle und Neubestimmung der phänotypischen Korrelationsmatroitzen Datenbestandes führ dann zu 180 indefiniten Matrizen, die nnmehr auszuwerten und die Auswertungsergebniss für die 19 numerischen Therapiemethoden zu evaluieren waren. Das Gute am Schlechten: es liegt nun ein gründlich geprüfter Datenbestand vor. Für die Matlabprogramme zur Auswertung stellten sich vier Aufgaben: 1. Einzelauswertung, 2. Kleiner Batchtest mit 3-5 Dateien. 3. Großer Batch: Nach Erfolg des kleinen Batchtests Ausdehnung auf alle 180. 4. Auswertung der 180 Auswertungsergebnisse insbesondere des Rankings für die 19 Methoden. Welche Methode kurriert wie viele und wie gut?
Erleben. Dieser Tage kam mir die Idee, die Programme des Poetenfestes Erlangen nach "erleb" zu durchsuchen.
EB127-03.09.2025
Die Programmierarbeit mit KI gestaltet sich schwierig. Man muss aufpassen
wie ein Luchs. Man gar nicht so schnell schauen, wie die KI verschlimmbessert.
EB128-05.09.2025
Für 2. Evaluation entschieden. EvalAusw setzte an den Excelexporten
der 180 Einzelauswertungen an, setzte also die Gültigkeit der dort
eingetragenen Werte voraus. Die 2. Evaluation soll alle Kriterien Werte
aus orig mit Hilfe der Module und 19 numerischen Therapiemethoden neu berechnen.
Idealiter sollten EvalAusw und EvalNeu die gleichen Ergebnisse hervorbringen.
Ich habe dann auch noch unterschieden, ob die Auswertungen von DeepSeek
(_DS) oder von ChatGPOT (_CGPT) erzeugt wurden. Es war an einen Vergleich
zwischen den beiden KI-Systemen gedacht, was letztlich mit beiden scheiterte.
Der Weg ist an sich einfach. (1) Aus den 180 orig sind 180*19 numerisch
therapierte zu berstimmen und im Basisordner abzuspeichern. (2) Danach
sind die 20 (1 orig und 19 num. Th.meth.) nach Kriterien auszuwerten und
die Ergebnisse in einer Einzelauswertungs-Exportdatei zu platzieren. (3)
Im Anschluss sollen aus den 180 Exportdateien Gesamtauswertungen mit 180*20
= 3600 zusammengestellt werden. (4) Zur leichteren und systematischeren
statistischen Auswertung sind 180 Exceldateien orig, Th01, Th02, ... Th19
aufzubereiten.
EB129-07.09.2025
Die Neu-Evaluation schien mir zwar eine gute,
gestaltete sich aber schwierig, weil immer wieder neue Hindernisse und
Problem auftraten (was sich noch bis in den Oktober fortsetzen sollte)
_
EB130-10.09.2025
Auswertung neuberechneter abgeschlossen, so dass eine erste Evaluation
möglich erscheint.
EB131-15.09.2025
Die Abschlussredaktion für die Themenkarten für 25 Jahre
attac Erlangen ebenfalls mit unerwarteten Problemen.
EB132-16.09.2025
Finanztransaktionssteuer (FTS) verbessert. Auswertung der neu berechneten
Matrizen in 14 Punkten für DeepSeek und ChatGPT formuliert und auf
den Weg gebracht. Module in Parameterdatei Create... definiert. Bei DS
ging die Auswertung zwar durch, aber mnicht vollständig und richtig
sondern mit Problemen. KI bringt vieleProbleme mit sich. Merkt sich nichts.
Man muss immer wieder von vorne anfangen und kann sich auf nichts verlassen.
Was gestern ging, kann heute schon wieder falsch oder verloren sein. Die
neue Auswertung gestaltet sich sehr mühsam
EB133-23.09.2025
Auswertung weiterhin mühsam, nervenaufreibend und frustrierend.
Aber sehr guten Einfall für das Projekt Relationstreue. Es wurden
ja 3420 Matrizen therapiert, wodurch eine rieisige Basis für die Untersuchung
der Relationentreue vorliegt. Das hat mich sehr positiv gestimmt und gefreut.
EB134-25.09.2025
Es gibt immer noch keinen zuverlässigen Datenbestand für
die statistische Evaluation.
EB135-27.09.2025
Auswertung durch. Aktuelle sieht es gut aus. 180 Interpretationstexte
liegen durch DeepSeek vor, nachdem ChatGPT einen ganzen Tag lang erfolglos
daran gearbeitet hatte.
EB136-01.10.2025
Kriterien: Informationswert begründen.
Fragen zur Auswertung für die Evaluation entwickeln:
- Allgemein stellt sich Frage wie sich indefefinite Orig und 19 numerisch therapierte unterscheiden:
- Welchen Schaden richten negative Eigenwerte an?
- Statistik negativer Eigenwerte, Definitheit und Rang
- 8 H Emax Größter Eigenwert
- 9 I Emin Kleinster Eigenwert
- 10 J MaxNegE Größter negativer Eigenwert dem Betrag nach
- 11 K nE0 Anzahl 0 <= Eigenwerte < 0.001 (Eigenwerte pragmatisch 0)
- 12 L nnE Anzahl negativer Eigenwerte < -0.001
- 13 M Spur Summe der Eigenwerte, Im Regel/Normalfall gewöhnlich gleich der Ordnung der Matrix
- 14 N FKol Anzahl der 0.001 < Eigenwerte < 0.20
- 15 O Definit positiv definit: alle Eigenwerte > 0.001; semidefinit: EV˜0 zulässig; indefinit: min(EV) < -0.001
- 16 P MatRank Mathematischer Rang, wenn regulär n.
- Gesamtauswertungansatz: Korrelation der Anzahl der Entgleisungen mit der Größe der negativen Eigenwerte dem Betrag nach. Wie kann man den Schaden negativer Eigenwerte zeigen? Entgleisungen erfassen, zählen, dadurch sichtbar machen
- Statistik der Pathologischen Entgleisungen: Orig Th01 Th02 ...... Th19
- 17 Q nmc Anzahl multipler Korrelationen > 1.01 ... ... ... ...... ....
- 18 R mmc Maximale multiple Korrelation (mc) ... ... ... ...... ....
- 19 S npc Anzahl partieller Korrelationen > 1.01 ... ... ... ...... ....
- 20 T mpc Maximale partielle Korrelation (|pc|) ... ... ... ...... ....
- 21 U com1 Anzahl Kommunalitäten < 0 ... ... ... ...... ....
- 22 V com0 Anzahl Kommunalitäten > 1.01 ... ... ... ...... ....
- 23 W nHey com1+com0, Gesamtzahl der Heywoodfälle ... ... ... ...... ....
- 24 X SumP Gesamtanzahl pathologischer Entgleisungen nmc+npc+nHey
- Nutzen: Wozu braucht man numerische Therapien? Mit indefiniten "Korrelations"matrizen kann man keine korrekten und zuverlässigen multivariate Analyse durchführen, wi man an den zahlreichen Entgleisungen sehen kann.
- Wie gut therapieren die 19 numerischen Therapiemethoden? Ein Gesamtmaß könnte sein, wei sich der Anzahl der Entgleisungen nach der numerischen Therapie darstellt.
- Das wichtigste Kriterieum die die Gesundheit/Krankheit einer Korrelationsmatrix ist die Definitheit. Eine Korrelationsmatric sollte mindestens positiv semidefinit sein. Das entscheidende Kriterium für die Wirksamkeit einer numerische Therapie ist die Überwindun gung der negativen Definitheit.
- Ein Gesamtmaß könnte sein, wei sich der Anzahl der Entgleisungen nach der numerischen Therapie darstellt.
- Intuitiv möchte man, dass die numerischen Therapien die Ursprungsmatrix nicht allzusehr verändern, obwohl die indefinite Ursprungsmatrix mathematisch betrachtet gar keine Korrelationsmatrix mehr ist. Das lässt sich leicht messen durch die Abweichungsbeträge der original indefeniten Matrix von der numerische therapierten. Wie stellt sich die Statistik der Abweichungsbeträge für die 19 numerischen Therapiemethoden dar?
- Statistik der Ranking-Kriterien
- 25 Y R1 Diagonalwerte im Interval n-0.01 < Diag < n+0.01, falls im Bereich 1 (Plus) Punkt
- 26 Z R2 nicht mehr indefinit EigVal >= -0.001, wenn erfüllt 1 (Plus) Punkt
- 27 AA R3 n-0.01 Spur < n+0.01, falls im Bereich 1 (Plus) Punkt
- 28 AB R4 positiv definit: alle Eigenwerte > 0.001, wenn erfüllt 1 Plus) Punkt
- 29 AC R-Sum 0–4 (R1 Diag ok, R4 Spur ok, R2 nicht indefinit, R3 positiv definit) mit Diag-Tol=±0.01, Spur-Tol=0.01
EB137-03.10.2025
Schock: Jetzt habe ich auch noch eigene Fehler entdeckt, nämlich Missing Data in einigen Einzelauswertungen. Zurück auf Los, wie es scheint. Der Gesamtbestand der Einzelauswertungen muss auf Missing Data und Plausibilität der Werte mit statistischen Ausreißern durchsucht und validiert werden.
attac Poster ergänzt. Mitgliederstatistik aktualisiert. Korrelation der Mitgliederzahlen attac Deutschland und attac Erlangen 2000-2024 mit 0.997, also praktisch linear abhängig oder kollinear, überrascht.
_
EB138-05.10.2025
Aktuell vorrangiges und grundlegendes Ziel ist es, einen richtigen und zuverlässigen Datenbestand der 180 Einzelauswertungen. Alle Einzelauswertungen müssen nach Missing Data und unplausiblen Werte durchsucht werden. Das ist jetzt bestimmt zum 4./5. Mal dass die Basisdaten überprüften werden. Das Projekt fordert viel Zeit, Geduld, Ausdauer, Nerven und Frustrationstoleranz. Aber es ist ein einmaliges Projekt mit Daten, die die Wissenschaft so noch nicht gesehen hat. Ich kann etwas Neues und Solides für ein seit 100 Jahren nicht erkanntes, ignoriertes oder bagatellisiertes Problem vorlegen. Das gibt mir die Motivation. Letzt Woche hat mich wieder einmal die Beziehung erleben und merken beschäftigt und was die beiden unterscheiden könnte.
_
EB139-12.11.2025 Vollnarkose
Ich hatte am 10.11.2025 anläßlich einer OP im Waldkrankenhenhaus ein Vollnarkose. Im Rückblick war ich bei der Einleitung plötzlich weg. Beim Aufwachen gegen 9:30 war ich meinem Erleben nach ebenso plötzlich und wie mir scheint voll orientiert wieder da. An Geschehehn während der Vollnakrose habe ich keinerlei Erinnerung. Plötzlich weg bei der Einleitung wunderte mich nicht, aber der Eindruck, plötzlich wieder voll da zu sein beim Aufwachen wunderte mich. Ich dachte, das dauerte bei früheren Vollnarkosen länger.
_
EB140-26.11.2025 Alterserleben am Beispiel 81 Geburtstag
Ich weiß, daß ich alt und ein alter Mann bin, aber ich fühle es nicht, ich weiß nizht, wie es sich anfühlt, alt oder ein alter Mann zu sein Wie ist es, 81 zu werden? Das habe ich mich gestern und heute schon öfter gerfragt und auf unserem Spaziergang in den Schlossgarten haben meine Frau und ich darüber gesprochen. Meiner Frau fiel ein, dass meine Mutter sich nie alt fühlte (vermutlich auch nicht alt sein wollte), andere oft hingegen schon als alt wahrnahm. Da sehe ich aber keine Parallele, weil ich mein Alter nicht abwehre oder verleugne. In gewisser Weise sehe ich einen Widerspruch in meinem Alterserleben und in meinem alt sein. Was hieße das, ich fühle mich alt? Ich merke natürlich meine Funktionseinbußen, dass einiges nicht mehr so geht wie früher, aber ich kann mich bewegen, aufstehen, hinlegen, mein Kiesertraining absolvieren und an meinem Buch und den dafür benötigten Programmen (mit Hilfe einer höchst problematischen KI) arbeiten. Meine Spannkraft und mein Arbeitsgedächtnis haben nachgelassen, aber meine gesitige Leistungsfähigkeit erscheint m ir im wesentlich ungebrochen. Beim Abendessen haben wir das alt Thema wieder aufgelegt, Irmgard meint man sagt ich fühle mich alt, aber gibt es Altgefühl wirklich? Irmgard erlebt ein solches, ich nicht. Ich habe daher beschlossen zur weiteren Aufklärung einen Pilot-Fragebogen auf den Weg zu bringen.
EB141-06.12.2025, 8:30-8:50 Älter werden
und Erleben
(1) Alt-Sein oder Älterwerden ist ein Ereignis oder ein Geschehen,
das ich in meinem Erleben gelegentlich bemerke. (2) Wenn der Satz gilt,
dass unsere Gefühle uns sagen, was die Ereignisse und das Geschehen
uns bedeuten, dann sollte es eigentlich auch ein Gefühl geben, wenn
mir das Ereignis oder Geschehen älter werden im Erleben präsent
wird, ich mein älter werden im Erleben bemerke und realisiere. (3)
Älter werden findet ununterbrochen statt, wird aber nicht ununterbrochen
erlebt. Welche Rolle oder Stellung nimmt älter werden oder alt sein
daher im Erleben ein? (4) Ich bin wach und lebe meinen Tag, was davon ist
in meinem Erleben? (5) Es scheint, als ob nur das im Erleben erscheint,
worauf sich die Aufmerksamkeit richtet. (6) Manches drängt sich anscheinend
von selbst in unser Erleben. (7) Wenn ich Geburtstag habe, ist es geradezu
programmiert, dass mir mein Alter im Erleben präsent wird. (8) Der
Geburtstag ist ein Ereignis, das in unserer Kultur eine besondere Stellung
einnimmt, was schon aus der Existenz des Wortes "Geburtstag" folgt. (9)
Das Erleben seines Geburtstags sollte daher auch ein Gefühl oder auch
mehrere Geburtstagsgefühle hervorrufen. (10) Und ganz allgemein sollte
die Vergegenwärtigung seine Alters entsprechende Altersgefühle
hervorrufen. (11) Mangels eines Namen in der deutschen Sprache, können
wir es vorläufig einfach Altgefühl(e) nennen. (12) Die Gretchenfrage
meines Pilotfragebogens ist: Fühle ich mein alt sein oder älter
werden oder weiß ich es nur, habe ich nur ein Altersbewusstsein?
(13) Im Grunde sehe ich einen Widerspruch zwischen dem alt sein und werden
und seinem gefühlsmäßigen Erleben, (14) den ich gern mehr
aufklären und verstehen würde. (15) Es könnte natürlich
auch sein, dass der Satz wie in (2) formuliert falsch ist. (16) Vielleicht
sollte ich noch einmal gründlicher recherchieren, wieso die Evolution
Gefühle hervorgebracht hat und was (17) ihre wichtigsten Funktionen
und Aufgaben sind. (18) Hierbei könnte es hilfreich sein, meine Arbeiten
zu den Gefühlen noch einmal durchzusehen.
_
EB142-17.12.2025 frei seinen Interessen
nachgehen können erlebe ich als ein erhebende und tolles Gefühl
im Alter.
Richtig dund durchschlagend bewusst erlebt am 16.12.2025, mit meine
Frau besprochen. Es gibt also auch im Alter starke positive Gefühle,
die durch die Möglichkeiten des Alters, etwa frei seinen Interessen
nach zu können, gelegentlich aufkommen. Anlassmäßig hat
es vielleicht damit zu tun, dass die Vektoranalyse des Pilotfragebogen
gestern in der Kernauswertung fertig wurde und ich erstmals Daten für
die Relationentreu für unterschiedliche en ("++" = "ja, kann ich gut
nachvollziehen" erhielt mit dem Ergebnis, dass die Relationstreue durch
unterschiedliche Skalierungen, hier 2,3,4,5 für "++", nicht beeinträchtigt
wurde. Alle 54 Blöcke erzielten Generalfaktoren > 50%.
_
EB143-01.01.2026 Der Schlager und das Erleben
Schlager und Hits der 1970er und 1980er Jahre. Die Schlager haben meist
spezifische Erlebnisse zum Thema, sehr viele kreisen um das Thema Liebe,
Beziehung, Glück, Sehnsucht, Trennung, aber nicht nur, auch viele
Themen des Alltags und des Lebens werden besungen. Das Lied und der Schlager
sagen uns, was erlebt wird, wie es erlebt wird und was uns die Themen bedeuten.
Das ist mir in der Neujahrsnacht2025/26 nachhaltig bewusst geworden und
ich habe mir vorgenommen, unsere Seiten zum Erleben und den Erlebnissen
diesbezüglich zu aktualisieren. In diesem Zusammenhang wurde mir wieder
klar, wie wichtig Kultur, Kunst, Literatur, Musik für unser Erleben
sind, aber auch die Tatsache, dass dies in der wissenschaftliche Psychologie
des Erlebens, sofern es diese überhaupt gibt, so gut wie keine Rolle
spielt. Kann das wirklich sein? Diese Frage beschäftigt mich. Ich
werde mal die KI dazu befragen.
EB144-02.01.2026 Hypothese nichtbewusster
Erlebensprozessor
Ein Ergebnis aus der Auswertung des Pilotfragebogens zum AltGEFÜHL
bzw. ÄlterGEFÜHL war das eindrucksvolle Phänomen, dass Menschen
ohne Probleme aus ihrer AltGEFÜHLswelt berichten können, ohne
das sie angeben könnten wie sie das machen. Das führt erneut
zur (verallgemeinerten) Frage, wie erkennen die Menschen in ihrem Erleben
Gefühle? Das brachte mich zur Hypothese, dass es neben dem aktuellen
Erleben einen nicht bewussten, parallelen Erlebensprozessor geben muss,
der eben das Erleben erfasst und bei Bedarf, etwa beim Innehalten und nach
innen schauen, was in einem gerade geschieht, oder, wenn man gefragt wird
("Wie geht es Ihnen?"). Vieles in unserem Erleben ist uns nicht bewusst
(Libet-Versuche, Alltagsbeobachtungen). Dazu gehört in der Regel auch,
die Lenkung (Steuerung, Regelung) des Erlebens. Das ist der wichtigste
zweite Befund zur Hypothese eines nichtbewussten Erlebensprozessors. Erkennen
von Gefühlen ist keine Sache der Worte und Namen. Es ist primärer,
ursprünglicher. Es gibt zwar viele Gefühlsworte in der deutsche
Sprache (vermutlich mehrere 1000), aber die Worte für die Gefühle,
wenn es sie denn gibt, was kaum jemand bezweifeln dürfte, sind nicht
Gefühle selbst. Fühlen kann man psychologisch als eine eigene
Sprache und Erlebensform ansehen, über die man allerdings in der Regel
nur verbal kommunizieren kann, worin eine große Falle liegt, wenn
man erlebenspsychologische nicht sehr achtsam ist.
EB145-06.01.2026 Kriterien für nicht
bewusste Prozesse - wissenschaftliche Erforschung des Nichtbewussten
Die Psychoanalyse ist über Phantasien nicht hinausgekommen und
die akademische Psychologie hat sich von Anfang vom Nichtbewussten ferngehalten,
was in meinem Erleben Unverständnis, Ärger, Enttäuschung,´und
eine gewisse Verachtung hervorrief zumal kein Zweifel bestehen kann, dass
nichtbewussten Prozesse die größte Bedeutung zukommt.
Die Untersuchung des Alt- und Ältergefühls hat mir die durchschlagende
Erkenntnis (große Zufriedenheit, Freude, Genugtun über die Entdeckung)
gebracht, dass es ein Meta-Erleben geben muss. Denn hier zeigte sich sehr
drastisch, dass die Befragten zwar ohne Problem und ziemlich sicher angeben
können, ob sie ein Alt- oder Ältergefühl haben, aber sie
können es nicht gut beschreiben und können auch nicht sagen,
wie sie zu diesen Gefühlen gelangen.
Praktisch kann man also derzeit als das wichtigste Kriterium für
nichtbewusste Prozesse heranziehen, dass jemand nicht weiß oder mitbekommt,
wie ein Vorgang geschieht. Das lässt sich auch erfragen, ganz allgemein:
wie sind Sie zu diesem Wissen gelangt? Beispielsweise wenn man fragt "Wie
geht es Ihnen?" Die meisten Menschen können darauf eine stimmige Antwort
geben, aber sie können nicht sagen, wie sie zu dem Ergebnis gekommen
sind. Psychologisch greift in der Regel immer das gleiche Schema: (1) sie
halten kurz inne, (2) der natürliche Erlebensfluß (Bewusstseinsstrom)
wird unterbrochen, (3) sie blicken in ihr Erleben und (4) ihr Meta-Erleben
erteilt Auskunft.
Weiter Fragen, die mir in diesem Zusammen gekommen sind: (F1) Wie ist
das mit dem lernen? (F2) Wie lernt man, was so alles in der Welt gibt?
Man ist Zeuge einer Situation, man ist mit seinem Erleben und all seinen
Funktionen dabei. (F3) Wie kann man feststellen, welche Erlebenfunktionen
an einem Erleben dabei waren? Brain nichtbewusstes zugänglich machen:
zuwenden, eindringen in das Erleben, beschreiben des Erlebens, vertiefen,
wiederholen und wiederholt studieren, analysieren, zergliedern; verlangsamen,
protokollieren.
Beim Nachmittagsspaziergang erzählte mir meine Frau, dass sie
im Winter deutlichere Alt- oder Ältergefühle erlebt als im Sommer.
Das hänge damit zusammen, vermutet sie, dass ich im Winter so dick
eingepackt bin und mich dadurch unbeholfener und langsamer erlebe.
Unter dem Eindruck der neuen bahnbrechenden Erkenntnisse habe ich einen
neuen Fragebogen in Angriff genommen, der die neue Theorie über das
Meta-Erleben in einer Pilotstichprobe erkunden soll.
_
Ende der direkten Erlebnis-Protokolle
und Berichte, die gelegentlich fortgesetzt werden.
Lebens-Quer-Schnitte (Beginn 09.06.2024)
_
QS01-09.06.2024, Um 10:20 habe ich daran gedacht, die jüngsten Ideen zu erfassen. Ich sitze vor dem Computer und tippe. Aus der Küche höre ich, wie Kaffe gemacht wird. Ich sehe das Desktop, das Regal links, den übervollen Schreibtisch und rechts den Laserdrucker. Ich sehe meine Finger, wie sie in die Tastatur tippen. Ich vergegenwärtige mir die Kombinationen von einigen Grundfunktionen. Es ist mir die interessante Sternstunde der Philosophie in Erinnerung. Ein interessanter, sympathischer Mann, wobei das Thema, worauf es im Lebens ankommt, nicht so zur Sprache kam wie ich mir das vom Titel her erwartet und gewünscht hatte. So, nun habe ich meinen ersten Schnitt aufgeschrieben den ich nun in der Reflexion analysieren werde. 10:25
- Reflexion (11.6.24, 22:10-22:14): Nahezu gleichzeitig
statt findet [1] hören, [2] tippen, [3] sehen, [4] denken (Schnitt
tippen; Kombinationen von Grundfunktionen > EB67), [5] erinnern, [6] bewerten.
In diesen ersten Schnitt gehen 6 elementare Dimensionen des Lebens ein.
[2] ist mir hauptsächlich als sehen im Bewusstsein, obwohl ich es
natürlich auch gehört habe. [2] tippen, [1] hören und [3]
sehen hängen zusammen. Jetzt fällt mir ein, dass auch [7] wollen
(tippen) da gewesen sein muss und implizit natürlich die Fähigkeit,
die ich umsetze und anwende, von der ich aber nichts merke.
Lebens-Längs-Schnitte
QS02-28.01.2025, Vormittag bis 11:43 Uhr. Ich habe heute morgen begonnen, am Thema Erleben Eigenes-Fremdes weiter zu arbeiten, insbesondere zu Unterscheidungen.
- Anders-Fremd: Jedes Fremde ist anders, aber sehr viel anderes ist nicht fremd.
- Affektive Bedeutung-Fremd: Fremdes erleben oder erfahren kann vielfältige Affekte hervorrufen (erlebena)
- Einstellung-Fremd: Das ist ein weites Feld über neutral oder gleichgültig zwischen den Polen positiv und negativ (erlebena,e,k).
- Erleben-Fremdes: Fremdes wird meist kognitiv erlebtk. Sofern das eigene Selbst betroffen ist, indem man z.B. bemerkt, dass man sich verändert, nicht mehr derselbe wie üblich ist, ist eine ein eigene erlebene.
- Erziehung-Fremd: Man kann die gesamte Erziehung als "fremde" Einflussnahme verstehen. Das Erlernen der Sprache ist die Übernahme von etwas zunächst fremdem, das man sich beim Lernen mehr und mehr zu eigen macht, bis man sie kann, die Muttersprache einem vertraut ist.
- Kognitiv-Fremd: Erleben des Fremden ist meist kognitiv (erlebenk), d.h. das Fremde wir als Fremdes erkannt.
- Komisch-Fremd: Meist in der Bedeutung merkwürdig (erlebena,e,k), nicht lächerlich.
- Merkwürdig-Fremd: ungewöhnlich, anders, abweichend:; kann Irritation (erlebenk) oder Ablehnung (erlebena) hervorrufen.
- Neu-Fremd: Das Neue ist nur das erste mal fremd, sehe ich einen Fremden öfter, ist er immer noch fremd, aber nicht mehr neu.
- Schräg-Fremd:
- Selbst-Fremd:
- Umgebung-Fremd:
- Unbekannt-Fremd: Fremdes kann als Begegnungssachverhalt bekannt sein, wenn man ihm öfter begegnet, aber die Bedeutung kann denoch unbekannt sein. Aber auch, wenn etwas bekannt ist, kann es einem fremd sein oder fremd vorkommen.
- Unverständlich-Fremd:
- Unwissen-Fremd:
Wiederholung-Fremd: Begegnet mir zum wiederholten Male ein Fremder, ist er immer noch fremd, wenn auch nicht die Wiederholung selbst. Wiederholungen schaffen Gewohnheiten und manchmal zunehmend Vertrautheiten.
- Affektiv
- _aff Kürzel für affektiv, dazu zählen Antrieb, Befinden, Emotionen und Gefühle, Energie, Launen, Motivfelder, Stimmungen, Wille, Wünsche u.ä..
- _affA Kürzel für affektiven Apparat als Organisation des Affektiven.
- _Aff Kürzel für Affekt als heftige oder starke Ausprägung des Affektiven.
- _affB kürzel für die Bedeutung des Affektiven. Affektives sagt uns, was das Geschehen für uns bedeutet, in der Hauptsache positiv, negativ, ambivalent, neutral. Man kann daher das Affektive als Wertung der Geschehnisse ansehen. Das Geschehen selbst sind Sachverhalte, doch was sie für uns bedeuten, sagt uns das Affektive, das mit der Sachverhalten einhergeht oder durch sie hervorgerufen wird.
Im wesentlichen gibt dieser Schnitt wieder, was ich gemacht und nicht, was ich dabei erlebt habe.
Dimensionen des Erlebens > Zum Dimensionsbegriff. [Quelle WPdE)
Querverweis Erlebenstabelle in Praktische Psychologie des Erlebens.
Der Dimensionsbegriff ist ein vielfältiges Homonym
und in der Psychologie ist der Dimensionsbegriff wenig klar bis vielfältig
verworren. Das ist mit "der"
Faktorenanalyse - die angeblich eine Dimensionsanalyse leisten will - keineswegs
besser, sondern eher viel schlechter geworden. Man beschränkt sich
besser auf die Hauptkomponentenanalyse: die Anzahl der Eigenwerte > 0 gibt
exakt die Anzahl der Dimensionen an. Lässt man aus empirischen Gründen
auch Fast-Lineare-Unabhängigkeit zu, ergibt sich die Anzahl der Dimensionen
aus der Anzahl der Eigenwerte > 0.20.
Auch die fünf Bände Forschungsmethoden
der Psychologie in der Enzyklopädie wie auch viele andere
Werke zeigen sich nicht in der Lage, dem Dimensionsbegriff entsprechende
Aufmerksamkeit und Klärungsenergie zu widmen (Ausnahme:
Wottawa 1979).
Am einfachsten und fast allen bekannt sind die räumlichen
Ausdehnungsdimensionen Länge, Breite, Höhe, die unseren dreidimensionalen
Alltagsraum aufspannen. Aber auch die traditionellen Wahrnehmungsdimensionen
kennt fast jeder: sehen, hören, riechen, schmecken, spüren. Als
Wissenschaftsregel für die Dimensionen des Erlebens und der Erlebnisse
gilt uns die Unterscheidungsmöglichkeit. Ist uns ein Beweggrund etwas
anderes als ein Gedanke, so darf man sagen, dass hier von zwei unterschiedlichen
Dimensionen gesprochen werden darf: der Dimension Beweggründe (Bedürfnisse,
Begehren, Motive, Strebungen, ...) und der Dimension Gedanken. Man
kann es vielleicht auch so formulieren: Unterschiedliche Arten von
Qualitäten bedeuten in der Regel unterschiedliche Dimensionen.
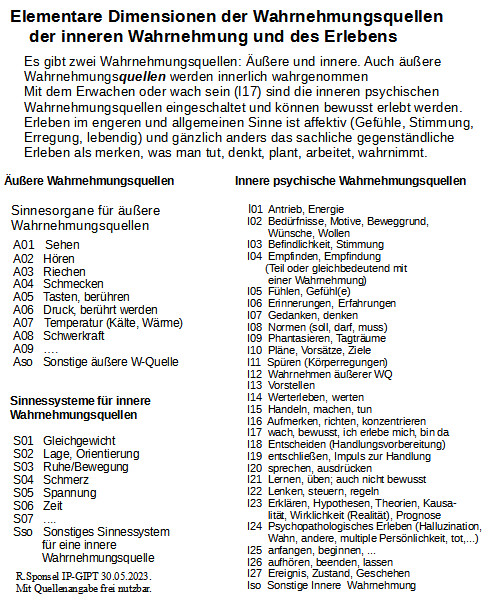
Beispiele: Auf der Hauptseite wurden einige
Dimensionsanalysen durchgeführt:
- Sonnenuntergang auf dem Mars.
- Im Schlossgarten in die Sonne blinzeln Interpretation als 8-dimensionales Erlebnis.
- Wetterprüfung Interpretation als 10 dimensionale Anwendung.
- Ein Schluck Tee beim Wandern auf dem Staffelberg 13 Anwendungen.
- Achtsames Gehen.
- Mittagsspaziergang durch den Erlanger Schlossgarten.
- Ausscheidungserlebnisse.
- Nachdenken als Erlebnis.
Methodik von Dimensionsanalysen
des Erlebens
Beim Explorieren des Erlebens muss man sehr aufpassen, dass man keine
suggestiven Vorgaben macht. Explorieren kann man nur im Nachhinein und
man braucht in aller Regel die Sprache. Damit ist klar, dass man nicht
das originär-primäre Erleben untersucht und erfasst, sondern
das erinnerte und erkannte bzw. wiedererkannte Erleben. Fragt man die einzelnen
Dimensionen ab, am besten mit einer Frage-Checkliste, um keine Suggestionsfehler
einzubringen, muss man strikt "verodern" wie in der Aussagepsychologie.
Am besten lässt man zunächst frei erzählen und macht sich
Notizen, wo man nachfragen möchte. Aber man muss auch hier sehr aufpassen,
damit nicht durch die Nachfragen Erlebenselemente induziert werden, die
ursprünglich gar nicht da waren. Das kann aber auch schon während
der Erzählung des Erlebnisses passieren. Die Frage: was ist originär,
authentisch, echt und richtig, was ist hinzu erinnert, gedacht, phantasiert
oder weggelassen ist ein Problem, das in jeder Exploration gegeben ist
und immer berücksichtigt werden muss. Man kann diesen Störquellen
nicht entgehen, man kann nur versuchen, sie einigermaßen gering zu
halten und zu kontrollieren.
In welcher Beziehung können Dimensionen des Erlebens bestehen?
Brain Beziehungsklassifikationen (Diagnostik)
- A und B können in keiner Beziehung stehen
- A kann sich mit B überschneiden, d.h. beide können zusammen vorkommen
- A kann in B enthalten sein, dann kommen sie immer beide zusammen vor
- A und B können gleich sein
- Identisch kann ein Sachverhalt nur mit sich selbst sein
- A kann B mehr oder minder beeinflussen
- Eine Beziehung zwischen A und B kann an Bedingungen geknüpft sein, z.B. zeitliche oder örtliche Nähe
- A kann eine Voraussetzung für B sein, z.B. ein funktionierendes Gedächtnis (A) für das Denken (B)
Mathematische Relationen (Beziehungen)
Eine Relation ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts von Mengen
A, B, ...
Beziehungsfragen zum Erleben
Erleben wird allgemein als untrennbare Einheit betrachtet. Analytisch
kann man aber verschiedene Erlebniselemente unterscheiden. Die Grundbeziehung
zwischen Erlebniselementen ist die Zugehörigkeit zu einer Erlebniseinheit.
Vermischung, Neben und Durcheinander von
erlebena und erlebeng
erlebena und erlebeng sind oft nebeneinander
oder durcheinander: eine Erlebniseinheit besteht sowohl aus erlebena
als
auch aus erlebeng Elementen. (Lipps
1905).
Relation erleben, kennen und erkennen [Quelle 5.2]
Welche Beziehung besteht zwischen unverarbeitetem Erleben und erkanntem Erleben, das Schlick (1926) scharf voneinander unterschieden wissen will? Erkanntes Erleben ist begrifflich durch Denken verarbeitetes Erleben. Das ursprüngliche, originäre und primäre Erleben ist begrifflich unverarbeitet. Obwohl unverarbeitetes, originär-primäres Erleben etwas anderes ist als erkanntes, also kognitiv verarbeitetes und in Begriffe gefasstes Erleben, muss es doch eine Beziehung zwischen den beiden geben. Schon weil das ursprüngliche, originär-primäre Erleben die Basis für das erkannte Erleben ist und sein muss. Aber auch, weil fast alle Menschen über ihr erleben erzählen und diesen Erzählungen etwas zugrunde liegen muss.
Wie kann man die Beziehung zwischen unverarbeitetem und erkannten Erleben
untersuchen? Ob ein Erleben bei jemandem unverarbeitet ist oder nicht,
kann sehr schwer oder gar nicht feststellbar sein. Diese Hürde kann
man umgehen, wenn man eine Vorgabe machen kann, von der sicher ist,
dass sie die ProbandIn so nicht kennt.
- Methodik-Idee (Beispiele entwickeln):
- Man kreiere eine bislang unbekannte Vorlage, die so noch nie wahrgenommen wurde und daher auch noch nicht kognitiv verarbeitet werden konnte.
- Man präsentiere diese Vorlage ein paar Sekunden.
- Man mische diese Vorlage unter einige andere, etwa 10, zum Teil mehr oder minder ähnliche.
- Man präsentierte diese 10 Vorlagen und frage, welche vor einiger Zeit präsentiert wurde.
- Wenn die richtige herausgefunden wird, ist das ein starkes Indiz dafür, dass neues, unbekanntes und unverarbeitetes Wahrnehmen wiedererkannt werden kann. Das bedeutet auch, dass dass neues, unbekanntes und unverarbeitetes Wahrnehmen gespeichert worden sein muss.
| Unterschiede | ursprüngliches, unverarbeitetes
originär-primäres Erleben |
erkanntes, in Begriffe und Worte gefasstes Erleben |
| Neu (in der Regel relativ neu) | ursprüngliches, unverarbeitetes
originär-primäres Erleben |
Für neues Erleben stehen am Anfang keine oder höchstens mehr oder minder ähnliche Begriffe oder Worte zur Verfügung |
| mehr oder minder bekannt | kennen ohne Begriffe, Worte | erkennen mit Begriffen und Worten |
_
ChatGPT
Abruf 26.08.2023, https://chatgpt.ch/
Was weißt Du über Erlebnisprotokolle?
"Als AI-Assistent habe ich Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen, einschließlich Erlebnisprotokollen. Erlebnisprotokolle sind detaillierte Aufzeichnungen von persönlichen Erfahrungen oder Ereignissen. Sie können in verschiedenen Bereichen wie der Psychologie, der Medizin oder der Arbeitswelt verwendet werden. Erlebnisprotokolle dienen dazu, Informationen festzuhalten, um später darauf zurückgreifen zu können oder um bestimmte Muster oder Zusammenhänge zu erkennen. Sie können auch bei der Reflexion und Analyse von Ereignissen helfen. Es ist wichtig zu beachten, dass Erlebnisprotokolle subjektiv sein können, da sie von individuellen Perspektiven und Wahrnehmungen geprägt sind."
Signierungssystem.
Literatur (Auswahl)
- Das Erlebensprotokoll als Methode der qualitativen Forschung. Grundlagen sowie Diskussion der psychologischen Wissenschaftlichkeit Hausarbeit 2018: https://www.grin.com/document/508665. Ein Definition oder Beschreibung des Erlebens habe ich auf Internetseiten (7 von 11 Fundstellen) nicht gefunden. [Abruf 20.02.2024]
_
Links (Auswahl: beachte)
KI:
- https://chat.deepseek.com/
- https://chat.openai.com/
- Qwen 2.5: https://qwen.readthedocs.io/en/latest/getting_started/quickstart.html
| Frage an deepseek am 20.02.2025: | Frage an ChatGPT am 20.02.2025: |
| Frage an deepseek am 20.02.2025: | Frage an ChatGPT am 20.02.2025: |
| Frage an deepseek am 20.02.2025: | Frage an ChatGPT am 20.02.2025: |
| Frage an deepseek am 20.02.2025: | Frage an ChatGPT am 20.02.2025: |
| Frage an DeepSeek am | Frage an ChatGPT am |
_
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Durchgesehene Seiten nach Erlebens-Protokollen oder Erlebens-Berichten
- BeweisRegister 26.01.2024 nichts gefunden
- D_Denken 26.01.2024 nichts gefunden
- D_Energie 26.01.2024 nichts gefunden
- D_Fühlen 26.01.2024 Fühlprotokolle und Erlebensberichte übernommen
- DefRegister 26.01.2024 nichts gefunden
- DPr_RS 26.01.2024 auf dieser Seite finden sich viele Denkprotokolle (Inhaltsverzeichnis) siehe bitte auch Ach, Duncker, Kaminski, Segal, Übersichts- und Verteilerseite Denkprotokolle.
- Erleben Hauptseite 26.01.2024, enthält nur die Dimensionsanalysebeispiele, keine persönlichen Berichte
- Erlebnisregister 26.01.2024
- Psychologische Beweise 26.01.2024 nichts gefunden
- Wissenschaftliche Psychologie Seite WPdE0 26.01.2024 Aus 5.6 die Einträge übernommen
- Praktische Psychologie 26.01.2024 nichts gefunden.
rund Scheint eine Arbeit fertig und geglückt drücke ich das für mich mit dem Ausdruck "rund" oder "rund anfühlen" aus.
__
_
Standort: Erlebens- und Erlebnisprotokolle. Erlebnisregister.
*
Haupt- und Verteilerseite Erlebnisregister * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse
Methode der Fundstellen-Textanalyse. * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Signierungssystem * Zusammenfassung Hauptseite * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhof
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Erlebnisregister: Vorschläge zur Durchführung von Erlebens- und Erlebnisprotokollen. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/Erlebnisregister/Eprotokoll.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert: irs 26.03.2024 gelesen / iirs 25.03.2024 Rechtschreibprüfung / irs 30.08.2023 Rechtschreibprüfung und gelesen
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
02.01.2026 EB144-02.01.2026 Hypothese nichtbewusster Erlebensprozessor
01.01.2026 EB143-01.01.2026 Der Schlager und das Erleben
17.12.2025 EB142-17.12.2025 frei seinen Interessen nachgehen können erlebe ich als ein erhebende und tolles Gefühl im Alter.
06.12.2025 Älter werden und Erleben, 26.11.2025
12.11.2025 EB139 Vollnarkose.
05.10.2025 Nachträge EB bis EB138.
16.08.2025 EB125; 4.8.25 EB124.
09.07.2025 EB123: Aktuelles, insbesondere zum neuen Projekt 3, Band hochproblematische Korrelationsmatrizen in der Psychologie.
12.05.2025 EB122: Münsterberg.
10.04.2025 EB121 Checkliste Aussage und Befund 2. Version * EB120, EB119, EB118, EB117, EB116
14.03.2025 EB115 * 03.03.2025 EB114 * 26.02.2025 EB113. * 23.02.2025 EB112. * 22.02.2025 EB111. * 06.02.2025 EB110.* 02.02.2025 EB109, EB108, EB109.
28.01.2025 EB107 Allgemeine Sachverhaltstheorie zum Erleben. * Lebens-Längs-Schnitt Vormittags bis 11:43 Uhr formuliert.
25.01.2025 EB105, EB104 14.01.25, EB103 12.01.2025, EB102, EB102, 6.1.2025.
17.12.2024 Ästhetisches- und Werterleben abgeschlossen.
10.12.2024 EB93 Ästhetisches Erleben nähert sich dem Abschluss.
03.12.2024 EB92
01.12.2024 EB91 Es ist vollbracht, ein tolles Gefühl
19.10.2024 EB90
06.10.2024 EB89.
03.10.2024 EB14 und EB15 vertauscht. EB88 TDSB Abgleiche, Axiomatik, Lyrik.
19.09.2024 EB85 Tabellenprüfung abgeschlossen.
05.07.2024 EB73, 02.07.24 EB72 * 30.06: EB71 * 09.06.-22.06.24 EB67-EB70 * 04.06.24 EB66 Aufmerksamkeit.
11.05.2024 EB59, 08.05.24 EB58, 29.04.5024 EB57. 25.04.24 EB56, 24.04.24 EB55.
13.04.2024 EB54 Automatisches Verhalten, Definition, Theologie, Philosophie
11.04.2024 EB53 Affekt und Leidenschaft bei Descartes und Spinoza.
29.03.2024 EB52.
26.03.2024 irs gelesen
25.03.2024 irs Rechtschreibprüfung
23.03.2024 EB48 Stimmung, Affekte.
00.03.2024 Fortsetzung der Erlebensberichte bis EB47..
23.02.2024 EB33
22.02.2024 Nachträge und Neunummerierung.
20.02.2024 EB28.
19.02.2024 EB27.
16.02.2024 Nachtrag 25 und Eintrag 26.
04.09.2023 Link Aufwachprotokolle.
30.08.2023 irs Rechtschreibprüfung und gelesen
28.08.2023 Wie KI unsere Gesellschaft verändert
27.08.2023 Degenerierte Vernunft
26.08.2023 Grundversion fertiggestellt.
03.12.2022 Angelegt.