(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=29.01.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 23.11.23
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Erleben und Erlebnis bei Moritz Schlick_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Erleben und Erlebnis bei Moritz Schlick

Bild-Quelle 1930: Wikipedia.
* Eintrag. *
Wiener
Kreis. * Persönlich
Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen
Methode der Fundstellen-Textanalyse
* Hauptbedeutungen
Erleben und Erlebnis * Signierungssystem*
Zusammenfassung
Hauptseite *
Begriffscontainer
(Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhof
Zusammenfassung-Schlick-1926-Erleben, Erkennen, Metaphysik
Schlick, Moritz: „Erleben, Erkennen, Metaphysik", Kant-Studien 31 (1926), S. 146-158."
- Darin auf von Schlick hingewiesene Teile aus seiner Allgemeinen Erkenntnislehre 2. Auflage 1925
- Analyse von Gottfried Gabriel Kennen und Erkennen.
Schlick, der Begründer des öffentlichen Wiener Kreises 1928, behauptet gleich auf der ersten Seite nach dem Titel seiner Abhandlung, dass erleben und Erlebnisse nicht kommunizierbar sind:
- SE2f: "Es wird allgemein zugestanden, daß die Frage, ob ein Rot,
das ich SE2e2.5erlebe [>3]
ein Rot, das ein anderer SE3e2.1erlebt (z. B. wenn wir gleichzeitig denselben roten
Gegenstand betrachten), dieselbe Farbe sind, daß diese Frage schlechthin unbeantwortbar
ist. Es gibt keine Methode, es ist keine denkbar, mit Hilfe
deren die beiden Rot verglichen und die Frage entschieden werden könnte.
Die Frage hat also keinen angebbaren Sinn, ich kann nicht erklären, was
ich eigentlich meine, wenn ich behaupte, daß zwei verschiedene Individuen
qualitativ gleiche SE3E2.1Erlebnisse haben. "
Dazu ist zunächst allgemein folgendes zu sagen:
- RS1-SE2f: Schlick macht zwar seine Behauptung am Beispiel die Farbe rot erleben verständlich, wobei es aber eine Behauptung bleibt, ebenso wie die im Anschluss erfolgte Verallgemeinerung, dass es keinen Sinn habe, davon zu sprechen, dass zwei verschiedene Individuen qualitativ gleiche Erlebnisse hätten.
- RS2-SE2f: Schlick definiert, erklärt oder erörtert einerseits bis auf das Farbenbeispiel nicht, was erleben oder Erlebnis(se) in seinem Verständnis bedeutet. Andererseits könnte man seine Behauptung auch als Definition verstehen: erleben ist gerade das, was sich nicht in Worte, Begriffe, Definition und Erklärungen fassen lässt, aber dann wäre es banal, zu behaupten, erleben und Erlebnisse sei nicht kommunizierbar, wenn er es so einführt.
- RS-SE3E2.2 Seite 3 kann man später entnehmen, dass zum Erleben und zu den Erlebnissen die "SE3E2.2erlebten Qualitäten, Farben, Töne, Gefühle, kurz alle inhaltlichen Bestimmungen des Bewußtseinsstromes" gehören. Damit kommuniziert Schlick Erlebens oder Erlebnisinhalte ("Qualitäten, Farben, Töne, Gefühle") und widerspricht sich selbst.
- RS3-SE2f: Dass noch nicht einmal eine Methode denkbar sein sollte, ist ebenfalls eine Behauptung. Ich hege z.B. nicht geringsten Zweifel daran, dass der natcode(erleben/Erlebnis(...)) in einigen Jahren gefunden sein wird.
- RS4-SE2f: Im strengen Sinne hatte Schlick mit seinen Behauptungen 1926 und auch aktuell, 2023, recht, im angewandten wissenschaftlichen und praktischen Sinne aber nicht: weder damals noch heute. Denn es wäre überhaupt kein psychosoziokulturelles Zusammenleben möglich, könnten sich die Menschen nicht über ihr Erleben austauschen. Schlick kann also höchstens nur zum Teil recht haben. Wo und wieso er nicht recht hat, sei daher an einigen konkreten Beispielen dargelegt und im Anschluss erörtert.
Beispiele zur Frage der Kommunizierbarkeit des Erlebens und der Erlebnisse:
- Man nehme seinen Zeigefinger und benetze ihn mit Salz, sodann führe man den Zeigfinger zur Zunge und schmecke daran. Es sollte sich bei verschiedenen Individuen das Erlebnis salzig einstellen.
- Man halte seine Hand vor das Gesicht, und sage, was man sehe. Es sollte sich bei verschiedenen Individuen das Erkennungserlebenis ich sehe meine Hand einstellen.
- Man streife mit dem Zeigerfinger der rechten Hand leicht über den Handrücken der linken Hand: Es sollten sich bei verschiedenen Individuen - meist eher angenehme als unangenehme - Berührungserlebnisse einstellen.
- Man presse im Stehen den rechten Fuß fest auf den Boden. Es sollten sich bei verschiedenen Individuen muskuläre Spannungsempfindungen in den Unterschenkeln einstellen.
- Man schließe die Augen und stelle sich ein weißes gleichseitiges Dreieck vor. Es sollte sich bei verschiedenen vorstellungsfähigen Individuen das Vorstellungserlebnis weißes Dreieck einstellen
- Man schließe die Augen und erzeuge in der Vorstellung das Lied O Tannenbaum, O Tannenbau. Es sollte sich bei verschiedenen akustisch vorstellungsfähigen Individuen das akustische Vorstellungserlebnis der Melodie O Tannenbaum, O Tannebaum eingestellt haben.
- Man denke die Zahlen1 und 3. Damit sollten sich bei verschiedenen Individuen die Denkerlebnisse 1 und 3 eingestellt haben.
- Man nehme drei Gefäße, eine mit kaltem Wasser (10°), eine mit heißem Wasser (35°) und eine mit Zimmertemperatur (20°). Man lege die linke Hand ins kalte, die rechte Hand ins heiße Wasser. Sodann tauche man beide Hände in das Gefäß mit Zimmertemperatur. Die linke Hand sollte bei verschiedenen Individuen das Wasser mit Zimmertemperatur als wärmer erleben als die rechte Hand, für die es sich kälter anfühlt. Damit hat sich ein Kalt-Warm-Unterschiedserlebnis eingestellt.
- Man stehe bei Tageslicht auf, gehe zum Fenster und blicke hinaus. Verschiedenen Individuen sollten dann das Wahrnehmungslebnis vom Blick aus dem Fenster.
- Verschiedene Individuen gehen in sich und fragen sich, wie wach, klar und fit man ist. Mit der inneren Wahrnehmung sollten die verschiedenen Individuen nun ein wach-klar-fit Erlebnis haben (wie wach-klar-fit sie sich fühlen).
- Verschiedene Individuen gehen in sich und fragen, auf was sie Appetit haben.. Damit sollte sich bei den verschiedenen Individuen ein Appetiterlebnis einstellen.
- Verschiedene Individuen gehen in sich fragen sich, was sie am Wochenende unternehmen könnten oder möchten. Damit solche sich bei den verschiedenen Individuen gehen in sich ein Wunsch- und möglicherweise ein Planerlebnis eingestellt haben.
- Verschiedene Individuen stehen auf und strecken sich. Verschiedenen Individuen sollten hierbei erlebt haben, wie es ist, sich zu strecken, es sollte sich bei den verschiedenen Individuen damit ein Streckerlebnis eingestellt haben.
- Verschiedene Individuen gehen in sich fragen sich, ob sie Hunger haben? Bejaht man, hat man drei Erlebnisse: ein Frageerlebnis, ein Hungererlebnis und ein Antwort- oder Ja-Erlebnis.
- Verschiedenen Individuen gehen in sich fragen sich, ob sie tanzen gehen möchten? Verneint man, hat drei Erlebnisse: ein Frageerlebniss, ein Wunschprüfungserlebnis und ein Antwort-Nein-Erlebnis.
- Verschiedene Individuen gehen in sich fragen sich, ob sie das nächste Jahr noch erleben werden? Mit dieser Frage hat man drei Erlebnisse: das Frageerlebnis, das Frageprüfungserlebnis und das Ergebnis/Prognoserlebnis, z.B. Weiß nicht.
- Verschiedene Individuen gehen in sich und frage sich, ob die Menschen den Mars noch besiedeln werden? Hält man das für möglich, hat man ein Frageerlebnis, ein Frageprüfungserlebnis und ein Prognose-Ergebniserlebnis (z.B. möglich)
Diskussion der Beispiele
Alle Beispiele nutzen Worte, die Kleider der Begriffe, was unter Umständen per definitionem, erleben ausschließt. Erleben und ein Erlebnis ist nach Schlick etwas Persönliches, Privates, das in seinem Verständnis seinem Wesen nach nicht kommunizierbar ist. Aber das bleibt erst einmal eine Behauptung. So stellt er immer wieder fest, was er behauptend einführt und festlegt.
Ende der Zusammenfassung
SE-Fundstellen Erleben, Erkennen, Metaphysik
Fundstellen: erleb 78, erleben 16, erlebt(e,en,es) 20, Erlebnis 41, innere Wahrnehmung 0.
Fundstellen im Kontext
Methode der Fundstellen-Textanalyse
* Hauptbedeutungen
Erleben und Erlebnis * Signierungssystem*
Zusammenfassung
Hauptseite * Begriffscontainer
(Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhof
Name-Werkkennung-Seite-ed/Ed- "." -AnzahlErwäh/Seite
S
E
z Typ Trenner
z
Indizierung: SEzed.z
Lesebeispiel SE2E2.1Erlebnis
Der Ausdruck Erlebnis stammt von Moritz Schlick aus seiner Arbeit Erleben,
Erkennen, Metaphysik (1926), die erste Erwähnung
auf Seite 2 mit der Bedeutung E2 Erlebnis als innere Wahrnehmung.
| e | < Erleben Differenzierung > Erlebnis | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E? |
E-Fundstellen im Kontext erleben, erkennen, Metaphysik
SE1: "Gorgias, der große Nihilist, hat behauptet,
daß wir, selbst wenn es77: "
Erkenntnis gäbe, sie doch nicht mitteilen könnten. Er hat
unrecht. Denn
es liegt im Wesen der Erkenntnis, daß sie mitteilbar sein muß.
Mitteilbar
ist, was auf irgendeine Weise formuliert, das heißt, durch irgendwelche
Symbole ausgedrückt werden kann, seien es Worte der Sprache oder
sonstige Zeichen. Jede Erkenntnis besteht nun aber darin, daß
ein Gegenstand,
nämlich der zu erkennende, zurückgeführt wird auf andere
Gegenstände,
nämlich auf diejenigen, durch welche er erkannt wird; und dies
findet darin seinen Ausdruck, daß der erkannte Gegenstand mit
Hilfe
derselben Begriffe bezeichnet wird, welche schon jenen anderen Gegenständen
zugeordnet waren. Es ist also für das Wesen der Erkenntnis
gerade diese symbolische Beziehung des Bezeichnens, der Zuordnung,
charakteristisch, welche zugleich immer schon Ausdruck, symbolische
Darstellung, ist. Erkenntnis ist also das Mitteilbare kat
exochn [schlechthin], jede
Erkenntnis ist mitteilbar und alles Mitteilbare ist Erkenntnis."
SE2: "Was ist nicht mitteilbar? Wenn ich eine rote
Fläche anschaue, so
kann ich niemandem sagen, wie das SE2E2.1Erlebnis
des Rot beschaffen ist.
- RS-SE2E2.1:
(1) Nein. Ich kann sagen ein schwaches, mattes, knalliges, helles, dunkles,
samtiges, grelles, tiedes, schreiendes, intensives, ... rot erleben und auch kommunizieren.
(2) Ich kann überhaupt den Namen der Farbe sagen
(3) Und ich kann eine Bestätigung der Farbe rot durch andere einholen
(4) Der Eindruck rot und damit das Erleben von Rot kann systematisch
hervorgerufen und damit auch kontrolliert werden
SE2E2.2: Der Blindgeborene kann durch keine
Beschreibung eine Vorstellung von dem
Inhalt eines SE2E2.2Farbenerlebnisses
bekommen.
- RS-SE2E2.2: Dass den Farberlebnissen Wahrnehmungen
zugrunde liegen
bestreitet ja niemand.
SEe2.1
Wer nie Lust gefühlt hätte,
würde durch keine Erkenntnis davon unterrichtet werden können,
was
man SE2e2.1erlebt, wenn
man Lust SE2e2.2erlebt.
- RS-SEe2.1: Auch das bestreitet im Grundsatz
niemand: man muss
etwas selbst oder zumindest etwas Ähnliches erlebt haben, um
einen Erlebensbegriff davon zu haben. Man kann es nicht über
Erkenntnis ohne Erlebensbasis unterrichten, aber eben mit schon.
SE2e2.3:
Und wer es einmalSE2e2.3 erlebt
und dann
vergessen hätte und nie wieder zu fühlen imstande wäre,
dem könnten es
auch etwaige eigene Aufzeichnungen niemals sagen.
- RS-SE2e2.3: Auch das bestreitet
im Grundsatz niemand, dass nicht mehr
Erlebbares nicht mehr erlebt werden kann wiewohl man auch das Phänomen
der Phantomschmerzen berücksichtigen muss.
SE2e2.4:
Und das Gleiche gilt,
wie jeder sofort zugibt, von allen Qualitäten, die als Inhalte
des Bewußtseinsstromes
auftreten. Sie werden nur durch unmittelbares SE2e2.4Erleben
bekannt.
- RS-SE2e2.4:
(1) Nein, ich gebe das nicht zu. Es ist zwar richtig, dass
die Inhalte des Bewusstseinsstromes durch unmittelbares Erleben
bekannt werden, aber dieses Erleben kann durch unsere psycho-
soziokulturelle Entwicklung auch durch Denken und Sprache
erkannt und damit kommuniziert werden.
Wir kennen sie schlechthin, und der Inhalt des Kennens kann
durch keine Erkenntnis vermittelt werden; er ist nicht ausdrückbar,
nicht mitteilbar. Der Gegensatz von Kennen und Erkennen, auf den ich
mit so großem Nachdruck hinzuweisen pflege, deckt sich mit dem
Gegensatz
des Nichtmitteilbaren und des Mitteilbaren.
- RS-SE2e2.4:
(2) Das ist eine interessante, aber sehr fragliche Unterscheidung und noch
mehr die Behauptung, dass zwischen kennen und erkennen ein Gegensatz
bestehen soll. Spätestens das Wieder-Kennen ist ein Erkennen - mit
oder ohne Namen.
"Es wird allgemein zugestanden, daß die Frage, ob ein Rot, das ich SE2e2.5erlebe [>3]
ein Rot, das ein anderer SE3e2.1erlebt (z. B. wenn wir gleichzeitig denselben roten
Gezenstand betrachten), dieselbe Farbe sind, daß diese Frage schlechthin unbeantwortbar
ist. Es gibt keine Methode, es ist keine denkbar, mit Hilfe
deren die beiden Rot verglichen und die Frage entschieden werden könnte.
- RS-SE2e2.5: Wie RS-SE2E2.1:
(1) Nein. Ich kann sagen ein schwaches, mattes, knalliges, helles, dunkles,
samtiges, grelles, tiedes, schreiendes, intensives, ... rot erleben und auch kommunizieren.
(2) Ich kann überhaupt den Namen der Farbe sagen
(3) Und ich kann eine Bestätigung der Farbe rot durch andere einholen
(4) Der Eindruck rot und damit das Erleben von Rot kann systematisch
hervorgerufen und damit auch kontrolliert werden
SE3E2.1: Die Frage hat also keinen angebbaren
Sinn, ich kann nicht erklären, was
ich eigentlich meine, wenn ich behaupte, daß zwei verschiedene
Individuen
qualitativ gleiche SE3E2.1Erlebnisse
haben.
- RS-SE3E2.1:
- Erlebnis0 Wacherlebnis, ich bin wach, aufnahme- oder erlebnisfähig (>Landgrebe). Erleben in dieser grundsätzlichen, elementaren Bedeutung bedeutet so viel wie ein- oder angeschaltet; an ("on", "online"), offen, bereit, mich diesem oder jenen Erlebnisinhalt zuzuwenden (intentionsfähig), leere Bühne, Projektionsraum, Projektor eingeschaltet. Widerspricht dem phänomenologischen Intentionalitätsdogma, denn Erlebnis0 ist gerade nicht gerichtet - wie die freischwebende Aufmerksamkeit auch nicht.
- Erlebnis1 eines äußeren Geschehens, bei dem ich dabei war.
- Erlebnis2 eines inneren Geschehens durch die innere Wahrnehmung.
- Erlebnis3 ein besonderes, nicht alltägliches Erlebnis
- Erlebnisr ein reines Erlebnis, eine Konstruktion (entkognitiviert) von der noch weitgehend unklar ist, ob oder wie sie möglich und sinnvoll ist. > Nur_empfinden.
- Erlebnispr ein praktisch reines Erlebnis. Diese Kategorie ist eine bewusste Abmilderung des gedachten reinen Erlebnisses, von dem noch gar nicht sicher ist, ob und wie es das gibt. Sicher ist, dass es ein mehr oder minder von Störelementen freies Erlebnis gibt. Den Index "pr" kann man lesen als praktisch rein (so gut es eben in der Wirklichkeit geht) oder auch als phänomenologisch rein. Beispiel: wenn ich mich auf ein Telefonat konzentrieren will, schalte ich das Störelement Radio aus.
- Erlebniss [1. Version Index a] mit spezifischer Bedeutung, z.B. Flow-Erlebnis nach Csikszentmihalyi [Indizierung: Flow-ErlebnissF] oder Erlebnistypus im Rorschachtest.
- Erlebnis? ein Erlebnis unklarer Bedeutung.
Das geht mit den grundsätzlichen Einschränkungen natürlich nur,
wenn der Erlebnisbegriff klar ist, z.B. so wie ich ihn gefasst und
differenziert habe:
Ein Ausschnitt aus dem Erleben heißt Erlebnis.
SE3E2.2
Es fragt sich, ob man solche Fragen,
die prinzipiell keine Antwort zulassen, selbst als sinnlos bezeichnen
soll,
oder ob man sagen soll: sie haben einen Sinn, wir vermögen nur
nicht, ihn
anzugeben. Wie man sich auch entscheiden möge, auf jeden Fall
wäre es
zwecklos, solche Fragen in der Wissenschaft oder in der Philosophie
aufzuwerfen,
denn es ist ja zwecklos zu fragen, wo man weiß, daß man
keine
Antwort erhalten kann.
Zu diesen Fragen gehört auch die, ob im angegebenen
Beispiel der
Mitmensch überhaupt ein SE3E2.2Farbenerlebnis,
ja überhaupt irgendein
SE3E2.3Erlebnis, ein
Bewußtsein hat; mit anderen Worten, die Frage nach der
Existenz des fremden Ich. Es gehört ferner dazu das Problem der
„Existenz"
einer Außenwelt überhaupt. Was Existenz, was Wirklichkeit
eigentlich
sei, läßt sich nicht begrifflich formulieren, nicht durch
Worte ausdrücken.
Natürlich lassen sich Kriterien angeben, durch die man in Wissenschaft
und Leben das „wirklich Existierende" vom bloßen „Schein" unterscheidet
— aber in der Frage nach der Realität der Außenwelt ist
bekanntlich
mehr gemeint. Was jedoch dieses Mehr eigentlich sei, was man meint,
wenn man der Außenwelt Existenz zuschreibt, ist auf jeden Fall
gänzlich
unaussprechbar. Wir haben nichts dagegen, daß man einer solchen
Frage
einen Sinn beimesse, mit allem Nachdruck müssen wir aber behaupten,
daß dieser Sinn nicht angegeben werden kann.
Wir finden dennoch, daß sich die Philosophen mit Problemen dieser
Art unablässig beschäftigen, und unsere Behauptung ist, daß
der Inbegriff
solcher Fragen sich völlig mit dem deckt, was man von altersher
unter
Metaphysik zu verstehen pflegte. Diese Fragen kommen aber dadurch
zustande, daß das, was nur Inhalt eines Kennens sein kann, fälschlich
für
den möglichen Inhalt einer Erkenntnis gehalten wird, das heißt,
dadurch,
daß versucht wird, das prinzipiell nicht Mitteilbare mitzuteilen,
das nicht
Ausdrückbare auszudrücken. [>4]
- RS: bis zu dieser Stelle, S.3,
kommentiert
sowie S.7 eine Anmerkung zu Schlicks
Berufung auf Carnap.
SE4 "Was aber läßt sich denn nun ausdrücken, wenn
der eigentliche Inhalt
des SE4e2.1Erlebens jenseits
aller Beschreibung ist? Was bleibt übrig, wenn alle
SE3E2.2erlebten Qualitäten,
Farben, Töne, Gefühle, kurz alle inhaltlichen Bestimmungen
des Bewußtseinsstromes als schlechthin subjektiv und unbeschreibbar
für eine Mitteilung nicht in Frage kommen? Man möchte zunächst
glauben, daß überhaupt nichts übrig bleibt, da wir
doch wohl
unsere SE4E2.1Erlebnisse
und Gedanken von allem Inhalt nicht ganz und gar befreien
können. Oder sind etwa die Beziehungen zwischen den Bewußtseinsinhalten
etwas, das der subjektiven Sphäre entrückt ist und daher
mitgeteilt werden kann?
Ich weiß zwar nicht, ob jemand, der einen
roten Gegenstand betrachtet,
dabei das Gleiche SE4e2.2erlebt
wie ich, aber ich stelle fest, daß er diesen Gegenstand
auch stets als rot bezeichnet (wenn er nicht farbenblind ist). Wir
können hieraus schließen, daß wir zwar nicht wissen,
ob das Wort „rot"
für ihn denselben Sinn hat, wie für mich, daß aber
für ihn jedenfalls sich
mit dem Worte „rot" immer der gleiche Sinn verbindet. Wir könnten
also versucht sein zu sagen, daß jedenfalls die Beziehung der
Gleichheit
zwischen zwei SE4E2.2Erlebnissen
von ihm ebenso SE4e2.3erlebt
würde wie von mir. Aber
dies wäre nicht richtig formuliert, denn wiederum braucht das
SE4E2.3Gleichheitserlebnis
qualitativ, inhaltlich, beim anderen nicht dasselbe zu sein wie
bei mir. Das SE4E2.4Beziehungserlebnis,
das er hat, wenn er etwa zwei gleiche
Gegenstände sieht, könnte von meinem SE4E2.5Beziehungserlebnis
unter gleichen
Umständen verschieden sein — immer vorausgesetzt, daß es
einen Sinn
hätte, hier von Gleichheit oder Verschiedenheit überhaupt
zu reden. SE4E2.6Erlebnisse
von Beziehungen nämlich enthalten — wie alle
SE4E2.7Erlebnisse
— auch
immer qualitative Momente, sie sind inhaltlich verschieden. Wodurch
z. B. sich das SE4e2.8Erlebnis
eines räumlichen Nebeneinander von demjenigen
eines zeitlichen Nacheinander unterscheidet, läßt sich nicht
auf Begriffe
bringen, sondern es muß in letzter Linie SE4e2.3erlebt
werden. Die anschaulich
räumlichen und die anschaulich zeitlichen Beziehungen haben qualitativ
verschiedene Inhalte und dasselbe gilt von allen unmittelbar
SE4e2.4erlebten
Beziehungen. Wenn also weder die Inhalte des Bewußtseins, noch
die
Beziehungen zwischen ihnen ausdrückbar sind, was bleibt dann als
mitteilbar
übrig?
Daß merkwürdigerweise tatsächlich noch etwas übrig
bleibt, zeigt uns [>5]
SE5: "die logische Lehre von der „impliziten Definition". Denn das Wesen
dieser
Art von Definition besteht darin, daß sie Begriffe festlegt,
ohne im geringsten
auf etwas Inhaltliches hinzuweisen, ohne auf irgendwelche qualitativen
Merkmale zurückgreifen zu müssen. Diese Lehre, welche hier
nicht näher dargestellt werden kann1), bestimmt die Begriffe dadurch,
daß sie rein formale, jeglichen Inhaltes entkleidete Beziehungen
zwischen
ihnen aufstellt. Das Wesen der implizit definierten Begriffe besteht
darin,
diesen rein formalen Beziehungen zu genügen. (Z. B. die Beziehung
"zwischen", die in der impliziten Definition der Grundbegriffe der
ab-
strakten Geometrie auftritt, enthält in keiner Weise irgend etwas
von dem
anschaulichen Sinn, den wir mit diesem Worte verbinden, sondern be-
deutet nur eine Beziehung überhaupt, ohne über ihr „Wesen",
über ihre
"Natur" irgend etwas vorauszusetzen; es wird nur erfordert, daß
das
Wort immer eine und dieselbe Beziehung bezeichne.) Die implizite
Definition stellt aber die einzige Möglichkeit dar, zu gänzlich
inhaltleeren
Begriffen zu gelangen (denn sowie ich die Begriffe nicht, wie die
implizite Definition es tut, durch ihre gegenseitigen Relationen definieren
wollte, könnte ich sie nur durch Zuordnung zu etwas Wirklichem
festlegen,
und dadurch wäre ihnen ein Sachinhalt beigelegt), folglich können
wir aus ihr die Lösung unseres Problems entnehmen und dürfen
sagen:
da nichts Inhaltliches aus der ungeheuren Mannigfaltigkeit unserer
SE5E2.1Erlebnisse
zum Gegenstand einer Aussage gemacht werden kann, so läßt
sich mit irgendwelchen Aussagen kein anderer Sinn verbinden als der,
daß sie rein formale Beziehungen ausdrücken. Und was dabei
unter einer
„formalen Beziehung" oder „Eigenschaft" zu verstehen ist, muß
der Lehre
von der impliziten Definition entnommen werden.
Diese Bestimmung ist schlechthin fundamental und
von unabseh-
barer Tragweite für die ganze Philosophie. Ihre Richtigkeit muß
jeder
zugeben, der sich von der unbezweifelbaren Tatsache überzeugt,
daß alles
Qualitative und Inhaltliche an unseren SE5E2.2Erlebnissen
ewig privatim bleiben
muß und auf keine Weise mehreren Individuen gemeinsam bekannt
zu
werden vermag. Es ist, so paradox es klingen mag, buchstäblich
wahr,
daß alle unsere Aussagen von den gewöhnlichsten des täglichen
Lebens
bis zu den kompliziertesten der Wissenschaft, immer nur formale Bezie-
1) Vgl. meine Allgemeine Erkenntnislehre.
2. Aufl. 1925. § 7. [>6]
SE6: "hungen der Welt wiedergeben, und daß schlechthin nichts
von der Qualität
der SE6E2.1Erlebnisse
in sie eingeht. Man hat oft von der Physik gesagt, meist
mit der Absicht eines Vorwurfes, daß sie die qualitative Seite
der Welt
gänzlich unberücksichtigt lasse und an deren Stelle ein Gebäude
vori
leeren abstrakten Formeln und Begriffen gebe. Jetzt sehen wir, daß
die
Aussagen der theoretischen Physik sich in dieser Hinsicht nicht im
geringsten
von allen anderen Aussagen des täglichen Lebens und auch denen
der
Geisteswissenschaften unterscheiden. Nur scheinbar geht in die letzteren
-etwas von der qualitativen Buntheit des Universums ein, weil in ihren
Sätzen viele Worte vorkommen, welche unmittelbar
SE6e2.1Erlebtes
bezeichnen.
Dem Physiker scheint es versagt zu sein, mit dem Dichter von einer
grünen
Wiese und einem blauen Himmel zu sprechen, oder mit dem Historiker
von der Begeisterung eines Helden der Geschichte oder der Verzückung
eines Religionsstifters. Es ist richtig, daß er diese Worte nicht
verwendet,
aber es ist nicht richtig, daß er mit Hilfe seines Begriffssystems
prinzipiell
nicht imstande wäre auch alles das auszudrücken, was den
mitteilbaren
Sinn der Äußerungen des Historikers und des Dichters bildet.
Denn der
Sinn jener vom Dichter oder Psychologen gebrauchten Worte kann unter
allen Umständen nur durch Zurückgehen auf die formalen Beziehungen
zwischen den Gegenständen angegeben und erklärt werden. Das
Wort
„grün" ist nicht reicher (im Gegenteil, sogar ärmer) als
der Begriff der
Frequenz der Lichtschwingungen, welchen der Physiker an seine Stelle
setzt. Das Wort „grün" drückt ja nicht wirklich aus, was
man beim Anschauen
einer grünen Wiese SE6e2.2erlebt,
das Wort ist dem SE6E2.2Grünerlebnis
nicht
inhaltllich verwandt, sondern es drückt nur eine formale Beziehung
aus,
durch die alle Gegenstände, die wir grün nennen, miteinander
verbunden
sind'). Die Geisteswissenschaften und die Dichtung unterscheiden sich
nicht
dadurch von der exakten Erkenntnis, daß sie etwas ausdrücken
könnten,
- FN6.1) Man vgl. die scharfsinnigen
und unwiderleglichen Ausführungen von R. Carnap
in seinem Werk „Der logische Aufbau der Welt", in dem er dartut, daß alle wissen-
schaftlichen Urteile sich auf reine Strukturaussagen — dieser Begriff entspricht
unseren „Formalen Beziehungen" — beschränken müssen. Wir fügen hinzu, daß
dies von allen sinnvollen Urteilen überhaupt gilt, denn die Argumente bleiben für alle,
auch die nichtwissenschaftlichen Aussagen gültig. Vgl. ferner Ludwig Wittgenstein,
„Tractatus logico-philosophicus", deutsch und englisch, London 1922. [>7]
| Wie kann sich Schlick 1926 auf ein Werk - Der logische Aufbau der
Welt von Rudolf Carnap - berufen, das erst zwei Jahre später,
nämlich 1928, erscheint?
Nun, Der logische Aubau der Welt ist zwar 1928 erschienen, aber lag bereits 1926 als Habilitationsschrift in Wien vor und damit auch Schlick. |
- _
Carnap in Der Logische Aufbau der Welt, 1928, RNr 16, S. 20:
"Alle wissenschaftlichen Aussagen sind Strukturaussagen
... Nun besagt eine Grundthese der Konstitutionstheorie (vgl.
§ 4), deren Nachweis in den folgenden Untersuchungen erbracht werden
soll, daß es im Grunde nur ein Gegenstandsgebiet gibt, von dessen Gegenständen
jede wissenschaftliche Aussage handelt. Damit fällt die
Notwendigkeit der Angabe des Gegenstandsgebietes in jeder Aussage
fort, und wir erhalten das Ergebnis, daß jede wissenschaftliche Aussage
grundsätzlich so umgeformt werden kann, daß sie nur
noch eine Strukturaussage ist. Diese Umformung ist aber nicht
nur möglich, sondern gefordert. Denn die Wissenschaft will vom Objektiven
sprechen; alles jedoch, was nicht zur Struktur, sondern zum
Materialen gehört, alles, was konkret aufgewiesen wird, ist letzten
Endes subjektiv."
Andererseits finde ich in Carnap Aufbau, z.B. unter Rnr 76, S. 108:
- "... So heißen also zwei Farbempfindungen übereinstimmend,
wenn
sie in Farbton, Sättigung, Helligkeit und im Lokalzeichen, also damit
auch in der Stelle des Sehfeldes, übereinstimmen; ..."
Präsentation und Analyse von Erleben und Erlebnis bei Rudolf Carnap
in Der logische Aufbau der Welt angehen werde.
SE7: "was dieser versagt ist (sie können im Gegenteil nur weniger aussagen), sondern
dadurch, daß sie nicht nur ausdrücken, sondern zugleich et was anderes
erreichen wollen. Sie wollen nämlich in letzter Linie SE7E2.1Erlebnisse anregen
und hervorrufen, das Reich des SE7e2.1Erlebens in bestimmten Richtungen bereichern;
die Erkenntnis ist für die Geisteswissenschaften (obwohl sie dies
manchmal ungern zugeben) nur Mittel zum Ziel; die Dichtung erreicht das
Ziel sogar ohne jedes Mittel durch direkte Erregungen. Nicht mit Unrecht
stellt man daher manchmal dem Erkennen der exakten Wissenschaften
das „Verstehen" der Geisteswissenschaften gegenüber, welch letzteres
eine Art von SE7e2.2Erleben ist, das sich an gewisse Erkenntnisse anschließt.
Der Historiker hat einen geschichtlichen Vorgang „verstanden", wenn er
sich die SE7E2.2Erlebnisse verschafft (SE7e2.3nacherlebt) hat, von denen er glaubt, daß
sie auch in den an jenem Vorgange beteiligten Personen stattgefunden
haben. Über das Wertverhältnis mag man denken wie man will — mir
persönlich versteht es sich von selbst, daß Bereicherung des SE7e2.4Erlebens
immer die höhere Aufgabe, ja die höchste überhaupt bildet — nur hüte
man sich vor der Verwechslung dieser so scharf getrennten Sphären:
tiefes SE7e2.5Erlebenist nicht deshalb wertvoller, weil es eine höhere Art der
Erkenntnis bedeutete, sondern es hat mit Erkenntnis überhaupt nichts
zu tun; und wenn Welterkenntnis nicht mit SE7E2.3Welterlebnis identisch ist, so
nicht deshalb, weil die Erkenntnis ihre Aufgabe nur schlecht erfüllte,
sondern weil dem Erkennen seinem Wesen und seiner Definition nach von
vornherein seine spezifische Aufgabe zufällt, die in ganz anderer Richtung
liegt als das SE7e2.6Erleben.
SE7E2.4Erlebnis ist Inhalt, das Erkennen geht seiner Natur nach auf die reine
Form. Unbewußte Einmengung des Wertens in reine Wesensfragen verführt
immer wieder dazu, beides zu vermischen. So lesen wir bei H. Wey11)
„Wer freilich in logischen Dingen nur formalisieren, nicht sehen will —
und das Formalisieren ist ja die Mathematikerkrankheit —, wird weder
bei Husserl noch bei Fichte auf seine Rechnung kommen." Aber uns ist
1) Jahresber. d. deutsch. Mathemat. Vereinigg. 28, 1919. S. 85. Aus der neuesten
Publikation Weyls jedoch (ich füge dies bei der zweiten Korrektur hinzu), seiner vor-
trefflichen „Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft" in dem „Handbuch
der Philosophie", München und Berlin 1926, geht hervor, daß er mit den Voraussetzungen
unserer obigen Ausführungen im Grunde völlig übereinstimmt. a. a. 0. S. 22, Zeile 9-30. [>8]
SE8: "klar: wenn das Formalisieren eine Krankheit ist, so kann niemand
gesund
sein, der überhaupt irgendeine Erkenntnis um ihrer selbst willen
gewinnen
will. Die rein formale Aufgabe und Funktion der Erkenntnis wird vielleicht
am besten ausgedrückt, indem man sagt: alles Erkennen ist stets
ein
Ordnen und Berechnen, niemals ein Schauen und SE8e2.1Erleben
der Dinge.
Alle Erkenntnis ist also ihrem Wesen nach Erkenntnis
von Formen,
Beziehungen, und nichts anderes. Nur formale Beziehungen in dem definierten
Sinn sind der Erkenntnis, dem Urteil im rein logischen Sinne des
Wortes zugänglich. Dadurch aber, daß alles Inhaltliche,
nur dem Subjekt
Angehörige, nicht mehr darin vorkommt, haben Erkenntnis und Urteil
zugleich den einzigartigen Vorteil gewonnen, daß nunmehr ihre
Geltung
auch nicht mehr auf das Subjektive beschränkt ist.
Zwar könnte man argumentieren: die Relationen,
die ein Urteilender
auszudrücken vermöge, seien zunächst doch eben Beziehungen
zwischen
seinen SE8E2.1Erlebnissen,
darüber komme er nicht hinweg und man müsse also
bei der Ansicht stehen bleiben, die in der Kantschen Formulierung lautet:
Erkenntnis ist nur von Erscheinungen — das heißt nur von Immanentem
— möglich. Aber in Wahrheit steht es damit so: entweder man stellt
sich auf den Standpunkt des Instantan-Solipsismus, für den nur
das
jeweils im Augenblick von mir SE8e2.2Erlebte
„wirklich" ist, oder man macht
auch Aussagen über andre Gegenstände als unmittelbare
SE8E2.2Erlebnisse.
Wir nennen die nicht SE8e2.3erlebten
Gegenstände „transzendent", unbekümmert
darum, ob man sie (mit dem strengen Positivismus) als logische Konstruktionen
auffaßt, oder (mit dem Realismus) ihnen „selbständige Realität"
zuschreibt. Der Unterschied zwischen beiden Standpunkten betrifft ja
nach dem früher Gesagten nur Unaussprechbares, kann also selbst
nicht
formuliert werden. Es ist gleichgültig, ob sich der Sinn der Behauptung,
daß diese transzendenten Gegenstände wirklich seien, angeben
läßt oder
nicht, auf jeden Fall werden sie zu den SE8E2.3Erlebnissen
in bestimmten Relationen
stehend gedacht. Das gilt auch von Kants Ding an sich. Denn in dem
Terminus „Erscheinung" liegt schon eine bestimmte Beziehung auf etwas,
das da erscheint. Wollte man diese Beziehung nicht als eine feste anerkennen,
so würde das Vorhandensein der Erscheinung gar nicht an ein bestimmtes
Ding gebunden sein, sie wäre also gar nicht seine Erscheinung,
sondern
etwas Selbständiges, die Rede von der „Erscheinung" wäre
überhaupt [>9]
SE9: "sinnlos. Diese bloß formale Beziehung der Zuordnung der
gegebenen
SE9E2.1Erlebnisse
zu nicht gegebenen (transzendenten) Gegenständen, die stets angenommen
werden muß, um von den letzteren Gegenständen überhaupt
reden
zu können, genügt aber, um auch sie restlos erkennbar zu
machen. Denn
wenn irgendwelche Gegenstände der Welt der SE9E2.2Erlebnisse
eindeutig zuge:,
rdnet sind, so ist jede Aussage über die letzteren, da sie ja
nur die formalen
Beziehungen trifft, zugleich eine Aussage über die ersteren. Die
formalen
Relationen der „transzendenten" Gegenstände nämlich sind
durch jene
Zuordnungen ja vollkommen mitbestimmt. Die „Dinge an sich" sind
also in genau demselben Sinne und Maße erkennbar wie die „Erscheinungen",
diese sind der Wissenschaft nicht um ein Haar besser zugänglich
als jene. Freilich sind nur die immanenten Gegenstände kennbar
(= eriebbar),
die transzendenten nicht — aber dieser Unterschied ist für die
Erkenntnis weder interessant noch faßbar. Kant kam zu seiner
Lehre der
Unerkennbarkeit der Dinge durch eine Verwechslung von Kennen und
ErkennenFN1) . . . Klar findet man die hier gewonnene
Einsicht formuliert
bei B. Russe1lFN2: „ Jeder Satz, der einen mitteilbaren Sinn hat, muß
von
beiden Welten gelten oder von keiner: der einzige Unterschied muß
in
jenem Wesen des Individuellen liegen, das nicht durch Worte wiedergegeben
werden kann und der Beschreibung spottet, und das eben aus
diesem Grunde für die Wissenschaft irrelevant ist."
Nach dem Vorhergehenden ist kein Zweifel, daß
echte Erkenntnis der
transzendenten Welt sehr wohl möglich ist und von jedem zugegeben
werden muß, der nicht überhaupt auf dem Standpunkt des Instantan-
Solipsismus steht und es daher überhaupt ablehnt, von transzendenten
Dingen zu sprechen. (Wir erinnern noch einmal daran, daß es gleichgültig
ist, ob man unter diesen Dingen bloße logische Konstruktionen
oder selbständige Wirklichkeiten versteht, denn zwischen beiden
Auffassungen
ist kein ang ebb ar er Unterschied.) Definiert man also, wie
es gewöhnlich geschieht, die Metaphysik als die Wissenschaft vorn
Transzendenten,
so ist sie nicht bloß möglich, sondern die allerleichteste
Sache
von der Welt. Dann wäre jede Wissenschaft Metaphysik und jedes
Kind
machte fortwährend metaphysische Aussagen. Denn alle Sätze,
die wir
- FN9.1) Vgl. auch meine „Allgemeine
Erkenntnislehre", § 27 der 2. Auflage.
FN9.2) B. Russell, „Introduction to Mathematical Philosophy". S. 61.
SE10: "überhaupt aussprechen, haben ja einen über das
unmittelbar Gegebene,
SE10e.1Erlebte hinausgehenden
Sinn, also nach unserer Terminologie eine transzendente
Bedeutung. ... Während
wir nämlich diesseits der Grenze nur das unmittelbar
SE10e.2Erlebte,
schlechthin
Gegebene, Bekannte ansetzen und alles andere zum Transzendenten
rechneten, nehmen die Vertreter der induktiven Metaphysik eine alte
Ansicht unkritisch auf, die alle jene Gegenstände, über welche
Einzelwissenschaft
und Alltag gültige Aussagen machen, durchaus nicht dem
Transzendenten beizählt, sondern zusammen mit dem Gegebenen einer
erweiterten „empirischen Welt" zurechnet.
SE12: " .... Dann aber
würde das Wort Metaphysik als Wissenschaft vom Transzendenten
keine
gegen die Einzelwissenschaften grundsätzlich abgegrenzte oder
je von
ihnen scharf zu trennende Disziplin bedeuten, sondern Metaphysik würde
nur den Inbegriff der allgemeinsten Hypothesen darstellen, welche zwar
auf Grund der SE12E.1Erfahrungserlebnisse
aufgestellt werden, über deren Richtigkeit
sich aber die Wissenschaft zur Zeit der Aussage enthalten muß."
SE13f: "Diese besondere Erkenntnisart der Metaphysik
ist die Intuition. Diese Intuition ist nicht etwa jene ahnende Vorwegnahme
eines Erkenntnisresultates, die bei allen großen Entdeckungen
der gedanklichen Ableitung vorherzugehen pflegt, nicht jenes Erraten
verborgener Zusammenhänge, das nur dem genialen Forscher gelingt,
und mit Recht „intuitive Erkenntnis" im empirischen Sinne heißen
darf, [>14]
sondern sie ist nichts anderes als das schlichte Vorhandensein eines
Bewußtseinsinhaltes,
ein bloßes Gegenwärtigsein, das vor aller geistigen Verarbeitung,
vor aller Erkenntnis liegt, kurz sie ist einfach das, was wir oben
SE14e.1Erleben nannten.
Diese metaphysische Intuition soll dort vorliegen,
wo das Bewußtsein mit dem zu erkennenden Gegenstand eins wird,
sich
mit ihm identifiziert, verschmilzt, oder, wie der bildliche Ausdruck
lautet,
in sein Inneres eindringt. Wir sehen also: der Metaphysiker will die
Dinge
gar nicht erkennen, sondern er will sie SE14e.2erleben.
Daß er dies SE14e.3Erleben
mit dem Worte Erkennen bezeichnet,
steht ihm schließlich frei, aber
das bedeutet natürlich eine Äquivokation. Dieser Äquivokation
fällt er
auch zum Opfer, indem er glaubt, daß beide irgend etwas gemein
hätten,
z. B. ein gemeinsames Ziel. Daß dies nicht der Fall ist, habe
ich oben angedeutet
und an anderem Orte') ausführlich dargetan.
Nun heißt etwas SE14e.4erleben,
es als Bewußtseinsinhalt haben. Der Metaphysiker
will also die Gegenstände dadurch erkennen, daß er sie zu
Inhalten
seines Bewußtseins macht. Aus diesem Grunde ist die am meisten
typische und verbreitete Art der Metaphysik der Idealismus in seinen
verschiedenen Formen, welcher behauptet, die transzendente Wirklichkeit
sei irgendwie von der Art der Idee, der Vorstellung, als des typischen
Bewußtseinsinhaltes.
So erkennen wir bei Platon das Transzendente, indem
wir die Idee schauen, das heißt teilweise in unser Bewußtsein
aufnehmen;,
so stellt sich der Voluntarismus (etwa Schopenhauers) vor, daß
das SE14E.2Erlebnis,
welches wir haben würden, wenn ein transzendentes Ding in unsere
Seele einträte, stets ein SE14E.3Willenserlebnis
sein müsse; in derselben Weise
ist auch Bergsons elan vital aufzufassen; so ist auch Spinozas metaphysische
Substanz dasjenige, „quod per se concipitur" usw. Aber auch der Materialismus,
dessen Grundgedanke auf den ersten Blick in der entgegengesetzten
Richtung zu liegen scheint, geht in Wahrheit denselben Weg.
Denn bei näherer Betrachtung zeigt sich, daß die Materie,
welche er zur
metaphysischen Substanz erhebt, von ihm durchaus sinnlich vorstellbar
gedacht wird; ihm ist der Inhalt des Begriffs Materie ein Letztes,
unmittelbar
Gegebenes. Seiner Anschauung liegt der dunkle Glaube zugrunde,
daß er durch das SE15E.4Erlebnis,
das er beim Anschauen oder Betasten, [15]
- 1) Vgl. auch meine „Allgemeine Erkenntnislehre'', §
12 der 2. Auflage.
SE15 "eines Körpers hat, des „wahren Wesens" der Substanz direkt
inne werde. —
Genug der Beispiele. Sie alle zeigen, daß das Streben der Metaphysik
in der Tat immer auf Intuition des Transzendenten gerichtet ist.
Und wie steht es mit der Erfüllbarkeit dieses
Strebens, mit der Mög-
lichkeit dieser metaphysischen „Erkenntnis"? Nun, da Intuition SE15E.1Erlebnis
ist und da der Inhalt eines SE15E.2Erlebnisses
eben ein Bewußtseinsinhalt, also
lefinitionsgemäß etwas Immanentes ist, so folgt, daß
„intuitive Erkenntnis
des Transzendenten" ein Nonsens, eine widerspruchsvolle Wortverbindung
ist. Intuition ist ihrem Wesen nach auf das Immanente beschränkt
(und sie ist keine Erkenntnis des Immanenten). Die transzendente
Wirklichkeit kann nicht erlebt werden, sie ist nur insofern und
solange transzendent, als sie nicht SE15e.1erlebt
wird; dies ist ja ihre Definition.
Wer etwa mit dem Voluntarismus behauptet, die metaphysische Natur
des transzendenten Seins sei der Wille, — der sagt in Wahrheit: wäre
das
nicht SE15e.2Erlebte erlebt,
so wäre es Wille — und spricht damit gleichfalls
Nonsens, denn die Hypothesis enthält einen Selbstwiderspruch.
Wer
ferner z. B. sagt, wie der Spiritualismus oder Psychomonismus es tut,
metaphysisch sei das Transzendente psychischer Natur, der sagt in
Wahrheit : wenn das Transzendente nicht transzendent, sondern immanent
- wäre, so wäre es Bewußtseinsinhalt — und das ist
teils eine Contradictio,
eine Tautologie. (Soll aber mit der spiritualistischen Behauptung gemeint
sein, daß es eben gar kein transzendentes Sein gäbe, daß
alles Wirkliche
immanent sei, daß nur Bewußtseine und ihre Inhalte existieren
(Berkeley) — so gehört diese Behauptung — gesetzt sie hätte
einen Sinn —
zu denjenigen oben erwähnten, deren Sinn jedenfalls nicht angebbar,
aussprechbar
ist, jedes Wort darüber wäre leerer Schall.)
Und hierzu gesellt sich der zweite Widerspruch.
Gesetzt nämlich, das.
Unmögliche sei möglich geworden, der Metaphysiker habe das
Unschaubare
geschaut; so glaubt er dieses sein Erlebnis nun in Worten und Begriffen
darstellen zu können (denn wozu schriebe er sonst seine Bücher
?)
— und wir wissen schon, daß dies heißt: er wünscht
das prinzipiell Unausdrückbare
auszudrücken. Nach dem früher Gesagten müßte bei
dieser
Übersetzung in Worte und Symbole gerade das wieder verloren gehen,
was das Spezifische am SE15E.3Erlebnis
war, nur die formalen Relationen würden
übrig bleiben und allein aus den Symbolen wieder ablesbar sein;
diese [>16]
SE16: "aber hätte er auch ohne jenes SE16E.1Erlebnis,
ohne Intuition, genau so gut ge-
winnen können, denn wir hatten ja eingesehen, daß die formalen
Bezie-
hungen des Transzendenten durch die gewöhnliche diskursive Erkenntnis
der empirischen Wissenschaften bereits restlos erreichbar sind. Durch
die Methoden der Einzelwissenschaften wird prinzipiell alle Erkenntnis
vom Seienden gewonnen; jede andere „Ontologie" ist leeres Geschwätz.
Der Philosoph mag noch so viele Worte für das SE16E.2Erlebnis
suchen: er kann
mit ihnen nur die formalen Eigenschaften desselben treffen, der Inhalt
entschlüpft ihm stets. Selbst wenn es also eine „intuitive Erkenntnis"
in
seinem Sinne gäbe, bliebe dem Metaphysiker nichts als — Schweigen.
Wir können leicht verstehen, warum wir uns nicht des Gefühles
erwehren
können, es sei doch nicht schlechthin sinnlos, eine solche Aussage
zu machen wie etwa die des Voluntarismus „alles Wirkliche ist Wille".
Sie
ist sinnlos als metaphysische Aussage, das heißt, wenn wir mit
dem
Worte Wille das unmittelbare SE16E.3Erlebnis
des Wollens selbst seinem Inhalt
nach bezeichnen. Aber dies ist nicht seine einzige Bedeutung, es können
auch die formalen Eigenschaften des Willensvorganges damit gemeint
sein, und dann bekommt jener Satz sofort einen empirischen Sinn;
durch diskursive Erkenntnis kann prinzipiell seine Richtigkeit bestätigt
oder widerlegt werden. Hätte man nämlich festgestellt, daß
die in jedem
SE16E.4Willenserlebnis
auftretenden Sukzessionen und Koexistenzen seiner psychologischen
Komponenten einer bestimmten Strukturformel gehorchen,
so würde der Inhalt des wissenschaftlichen Begriffes „Wille" nunmehr
eben diese bestimmte formale Struktur sein, und die voluntaristische
Behauptung
„alles ist Wille" würde besagen: alles Geschehen in der Welt
ist von der Art, daß es durch eben jene Strukturformel beschrieben
werden
kann (ein physikalisches Analogon: die Behauptung „alle Materie ist
elektrischer
Natur" bedeutete „alles materielle Geschehen läßt sich durch
die
Grundgleichungen der Elektrizitätslehre beschreiben"). Man sieht,
dies
ist jetzt keine metaphysische Behauptung mehr, sondern ein Satz der
Wissenschaft, der auf empirischem Wege geprüft werden könnte.
In ähnlicher
Weise kann man andere metaphysische Sätze in empirisch-wissenschaftliche
umwandeln, indem man ihren Worten die entsprechenden
formalen Bedeutungen gibt — wobei sich dann allerdings fast in allen
Fällen herausstellt, daß man keinen Grund dafür findet,
diese Sätze zu be-
EEM17: "haupten. Sobald wir die Sätze aber metaphysisch verstehen,
also unmittelbare
SE17E.1Erlebnisinhalte
als Bedeutung der Worte festsetzen, und darauf
diese Worte doch auf Transzendentes anwenden, dann werden jene Sätze
nicht bloß falsch, sondern durch den zwiefachen Widerspruch in
ihnen
von Grund aus unsinnig.
Metaphysik ist also unmöglich, weil sie Widersprechendes
verlangt.
Strebte der Metaphysiker nur nach SE17e.1Erleben,
so wäre sein Verlangen er-
füllbar, nämlich durch Dichtung und Kunst und durch das Leben
selber,
welche durch ihre Erregungen den Reichtum der Bewußtseinsinhalte,
des
Immanenten vermehren. Indem er aber durchaus das Transzendente
SE17e.2erleben will,
verwechselt er Leben und Erkennen und jagt, durch doppelten
Widerspruch benebelt, leeren Schatten nach. Nur ein Tröstliches
ist
dabei: daß nämlich auch die metaphysischen Systeme selbst
Mittel zur
Bereicherung des Innenlebens sein können, auch sie regen ja SE17E.2Erlebnisse
an und vermehren dadurch die Mannigfaltigkeit des Immanenten, des
Gegebenen. Sie vermögen gewisse Befriedigungen zu gewähren,
weil sie
wirklich etwas von dem geben können, was der Metaphysiker sucht,
nämlich
SE17e.3Erleben. Freilich
ist es nicht, wie er glaubt, ein SE17E.3Erlebnis
des Transzendenten.
Wir sehen, in welchem präzisen Sinne die oft geäußerte
Meinung
richtig ist, daß metaphysische Philosopheme Begriffs-Dichtungen
seien: sie spielen im Kulturganzen in der Tat eine ähnliche Rolle
wie die
Dichtung, sie dienen der Bereicherung des Lebens, nicht der Erkenntnis.
Sie sind als Kunstwerke, nicht als Wahrheiten zu werten. Die Systeme
der Metaphysiker enthalten manchmal Wissenschaft, manchmal Poesie,
aber sie enthalten niemals Metaphysik."
Fundstellen-27 Allgemeine Erkenntnislehre 2. Auflage 1925
Querverweis Schlick aus SE9: "
.... Kant kam zu seiner Lehre der
Unerkennbarkeit der Dinge durch eine Verwechslung von Kennen und
Erkennen1)"
- [Fußnote "1) Vgl. auch meine „Allgemeine Erkenntnislehre", 27
der 2. Auflage."
- 27 der 2. Auflage, trägt die Überschrift Wesen und Erscheinung
S. 214-224.
Dort wird aber die "Verwechslung" von kennen und erkennen gar nicht thematisiert
- In 27 Wesen und Erscheinung, der 2. Auflage gibt es 10 Fundstellen
"kennen",
davon 2 Pseudo (anerkennen), 2 kennen und 6 erkennen, also inhaltlich relevante 8.
Fundstellen Erkenntnis 15 (24, davon 3 im Vorkapitel 26, 1 im übergeordneten Titel B.,
und 5 in den Kopfzeilen des 27: 216, 218, 220, 222, 224).
Fundstellen Erleben 2, erlebt 3, Erlebnis...5 :
- SA215: "Obwohl der Begriff der Wirklichkeit letztlich
aus dem SA27e.1Erleben
stammt, weil das gegebene Reale das einzige ist, das wir SA27Ken.1kennen, so wird
doch bereits bei seiner bewußten Bildung sein Gültigkeitsbereich auf ein
Sein jenseits des SA27e.2Erlebens ausgedehnt; von der Philosophie aber wurde
alsbald - wie das bei solchen Entwicklungen zu gehen pflegt - diejenige
Sphäre des Begriffs als die vorzüglichste und wesentlichste proklamiert,
welche von seiner Quelle am weitesten entfernt liegt. Das
heißt also in unserem Falle: das Wirkliche jenseits des Bewußtseins wird
für eine Realität höherer Ordnung erklärt, für ein echteres Sein, dem
gegenüber die Welt des Bewußtseins nur ein Schatten und flüchtiger
Abglanz ist."
SA.216: "Die Dinge an sich sind bei KANT unerkennbar, und auf die Frage:
was SA27Erk.1erkennen wir denn? antwortet er: nur Erscheinungen! ..."
SA.217: " ....Denn was soll es
heißen, zu sagen, die seelischen Realitäten würden gar nicht so SA27e.3erlebt
wie sie sind, sondern wir lernten nur ihre Erscheinungen kennen? Gerade
diese Bewußtseinswirklichkeit, der unser Begriff des Seins überhaupt
entstammt, würde damit für ein Sein zweiter Ordnung erklärt, denn es
soll ja nicht in sich selbst genugsam existierend, nicht reines Wesen,
sondern nur Erscheinung eines andern sein! ...."
SA220 Pseudo: "anzuerkennen"
SA221: "Der Phänomenalismus1), welcher ja dem Begriff der "Erscheinung"
seinen Namen verdankt und behauptet, daß wir nur diese und nicht das
Wesen der Dinge SA27Erk.2erkennen, ist überhaupt gänzlich unhaltbar; es kann
mit aller Strenge bewiesen werden, daß seine Position in sich selbst
widerspruchsvoll ist.
Wir haben wiederholt betont, daß die Dinge an sich freilich als SA27Erk.3unerkennbar
angesehen werden müßten, wenn man mit KANT glaubte, daß
zur Erkenntnis eines Gegenstandes seine unmittelbare Anschauung notwendig
erfordert werde, und jedesmal haben wir dargetan, daß man dies
eben nicht glauben dürfe, weil das SA27Erk.4Erkennen so nicht definiert werden
kann, sondern prinzipiell mit Anschauen nichts zu tun hat. Durch die
nähere Betrachtung des Phänomenalismus wird das noch bestätigt.
Denn es zeigt sich bald, daß die Behauptung, wir könnten von den Dingen
an sich gar nichts weiter aussagen als ihre Existenz, sich nicht aufrecht
erhalten läßt."
SA222: "Mit einem ·Wort: es muß angenommen werden, daß jedem Bestimmungsstück
der "Erscheinungen" irgend etwas an den Dingen an
sich korrespondiert, eindeutig zugeordnet ist. Und dies genügt vollkommen,
um die Welt an sich nicht nur zu SA27Erk.5erkennen, sondern auch in
demselben Grade und Umfang zu SA27Erk.6erkennen wie die Sinnenwelt, weil zur
SA§27Erk.7Erkenntnis nichts anderes erfordert wird als die Möglichkeit der eindeutigen
Zuordnung. Ja wir müssen sogar erklären und haben es früher
schon ausgesprochen, daß überhaupt jede SA27Erk8Erkenntnis der Sinnendinge
zugleich eine solche der transzendenten Wirklichkeit ist; denn unsere
Begriffe sind Zeichen für die einen sowohl wie für die andere."
SA223: "Noch von einer anderen Seite her können
wir die Unmöglichkeit der
phänomenalistischen Position einsehen. Da nämlich das Kennzeichen
alles Wirklichen darin besteht, daß es zeitlich eingeordnet vorgestellt
werden muß, so besagt die Behauptung des Phänomenalismus:
es gibt
Dinge, von denen wir wissen, daß sie zu einer bestimmten Zeit
da sind,
sonst aber weiter nichts. Die Möglichkeit eines gerade in dieser
Weise
beschränkten Wissens ist nun aber durch die Natur des SA27Erk9Erkennens
schlechthin ausgeschlossen. Denn die empirischen Regeln, die zur zeitlichen
Einordnung eines Ereignisses oder Dinges führen, setzen zu ihrer
Anwendung bereits mannigfache Kenntnis der Beziehungen des Ereignisses
zu andern voraus. "
Aus SA§3 Allgemeine Erkenntnislehre:
"§ 3. Das SA3Erk.1Erkennen
in der Wissenschaft. ...
SA11: "Häufig findet man auch die Formulierung, SA3Erk.2Erkennen
sei "Zurückführung
des Unbekannten auf Bekanntes". Dies ist aber eine verkehrte
Ausdrucksweise. Das zu Erklärende muß uns immer bekannt
sein -
denn wie könnten wir es erklären wollen, wenn wir nichts
von ihm
wüßten? Man begeht hier eine Verwechslung
von SA3Ken1Kennen und SA3Erk3Erkennen,
die, wie wir später sehen werden, an manchen Stellen die schlimmsten
Folgen für die Philosophie haben kann (siehe auch unten §
12)."
SA77 Aus § 12 Was SA12Erk1Erkenntnis
nicht ist:
"Und damit ist der große Fehler aufgedeckt, den die Intuitionsphilosophen
begehen: sie verwechseln SA12Ken1Kennen
mit SA12Erk2Erkennen.
SA12Ken2Kennen
lernen
wir alle Dinge durch Intuition, denn alles, was uns von der Welt gegeben
ist, ist uns in der Anschauung gegeben; aber wir SA12Erk3erkennen
die
Dinge allein durch das Denken, denn das Ordnen und Zuordnen, das
dazu nötig ist, macht eben das aus, was man als Denken bezeichnet.
Die Wissenschaft macht uns mit den Gegenständen nicht SA12Ken3bekannt,
sie
lehrt uns nur, die SA12Ken4bekannten
verstehen, begreifen und das heißt eben
SA§12Erk4Erkennen.
SA12Ken5Kennen
undSA12Erk5Erkennen
sind so grundverschiedene Begriffe,
daß selbst die Umgangssprache dafür verschiedene Worte hat;
und doch
werden sie von der Mehrzahl der Philosophen hoffnungslos miteinander
verwechselt. Der rühmlichen Ausnahmen sind nicht allzu viele 1).
Der Irrtum ist zahlreichen Metaphysikern verhängnisvoll
geworden.
Es lohnt sich wohl, das an einigen besonders deutlichen Beispielen
zu
zeigen.
Wenn wir auch im allgemeinen durch Anschauung die
Dinge nicht
in uns oder uns in die Dinge hineinversetzen können, so gilt das
doch
nicht von unserem eigenen Ich. Zu ihm stehen wir tatsächlich in
dem
Verhältnis, welches die Mystiker für die Erkenntnis sich
ersehnten: dem
der völligen Identität. Es ist uns im strengen Sinne vollständig
SA12Ken6bekannt.
Wer nun den Unterschied zwischen SA12Ken7Kennen
und SA12Erk6Erkennen vergißt,
der
muß glauben, daß wir das Wesen des Ich auch schlechthin
vollkommen [>78]
SA12Erk7erkannt hätten.
Und das ist in der Tat eine weitverbreitete These. Zahlreiche
metaphysische Denker würden den Satz unterschreiben, der in
unserer Zeit so formuliert worden ist 1): "Sofern das Ich sich selbst
im
Selbstbewußtsein erfaßt, SA12Erk8erkennt
es ein Wirkliches, wie es an sich selber
ist ... " Der Satz ist falsch, so oft er auch in irgendeiner Form ausgesprochen
wird. Denn die psychischen Gegebenheiten, deren wir im
Bewußtsein inne werden, sind damit nicht im geringsten SA12Erk9erkannt,
sondern
bloß einfach gesetzt, gegeben:
das Bewußtsein SA12e.4erlebt
sie, sie haben
teil an ihm, sie werden im SA12E.1Erlebnis
dem Bewußtsein SA12Ken8bekannt,
nicht
von ihm SA12Erk10erkannt.
Erkannt im echten Sinne des Wortes können sie
höchstens werden durch eine wissenschaftliche, d. h. klassifizierende
begriffsbildende Psychologie; wenn die Bewußtseinsinhalte durch
bloße
Intuition restlos SA12Erk11erkannt
würden, so müßte ja überhaupt alle Psychologie
entbehrlich sein.
In dem soeben zitierten Satze wurde das SA12Erk12Erkennen
als ein "Erfassen"
bezeichnet. Das ist nun eine Redewendung, die nur wenige Denker zu
vermeiden wußten, wenn sie das Wesen der SA12Erk13Erkenntnis
zu bestimmen
unternahmen. Immer wieder liest man, das Erkennen
sei ein "geistiges
SA12Erf1Erfassen". Aber
natürlich ist dies keine Definition des SA12Erk14Erkenntnisprozesses,
sondern nur eine Vergleichung desselben mit dem physischen
Akt des Anfassens, Betastens, Begreifens, und zwar ist der Vergleich
nicht sonderlich glücklich, denn wenn ich einen Gegenstand mit
der
Hand ergreife, so bedeutet das nur die Herstellung einer Beziehung
zwischen jenem Objekte und mir selber; beim SA12Erk15Erkennen
jedoch ist das
Wesentliche gerade die Schaffung einer Beziehung zwischen mehreren
Gegenständen durch den SA§12Erk16Erkennenden.
Die Rede vom SA12Erk14Erkennen als
einem SA12Erf2Erfassen
ist also im allgemeinen ein irreführendes Bild; nur
dann
hat es Berechtigung, wenn es so verstanden wird, daß es sich
dabei um
ein Einfangen, ein Einschließen des erkannten Objektes durch
Begriffe
handelt, durch das ihm ein Platz in ihrer Mitte eindeutig zugewiesen
wird.
An keinem Punkte der Geschichte der Philosophie
läßt sich der in
dem Unbegriff der intuitiven SA12Erk17Erkenntnis
verborgene Irrtum nebst seinen
Folgen wohl so deutlich aufweisen wie in der Lehre des DESCARTES. Sein
Satz, daß wir die Existenz des eigenen Ich (oder, um ihn in modernerem
Sinne zu korrigieren: der eigenen Bewußtseinsinhalte) intuitiv
einsehen,
und daß diese Einsicht eine SA12Erk18Erkenntnis
ist, und zwar von fundamentaler
Bedeutung, scheint eine ganz unwiderlegliche Wahrheit zu sein. Und
sie scheint gesichert zu sein durch das bloße SA12e.5Erleben
der
Bewußtseinsinhalte,
ohne daß irgendeine begriffliche Verarbeitung, irgendein Vergleichen
und Wiederfinden zuvor stattfinden müßte. Was hätten
wir
also hier vor uns, wenn nicht eine echte intuitive
SA12Erk19Erkenntnis?
PAULSEN, im Bande "Systematische Philosophie" der "Kultur der
Gegenwart", 1907. S.397
- 1) Als solche möchte ich anführen A. RIEHL,
der dem Begreifen das
unmittelbare Wissen gegenüberstellt (Der philos. Kritizismus, II, I, S. 221),
und B. RUSSELL, welcher sehr richtig unterscheidet zwischen knowledge of
things (Kennen) und knowledge of truths (Erkennen). (The problems of
philosophy, p. 69). Ferner v. ASTER, Prinzipien der Erkenntnislehre. 1913.
S.6f.
- RS: von Aster schreibt in seiner Erkenntnislehre
(1913) S. 7:
".... wissenschaftlich bestimmt kann nur ein uns Bekanntes werden - wie
soll ich etwas, das ich noch in keiner Form kennen gelernt habe, vergleichen
und beurteilen? Alles wissenschaftliche Erkennen und Beurteilen setzt also
geradezu eine andere Art von „Erkennen“ voraus, das unmittelbare
Bekanntsein, das unmittelbare Gegebensein."
RS: Riehl ist mit "II, I" etwas unklar zitiert. Wenn gemeint ist der 1. Teil
vom zweiten Band, so finde ich auf S. 221 im letzten Absatz:
"Die Natur des Denkens setzt dem Erkennen des Wirklichen
bestimmte Grenzen; obschon das Denken innerhalb dieser Grenzen
einer unbeschränkten Erweiterung fähig sein mag. Es besteht
keine Gleichung zwischen Sein und Denken; es kann eine solche
nur zwischen der Formdes Seins und der Denkform bestehen.
Das Denken ist nicht alles Sein; aber das Sein erscheint nur,
oder wird erfahren, einerseits insofern es empfindbar und andrer-
seits insofern es denkbar ist. In der That sehen wir, wie die
Wissenschaft den Inhalt der Erfahrung auf das Gesetzliche in
ihr, auf das gleichförmig Wiederkehrende, das quantitativer Be-
stimmung Zugängliche, folglich durch Grössenoperationen Dar-
stellbare, kurz auf das Begreifliche reducirt. Alles Uebrige
bildet kein Object des Begreifens, sondern des unmittelbaren
Wissens, also des Gefühls, der Empfindung und der Wahr-
nehmung."
Andererseits sagt Riehl S. 219: "Es besteht zwischen Wissenschaft
und gewöhnlicher Erfahrung kein Gegensatz. Die Wissenschaftist die
Erfahrungselbst, insoferne ihre Elemente systematisch verbunden und
womöglich nach Maass und Zahl bestimmtsind. Demnachist die Wis-
senschaft die exacte Erfahrung. Ihr Material ist statt der Wahrnehmung
die Beobachtung oder die kritische Wahrnehmung, nach gewissen
Gesichtspunkten ausgewählt und befreit von den Zufälligkeiten
der Anschauungder Sinne."
Wir antworten, daß natürlich eine Intuition hier vorliegt, aber trotz
allem keine SA12Erk20Erkenntnis.
Allerdings drückt das Urteil "cogito, ergo sum" (nach Anbringung
aller erforderlichen Korrektionen) eine unumstößliche Wahrheit aus,
nämlich eben die Tatsache der Existenz der Bewußtseinsinhalte. Wir
sahen aber längst, daß nicht jede Wahrheit eine SA12Erk21Erkenntnis zu sein
braucht; Wahrheit ist der weitere, SA12Erk22Erkenntnis der engere Begriff. Wahrheit
ist Eindeutigkeit der Bezeichnung, und die kann nicht nur durch
SA12Erk23Erkenntnis, sondern auch durch Definition erreicht werden. Und so
liegt es hier. Der Satz des DESCARTES ist eine versteckte Definition, er
ist eine uneigentliche Definition des Begriffes Existenz, nämlich das,
was wir früher als "konkrete Definition" bezeichnet hatten. Wir haben
einfach die Festsetzung vor uns, das SA12E.2Erlebnis, das Sein der Bewußtseinsinhalte
durch die Worte zu bezeichnen: "ego sum" oder "die Bewußtseinsinhalte
existieren". Wenn uns aus sonstigen Anwendungen der
Begriff des Daseins, der Existenz bereits bekannt wäre, und wenn wir
nun bei genauerer Betrachtung unserer Bewußtseinsvorgänge fänden,
daß sie alle Merkmale dieses Begriffes aufweisen, und wenn wir erst auf
Grund dieses Wiederfindens den Satz aussprechen könnten: "Die Bewußtseinsinhalte
sind" -, dann und nur dann wäre der Satz des DEs-
CARTES eine SA12Erk24Erkenntnis, aber dann stellte er ja auch keine intuitive
SA12Erk25Erkenntnis mehr dar, sondern würde sich vollkommen demjenigen
SA12Erk26Erkenntnisbegriff unterordnen, den wir bis hier entwickelt haben. Aber
natürlich war so nicht die Meinung des großen Metaphysikers, und es
wäre töricht, seinen Satz so zu interpretieren; er soll vielmehr nur auf
die unumstößliche Tatsache des Gegebenseins der Bewußtseinsinhalte
hinweisen, er soll das Fundament alles weiteren Philosophierens sein,
es soll ihm weiter gar kein Wissen vorausgehen. In der Tat ist das SA12e.5Erleben
der Bewußtseinszustände (wir kommen im dritten Teile des Buches
darauf zurück) die ursprüngliche und einzige Quelle des Existenzbegriffes,
also nicht ein Kasus, auf den der bereits fertige Begriff nachträglich
angewandt werden könnte. Das "Ich bin" ist schlechthin
Tatsache, nicht SA12Erk26Erkenntnis I).
Durch die Verfehlung dieses wichtigen Punktes werden bei DESCAR-
TES die bekannten weiteren Irrwege unvermeidlich. Da er nämlich seinen
Grundsatz für eine SA12Erk27Erkenntnis ansah, so durfte und mußte er nach einem
Kriterium fragen, das ihm ihre Gültigkeit verbürgte. Er glaubte ein
solches in der Evidenz zu entdecken (oder, wie er es nannte, in der
Klarheit und Deutlichkeit der Einsicht); die Garantie für die Untrüglichkeit
der Evidenz aber vermochte er nur in der Wahrhaftigkeit Gottes
zu finden, und so bewegte er sich haltlos im Kreise, denn die Existenz
- 1) Dieselbe Wahrheit liegt der etwas umständlichen
Bemerkung zugrunde,
die KANT über den DESCARTEsschen Satz macht: Kr. d. r. V. KEHR-
BACH S.696. [>80]
dessen, der ihm für die Zuverlässigkeit der Evidenz garantiert,
ist ihm
allein durch eben diese Evidenz verbürgt.
In einen ähnlichen Zirkel muß jeder verfallen, der den CARTESIANIschen
Satz für eine SA12Erk28Erkenntnis
hält. Er kann nur als Definition, als Bezeichnung
einer fundamentalen Tatsache aufgefaßt werden. Das ego
sum, das Sein der Bewußtseinsinhalte, bedarf keiner Begründung,
weil
es keine SA12Erk29Erkenntnis
ist, sondern eine Tatsache; und Tatsachen bestehen
schlechthin, sie haben zu ihrer Sicherung keine Evidenz nötig,
sie sind
weder gewiß noch ungewiß, sondern sind schlechthin, es
hat gar keinen
Sinn, nach einer Garantie ihres Bestehens zu suchen.
Der CARTESIANische Irrtum wurde in neuerer Zeit zum Prinzip einer
Philosophie erhoben in der Evidenz-Psychologie, wie sie von BRENTANO
begründet wurde. Nach der Meinung dieses Denkers I) ist jeder
psychische
Akt von einer darauf gerichteten BrentanoErkenntnis
begleitet. Er sagt"):
"Wir denken, wir begehren etwas, und erkennen,
daß wir dieses tun.
BrentanoErkenntnis aber
hat man nur im Urteile." Folglich, so schließt er, ist
in allen psychischen Akten ein Urteil enthalten! Wir lesen ferner 3)
:
"Mit jedem psychischen Akte ist daher ein doppeltes inneres Bewußtsein
verbunden, eine darauf bezügliche Vorstellung, und ein darauf
bezügliches Urteil, die sogenannte innere Wahrnehmung, welche
eine
unmittelbare evidente BrentanoErkenntnis des
Aktes ist." Nach BRENTANO
zählt jede Wahrnehmung zu den Urteilen4 ): "ist sie ja doch eine
BrentanoErkenntnis
oder doch ein, wenn auch irrtülnliches, Fürwahrnehmen".
Von einer Psychologie "vom empirischen Standpunkte" sollte man
doch erwarten, daß in jedem psychischen Akt ein Urteil als erfahrenes,
erlebtes Moment aufgewiesen werde,
bevor sein Vorhandensein darin
behauptet wird; statt dessen wird geschlossen: weil Wahrnehmung SA12Erk30Erkenntnis
ist, so muß sie ein Urteil enthalten. Der richtige Schluß
aber
lautet offenbar: weil Wahrnehmung erfahrungsgemäß kein Urteil
enthält,
so ist sie auch keine SA12Erk31Erkenntnis5
). Die Verwechslung von Erkennen
und Kennen an· den Zitierten Stellen ist nur allzu deutlich.
Die reine, unverarbeitete Wahrnehmung (Empfindung) ist ein bloßes
SA12Ken9Kennen; es ist
ganz falsch, von einer "Wahrnehmungserkenntnis" zu
sprechen, wenn man sie im Auge hat; die Empfindung gibt uns keinerlei
SA12Erk31Erkenntnis,
sondern nur eine Kenntnis der Dinge. Nun kommen aber
isolierte reine Wahrnehmungen bekanntlich im entwickelten Bewußtsein
- 1) BRENTANO, Psychologie vom empirischen Standpunkt.
S.185.
2) Ebenda. S. 181. 3) Ebenda. S. 188. 4) Ebenda. S.277.
5) Entgegengesetzt schließt L. NELSON (Die Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie.
Abhandl. d. FRIEsschen Schule 1912. Bd. III. S. 598), da
die Wahrnehmung eine Erkenntnis sei, aber kein Urteil, so brauche nicht
jede Erkenntnis ein Urteil zu sein. Damit steht auch er ganz auf dem Boden
des Irrtums der "unmittelbaren Erkenntnis", den wir hier zu widerlegen
suchen. Er sagt (a. a. O. S. 599): Die Wahrnehmung "ist eine unmittelbare
Erkenntnis". [81]
so gut wie gar nicht vor, sondern es schließt sich an die
Empfindung
assoziativ ein sogenannter Apperzeptionsprozeß an, d. h. die
Empfindung
oder der Empfindungskomplex verschmilzt mit verwandten Vorstellungen
alsbald zu einem Gesamtgebilde, das sich im Bewußtsein als
.etwas schon früher SA12Ken10Bekanntes
darstellt. So werden etwa die Schwarz-
Weiß-Empfindungen beim Blick auf das vor mir liegende Papier
ohne
weiteres zur Wahrnehmung von Schriftzeichen. Hier haben wir natürlich
eine Erkenntnis, wenn auch primitivster Art, vor uns, denn es
bleibt ja nicht bei dem bloßen Sinneseindruck, sondern er wird
sogleich
in den Kreis früherer Erfahrungen eingeordnet, als der und der
SA12Erk32wiedererkannt.
Wenn man also den Ausdruck "Wahrnehmung" auf den
apperzipierten Sinneseindruck beschränkt, dann allerdings, aber
nur
dann, darf man von einer SA12Erk33Wahrnehmungserkenntnis
sprechen. Will
man diese SA12Erk34Erkenntnis,
solange sie noch nicht in (vorgestellte oder gesprochene)
Worte gefaßt ist, von der sprachlich formulierten dadurch
unterscheiden, daß man die erstere als "intuitive" bezeichnet
I), so läßt
sich dagegen natürlich nichts einwenden; es bedarf keiner Erwähnung,
daß dieser Begriff der intuitiven SA12Erk35Erkenntnis
mit dem oben behandelten
und zurückgewiesenen (wie wir ihn bei BERGSON und HUSSERL fanden)
nicht das geringste zu tun hat.
KANT hat die Wahrheit, daß das reine Anschauen
ohne apperzeptive
oder begriffliche Verarbeitung keine SA12Erk36Erkenntnis
ist, nicht in ihrer vollen
Tragweite eingesehen und sie daher in seinem berühmten Satze "Anschauungen
ohne Begriffe sind blind" nur unvollkommen zum Ausdruck
gebracht; beginnt er doch die Untersuchungen der Kritik der
reinen Vernunft mit den Worten: "Auf welche Art und durch welche
Mittel sich auch immer eine KantErkenntnis
auf Gegenstände beziehen mag,
so ist doch diejenige, wodurch sie sich auf dieselben unmittelbar bezieht,
und worauf alles Denken als Mittel abzweckt, die Anschauung." Hier
zeigt sich deutlich, daß KANT den innigen Konnex, den die Anschauung
zwischen Objekt und Schauendem herstellt, doch für ein wesentliches
Moment des KantErkennens
ansah. Dies hinderte ihn auch, das Problem
der Erkenntnis der Dinge an sich als ein bloßes Scheinproblem
zu entlarven.
Er glaubte nämlich, eine solche Erkenntnis müßte eine
Anschauung
von der Art sein, "daß sie Dinge vorstellte, so wie sie an sich
selbst sind", und er erklärt sie für unmöglich, weil
die Dinge "nicht in
meine Vorstellungskraft hinüberwandern können". Wir wissen
aber
jetzt: selbst wenn dies möglich wäre, wenn also die Dinge
eins würden
mit unserem Bewußtsein, dann würden wir die Dinge wohl erleben,
aber
das wäre etwas ganz anderes als SA12Erk37Erkenntnis
der Dinge. "SA12Erk38Erkenntnis
der Dinge an sich" ist so lange
einfach eine contradictio in adiecto, als
- 1) Das tut z. B. BENNO ERDMANN in seiner schönen
Abhandlung "Erkennen
und Verstehen". Sitzungsberichte der kgl. preuß. Akad. d. Wiss.
LIII. S. 1251. Dort gebraucht er auch den Ausdruck "wahrnehmende Erkenntnis"
stets nur in der oben erläuterten einzig zulässigen Bedeutung.
man unter Erkennen irgendein Anschauen oder anschauliches Vor-
stellen versteht, denn es würde ja der Widersinn gefordert, Dinge
vorzustellen,
wie sie unabhängig von allem Vorstellen sind. Die Frage nach
der Möglichkeit solcher SA12Erk39Erkenntnis
darf also gar nicht gestellt werden.
Wie steht es aber mit dieser selben Frage, nachdem wir uns über
das wahre Wesen der SA12Erk40Erkenntnis
klar geworden sind? Nun, hätte man
immer gewußt und es sich vor Augen gehalten, daß SA12Erk41Erkenntnis
durch
ein bloßes Zuordnen von Zeichen zu Gegenständen entsteht,
so wäre
man niemals darauf verfallen, zu fragen, ob ein SA12Erk42Erkennen
der Dinge
möglich sei, so wie sie an sich selbst sind. Zu diesem Problem
konnte
nur die Meinung führen, SA12Erk43Erkennen
sei eine Art anschaulichen Vorstellens,
welches die Dinge im Bewußtsein abbilde; denn nur unter dieser
Voraussetzung konnte man fragen, ob die Bilder wohl dieselbe Beschaffenheit
aufwiesen wie die Dinge selbst.
Wer das SA12Erk44Erkennen
für ein anschauliches Vorstellen hielt, durch
welches wir die Dinge "erfassen" oder "in unsern Geist aufnehmen",
oder wie die Ausdrücke sonst lauten mögen, der mußte
immer von
neuem Ursache finden, über das Unzulängliche und Vergebliche
des
SA12Erk45Erkenntnisprozesses
zu klagen, denn ein so beschaffener SA12Erk46Erkenntnisprozeß
konnte seine Objekte doch nicht wohl ins Bewußtsein überführen
ohne sie mehr oder weniger gründlich zu verändern, und mußte
somit
seinen letzten Zweck stets verfehlen, nämlich die Dinge unverändert,
eben wie sie "an sich" sind, zu erschauen.
Der wahre SA12Erk47Erkenntnisbegriff,
wie er uns jetzt aufgegangen ist, hat
nichts unbefriedigendes mehr. Nach ihm besteht das SA12Erk48Erkennen
in
einem Akte, durch den in der Tat die Dinge gar nicht berührt oder
verändert werden, nämlich im bloßen Bezeichnen. Eine
Abbildung
kann niemals ihre Aufgabe vollkommen erfüllen, sie müßte
denn ein
zweites Exemplar des Originals, eine Verdoppelung sein; ein Zeichen
aber kann restlos das von ihm Verlangte leisten, es wird nämlich
bloß
Eindeutigkeit der Zuordnung von ihm verlangt. Abgebildet kann ein
Gegenstand niemals werden wie er an sich ist, denn jedes Bild muß
von
einem Standpunkte aus und durch ein abbildendes Organ aufgenommen
werden, kann also nur eine subjektive und gleichsam perspektivische
Ansicht des Gegenstandes bieten; bezeichnen dagegen läßt
sich jeder
Gegenstand selber, wie er ist. Die verwendeten Zeichen und die Methoden
der Zuordnung tragen zwar subjektiven Charakter, der ihnen
vom SA12Erk49Erkennenden
aufgedrückt wird, die vollzogene Zuordnung aber
zeigt keine Spuren mehr davon, sie ist ihrem Wesen nach unabhängig
von Standpunkt und Organ.
Deshalb können wir getrost sagen: in Wahrheit
gibt uns jedes SA12Erk50Erkennen
eine SA12Erk51Erkenntnis
von Gegenständen, wie sie an sich selbst sind.
Denn was das Bezeichnete auch immer sein mag, ob Erscheinung oder ..."
SA192: "Aber diese Forderung, nur SA12Erk52kennbare
Elemente als wirklich zuzulassen,
ist erstens gänzlich ungerechtfertigt, denn sie ist nichts als
ein Überrest
des Vorurteils, als gehöre das SA12Ken10Kennen
zum SA12Erk53Erkennen
und sei der bessere
Teil davon; - zweitens aber ist jene Forderung in der besprochenen
Ansicht selbst schon gar nicht erfüllt - denn ein "nichtwahrgenommener
Aspekt" kann nicht schlechthin dasselbe sein wie ein" wahrgenommener
Aspekt", da ja sonst diese Distinktion sinnlos. wäre. Und noch
in einem
tieferen Sinne müssen beide Arten von Komplexen verschieden sein.
Von den Aspekten nämlich, die z. B. dieses Zimmer bilden, wenn
niemand
darin ist, kann keiner mit einem Aspekt identisch sein, den jemand
SA12e.6erlebt, der das
Zimmer betritt; denn der letztere Aspekt ist, wie natürlich
auch RUSSELL (S. 88) anerkennt, "conditioned by the sense-organs,
nerves and brain of the newly arrived man" ... , und alles, was man
vemünftigerweise annehmen kann, ist" that some aspect of the universe
existed from that point of view, though no one was perceiving it".
Man
sieht, daß die hypothetisch hinzugefügten Komplexe unter
allen Umständen"
SA12Ken11unbekannt" sind.
- So ist dieser Kampf der Immanenzphilosophie
gegen die realistische Annahme der Dinge an sich vergeblich,
denn sie kann selbst nicht ohne vollständig äquivalente Annahmen
auskommen."
SA212: "Der Grund dieses Verhaltens aber liegt darin, daß sie
sich noch nicht
ganz los machen können von jenem alten SA12Erk54Erkenntnisbegriff,
zu dessen
Überwindung sonst gerade das positivistische Denken am meisten
beigetragen
hat. Sie verwechseln an diesem einen Punkte immer noch SA12Erk55Erkennen
mit SA12Ken12Kennen,
d. i. mit reinem SA12e.7Erleben,
bloßem Gegebensein; sie
suchen an dieser Stelle immer noch Antwort auf die Frage, was denn
das
Reale eigentlich "ist", und diese Antwort könnte uns nur ein unmittelbares
SA12Ken13Kennen, SA12e.8Erleben
verschaffn. Was die "Elemente" bei MACH und
AVENARIUS "sind", wissen wir unmittelbar; Farben, Töne, Gerüche
sind
uns schlechthin gegeben, kein Urteil, keine Definition, sondern das
Erleben
gibt uns über ihr "Wesen" Aufschluß .... aber SA12Erk56erkannt
sind die
Elemente und ihr Wesen damit nicht (siehe oben I § 12). Die richtige
Einsicht in diesen Sachverhalt finden wir auch bei Vertretern des Posi-[213]
SA213: "tivismus gelegentlich mit aller Deutlichkeit ausgesprochen.
So sagt VAI-
RINGER (Die Philosophie des Als Ob', S. 94): "Das Sein ist nur wißbar
in der Form von unabänderlichen Sukzessionen und Koexistenzen:
begreifbar
ist es nicht, weil begreifen heißt: etwas auf ein anderes zurückführen,
was doch beim Sein selbst nicht mehr der Fall sein kann". In
dieser Weise können wir also die Dinge an sich freilich niemals
SA12Ken14kennen
lernen, wißbar sind sie nicht (sie sind ja definitionsgemäß
nie gegeben),
aber wenn wir das unbefriedigend finden, so haben wir unser Ziel aus
den
Augen verloren. Wollten wir denn die Welt SA12Ken16kennen
lernen? Wollten wir
sie nicht vielmehr SA12Erk57erkennen?
Das letztere allein ist die Aufgabe der
Philosophie und der Wissenschaft.
Daß uns ein Teil der Welt unmittelbar gegeben
ist, ein anderer,
größerer dagegen nicht, ist gleichsam als zufällige
Tatsache hinzunehmen,
als SA12Erk58Erkennende
haben wir gar kein Interesse daran, sondern
nur als in der Welt Lebende. Gerade dem SA12Erk59Erkennenden
ist nicht damit
gedient, wenn er bei der Frage, was denn eigentlich ein Gegenstand
ist,
auf das reine SA12e.9Erleben
verwiesen wird; für ihn bedeutet die Frage ganz
allein: durch welche allgemeinen Begriffe läßt der Gegenstand
sich bezeichnen?
Darauf aber kann er bei den Dingen an sich um so eher antworten,
als er doch überhaupt nur durch eben diese Begriffe zu ihnen
geführt wird. Die Einzelwissenschaften liefern uns gerade die
Begriffe
von realen Gegenständen, die nicht gegeben sind und die wir deshalb
als "an sich" existierende bezeichneten. Durch jene Begriffe SA12Erk60erkennen
wir also wahrhaftig, was die Dinge an sich sind, und die Verleumdung
dieser Dinge wegen ihrer Unerkennbarkeit ist in Wahrheit nur eine
Klage über ihre SA12Erk61Unkennbarkeit,
Nichterlebbarkeit, also ihre Unanschaulichkeit
- kurz, es ist ein Rückfall in den mystischen SA12Erk62Erkenntnisbegriff.
Das Schauen der Dinge ist nicht SA12Erk61Erkennen
und auch nicht
Vorbedingung des SA12Erk63Erkennens.
Die Gegenstände der SA12Erk64Erkenntnis
müssen
widerspruchslos denkbar sein, d. h. sich durch Begriffe eindeutig bezeichnen
lassen, aber sie brauchen nicht anschaulich vorstellbar zu sein.
Daß das letztere von positivistisch gerichteten
Denkern noch so oft
gefordert wird, ist ein sonderbares Vorurteil. Der Umstand, daß
psychologisch
jeder Gedanke mit anschaulichen Bewußtseinsvorgängen verknüpft
ist und ganz ohne solche nicht stattfinden kann, führt leicht
zu
einer Verwechslung des begrifflichen Denkens und des anschaulichen
Vorstellens im SA12Erk65erkenntnistheoretischen
Sinne. In dem mehrfach zitierten
Buche von PETZOLDT tritt die durchgehende Verwechslung von Denken
und Vorstellen, d. h. von bloßem Bezeichnen auf der einen Seite
und
anschaulichem Ausmalen auf der andern, besonders deutlich immer
wieder zutage, und es ist die Hauptquelle seiner Fehlschlüsse,
daß er
unter Denken statt einem begrifflichen Zuordnen ein bildhaftes Vorstellen
versteht. In einem Satze auf S. 201 des "Weltproblems" ist der
Grundirrtum auf seinen prägnantesten Ausdruck gebracht: "Die Welt
[>214]
SA214: "vorstellen oder (1) sie denken bedeutet eben, sie mit Qualitäten
vorstellen
oder denken, während die Frage nach der Welt an sich ausdrücklich
von allen sinnlichen Qualitäten absieht." Wir müssen uns
die Verhältnisse
von Begriffen zueinander wohl irgendwie anschaulich repräsentieren,
um sie überblicken zu können, aber das kann auf beliebig
viele
Weisen geschehen, und auf welche Art es geschieht, ist erkenntnistheoretisch
gleichgültig. Der erfolgreiche Forscher hat meist einen starken
Trieb zum Anschaulichen, eine Menge deutlichster Bilder schweben
ihm als Illustration der durchdachten Begriffsbeziehungen vor; ihm
liegt es nahe, sie für das Wesentliche der SA12Erk66Erkenntnis
zu halten und
allein das anschaulich Vorstellbare als ihr Objekt anzuerkennen. In
Wahrheit sind aber die sinnlichen Vorstellungen etwas mehr oder weniger
Zufälliges und Nebensächliches bei der SA12Erk67erkenntnistheoretischen
Fragestellung,
nur bei der psychologischen Betrachtungsweise bilden sie das
Wesentliche.
Die Unvorstellbarkeit nicht gegebener Realitäten ist also kein
Einwand
gegen ihre Existenz oder gegen ihre SA12Erk68Erkennbarkeit."
Gabriel, Gottfried (2010) Kennen und Erkennen. In (43-55) Bromand, Joachim & Kreis, Guido (2010) Was sich nicht sagen lässt : das Nicht-Begriffliche in Wissenschaft, Kunst und Religion. Berlin: Verlag: Akademie-Verl.
Zusammenfassung-Gabriels-Schlicks-Kritik: Echte Argumente gegen Schlicks Auffassung konnte ich nicht finden.
"Kennen und Erkennen
GOTTFRIED GABRIEL
G48: "Wie es ist, eine Depression zu haben, weiß wohl nur derjenige,
der selbst in einer solchen
Situation gewesen ist, die Depression am eigenen Leibe erlebt
bzw. in der eigenen
Seele gefühlt hat. Dann erst kennt man sie wirklich. "
G50: "Schlicks Kritik gilt in erster Linie der Auffassung, dass es „zwei
Arten des Erkennens"
gebe, „das begriffliche, diskursive und das anschauliche, intuitive".22
Im Blick
hat er dabei, obwohl auch Husserl erwähnt wird, vornehmlich H.
Bergson, der selbst von
dem Gegensatz zwischen den Methoden der "Analyse" und der „Intuition"
spricht, die
„sich gegenseitig ergänzen müssen".23 Wenn Schlick Bergson
soweit entgegen kommt,
die Intuition als ein bedeutsames "Kennen" anzuerkennen, so möchte
man meinen, damit
sei der Schritt zur Akzeptanz eines kognitiven Zugangs zum Nicht-Propositionalen
bereits vollzogen. Auffällig ist aber der terminologische Schachzug,
bereits die elemen-[>51]
taren Wahrnehmungsinhalte (die „Empfindungen"24) „Erlebnisse"
zu nennen und z. B.
von dem "Erlebnis des Rot" zu sprechen.25
Was ich erlebe, gehört der Sphäre
des Lebens
an, und das Leben setzt Schlick dem Erkennen entgegen. Schlick beschreibt
das
Erlebnis der Farbe Blau so, dass
„ich zum wolkenlosen Himmel aufschaue und mich
ganz und gar der Blauempfindung hingebe".26 Damit deutet er trefflich
einen kontemplativen
Aspekt in der Farbwahrnehmung an, wie er von modernen Künstlern
(Barnett
Newman und Yves Klein) ästhetisch in monochromen Gemälden
vergegenwärtigt
worden ist. Sogleich bestreitet er aber der kontemplativen Einstellung
ihren kognitiven
Wert, indem er hinzufügt, dass das „Wesen des Blau" nur physikalisch
erkannt werden
könne.27 Letztlich versteigt sich Schlick zu der Auffassung, dass
Qualitäten insgesamt
als Objekte der Erkenntnis ausscheiden und wird so zu einem Vertreter
der von G. Th.
Fechner so genannten „Nachtansicht" der Welt.
Im weiteren geht Schlick über die exemplarische
Betrachtung der sinnlichen Anschauung
weit hinaus, indem er andere Formen des Schauens bis hin zur unio mystica
einbezieht. Obwohl er dem Versuch Bergsons, in der Intuition eine Erkenntnis
eigenen
Rechts zur Anerkennung zu bringen, entschieden widerspricht, fällt
seine Kritik insgesamt
wohlwollender aus, als man dies auf den ersten Blick von einem logischen
Empiristen
erwarten würde. Er verwirft die Intuition nicht als mystifizierenden
Unsinn,
sondern grenzt sie lediglich aus der Sphäre der Erkenntnis aus
und weist sie stattdessen
dem "Erleben" und dem Leben selbst
zu: "Durch Erleben, durch Schauung begreifen
und erklären wir nichts. Wir erlangen dadurch wohl ein Wissen
um die Dinge, aber niemals
ein Verständnis der Dinge."28 Schlick gesteht Bergson hier sogar
ein intuitives
Wissen zu und bindet somit nur den Erkenntnisbegriff, aber nicht den
Wissensbegriff
an den propostionalen Wahrheitsbegriff. Dabei trifft er dieselbe Unterscheidung
wie
Bergson, allerdings in Verkehrung der traditionellen Terminologie,
der gemäß die
cognitio circa rem als Erkenntnis ‚um' das Ding (in seinen Beziehungen
zu anderen
Dingen) und die cognitio rei als die Erkenntnis des Dings selbst verstanden
wird. So
charakterisiert Bergson, diese Unterscheidung aufgreifend, die Differenz
zwischen wissenschaftlicher
und intuitiver Erkenntnis mit den Worten: „Die erste geht gleichsam
um
ihren Gegenstand herum, die zweite dringt in ihn ein."29
"Schlicks Position stellt sich — überraschend genug — als eine
Radikalisierung oder
Überbietung der Lebensphilosophie dar, indem geradezu von einer
Kluft zwischen Leben
und Erkenntnis ausgegangen wird. Wir haben es hier mit einem ähnlichen
Phänomen
wie im Falle Rudolf Carnaps zu tun, bei dem man lange den nachhaltigen
Einfluss
der Lebensphilosophie übersehen hat. Die Übereinstimmung
kommt besonders in der
Einschätzung der Metaphysik zum Tragen, wobei in beiden Fällen
sicher auch der Einfluss
von Wittgensteins Tractatus erkennbar ist. Die spezifische Wendung,
dass die Metaphysik
den verfehlten Versuch darstelle, ein „Lebensgefühl" — so Camap32
— oder ein
„Erleben" — so Schlick33 — propositional
mitzuteilen und zu begründen, verweist aber
auf einen lebensphilosophischen Hintergrund. Schlick geht sogar so
weit, das „Welterlebnis"
über die „Welterkenntnis" zu stellen.34 Daran wird deutlich, dass
sein Ausgrenzungsversuch
keineswegs mit einer Abwertung verbunden ist, sondern geradezu ein
Reservat von Unmittelbarkeit außerhalb der Erkenntnissphäre
zu sichern sucht. Bei
Camap besteht eine ähnliche Tendenz. In der Beurteilung seiner
Metaphysikkritik wird
häufig übersehen, dass diese sich weniger gegen bestimmte
Inhalte der Metaphysik, die
Camap in der Kunst aufgehoben sieht, als vielmehr gegen deren Darstellung
in propositional-
argumentativer Form richtet. Schlick und Camap sind daher gegen den
Vorwurf
eines bornierten Szientismus in Schutz zu nehmen. Szientistisch ist
zwar ihr
Erkenntnisbegriff, nicht aber ihre Einstellung zur Welt und zum Leben.
Problematisch
ist allerdings die absolute Disjunktion zwischen Leben und Erkenntnis
sowie Kunst
- 30 Schlick (1918), S. 66.
31 Schlick (1926), S. 146.
32 Carnap (1931), Abschnitt 7 (S. 238-241): "Metaphysik als Ausdruck des Lebensgefiihls". Der
Ausdruck "Lebensgeffffil" ist ein zentraler Terminus der Diltheyschen Lebensphilosophie.
33 Schlick (1926), S. 156. Vgl. Carnaps Rede von "Elementarerlebnissen" (Carnap 1928, §§ 67f.).
34 Schlick (1918), S. 150."
Erleben, Erlebnis und Innere Wahrnehmung in der Allgemeinen Erkenntnislehre 2.A. 1925
Fundstellen erleben 61, Erlebnis 194, innere Wahrnehmung 18 (eigener Abschnitt "20. Die sogenannte innere Wahrnehmung" S.139-148)
Literatur (Auswahl)
- Bibliographie: https://vcs.univie.ac.at/Schlick-Projekt/english/schlick_bibliographie.pdf
- Schlick, Moritz (1925) Allgemeine Erkenntnislehre. 2. Auflage.
- Schlick, Moritz (1926) „Erleben, Erkennen, Metaphysik", Kant-Studien 31 (1926), S. 146-158. [Online]
- Gabriel, Gottfried (2010) Kennen und Erkennen. In (43-55) Bromand, Joachim & Kreis, Guido (2010) Was sich nicht sagen lässt : das Nicht-Begriffliche in Wissenschaft, Kunst und Religion. Berlin: Verlag: Akademie-Verl.
- Schlick, Moritz (1904) Über die Reflexion des Lichtes in einer inhomogenen Schicht, Diss. Berlin 1904.
- Schlick, Moritz (1908) Lebensweisheit. Versuch einer Glückseligkeitslehre. Becksche Verlagsbuchhandlung, München 1908.
- Schlick, Moritz (1909) Das Grundproblem der Ästhetik in entwicklungsgeschichtlicher Bedeutung. In: Archiv für die gesamte Psychologie. Jg. 14, 1909, S. 102–132.
- Schlick, Moritz (1910a) Die Grenze der naturwissenschaftlichen und philosophischen Begriffsbildung. In: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie. Jg. 34, 1910, S. 121–142.
- Schlick, Moritz (1910b) Das Wesen der Wahrheit nach der modernen Logik. In: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie. Jg. 34, 1910, S. 386–477.
- Schlick, Moritz (1913) Gibt es intuitive Erkenntnis?. In: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie. Jg. 37, 1913, S. 472–488.
- Schlick, Moritz (1915) Die philosophische Bedeutung des Relativitätsprinzips. In: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. Jg. 159, 1915, S. 129–175.
- Schlick, Moritz (1916) Idealität des Raumes, Introjektion und psychophysisches Problem. In: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie. Jg. 40, 1916, S. 230–254.
- Schlick, Moritz (1922) Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Zur Einführung in das Verständnis der allgemeinen Relativitätstheorie. Verlag von Julius Springer, Berlin 1917 (4. Auflage 1922).
- Schlick, Moritz (1917) Erscheinung und Wesen (Vortrag in Berlin 1917). In: Kant-Studien. Jg. 23, 1918, S. 188–208.
- (1918 Erkenntnislehre) Allgemeine Erkenntnislehre (= Naturwissenschaftliche Monographien und Lehrbücher Bd. 1), Berlin: Springer 1918. IX + 346 S
- Schlick, Moritz (1925) Allgemeine Erkenntnislehre. Verlag von Julius Springer, Berlin 1918 (2. Auflage 1925).
- Schlick, Moritz (1920) Naturphilosophische Betrachtungen über das Kausalprinzip. In: Die Naturwissenschaften. Jg. 8, 1920, S. 461–474.
- Schlick, Moritz (1921a) Einsteins Relativitätstheorie. In: Mosse Almanach, 1921, S. 105–123.[22]
- Schlick, Moritz (1921b) Kritizistische oder empiristische Deutung der neuen Physik? In: Kant-Studien. Jg. 26, 1921, S. 91–111.
- Schlick, Moritz (1921c) Hermann von Helmholtz. Schriften zur Erkenntnistheorie. Hrsg.: Moritz Schlick & Paul Hertz. Springer, Berlin 1921.
- Schlick, Moritz (1921d) Helmholtz als Erkenntnistheoretiker (Vortrag n Berlin 1921). In: Helmholtz als Physiker, Physiologe und Philosoph. Karlsruhe 1922, S. 29–39.
- Schlick, Moritz (1922) Die Relativitätstheorie in der Philosophie. (Vortrag in Leipzig 1922). In: Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. Jg. 87, Leipzig 1922, S. 58–69.
- Schlick, Moritz (1925) Naturphilosophie. In: Max Dessoir (1925, Hrsg.), Die Philosophie in ihren Einzelgebieten. (Lehrbuch der Philosophie, II). Berlin 1925, S. 395–492.
- Schlick, Moritz (1926) Erleben, Erkennen, Metaphysik. In: Kant-Studien. Jg. 31, 1926, S. 146–158. Nachgedruckt (mit einer Ergänzung in der Fußnote auf Seite 7) in dem Band „Gesammelte Aufsätze 1926–1936“ S. 1–17.
- Schlick, Moritz (1927) Vom Sinn des Lebens. In: Symposion. Philosophische Zeitschrift für Forschung und Aussprache. Jg. 1, 1927, S. 331–354.
- Schlick, Moritz (1929a) Erkenntnistheorie und moderne Physik. In: Scientia. Jg. 45, 1929, S. 307–316.
- Schlick, Moritz (1929b) Philosophie und Naturwissenschaft. (Vortrag in Wien 1929). In: Erkenntnis. Jg. 4, 1934, S. 379–396 .
- Schlick, Moritz (1930a) Die Wende der Philosophie. In: Erkenntnis. Jg. 1, 1930, S. 4–11.
- Schlick, Moritz (1930b) Fragen der Ethik (=Schriften der wissenschaftlichen Weltauffassung, 4). Verlag Julius Springer, Wien 1930.
- Schlick, Moritz (1930c) The Future of Philosophy. In: Proceedings of the Seventh International Congress of Philosophy/Oxford 1930, London 1931, S. 112–116.
- Schlick, Moritz (1930d) Gibt es ein Materiales Apriori? (Vortrag in Wien 1930). In: Wissenschaftlicher Jahresbericht der Philosophischen Gesellschaft an der Universität zu Wien für das Vereinsjahr 1931/32, Wien 1932, S. 55–65.
- Schlick, Moritz (1931a) Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik. In: Die Naturwissenschaften. Jg. 19, 1931, S. 145–162.
- Schlick, Moritz (1931b) The Future of Philosophy (Vortrag in Stockton, Cal.). In: College of the Pacific Publications in Philosophy. Jg. I, 1931, S. 45–62.
- Schlick, Moritz (1931c) A new Philosophy of Experience (Vortrag in Stockton, Cal.). In: College of the Pacific Publications in Philosophy. Jg. I, 1931, S. 63–78.
- Schlick, Moritz (1932) Causality in Everyday Life and Recent Science (Vortrag in Berkeley, Cal.). In: University of California Publications in Philosophy. Jg. XV, 1932, S. 99–125.
- Schlick, Moritz (1932) Positivismus und Realismus. In: Erkenntnis. Jg. 3, 1932, S. 1–31.
- Schlick, Moritz (1934a) Über das Fundament der Erkenntnis. In: Erkenntnis. Jg. 4, 1934, S. 79–99.
- Schlick, Moritz (1934b) Über den Begriff der Ganzheit. In: Erkenntnis. Jg. 5, 1934, S. 52–55.
- Schlick, Moritz (1934c) Ergänzende Bemerkungen über P. Jordans Versuch einer quantentheoretischen Deutung der Lebenserscheinungen. In: Erkenntnis. Jg. 5, 1934, S. 181–183.
- Schlick, Moritz (1935a) Über den Begriff der Ganzheit (Vortrag in Wien). In: Wissenschaftlicher Jahresbericht der Philosophischen Gesellschaft an der Universität zu Wien für die Vereinsjahre 1933/34 und 1934/35, Wien 1935, S. 23–37.
- Schlick, Moritz (1935b) Facts and Propositions. In: Analysis. Jg. 2, 1935, S. 65–70.
- Schlick, Moritz (1935c) Unanswerable Questions? In: The Philosopher. Jg. 13, 1935, S. 98–104.
- Schlick, Moritz (1935d) De la Relation entre les Notions Psychologiques et les Notions Physiques. In: Revue de Synthèse Jg. 10, 1935, S. 5–26.
- Schlick, Moritz (1936) Sind Naturgesetze Konventionen? In: Actes du Congrès International de Philosophie Scientifique, Paris 1935, IV: Induction et Probabilité (= Actualités Scientifiques et Industrielles 391), Paris 1936, S. 8–17. 2, 1935, S. 65–70.
- Schlick, Moritz (1936a) Gesetz und Wahrscheinlichkeit In: Actes du Congrès International de Philosophie Scientifique, Paris 1935, IV: Induction et Probabilité (= Actualités Scientifiques et Industrielles 391), Paris 1936, S. 8–17. 2, 1935, S. 46–57.
- Schlick, Moritz (1936b) Meaning and Verification. In: The Philosophical Review 45, 1936, S. 339–369.
- Schlick, Moritz (1936c) Über den Begriff der Ganzheit. In: Actes du Huitième Congrès International de la Philosophie à Prague, 2-7 September 1934 Prag 1936, S. 85–99.
- Schlick, Moritz (1937a) Quantentheorie und Erkennbarkeit der Natur. In: Erkenntnis. Jg. 6, 1937, S. 317–326.
- Schlick, Moritz (1937b) L’École de Vienne et la Philosophie Traditionelle. In: Travaux du IXème Congrès IOnternational de Philosophie, IV: L'Unité de la Science: la Méthode et les Méthodes (=Actualités Scientifiques et Industrielles 533), Paris 1937, S. 199–107.
- Schlick, Moritz (1938) Gesammelte Aufsätze 1926-1936. Gerold & Co., Wien 1938. Online Archive
- Schlick, Moritz (1948a) Gesetz, Kausalität, und Wahrscheinlichkeit. Gerold & Co., Wien 1948.
- Schlick, Moritz (1948b) Grundzüge der Naturphilosophie, hg. von W. Hollitscher und J. Rauscher, Wien 1948.
- Schlick, Moritz (1986) Die Probleme der Philosophie in ihrem Zusammenhang. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1986.
- Schlick, Moritz (2006ff) Moritz Schlick Gesamtausgabe. Springer Verlag, Wien/ New York 2006 ff. — Annähernd vollständige Autorenkopie von Bd. I/1, I/2, I/3, I/5, I/6
Links(Auswahl: beachte)
https://ia800703.us.archive.org/1/items/GesammelteAufsaumltze1926-1936/Moritz_Schlick_Gesammelte_Aufsaetze.pdf
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
___
1926
Die meisten Bibliographien geben 1926 als Veröffentlichungsjahr an. Im Artikel selbst wird aber 1930 falsch genannt. Denn in den Kant-Studien von 1930 findet man die Arbeit nicht gelistet, wohl aber 1926.
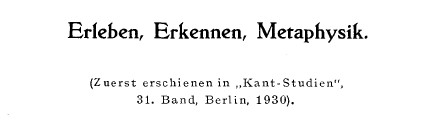
__
__
Standort: Erleben und Erlebnis bei Moritz Schlick.
*
Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse
Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse. * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Erleben und Erlebnis bei Moritz Schlick. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/Schlick.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert:
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
23.11.2023 Erfasst: Erleben, Erlebnis und Innere Wahrnehmung in der Allgemeinen Erkenntnislehre 2.A. 1925
04.03.2023 Kleine Korrekturen.
30.01.2023 Auklärung Schlicks Berufung auf Carnaps Der logische Aufbau der Welt (Habilitation 1926).
29.01.2023 Eingestellt.
00.01.2023 Erfassungen, Analysen.
15.01.2023 Angelegt.