(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=31.07.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änder ung: 23.02.24
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Praktische Psychologie des Erlebens_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Abteilung Allgemeine Psychologie, Bereich Erleben, und hier speziell zum Thema:
Praktische Psychologie des Erlebens
aus allgemeiner und integrativer
Perspektive
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
Gesamt-Übersichtsseite
Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse mit Direktzugriffen
Haupt-
und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse
* Zusammenfassung Hauptseite
* Erlebnisregister
* Beweisen in der Psychologie
* Beweisregister
Psychologie * natcode
Register * Zur Methode
der Fundstellen-Textanalyse * Hauptbedeutungen
Erleben und Erlebnis * Signierungssystem
* Begriffscontainer
(Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhof
_
Editorial
Die praktische Psychologie des Erlebens und der Erlebnisse beschäftigt sich I. mit der Kommunikation des Erlebens und der Erlebnisse im Alltag, im Bildungsbereich (Literatur, Kunst, Kultur), im Recht, in der psychologischen Beratung, Coaching, Psychotherapie und in den Medien. Im Wesentlichen scheint man sich zu verstehen und wenn es ein Problem gibt, fragt man nach oder diskutiert es. II. Eine besondere Rolle spielt die Schnittstelle zur wissenschaftlichen Psychologie des Erlebens und der Erlebnisse, wenn es um die Kommunikation von ErlebenswissenschaftlerInnen mit Versuchspersonen und ForschungspartnerInnen geht, wenn Erleben und Erlebnisse genauer wissenschaftlich erkundet werden sollen.
_
Einführung in die praktische Psychologie des Erlebens und der Erlebnisse
Das Wesentliche in der Praxis
Es ist nicht viel Zeit, keine Zeit für Wissenschaft
Es bestehen gewisse Erwartungen (Das Leben ist kein Forschungslabor)
Paradigmen der praktischen Psychologie in der Gesellschaft
Begutachtung
Beratung
Coaching
Psychologische Diagnostik
Psychotherapie
Rechtspsychologie
Supervsion
Schulpsychologische Dienste
Verkehrspsychologie
Begriffsunterscheidungen: Von der 14 untersuchten Unterscheidungen sind für die Praxis im Wesentlichen zwei wichtig: das eigentliche Erlebena, wie es die meisten Menschen verstehen und erlebeng als befassen, sich beschäftigen mit, wo es gerade nicht um das Erleben geht (Lipps 1905).
Im Alltag beschäftigt sich der Mensch gewöhnlich nicht damit,
was erleben ist. Für die meisten Menschen ist es kein Problem, von
ihrem Erleben und ihren Erlebnissen zu erzählen. Mensch erzählt
einfach, wie es ihm geht, wie er sich fühlt und drauf ist, was er
denkt, wünscht oder will. Gibt es ein Problem, diskutiert man darüber
und klärt es im Dialog. Erleben wird im Alltag erst dann zum Kommunikationsproblem,
wenn man es genauer wissen will, es nicht gut greifbar, unklar und schwer
in Worte zu fassen ist.
Für erleben werden oft auch andere Wörter
gebraucht, z.B. bemerken, bewusst werden, denken, empfinden, erfahren,
erfassen, erkennen, fühlen, gewahr werden, merken, mitbekommen, spüren,
wahrnehmen, wissen. Mit allen kann Erleben ausgedrückt werden. Eine
kurze Diskussion zu möglichen kleinen Unterschieden kann hier
eingesehen werden.
Grundfrage der praktischen Psychologie des Erlebens in verschiedenen
Bereichen:
Sprache, Haltung, Mimik, Gestik, Bewegung sind die wichtigsten Ausdrucksmittel
für erleben und Erlebnisse.
Wie werden in Alltagskontakten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden in der Kindertagesstätte erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden im Kindergarten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden auf dem Spielplatz erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden in der Schule erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden im Hort erleben und Erlebnisse ausgetauscht? (Standardkontakte
und Äußerungen)
Wie werden im Wirthaus erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden bei Sportereignissen erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden im öffentlichen Verkehr (Bus, Bahn, Straßenbahn)
erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden im Arbeitsleben erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden im Schwimmbad erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden in Alltagskontakten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden in Alltagskontakten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden in Alltagskontakten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden in Alltagskontakten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Wie werden in Alltagskontakten erleben und Erlebnisse ausgetauscht?
Nichtwissenschaftliche Kommunikation von PsychologInnen in der Gesellschaft
Der Alltag des Erlebens und
der Erlebnisse.
Die Grundfrage lautet: wie werden im Alltag erleben und Erlebenisse
ausgetauscht?
Viele Routinen, Standardsituationen und Gewohnheiten
im Alltag werden nicht besonders erlebt, sondern einfach gemacht, durchgeführt,
getan, abgewickelt, wobei gelegentlich das eine oder andere Gefühl
oder Interesse aufblitzt oder mitschwingt.
Man kann die Standardsituationen des Lebens unterschiedlich
gruppieren.
- Standardsituationen im Tagesverlauf: Schlaf, erwachen, wach sein, aufstehen, Bad / Toilette, anziehen, frühstücken, Weg zur Arbeit / Schule / Einkaufen, Vormittagsgestaltung, Mittagspause / Mittagessen, Nachmittagsgestaltung, Nachmittagspause, Weg nach Hause, Abendessen, Feierabendgestaltung, Nachttoilette, zu Bett gehen, schlafen.
- Standardsituationen im Wochenverlauf: Werktage, Wochenende.
- Standardsituationen im Jahresverlauf: Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
- Standardsituationen der Entwicklung im Lebensverlauf: Entwicklung: Kita, Kindergarten, 1. Fahrrad, Schuleintritt, ... > Schnittpunkte des Lebens, Liebe, erste Liebe; Partnerschaft, Kinderfrage, Schwangerschaft, Geburt, Höhepunkte, Tiefpunkte, Enttäuschungen, Verluste, Krisen, Trennung, Scheidung, ...; Freundschaft, Beziehungserleben, Erfolge, Mißerfolge, Tagesverlauf: Erwachen, aufstehen, Bad, Frühstück, Vormittag, Mittag, Nachmittag, früher Abend, später Abend, zu Bett gehen, schlafen (träumen); Freizeiterleben; Feierabend, Wochenende, Urlaub), älter werden, Alter, Rentenzeit, Hochbetagt- und Greisenzeit; Pflege; Sterben und Tod.
- Allgemeine Standardsituationen des Lebens (alphabetisch geordnet): Arbeit, Ausgehen, Begegnungen, Begegnungsstätten (Café, Disco, Gaststätte), Bewegung, Beziehungen und Beziehungspflege, Einkaufen, Essen, Feierabend, Fernsehen, Feste, Filme, Freizeit, Freundschaften pflegen, Haushalt, Information (Nachrichten, Weltgeschehen, Internet), Kleiden, Körperpflege (waschen, duschen, baden), Kochen, Kommunikation (unterhalten, reden, diskutieren, erzählen, verabreden), Kontakt (telefonieren, mailen, schreiben, soziale Medien, treffen), Musik, Radio, Reisen, Spiele, Sport, Tanz, Urlaub, Wandern, Wissenserwerb, Wochenende.
Teilweise überschneiden sich Erleben und Erlebnis im Alltag
mit Erleben und Erlebnis im Bildungsbereich und in den Medien.
Erlebenstabelle zur Selbsterkundung
seines Erlebens
In eine Erlebenstabelle kann man alle Elemente des Erlebens aufnehmen,
die sich zu einer Erlebensgestalt formen können und in einer Erlebenstabelle
abfragen:
- Was sehe ich?
- Was höre ich?
- Was rieche ich?
- Was schmecke ich?
- Wie spüre ich meinen Körper?
- Spüre ich mein Gleichgewicht?
- Spüre ich meine Bodenhaftung?
- Spüre ich Spannung?
- Spüre ich Druck?
- Welche Temperatur fühle ich?
- Was denke ich?
- Was fühle ich?
- Wie bin ich gestimmt?
- Wie ist mein Befinden?
- Was für Pläne habe ich?
- Was wünsche ich?
- Was will ich?
- Was brauche ich?
- Fühle ich Durst?
- Fühle ich Hunger?
- Habe ich Appetit?
- Worauf habe ich Lust?
- Woran habe ich Interesse?
- Welche Konflikte habe ich?
- Bin ich wach, klar, orientiert?
- Bin ich müde, abgespannt?
- Fühle ich mich fit, genügend Antrieb und Energie?
Erleben und der Erlebnisse im Bildungsbereich, Literatur, Kunst, Kultur, Sport und Gesellschaft.
Standardstätten im soziokulturellen Bereich (alphabetisch geordnet):
Akademien, Ausbildungsstätten, Ballett, Band, Begegnungsstätten
(Bar, Café, Gasthaus, ...), Berufsschulen, Bibliotheken, Bildungseinrichtungen,
Buchhandlungen, Büro, Chor, Erwachsenenbildung, Fabrik, Fernsehen,
Film, Freizeitparks, Galerien, Gesangverein, Geschäft, Gesellschaft,
Hochschulen, Kabarett, Kino, Kleinkunststätten, Konzert, Kunstausstellung,
Literatur, Museen, Musical, Musikveranstaltungen, Oper, Operette, Parteien,
Politik, Schulen, Singen, Soziales, Spirituelles, Sport (aktiv, passiv),
Sportverein, Theater, Universitäten, Verein, Volkshochschule.
Literatur > Erleben
und Erlebnis in der Literatur.
Die Literatur besteht zu großem Teilen aus Erzählungen von
Erleben und Erlebnissen und ist damit eine große und reichhaltige
Quelle für das Erleben und die Erlebnisse. Um diese Quelle zu nutzen
war zunächst die Frage zu klären, ob die literarischen
Schilderungen des Erlebens und der Erlebnisse für die wissenschaftliche
und praktische Psychologie genutzt werden dürfen und können.
Das ist mit positivem Ergebnis in einer eigenen Arbeit geschehen, die hier
eingesehen werden kann.
Erleben und Erlebnisse mit Medien
Artikel, Fernsehen, Internet, Radio, Soziale Medien, Zeitungen, Zeitschriften.
FAZ erleben
https://www.faz.net/suche/?query=erleben
"Tagelang Demokratie erleben" - Im winzigen Text kommt "erleben" nicht
mehr vor, nur im Titel
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/paulskirchenjubilaeum-veranstaltungen-im-ueberblick-18894673.html
"SZ erleben" - ein Newsletter der SZ und eine Rubrik für SZ AbonnentInnen
https://sz-erleben.sueddeutsche.de/
OZ Ostfriesenzeitung
"Wie erleben Ehrenamtler ihre Arbeit
bei den Tafeln?" Ostfriesenzeitung von Nora Kraft 02.12.2022: https://www.oz-online.de/artikel/1318548/Wie-erleben-Ehrenamtler-ihre-Arbeit-bei-den-Tafeln"
Im ganzen Artikel kommt "erleben" nur im Titel vor, aber nicht mehr
im Text selbst.
Der Spiegel
"Wirtschaft erleben" Der Spiegel,
manager magazin, 14.06.2020, 20:54 Uhr.
https://www.spiegel.de/thema/wirtschaft_erleben/
Auf der ganzen ersten Seite mit 20 Verweisen vom 19.März bis 14.
Juni 2020 kommt "erleben" nur in der Rubrik-Überschrift vor, aber
nicht im Text.
DIE ZEIT
https://www.zeit.de/suche/index?q=erleben&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
findet, Abruf 18.05.2023, 10.000 Suchergebnisse für erleben. Auf
der Startseite findet sich in keinem Text "erleben"
DIE WELT
https://www.welt.de/
Dort kann man mit WANT nach "erleben" suchen. Dort werden 20 Funde
ausgegeben, danach wird auf das Web verwiesen. Die Suchfunktion ist ausgesprochen
schlecht, weil die Suchergebnisse immer wieder neu aufgerufen werden müssen.
- "Vogler, der bei den Festspielen mit seinem Cello auch als Solist zu erleben ist, hatte ..."
- "... Der VfL und der SC Freiburg in Köln spielen vor einer Rekordkulisse - und erleben vielleicht eine Premiere."
- "... Wollen wir nicht die Auswirkungen erleben, die ..."
- "... «Wenn es so weitergeht, werden einige Kliniken das geplante neue Krankenhausgesetz gar nicht mehr erleben», ..."
TAGESSPIEGEL
https://www.tagesspiegel.de/
Keine Suchfunktion auf der Seite gefunden.
Erleben und Erlebnisse in der Psychotherapie.
Erleben spielt in der Psychotherapie eine große Rolle, weil die meisten Störungen das Erleben mehr oder minder direkt betreffen. Direkt und grundlegend ist das Erleben bei der Alexithymie (Fühlfähigkeit) und auch bei der Affektverflachung oder Affektübersteigerung betroffen. Affektverflachung wird bei mehreren Störungen angegeben: Alexythymie, Anhedonie, Depression, Schizophrenie, Psychosen. In der Psychopathologie versteht man unter Affektverflachung, dass das emotionale Erleben an Intensität, Dauer und Häufigkeit verliert. Gefühle, Stimmungen, Interessen, Wünsche und Bedürfnisse sind "ausgedünnt", vermindert. Eine Folge gestörter Fühlfähigkeit kann sich darin zeigen, dass der Mensch oft nicht weiß, was er will oder mag. Vergegenwärtigt man sich den Hauptsatz der Gefühlstheorie, dass uns die Gefühle sagen, was die Dinge uns bedeuten und wert sind, versteht man unmittelbar, wie wichtig die Fühlfähigkeit für unser Wollen und Entscheiden ist.
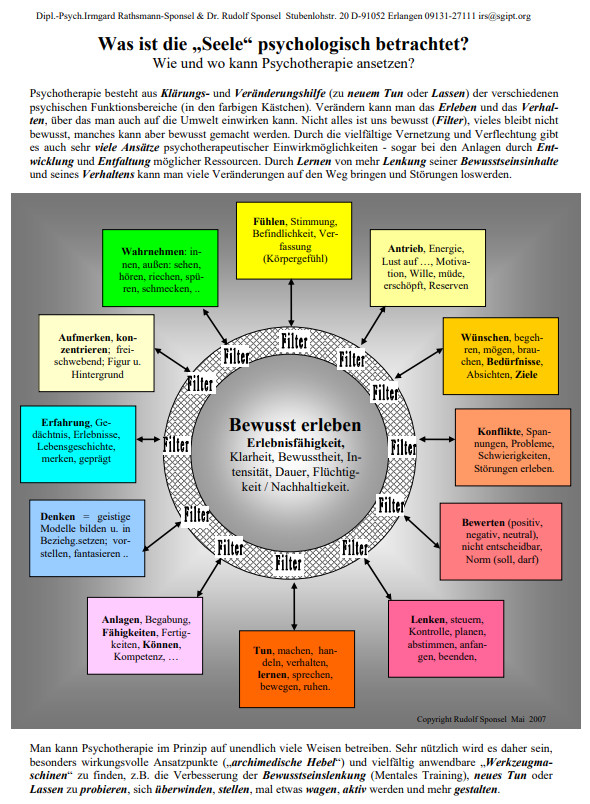
Praktische
Erlebens Hilfe Bewusstheits-Check
 |
Kommentar
Die Versform erhebt natürlich keinerlei literarischen Anspruch, sie soll das Erlernen dieser Abfrage erleichtern und im Laufe der Zeit ein alltägliches und jederzeit zur Verfügung stehendes Programm - Sammlung zur Innenschau - fördern. Folgende Funktionsbereiche werden hier angesprochen: 01 Wachheit
05 Antrieb, Energie, Kraft
09 Erinnerung, Gedächtnis
13 Positive Selbstanregung
|
Erlebensfördernde
Methoden in der Psychotherapie, psychologischen Beratung und im Coaching
Die Zuwendung und Achtsamkeit für das Erleben kann gefördert
werden. Und das ist besonders dann geboten, wenn der Verdacht besteht,
dass Symptombildungen mit unterdrücktem oder weggeschobenen Erleben
zu tun haben können.
Querverweise: