(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=15.7.2002 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 21.01.20.
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_Zitierung & Copyright_
Literatur und Linkliste
(Auswahl)
Staatsverschuldung und Umfeld:
Geld, Wirtschaft, Finanzen, Reichtum, Geldpathologie und
Psychopathologie des Geldes, von Wirtschaft und Finanzen
von Rudolf Sponsel, Erlangen.
Überblick Staatsverschuldung
* Überblick Schuldenuhren.
Aktuelle Verschuldung: Link zum Bund für Steuerzahler

Frei verwendbar mit Angabe der
Quelle R. Sponsel IP-GIPT (12/06) * Ausführlich.
- Übersicht
- Zusammenfassung * Abstract * Summary Staatsverschuldung.
- Finanz-, Wirtschafts- und Staatswissenschaften zum Umfeld Staatsverschuldung(Geld, Geldtheorie, Geldwert, Gold, Währung).
- Geldtabu.
- Lexika & Wörterbücher Wirtschaft & Finanzen.
- Historische Daten, Umrechnungen der verschiedenen historischen Währungen und ihrer Deckung.
- Alternativen zur plutokratischen Geldwirtschaft.
- PolitikerInnen, Ausbeutung des Staates, Korruption, Staatsmafiose Umtriebe (extern).
- Geldgeschichte.
- Geldwertgeschichte und Finanzkrisen.
- Psychologie und Psychopathologie des Geldes.
- Finanzkrise(n).
- Öffentliche Verschwendung und Mißwirtschaft.
- Alternativen zur plutokratischen Geldwirtschaft, Zins- und Zinseszinsprobleme.
- Literatur (Praktische) Finanzmathematik, Formeln und Tabellen.
- Steuern, Steuerrecht, Steuerpolitik, Steuerpsychologie.
- Staatsverschuldung (Spezial).
- Schulden und Finanzwirtschafts der Städte und Gemeinden
- Soziologische Grundlagen.
- Politische Möglichkeiten der BürgerInnen.
- Kommunale Haushalts- und Finanzwirtschaft.
- Geschichte der kommunalen Haushalte, Finanzen und Schuldenwirtschaft.
- Veröffentlichungen von KommunalpolitikerInnen.
- Einzelfallstudien:
- Die 250 reichsten Menschen in Deutschland werden im Manager-Magazin 3/2003 dokumentiert.
- Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesregierung.
- Das Pensionskostenproblem.
- Finanz- und Wirtschaftsrecht.
- Links Staatsverschuldung: Information, Basisdaten, Bewertung (Alphabetisch nach Quellen Sachbegriffe).
Literaturteil:
Zusammenfassung * Abstract * Summary Staatsverschuldung: Das psychologsiche Grundproblem liegt sicher in der falschenEinstellung und in der Folgenlosigkeit maßlosen Wirtschaftens. Staatsverschuldung hat eine jahrtausende alte Geschichte und Tradition über fast alle Kulturen und Epochen, geht über alle Herrschaftssysteme, über alle politischen Verwaltungsebenen (Gemeinden, Städte, Kreise, Bezirke, Länder, Bund, Nationen) und über alle Parteien hinweg. Sie ist ein grundsätzliches und strukturelles Problem (historisch oft durch Inflationen, Währungsreformen und Kriege entschuldet), das nur durch grundlegende strukturelle Veränderungen lösbar ist. Das Struktur-Problem Schuldenspirale ist langfristig nur lösbar, wenn echte Stabilitätsbedingungen in die Verfassung so eingebaut werden, dass VerletzerInnen automatisch amtsenthoben, für eine Zeit lang von Wahlen ausgeschlossen und nicht durch Abfindungen oder andere Vergünstigungen belohnt werden dürfen. Außerdem sollten PolitikerInnen als Minimalbedingung einen zu schaffenden Facharbeiterbrief in Politik nachweisen, der fortwährend qualitätszusichern ist. Schulden dürfen auch nur dann gemacht werden, wenn zugleich ein Investitions-Kostenfolge- und Tilgungsplan vorgelegt wird, der von Ephoren überwacht wird. Für die Verfassungsgerichte müssen neue Besetzungs- und Kontrollstrukturen gefunden werden.
Hierzu bedarf es eines starken öffentlichen Problem-Bewußtseins und einer tiefgreifenden Konditionierung der politischen Massenhirne. Schulden machen, das muss Gefühle wie Scheiße in der Zahncreme hervorrufen: Abscheu und Ekel.
Und man muss sich von falschen Eliten (Etilen) und besonders von den Irrlehren der US-etilE-Universitäten lösen - die sind in erster Linie für sich selber da - wie man auch begreifen muss, dass die USA ganz andere natürliche Wachstumsbedingungen haben als Deutschland (Bevölkerungswachstum und Arbeitsplatzentwicklung). Die USA sind weder real noch normativ oder ideal ein Weltmodell, das sollten die USA und wir Europäer und Deutsche möglichst schnell begreifen und akzeptieren. Die Ausbeutung und Zerstörung der Landwirtschaftsbasis der Dritten Welt durch die Globalisierung und die supra-nationalen Egoismen (EU)ist ein politisches Wirtschaftsverbrechen gegen die Menschlichkeit und die Regierungen der führenden Industrienationen gehörten dafür vor ein internationales Tribunal gestellt.
Als allererstes sollte bei PolitikerInnen das Geldtabu aufgehoben und radikale finanzielle Transparenz herbeigeführt werden und vielleicht wäre es eine gute Qualitätssicherungsmaßnahme, wenn JuristInnen und BeamtInnen wenigstens eine Quotenbegrenzung bei Wahlen erhielten, um das Allerschlimmste zu verhüten.
Kognitive Therapie des Schuldenproblems. Wie fast immer beginnt die Problemlösung mit der Problemwahrnehmung. Doch was ist hier das Grundproblem? Wie wir aus der Psychotherapie wissen, setzt eine Verhaltensänderung Leidensdruck, Motivation oder / und Einsicht voraus. Am Beginn einer Verhaltensänderung steht oft eine veränderte, neue Einstellung. Wie wichtig Einstellungen für Verhaltensänderungen sind, weiß man aus der "Küchenpsychologie": Gibt man irrtümlicherweise die Buntwäsche in das Kochwäscheprogramm, dann erfährt man ziemlich schnell, was eine falsche Einstellung der Waschmaschine für Folgen hat hinsichtlich der Buntwäsche (sie geht ein, verblasst und verfärbt).
Die elementar notwendige Grundstellung für eine dauerhaft verantwortliche, solide und vernünftige Haushaltswirtschaft ist:
- (1) man kann auf Dauer nicht mehr ausgeben als man einnimmt, ohne früher
oder später in der exponentiellen Schuldenfalle zu landen (>Eingangsgraphik,
was
bedeutet ...? );
(2) man muss in guten Zeiten Rücklagen bilden, damit man in schlechten Zeiten darauf zurückgreifen kann (> Antizyklische Finanzhaushaltung).
Hinweis: Zur Erkundung des Wissens, des BürgermeisterInnen-Profils und worauf es nach Meinung der kompetenten und erfolgreichen PraktikerInnen ankommt, habe ich einen "Fragebogen KommunalpolitikerInnen (fast) schuldenfreier Gemeinden" entwickelt, der sich derzeit in der Erprobungsphase befindet. Wer mitmachen möchte, melde sich bitte. Gesucht werden für die Kontrollgruppe auch BürgermeisterInnen und KommunalpolitikerInnen von Gemeinden, die noch stärker in den Schulden stecken.
Finanz-, Wirtschafts- und Staatswissenschaften zum Umfeld Staatsverschuldung
Geld, Geldtheorie, Geldwert, Gold, Währung * Spezielle Literatur Staatsverschuldung hier
- Andel, Norbert (1983). Finanzwissenschaft. Tübingen: Mohr.
- Anikin, A.W. (dt. 1980, russ. 1978). Gold. Berlin: Verlag Die Wirtschaft.
- Aubin, Hermann & Zorn, Wolfgang (1976). Handbuch der Deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 2 Bde. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Baader, Roland (2004). Geld, Gold und Gottspieler. Am Vorabend der nächsten Wirtschaftskrise. Gräfelfing: Resch.
- Baetge, Jörg (1996). Bilanzen. Düsseldorf: IDW-Verlag.
- Bundesbank (als PDF runterladbar): Kleine deutsche Währungsgeschichte
- Compter, Wolfgang (1964). Bankbetriebslehre. Darmstadt: Winklers.
- Döring, Herbert (1922). Die Geldtheorien seit Knapp. Greifswal: L. Bamberg.
- Fisher, Irving (1928). Die Illusion des Geldes. Berlin: Hobbing.
- Gäfgen, Gerard (1968). Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung. Untersuchungen zur Logik und ökonomischen Bedeutung des rationalen Handelns. Tübingen: Mohr.
- Issing, Otmar (1977). Einführung in die Geldtheorie. München: Vahlen.
- Häuser, Karl (1992). Ausgleichsforderungen und Währungsreform. BHF - Bank, Beilage zum Geschäftsbericht.
- Knapp, Gerog Friedrich (1923, 4. A.). Staatliche Theorie des Geldes. München & Leipzig: Duncker & Humblot.
- Knapp, Manfred (1984). Von der Bizonengründung zur ökonomisch politischen Westintegration. Frankfurt:
- Köhler, Claus (1962). Geldtheoretische Thesen im Spiegel der Empirie. Berlin: Duncker & Humblot.
- Köhler, Claus (1968). Orientierungshilfen für die Kreditpolitik. Berlin: Duncker & Humblot.
- Köhler, Claus (1977). Geldwirtschaft. Erster Band: Geldversorgung und Kreditpolitik. Berlin: Duncker & Humblot.
- Kolms, Heinz (1959 ff). Finanzwissenschaft. 4 Bde. Bd.I: Grundlegung, Öffentliche Ausgaben. II. Erwerbseinkünfte, Gebühren und Beiträge. Allgemeine Steuerlehre. III. Besondere Steuerlehre. IV. Öffentlicher Kredit, Haushaltswesen, Finanzausgleich. Berlin: Göschen.
- Landeszentrale für Politische Bildung NRW (1974, Hrsg.). Lebensqualität. Von der Hoffnung Mensch zu sein. Köln: Wissenschaft & Politik.
- Leontief, Wassily (1998). Input-Output Ecconomics. New York: Oxford University Press.
- Marshall, A. (1923). Money, Credit & Commerce. London: V?.
- Milde, Hellmuth & Monissen, Hans G. (1985, Hrsg.). Rationale Wirtschaftspolitik in komplexen Gesellschaften. Gèrard Gäfgen zum 60. Geburtstag. Stuttgart: Kohlhammer.
- Menger, Carl (1909). Geld. In: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Bd. 4. Jena: V?. Auch in: Menger Gesammelte Werke, Bd. IV, Schriften über Geld und Währungspolitik, 1-116. Tübingen: V?.
- Mises, Ludwig von (1912). Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. München: Duncker & Humblot.
- Mises, Ludwig von (1917/18). Klassifikation der Geldtheorie. Archiv für Sozialwissenschaften, 44. Bd.,198-213.
- Möller, Hans (1988). Die westdeutsche Währungsreform von 1948. WiSt Heft 6 - Juni
- Rasch, Harold (1966). Die Finanzierung des Wirtschaftswunders. Der Weg in die permanente Inflation. Stuttgart-Degerloch: Seewald.
- Recktenwald, Claus (1969, Hrsg.). Finanztheorie. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Riese, Hajo (1995). Geld. Das letzte Rätsel der Nationalökonomie. In: Schelkle et al. (1995), 45-62
- Rothbard, Murray Newton (2000). Das Schein-Geld-System. Wie der Staat unser Geld zerstört. Gräfelfing: Resch.
- Samuelson, Paul. A. & Nordhaus, William D. (dt. 1987, engl. 1985). Volkswirtschaftslehre. 2 Bde. Köln: Bund.
- Schelkle, Waltraud & Nitsch, Manfred (1998, Hrsg.). Rätsel Geld. Annäherung aus ökonomischer, soziologischer und historischer Sicht. O?: Metropolis.
- Schmölders, Günter (1968). Geldpolitik. Tübingen: Mohr.
- Schmölders, Günter (1983). Der Wohlfahrtsstaat am Ende. Adam Riese schlägt zurück. München: Langen-Müller.
- Wagemann, Ernst (1940). Wo kommt das viele Geld her? Geldschöpfung und Finanzlenkung in Krieg und Frieden. Mit einem Vorwort des Reichswirtschaftsministers und Präsidenten der Deutschen Reichsbank. Düsseldorf: Völkischer Verlag.
Geldtabu.
- Chambost, Edouard (dt. 1982, fr. 1980). Die Bankgeheimnisse in den Ländern der Welt. München: Piper.
- Lietaer, Bernard A. (2000). Mysterium Geld. Emotionale Bedeutung und Wirkungsweise eines Tabus. Mönchengladbach: Riemann.
Lexika & Wörterbücher Wirtschaft & Finanzen [s.a. Geldgeschichte]
- Dichtl, Erwin & Issing, Ottmar (1987, Hrsg.). Vahlens großes Wirtschaftslexikon. 4 Bde. München: C.H. Beck & dtv.
- Grosjean, René Klaus (9. A. 1984, Hrsg.). Gabler Bank Lexikon. Handwörterbuch für das Bank- und Sparkassenwesen mit Bankenverzeichnis. Wiesbaden: Gabler.
- Kosiol. Erich (1969, Hrsg.). Handwörterbuch des Rechnungswesens. Stuttgart: Poeschel.
- Oppitz, Volker (1995). Gabler Lexikon Wirtschaftlichkeits Rechnung. Mit Anwender Software für Praxis und Studium. Wiesbaden: Gabler.
- Recktenwald, Horst Claus (1983). Lexikon der Staats- und Geldwirtschaft. München. Vahlen.
- Sellien, R. & Sellien, H. (1972). Wirtschafts-Lexikon. 6 Bde. Kurzausgabe: Frankfurt: Fischer.
- Staender, Klaus (1993, 3.A.). Lexikon der öffentlichen Finanzwirtschaft. Wirtschafts-, Haushalts- und Kassenrecht. Heidelberg: R.v.Deckers.
Historische Daten, Umrechnungen der verschiedenen historischen Währungen und ihrer Deckung [s.a. Geldgeschichte]
- Aftalion, Albert (1913). Les crises périodiques de surproduction. 2 Bde. Paris:
- Hars, Peter (1992). Der Dareikos. Schicksale um eine Goldmünze. Stuttgart: Theiss.
- Caesars erste Frau Cornelia war 55 v. nicht mehr am Leben (S. 193);
- Soldaten trugen keine Toga (S. 196 und öfter);
- Varus war nicht Statthalter von Iudaea (S. 224), sondern von Syrien gewesen (richtig S. 254);
- etwas seltsam, daß der Legionär Domitius einen (offenbar legitimen) Sohn in Pompeii haben soll (S. 231)."
- Historische Wirtschaftsdaten USA: Links im Das Schulden-Porträt der USA 1791-2004.
- Juglar, Clément (1860, 2.ed. 1889). Des Crises commerciales et de leur retour périodique en France, en Angleterre et aux Etat-Unis. Paris:
- Kellenbenz, Hermann (1976). Zahlungsmittel, Maße und Gewichte seit 1800. 3. Das deutsche Reich 1871-1814. In: Aubin, Hermann & Zorn, Wolfgang (1976). Handbuch der Deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Stuttgart: Klett-Cotta. Hier aus Bd. II,S. 943-946.
- Lescure, Jean (1906, 4.ed.). Des crises générales et périodiques de surproduction. 2 Bde. Paris:
- Mitchell, Wesley Clair (1913). Business Cycles. Berkeley:
- Mitchell, Wesley Clair (1927). Business Cycles, The Problem and its Setting. New York:
- Mitchell, Wesley Clair (dt. 1931). Der Konjunkturzyklus, Problem und Problemstellung. Herausgegeben von E. Altschul. Leipzig:
- Pigou, A. C. (1927). Industrial Fluctuations. London:
- Schumpeter, Joseph A. (1939). Business Cycles. A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalistic process. New York & London:
- Spiethhoff, Arthur (1955). Die wirtschaftlichen Wechsellagen. II. Lange statistische Reihen. Mit einem deutschen Preisindex von 1889-1939. Mohr: Tübingen.
- Umrechnung von Währungen/Gold um 1900 und ab dem Jahr 2000 mit ergänzenden Wirtschaftsdaten einiger Länder Goldstandard und Umrechnungen: [URL geändert ohne Weiterleitung]
Der Dareikos kann als der "Dollar" (Welthandelswährung) der Antike zur Zeit Philipps und Alexander d. G. angesehen werden. In der kritischen Besprechung [1] werden folgende Versehen angemerkt: "Der Dareikos steht an keiner Stelle wirklich im Mittelpunkt der Handlung (anders als beim sonst nicht unähnlichen "Amulett" von Bergius), sondern dient eher als nebensächlicher Vorwand für die Verkettung der einzelnen Episoden. ... Es gibt einige sachliche Versehen:
Geldgeschichte [Google] [s.a. Lexika u. Historische Daten]
Links Museen, Sammlungen, Münzen, Geld per fiat (durch glauben [an seinen Wert]):
- Coin Net: http://www.coin.net/.
- Federal Reserve Bank of Minneapolis: The History of Money: http://minneapolisfed.org/econed/curric/history.cfm.
- Geldgeschichtliches Museum der Kreissparkasse Köln. http://www.geldgeschichte.de/.
- Geldmuseum Deutsche Bundesabnk: http://www.geldmuseum.de/einblick/einblick_geldgeschichte.php.
- Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte: http://www.gig-geldgeschichte.de/.
- Gold : prices, facts, figures & research MONETARY EPISODES FROM HISTORY http://www.galmarley.com/framesets/fs_monetary_history_faqs.htm.
- History of Money from Ancient Times to the Present Day by Glyn Davies: http://www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/llyfr.html.
- Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Bibliothek und Sammlung: http://www.univie.ac.at/Wissenschaftstheorie/wiss-archive/daten/archiv59.html.
- Materialien zur Münz- und Geldgeschichte (schweiz): http://www.muenzgeschichte.ch/muenzgeschichte/m_intro.htm.
- The American Numismatic Society and The Federal Reserve Bank of New Yorkhttp://www.amnumsoc.org/exhibits/DrachmasDoubloonsDollars/.
- The British Museum: World of Money: http://www.thebritishmuseum.ac.uk/worldofmoney/world_wom.html.
- Fengler, Heinz; Gierow, Gerhard & Unger, Willy (1982, 3.A.). Lexikon der Numismatik. Berlin: transpress.
- North, Michael (1995, Hrsg.). Vom Aktie bis Zoll. Ein historisches Lexikon des Geldes. München: C.H. Beck.
- Brown, Ellen Hodgson (dt. 2009). Der Dollar-Crash. Was Banker Ihnen nicht erzählen. Die schockierende Wahrheit über die US-Notenbank, unser Währungssystem und wie wir uns von ihm befreien können. Rottenburg: Kopp-Verlag.
- Griffin, G. Edward (dt. 2011, 3.A.). Die Kreatur von Jekyll Island. Die US-Notenbank FEDERAL RESERVE. Das schrecklichste Ungeheuer, das die Hochfinanz je schuf. Rottenburg: Kopp Verlag.
- Henderson, Dean (dt. 2011). Das Kartell der Federal Reserve. Acht Familien beherrschen die Welt. Rottenburg: Kopp-Verlag.
- Paul, Ron (dt. 2010). Befreit die Welt von der US-Notenbank! Rottenburg: Kopp-Verlag.
- US-Notenbank. Der mächtigste Geheimbund der Welt. Geld-Magazin Extra der Wiener Zeitung 04/2009 (PDF)
- Komprimiert und kritisch:: Die Entstehungsgeschichte der vermeintlich staatlichen US- Zentralbank "Federal Reserve System", kurz FED.
FED Eine Gruppe von Privatbanken, die - unter dem irreführenden Namen Federal Reserve Board - eine "unabhängige" USA Bundesbank mimen und sich damit das Geld drucken, im Wert steigen oder fallen lassen können, wie sie es gern hätten. Video: Wer steckt hinter dem Zentralbanksystem - Interessantes Video am Beispiel FED. Ebenfalls sehr interessant: Video: Wie Banken Geld aus Schulden schaffen.
Wichtige
kritische Veröffentlichungen zur FED:
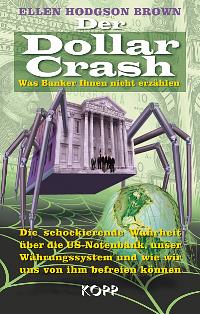


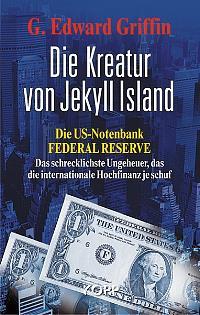
Zum direkten Bestellen bitte das jeweilige Titelbild anklicken. Präsentationen
finden Sie unter den Links:
Psychologie und Psychopathologie des Geldes
- Ahrends, Martin (1988). Das große Geld. Spielsucht: Fallbeispiele-Symptome-Therapie.München: Heyne.
- Bornemann, Ernest (1977, Hrsg.). Psychoanalyse des Geldes. [Reader mit Bibliographie psychoanalytischer und psychologischer Schriften zur Geldtheorie und großem Literaturverzeichnis]. Frankfurt: Suhrkamp.
- Coën, Evelyne (2001). Das Geld regiert die Menschen. Zeitschrift für Sozialökonomie 131. Folge 38J. Dez, 3-8
- Getty, J. Paul (dt. o.J., engl. o.J.). Wie wird man reich [verkürzte TB von: So macht man Milliarden]. München: Goldmann.
- Goldberg, H. & Lewis, R.T. (dt. 1983, engl. 1978). Der Tanz ums goldene Kalb. Geld und Gold als Schicksal und Verhängnis im Leben und Charakter des Menschen. Zürich: SV INternational.
- Heinrichs, Johannes (2001). Wege aus einer kranken Gesellschaft. Zeitschrift für Sozialökonomie 131. Folge 38J. Dez, 49-62.
- Haubl, Rolf (1999). Zur Psychodynamik des Geldes - Unbewusste monetäre Phantasien. Psychoanalyse-im-Widerspruch. 1999; 21: 29-43
- Horn, Jack (1976). Geld als Liebesersatz. Psychologie Heute Oktober, S. 65
- Kerber, Bärbel (2001).Geld - reine Gefühlssache. Zeitschrift für Sozialökonomie 131. Folge 38J. Dez, 9-12
- Lietaer, Bernard A. (2000). Mysterium Geld. Emotionale Bedeutung und Wirkungsweise eines Tabus. Mönchengladbach: Riemann.
- Lundberg, Ferdinand (o.J.). Die Reichen und die Superreichen. Macht und Allmacht des Geldes. Hamburg: Hoffmann und Campe. Hier Lizenz für Bertelsmann et al.
- Jungblut, Michael (1973). Die Reichen und die Superreichen in Deutschland. Reinbek: Rowohlt.
- Mayle, Peter (1995). Geld allein macht doch glücklich. Erstaunliches und Kurioses aus der Welt der Reichen. München: Knaur.
- Mohr Catalano, Ellen & Sonenberg, Nina (1996). Kaufen, kaufen, kaufen. Wegweiser für Menschen mit zwanghaftem Kaufverhalten. Ein Selbsthilfeprogramm mit vielen Fragebögen und Protokollen. Regeln fürs Geldmanagement. Stuttgart: Thieme.
- Niehuis-Schwiertz, Hermann (2001). Götter, Geld und Grenzerfahrungen - Die griechische Mythologie als Quelle von Einsichten in archetypische Muster des Handels. Zeitschrift für Sozialökonomie 131. Folge 38J. Dez, 24-33
- Nutt, Harry (1994). Chance und Glück. Erkundungen zum Glücksspiel in Deutschland. Frankfurt: Fischer.
- Onken, Werner (2001). Das Geld(tabu) und die menschliche Seele. Zeitschrift für Sozialökonomie 131. Folge 38J. Dez, 34-48
- Packard, Vance (dt. 1990, engl. 1989). Die Ultra Reichen. Anatomie eines amerikanischen Phänomens. Düsseldorf: Econ.
- Petry, Joerg (1998). Geld, Selbstwert, Gluecksspielsucht und therapeutisches Geld-/Schuldenmanagement. In: Fuechtenschnieder, Ilona, Petry, Joerg (1998). Glücksspielsucht. Gesellschaftliche und therapeutische Aspekte. München: Profil. S. 77-102
- Pritzkoleit, Kurt (oJ, ca. 1958). Glück und Geld. Die Dynamik der neuen Wirtschaftsherren. München: List.
- Rattner, Josef (2001). Geld, Macht und menschliche Seele. Zeitschrift für Sozialökonomie 131. Folge 38J. Dez, 16-23
- Ritter, Hugo (1952). Der Mensch und das Geld. Sinn und Unsinn des Geldes im Kampf um den Fortschritt. München: Goldmann.
- Schmidbauer, Wolfgang (1995). Jetzt haben, später zahlen. Die seelischen Folgen der Konsumgesellschaft. Reinbek: Rowohlt.
- Schmölders, Günter (1970). Finanz- und Steuerpsychologie. Erweiterte Neuauflage von: Das Irrationale in der öffentlichen Finanzwissenschaft. Reinbek: Rowohlt.
- Schweitzer, Rosemarie von (1991). Einführung in die Wirtschaftslehre des privaten Haushalts. München: UTB (Ulmer).
- Scitovsky, Tibor (dt. 1977, engl. 1976).Psychologie des Wohlstands. Die Bedürfnisse des Menschen und der Bedarf des Verbrauchers. Frankfurt: Campus.
- Simmel, Georg (1920; 2001 reprint). Philosophie des Geldes. Köln: Parkland.
- Stopp, Konrad (1994). Wider die Raffgesellschaft oder Wie der Sozialstaat noch zu retten ist. München: C.H. Beck.
- Suprayan, Ingrid (2001). Geld als Droge? Zeitschrift für Sozialökonomie 131. Folge 38J. Dez, 13-15
- Tegtmeier, Ralph (1988). Der Geist in der Münze. Vom magischen Umgang mit Reichtum und Geld. Reihe Grenzwissenschaften, Esoterik. München: Goldmann.
- Zaster, Zacharias [Pseudonym] (1999). Kapitale Lust. Das geheime Sexualleben des Geldes. Berlin: Quadriga.
Geldwertgeschichte und Finanzkrisen
Doku Finanzkrise 2007/08/09 ... 3-10, 2-10, 1-10, 4-09, 3-09, Grundlagen: 2007-09.
Was hat man im Laufe der Geschichte für sein Geld bekommen, was war es wert; Inflationen und Währungsreformen.
s.a. Aubin.
- Böe, A. (1904). Kulturbilder aus Deutschlands Vergangenheit für Schule und Haus zur Ergänzung und Belebung des Geschichtsunterrichts. Leipzig: Gustav Gräbener.
- Czerny, Alexander (o.J.). Kurzbeschreibung der aktuellen Finanzkrise. [PDF]
- Dirlmeier, Ulf (1978). Untersuchungen zu Einkommensverhältnissen und Lebenshaltungskosten in oberdeutschen Städten des Spätmittelalters. Heidelberg: Winter.
- Eichhhorn, Wolfgang & Solte, Dirk (2010). Das Kartenhaus Weltfinanzsystem. Rückblick - Analyse - Ausblick. Bonn: bpb.
- Gaettens, Richard (1982). Geschichte der Inflationen. Vom Alterum bis zur Gegenwart. München: Battenberg.
- Konrad, Kai A. & Zschäpitz, Holger (2010). Schulden ohne Sühne. Warum der Absturz der Staatsfinanzen uns allte trifft. München: C.H. Beck.
- Müller, Leo (2010). Bank-Räuber. Wie kriminelle Manager und unfähige Politiker uns in den Ruin treiben. Berlin: Econ.
- Reinhart, Carmen M. & Rogoff, Kenneth S. (dt. 2010, engl. 2009). Dieses Mal ist alles anders. Acht Jahrhunderte Finanzkrisen. München: Finanzbuch [Verlags-Info]
- Riese, Hajo (1986). Theorie der Inflation. Tübingen: Mohr.
- Soros, George (2008). Das Ende der Finanzmärkte - und deren Zukunft. Die heutige Finanzkrise und was sie bedeutet. München: FinanzBuch.
- Slotosch, Walter (1970). Das Geld mit dem wir leben müssen. Panorama der Weltinflation. München: Desch.
PolitikerInnen, Ausbeutung des Staates, Korruption, Staatsmafiose Umtriebe
Öffentliche Verschwendung und Mißwirtschaft
- Alljährliches Schwarzbuch "Die öffentliche Verschwendung" des Bundes der Steuerzahler: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 , 2001,
- Internet-Netzwerk Kritik Intelligenz Reform (IN-KIR). Dokumentation von Äffären, kriminellen Machenschaften, Inkompetenz und Versagen.
- Links zu Datenquellen und Kontrollinstanzen (Rechnungshöfe, Bund der Steuerzahler, ...).
- Bandulet, Bruno (1979, 2.A.). Schnee für Afrika. Das Milliardengeschäft mit der Entwicklungshilfe. Mit einem aktuellen Bericht des Bundesrechnungshofes (im Wortlaut). München: Herbig.
- Möntmann, Hans G. (1994). Protzkis Traumland. Das Brevier über Bereicherung, Verschwundung und Prunktsucht im Öffentlichen Dienst.Wien: Ueberreuther.
Alternativen zur plutokratischen Geldwirtschaft, Zins und Zinseszinsprobleme
Hier gibt es schon eine ganze Reihe von Vorstellungen: Die Freigeld-Lehre von Silvio Gesell [1,2,3,4,Google,], die Idee des Vollgeldes, Bürgergeld [1,Google,], Monetative, Lehren aufs dem Notgeld (Google,], Gutschein oder Privatgeld [1,2,3,] und die Tauschringe [1,Google,]. Hierzu gehört auch die Idee der Gegenseitige Hilfe von Kropotkin. Interview mit Heidemarie Schwermer Leben ohne Geld [BR-Online]. Münchener Modell Fließendes Geld.
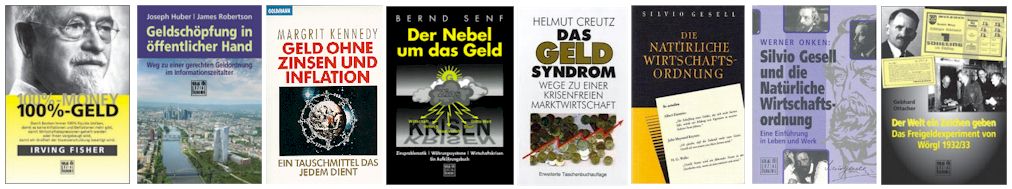
- Creutz,Helmut (1993 ff). Das Geldsyndrom. Wege zu einer krisenfreien Marktwirtschaft. 4. aktualisierte Ausgabe 1997. Berlin: Ullstein. [Online]
- Fisher, Irving (1935, dt. 2007). 100% Money. 100% Geld. Kiel: Verlag für Soziale Ökonomie. [PDF]
- Gartz, Ludwig (2008). Fließendes Geld. Die Geburt des Goldenen Zeitalters. St. Augustin: Aragorn.
- Gesell, Silvio (1916 ff). Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. Les Hauts Geneveys: Selbstverlag. Mehr > W.
- Huber, Joseph (2004). Reform der Geldschöpfung. Wiederherstellung des staatlichen Geldregals und der Seigniorage durch Vollgeld. Zeitschrift für Sozialökonomie, 41. Jg., 142. Folge, Sept. 2004, S. 13–21.
- Huber, Joseph (2008). Geldschöpfung in öffentlicher Hand : Weg zu einer gerechten Geldordnung im Informationszeitalter. Kiel : Gauke.
- Huber, Joseph (2011). Monetäre Modernisierung. Zur Zukunft der Geldordnung, Marburg: Metropolis.
- Looff, Rüdiger (). Die Auswirkungen der Zinsliberalisierung in Deutschland
- Kennedy, Margrit (1990 ff).Geld ohne Zinsen und Inflation. München: Goldmann.
- Kennedy, Margrit (2011). Occupy Money. Damit wir zukünftig ALLE die Gewinner sind.
- Senf, Bernd (2011). Zinssystem und Staatsbankrott. Die eigentlichen Ursachen der Wirtschafts- und Finanzkrise. DVD 165 min Kopp-Media.
Literatur (Praktische) Finanzmathematik, Formeln und Tabellen
- Alt, Helmut. (1979). Angewandte Mathematik Finanzmathematik Statistik Informatik für UPN Rechner. Braunschweig, Vieweg.
- Bussmann, Karl Ferdinand (1949). Kaufmännisches Rechnen und Finanzmathematik / Karl Ferdinand Bussmann, München : Weinmayer.
- Däumler, Klaus Dieter (1978). Finanzmathematisches Tabellenwerk für Praktiker und Studierende. Herne: NWB. [B]
- Caprano, Eugen und Konrad Wimmer (1999). Finanzmathematik. Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft. 6., völlig überarbeitete Auflage München: Verlag Franz Vahlen.
- Flechsenhaar, A. (1927). Einführung in die Finanzmathematik. zweite Auflage bearbeitet in Verbindung mit F. Fleege-Althoff. Leipzig: B. G.Teubner.
- Haberler, Gottfried von (1927). Der Sinn der Indexzahlen : Eine Untersuchg über d. Begriff d. Preisniveaus u. d. Methoden s. Messung. Tübingen: J. C. B. Mohr
- Heidorn, Thomas (2006, 5.A.). Finanzmathematik in der Bankpraxis. Vom Zins zur Option. Wiesbaden: Gabler. [EB]
- Ihrig, Holger & Pflaumer, Peter (2001). Finanzmathematik. Intensivkurs. 8., verbesserte und erweiterte Auflage München / Wien: R. Oldenbourg Verlag. [B]
- Irle, Albrecht & Prelle, Claas (2007). Übungsbuch Finanzmathematik. Teubner Studienbücher Wirtschaftsmathematik. Leitfaden, Aufgaben und Lösungen zur Derivatbewertung. Wiesbaden: Teubner. [EB]
- Isaac, Alfred (1983). Praktische Anwendungen der Finanzmathematik. Herausgegeben von Wilhelm Hasenack Essen: W. Girardet Verlag
- Kemeny / Schleifer jr. / Snell / Thompson (1966). Mathematik für die Wirtschaftspraxis. Mit zahlreichen Abbildungen, Tabellen, Formeln und Sachregister. Berlin: Walter de Gruyter Verlag.
- Kosiol, Erich (1973). Finanzmathematik. rechnerische Grundlagen, Zinseszinsrechnung, Rentenrechnung, Tilgungsrechnung, Kursrechnung. Wiesbaden: Gabler. [B]
- Kremer, Jürgen (2006). Einführung in die Diskrete Finanzmathematik. Berlin: Springer. [EB]
- Krüger, Kurt/ Schröder, Hannelore: (1977). Finanzmathematik. Mit Lösungsheft. Paderborn: Schöningh.
- Ladegast, K. (1929). Finanzmathematik. Ein Leitfaden für die Praxis, insbesondere für Kommunen, Banken und Sparkassen. Bln.. Köln: Heymann.
- Locarek, Hermann (1991): Finanzmathematik. Lehr- und Übungsbuch. München: Oldenbourg.
- Männel, Rolf (1992). Mathematik für die Höhere Berufsfachschule Typ Wirtschaft (Höhere Handelsschule) Band 1: Algebra mit Finanzmathematik. Bad Homburg v. d. H.: Dr. Gehlen.
- Mösenthin, Gerhard (1956). Finanzmathematik gut verständlich. Lehrbuch und Aufgabensammlung. Rinteln: Merkur
- Nehls, Jürgen & Nehls, Christian Tobias (2001, 2.A.). Kapitalisierungstabellen. Berlin: Schmidt. [B]
- Nicolas, Marcel (1967). Finanzmathematik. Berlin: Walter de Gruyter & Co. Sammlung Göschen, 1183.
- Renger, Klaus (2006, 2.A.). Finanzmathematik mit Excel. Grundlagen – Beispiele – Lösungen. Mit interaktiver Übungs-CD-ROM. Wiesbaden: Gabler. [EB]
- Seckelmann, (1989). Zinsen in Wirtschaft und Recht. Einführung in die Finanzmathematik als logische Grundlage des Finanzrechts, in Anwendungen in der Wirtschaft und Besonderheiten im Geldgewerbe. Analyse des gegenwärtigen Finanzrechts. Frankfurt/M.: Knapp.
- Tanew Gerhard (1994). Finanzmathematik für Manager. : Orac 1994.
- Tietze, Jürgen (1997). Einführung in die Finanzmathematik. Braunschweig. Wiesbaden: Friedr. Vieweg & Sohn. [EB]
- Tietze, Jürgen (2000, 5.A.). Übungsbuch zur Finanzmathematik. Braunschweig. Wiesbaden: Friedr. Vieweg & Sohn. [EB]
- Tietze, Jürgen (2007, 6.A.). Übungsbuch zur angewandten Wirtschaftsmathematik. Braunschweig. Wiesbaden: Friedr. Vieweg & Sohn. [EB]
- Werner, Gerhard (1980). Wirtschaftsrechnungen. Grundlagen und Methoden. Wiesbaden: Gabler. [B]
- Wolf, Alfred (1951). Einführung in die Politische Arithmetik (Finanz-Mathematik). Wien: Deuticke.
- Wüst, Kirsten (2006). Finanzmathematik. Vom klassischen Sparbuch zum modernen Zinsderivat. Wiesbaden: Gabler.
Steuern, Steuerrecht, Steuerpolitik, Steuerpsychologie
- Mann, Karl Friedrich (1937). Steuerpolitische Ideal. Vergleichende Studien zur Geschichte der ökonomischen und politischen Ideen und ihres Wirkens in der öffentlichen Meinung 1600-1935. [Finanziwssenschaftliche Forschungen Hef t 5]. Jena: G. Fischer.
- Ötsch, Silke & Di Pauli, Celia (2009, Hrsg.). Steuer-Oasen. "Räume der Offshore-Welt". Frankfurt, September 2009: Attac-Trägerverein. ISBN 978-3-9813214-0-1.
- Palan, Ronen; Murphy, Richard & Chavagneux, Christian (2009). Tax Havens. How Globalization Really Works. Cornell Studies in Money. $24.95s paper. 2009, 280 pages, 6 x 9, 4 charts/graphs, 16 tables. ISBN: 978-0-8014-7612-9. [Info]
- Schmölders, Günter (1970). Finanz- und Steuerpsychologie. Erweiterte Neuauflage von: Das Irrationale in der öffentlichen Finanzwissenschaft. Reinbek: Rowohlt.
- Schönfels, Friedrich von & Leske, Jürgen (1997). Den Redlichen fressen die Steuern. Der grassierende Betrug, die nutzlose Reform. Hamburg: Hoffmann & Campe.
- Schultz, Uwe (1992, 3.A., Hrsg.). Mit dem Zehnten fing es an. Eine Kulturgeschichte der Steuer. München: C.H. Beck.
Staatsverschuldung
- Ahrens, Gerhard (5/1984). Staatsverschuldung ohne Ende. Hochschule der Bundeswehr Hamburg. Beiträge aus dem Fachbereich Pädagogik.
- Bartz, Torben (2007). Staatsverschuldung in einem Modell überlappender Generationen. O:? Grin.
- Blankart, Charles B. (2006). Öffentliche Finanzen in der Demokratie. Eine Einführung in die Finanzwissenschaft. München: Vahlen.
- Bloch, Sebastian (2009). Staatsverschuldung. Begriff, gesamtwirtschaftliche Funktion, internationaler Vergleich. O:? Grin.
- Bogensperger, Johann A. (2007). Die Finanzkrise Argentiniens. Auswirkungen einer verfehlten Finanzpolitik des Internationalen Währungsfonds. O:? Vdm.
- Bräuninger, Michael (2003). Public Debt and Endogenous Growth. Würzburg: Physica.
- Bundesminister für Wirtschaft (2007, Hrsg.). Staatsverschuldung wirksam begrenzen. Expertise im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
- Dabrowski, Martin; Fisch, Andreas; Gabriel, Karl & Lienkamp, Christoph (2003, Hrsg.). Die Diskussion um ein Insolvenzrecht für Staaten. Bewertungen eines Lösungsvorschlages zur Überwindung der Internationalen Schuldenkrise. Tagungsbd. O:? Duncker & Humblot
- Deutsche Bundesbank. Monatsberichte der Deutschen Bundesbank Seit 1948. Besonders: Statistischer Teil Abschnitt VIII Öffentliche Finanzen in Deutschland, 7: Verschuldung der öffentlichen Haushalte.
- Deutsche Bundesbank (1976). Deutsches Geld- und Bankwesen in Zahlen 1876-1975. Frankfurt: Knapp.
- Deutsche Bundesbank (1988). 40 Jahre Deutsche Mark - Monetäre Statistiken 1948-1987: Frankfurt: Knapp.
- Deutsche Bundesbank (1997). Die Entwicklung der Staatsverschuldung seit der deutschen Vereinigung. Monatsbericht 3, 1997, 17-32
- Deutsche Bundesbank (1998, Hrsg.). Fünfzig Jahre Deutsche Mark. Notenbank und Währung seit 1948. München: C.H. Beck. Hierzu ist auch eine CD-ROM mit den Statistiken erschienen.
- Donner, Otto (1942). Die Grenzen der Staatsverschuldung. Weltwirtschaftliches Archiv, Bd.56, Heft 2, Sonderabdruck. Jena, G. Fischer.
- Ehrlicher, Werner (1981, Hrsg.). Geldpolitik, Zins und Staatsverschuldung. Schriften des Vereins für Socialpolitik : N.F.; Bd. 111 Berlin : Duncker & Humblot.
- Emmerling, Simon (2007). Staatsverschuldung - Formen, Entwicklungen und Probleme. O:? Grin.
- Etter, Patrick (2007). Die Reform des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts. Problematik und Auswirkungen. O:? Vdm.
- Fehr, Hans; Grossekettler, Heinz ; Neck, Reinhard & Schwarting, Gunnar (2005). Haushaltspolitik und öffentliche Verschuldung. O:? Duncker & Humblot.
- Finsterbusch, Sebastian (2005). Staatsverschuldung in der Bundesrepublik Deutschland. Historische Entwicklung, rechtliche Grundlagen, ökonomische Folgen. Berlin: Fachverl. für Politische Kommunikation.
- Fojcik, Thomas Martin (2009). Staatsverschuldung in Deutschland. Lastenverschiebung auf zukünftige Generationen? O:? Grin.
- Gönner, Nikolaus Thaddäus von (1826). Von Staatsschulden, deren Tilgungs-Anstalten und vom Handel mit Staatspapieren. München: Fleischmann. [GB]
- Graeber, David (2012). Schulden. Die ersten 5000 Jahre. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grashoff, D. (1993). Staatensukzessionsbedingter Schuldnerwechsel: Die Teilung öffentlicher Schulden unter Nachfolgestaaten im Dismembrationsfall. Diss.Konstanz.
- Gunkel, Martin (2009). Bewältigung von Staatsinsolvenz durch collective action clauses? O:? Diplomica.
- Hengstenberg, Claudine (2010, Hrsg.). Rating-Agenturen. Die Richter über die Tops und Flops der Weltwirtschaft. O:? Fastbook Publishing.
- Hoff, Benjamin-Immanuel (2007). Staatsverschuldung. Berlin, BWV.
- Joachim-Jungius-Gesellschaft (1996, Hrsg.). Staatsüberschuldung. [Geschichte 1800-1996] Referate gehalten auf dem Symposium der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften Hamburg am 9. und 10. Februar 1996. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kerber, Markus C. (2002). Der verdrängte Finanznotstand. Zur finanzpolitischen Verantwortlichkeit von Parlament und Regierung sowie zur Rolle des Bundes als Hüter der finanzwirtschaftlichen Souveränität. Berlin: Springer.
- Kern, Helmut (1981). Monetäre Wirkungen der Staatsverschuldung. Konsequenzen für das Debt Management. Schriftenreihe der Hochschule Speyer Band 83. Berlin: Duncker & Humblot.
- Korth, Daniel (2007). Das ungelöste, wirtschaftliche Strukturproblem "Staatsverschuldung" in der politischen Wirtschaftslehre - Ursachen, Entw. O:? Grin.
- Lahnstein-Kandel, Sonja & Göring, Michael (1999, Hrsg.). Staatsverschuldung. In: Der soziale Zusammenhalt in den Staaten der triade USA, Japan, Europa, 111-239. Baden-Baden: Nomos.
- Lerch, David Christoph (2007). Wer verhindert den Schuldenabbau? Kann der Vetopunkte-Ansatz Unterschiede beim Abbau der Staatsverschuldung erklären? Eine vergleichende Untersuchung von Großbritannien, Deutschland, Schweden und Finnland. O:? Grin.
- Likawetz-Oberhauser, A. (1850). Die europäischen Staats- Schulden vergleichend dargestellt. Wien: Gerold.
- Martin, Paul C. (1983). Wann kommt der Staatsbankrott? München: Langen-Müller Verlag.
- Martin, Paul C. & Lüftl, Walter (1984, 2.A.). Die Pleite. Staatsschulden, Währungskrise und Betrug am Sparer. München: Langen-Müller.
- Meyer, Alexander (2009). Politische Institutionen und Staatsverschuldung. O:? Grin.
- Milbradt, Georg (1980). Darstellung und Analyse der Staatsverschuldung in der Bundesrepublik Deutschland. Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialpolitik der deutschen Wirtschaft. 81, 6/ 1980. Köln: Deutscher Instituts-Verlag
- Musgrave, R.A.; Musgrave, P.B. & Kullmer, L. (1987, 2.A.). Ökonomie der öffentlichen Schuld. In: Die öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis. 3. Tübingen: J.C.B. Mohr (UTB (Paul Siebeck). 30. Kapitel S. 197-229.
- Neidhardt, Hilde (2010). Staatsverschuldung und Verfassung. Geltungsanspruch, Kontrolle und Reform staatlicher Verschuldungsgrenzen. Tübingen: Mohr Siebeck.
- O'Connor, James (dt. 1984, engl. 1973). Die Finanzktise des Staates [USA]. Frankfurt: Suhrkamp.
- Perina, Udo (1991, Hrsg.). Kursbuch Geld 2. Schulden: Nutzen und Gefahren. Frankfurt: Fischer.
- Ratcheva, Christiana (2010). Staatsverschuldung und Glaubwürdigkeit der Geldpolitik in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. O:? Diplomica.
- Rebe, Bernd & Braun, Peter (2010). Die Tyrannei der Fresskette. Wie das Weltfinanzsystem die Fähigkeit zur Selbstzerstörung hervorgebracht hat und weiter hervorbringen kann. O:? adlibri.
- Rosenbusch, Joscha (2008). Unverschuldet verschuldet: Die Debatte um das Konzept der "odious debts". Aussichten der Aufnahme des Konzeptes odious debts in die kooperative Bearbeitung des Politikfeldes Staatsschulden aus Perspektive der Regimetheorie. O:? Vdm.
- Roth, Rainer (1999). Das Kartenhaus: DVS-Verlag. [Bespr1] [Bespr2]
- Rügemer, Werner (2008). »Heuschrecken« im öffentlichen Raum. Public Private Partnership - Anatomie eines globalen Finanzinstruments. O:? Transcript
- Sachse, Oscar & Ramp, Hansjörg (1943). Geld und Schulden. Grundsätzliches zur Währungsfrage. Zürich: Europa.
- Schafroth, Felix (2009). Schuldenmanagement der öffentlichen Hand. Eine theoretische und empirische Studie. O:? Diplomica.
- Schlesinger, Helmut; Weber, Manfred & Ziebarth, Gerhard (1993). Staatsverschuldung - ohne Ende. Zur Rationalität und Problematik des öffentlichen Kredits. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft.
- Schwarz, Martin (2007). Staatsverschuldung: Ausmaß, Begründung, Kritik. O:? Grin.
- Simmert, Diethard B. (1981). Problem der Staatsverschuldung. In: Die Schulden der öffentlichen Hand. Schriftenreihe der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Fakten, Meinungen, Argumente, Folge 8. Hannover, S. 5-27
- Simmert Diethard & Wagner, Kurt Dieter (1981, (Hrsg.). Staatsverschuldung kontrovers. Bonn: Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung Band 174. Bonn.
- Stalder, Inge (1992). Staatsverschuldung aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomie. Forum Finanzwissenschaft Bd. 2. Nürnberg, 1-116 mit Tabellen und umfangreichen Literaturverzeichnisanhang.
- Stützle Ingo (2008). Staatsverschuldung im Paradigmenwechsel von Keynesianismus zu Neoklassik. Das Konzept des »ausgeglichenen Staatshaushalts« untersucht anhand des »Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung« O:? Vdm.
- Sturm, Roland (1995). Staatsverschuldung. In: Politische Wirtschaftslehre, 154-179. Opladen: Leske & Budrich (UTB).
- Szodruch, Alexander (2008). Staateninsolvenz und private Gläubiger. Rechtsprobleme des Private Sector Involvement bei staatlichen Finanzkrisen im 21. Jahrhundert. Berlin: Bwv.
- Tappe, Henning (2008). Das Haushaltsgesetz als Zeitgesetz. Zur Bedeutung der zeitlichen Bindungen für das Haushalts- und Staatsschuldenrecht. O:? Duncker & Humblot.
- Tobin, James (dt. 1978, engl. 1963). Grundsätze der Geld- und Staatsschuldenpolitik. Baden-Baden: Nomos.
- Tobin, James (1963). An Essay On Priciples Of Debt Management. Reprinted from Fiscal and Debt Management Policies,
- Wagner, Baldur (1981). Staatsfinanzen in Not. Zahlen - Fakten - Meinungen. In: Die Schulden der öffentlichen Hand. Schriftenreihe der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Fakten, Meinungen, Argumente, Folge 8. Hannover, S. 29-55.
- Wedekind, G. J (1802). Können die deutschen Stammgutsgrundsätze einen Regierungsnachfolger befryen, die Regentenhandlungen seines Vorfahrers zu vertretten; ". mithin die erweislichen und redlichen Schulden desselben zu bezahlen? Frankfurt u. Leipzig.: V?
- Weber, Martin (2007). Gibt es genuin politische neben den standardmäßigen ökonomischen Ursachen für Staatsverschuldung? O:? Grin.
- Wehr, Andreas (2010). Griechenland, die Krise und der Euro. O:? Papyrossa.
- Wellisch, Dietmar (2000). Staatsverschuldung. Finanzwissenschaft. Bd.3. O:? Vahlen.
- Weltring, Sylvia (1997). Staatsverschuldung Als Finanzierungsinstrument Des Deutschen Vereinigungsprozesses: Bestandsaufnahme Und Theoretische Wirkungsanalyse. O:? Lang.
- Wolf, Ulrich (1984). Verfassungsrechtliche Grenzen der Staatsverschuldung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Bedeutung des Art. 115 GG im Rahmen der von Art. 109, Abs. 2 GG verankerten gesamtwirtschaftlichen Funktion des Haushalts. Dissertation im Fachbereich Rechtswissenschaften Universität Hamburg.
- Wucherpfennig, Lutz (2007). Staatsverschuldung in Deutschland. Ökonomische und verfassungsrechtliche Problematik. Baden-Baden: Nomos.
 |
Das sog. Lüftl-Theorem finden Sie auch praktisch durchgerechnet für die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen hier. Entscheidend für die Problematik ist die Geschwindigkeit des Wachstums, z.B. der Schulden in Beziehung zu den Ressourcen, z.B. BIP, d.i. bei der exp. Regression der Faktor b in: F(X)=A*eb*x |
Commission on Money and Credit, 1963 [PDF]
Schulden und Finanzwirtschafts der Städte und Gemeinden
Haushaltsrecht und Haushaltspraxis.
In der staatlichen Rechnungslegung und Haushaltsführung zeichnet sich ein Wandel ab. Das traditionelle sog. Kameralistik-System folgt einer einfachen Eingabe/Ausgaberechnung. Die sog. Doppik nutzt die kaufmännische doppelte Buchführung und orientiert am privatwirtschaftlichen Bilanzierungssystem, womit man sich mehr Transparenz hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, der aktuellen Finanzsituation und eine bessere Steuerungsfähigkeit verspricht. Manche sehen in der Umstellung eine Fluchtmöglichkeit, ihre Misswirtschaft zu verschleiern, daher vergesse man nicht: wer kameralistisch keinen ordentlichen Haushalt hinkriegt, wird auch bei doppelter Buchführung scheitern.
- Begriffe und Richtlinien zur Jährliche. Erhebung der Schulden der kommunalen Körperschaften.
- Fragebogen zur Schuldenerhebung der Kommunen in Niedersachsen.
- ABC der Haushaltspraxis (Beispiel Bremen).
- Doppik.de * W_Kameralistik * W_Doppik * * W_Eigenbetrieb * W_Regiebetrieb * Doppik-Vergleich *
- Doppik schlägt Kameralistik. Fragen und Antworten zur Einführung eines doppischen Haushalts- und Rechnungswesens.
- IDW-Verlautbarung zur Umstellung der kommunalen Haushaltsrechnung.
- Gesetze und Verordnungen zur Statistik.
- Bayerische Gemeindezeitung.
- HaushaltsSteuerung.de.
- König, René (1958). Grundformen der Gemeinschaft. Die Gemeinde. Reinbek: Rowohlt (rde).
Politische
Möglichkeiten der BürgerInnen
- Ackermann, Paul (2004). Bürgerhandbuch. Basisinformationen und 66 Tipps zum Tun. Bundeszentrale für Politische Bildung. Schwalbach: Wochenschauverlag.
Kommunale
Haushalts- und Finanzwirtschaft (Auswahl)
- Allgemein - unspezifisch:
- Bey, Wolfgang; Klaus, Manfred & Rössel, Usw-Jens (2001). Das gläserne Rathaus. Kommunalpolitik von A-Z. Hamburg: VSA.
- Fiebig, Helmut (1999). Prüfung und Analyse der kommunalen Jahresrechnung. Leitfaden für die Praxis. Berlin: Schmidt.
- Germ, Alfons (1994). Deutsches Kommunalrecht. Baden-Baden: Nomos.
- Jungfer, Klaus (2005). Die Stadt in der Krise. Ein Manifest für starke Kommunen. Bonn: bpb. Anmerkung: Jungfer ist ein verantwortlicher Stadtkämmerer (1993-2004) für die maß- und verantwortungslose Schuldenwirtschaft in München. Da schreibt also ein wahrer "Gärtnerbock".
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt): http://www.kgst.de/home/
- > Recktenwald.
- Schraffer, Heinrich (1993). Der kommunale Eigenbetrieb. Untersuchungen zur Reform der Organisationsstruktur. Baden-Baden: Nomos.
- See, Hans (1975). Grundwissen einer kritischen Kommunalpolitik. Wirtschaft, Staat und kommunale Selbstverwaltung. Köln: Kiepenheuer & Witsch
- > Ständer.
- Länder
- Baden-Württemberg
- Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württemberg: http://www.nkhr-bw.de/servlet/PB/menu/-1_l1/index.html
- Brandenburg
- Oelgeklaus; Bernhardt; Schünemann & Schwingeler (2003). Kommunales Haushaltsrecht Brandenburg. Witten: Bernhardt-Witten. [ISBN 3-933870-33-X]
- Hessen
- Daneke; Bernhardt & Schwingeler (2007). Kommunales Haushaltsrecht Hessen. Witten: Bernhardt-Witten.
- NRW
- Bernhardt; Mutschler & Stockel-Veltmann (2006). Kommunales Finanzmanagement NRW. Witten: Bernhardt-Witten. [ISBN 3-933870-65-8]
- Sachsen-Anhalt
- Grimberg; Bernhardt; Mutschler & Stockel-Veltmann (). Neues Kommunales Haushaltsrecht Land Sachsen-Anhalt (LSA). Witten: Bernhardt-Witten. [ISBN 3-933870-60-7]
- Spezielles
- Rügemer, Werner (1995). Staatsgeheimnis Abwasser. Düsseldorf: Zebulon [erhältlich über]
- Rügemer, Werner (2004). Cross Border Leasing - Ein Lehrstück zur globalen Enteignung der Städte. Münster: Westfälisches Dampfboot.
- CBL in Baden-Württemberg. [Die "verkauf-leasten" sogar ihr Trinkwasser]
- CBL in Nürnberg.
- Homepage Werner Rügemer.
- Bund Naturschutz Bayern: Cross- Border- Leasing - Ausverkauf kommunalen Vermögens / Aushebelung der Gemeindeordnung.
- Die Welt im Privatisierungswahn!
- Info mit Inhaltsverzeichnis.
- Rezension in der Zeit.
- Wikipedia.
- Schuldenfreie Gebietskörperschaften
- Gnädinger, Marc (2010). Schuldenfreie Kommunen 2010: Ein Überblick über die schuldenfreien Gemeinden und Gemeindeverbände der dreizehn deutschen Flächenländer. O: Driesen.
CBL im Netz:
Geschichte der kommunalen Haushalte, Finanzen und Schuldenwirtschaft.
[SQ] := Sekundärquelle.
- Harms, Bernhard: Der Stadthaushalt Basels im ausgehenden Mittelalter. Quellen und Studien zur Basler Finanzgeschichte, 3 Bände, 1909-1913. [Edition der Basler Stadtrechnungen 1360-1535] [SQ]
- Nürnbergs Stadthaushalt und Finanzverwaltung. In: Die Chroniken der fränkischen Städte. Nürnberg, 1. Band (Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis in's 16. Jahrhundert), Leipzig 1862, Beilage 12, S. 263-296. [Edition der Stadtrechnung von 1388] [SQ]
- Becker, Heinrich: Der Haushalt der Stadt Zerbst 1460 bis 1510, dargestellt nach den Handbüchern des Rates der Stadt Zerbst, Diss. Tübingen 1905. [SQ]
- Becker, Ute: Der Haushalt der Stadt Duisburg in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die Anfänge regelmäßiger Rechnungsführung, Magisterarbeit Münster 1988. [SQ]
- Bingener, Andreas, Gerhard Fouquet und Bernd Fuhrmann: Almosen und Sozialleistungen im Haushalt deutscher Städte des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit. In: Städtisches Gesundheits- und Fürsorgewesen vor 1800, hrsg. von Peter Johanek (Städteforschung, Reihe A.50), 2000, S. 41-62. [am Beispiel der Städte Marburg und Siegen aus dem 16. Jh.] [SQ]
- Borchardt, Paul: Der Haushalt der Stadt Essen am Ende des XVI. und Anfang des XVII. Jahrhunderts (Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen 24), 1903. [SQ]
- Bücher, Karl: Der öffentliche Haushalt der Stadt Frankfurt im Mittelalter. In: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 5, 1896, S. 1-19. [SQ]
- Cipolla, Carlo M.: Finanze di borghi e castelli sotto il dominio spagnolo. In: Bollettino Storico Pavese. Vol. VIII, Fasc. I-II, 1945, S. 7-19. [SQ]
- Fahlbusch, Otto: Der Haushalt der Stadt Einbeck im Jahre 1583. In: Elfter Jahresbericht des Vereins für Geschichte und Altertümer der Stadt Einbeck und Umgebung, 1928, S. 23-31. [SQ]
- Foltz, Max: Geschichte des Danziger Stadthaushalts (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens; Bd. 8), 1912. [SQ]
- Fouquet, Gerhard, Ulf Dirlmeier, Reinhard Schamberger: Die spätmittelalterliche Haushaltsführung Hamburgs und die Finanzierung der städtischen Militärpolitik in den Jahren zwischen 1460 und 1481. In: Peter Lösche (Hrsg.), Göttinger Sozialwissenschaften heute. Fragestellungen, Methoden, Inhalte (Göttinger Universitätsschriften, Serie A: Schriften, Bd. 8), 1990, S. 46-59. [SQ]
- Fuhrmann, Bernd: Die öffentliche Verschuldung der Stadt Marburg 1451-1525. In: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 42, 1992, S. 103-115. [SQ]
- Fuhrmann, Bernd: Der Haushalt der Stadt Marburg in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (1451/52-1622) (Sachüberlieferung und Geschichte 19), 1996. [SQ]
- Gilomen, Hans-Jörg: Die städtische Schuld Berns und der Basler Rentenmarkt im 15. Jahrhundert. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 82, 1982, S. 5-64. [SQ]
- Ginatempo, Maria: Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.) (Biblioteca Storica Toscana; 38), Firenze 2000. [Untersucht Einnahmen, Ausgaben und Verschuldung der vier großen toskanischen Städte, auch im Vergleich mit Genua und Venedig.] [SQ]
- Greif, E.: Beiträge zum Stadthaushalt Straubings im Übergang von Mittelalter zur Neuzeit. Diss. München 1927 (Jahresberichte des Historischen Vereins von Straubing 1927). [SQ]
- Havemann, Wilhelm: Der Haushalt der Stadt Göttingen am Ende des 14. und während der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen 22, 1857, S. 204-226. [SQ]
- Hegel, Karl: Nürnbergs Stadthaushalt und Finanzverwaltung. In: Die Chroniken der fränkischen Städte: Nürnberg, Bd. 1 (Die Chroniken der deutschen Städte Bd. 1), 1862, S. 263-296. [SQ]
- Hesse, Walter: Der Haushalt der freien Reichsstadt Goslar im 17. Jahrhundert (1600-1682) (Beiträge zur Geschichte der Stadt Goslar 6), 1935.
- Hobohm, Walter: Der städtische Haushalt Quedlinburgs in den Jahren 1459 bis 1509 (Forschungen zur thüringisch-sächsischen Geschichte; H. 3), 1912. [SQ]
- Huber, Paul: Der Haushalt der Stadt Hildesheim am Ende des 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts (Volkswirtschaftliche und wirtschaftsgeschichtliche Abhandlungen 1), 1901. [SQ]
- Karner, Stefan: Zur Ausgabenstruktur einer frühneuzeitlichen Kleinstadt in Österreich. Möglichkeiten beim Einsatz der EDV. In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 71, 1984, S. 357-376. [SQ]
- Kellenbenz, Hermann: Die Finanzen der Stadt Augsburg 1547. In: Helmut Jäger, Franz Petri, Heinz Quirin (Hrsg.), Civitatum Communitas. Studien zum europäischen Städtewesen. Festschrift Heinz Stoob, Teil 2 (Städteforschung A/21.1), 1984, S. 517-542. [SQ]
- Kirchgässner, Bernhard: Währungspolitik, Stadthaushalt und soziale Fragen südwestdeutscher Reichsstädte im Spätmittelalter. Menschen und Kräfte zwischen 1360 und 1460. In: Jahrbuch für Geschichte der oberdeutschen Reichsstädte. Esslinger Studien 11), 1965, S. 90-127. [SQ]
- Knipping, Richard: Ein mittelalterlicher Jahreshaushalt der Stadt Köln (1379). In: Beiträge zur Geschichte vornehmlich Kölns und der Rheinlande. Festschrift Gustav von Mevissen, 1895, S. 131-159. [SQ]
- Knittler, Herbert: Vom Elend der Kleinstadt. Überlegungen zu Stadthaushalten des frühen 16. Jahrhunderts. In: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich N.F. 62, 1. Teil, 1996, S. 367-387. [betr. Stadtrechnungen von Weitra ab 1494 und von Retz ab 1533] [SQ]
- Körner, Martin: Berns Staatsfinanzen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Ein Forschungsprojekt an der Universität Bern. In: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 59, 1997, Heft 4, S. 324-326. [Volltext-Publikation auch im WWW: WWW] [SQ]
- Kopp, Hans Georg: "Das reiche Augsburg" ? Studien zum Haushalt der freien Reichsstadt Augsburg im 16. Jahrhundert: Die Buchhaltung. In: Jochen Brüning / Friedrich Niewöhner (Hrsg.), Augsburg in der Frühen Neuzeit (Colloquia Augustana 1), 1994, S. 384-402. [SQ]
- Kraus, Christian: Die Entwicklung des Weseler Stadthaushaltes von 1342-1390, dargestellt auf Grund der Stadtrechnungen (Studien zur Geschichte von Wesel 2), 1907, ND 1986. [SQ]
- Kreil, Dieter: Der Stadthaushalt von Schwäbisch-Hall im 15./16. Jahrhundert. Eine finanzgeschichtliche Untersuchung (Forschungen aus Württembergisch-Franken Bd. 1), 1967, S. 118-123. [SQ]
- Kreil, Dieter: Zusammensetzung und Entwicklung des Haushalts der Reichsstadt Schwäbisch Hall von 1420 bis 1620. In: Erich Maschke / Jürgen Sydow (Hrsg.), Städtisches Haushalts- und Rechnungswesen (Stadt in der Geschichte 2), 1977, S. 83-90. [SQ]
- Kreil, Dieter: Zusammensetzung und Entwicklung des Haushalts der Reichsstadt Schwäbisch Hall von 1420 bis 1620. In: Erich Maschke / Jürgen Sydow (Hrsg.), Städtisches Haushalts- und Rechnungswesen (Stadt in der Geschichte 2), 1977, S. 83-90. [SQ]
- Krüger, Else: Der Haushalt der Stadt Göttingen zwischen 1580 und 1640 unter besonderer Berücksichtigung des Schuldenwesens, Diss. Göttingen 1923. [SQ]
- Landolt, Oliver: Der Finanzhaushalt der Stadt Schaffhausen im Spätmittelalter. In: Sébastien Guex, Martin Körner und Jakob Tänner (Hrsg.): Staatsfinanzierung und Sozialkonflikte (14.-20. Jh.) (Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 12), 1994, S. 41-53. [SQ]
- Landolt, Oliver: Der Finanzhaushalt der Stadt Schaffhausen im Spätmittelalter. In: Guex, S. / M. Körner / J. Tanner (Hrsg.): Staatsfinanzierung und Sozialkonflikt (14.-20. Jh.) / Financement de l'Etat et conflicts sociaux (14e-20 e siècles) (Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 12), 1994, S. 41-53. [SQ]
- Mittag, Hans: Zur Struktur des Haushalts der Stadt Hamburg im Mittelalter, Phil. Diss. Kiel 1914. [SQ]
- Müller, Adolf: Die Rechnungsbücher über den städtischen Haushalt zu Groß-Salze seit 1407. In: Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg 48, 1913, S. 41-74. [betr. Stadtrechnungen ab 1407] [SQ]
- Naujoks, Eberhard: Der älteste Gmünder Stadtetat. In: Gmünder Heimatblätter 12, 1951, Nr. 1, S. 4-7. [betr. Stadtrechnung von 1500] [SQ]
- Neuwöhner, Andreas: Paderborn vor dem finanziellen Ruin. Der Dreißigjährige Krieg im Spiegel der Paderborner Stadtrechnungen. In: Westfälische Zeitschrift 149, 1999, S. 263-286. [nach den Stadtrechnungen ab 1619] [SQ]
- Ohlau, Jürgen Uwe: Der Haushalt der Reichsstadt Rothenburg o.T. in seiner Abhängigkeit von Bevölkerungsstruktur, Verwaltung und Territorienbildung (1350-1450), Diss. Erlangen-Nürnberg (Maschr.) 1965. [SQ]
- Ohler, Norbert: Zum Haushalt der Stadt Freiburg im Breisgau im 16. und 17. Jahrhundert. In: Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins ("Schau-ins-Land") 94/95, 1976/77, S. 253-289. [SQ]
- Ohler, Norbert: Strukturen des Finanzhaushalts der Stadt Freiburg i.Br. in der Frühen Neuzeit. In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 125, 1977, S. 97-140. [SQ]
- Pape, Dietrich: Untersuchungen zum Stadthaushalt von Marburg mit besonderer Berücksichtigung der militärisch bedingten Ausgaben. Staatsarbeit Universität-Gesamthochschule Siegen (Maschr.), 1986. [SQ]
- Potthoff, Heinz: Der öffentliche Haushalt Hamburgs im 15. und 16. Jahrhundert. In: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 16, 1911, S. 1-185. [SQ]
- Pühringer, Andrea: Zur Entwicklung kommunaler Haushalte in der Frühneuzeit. Die Fallbeispiele Eggenburg und Krems 1550 bis 1750 im Vergleich. In: Unsere Heimat. Zeitschrift für Landeskunde für Niederösterreich 65, Heft 3, 1994, S. 170-188. [SQ]
- Pühringer, Andrea: Kommunale Finanzen in der frühen Neuzeit. Ein Vergleich der budgetären Struktur und Entwicklung österreichischer landesfürstlicher Kleinstädte. 2 Bände, Diss. Wien 1998. [betr. Krems, Eggenburg, Wels, Freistadt] [SQ]
- Pühringer, Andrea: Aspekte der Finanzverwaltung österreichischer Kleinstädte in der frühen Neuzeit (1550-1750). In: Holger Th. Gräf (Hrsg.), Kleine Städte im neuzeitlichen Europa (Innovationen 6), 1997, S. 111-135. [betr. Krems, Eggenburg, Wels und Freistadt] [SQ]
- Pühringer, Andrea: Zur Lage der Kommunalverwaltung der Stadt Krems zwischen Reformation und Gaisruckscher Instruktion. In: Willibald Rosner (Hrsg.): 1000 Jahre Krems - am Fluß der Zeit (Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde 24), 2001, S. 161-185. [SQ]
- Ranft, Andreas: Der Basishaushalt der Stadt Lüneburg in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Zur Struktur der städtischen Finanzen im Spätmittelalter (Veröffentlichungen des Max- Planck-Instituts für Geschichte 84), 1987. [SQ]
- Ranft, Andreas: Städtisches Finanzgebaren und -management am Ende des Mittelalters anhand der Rechnungsbücher des Lüneburger Rats. In: Finances publiques et finances privées au bas moyen âge (Public and private finances in the late middles ages). Actes du colloque tenu à Gend les 5 et 6 mai 1995, Leuven-Apeldoorn 1996, S. 15-56. [SQ]
- Rankl, Elfriede: Der Finanzhaushalt der Stadt Wien im Zeitalter von 1540 bis 1570. Diss. (Maschr.) Wien 1954. [SQ]
- Rosen, Josef: Der Staatshaushalt Basels von 1360 bis 1535. In: Hermann Kellenbenz (Hrsg.): Öffentliche Finanzen und privates Kapital im späten Mittelalter und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 16), 1971, S. 24-38. [SQ]
- Rosen, Josef: Die Universität Basel im Stadthaushalt 1400-1535. Die Gehälter der Dozenten. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 72, 1972, S. 137-219. [SQ]
- Sander, Paul: Die reichsstädtische Haushaltung Nürnbergs. Dargestellt aufgrund ihres Zustands von 1431 bis 1440, 1902. [SQ]
- Schieber, Martin (2000). Pfänder, Schulden, Inflationen. Schulden und Verschuldung in der Nürnberger Stadtgeschichte. Nürnberger Stadtgeschichten Nr. 2 Herausgegeben von Geschichte Für Alle e.V. Nürnberg: Sandberg. [ISBN 3-960699-16-8]. [Bestellung Online]
- Schneider, Reinhard: Vom Klosterhaushalt zum Stadt- und Staatshaushalt: Der zisterziensische Beitrag (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 38), 1994. [SQ]
- Schuster, Georg: Der Haushalt der Stadt Görlitz nach den Görlitzer Ratsrechnungen von 1375-1416, Diss. Leipzig 1919. [SQ]
- Staehler, Magnus (2008). 1, 2, 3 Schuldenfrei: Wie die Stadt Langenfeld aus Amtsschimmeln Rennpferde machte - die Erfolgsformel zur Sanierung städtischer Finanzen. Wien: Linde.
- Steinwascher, Gerd: Osnabrück und der Westfälische Frieden. Die Geschichte der Verhandlungsstadt 1641-1650 (Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen 42), 2000. [zum städtischen Haushalts- und Rechnungswesen S. 85-93.] [SQ]
Veröffentlichungen
von KommunalpolitikerInnen:
- Vogel, Jochen (1972). Die Amtskette. Mein 12 Münchner Jahre. München: Süddeutscher Verlag.
Einzelfallstudien
Küntzel, Ulrich (1964). Die Finanzen großer Männer. Wien: Econ. [Odysseus, Sokrates, Caesar, Kolumbus, Shakespeare, Washington, Goethe, Napoleon, Bismarck, Gandhi].
Die
250 reichsten Menschen in Deutschland werden im Manager-Magazin 3/2003
dokumentiert:
[URL verändert und keine Weiterleitung eingerichtet]
Querverweis: Neid und Mißgunst
* Gier * soziale
Gerechtigkeit *
Armuts-
und Reichtumsberichte der Bundesregierung.
"Mit Beschluss vom 27. Januar 2000 hat der Deutsche Bundestag
die Bundesregierung aufgefordert, regelmäßig einen Armuts- und
Reichtumsbericht zu erstatten. Am 25. April 2001 hat die Bundesregierung
den ersten Armuts- und Reichtumsbericht vorgelegt [Erster,
Anlagen].
Der Bericht und die zeitgleiche Vorlage des "Nationalen Aktionsplanes zur
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 2001-2003" (NAP-incl)
bei der EU-Kommission waren der Beginn einer kontinuierlichen Berichterstattung
über Fragen der sozialen Integration und der Wohlstandsverteilung
in Deutschland. Die Armuts- und Reichtumsberichterstattung basiert auf
dem Leitgedanken, dass eine detaillierte Analyse der sozialen Lage die
notwendige Basis für eine Politik zur Stärkung sozialer Gerechtigkeit
und zur Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe ist. Am 19. Oktober 2001
hat der Deutsche Bundestag die Verstetigung der Armuts- und Reichtumsberichterstattung
beschlossen und die Bundesregierung aufgefordert, jeweils zur Mitte einer
Wahlperiode einen entsprechenden Bericht vorzulegen. Dem kommt die Bundesregierung
mit der Vorlage des Berichts "Lebenslagen in Deutschland - Der 2. Armuts-
und Reichtumsbericht der Bundesregierung" nach. Der Bericht beschreibt
die Lebenslagen der Menschen in Deutschland auf der Basis statistischer
Daten etwa zu Einkommen, Vermögen, Erwerbstätigkeit, Bildungsbeteiligung.
Stand: Februar 2005. PDF-Bericht
(1.79 MB) 370 Seiten., Anhänge."
- http://www.heute.t-online.de/ZDFheute/artikel/2/0,1367,HOME-0-2023298,00.html
- http://www.nils-schmid.de/inhalt/wirtschaft/beamtenpensionen.html
- http://morgenpost.berlin1.de/archiv2002/021115/politik/story562446.html
- http://online.wdr.de/online/news2/beamte_fruehpensionierung/gaestebuch.phtml
- grüne: http://www.gruene-wuppertal.de/pressemitteilungen2002-2.htm
- ver.di: http://217.27.2.43/0x0ac80f2b_0x0003661a
- Eichels Milliardenloch: Pfusch bei den Postpensionen?
- http://www.swr.de/report/aktuell/index.html
- > Kommunale Haushalts- und Finanzwirtschaft.
- Gesetze und Gesetzestexte:
- Zeitschriften:
- Zeitschrift für Wirtschaftsrecht.
- EuZW.
- EWiR.
- IWW: http://www.fu-berlin.de/iww/.
- Finanztip: Wirtschaftsrecht.
- Portal für Wirtschaftsrecht.
- Video: Wer steckt hinter dem Zentralbanksystem am Beispiel der FED.
- Video: Wie Banken Geld aus Schulden schaffen.
Links
Staatsverschuldung: Information, Basisdaten, Bewertung
(Alphabetisch nach Quellen Sachbegriffe)
Wichtiger
Hinweis
Videos zur Staatsverschuldung auf Youtube.
| Beispiele(Länder und Faktoren): Arbeitslosigkeit * Argentinien * Berlin * Deutschland * Globalisierung * Inflation * Internationaler Vergleich * Japan * Kriege * Ludwig II. * Partiell geschäftsunfähige Politiker * Produktivität * Rezession * Schweden * Soziallasten * USA * Wachstum * Währungsreform 21.6.1948 * Weimarer Republik * Wiedervereinigungslasten (DE) |
| Bund, u.a. Bundesvermögensverwaltung u. Liegenschaften: http://www.bund.de/ |
| Bundesfinanzakademie (gehört mit zum Finanzministerium) http://www.bundesfinanzakademie.de |
| Bundesrechnunghof: http://www.bundesrechnungshof.de |
| Bundesregierung: [URL verändert ohne Weiterleitung] |
| Bundestag: http://www.bundestag.de/ |
| Bundeszentrale für Politische Bildung: http://www.bpb.de/ |
| CDU: http://www.cdu.de/politik-a-z/finanzen/fi_31000.htm (nicht substanziell, die Arbeit begreift das Problem nicht und richtet sich gegen rot-grün u.a. unter Berufung auf DDR-Altlasten) |
| CSU: |
| Deutsche Bundesbank: http://www.bundesbank.de/ * Hier besonders auch: Die Entwicklung der Staatsverschuldung seit der deutschen Vereinigung. Montsbericht 3, 1997, 17-32. Zu Berlin 11,2001, S. 61. Monatsberichte EZB |
| FDP: |
| Finanzministerium: Über > Bundesregierung erreichbar |
| Grüne: |
| Meyer, Dieter: Die Schuldenfalle: Eine Untersuchung der Staatsverschuldung ab 1965 bis 2025 mit Vorschlägen zur GG-Änderung (substanzielle, grundlegende Arbeit): http://home.t-online.de/home/dieter.meyer/homepage.htm |
| PDS: |
| Schuldnerfachberatungszentrum Universität Mainz: http://www.sfz-mainz.de |
| Schwedisches Modell: Kritik: Die Sozialisierung der Pleite (Reinhard Helmers, kritische Anmerkungen zu Eichels Sparkurs aus gewerkschaftlicher Sicht) |
| SPD: |
| Statistisches Bundesamt (Daten): http://www.destatis.de/
Schulden Öffentliche Haushalte 1999 und 2000 * Schulden Öffentliche Haushalte 2001 Nettokreditaufnahme * Links Internationale Statistische Daten |
| Staatsverschuldung online: http://www.staatsverschuldung-online.de/ * Überblick IP-GIPT. |
| Steuerzahler (Bund) Leitseite Schuldenzuwachs pro Sekunde:
http://www.steuerzahler.de/
Hinweis: sehr wichtig auch das alljährliche "Schwarzbuch" zur Steuergeldverschleuderung |
Sonstige finanzökonomisch interessante Links
- Karl-Heinz Brodbecks Homepage.
- Warum geliehenes Geld nicht immer produktiv ist Professor Jürgen Heinrich erklärt den Begriff "Staatsverschuldung"
- Cowles Foundation for Research in Economics (viele PDF-Downloads)
und seine Bedeutung für die Wirtschaft
Glossar, Anmerkungen und Endnoten
GIPT = General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
Stichworte: Allgemeines zum Schulden-Syndrom , Was bedeutet Staatsverschuldung ganz praktisch? * Amtliche Statistik * Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesregierung. * Antizyklische Wirtschaftspolitik * Bund Links * Cross-Border-Leasing * Datenquellen und Hinweise zu Schulden und Wirtschaftswachstum (BIP) * Demokratien * Euphemismus * Globalisierung * Globale Enteignung der Städte (CBL) * Hollyvoodoo * homo oeconomicus * Ich pumpe, also bin ich * Länder, Gemeinden und Zweckverbände * Lüftl-Theorem * Mittel(werte) * politische "Krankheit" * Etile * Euphemismus * Schulden-Pisa * Schulden-Porträt (Neues Benchmarkformat zur Bewertung der Leistung von PolitikerInnen) * Schulden-Uhren Links * Schulden-Wachstums-Rate * Staatsverschuldung: Literatur- und Linkhinweise zu Paul C. Martins Arbeiten ("Lüftl-Theorem") * Die Schuld der Wirtschaftswissenschaften und der Medien * Wachstum kritisch betrachtet * Wachstumstabellen (Zinseszins) * Zeitgeschichte.
___
Allgemeines zum Schulden-Syndrom: Das Schuldenproblem hat seinen Ursprung in einer expansiven und verfehlten maniformen Grundeinstellung: mehr, immer mehr und noch viel mehr. Diese grundlegende Fehleinstellung kommt aus der plutokratischen Wirtschaft und ihrer falschen Philosophie des homo oeconomicus, die ihre pseudowissenschaftliche Rechtfertigung in den amerikanischen etilE-Universitäten (Harvard, Princeton, Yale, Stanford) findet. Wachstum über alles, Wachstum um jeden Preis, Konsum, Konsum, kaufen, kaufen (wozu letztlich auch die Globalisierung erfunden wurde, weil die heimischen Märkte grundgesättigt sind). Der Mensch interessiert nicht oder nur als Konsummaschine, als konditionierte Kaufratte. Stabilität interessiert nicht. Gerechtigkeit interessiert nicht. Es geht darum, dass eine kleine radikale Minderheit von Millionären und Milliardären mehr, noch mehr und noch viel mehr anhäufen kann. Die Nationalökonomie und Wirtschaftspolitik wird vollkommen beherrscht von einer plutokratischen Pseudo-Elite, die weder vom Menschen noch von der Wirtschaft wirklich etwas verstehen, nur vom in die eigene Tasche raffen, Bilanzfälschungen, vom Schulden machen, von Börsenspekulation, Luft- und Seifenblasen, globalem Zocken und einer verantwortungs- und hemmungslosen Manipulation durch Werbung, Falschinformation und ihrer hollywoodgerechten Aufbereitung mit Hilfe gewissenloser Medien. Denn dass Deutschland so an den Rand des finanziellen Ruins getrieben werden konnte, ist wesentlich mit das Werk seiner unkritischen und willfährigen WirtschaftswissenschaftlerInnen und der wirtschaftspolitischen Medien, die das Problem seit ca. 35 Jahren nicht nur verharmlosen und falsch darstellen, sondern an der finanzpolitischen Verwahrlosung und Verblödung dieses Landes wesentlich Mitschuld haben.

Was bedeutet Staatsverschuldung ganz praktisch ? Schulden erfordern einen Kapitaldienst, d.h. die Begleichung bei Fälligkeit und die Zahlung der Zinsen. Derzeit belaufen sich nach der Zinsuhr des Bundes für SteuerzahlerInnen die Zinsen wie hier ausgewiesen. Am 5.11.6, gegen 14 Uhr, waren dies über 57 Milliarden Euro. Der Bundeshaushalt für 2006 sieht Ausgaben in Höhe von 261,6 Milliarden Euro vor. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet, ergeben sich rund 66 Milliarden Euro Zinslast für den Bund. Das sind 25,2% der gesamten Ausgaben im Bundeshaushalt allein für Zinszahlungen. Dieses Geld fehlt nicht nur für sinnvolle Ausgaben, aufgrund der Zinseszins- und Wachstumseffekte droht dieser Anteil immer größer zu werden.
- Zunehmende Staatsverschuldung bedeutet unmittelbar, dass über die Verhältnisse gelebt und mehr verbraucht als erwirtschaftet und geleistet wird, was über längere Zeiten oder gar auf Dauer geldwirtschaftlich und staatspolitisch als krankhaft zu bewerten ist.
- Zunehmende Staatsverschuldung bedeutet dann in der Folge, dass der Staat immer weniger Geld für sinnvolle Investitionen und Leistungen zur Verfügung hat, weil immer mehr Geld für Zinsen aufgewendet werden muss.
- Fragt man, wer in den Genuss des Kapitaldienstes kommt, so wird man feststellen, dass zusätzlich eine Umverteilung von arm nach reich eintritt: die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer.
- Die Risiken und Instabilitäten werden immer größer, weil sie nicht durch Rücklagen aufgefangen werden können, sondern die Staatsverschuldung weiter in die Höhe treiben.
- Am Ende steht Zusammenbruch, Geldentwertung und Währungsreform, was extreme soziale Verwerfungen, Elend, Aufstände, Bürgerkriegs- und Kriegsgefahren begünstigt. Kriegsgefahren auch deshalb, um abzulenken, die unerträglichen Spannungen zu lösen, einen Sündenbock zu finden oder sogar in der Hoffnung auf Ausgleich durch Kriegsgewinne und Ausbeutung der Verlierer.
- Staatsverschuldung bedeutet auch das Eingeständnis, nicht vernünftig und angemessen haushalten und wirtschaften zu können oder zu wollen und ist damit Ausdruck einer tiefgreifenden [egozentrisch-maniformen] Fehlhaltung.
- Staatsverschuldung bedeutet auch versteckte vorgezogene Steuererhöhungen zu Lasten späterer Generationen; sie verbergen aktuelle Konflikte und verlagern sie auf später ("Nach uns die Sintflut"). Das ist unfair, ungerecht, intransparent, feige und letztlich verantwortungslos.
- Entlastungsmotive für
Kriege: So schreibt David Rapoport (1971, Part II.) in "Primitive War
- Its Practise and Concepts" von zwei großen Motivsystemen: sozio-psychologischen
und ökonomischen. Zu den ganz großen sozio-psychologischen
gehören:
"A very profound motive for going to war is to resolve life's tensions, to escape from unhappiness caused by frustration in other realms of existence. War is one of the most effective devices ever invented for this cathartic purpose. Life at best is full of frustration, thwarted ambitions, unfulfilled wishes — all of the sorrows and disappointments with which humanity is only too familiar. People become involved in personal dislikes which develop into hatreds, often irrational ones. ..."
(Ein sehr grundlegendes Motiv für Kriege führen ist die Lösung von Spannungen, um dem Kummer durch die Frustration in anderen Bereichen der Existenz zu entgehen. Krieg ist eines der wirksamsten Instrumente, die jemals erfunden wurden, um Katharsis [= die Seele von Spannung, Frustration und Unglücklichsein zu 'reinigen'] herbeizuführen. Auch ein gutes Leben ist voll von Frustration, durchkreuzten Bestrebungen, unerfüllten Wünschen - alle Sorgen und Enttäuschungen mit denen die Menschheit nur zu vertraut ist. Menschen widerfahren persönliche Missgeschicke, die sich zu Hass, oft zu irrationalem Hass, entwickeln.)
Wirtschaftsmotive für Kriege: Dass Kriege führen der Abwehr oder Überwindung von Wirtschaftskrisen dient, schreibt auch der berühmte amerikanische Soziologie David Riesman [W]. Er führt in Wohlstand wofür? (dt. 1973, engl. 1964, S. 264; fett-kursiv RS) aus: "Ich gehörte zu jenen Quasi-Keynesianern, die kurz nach dem Kriegseintritt Amerikas zu der Überzeugung gelangten, daß Amerika mit größter Wahrscheinlichkeit künftig keine großen Wirtschaftskrisen mehr erleben werde. Wie ich es befreundeten Nationalökonomen gegenüber gelegentlich überspitzt formulierte: »John Taber [W] mag imstande sein, durch seine sture Stupidität eine Depression herbeizuführen, aber es ist äußerst unwahrscheinlich, daß das Land und selbst die Republikaner das zulassen würden.« Meine Überzeugung gründete sich weniger auf das Keynessche Rüstzeug im Sinne einer politisch praktikablen Medizin als vielmehr auf die Annahme, der Krieg habe den Amerikanern die Lektion beigebracht, daß Kriege Wirtschaftskrisen kurieren und, sofern sie außerhalb des eigenen Territoriums geführt werden, das kleinere Übel sind: keine Lektion, die man in der Schule oder in der Kirche lernt, oder die man auch nur sich selbst gegenüber deutlich ausspricht (außer vielleicht im Kreis von Männern der unteren Schichten), sondern eher die stillschweigende Übereinstimmung, daß die Regierung, wenn Not am Mann ist, eine Krise durch Krieg oder Kriegsvorbereitung unter Kontrolle bringen kann. (Erhebungen über die Öffentliche Meinung liefern gewisse, wenn auch fragmentarische Beweise dafür, daß in dem Zeitraum zwischen 1949 und 1956 mehr Amerikaner einen größeren Krieg als eine größere Wirtschaftskrise für die kommenden Jahre erwarteten.)"
historische Entschuldungen. Den Mechanismen historischer Entschuldung über Inflation, Währungsreform, Ermordung der Gläubiger und Kriege bzw. Kriegsfolgen werde ich demnächst im Schuldenporträt der Stadt Nürnberg 1298-2005 erstmals etwas ausführlicher nachspüren. So zynisch und absonderlich es sich auch anhören mag: die sehr wünschenswerte und ungewöhnlich lange Friedenszeit in Europa und die Kontrolle der Notenbanken der Inflation lassen die Schuldenprobleme immer stärker werden. So wird ein Umdenken nicht etwa durch Einsicht kommen, sondern weil die Grenzen der Bezahlbarkeit der Zinsen, der Preis für die Ware Geld, dies erzwingen.
Finanzpolitisches Fazit und Vorbeugung: Schon Kant hat in seinem Ewigen Frieden ausgeführt, daß es moralisch nicht zulässig sein darf, Kriege über Schulden zu finanzieren. Ich denke, wir müssen weiter gehen: die Schuldenmacherei muß grundsätzlich und zwingend begrenzt werden. Wir brauchen eine völlig neue Verfassung.
Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesregierung.
- "Mit Beschluss vom 27. Januar 2000 hat der Deutsche Bundestag
die Bundesregierung aufgefordert, regelmäßig einen Armuts- und
Reichtumsbericht zu erstatten. Am 25. April 2001 hat die Bundesregierung
den ersten Armuts- und Reichtumsbericht vorgelegt [Erster,
Anlagen].
Der Bericht und die zeitgleiche Vorlage des "Nationalen Aktionsplanes zur
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 2001-2003" (NAP-incl)
bei der EU-Kommission waren der Beginn einer kontinuierlichen Berichterstattung
über Fragen der sozialen Integration und der Wohlstandsverteilung
in Deutschland. Die Armuts- und Reichtumsberichterstattung basiert auf
dem Leitgedanken, dass eine detaillierte Analyse der sozialen Lage die
notwendige Basis für eine Politik zur Stärkung sozialer Gerechtigkeit
und zur Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe ist. Am 19. Oktober 2001
hat der Deutsche Bundestag die Verstetigung der Armuts- und Reichtumsberichterstattung
beschlossen und die Bundesregierung aufgefordert, jeweils zur Mitte einer
Wahlperiode einen entsprechenden Bericht vorzulegen. Dem kommt die Bundesregierung
mit der Vorlage des Berichts "Lebenslagen in Deutschland - Der 2. Armuts-
und Reichtumsbericht der Bundesregierung" nach. Der Bericht beschreibt
die Lebenslagen der Menschen in Deutschland auf der Basis statistischer
Daten etwa zu Einkommen, Vermögen, Erwerbstätigkeit, Bildungsbeteiligung.
Stand: Februar 2005. PDF-Bericht
(1.79 MB) 370 Seiten., Anhänge."
Antizyklische Wirtschaftspolitik: Jede antizyklische Finanz- und Wirtschafts-Politik setzt voraus, dass in schlechten Zeiten das eingesetzt wird, was in guten Zeiten zur Seite gelegt wurde. Antizyklisch kann niemals heißen: wir machen immer Schulden und in schlechten Zeiten ganz besonders viele. Das scheint in Deutschland und in den plutokratischen Hollyvoodookratien noch nie einer richtig begriffen zu haben. Es sei daher noch einmal an das erinnert, worum es John Meynard Keynes (1936, S. 314) letztlich und wirklich ging:
"Die hervorstechenden Fehler der wirtschaftlichen Gesellschaft, in der wir leben, sind ihr Versagen, für Vollbeschäftigung Vorkehrung zu treffen und ihre willkürliche und unbillige Verteilung des Reichtums und der Einkommen."Antizyklische Haushaltspolitik steht nach Keynes also unter dem Ziel der Vollbeschäftigung, Stabilität und die sie ermöglichende soziale Gerechtigkeit.
__
Datenquellen und Hinweise zu Schulden und Wirtschaftswachstum (BIP): s.a. Überblick (Datenquellen) ...
- Statistisches Bundesamt: Fachserie 14, Reihe 5: Schulden der Öffentlichen Haushalte (2180140047005.xls), Verschuldung des Bundes Tabelle 1.1.1, Verschuldung der Länder Tabelle 1.3 und Fachserie 18 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. * Statistik shop destatis.
- BIP Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen Länder 1970: VGR Tabelle tab01. Zu den Daten wurde mitgeteilt: "Der Arbeitskreis VGR d L hat im Jahr 1999 nach einer Verordnung der Europäischen Union seine Rechnungen auf das neue Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 1995) umgestellt. Es liegen Rückrechnungsergebnisse nach dem neuen System nur bis 1970 vor. ... Beide Systeme sind nicht vergleichbar! Nach der Umstellung der VGR auf das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 1995 (ESVG 1995) wurden die Länderergebnisse nur bis 1970 zurückgerechnet. Für die Vorjahre sind lediglich Daten nach dem alten deutschen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen vorhanden. Diese Daten sind aufgrund zahlreicher methodischer und konzeptioneller Unterschiede nicht mit den aktuellen Daten nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 1995 (ESVG 1995) vergleichbar und dürfen keinesfalls an diese Daten angehängt werden." Anmerkung: Hier ist natürlich zu wünschen, daß die Daten weiter zurückgerechnet oder Schätzformeln mitgeteilt werden, wie die Vergleichbarkeit verbessert werden kann.
- Deutsche Bundesbank (1998). 50 Jahre Deutsche Mark. Monetäre Statistiken 1948-1997. CD ROM Verlage C.H.Beck & Vahlen (erfordert unter XP im System MFCUIA32.dll)
- Interne Datenquellen (Bayern): sgipt_orig/politpsy/statis/LAENDER/BAY/Schulden/...
__
Demokratien. Die meisten westlichen Demokratien sind vom Hollyvoodoo-Typ, also Oligarchien, meist plutokratische Medien- und Hollywooddemokratien.
__
Etile = Elite rückwärts e t i l E, womit ausgedrückt wird, dass die vermeintlichen - in Wahrheit plutokratischen - "Elite"- Universitäten keine echten, gemeinwohlorientierten Eliten heranbilden, sondern das Gegenteil: Anti-Elite =: Etile. Die Analyse der Schuldentollwut zeigt ganz klar, dass die Eliten hinten und vorne nicht stimmen, wenn man sie mit ihrem eigenen Maß misst: Wirtschaftskompetenz und Umgang mit Geld. Schaut man nämlich genau hin, also auf die zwei wichtigsten Zahlen, die Schulden- und die Wirtschaftswachstumsrate, stellt man ebenso erstaunt wie ernüchtert fest, dass wir es meist mit Gauklern, Hochstaplern, Schwätzern, Dünnbrettbohrern, Selbstbedienern und Tartüffs zu tun haben. In Wahrheit gilt also die Umkehrfunktion: die Kompetenz ist umso geringer je höher die Funktion und je größer das Einflussgebiet. Und je etilärer das Niveau, desto größer auch der Schaden, der angerichtet wird. Parkinson und noch mehr das Peter-Prinzip feiern hier ein Dauerfest. Und es passt auch alles hervorragend zusammen: ein einzigartig etilärer Filz aus Politik, Justiz, Banken, Wirtschaft und Wissenschaft (vornehmlich die maniforme Variante der Wachstumsfetischisten in der Volkswirtschaft).

Interne Links zum Elite-Problem: * Literaturliste * Generalkritik an der "Elite" * Elite-Meßverfahren * Was sind und wozu brauchen wir "Eliten" (Elite-Universitäten)? * Was bieten amerikanische etilE-Universitäten am Beispiel Wirtschaft?. * Wirtschaftlich motivierte "Elite"-Kritik * Wirtschaftselite in Deutschland * plutokratischer etilE-Papagei Peter Glotz *
Das Peter-Prinzip: "Mir kam der Verdacht, daß meine Schulbehörde in puncto Unfähigkeit kein Monopolbetrieb war. Als ich mich umsah, stellt ich fest, daß es in jeder Organisation eine Anzahl Menschen gab, die unfähig waren, ihrer Arbeit gerecht zu werden." (S. 15). Ein universales Phänomen: "Berufliche Unfähigkeit gibt es überall" (S. 16) "In einer Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen" (S. 19) "Die Arbeit wird von den Mitarbeitern erledigt, die ihre Stufe der Inkompetenz noch nicht erreicht haben." (S. 20)." [mehr: PKW3-04, Überblick Bürokratie, ]
- Dr. Laurence J.
Peter, 1919 in Vancouver/Kanada geboren; Studium der Pädagogik an
der Washingtoner State University; Tätigkeit als Lehrer, Erziehungs-
und Sozialberater, Schulpsychologe, Gefängnislehrer und Universitätsprofessor;
Veröffentlichung zahlreicher Artikel in Fachzeitschriften; Erfinder
und Autor des «Peter-Prinzips», der «Peter-Pyramide»
(rororo sachbuch Nr. 8715) und des «Peter-Programms» (rororo
sachbuch 6947) sowie von «Schlimmer geht's nimmer. Das Peter-Prinzip
im Lichte neuerer Forschung» (Wunderlich Verlag, Reinbek bei Hamburg
1985). Laurence J. Peter starb 1990 in Kalifornien.
Selbstbediener. Die Selbstbedienungsmentalität wird seit Jahrzehnten gut dokumentiert durch die Schriften von Arnims.
___
Euphemismus. Sprachliche Schönfärberei, beschönigende Darstellung. Gr. "eu" = gut, wohl; phem = sagen, also wörtlich gut sagen. Beispiele: heimgehen für sterben, seine soldatische Pflicht tun für morden; jdn. lächerlich machen als Späßchen deklarieren; wenn Diktaturen z.B. "präsidiale Staaten" genannt werden. Rein sachlich bedeutet Euphemismus eine falsch positive Darstellung, besonders üblich im diplomatischen Dienst, in der Politik, Kirche und in "höheren" Kreisen (Aristokratie).
___
Geldmenge. So wie es sich seit Jahrzehnten abzeichnet nimmt die Geldmenge extrem zu, ohne dass das Geld für realwirtschaftliche Leistungen gebraucht oder verwendet würde. Das Geldsystem "ernährt" und vervielfacht sich selbst für sich selbst. Im wesentlichen geht diese perverse finanzökonomische Entwicklung von den USA und hier besonders von der seltsamen Konstruktion der privaten FED aus. Die Banken gehören wie die Energieversorgung und grundlegende Infrastruktur verstaatlicht. Informationen zur Geldmengenentwicklung:
- [DBB: M3)
- Geldmenge USA innerhalb eines Jahres verdoppelt. "– die Verschuldung aller US-Sektoren ist mittlerweile auf über 400 Prozent des BIP angestiegen. ... Die radikale Fed-Politk hat nämlich zu einer drastischen Ausweitung der Geldmenge geführt: Die monetäre Basis ist laut einer offiziellen Statistik auf der Seite der Fed bis Ende Februar 2009 auf 1,6 Billionen US-Dollar angestiegen und hat sich damit binnen Jahresfrist nahezu verdoppelt (siehe unsere Grafik). ... " [ARD 17.3.9]:
- "Geldmenge im Euroraum nimmt drastisch zu. Berlin: (hib/HLE) Die Geldmenge "M3" im Euro-Raum ist seit Beginn des Jahres 1999 um jahresdurchschnittlich 7,5 Prozent gewachsen. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (16/12362) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (16/12161) nach der Stabilität des Euro mit. Trotz der Zinserhöhungen von Dezember 2005 bis Juli 2008 habe die Geldmenge "M3" in den letzten Jahren sogar zweistellige Jahreswachstumsraten erreicht. Diese Rate habe in der Spitze im Oktober 2007 bei 12 Prozent gelegen. Derzeit habe sich der Zuwachs der Geldmenge deutlich abgeschwächt und im Januar dieses Jahres bei 5,9 Prozent gelegen. ... " [DBT 30.3.9]
- Geldmenge USA aktuell: Die FTD berichtet am 19.3.8: "Die FED wird mächtig nachlegen müssen. Die Fed ist mittlerweile so aggressiv, dass eine Wende von Konjunktur und Finanzmärkten zum Greifen nahe scheint. Sie wird ausbleiben, weswegen sich auch die zweistelligen Kursgewinne der US-Broker als Zwischenerholung erweisen werden. Am Ende wird die FED daher geradezu rasend werden. ... das weithin als stabilste erachtete US-Geldmengenaggregat "Money of Zero Maturity" liegt um 16 Prozent über dem Vorjahr. Über die vergangenen sechs Monate ist es aufs Jahr hochgerechnet um 19,5 Prozent gestiegen, über die vergangenen drei Monate um 25 Prozent. ... Die Fed gibt ihr Geld jetzt auch direkt an Institute heraus, die nicht ihrer Kontrolle unterliegen, und akzeptiert dabei allen Ramsch als Sicherheit." Siehe auch Geldmengenentwicklung in den USA und Schulden-Porträt USA (1791-aktuell).

Globalisierung. Definition, Globalplayer, Erfindung und Sinn der Globalisierung I, II, III, IV, V., Schwarzbuch, Begriffe, Grundprobleme der Menschheit, Vorbilder und Alternativen. * Preisabsprachen, Kartelle und Oligopole *
___
Globale Enteignung der Städte. [1,2,3,4,]
Ein lesenswerter Artikel in den Nürnberger Nachrichten (6.7.4, S.13) über das Buch von Werner Rügemer (2004). Cross Border Leasing - Ein Lehrstück zur globalen Enteignung der Städte. Münster: Westfälisches Dampfboot.
| "Seit 1995 haben Hunderte Städte und öffentliche Unternehmen in Deutschland und Europa ihre Großanlagen wie Klär- und Wasserwerke, Straßenbahnen, Schulen und Messehallen an US-Investoren verkauft und zurückgemietet. Erst durch Rundfunksendungen von Werner Rügemer wurde »Cross Border Leasing« seit 2002 zu einem öffentlichen Thema. Er schildert die Entstehung und Struktur dieses Finanzprodukts der »New Economy« in den USA, ihre Verwandtschaft mit anderen Formen öffentlicher Enteignung, ihr Ausmaß in den wichtigsten europäischen Staaten sowie die Arbeitsmethoden der Leasing-branche. Erstmalig legt er jetzt die bisher geheimen Vertragsinhalte dieser Konstrukte fiktiver Kapitalbildung in vollem Umfang offen." (Rückumschlag / Info mit Inhaltsverzeichnis.). Bestellung: Westfälisches Dampfboot. |
- CBL im Netz:
Hollyvoodoo. Eine Wortschöpfung aus Hollywood ("Traumfabrik") und Voodoo (Zauber), das meist im Zusammenhang Voodoo-Tod (Tod durch Glauben, die Überzeugung durch einen Bann oder Fluch sterben zu müssen) gebraucht wird, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass die Amerikanisierung der Welt auf Schein ("Hollywoodisierung") beruht und für viele in den Tod führt. Obwohl die radikal- islamistischen Mullahs natürlich so wenig eine Alternative sind wie die Kommunisten oder Faschisten, haben sie doch etwas Richtiges und Kritisches erkannt: dieses Amerika hat etwas Tödlich-Teuflisches an sich. Die globale Hollyvoodookratie, der global-grenzenlose Konsum- und Wachstumsterror, führt die ganze Menschheit in den Ruin.
___
homo oeconomicus. Die westlichen Gesellschaften werden vollkommen beherrscht vom homo oeconomicus, d.h. der Mensch wird weitgehend als Wirtschaftsobjekt missbraucht und als Konsummaschine gezüchtet bzw. konditioniert. Das ist an sich familien- und kinderfeindlich und daher ist auch völlig klar, weshalb in sog. Marktwirtschaften und Wohlstandsgesellschaften die Geburtenrate abnehmen muss. Die übermächtige share holder value Ideologie der Plutokraten trägt wesentlich mit zu einer einseitig überalterten, damit kinderreduzierten Gesellschaft und zur Unmenschlichkeit der Sozialsysteme bei. Die Zerschlagung der Großfamilie und ihrer zahlreichen 'kostenlos' erbrachten sozialen Leistungen führt zu immer gigantischeren Kosten eines sog. professionellen Sozialsystems, das zunehmend weniger bezahlbar und zugleich unmenschlicher wird. Das ist die Saat und Frucht der absoluten Herrschaft des homo oeconomicus, made in USA. Die Aufrechterhaltung dieser Systeme erfordert die ständige Ausbeutung und Unterdrückung der nicht-westlichen Welt, der Armen und Schwachen und fördert damit auch den Kampf der Kulturen, Hass, Krieg und den Kampf aller gegen alle und erzwingt unvorstellbare und gigantische Aufwendungen für die Machtapparate (Militär, Waffen, Geheimdienste, Polizei, Medien: Hollyvoodoo).
|
(Faust II, A V, Palast, Mephisto Vers 11187) |
Konsum-Animation, Verführung und Konditionierung des homo oeconomicus.
Das maniforme System des globalen Wachstumsrausches verlangt immer mehr und mehr und noch viel mehr. Im Dienste der Animation, Konditionierung und der Verführung stehen die Werbung, leichter Geldzugang und Einkaufsmöglichkeiten rund um die Uhr - flankiert und gestützt von einer willfährigen Justiz.
- 2000 BVerG erklärt Werbung mit schockierenden
Bildern (ölverschmierten Enten, Kinderarbeit oder Aids-Kranken) für
nicht verfassungswidrig und damit erlaubt. [Q]
1999 Homebanking und Interneteinkauf.
1996 Erneute LIberalisierung des Ladenschluss
1989 Liberalisierung Ladenschluss
1982 Einführung der Geldautomaten.
1972 EC-Karte
1952 Kaufkredit (Ratenkredit)
1949 Bildung von Diners Club.
Ich pumpe, also bin ich. Die Formel ist Descartes berühmter Formel nachgebildet, die hier allerdings eher das Gegenteil repräsentiert. Dem entspricht das Credo Ich kaufe, also bin ich des homo oeconomicus.
___
Kapitalismus: Der Kapitalismus taugt so wenig wie der diktatorische Kommunismus (> "Hollyvoodoo"). Er wird beherrscht von den fossilen Neandertalerprinzipien: Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren, Steuern minimieren - und nach uns die Sintflut. Und im Zeitalter "der" Globalisierung gibt es noch nicht einmal mehr richtige Märkte, so dass sich inzwischen der einzige ökonomische Vorteil des Kapitalismus - optimale Leistung durch freien Wettbewerb und Konkurrenz - weitgehend selbst aufhebt [Kartelle, Geschwätz von der freien Marktwirtschaft]. Die sog. Finanzkompetenz des Kapitalismus besteht in erster Linie darin, die ganze Welt in ein Casino zu verwandeln, wo mit einer irrsinnig durch Schuldentollwut aufgeblähten Geldmenge ein maniformes Schneeballsystem von Geld-, Luft- und Seifenblasenwirtschaftswachstum immer seltsamere und katastrophalere Blüten treibt. In ihrer Not fallen viele KommunalpolitikerInnen auf die Heilsversprechen der Banken (PPP) herein. Aber die Banken haben nur eines Sinn: Kapitalrenditen von 25%, wie der Deutsche Bank Chef die Branchenprimus-Parole ausgegeben hat. Und wenn diese Kapitalrendite erreicht sein wird, wollen sie noch mehr, bis wir wieder bei der Wucherzinsen im Mittelalter angelangt sind oder bis sie alles haben, vom Grashalm bis zum letzten Dachziegel. Da kann der Staat, die Gemeinde nicht gewinnen. Sie kann nur noch mehr verlieren und am Ende alles. Zur richtigen Therapie gehts hier.
__
Kassenverstärkungskredite. [Mehr hier]
In den Erläuterungen des statistischen Bundesamtes "Schulden der öffentlichen Haushalte" heißt es: "Unter Kassenverstärkungskrediten werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten erfasst, welche die Berichtskörperschaften zur Überbrückung vorübergehender Kassenanspannungen eingehen. Zu den Kassenverstärkungskrediten rechnen neben den Kassenkrediten von Kreditinstituten auch Geldmarkttitel (Schatzwechsel, unverzinsliche Schatzanweisungen) soweit sie zur kurzfristigen Kassenverstärkung bestimmt sind. Die früher ebenfalls dazu zählenden Kassenkredite der Deutschen Bundesbank entfielen ab dem 1. Januar 1994, da zu diesem Zeitpunkt die Regelungen über die zweite Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion wirksam geworden sind. Danach dürfen Notenbanken den öffentlichen Haushalten keine Kredite mehr gewähren. (Erlaubt bleiben allerdings im Interesse der reibungslosen Abwicklung staatlicher Kassentransaktionen sog. untertägige Kreditaufnahmen bei der Notenbank, die zum Tagesschluss aber ausgeglichen sein müssen). Zweck dieses Kreditverbotes ist es, die öffentliche Hand zu zwingen, sich an den Kredit- und Kapitalmärkten zu Marktkonditionen zu finanzieren. Dadurch soll die Haushaltsdisziplin gestärkt und gleichzeitig eine wichtige potentielle Inflationsquelle verschlossen werden."
Auch der Bund der Steuerzahler bestätigt in seinem Bericht "2006 Die öffentliche Verschwendung" die Praxis, mit Hilfe der Kassenverstärkungskredite die echte Staatsverschuldung optisch kleiner zu halten. Im Bericht wird S. 43 am Beispiel Bodenheim (Hessen) ausgeführt: "Die [Kassenverstärkungs] Kredite dienen eigentlich nur der kurzfristigen Liquiditätssicherung einer Kommune, werden mittlerweile aber landauf und landab als Finanzierungsquelle laufender Ausgaben benutzt."
Weitere Information Deutscher Städtetag: Explosion der Kassenkredite
1992-2006 [PDF]
____
Länder,
Gemeinden und Zweckverbände. Wie das stat. Bundesamt mitteilt,
sind die Aufgaben zwischen Land, Gemeinden und Zweckverbänden in den
verschiedenen Bundesländern unterschiedlich geregelt. Aus Gründen
der besseren Vergleichbarkeit, werden
daher die Schulden von Ländern, Gemeinden und Zweckverbänden
zusammengefaßt.
___
Lüftl-Theorem.
___
Mittel = Arithmetischer Mittelwert: Alle
Werte addieren und durch ihre Anzahl teilen: M = Summe / N. Man beachte,
wenn Mittelwerte über Zuwächse gegenüber Vorjahreswerten
gerechnet werden, ergeben sich andere Mittelwerte als wenn der gesamte
Zeitraum gemittelt wird. In Mittelwertberechnungen von Zuwächsen geht
ein Wachstumsfaktor ein.
Streuung =: die Standardabweichung, ein Schätzmass
für die Streuung um den Mittelwert.
Spannweite = Maximum - Minimum.
___
Plutokratie Thema in der IP-GIPT:
- Grundinfo Oligarchie, Plutokratie ...
- Das Plutokratie-Syndrom.
politische "Krankheit". Sie heißt: Schulden, Schulden über alles, über alles in der Welt. Man könnte sie als eine Art Schuldentollwut bezeichnen. Siehe Überblick Schuldenporträts. Leider helfen bislang weder die entsprechenden Grundgesetzartikel (115 und 109) noch das Stabilitäts-Gesetz (1967); die "Schulden-Tollwut" scheint inzwischen ein globales Phänomen zu sein. Und die Nationalökonomie und Finanzwissenschaft zeigt sich auch weitgehend unfähig, das Problem angemessen wahrzunehmen und zu lösen. Dafür gibt es dann Wirtschaftsnobelpreise für Spekulationsgewinnoptimierung.
__
Schuldenentwicklungs-Modell Verantwortlich für die unverantwortliche Schuldenpolitik sind: Politik, Recht, Verfassung, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaft, Werbung, Banken, Medien, KonsumentInnen und WählerInnen. Jeder Faktor für sich alleine genommen scheint zu einem bestimmten Zeitpunkt - vor allem am Anfang - eine sehr geringe Wirkung oder Bedeutung haben, wie es z.B. typisch für Wachstumsphänomene ist, wo man lange, lange Zeit nichts merkt. Jeder gesellschaftliche Bereich trägt in einem vernetzten Wechselwirkungsprozess immer wieder eine kleine Veränderung bei, so dass aber insgesamt und über die Zeit betrachtet eine riesige und womöglich nicht mehr beherrschbare Eigendynamik an Wechselwirkungen zustande kommt. In einem Schaubild vorgestellt, könnte man sich eine Spirale denken, die sich allmählich immer mehr ausdehnt und in eine gigantische Wachstumsblase einmündet, die schließlich in einer Währungsreform platzt. > Mehr Politische Krankheit ...
___
Schulden nach dem Maastrichtvertrag.
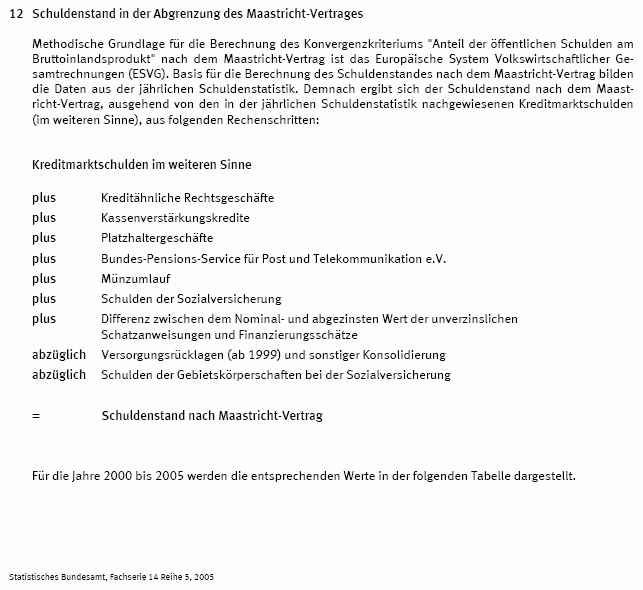
___
Schulden-Pisa.
- "Im Prinzip zahlt also der Staat keine Zinsen!" Jochen Steffens am 11.12.6 in Finanznachrichten.de. Das ist ja praktisch. Tilgen tut er nicht und Zinsen zahlt er auch nicht - im Prinzip. Bei solchen Kommentaren muss sich wirklich niemand mehr wundern.
Schulden-Porträt. Ein neues Benchmark-Format und Evaluations-Kriterium zur Qualitätssicherung von PolitikerInnen, Ökonomen, Finanziers und Wirtschaftseliten. Es ist wichtig, dass die abstrakten Zahlen zu Gesichtern, Namen und verantwortlichen Funktionen in Beziehung gesetzt werden, sonst ändert sich womöglich nie etwas. PoltikerInnen reden viel und sagen meist wenig, doch wichtig und entscheidend zur Beurteilung ihrer Gemeinwohl-Qualität sind allein ihre Handlungen und deren Wirkungen, hier Schulden- und Wirtschaftswachstumsraten: die beiden wichtigsten Kenngrößen für eine vernünftige Finanzökonomie und Stabilität. Und hierbei kommt es nach Musgrave (1987, Bd. 3, S. 209) entscheidend darauf an, dass das Verhältnis beider Wachstumraten wenigstens konstant bleibt: Stabilitätsbedingung für ein Finanzsystem: Wirtschaftswachstumsrate >= Schuldenwachstumsrate. Eine Service-Leistung der IP-GIPT, Abteilung Politische Psychologie (Präambel; Sprache). > Stetige und jährliche Wachstumsraten.
- _
| Anregung: machen oder unterstützen
Sie Schulden-Porträts von Ihren PolitikerInnen im Land, im Bezirk,
im Landkreis, in der Gemeinde und in der Stadt, von den Institutionen,
Organisationen und großen Firmen. Helfen Sie mit, unsere PolitikerInnen
und VerantwortungsträgerInnen zu erziehen, dass sie den einfachsten
und wichtigsten kaufmännischen Grundsatz, dass man auf Dauer
nicht mehr ausgeben darf als man einnimmt, also solides wirtschaften begreifen,
verinnerlichen und praktizieren lernen. Wählen Sie niemanden, der
dies nicht kann, beherzigt und zeigt.
PolitikerInnen reden viel, gefällig und selbstgefällig. Achten Sie nicht auf die Worte, denn diese bedeuten nichts, sind meist Werbung, Imagepflege, oft stimmen sie nicht. Achten Sie nur auf die Tatsachen, auf das, was gemacht wird; auf das, was als Ergebnis rauskommt. Und die Verschuldungszahlen sind ein sehr gutes Kriterium für Tüchtigkeit und Verantwortung. Und wer mit Steuer-Geldern nicht richtig umgehen kann, bedient sich womöglich nur selbst, kann also nicht nur nichts, sondern ist sogar eine Gefahr für das Gemeinwohl. Geld wäre genug da: Gehen wir von 1% bestverdienenden OligarchInnen in Deutschland aus, dann ergibt dies bezogen auf 40 Millionen Erwerbstätige 400.000. Schöpfen wir von den auf - im Durchschnitt - mindestens 1 Million Euro geschätzten Einnahmen der 1% Bestverdienenden 50% ab, dann ergäbe dies 400.000 mal 1/2 Million, das macht 200 Milliarden. Bei ca. 1,3 Billionen Staatsschulden wäre Deutschland damit in ca. 6,5 Jahren (alt) schuldenfrei. Derzeit gibt es nach der Datenquelle und Basis Materialband zum ersten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung S. 112, Tab. 1.65, ungefähr 460.000 (Multi) Millionäre in Deutschland. Das hier vorgeschlagene Modell ist also durchaus realistisch, wie hier auch gezeigt wurde: Die Wachstumsrate der Millionäre in Deutschland. |
Schuldenstände Deutschland nach den Kriterien des Maastrichtvertrages

Quelle: Erläuterungen Statistisches
Bundesamt Fachserie 14 Schulden der öffentlichen Haushalte.
___
Schulden-Uhren
Links.
___
Schulden-Wachstums-Rate
nach der Formel für stetiges Wachstum Beispiel ... : Endwert = Anfangswert
* ezs*n. Für .... z.B.: Hier
n = ... = JE-JA.
Rechnung mit Excel für stetiges
Schuldenwachstum: zs = [ln(E/A]/ n , = [ln()]/ n = [...] / n =
... = ...% %. Probe stetig
mit Excel: [Anfangswert]
* e^(zs*n): e^(zs*n) = A * ... = ... [Endwert]. Probe
gerechnet mit Taschenrechner Sharp El-531VH: [2ndF] [ln] [...] =
... [X] [A] = ... Endwert.
Rechnung mit Excel für jährlichesSchuldenwachstum
zj=[(E/A)^(1/n)]-1 = [(...)^(...)]-1 = ... = ...%. Probe jährlich
mit
Excel:: (1+zj)^n * [Anfangswert]: [(...)^n] * A =
... * A = [Endwert] Gerechnet mit Taschenrechner Sharp El-531VH:
[...][yx] [n] = ... [X] [A] = ...
Anmerkung: Die Zahlen liegen manchmal
nicht auf Millionen gerundet und "krumm" vor. Das rührt meist von
der Umrechung auf Euro her. Daher können die mitgeteilten und mit
Excel-interner Genauigkeit gerechneten Werte manchmal geringfügig
abweichen von den mit dem Taschenrechner ausgerechneten ungenaueren Werten,
weil die Eingabewerte nicht so stellengenau wie in der Exceltabelle vorliegen.
Bedeutung
und Berechnung der stetigen und jährlichen Wachstumsrate. Einen
Vergleich zwischen der exponentiellen stetigen Schulden-Wachstums-Rate
nach dem Zinses-Zins-Modell und dem jeweils entsprechenden arithmetischen
Mittelwert findet man z.B. für alle Bundesbankpräsidenten und
Kanzler von Adenauer 1950 bis Schröder 2002 hier.
Wie man sieht, stimmen die Größenordnungen ganz gut überein.
Eine ziemlich perfekte Dokumentation könnte umfassen, absolut und
relativ in %: Ausgangswert = Schulden des Vorgängers, Anfangswert,
Endwert = Ausgangswert des Nachfolgers, Mittelwert, Standardabweichung
(Streuung), Minimum, Maximum, Spanne (Maximum-Minimum), stetige und jährliche
Wachstumsrate. Eine negative Schulden-Wachstums-Rate bedeutet natürlich
Tilgung und sparen. "Sparen" bedeutet nicht, wie in der Presse vielfach
falsch euphemistisch dargestellt, dass weniger
neue Schulden aufgenommen werden. In diesem Falle wird nicht
etwa gespart, "nur" nicht mehr so viel Schulden gemacht wie gegenüber
dem Bezugskriterium (meist Vorjahr). Siehe:
Was
zum Teufel heißt eigentlich "Sparkurs"?.
___
Staatsverschuldung:
Literatur- und Linkhinweise zu Paul C. Martins Arbeiten und dem sog. "Lüftl-Theorem"
Martin, Paul C. & Lüftl, Walter (1984, 2.A.). Die Pleite.
Staatsschulden, Währungskrise und Betrug am Sparer. München:
Langen-Müller.
 |
Das sog. Lüftl-Theorem finden Sie auch praktisch durchgerechnet für die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen hier. Entscheidend für die Problematik ist die Geschwindigkeit des Wachstums, z.B. der Schulden in Beziehung zu den Ressourcen, z.B. BIP, d.i. bei der exp. Regression der Faktor b in: F(X)=A*eb*x |
Die Warnungen Paul C. Martins von vor 20 Jahren bewahrheiten sich inzwischen
recht dramatisch, einige Kommunen sind praktisch pleite und die Staatsfinanzen
völlig zerrüttet. Es zeigt sich immer mehr, dass die politische,
ökonomische gesellschaftliche Entwicklung eigentlich nur noch mit
psychopathologischen Mitteln analysiert werden kann. Leider ist das Problem
nicht lösbar, weil immer dann, wenn Massenwahnphänomene
greifen, besonders in sog. "Demokratien", die
Mehrheit bestimmt, was "normal"
ist - auch wenn es noch so verrückt ist.
___
supra-nationale Egoismen
(EU). Es ist ein ungeheurer Vorgang, wenn die subventionierte Landwirtschaft
der Europäischen Union z.B. die afrikanische Landwirtschaft zerstört,
indem sie ihre Überschuss- und Überflussprodukte dorthin "billiger"
exportieren als die einheimischen landwirtschaftlichen Erzeuger produzieren
können.
- Afrika und die drei Wellen der Globalisierung [Q].
- EU und USA zahlen 13 Milliarden Dollar illegaler Agrar-Subventionen [Q] Hieraus: "Die EU zahlt Oxfam zufolge 300 Mio. Euro im Jahr an Tomatenverarbeiter vor allem in Griechenland, Italien, Spanien und Portugal - was 65% des Wertes der Tomatenernte ausmacht und es ihnen ermöglicht, der weltgrößte Exporteur von Tomatenmark zu sein. Produzenten in Südafrika, Chile und Tunesien hingegen gehören zu den Verlierern. Die EU subventioniere ihre Fruchtsaft-Industrie, vor allem in Spanien und Italien, zu über 300%, heißt es in dem Bericht, mit 250 Mio. Euro pro Jahr. Produzenten in Argentinien, Brasilien, Costa Rica und Südafrika könnten jährlich 40 Mio. US$ mehr verdienen, wenn die EU ihre Subventionen abschaffte. Außerdem schütze die EU ihre Milchindustrie vor Wettbewerb und subventioniere die Hersteller von Molkereiprodukten mit 1,5 Mrd. Euro im Jahr. Argentinien, Brasilien und Uruguay könnten Butter exportieren, wenn nicht die EU-Exportsubventionen den Weltmarktpreis drücken würden. EU-Butter wird zu Dumpingpreisen direkt in Ägypten, Marokko und Südafrika eingeführt."
Tatsächliche Schulden der Gemeinden.
Deutsche Kommunen höher verschuldet als bisher bekannt. "Bertelsmann Stiftung: Ein Großteil der Schulden wird in ausgegliederte Gesellschaften und Unternehmen verlagert. Grafik zum Kommunalkongress 2007: Schulden der Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände. "Die deutschen Kommunen sind deutlich höher verschuldet, als bisher angenommen. Das geht aus aktuellen Analysen der Bertelsmann Stiftung hervor, die heute in Berlin veröffentlicht werden. Danach verlagern die Kommunen einen beträchtlichen Teil ihrer Schulden in ausgegliederte Gesellschaften. Im Bundesdurchschnitt werden rund 57 Prozent der Schulden in den Kernhaushalten von Städten und Gemeinden ausgewiesen; die restlichen 43 Prozent fallen in den ausgegliederten öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen an. ..." [Mehr an der Quelle]
___
Wachstum kritisch betrachtet.
___
Wachstumstabellen (Zinseszins).
___
Die Schuld der Wirtschaftswissenschaften und der Medien
Dass Deutschland so an den Rand des finanziellen Ruins getrieben werden konnte, ist wesentlich mit das Werk seiner unkritischen und willfährigen WirtschaftswissenschaftlerInnen und der wirtschaftspolitischen Medien, die das Problem seit ca. 25 Jahren nicht nur verharmlosen und falsch darstellen, sondern an der finanzpolitischen Verwahrlosung und Verblödung dieses Landes wesentlich Mitschuld haben.
___
Zeitgeschichte
- IFZ: Institut für Zeitgeschichte (München).
- Deutsches Historisches Museum (dhm), Jahreschroniken zum zeitgeschichtlichen Rahmen in Deutschland: 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915,1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943,1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967,1968, 1969, 1970,1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
- bpb: Bundeszentrale für Politische Bildung mit vielen interessanten und grundlegenden Informationen.
Sponsel, Rudolf. Jahrgang 1944, Psychologe und Psychotherapeut in Erlangen; Politische Psychologie als "Hobby". Geboren in Markt-Erlbach, aufgewachsen in Wilhermsdorf,Utrecht und Nürnberg (Schweinau, Deutschherrenwiese, Erlenstegen), später in Wertheim a.M., Stockholm [W], Stuttgart und seit 1971 in Erlangen. Früher politisch links-alternativ orientiert und engagiert, inzwischen zu einem "Weißen" entwickelt. Politikaxiome. Weltanschaulich: metaphysisch liberaler Freidenker. Grundsätze: integratives Manifest, integratives Menschenbild. Künstlerische Aktivitäten Hegel-Bilder, Offenes Atelier, Porträts. - Berufsfachbiographisches.
___
Standort: Literatur- und Linkliste Staatsverschuldung und Umfeld ...
*
Überblick Staatsverschuldung. *_Die politische Krankheit der Schuldentollwut: Erklärung und Heilung *
Überblick Programm Politische Psychologie in der IP-GIPT. * Überblick Wirtschaft *
Überblick Statistik in der IP-GIPT: Methoden, Daten, Geschichte, Verwandtes.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Staatsverschuldung site:www.sgipt.org. * Deutschland AG site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Literatur- und Linkliste Staatsverschuldung und Umfeld: Geld, Wirtschaft, Finanzen, Reichtum, Geldpathologie und Psychopathologie des Geldes, von Wirtschaft und Finanzen. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/politpsy/finanz/filili.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen, die die Urheberschaft der IP-GIPT nicht jederzeit klar erkennen lassen, ist nicht gestattet. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
noch nicht end-korrigiert
Änderungen - wird im Laufe der Zeit (unregelmäßig) überarbeitet und ergänzt
13.01.12 Alternative Geldsysteme.
19.12.11 Erg. Finanzmathe.
06.08.10 Aktualisierung Literatur Staatsverschuldung.
21.02.10 Kritische Literatur Steueroasen.
30.01.07 Lit. Erg.
21.01.07 Neue Kategorie Geldtabu.
29.12.06 Lit: Schulden und Finanzwirtschafts der Städte und Gemeinden * Inhaltsverzeichnis *
10.12.06 Neuer Graph zur Staatsverschuldung.
20.11.05 Neuaufnahmen der Rubriken: Öffentliche Verschwendung und Mißwirtschaft * Alternativen zur plutokratischen Geldwirtschaft * Das Pensionskostenproblem.
23.08.05 Literatur nachträge Anikin, Baader, Mises, Rothbard.
23.08.04 Beginn Historische Daten Rubrik.
05.08.04 Einzelfallstudien, Lit: Die Finanzen großer Männer.
01.07.04 Rubrik (praktische) Finanzmathematik und Steuern aufgenommen
26.02.04 Aufnahme Martin, P.C. und Linkweise zur Geschwindigkeitsproblematik der Wachstumsfaktoren
24.12.03 Aufnahme Goldberg & Lewis und "Zacharias Zaster"
29.11.03 Link Monatsberichte EZB