Internet Publikation
für Allgemeine und Integrative Psychotherapie
(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=18.04.2016
Internet-Erstausgabe,
letzte Änderung: 11.05.19
Impressum:
Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel
Stubenlohstr.
20 D-91052 Erlangen * Mail:_sekretariat@sgipt.org__Zitierung
& Copyright
Anfang_Neurowissenschaftliche
PTF__Datenschutz_Überblick_Rel.
Aktuelles_Rel.
Beständiges_
Titelblatt_
Konzept_
Archiv_
Region_
Service-iec-verlag___
Wichtige
Hinweise Links u. Heilmittel
Willkommen in unserer Internet-Publikation
für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Heilmittel-Lehre
& Heilmittel-Monographien der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie,
hier:
Neurowissenschaftliche Psychotherapieforschung
Eine kritische Analyse am Beispiel
Roth/Strüber (2014):
"Die Wirkungsweise der Psychotherapie
aus Sicht des Neurowissenschaftlers"
Übersicht
Heilmittellehre und Heilmittel-Monographien
*
Literaturhinweis
* Symbolik
Heilmittelgraphik
von Rudolf Sponsel, Erlangen
_
Inhaltsverzeichnis
Abstract Zusammenfassung
Summary.
Die zwei Hauptaufgaben
der Psychotherapie.
Allgemeine Psychologisch-Psychotherapeutische
Grundfragen zu den neurobiologischen Grundlagen.
Spezielle Fragen an die Neurowissenschaftliche
Psychotherapieforschung.
Ergebnisse
der kritischen Analyse.
Beispiel Roth & Strüber (2014)
Die Wirkungsweise der Psychotherapie aus Sicht des Neurowissenschaftlers
Die Gründungsvaeter
des Projektes "Seele und Gehirn".
Neuropsychotherapeutische«
Korrelate
und Messmethoden.
9.1 Welche Methoden
besitzt die Neurobiologie, um die Wirksamkeit von Psychotherapien zu überprüfen
Exkurs:
Zwischenbilanz methodische Probleme.
Exkurs:
Hochstapler-Zitierstil.
9.2
Neurowissenschaftliche Beurteilung der Therapiewirkungsforschung.
(1)
Das VT-Paradigma der »Löschung« unangepasster Verknüpfungen.
(2)
Das Paradigma der kognitiven Kontrolle und kognitiven Umstrukturierung
in der KVT.
(3)
Das Paradigma des Bewusstmachens unbewusster Inhalte in der Psychoanalyse.
9.3
Neurobiologische Interpretation der »therapeutischen Allianz«.
9.4
Was geschieht in der zweiten Therapiephase?
9.5
Was bedeuten diese Erkenntnisse für eine »Neuropsychotherapie«?
Zur
Neurobiologie von Tun und Lassen
Zur Neurobiologie,
Psychologie und Psychotherapie der Loeschung.
Bedeutungen
(Modelle) des Löschens.
Löschen
im Alltagsleben.
Löschen
im Computer.
Löschen
in der Lerntheorie und Verhaltenstherapie.
Löschen
neurobiologisch.
Materialien
zum Löschungsbegriff.
Grawe
(2004, S. 103f) zur Löschung.
Im
Lexikon der Neurowissenschaften (2000).
Im
Lexikon der Psychologie von Spektrum.
Löschung
im Handwörterbuch der Psychologie.
Exstinktionslernen
in Tiermodelle und translationale Forschung bei der Depression.
Befunde und Materialien
der neurobiologischen Forschung zu psychotherapierelevanten Themen (Auswahl)
Wie
LSD das Ich auflöst - Studie zur Gehirnaktivität unter Drogen.
Bock,
Jörg & Braun, Katharina (2012) Reizarme Umgebungen und
visueller Neocortex.
Bock,
Jörg & Braun, Katharina (2012) Stresserfahrungen und
limbisches System, Hippocampus,
Amygdala
und Präfrontalcortex.
Kellermann
& Habel (2013) Planung und Umsetzung experimenteller Paradigmen.
Block-
und Event-related-Design nach nach Kellermann & Habel.
Nachtigall
& Suhl (2004) Evaluation individueller Veränderung.
Gerhard
Roth (2015) Krankes Gehirn - kranke Seele?
Lewitzka
Bauer (2011) Neurobiologie der bipolaren Störungen.
Suslow &
Arolt (2010) Neurobiologische Grundlagen von Psychotherapie.
Prof.
Dr. Giselher Guttmann o.J. Abteilung für neurowissenschaftliche Grundlagen
der Psychotherapie.
Müller
& Fromberger (2010) Bildgebende Befunde bei Sexualstraftätern.
Koncsik,
Imre (2015) Der Geist als komplexes Quantensystem.
Pfützner,
Helmut (2014) Bewusstsein und optimierter Wille.
Wissenschaftlicher
Apparat.
Literatur (Auswahl)
* Zeitschriften mit neurowissenschaftlichen
Beiträgen * Links *
Glossar,
Anmerkungen und Endnoten:
Stichworte: * Abrufen *
Abspaltung
(Dissoziation) * Abwehr,
Abwehrmechanismen, Neutralisationsmechanismen * Abwesend
(Geistesabwesenheit) * affektiv,
Affekt, affektiver Apparat * Achromatopsie
* adaptives Gedaechtnis * Aktionspotential
* Amygdala (Mandelkern) * Amnesie
* Anatomie der Bewusstseinsstrukturen
* Anfall * Anfallsleiden
* ARAS * Arbeitsgedaechtnis
* Assoziieren, Assoziation * Assoziatives
Gedaechtnis * Attraktor * Aufmerksam,
Aufmerksamkeit * Aufmerksamkeitslenkung
* Auf der Zunge liegen * Aufwachen
* Aura * Axon * Bahnen
* Benommen, Benommenheit *
Bewusst,
Bewusstheit * Bewusstsein * Bewusstseinseinengung
* Bewusstseinslenkung * Bewusstlos
* Bewusstseinsspaltung * Bewusstseinsspanne
* Bewusstseinsstrom * Bewusstseinssupervision
*
Bewusstseinstrübung * Bewusstseinszustand
* Bildgebende Verfahren * Blinder
Fleck * Brain fingerprint * Brainstorming
* CT * Dämmerzustand
* Delirium * Deklaratives
Gedaechtnis * Denken * Depolarisation
* Dopamin * Dissoziation
* Dösen * Echo Gedaechtnis
* EEG * Empfindung * Engramm
* Enkodieren * Entscheidung:
Libet-Versuch,
Haynes-Versuch * Epiphämomen
Epiphänomenalismus * Episodisch-autobiographisches
Gedaechtnis * Episodisches Gedaechtnis
* EPSP Exzitatorisches
Postsynaptisches Potential * Erinnern * Erleben
* Explizites Gedaechtnis * Exposition
* Fokussieren * fMRT
* Formatio reticularis * Freier
Wille * Funktion * Funktionsbereiche
* Ganzes * Ganzheiten *
Gedanken
* Gedankenabreißen * Gedankensperrung
* Gedankenstopp * Gedaechtnis:
Einzelfaelle
(gedächtnisrelevante): Naomi Jacobs,
Clive
Wearing, H.M. ,
William O.
* Gedaechtnishemmungen * Genschere
* Gestalt * Grenzzustände
* Genexpression * Gesetz
der Uebung * Gesichtererkennung
* Gewohnheit * habit * Habituation
* Halluzination * Hebbsche
Lernregel * Hellsehen * Hellsichtig
* Hemmung * Hippocampus
* Hirnstamm * Hypnoid
* Ich-Bewusstsein * Ich-Erleben
* Identität * Identitaets-Bewusstsein
* Identitaetstheorie Leib-Seele-Geist
* Ikonischer Speicher * Implizites
Gedaechtnis * Indexieren * Isocortex
* Katalepsie, kataleptisch * Katatonie,
kataton * Kausalität * Klarheit
* Kollektives Bewusstsein * Koma
* Konsolidierung * Konzentration
* Krankheit,
Krankheitsbegriff, Krankheitsmodelle * Kurzzeitgedaechtnis
* Langzeitgedaechtnis * Lenkung,
Regelung oder Steuerung * Löschen
* LTD Langzeitdepression *
LTP
Langzeitpotenzierung * Lucid traeumen
* Markowitsch * Meditation
* Mentales Training * Modul,
Modularität * Molekulare
Mechanismen von Lernen und Gedaechtnis * MRT
* Muede, Muedigkeit * Multiple
Persönlichkeit(en) * Mustererkennung
* Mutismus * Nahtoderfahrung
* Narkose * Narkolepsie
* narrative Form * NCC
* Nervenzellen * Neurogenese
* Neuromathematik * Neuronales
Netzwerk * Neuroplastizitaet * Neurotransmitter
* Normalbedingungen * Ohnmacht
* Oneiroid * P300 * Pareidolie
* Penfield * PET * Prosopagnosie
* Prozedurales Gedaechtnis * relationales
Gedaechtnis * Schlaf * Schlaefrig
* Schlafstoerungen * Schlafwandeln
* Schwindel * Selbst
* Selbstorganisation * Semantisches
Gedaechtnis * Semiotisch-Terminologisches*
Skript
* Somnambul * Somnolenz
* Sonderzustände * Sopor
* Sperrung *
Striatum *
Stupor
* Synapse * Synaptische
Plastizitaet im Hippocampus * Synergetik
* Synkope * Tagtraum * Teil
* Temporallappen * Transienten
* Trance * Traum * Tunnelblick
*
Ultrakurzzeitgedaechtnis * Unbewusstes
* Verbinden * Verdrängen
* Vergessen * Verwirrt,
Verwirrung * Verzueckung * Vigilanz
* Vorbewusstes * Vorstellung,
vorstellen * Wach, Wachheit * Wachkoma
* Wachtraum * Wahrnehmung
* Wecken * Willensfreiheit
* Wissensgedaechtnis * Wissenssystem
* Zeitschriften Gedaechtnis *
Zerstreut * Zustand *
Querverweise * Zitierung
* Änderungen *
|
Abstract
Zusammenfassung Summary
In der Psychotherapie gibt es ganz allgemein zwei Hauptaufgaben: Tun
und Lassen. Genauer: das persönlich Hilfreiche oder Nützliche
tun
oder das nicht Hilfreiche oder Schädliche lassen lernen,
um Störungen von Krankheitswert nachhaltig zu heilen, bessern oder
zu bewältigen. Die praktische Gretchenfrage ist also jeweils: wie
lernt man, persönlich hilfreiche oder nützliche Erlebens- und
Verhaltensweisen zu entwickeln und zu festigen bzw. nicht hilfreiche oder
schädliche los zu werden?
Allgemeine Psychologisch-Psychotherapeutische
Grundfragen zu den neurowissenschaftlichen Grundlagen
-
Wie werden Erfahrungen im Gehirn abgespeichert? [Episodisches Gedächtnis]
-
Bleiben diese Erfahrungen konstant abgespeichert oder verändern sie
sich durch die Informationsverarbeitung?
-
Wie lange bleiben abgespeicherte Erfahrungen im Gehirn erhalten? [Episodisches
Gedächtnis]
-
Wie werden Erfahrungen im Gehirn miteinander verbunden? [Organisation der
Erfahrungen]
-
Wie werden Erfahrungen im Gehirn voneinander getrennt?
-
Wie werden Handlungspläne im Gehirn abgespeichert? [Prozedurales Gedächtnis]
-
Wie werden Handlungspläne im Gehirn verändert? [Prozedurales
Gedächtnis]
-
Wie lassen sich solche Veränderungen neurobiologisch evaluieren?
-
Was sind die neurowissenschaftlichen Grundlagen von Lernen, Verstärken,
Löschen?
Spezielle Fragen an die Neurowissenschaftliche
Psychotherapieforschung
-
Wieso sollte ein buntes Scanner-Bildchen als Kriterium für die Wirksamkeit
einer Psychotherapie taugen?
-
Wieso müssen sich neuronale Hirnstrukturen verändern, um die
Wirksamkeit einer Psychotherapie anzuzeigen?
-
Was muss sich an einer Hirnstruktur verändern, um die Wirksamkeit
einer Psychotherapie anzuzeigen?
-
Können PhilosophInnen, BiologInnen, ZoologInnen, NeurowissenschaftlerInnen
etwas zu Psychotherapieforschung beitragen und worin könnte ihr Beitrag
bestehen?
-
Kriterien der Hirnforschung für die Wirksamkeit einer Maßnahme?
-
Woher weiß die neurowissenschaftliche Hirnforschung, dass festgestellte
Veränderungen im Scanner auf die Psychotherapie zurück gehen?
-
Woher weiß die neurowissenschaftliche Hirnforschung, wie festgestellte
Veränderungen im Scanner zu bewerten sind (positiv, negativ)?
-
Woher weiß die neurowissenschaftliche Hirnforschung, wie nachhaltig
festgestellte Veränderungen im Scanner gelten?
-
Wie werden farbliche Veränderungen bei einzelnen Vpn zu Gruppenwerten
verarbeitet (analog Mittelwertbildung)?
-
Welche Veränderungen können im Gehirn sichtbar gemacht werden
(strukturelle, funktionelle, ...)?
-
Was genau wird bei Strukturveränderungen festgestellt? Wie stabil
und nachhaltig sind diese Strukturveränderungen?
-
Was heißt "neuronales Korrelat"?
Ergebnisse der
kritischen Analyse
NeurowissenschaftlerInnen umgeben sich gern mit dem Nimbus des wahrhaft
oder gar exakt Wissenschaftlichen. Aber Hirne in die Röhre schieben
und bunte Veränderungen registrieren ohne die Methoden genau und klar
in einem experimentellen Versuchsplan darzustellen hat mit Wissenschaft
nur wenig zu tun, hingegen viel mit Mythos und Nimbus. Gelegentlich erscheint
das Auftreten der neurowissenschaftlichen Zunft umgekehrt proportional
zu ihren tatsächlichen wissenschaftlichen Leistungen. Bei Roth &
Strüber (2014) ist der Tenor zweifellos: psychotherapeutisch bewirkte
Veränderungen, müssen auch neurowissenschaftlich - strukturell
oder funktionell - nachweisbar sein, sonst zählen sie quasi nicht.
Das würde allerdings voraussetzen, dass die Neurowissenschaft in der
Lage wäre, Veränderungen in der Erlebens- und Verhaltenssoftware
zu erfassen, doch dafür gibt es derzeit noch nicht einmal einen Ansatz.
Roth & Strüber: Die Wirkungsweise der
Psychotherapie aus Sicht des Neurowissenschaftlers (2014, S.335-369)
Hintergrund: Der Philosoph und gelernte Zoologe Gerhard Roth hatte
sich nach dem Vorwort 1997 entschlossen, eine neues großes Rahmenthema
für sein frisch gegründetes Institut "Hanse-Wissenschaftskolleg"
zu suchen. Man einigte sich auf das Thema "Determinanten menschlichen Verhaltens",
sicher ein sehr grundlegendes und spannendes Thema._
| Die
Gründungsvaeter Vorwort S. 9.
"Schnell waren »Gründungsväter« für das Projekt
»Seele und Gehirn« gefunden, vor allen anderen der Heidelberger
Psychiater und Psychotherapeut Manfred Cierpka, hinzu kamen als weitere
Kollegen Horst Kächele aus Ulm, Peter Buchheim aus München, Ulrich
Sachsse aus Göttingen, Thomas Münte, seinerzeit aus Magdeburg,
und Eckart Altenmüller aus Hannover, mit denen wir über zehn
Jahre hinweg viele kleinere und größere Tagungen am Hanse-Kolleg
und in Heidelberg, Ulm und München durchführten. Später
kam eine ganze Reihe jüngerer Kolleginnen und Kollegen hinzu wie Anna
Buchheim (heute Innsbruck), Svenja Taubner (heute Klagenfurt), Daniel Wiswede
(heute Lübeck), Daniel Strüber (heute Oldenburg), Cord Benecke
(heute Kassel), John Dylan Haynes (heute Berlin) und Henrik Kessler (heute
Bonn)."
__
_
_ |
|
Manfred Cierpka (Heidelberg): Psychoanalytiker.
Horst Kächele (Ulm): Psychoanalytiker.
Peter Buchheim (München): Psychoanalytiker.
Ulrich Sachsse (Göttingen): Psychoanalytiker.
Thomas Münte (seinerzeit Magdeburg): Neurophysiologe.
Eckart Altenmüller (Hannover): Neurologe.
Anna Buchheim (heute Innsbruck): Psychoanalytikerin.
Svenja Taubner (heute Klagenfurt): Psychoanalytikerin.
Daniel Wiswede (heute Lübeck): Fellow.
Daniel Strüber (heute Oldenburg): Kognitionspsychologe.
Cord Benecke (heute Kassel): Psychoanalytikerin.
John Dylan Haynes (heute Berlin): Psychol. Neurowiss.
Henrik Kessler (heute Bonn): Med. Psychologe, Fellow.
Es fällt überdeutlich auf, dass seitens der
PsychotherapeutInnen
nur PsychoanalytikerInnen vertreten sind (100%; von allen 58%): keine
(trotz Interesses) Verhaltens- , Gesprächs-, Humanistische, Integrative,
Körper-, Hypno- oder Systemische Psychothera- peutInnen. Das passt
eigentlich gar nicht zu der Bemerkung S. 10, wonach "... die kognitive
Verhaltenstherapie schon seit langem die Zusammenarbeit mit Neurowissenschaftlern
sucht, öffnet man sich dem in der psychoanalytischen Therapie nur
zögerlich. ..." |
_
| 9 Die Wirkungsweise
von Psychotherapie aus Sicht der Neurowissenschaften 335 [fett-kursiv
RS]
"9.1 »Neuropsychotherapeutische« Korrelate
und Messmethoden
Für eine erfolgreiche Psychotherapie gibt es aus neurobiologischer
Sicht im Prinzip folgende Möglichkeiten:
(1) Unzulänglich oder fehlentwickelte
limbische oder kognitive Hirnstrukturen reifen unter Einwirkung
der Psychotherapie nach. Dies ist an gesichts unserer Erkenntnisse über
die Hirnentwicklung einigermaßen unwahrscheinlich, denn das menschliche
Gehirn ist zu einer »Reparatur« ganzer Hirnzentren nicht in
der Lage.
(2) Gestörte Strukturen und Prozesse
werden durch die Therapie gelöscht und dauerhaft durch »gesunde«
Strukturen und Prozesse ersetzt. Dies ist nur sehr begrenzt möglich,
wie wir sehen werden.
(3) Die gestörte Wirkung von Neuromodulatoren wird
durch eine Vermehrung oder Verminderung der
entsprechenden
Rezeptoren bzw. eine Erhöhung
oder Verminderung ihrer Empfindlichkeit behoben.
Dadurch könnte sich ein
neues Gleichgewicht der Interaktion
zwischen Zentren herstellen.
(4) Aufgrund neuer und positiver Erfahrungen werden kompensatorische
Schaltungen ausgebildet, welche die gestörten Strukturen
und Prozesse in ihren Wirkungen auf psychische Befindlichkeit
und Verhalten durch Überlagerung zumindest teilweise
außer Kraft setzen.
Diese Möglichkeiten werden wir diskutieren, wenn wir uns kritisch
mit der Wirkungsweise der behandelten Therapieformen auseinandersetzen.
Zunächst müssen wir uns aber kurz mit den Problemen der Messmethoden
und des »Untersuchungsdesigns« beschäftigen."
__
_ |
|
Die Einführung enthält viele
Wortschöpfungen, deren operationale Bedeutung völlig im Dunkeln
bleibt. Das ginge ja noch, wenn wenigstens Querverweise erfolgten. Aber
nicht einmal im Sachregister findet sich ein Eintrag zu dem doch fundamental
wichtigen Begriff "Struktur" oder "strukturell":

Woran erkennt man "unzulänglich" oder "fehlentwickelte"
Hirnstrukturen, gestörte Strukturen und Prozesse?
Wie gewinnt man die Normstruktur? Wie werden "Prozesse" erfasst? Und wie
unterscheidet man ein "neues" von einem "alten"
Gleichgewicht? Wie stellt man überhaupt ein "Gleichgewicht"
oder kompensatorische Schaltungen fest? Woran erkennt man
"Überlagerungen"?
Die alles entscheidende Methodenfrage ist in jedem Fall: woher weiß
man, dass die beobachteten Veränderungen auf die Psychotherapie und
nicht auf andere Faktoren zurückgehen? Die AutorInnen entfesseln ein
Stakkato von Worthülsen, die rein äußerlich, grammatikalisch
den Eindruck vermitteln, als handelte es sich inhaltlich um Aussagen. Sehr
verheißungsvoll ist von "Untersuchungsdesigns" die
Rede, aber auch hier findet sich kein Sachregister Eintrag (Untersuchungdesign,
Design). |
_
9.1 »Neuropsychotherapeutische«
Korrelate und Messmethoden ... 335
Welche Methoden besitzt die Neurobiologie, um die Wirksamkeit von
Psychotherapien zu überprüfen? S.336 ff
"Das psychische Geschehen ist unabdingbar an die Aktivitäten corticaler
und subcorticaler limbischer Zentren und deren Wechselwirkungen gebunden,
und es gilt als erwiesen, dass sie bei psychisch
kranken Menschen je nach Erkrankung in bestimmter Weise verändert
sind.
Dies kann z.B. eine gegenüber dem »Normalzustand«
deutlich erhöhte oder verminderte Aktivität
vonAmygdala,
Nucleus accumbens, Hippocampus,
dorsolateralem,
orbitofrontalem
und ventromedialem Cortex usw. bedeuten. Mithilfe geeigneter
Methoden lässt sich außerdem feststellen, ob und in welcher
Weise diese jeweiligen Veränderungen miteinander zusammenhängen,
etwa derart, dass eine Aktivitätserhöhung der Amygdala mit einer
Aktivitätserniedrigung des dorsolateralen präfrontalen Cortex
einhergeht. Solche Untersuchungen sind inzwischen Routine, auch wenn sie
mit erheblichen methodischen Schwierigkeiten zu kämpfen
haben. Ein Problem liegt darin, dass bei der Untersuchung
des menschlichen Gehirns in der Regel nur solche Verfahren zum Einsatz
kommen können, mit denen man die Hirnaktivität durch die
intakte Schädeldecke hindurch messen kann.
Üblicherweise finden bei Untersuchungen am intakten Gehirn vier
Methoden Verwendung: die Elektroenzephalographie bzw. das Elektroenzephalogramm
(EEG), die Magnetenzephalographie bzw. das Magnetenzephalogramm (MEG),
die Positronen- Emissionstomographie (PET) und die funktionelle Kernspin-
oder Magnetresonanztomographie (fMRT bzw. fMRI)." |
|
"und es gilt als erwiesen,
dass sie bei psychisch kranken Menschen je nach Erkrankung in bestimmter
Weise verändert sind"? Das ist eine sehr starke Behauptung,
die gründlich belegt werden müsste. Ich bezweifele das schon
aus dem Grund, weil viele Störungen neuobiologisch ja gar nicht auffallen
müssen, wenn man das Modell "Software" zugrunde legt. Man kann es
einer Hirnstruktur oder einer Aktivationsspur ja nicht ansehen, ob ein
"gesundes" oder ein "gestörtes" Programm läuft. Ja vielfach ist
es schwierig, die "Hardware" von der "Software" zu unterscheiden
[in (3)].
Wie wird der "Normalzustand" im Einzelfall festgestellt?
Was sind normale - im Gegensatz zu erhöhten
oder
verminderten
- Aktivitäten von Amygdala,
Nucleus accumbens,
Hippocampus,
dorsolateralem,
orbitofrontalem
und ventromedialem Cortex?
Hier wird mit wissenschaftlich klingenden Worten jongliert, ohne die
tatsächlichen wissenschaftlichen Begriffs- und Methodenprobleme auch
nur annähernd nachvollziehbar auszuarbeiten.
Objektivität,
Reliabilität und Validität der vier Hauptuntersu- chungsmethoden
EEG, MEG, PET und fMRT
gehörten gründlich erörtert, sowohl für das - ohnehin
problematische
- gruppenstatistische als auch für das Einzelfalldesign.
_
_
_
_
_ |
_
Exkurs:
Zwischenbilanz methodische Probleme (S. 336-340):
"... mit erheblichen methodischen Schwierigkeiten" (S.
336)
" ... Ein Problem ... durch die intakte Schädeldecke
hindurch ..." (S. 336)
"Die Präsentation geeigneter Reize ist ein weiteres großes
Problem" (S. 338)
"Eine weitere Schwierigkeit beim Erfassen von Therapieerfolgen
durch bildgebende Verfahren besteht neben der notwendigen Zahl von Patienten
und Kontrollpersonen in der hinreichenden Dauer der Untersuchung. ..."
(S. 339)
"Schwierig ist auch die Deutung der gemessenen Signale. ..." (S. 339)
"... Selbst unter besten Bedingungen kann eine fMRI-Messung nur die
simultane Aktivität Hunderttausender von Nervenzellen erfassen. ..."
(S. 339)
"... Alle ge-[> S. 340] naueren Kenntnisse des zellulären und
subzellulären Geschehens stammen - von gelegentlichen Messungen am
freigelegten menschlichen Gehirn etwa im Zusammenhang mit Hirnoperationen
abgesehen - aus Untersuchungen an Versuchstieren, meist Ratten oder Mäusen,
gelegentlich Makaken." |
|
Hier werden einige der mannigfaltigen
Probleme zwar genannt, aber keine Lösungen. Daraus lässt sich
entnehmen, dass hier vor allem viel programmatisch heiße Luft erzeugt
wird. Tatsächlich wird kein Design vorgelegt, an dessen verschiedenen
Schnitt- stellen die vielfältigen Probleme zur kritischen Diskussion
über- haupt erfasst sind.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ |
__
| Exkurs:
Hochstapler-Zitierstil (kleine Auswahl):
S. 340f: "... Die frühe negative Erfahrung war also nicht vergessen
(Fendt und Fanselow 1999; LeDoux 2000)."
S. 341: "... Eine Variante dieses Ansatzes ist die »furchtpotenzierte
Schreckreaktion«, in der eine natürliche Schreckreaktion, etwa
auf ein sehr lautes Geräusch, durch eine Zusatzkonditionierung auf
ein grelles Licht noch weiter verstärkt wird (vgl. Koch 1999)."
S. 341: "... Allerdings ist dies keine Löschung, sondern
ein eigenständiger, aktiver Lernprozess, der die bestehende CS-US-Assoziation
nicht eliminiert, sondern neue Verknüpfungen aufbaut, die besagen,
dass das Ganze »doch nicht so schlimm ist« (Quirk und Beer
2006). ..."
S. 342: "... Die Erinnerung an das »doch nicht so schlimm«
ist dann verschwunden, während die Erinnerung an das ursprüngliche
Erlebnis bestehen bleibt (Milad und Quirk 2002)."
S. 343: "Seit einigen Jahren ist bekannt, dass bei Ratten, die eine
Furchtkonditionierung erfahren, durch Injektion des Antibiotikums D-Cycloserin
eine radikale Auslöschung der Furchtkon- ditionierung erreicht werden
kann (vgl. Norberg et al. 2008). ..."
S. 343: "... Die gegenwärtige Befundlage über seine Wirksamkeit
ist aber uneinheitlich. Während einige Meta-Analysen durchaus Verstärkungseffekte
bei einer Expositionstherapie erkannten (vgl. Bontempo et al. 2012), konnten
andere Meta-Analysen keine signifikanten Effekte nachweisen (Myers und
Carlezon 2012)."
S. 343: "Experten der Furchtkonditionierung gehen sowohl bei der Ratte
als auch beim Menschen davon aus, dass die hemmenden Eingänge von
den »emotionalen« Hirnrinden- bereichen wie OFC und vmPFC auf
die basolaterale Amygdala durch die Gabe von Oxytocin und zumindest im
Tierversuch durch Cycloserin noch verstärkt werden (Wotjak und Pape
2013). ..."
S. 343f: "... Klaus Grawe schreibt zutreffend, dass eine Psychotherapie
niemals eine frühere Traumatisierung auslöscht, sondern vielmehr
die vorher zu schwache hemmende Wirkung corticaler Areale verstärkt.
Das Motto lautet: »Hemmung statt Ausradieren!« (Grawe 2004).
..." |
|
Der Hochstapler-Zitierstil
wurde leider von den US-Psycholo- genverbänden erfunden und setzt
sich mittlerweile auch in der Psychiatrie und in den Neurowissenschaften
mehr und mehr durch. Mit Wissenschaft hat das allerdings gar nichts zu
tun, insbesondere nicht mit vernünftigen Kommunikations- und
Ökonomieregeln. Das ist leicht einzusehen, wenn man das Beispiel des
Grawe-Zitates betrachtet:
"... Klaus Grawe schreibt zutreffend, dass eine Psychotherapie
niemals eine frühere Traumatisierung auslöscht,
sondern vielmehr die vorher zu schwache hemmende
Wirkung corticaler Areale verstärkt. Das Motto
lautet:
»Hemmung statt Ausradieren!« (Grawe 2004).
..."
Grawes Buch hat 509 Seiten. Um das Zitat und seine korrekte Verwendung
überprüfen zu können, kann schnell eine Stunde oder auch
noch mehr Zeit vergehen - falls das Zitat existiert.
In der Universitätsbibliothek Erlangen findet sich glücklicherweise
eine E-Book Version, die leichtes Suchen erlaubt. Die Suche nach "Hemmung
statt Ausradieren" führte zu keinem Treffer. "Ausradieren"
wird nur auf den Seiten 103, 108 angezeigt, aber nicht in dieser Wortkombination.
Allerdings wird der intentionale Sachverhalt Grawes von Roth & Strüber
richtig wiedergegeben, wenn auch völlig unzulänglich "zitiert".
Grawe schreibt auf S. 103: "Diese Überlegungen legen nahe, dass dem
Vorgang der Löschung der Aufbau einer aktiven
Hemmung zu Grunde liegt."
An dieser Stelle zeigt sich bereits bei Grawe, (mehr zur Löschung
S.
103f), dass einige grundlegende lerntheoretisch- neurowissen- schaftliche
Begriffe unklar sind wie z.B. eben Löschung, Lernen,
Vergessen u.a., was im nächsten Abschnitt noch einmal diskutiert
wird.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ |
__
9.2
Neurowissenschaftliche Beurteilung der Therapiewirkungsforschung
340f
(1) Das VT-Paradigma der »Löschung«
unangepasster Verknüpfungen 340
"... Obwohl die Löschung ein wichtiges Paradigma der VT darstellt,
liegen hierzu aber kaum neurobiologische Studien an Patienten oder Versuchspersonen
vor. Daher müssen wir die Gültigkeit dieser Aussage zumindest
teilweise anhand von experimentellen Untersuchungen an Tieren, meist Ratten
prüfen.
Bereits vor Jahren haben Experimente mit Furchtkonditio-
nierung an Ratten gezeigt, dass frühe negative Erfahrungen durch spätere
positive nicht gelöscht, sondern nur überlernt werden.
D.h., die alten Erfahrungen verschwinden nicht, sondern werden durch neue
»eingekapselt«. Wenn zum Beispiel Ratten in früher Jugend
in einem bestimmten Käfig furchtkonditioniert wurden und dann nach
zwei Jahren eines durchaus angenehmen Lebens in die Umgebung zurückgebracht
wurden, in der sie furchtkonditioniert worden waren, so reagierten sie
auf den furchtauslösenden Reiz so furchtsam wie beim ersten Mal. Die
frühe negative Erfahrung war also nicht vergessen (Fendt und Fanselow
1999; LeDoux 2000)." |
|
Ob tatsächlich alte Erfahrungen
grundsätzlich nicht "verschwin- den" können, ist derzeit eine
offene Frage. Darüber hinaus ist es lebenspraktisch auch gar nicht
wünschenswert, dass wichtige Erfahrungen "verschwinden". Ziel der
Therapie ist, dass konditionierte und letztlich nicht begründete Reaktionen
unwirksam gemacht werden. Das gelingt ja auch in erfolgreichen Verhaltenstherapien
wie Grawe (2004), S. 103 schreibt: "Eine erfolgreiche Verhaltenstherapie
baut dort neue Strukturen auf, welche die Angstreaktion schließlich
wirksam hemmen. Man kann dann durchaus davon sprechen, dass die Angstreaktion
beseitigt wurde, denn sie wird im Erleben und Verhalten nicht mehr spürbar
oder erkennbar, sondern sie kann nur noch über eine Messung der Hirnaktivität
nachgewiesen werden. Ohne solche Messung wüssten wir gar nichts davon,
dass doch noch Spuren der alten Angstbereitschaft da sind."
In diesem Zusammenhang wäre es weiter zu wünschen,
dass die neurobiologischen Forscher erklären, was sie unter "vergessen"
verstehen.
_
_
_ |
_
__
(2)
Das Paradigma der kognitiven Kontrolle und kognitiven Umstrukturierung
in der KVT 344
"Wie schon im vorangegangenen Kapitel angedeutet, baut die kognitive
Verhaltenstherapie oder kognitive Therapie auf dem Paradigma auf, dass
bei vielen psychischen Störungen eine Minderaktivität kognitiver
corticaler Strukturen, vornehmlich des dorsolateralen präfrontalen
Cortex (dlPFC) als Sitz von Einsicht und Verstand, vorliegt, deren Hauptfunktion
es ist, die oft »irrationale« Aktivität subcorticaler
Zentren wie der Amygdala, des Nucleus accumbens oder des Striatum insgesamt
zu zügeln. Zu erwarten wäre deshalb, dass man in den bildgebenden
Studien an Patienten mit Angststörungen, Depression, Zwangsstörungen
oder Phobien, bei denen die KVT oft zum Einsatz kommt, vor Beginn der Therapie
eine abnorm verminderte Aktivität des dlPFC und eine abnorm
erhöhte Aktivität der genannten subcorticalen Zentren findet." |
|
_
Die Behauptung, die kognitive Verhaltenstherapie und kognitive Therapie
baut "auf dem Paradigma auf, dass bei vielen psychischen Störungen
eine Minderaktivität kognitiver corticaler Strukturen ..." vorliegt,
wird nicht belegt.
Zunächst müsste gezeigt werden, dass eine bestimmte strukturelle
oder funktionelle neurobiologische Störung einer psychischen Störung
eindeutig zugeordnet werden kann. Erst dann könnte man sagen, dass
man ein neurobiologisches Kriterium hat, das zu den entsprechenden Aussagen
berechtigt.
Hier wird noch viel im Nebel gestochert, wobei die wichtige Frage,
dass falsche oder unzweckmäßige Programme, sich weder in einer
strukturellen oder funktionellen Veränderung offenbaren müssen,
noch nicht einmal thematisiert wird. Wie also könnte man unzweckmäßige
"Software" erkennen?_ |
_
(3)
Das Paradigma des Bewusstmachens unbewusster Inhalte in der Psychoanalyse
350
"Die zentrale These Freuds und vieler seiner Anhänger lautet,
dass das »Aufdecken« negativer Erlebnisse in früher Kindheit
und Jugend durch den Analytiker ein wesentlicher Bestandteil des Therapieerfolges
ist. Es ergeben sich hierbei allerdings zwei wichtige Probleme. Zum einen
ist nicht klar, auf welchen »Etagen« des seelischen Apparates
solche aufgedeckten Inhalte ursprünglich angesiedelt sind - der unbewussten,
der vorbewussten oder der bewussten Ebene? Wie bereits erwähnt, zeigt
eine genauere Analyse der entsprechenden Aussagen einschließlich
derjenigen von Freud in seinen »großen« Beiträgen
von 1915 und 1923 zum Verhältnis zwischen dem Unbewussten und dem
Bewussten, dass hier viele begriffliche Unklarheiten vorliegen. Das berühmte
Diktum: »Wo Es war, muss Ich werden«, kann im Lichte der »zweiten
Topik« (vgl. voriges Kapitel) nur so gedeutet werden, dass Freud
tatsächlich der Meinung war, die psychoanalytische Therapie könne
Unbewusstes zu Bewusstsein bringen, und so wird es auch heute noch in vielen
psychoanalytischen Abhandlungen dargestellt (für eine Übersicht
vgl. Benecke 2014). ..." |
|
Die Ausführungen machen deutlich,
dass die grundlegenden psychoanalytischen Konzepte neurobiologisch entweder
mangels Klarheit nicht überprüft werden können oder nicht
bestätigt werden konnten. Es ist aber auch nicht die Aufgabe der PsychoanalytikerInnen,
die neurobiologische Arbeit zu verrichten, hierzu sind sie, wie andere
PsychotherapeutInnen auch, nicht ausgebildet. Wenn NeurobiologInnen kein
"Vorbewusstes", keine Ich-Instanz oder "Verdrängung" finden können,
so spricht dies nicht unbedingt gegen die Konzepte, sondern es kann ebenso
gut am Unvermögen und Entwicklungsstand der Neurobiologie liegen.
Grundsätzlich ist auch an dieser Stelle festzuhalten, das PsychoanalytikerInnen
oder PsychotherapeutInnen ihre Wirksamkeit neurobiologisch nicht
nachweisen müssen, erst recht beim derzeitigen desolaten Zustand der
Neurowissenschaften hinsichtlich der psychosozialen Codierung. Entscheidend
sind die psychosozialen und psychopathologischen Kriterien und nicht neurobiologische
spekulative Phantasien, wie die vielen "könnte" im Text belegen.
_
_
_ |
_
| 9.3
Neurobiologische Interpretation der »therapeutischen Allianz«
355f
"Wie im vorangegangenen Kapitel dargestellt, scheint bei Psychotherapien
verschiedenster Ausrichtungen ein gemeinsamer Faktor zu wirken, nämlich
die
therapeutische Allianz, also das Vertrauensverhältnis zwischen
Patient und Therapeut. Man hat in diesem Zusammenhang lange Zeit abwertend
von einem »Placeboeffekt« im Sinne einer Scheinwirkung gesprochen.
Allerdings konnte vor einigen Jahren im Zusammenhang mit der Schmerzbehandlung
gezeigt werden, dass die Verabreichung eines pharmakologisch unwirksamen
Mittels (des Placebos) und die damit verbundene Minderung des Schmerzgefühls
auf realen neurobiologischen Prozessen beruht.
...
Es besteht kein Zweifel, dass freundliche, lobende oder
auf- munternde Worte, aber auch nichtverbale Kommunikation wie Blicke,
Gestik, Mimik und sanfte Berührungen die Ausschüttung »positiver«
neuroaktiver Substanzen wie etwa endogener Opioide, Serotonin und Oxytocin
auslösen können. Für eine solche Wirkung im Zusammenhang
mit der therapeutischen Allianz liegen inzwischen zahlreiche neurobiologische
Belege vor. So werden vertrauensvolle Interaktionen von Menschen, die sich
in irgendeiner Weise aneinander gebunden fühlen, im Gehirn von einer
Oxytocinausschüttung
begleitet (Crockford et al. 2014). Werden etwa Geheimnisse ausgetauscht,
so finden sich anschließend erhöhte Oxytocinkonzentrationen
im Blut (Kéri und Kiss 2011). Man kann davon ausgehen, dass auch
die Wirksamkeit der therapeutischen Allianz auf einer erhöhten Oxytocinfreisetzung
im Gehirn des depressiven Patienten beruht, und zwar aufgrund von dessen
Überzeugung, dass der Therapeut gewillt ist, ihm zu helfen, und über
eine wirksame Therapiemethode verfügt (s. voriges Kapitel). Die positive
Wirkung von Serotonin-Wiederaufnahmehemmern könnte teilweise ebenfalls
auf einer Oxytocinwirkung beruhen, denn sie stimulieren dessen Freisetzung
(s. Kapitel 7)." |
|
"Therapeutische Allianz" wird mit "Vertrauensverhältnis"
erklärt und nicht näher differenziert dargelegt, weder das Verständnis
"der" PsychotherapeutInnen noch "der" NeurobiologInnen. Die "therapeutische
Allianz" ist ein ziemlich komplexes Konstrukt, das sich nicht nur auf ein
Hormon reduzieren lässt.
Die einführenden Worte "freundliche, lobende oder auf- munternde
Worte" gehören auch eher zur therapeutischen Methodik der Motivierung
und Verstärkung. Roth & Strüber haben hier wohl eher die
therapeutische Beziehung im Blick, die zwar sehr wichtig für die therapeutische
Allianz, aber nicht mit ihr gleichzusetzen ist. Auch hier zeigt sich, wie
so oft, dass die NeurobiologInnen eine reduzierte, schlichte und ungenaue
Sprache sprechen, was sie anderen oft vorhalten (siehe oben: Psychoanalyse)
Oxytocinausschüttung mag - vor allem für die Bindungsbeziehung
- eine Rolle spielen, wie die Forschungsergebnisse nahelegen. Aber das
ist nur ein Aspekt. Therapeutische Allianz ist mehr, auch kognitiv
(unsere Therapievereinbarung umfasst z.B. zwei engzeilig beschriebene Seiten).
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ |
_
9.4
Was geschieht in der zweiten Therapiephase? 361f
"Klaus Grawe spricht in seiner Neuropsychotherapie von einem
»expliziten«, d.h. auf Worten beruhenden, und einem »impliziten«,
also auf nichtverbaler Interaktion gründenden Modus der Therapie,
wobei Letzterer seiner Meinung nach vornehmlich unbewusst wirkt. Freilich
sind hier die Begriffe »explizit« und »implizit«
nicht genau auf die erste und zweite Phase einer Therapie anzuwenden, denn
auch in der ersten Therapiephase läuft neben den notwendigen »expliziten«
Gesprächen zwischen Patient und Therapeut vieles nichtverbal-implizit
ab, etwa die gegenseitige Vertrauensbildung, und dadurch stellt sich ja
auch ganz wesentlich die für den ersten Therapieerfolg notwendige
positive Emotionalität her. In der zweiten Therapiephase liegt der
Schwerpunkt vornehmlich auf den impliziten Maßnahmen, da der Patient
jetzt - wenngleich explizit-verbal und implizit-nonverbal vom Therapeuten
angeleitet und betreut - selbst etwas tun muss, nämlich neue
Weisen des Fühlens, Denkens und Handelns einüben.
Ein Neu- und Umlernen ist aus neurobiologischer
Sicht nur zu Beginn an Aktivitäten des bewusstseinsfähigen Cortex
gebunden; danach vollzieht es sich nach dem Muster der Umbildung von
Gewohnheiten in den Ba[>362]salganglien. ..." |
|
Was die erste und die zweite Therapiephase sein soll, wird nicht genau
erklärt, obwohl Roth & Strüber Grawe merkwürdiger- weise
dafür kritisieren, dass sein Konzept expliziter und impliziter Therapie
nicht so recht auf die erste und zwei Therapiephase - eine Kreation von
Roth & Strüber? - passen. Auch in Grawes Neuropsychotherapie habe
keine Verständnishinweise gefunden. Was passiert genau? Roth &
Strüber zitieren eine erste und zweite Therapiephase, die sie nicht
näher erläutern, aber kritisieren, dass andere Begriffe, wie
explizit und implizit bei Grawe nicht gut dazu passen. Grawe hat sehr detaillierte
Regeln für die Therapieplanung (10; S. 434f) und den Therapieprozess
(12; 435-444). entwickelt, die Roth & Strüber in keiner Weise
angemessen wiedergeben oder gar neurobiologisch fundieren.
_
_
_
_
_
_
_ |
_
9.5
Was bedeuten diese Erkenntnisse für eine
»Neuropsychotherapie«? 365f
"»Neuropsychotherapie« kann nicht bedeuten, dass Neurobiologen
die Psychotherapie »feindlich übernehmen«, wie dies vor
einiger Zeit für eine »Neuropädagogik« in Hinblick
auf schulische Bildung propagiert wurde. Die Arbeit müssen die Psychotherapeuten
und die Patienten selbst leisten, und zwar im Rahmen einer therapeutischen
Allianz. Wie wir aber gese-[>366] hen haben, ist die Zuarbeit der Neurobiologie
im Sinne einer empirisch-experimentellen Grundlegung von Psychotherapie
unabdingbar.
Die wichtigste Aufgabe besteht darin zu erkennen,
welche
neuronalen Prozesse bei psychischen Erkrankungen gestört sind, und
zwar auf der Ebene der Neuromodulatoren, die hier entscheidend sind, und
zu überprüfen, was auf dieser Ebene und auf der hierauf aufbauenden
Ebene der Interaktion limbischer Zentren bei einer erfolgreichen Psychotherapie
geschieht. Ohne solche Erkenntnisse muss jede Psychotherapie ein Lernen
nach Versuch und Irrtum ohne tiefergehendes Verständnis von den Mechanismen
bleiben."_ |
|
Das ist eine starke Behauptung und Forderung:
"Wie wir aber gese-[>366] hen haben, ist die Zuarbeit der Neurobiologie
im Sinne einer empirisch-experimentellen Grundlegung von Psychotherapie
unabdingbar." Da mag dann ein Schuh daraus werden, wenn die NeurobiologInnen
das Einmaleins der Psychologie, Psychopathologe und Psychotherapie beherrschen
und berücksichtigen.
Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. Psychopathologie
ist die Wissenschaft vom gestörten Erleben und Verhalten. Psychotherapie
ist wissenschaftlich fundierte (evidenzbasierte) Praxis zur Heilung, Besserung,
Linderung oder Bewältigung von gestörtem Erleben und Verhalten.
Neurobiologie ist u.a. die Wissenschaft von der neurobiologischen Kodierung
und Fundierung des Erlebens und Verhaltens. Es ist keineswegs erforderlich,
dass Psychotherapie ihre Wirksamkeit neurobiologisch belegt, schon gar
nicht, wenn der Entwicklungsstand der Neurobiologie so dürftig ist
wie derzeit.
_
_ |
Zur
Neurobiologie von Tun und Lassen
Will man die neurobiologischen Grundlagen der Psychologie und Psychotherapie
untersuchen, stellt sich ganz allgemein die Frage der neurobiologischen
Grundlagen von Tun und Lassen. In der Lern- und Verhaltenstherapie hat
sich dabei die Löschung als zentraler Grundbegriff herausgestellt.
Zur Neurobiologie, Psychologie
und Psychotherapie der Loeschung
Der Löschbegriff ist vieldeutig. In der Verhaltenstheorie ist
damit meist die Idee verbunden, dass eine, gewöhnlich negative, Erfahrung,
z.B. eine Phobie, nicht mehr wirkt. Die Neurobiologie äußert
Zweifel, ob echtes Löschen im Sinne von ausradieren, zum vollständigen
Verschwinden bringen, möglich ist. Im Folgenden möchte ich zunächst
die vielfältigen Bedeutungen, Bedeutungsfelder und Spezifikationen
des Löschbegriffs erfassen.
Bedeutungen (Modelle)
des Loeschens
Loeschen im Alltagsleben
-
auflösen
-
Auftragungen entfernen, abwaschen
-
Durst löschen
-
entfernen (> etwas weg machen)
-
Erinnerung löschen (bewusst sehr schwierig)
-
Feuer löschen
-
ein Ladung löschen im Hafen (Güter von den Schiffen nehmen)
-
entleeren (Inhalt löschen)
-
ordnen (Unordnung löschen)
-
putzen
-
radieren
-
Schmerz löschen
-
sterben
-
vergehen
-
vergessen (vieldeutig)
-
waschen (Schmutz löschen)
-
weg machen
-
zerfallen
-
zerlegen
-
zerstören
-
...
Loeschen im Computer
Ob es tatsächliches Löschen im Sinne von "da ist nichts mehr"
in einem Computer gibt, ist gar nicht so einfach zu sagen. Hier muss man
aufpassen, dass man "nicht mehr dargestellt" oder "nicht mehr zugreifbar"
nicht mit "nicht mehr vorhanden" verwechselt.
-
Im Inhaltsverzeichnis des Betriebssystems freigeben zum Überschreiben
("Auslagerung in den Papierkorb")
-
Mit anderem Inhalt, z.B. Zufallszeichen, physikalisch überschreiben
-
Den Zugriff verunmöglichen
-
Verstecken durch Verlagern
-
Verstecken durch "unsichtbar" machen
Loeschen in der Lerntheorie
und Verhaltenstherapie
Ein nicht ganz klarer Grundbegriff der Lerntheorie und Verhaltenstherapie.
Praktisch und operational bedeutet Löschung, dass eine gelernte oder
erworbene Reaktion nicht mehr erfolgt.
Loeschen neurobiologisch
Doch was heißt löschen neurobiologisch? Es kann bedeuten:
-
dass eine neuronale Struktur zerfallen ist, nicht mehr existiert (in ihrer
funktional intakten Zusammensetzung).
-
dass ein Glied in der Reaktionskette nicht mehr zur Verfügung steht.
In diesem Modell ist die neuronale Struktur beschädigt, es fehlt ein
Stück.
-
dass bei Reizung keine Reaktion mehr erfolgt.
-
dass die gesamte Reaktionskette gehemmt wird. In diesem Modell ist die
neuronale Struktur noch vorhanden, in sich auch noch intakt, aber ihre
Ausführung wird behindert (Grawe, Roth).
Materialien zum
Loeschungsbegriff
Grawe (2004,
S. 103f) zur Loeschung "LeDoux (2001, 2002) vertritt dezidiert die
Auffassung, dass bei der Löschung einer Angstreaktion nicht die in
der Amygdala gespeicherte „implizite Erinnerung“ selbst ausgelöscht
wird, sondern dass die weiteren Auswirkungen dieser emotionalen Erinnerung
vom PFC gehemmt werden. „Unbewusste Furchterinnerungen, die von der Amygdala
gebildet wurden, scheinen unauslöschlich ins Gehirn eingebrannt zu
sein. Sie bleiben uns wahrscheinlich ein Leben lang erhalten“ (LeDoux,
2001, S. 272). Diese Auffassung wird außer durch LeDouxs eigenen
Untersuchungen auch durch die Ergebnisse einer Untersuchung von Gutberlet
und Miltner (1999) gestützt. Sie fanden, dass nach einer erfolgreichen
verhaltenstherapeutischen Behandlung einer Spinnenphobie zwar im Verhalten,
im subjektiven Gefühl und in autonomen Reaktionen (Hautleitfähigkeit
und Herzrate) bei der Konfrontation mit Spinnen keine Angstanzeichen mehr
auftraten, aber sich die mit EEG gemessene Hirnaktivivität (P3-Amplitude)
weiterhin so von der normaler Kontrollpersonen ohne Spinnenphobie unterschied
wie vor der Therapie. Die Autoren interpretieren dies so, dass der oben
angesprochene „schnelle“ Weg der direkten Amygdala-Aktivierung ohne cortikale
Vorverarbeitung des Reizes weiterhin aktivierbar bleibt, dass aber über
den „langsamen“ Weg eine cortikale Hemmung der weiteren Reaktionskette
erfolgt. Diese Hemmung geht wahrscheinlich vom orbitofrontalen Cortex aus.
Eine erfolgreiche Verhaltenstherapie baut dort neue Strukturen auf, welche
die Angstreaktion schließlich wirksam hemmen. Man kann dann durchaus
davon sprechen, dass die Angstreaktion beseitigt wurde, denn sie wird im
Erleben und Verhalten nicht mehr spürbar oder erkennbar, sondern sie
kann nur noch über eine Messung der Hirnaktivität nachgewiesen
werden. Ohne solche Messung wüssten wir gar nichts davon, dass doch
noch Spuren der alten Angstbereitschaft da sind.
Am gründlichsten hat sich LeDoux mit der Frage
auseinander gesetzt, was eigentlich genau bei der Löschung von Angstreaktionen
auf neuronaler Ebene geschieht. Er ist dabei auf eine sehr interessante
Beobachtung gestoßen, die mir von großer allgemeiner Bedeutung
zu sein scheint und die ich ihn deshalb in seinen eigenen Worten beschreiben
und erläutern lassen will:
„Ich hatte kürzlich ein wissenschaftliches Aha-Erlebnis, einen
dieser seltenen, wunderbaren Momente, wo man auf Grund neuer Laborergebnisse
einen Zusammenhang, der einem bis dahin ein Rätsel war, plötzlich
vollkommen durchschaut. Greg Quirk, Chris Repa und ich maßen die
elektrische Aktivität der Amygdala vor und nach der Konditionierung.
Nach der Konditionierung verstärkten sich die elektrischen Reaktionen
auf den CS, einen Ton, drastisch, und durch Löschung ging diese Steigerung
wieder zurück. Da wir aber die Aktivität vieler einzelner Neurone
maßen, konnten wir auch die Beziehungen zwischen den Zellen verfolgen.
Die funktionellen Wechselwirkungen zwischen Neuronen nahmen infolge der
Konditionierung zu, und die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Zellen gleichzeitig
feuerten, stieg drastisch an. Diese Wechselwirkungen äußerten
sich sowohl in der Reaktion auf den Reiz als auch darin, dass die Zellen
spontan feuerten, wenn nichts Besonderes geschah. Bei einigen dieser Zellen
– und das ist höchst bemerkenswert – gingen diese funktionellen Wechselwirkungen
nach der Löschung nicht zurück. Durch die Konditionierung waren
offenbar „Zellverbände“ entstanden, wie Donald Hebb sie nannte, und
einige davon schienen gegen Löschung resistent zu sein. Wenngleich
der Ton die Zellen nicht mehr zum Feuern veranlasste (sie waren gelöscht),
blieben die funktionellen Wechselwirkungen zwischen den Zellen, die sich
in ihrem spontanen Feuern äußerten, erhalten. Diese funktionellen
Kopplungen halten die Erinnerung offenbar auch dann noch fest, wenn die
äußeren Auslöser der Erinnerung (zum Beispiel phobische
Reize) nicht mehr die Erinnerung und das mit ihr verknüpfte Verhalten
(zum Beispiel phobische Reaktionen) aktivieren. Im Augenblick ist das noch
reine Spekulation, doch geben die Beobachtungen Hinweise darauf, wie die
Erinnerungen im Gehirn weiterleben können, während sie mit äußerlichen
Reizen nicht erreichbar sind. Um diese Erinnerungen zu reaktivieren, bräuchte
nur der Input zu den Zellverbänden verstärkt werden. Das leistet
möglicherweise der Stress.“ (LeDoux, 2001, S. 271/2)"
Im Lexikon der
Neurowissenschaften (2000) von Spektrum wird zur Löschung ausgeführt
(auch Online einsehbar):
"Extinktion
In der Physik bedeutet Extinktion die frequenz- bzw. stoffabhängige
Schwächung der Intensität einer Strahlung durch Absorption, Streuung
und Reflexion in bzw. an Materie, in der Biophysik speziell die Extinktion
eines durch eine Lösung geschickten Lichtstrahls bestimmter Wellenlänge.
Die Extinktion ist definiert durch die Gleichung: E = lg(I0/I), wobei I0
die Intensität des in eine Lösung einfallenden, I die des austretenden
Lichts ist. Eine Extinktion von 1 (bzw. 2) bedeutet somit, daß das
austretende Licht um den Faktor 10 (bzw. 100) geschwächt ist. Die
Konzentration c eines lichtabsorbierenden Stoffes, der in einer optisch
durchlässigen Flüssigkeit (Wasser, nichtaromatische organische
Lösungsmittel) gelöst ist, steht mit der Extinktion in dem Zusammenhang:
E = eM•c•d, wobei d der Lichtweg (cm) und eM der für jeden Stoff charakteristische
molare Extinktionskoeffizient ist (identisch mit der Extinktion bei der
Konzentration 1 Mol/l, gemessen bei einer Schichtdicke der Lösung
von 1 cm). Die Messung der Extinktion ist in der Biochemie ein wichtiges
Hilfsmittel zur quantitativen Bestimmung zahlreicher Biomoleküle,
besonders von Coenzymen (bei Enzymkinetiken), Proteinen (280 nm), Nucleotiden
und Nucleinsäuren (260 nm)."
Im Lexikon der Psychologie
von Spektrum wird ausgeführt (auch Online einsehbar):
"Löschung
Löschung, Form des instrumentellen Lernens: Dem Verhalten folgt
weder ein angenehmes noch ein unangenehmes Ereignis (Lernen)."
Loeschung
im Handwoerterbuch der Psychologie
3.2 Die vier Formen des instrumentellen Verhaltens
Nach der Art der Konsequenzen unterscheiden wir vier Formen des instrumentellen
Lernen:
1. Die positive Verstärkung: Dem Verhalten folgt ein positives
Ereignis.
2. Die negative Verstärkung: Dem Verhalten folgt das Verschwinden
eines aversiven (unangenehmen) Ereignisses.
3. Die Bestrafung: Dem Verhalten folgt ein unangenehmes Ereignis.
4. Die Löschung: Dem Verhalten folgt weder ein angenehmes noch
ein unangenehmes Ereignis. Die positive und die negative Verstärkung
führen zum Aufbau eines Verhaltens und die Bestrafung und Löschung
zum Abbau (Abb. 3).
3.3 Instrumentelles Verhalten als gewohnheitsmäßiges Verhalten
Instrumentelles Lernen findet nur statt, wenn der Lerner motiviert
ist, die spezifischen Konsequenzen herbeizuführen. Das routinemäßige
Verhalten kann mit unterschiedlichen Graden von Bewußtheit auftreten,
ist aber immer gesteuert von den Konsequenzen. ..."
[Lernen (Walter Edelmann): Handwörterbuch Psychologie, S. 1802
(vgl. HWB Psych., S. 394 ff.) (c) Psychologie Verlags Union
http://www.digitale-bibliothek.de/band23.htm ]
Exstinktionslernen
in Tiermodelle und translationale Forschung bei der Depression
Pryce, Christopher R.; Scharfetter, Christian; Cathomas, Flurin &
Seifritz, Erich (2012) Exstinktionslernen in Tiermodelle und translationale
Forschung bei der Depression. In (S. 604) Böker, Heinz & Seifritz,
Erich (2012. Hrsg.) Psychotherapie und Neurowissenschaften. Integration
- Kritik - Zukunftsaussichten. Bern: Huber.
"Extinktionslernen: Verschiedene Psychotherapietechniken, z.B.
die Verhaltenstherapie, die Kognitiv-behaviorale Therapie, die psychodynamische
Therapie oder die CBASP legen großen Wert auf die psychologische
und sogar physische Reexposition des depressiven Patienten mit jenen Stimuli
und Ereignissen die, gemäß der zugrundeliegenden Theorie zur
Entstehung der Depression beigetragen haben. Extinktionslernen ist ein
Begriff, der in der tierexperimentellen Psychologie gebraucht wird, um
den Prozess, bei dem durch die wiederholte Exposition gegenüber einem
emotional hervorstehenden Stimulus mit der gleichzeitigen Absenz eines
emotional auffälligen Ereignisses eine graduelle Reduktion in der
emotionalen Salienz des Stimulus und demzufolge der Antwort des Organismus
auf ihn erreicht wird. Extinktionslernen ist verbunden mit aversiven Stimuli
sowie mit Belohnungsstimuli. Die Extinktion von Stimulus-Stimulus Assoziationen,
welche durch die klassische Konditionierung erlernt wurde, geschieht, wenn
eine Exposition gegenüber einem explizit konditionierten Stimulus
(CS; z.B. Ton, Licht, Person) oder generellem Kontext aufhört, den
unkonditionierten Stimulus vorauszusagen. Eine Extinktion von Antwort-Stimulus-Assoziationen,
welche durch die operante Konditionierung erlernt wurde, tritt
auf, wenn eine Verhaltensantwort aufhört, der Beginn oder die Beendigung
des unkonditionierten Stimulus zu kontrollieren. Deshalb basiert das Prinzip
der Wiederexposition, welches in der Psychotherapie gebraucht wird, auf
dem Prinzip des Extinktionslernens. In Tierexperimenten von Emotionalität
wurde das Extinktionslernen am meisten in der Verbindung mit Furcht und
CS- und kontextkonditionierte, Erstarrungsverhalten studiert. Die Amygdala
ist entscheidend involviert in [>605] den Schaltkreis von Lernen, Gedächtnis
und Angst und die Projektion des präfrontalen Kortex zur Amygdala
ist essenziell in der Vermittlung von Furcht-Extinktionslernen (Phelps
et al., 2004; Maren, 2005; Herry et al, 2008). Eine relativ große
Expression von Furcht und Angst, assoziiert mit Amygdalahyperaktivität,
ist bei der Depression verbreitet (Fales et al., 2008). Ebenfalls könnte
eine hohe Reaktivität gegenüber furchtassoziierten Stimuli einen
Endophänotypen der Depression darstellen, wie dies bei der Assoziation
von genetischen Polymorphismen mit einem erhöhten Risiko für
die Entwicklung einer Depression beschrieben wurde (Hariri et al., 2002).
Deswegen ist das Studium der Furchtextinktion bei Nagetieren wichtig für
die Erforschung der Depression. Es ist ebenfalls bedeutend in Bezug auf
andere psychiatrische Erkrankungen wie Posttraumatische Belastungsstörung
und Phobien.
Eine interessante translationale Studie wurde zum
Thema Wirksamkeit der Kombination von Pharmakotherapie und Extinktionslernen
in der Behandlung der Angsterkrankung durchgeführt (Davis et al.,
2005). In der Ratte wurde eine Furchtkonditionierung mit einem Licht-CS
und einem Elektroschock (Tag 1) durchgeführt. Darauf wurde dieser
CS vor einem lauten Ton, welcher eine Schreckreaktion auslöste (Tag
2), verabreicht. Der CS verstärkte die Schreckreaktion, ein Verfahren,
das furchtpotenzierte Schreckreaktion genannt wird. Das Extinktionstraining
bestand aus der Präsentation des CS ohne Elektroschock (Tag 3). Vor
dem Extinktionstraining wurde den Ratten D-Cycloserin, ein Agonist des
Glutamat N-Methyl-D-Aspartat(NMDA)-Rezeptors, verabreicht, und zwar systemisch,
direkt in die Amygdala oder ein Placebovehikel. Am vierten Tag wurden die
Ratten wiederholt auf ihre furchtpotenzierte Schreckreaktion getestet.
D-Cycloserin verstärkte dososabhängig den Effekt des Extinktionstrainings,
was darauf hinweist, dass dieser Stoff das Extinktionslernen von furchtinduzierenden
Stimuli erhöht. Beim Menschen wurden Patienten mit Höhenangst
über mehrere Sitzungen einer virtuellen Höhensituation ausgesetzt.
Die Patienten haben vor jeder Sitzung entweder D-Cycloserin oder Placebo
erhalten. Expositionstherapie kombiniert mit D-Cycloserin resultierte in
einer größeren Reduktion von Höhenangstsymptomen als die
Expositionstherapie kombiniert mit einem Placebo. Es wird nun darum gehen,
in einem Tiermodell der Depression herauszufinden, ob eine sensorische
- aber nicht physisch schmerzhafte- Exposition gegenüber einem Stimulus
(z.B. ein aggressiver Artgenosse), der das depressionsähnliche Verhalten
hervorruft, zu einer Verminderung dieses Zustands durch Extinktion führt
und ob ein solcher Effekt pharmakologisch verstärkt werden kann."
Befunde und
Materialien der neurobiologischen Forschung zu psychotherapierelevanten
Themen (Auswahl)
_
Wie LSD das
Ich auflöst - Studie zur Gehirnaktivität unter Drogen
"Wenn Menschen die bewusstseinsverändernde
Droge LSD nehmen, empfinden manche eine Auflösung jeglicher Grenzen,
die sie von der Welt um sie herum trennen. Dieses Phänomen, auch als
„Ich-Auflösung“ bekannt, haben Wissenschaftler der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel (CAU) in Zusammenarbeit mit einem internationalen Forschungsteam
jetzt genauer untersucht und die ersten funktionellen Magnetresonanzbilder
(fMRI) von menschlichen Gehirnen unter LSD-Einfluss aufgenommen. Die Ergebnisse
dieser Studie sind jetzt in der internationalen Fachzeitschrift Current
Biology erschienen. ...
„Wir konnten feststellen,
dass unter Einfluss der Droge die Vernetzung von Regionen sogenannter höherer
Hirnfunktion signifikant zunimmt“, erklärt PD Dr. Helmut Laufs von
der Klinik für Neurologie der CAU. „Diese Hirnregionen entsprechen
genau den Bereichen, in denen sich die Rezeptoren befinden, die auf LSD
reagieren.“ Die Zunahme der Gesamtvernetzung im Gehirn unter LSD-Gabe entsprach
dem Grad der Ich-Auflösung, den die Probandinnen und Probanden berichteten.
Die Forscherinnen und Forscher
lokalisierten eine besonders starke Zunahme der Vernetzung innerhalb von
fronto-parietalen Hirnregionen, die führend verantwortlich sind für
die Ausbildung einer Selbstwahrnehmung. Insbesondere beobachteten sie eine
Zunahme der Kommunikation zwischen diesen Teilen des Gehirns und sensorischen
Arealen, die Informationen über die äußere Umgebung des
Körpers empfangen und sie für die weitere Verarbeitung anderen
Gehirnbereichen weitervermitteln. „Die Hirnscans der Probandinnen und Probanden
deuten darauf hin, dass LSD die Sinneseindrücke aus der Umwelt unmittelbarer
in die Selbstwahrnehmung miteinbeziehen lässt“, sagt der Erstautor
der Studie, Dr. Enzo Tagliazucchi, ehemals Institut für Medizinische
Psychologie und Medizinische Soziologie der CAU, jetzt an der Königlich
Niederländischen Akademie der Künste und Wissenschaften. „Dieses
Verschmelzen der Außenwelt mit der eigenen Innenwelt entspricht der
Bewusstseinsänderung unter LSD mit Ich-Auflösung.“ ...
Originalpublikation:
Enzo Tagliazucchi, Leor Roseman, Mendel Kaelen,
Csaba Orban, Suresh Muthukumraswamy, Kevin Murphy, Helmut Laufs, Robert
Leech, John McGonigle, Nicolas Crossle, Edward Bullmore, Tim Williams,
Mark Bolstridge, Amanda Feilding, David Nutt und Robin Carhart-Harris (2016)
Increased global functional connectivity correlates with LSD-induced ego-dissolution,
Current Biology." [änd 20.04.2016]
Anmerkung: Es wird kritisch
zu untersuchen sein, wie der Grad der Ich-Auflösung "gemessen" wurde
und was genau unter Ich-Auflösung" in dieser Studie zu verstehen ist.
Reizarme
Umgebungen und visueller Neocortex
Bock, Jörg & Braun, Katharina (2012) Prä- und postnatale
Stresserfahrungen und Gehirnentwicklung. In (150-164) Böker &
Seifert (2012) berichten S. 152: "... Beispielsweise besitzen Neurone im
visuellen Kortex von Ratten, die in einer reizarmen Umgebung aufgewachsen
waren, weniger Synapsen und dendritische Verzweigungen als Tiere, die in
einer abwechslungsreichen Umgebung aufwuchsen. Ähnliche Ergebnisse
brachten Untersuchungen im somato-sensorischen und motorischen Kortex von
Affen, die während der ersten sechs Lebensmonate in unterschiedlich
komplexen Umgebungen aufgezogen wurden. Auch hier besaßen die Neurone
bei den in reizarmer Umgebung aufgezogenen Jungtieren geringere Synapsendichten
(Bryan und Riesen, 1989)."
Stresserfahrungen
und limbisches System, Hippocampus, Amygdala und Präfrontalcortex
Bock, Jörg & Braun, Katharina (2012) Prä- und postnatale
Stresserfahrungen und Gehirnentwicklung. In (150-164) Böker &
Seifert (2012) berichten S. 152f:
"Umwelteinflüsse, die zu besonders auffälligen strukturellen
neuronalen Veränderungen führen, sind chronische und akute Stresserfahrungen
(zur Übersicht siehe McEwen, 2010; Bangasser und Shors, 2010). Als
Folge solcher Stresserfahrungen finden sich meist eine Abnahme der Länge
und Komplexität neuronaler Dendriten, eine Abnahme der Synapsendichte
und eine gestörte Neuroneogenese. Diese Veränderungen finden
sich vor allem in Regionen des limbischen Systems wie dem Hippocampus,
der Amygdala und auch dem Präfrontalkortex. Es wird allgemein angenommen,
dass dies zu einer eingeschränkten Funktionalität der betroffenen
Hinregionen führt.
Neben diesen Befunden an adulten Tieren belegen neuere tierexperimentelle
Untersuchungen, dass auch pränatale und postnatale Erfahrungs- und
Lernprozesse die noch jungen und wenig vernetzten Nervenzellen in ihrer
auf Hochtouren laufenden genetischen und molekularen «Maschinerie»
verändern und damit die Entstehung ihrer synaptischen Vernetzung beeinflussen
können. Dabei sind die durch Erfahrungs- und Lernprozesse im kindlichen
Gehirn ausgelösten strukturellen neuronalen Veränderungen meist
ausgeprägter und dauerhafter als bei Lernprozessen im erwachsenen
Gehirn.
9.3 Perinataler Stress als Ursache für veränderte oder «defekte»
neuronale Netzwerke?
Was passiert im Gehirn eines Jungtieres, wenn es zum ersten Mal im
Leben von seiner Familie getrennt wird, welche Hirnregionen sind besonders
betroffen und wie verändert sich deren Aktivität? Mithilfe von
bildgebenden Verfahren konnte an Degus (Octodon degus, Strauchratte)
nachgewiesen werden, dass [>153] während der Trennung von Eltern
und Geschwistern insbesondere die Regionen des limbischen Systems, der
cinguläre Kortex, Präfrontalkortex, Hippocampus und Thalamus
eine deutliche Reduktion des Hirnstoffwechsels zeigen. Diese akut auftretende
Reduktion der Hirnaktivität kann später chronisch werden und
ist damit ganz vergleichbar zu der präfrontalen Unteraktivierung,
die auch bei unter extremer Sozialdeprivation aufgewachsenen rumänischen
Waisenkindern nachgewiesen wurde (Chugani et al., 2001). Ähnlich verminderte
Präfrontalkortexaktivität finden sich auch bei einer Reihe psychischer
Störungen, wie z.B. Depression, Aufmerksamkeitsstörung (ADHD)
und Schizophrenie (Manoach, 2003; Rubia et al., 1999; Brower und Price,
2001)."
Planung
und Umsetzung experimenteller Paradigmen nach Kellermann & Habel
(2013)
Die Autoren führen hierzu vorab und allgemein S. 132 aus:
"Die Untersuchung mittels der fMRT konfrontiert den Versuchsleiter
aufgrund externer, aber auch interner methodischer Besonderheiten mit besonderen
Untersuchungsbedingungen. Dies darf aber nicht dazu verleiten, experimentalpsychologisch
wichtige Gütekriterien bei der Wahl und Umsetzung experimenteller
Paradigmen außer Acht zu lassen. Hier – wie auch in anderem Kontext
– beeinflusst die sorgfältige Wahl und Planung der Experimente sehr
wesentlich die Ergebnisse. Die Möglichkeiten der Stimulusvorgabe und
der Reaktionserfassung sollen im Folgenden vorgestellt und diskutiert werden.
Im Anschluss daran werden die charakteristischen Formen des experimentellen
Designs bei funktionell bildgebenden Untersuchungen erörtert. Allgemeine
Planungshinweise können nur einen groben Anhalt liefern; eine intensive
Beschäftigung mit inhaltlichen und methodischen Fragestellungen, den
Charakteristika des interessierenden Konstruktes sowie der Messmethode
ist bei der Realisierung experimentell valider funktioneller Magnetresonanzuntersuchungen
unerlässlich."
__
"Block- und Event-related-Design
nach nach Kellermann & Habel (2013)
Definition
Blockdesign (auch »boxcar« genannt): Experimentelles Design,
in dem die Stimuli in fester Zeitfolge und über längere Zeit
(ca. 10–30 s) präsentiert werden – unabhängig von subjektiven
Reaktionen. Jeder Block wird bei der Analyse als Einheit betrachtet,
sodass alle Stimulusvorgaben bzw. Aufgaben nur zu einer Bedingung gehören
sollten.
Definition
»Event related«-Design (»Single trial«-Design):
Experimentelles Design, bei dem die Zeit des Auftretens eines Stimulus
nicht festgelegt ist und bei dem die Stimulusvorgaben sehr kurz sind. Jeder
Stimulus/jede Aufgabe ist damit statistisch unabhängig von den vorhergehenden.
Um dies zu gewährleisten, müssen die verschiedenen Stimuli randomisiert
werden, sodass keine Antizipation möglich ist bzw. der nächste
Stimulus/die nächste Aufgabe nicht vorhersagbar ist." (S. 140)
__
Evaluation individueller
Veränderung (Nachtigall & Suhl 2004) "Zusammenfassung. Zur
Frage der Erfassung von intraindividuellen Therapieeffekten auf der Basis
von Prä- und Post-Messungen liegt eine Reihe von Lösungsvorschlägen
vor. Grawe und Braun (1994) schlugen als deskriptiven Kennwert die standardisierte
Post-Prä-Differenz vor. Mit der Kritischen Differenz nach Lienert
(1961) bzw. deren Umformulierung als Reliable Change Index (Jacobson &
Truax, 1991), existieren weit verbreitete inferenzielle Kennwerte. Diese
etablierten Kennwerte werden von Steyer, Hannöver, Telser und Kriebel
(1997) mit dem Argument kritisiert, dass die Unreliabilität der Messinstrumente
sowie Regressionseffekte nicht adäquat berücksichtigt seien.
Stattdessen werden dort alternative Kennwerte zur Erfassung intraindividueller
Veränderung vorgeschlagen. Der vorliegende Beitrag untersucht diese
Alternativen und vergleicht sie mit den etablierten Kennwerten. Es zeigt
sich, dass die alternativen Kennwerte mit großen Problemen sowohl
hinsichtlich der Einhaltung des ?-Fehlers als auch bei der Berücksichtigung
des Regressionseffektes behaftet sind, so dass von einer Verwendung abzuraten
ist."
__
Gerhard Roth (2015)
Krankes
Gehirn - kranke Seele? Neurobiologische Grundlagen psychischer Erkrankungen
und ihrer Therapie" Vortrag Symposium 2015 Turm der Sinne. Zusammenfassung:
"In jüngster Zeit ist es der Hirnforschung in enger Zusammenarbeit
mit Psychologie und Psychiatrie möglich geworden, plausible Antworten
auf die Fragen zu geben, wie innerhalb der Interaktion von Genen und Umwelt
das Psychische im Gehirn entsteht, wie sich unsere Persönlichkeit,
unser Ich und unsere Handlungsmotive formen, wie psychische Erkrankungen
entstehen und welches die Wirkungsweisen von Psychotherapien sind. Die
Mehrzahl der psychischen Erkrankungen einschließlich Persönlichkeitsstörungen
und gewalttätigen, antisozialen Verhaltens und Psychopathie geht auf
eine Kombination genetisch-epigenetischer Vorbelastungen und teils vorgeburtliche,
teils früh nachgeburtliche Störungen des Stressverarbeitungs-,
Selbstberuhigungs- und Bindungssystems zurück, die durch positive
oder negative spätere Erfahrungen verstärkt oder abgeschwächt
werden. Alle Arten von Psychotherapie haben als schnell wirkenden Hauptfaktor
die „therapeutische Allianz“, also der engen, vertrauensvollen Bindung
zwischen Patient und Therapeut. Demgegenüber ist – entgegen der jeweiligen
Selbstdarstellung – die Wirkung der unterschiedlichen Behandlungsweisen
wie kognitive Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse sekundär und je
nach Patient, Zeitpunkt, Art und Schwere der Erkrankung unterschiedlich
wirksam.
Literatur: Gerhard Roth und Nicole Strüber:
Wie das Gehirn die Seele macht. Klett-Cotta, Stuttgart, 2014."
__
Neurobiologie der bipolaren
Störungen (Lewitzka Bauer, 2011) "Zusammenfassung Die biologische
Forschung hat in den letzten Jahren wertvolle Erkenntnisse über die
Ursachen der bipolaren Störung geliefert. Studien über neurochemische
und molekularbiologische Veränderungen im Gehirn, strukturelle Auffälligkeiten
aber auch eine Vielzahl genetischer Untersuchungen konnten dabei das Wissen
zur bestehenden Annahme einer multifaktoriellen Genese vertiefen. Der Einfluss
psychosozialer Faktoren und neuropsychologischer Parameter stehen im Mittelpunkt
des Forschungsinteresses. Im folgenden Artikel werden die wesentlichen
neurobiologischen Forschungsergebnisse der letzten Jahre zusammengefasst.
Dabei liegt der Schwerpunkt auf molekularbiologischen und hirnmorphologischen
Veränderungen, die die Grundlage weiterer erfolgversprechender Ansätze
zukünftiger Forschung darstellen."
__
Abteilung
für neurowissenschaftliche Grundlagen der Psychotherapie Leitung:
Univ.-Prof. Dr. Giselher Guttmann
"Aufgabe Ein Verständnis für die biologischen Grundlagen
des psychischen Geschehens ist für jeden Psychotherapeuten, gleich
welcher Schule er angehört, von entscheidender Bedeutung. War es früher
lediglich die Hoffnung, durch eine Kenntnis der neuronalen Mechanismen
bessere Modellvorstellungen über den - normalen oder gestörten
- Ablauf psychischer Funktionen zu erhalten, hat die moderne Neurowissenschaft
völlig neue Zugänge zum Psychischen eröffnen können.
Bildgebende Verfahren ermöglichen in gewissem Sinn den lange ersehnten
„objektiven Blick ins Erleben“, durch den bisher strittige und schwer fassbare
Phänomene wie etwa Auswirkungen von affektiven Veränderungen
auf den kognitiven Bereich empirisch untersucht werden können. Diese
Arbeiten sind von hoher Praxisrelevanz. So lassen sich nun beispielsweise
geeignete physiologische Kennwerte zur Erfolgskontrolle einsetzen („therapiebegleitende
Psychophysiologie“) oder die Rückmeldung von Veränderungen biologischer
Funktionen als therapeutische Intervention („Biofeedback“) nützen.
Die Abteilung wird sich daher in Forschung und Lehre den für die Psychotherapie
relevanten Erkenntnissen der Kognitiven Neurowissenschaft widmen.
Lehre
Ziel der Ausbildung ist die Vermittlung der für die Psychotherapie
notwendigen Kenntnisse über die neuronalen Grundlagen des
Erlebens und Verhaltens.
-
Grundkenntnisse der funktionellen Anatomie des Nervensystems
-
Mechanismen der nervösen Erregungsleitung und Übertragung
-
Wirkmechanismen von Neurotransmittern und Psychopharmaka
-
Biologische Grundlagen von Lernen, Gedächtnis, Vergessen
-
Neurobiologie von Emotionalität, Angst
-
Neurohumorale Grundlagen von Motivations- und Triebzuständen
-
Zirkadiane Periodik – Schlaf- und Traumforschung
-
Bildgebende Verfahren – EEG, fMRI, PET
-
Psychoneuroimmunologie
-
Molekularbiologie und Genetik "
__
Neurobiologische
Grundlagen von Psychotherapie (Suslow & Arolt, 2010) S. 572: "...
Die Reduzierung einer Symptomatik stellt eines der Hauptziele von Psychotherapie
im Allgemeinen dar und kann als ein Maß aufgefasst werden, mittels
dessen der Erfolg von (kognitiven) Verhaltenstherapien bemessen werden
kann. Die Aufklärung der neuronalen Korrelate der Symptomreduktion
ist ohne Zweifel eines der primären Ziele und Herausforderungen der
Forschung zu den biologischen Grundlagen der Psychotherapie. Die reliable
Provokation von Kernsymptomen einer Störung im Rahmen der Bildgebungsuntersuchungen
ist in diesem Zusammenhang von hoher methodischer Bedeutung. Solche systematischen
Symptomprovokationen, z. B. durch gefürchtete Szenarien oder Stimuli,
ermöglichen einen Vergleich der zerebralen Antworten vor und nach
psychotherapeutischer Behandlung und damit eine Evaluation der Therapieeffekte
auf hirnfunktionelle Parameter."
__
Bildgebende
Befunde bei Sexualstraftaetern (Müller & Fromberger, 2010)
"Zusammenfassung Sexualstraftaten sind heterogen motiviert. Verstärkt
in jüngerer Zeit wurden neurobiologische Veränderungen
auch bei Sexualstraftätern untersucht. Dabei fanden
sich strukturelle und funktionelle Veränderungen in kortikalen
und subkortikalen Hirnarealen bei verschiedenen Tätergruppen. Es wird
eine Übersicht über die Literatur zu neurobiologischen Veränderungen
bei Sexualstraftätern gegeben. Insbesondere wird die Notwendigkeit
einer differenziert auch neurobiologisch fundierten Diagnostik hervorgehoben."
__
Schlecht
verbunden: Mangelhafte Neuvernetzung des Gehirns mögliche Ursache
von Depression (2015)
"Forscher des Universitätsklinikums Freiburg haben eine mögliche
Ursache gefunden, die depressiven Episoden im Gehirn zugrunde liegt. In
einer Studie im Fachmagazin ‚Neuropsychopharmacology’ wiesen sie nach,
dass sich Nervenzellen im Gehirn während der depressiven Episoden
langsamer neu vernetzen – und sich damit das Gehirn schlechter an neue
Reize anpassen kann. Mit dieser als synaptische Plastizität bezeichneten
verminderten Anpassungsfähigkeit lassen sich viele Symptome einer
Depression erklären. Die Erkenntnisse könnten die gezielte Suche
nach neuen Therapien ermöglichen. Weitere Entwicklungen könnten
den Grundstein für eine objektivere Depressions-Diagnostik legen."
Linkmerkmale: idw-online-news641847
__
Der Geist als
komplexes Quantensystem
Koncsik, Imre (2015) Der Geist als komplexes Quantensystem. Interdisziplinäre
Skizze einer Theory of Mind. Springer. Abstract: "Imre Koncsik beschreibt
die Theorie des Geistes als naturphilosophische Theorie auf Basis der Physik.
Er identifiziert signifikante Parallelen zwischen Geist und Gehirn, die
beide durch Elemente der Quantentheorie und der komplexen Systemtheorie
beschrieben werden können. Beide Theorien beziehen sich auf eine immaterielle,
formale und imaginäre Schicht der Realität. Sie ermöglichen
eine innovative Beschreibung der morphologischen Strukturen und dynamischen
Aktivitätsmuster des Gehirns in Analogie zu Mustern des Geistes. Eine
Theorie des Geistes bildet hinsichtlich ihrer technologischen Applikation
den Grundstein einer neuen, im eigentlichen Sinn „intelligenten“ Technologie:
der quantenbasierten Systemtechnologie."
__
Bewusstsein und
optimierter Wille
Pfützner, Helmut (2014) Bewusstsein und optimierter Wille Freier
/ optimierter Wille aus Sicht eines Biophysikers. Springer. Abstract: "Das
Fehlen freien Willens – so die Sorge der Dualisten - entwürdigt den
Menschen. Der Text belegt das Gegenteil: das Fehlen macht den Menschen
robust und verlässlich. Dazu entwirft das Buch ein auf schrittweise
optimierenden Vorgängen basierendes biophysikalisches Iterations-Modell,
das die elementaren Funktionen des Gehirns in konsequenter Weise interpretiert.
Aus nüchterner Sicht der Biophysik ist es hohe Konzentration von spezifischen
Neuronen, die das höchst physische Phänomen des Bewusstseins
entstehen lässt. Voraussetzung dafür ist, dass "Vehemenz" des
Denkens aufkommt. Bewusstsein ist kein Produkt der Evolution, sondern ein
den Naturgesetzen a priori zugegebener Faktor. Der ist zwar beschreibbar,
doch nicht erklärbar – ebenso wenig wie Magnetismus oder Gravitation.
An die Stelle von „freiem“ Willen rückt „optimierter“ Wille: Das von
Ererbtem und Erworbenem geprägte Ich bestimmt das Handeln und Denken
in optimierter Weise, gemeinsam mit Einflüssen der Umwelt."
Wissenschaftlicher
Apparat
Literatur (Auswahl)
-
Amerbauer, Martin () Erste Schritte in der Philosophie. Einheit 7:
Körper und Geist (PDF im Internet)
-
Arolt, Volker & Kersting, Anette (2010, Hrsg.) Psychotherapie in der
Psychiatrie. Welche Störung behandelt man wie?
-
Behl, Christian et al. (2008) Neurobiologie psychischer Störungen
In (236-340) Holsboer, Florian; Gründer, Gerhard & Benkert, Otto
(2008, Hrsg.) [v]
-
Bertram, W. (2009) Neurobiologie, Psychotherapie und Psychosomatik. Ärztliche
Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, 4, 4, 197-198. [v]
-
Böker, Heinz & Seidritz, Eric (2012, Hrsg.) Psychotherapie und
Neurowissenschaften. Bern: Huber.
-
Brühl, Annette Beatrix; Herwig, Uwe; Rufer, Michael & Weidt, Steffi
(2015) Neurowissenschaftliche Befunde zur Psychotherapie von Angststörungen.
Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 63(2),
109-116.
-
Förstl, Hans; Hautzinger, Martin & Roth, Gerhard (2006,
Hrsg.) Neurobiologie psychischer Störungen. Heidelberg: Springer.
[v]
-
Grawe, Klaus (2004) Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe.
-
Gründer, Gerhard () Positronen- und Einzelphotonenemissionstomographie
In (416-425) Holsboer, Florian; Gründer, Gerhard & Benkert, Otto
(2008, Hrsg.)
-
Hanser, Ludwig (2000, PL). Lexikon der Neurowissenschaft. 4 Bde. incl.
1 Erg. Bd. m. Register. Heidelberg: Spektrum.
-
Hebb, Donald O. (dt. 1967) Einführung in die moderne Psychologie.
Weinheim: Beltz.
-
Hebb, (1949) The Organization of Behavior. New-York: Wiley.
-
Holsboer, Florian; Gründer, Gerhard & Benkert, Otto (2008, Hrsg.)
Handbuch der Psychopharmakotherapie. Heidelberg: Springer. [v]
-
Jacobs, Stefan (2009, Hrsg.) Neurowissenschaften und Traumatherapie: Grundlagen
und Behandlungskonzepte. Universitätsverlag Göttingen. [v]
-
Jäncke, Lutz (2013) Lehrbuch kognitive Neurowissenschaften. Bern:
Huber.
-
Kandel & Hawkins (1992) "Molekulare Grundlagen des Lernens", Spektrum
der Wissenschaft, 66-76.
-
Kandel, Eric (dt. 22009) Auf der Suche nach dem Gedächtnis.
Die Entstehung einer neuen Wissenschaft des Geistes. München: Goldmann.
-
Karnath, Hans-Otto & Thier, Peter (2012, Hrsg.) Kognitive Neurowissenschaften.
Heidelberg: Springer. [v]
-
Kellermann, T. & Habel, U. (2013) Planung und Umsetzung experimenteller
Paradigmen. In (131-150) Schneider, Frank & Fink, Gereon R. (2013,
Hrsg.).
-
Schröger, E., & Koelsch, S. (2013, Hrsg.) Affektive und kognitive
Neurowissenschaften. Göttingen: Hogrefe.
-
LeDoux, J. E. (2003, engl. 2002) Das Netz der Persönlichkeit. Wie
unser Selbst entsteht. Düsseldorf: Walter.
-
LeDoux, J. E. (2001, engl. 1996) Im Netz der Gefühle. Wie Emotionen
entstehen. München: dtv.
-
Lehrner, Johann; Pusswald, Gisela; Fertl, Elisabeth (2006,
Hrsg.): Klinische Neuropsychologie. Heidelberg: Springer.
-
Lewitzka, U. & Bauer, M. (2011) Neurobiologie der bipolaren Störungen.
Nervenheilkunde, 849-948. [Zusammenfassung]
-
Nachtigall, Christof & Suhl, Ute (2004) Evaluation individueller Veränderung.
Ein Vergleich verschiedener Veränderungskennwerte. Zeitschrift für
Klinische Psychologie und Psychotherapie (2005), 34, pp. 241-247. [Zusammenfassung]
-
Lovric, Damir (2014) Neurowissenschaftliche Aspekte der therapeutischen
Beziehung. Psychotherapie-Wissenschaft 4,1. [Online]
-
Müller, Jürgen L. & Fromberger, Peter (2010) Bildgebende
Befunde bei Sexualstraftätern. Forens Psychiatr Psychol Kriminol (2010)
4 (suppl 1), 3–7 [v]
-
Rohracher, Hubert (1988) Einführung in die Psychologie. 13.
Auflage. München: PVU.
-
Rösler, Frank (2011) Psychophysiologie der Kognition. Eine Einführung
in die Kognitive Neurowissenschaft. Heidelberg: Spektrum. [v]
-
Roth, Gerhard (1997) Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive
Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt aM: Suhrkamp.
-
Roth, Gerhard (2008) Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten.
Warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern - Aktualisierte
Neuauflage. Stuttgart: Klett-Cotta.
-
Roth, Gerhard (2010) Wie einzigartig ist der Mensch? Die lange Evolution
der Gehirne und des Geistes. Heidelberg: Springer.
-
Roth, Gerhard & Strüber, Nicole (2014) Wie das Gehirn die Seele
macht. Stuttgart: Klett-Cotta.
-
Roth, Gerhard (2015) Krankes Gehirn - kranke Seele? Neurobiologische Grundlagen
psychischer Erkrankungen und ihrer Therapie. Vortrag Symposium 2015 Turm
der Sinne. [Zusammenfassung]
-
Schiepek, Günter & Tschacher, Wolfgang (1997, Hrsg.) Selbstorganisation
in Psychologie und Psychiatrie. Vieweg+Teubner.
-
Schiepek, Günter & Haken, Hermann (2010, Hrsg.) Neurobiologie
der Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer. [Im SR fehlen Einträge
wie Bahnen; Exstinction, Löschen]
-
Schneider, Frank & Fink, Gereon R. (2013, Hrsg.) Funktionelle MRT in
Psychiatrie und Neurologie. Heidelberg: Spektrum. [v]
-
Schlösser, Ralf & Koch, Kathrin (2008) Magnetresonanzverfahren.
In (400-411) Holsboer, Florian; Gründer, Gerhard & Benkert, Otto
(2008, Hrsg.) Handbuch der Psychopharmakotherapie. Heidelberg: Springer.
[v]
-
Seifritz, Erich & Böker, Heinz (2012) Psychotherapie
und Neurowissenschaften Bern: Huber.
-
Sponsel, R. (1984). Lebens-
und Selbstzufriedenheit als Psychotherapieerfolgskontrolle. Praktische
Systematik psychologischer Behandlungsforschung. Dissertation, Erlangen:
IEC-Verlag. Gebundene Sonderausgabe (Ist im CST-SYSTEM enthalten.)
-
Literaturhinweis:
In Sponsel 1995 werden
S. 193 - 200 die meisten potentiellen psychologischen Heilmittel (neudeutsch:
Heilwirkfaktoren) gelistet und ca. 180 - das sind längst nicht alle
- in der Literatur beschriebenen Heilmittel S. 387 - 404 dokumentiert.
-
Suslow Thomas & Arolt, Volker (2010) Neurobiologische Grundlagen
von Psychotherapie. In (563-575) Arolt, Volker & Kersting, Anette (2010
, Hrsg.) Psychotherapie in der Psychiatrie. Welche Störung behandelt
man wie?_
-
Yang, G.; Lai, CS; Cichon, J; Ma, L; Li, W. &
Gan, WB (2014) Sleep promotes branch-specific formation of dendritic spines
after learning. Science, 344 (6188), 2014: 1173–1178.
-
Zeier, Hans (1976) Wörterbuch der Lerntheorien
und der Verhaltenstherapie. München: Kindler.
_
Zeitschriften mit neurowissenschaftlichen
Beiträgen > Übersicht
bei Wikipedia. Weitere:
-
Cognitive Science
-
Journal of Clinical Psychiatry
-
Nervenarzt
-
Neurobiology
-
Neurocase
-
Sciences
Glossar,
Anmerkungen und Endnoten:
GIPT=
General
and Integrative
Psychotherapy, internationale Bezeichnung
für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Stichworte (teilweise aus anderen ip-gipt-Seiten):
* Abrufen *
Abspaltung
(Dissoziation) * Abwehr,
Abwehrmechanismen, Neutralisationsmechanismen * Abwesend
(Geistesabwesenheit) * affektiv,
Affekt, affektiver Apparat * Achromatopsie
* adaptives Gedaechtnis * Aktionspotential
* Amygdala (Mandelkern) * Amnesie
* Anatomie der Bewusstseinsstrukturen
* Anfall * Anfallsleiden
* ARAS * Arbeitsgedaechtnis
* Assoziieren, Assoziation * Assoziatives
Gedaechtnis * Attraktor * Aufmerksam,
Aufmerksamkeit * Aufmerksamkeitslenkung
* Auf der Zunge liegen * Aufwachen
* Aura * Axon * Bahnen
* Benommen, Benommenheit *
Bewusst,
Bewusstheit * Bewusstsein * Bewusstseinseinengung
* Bewusstseinslenkung * Bewusstlos
* Bewusstseinsspaltung * Bewusstseinsspanne
* Bewusstseinsstrom * Bewusstseinsstrom
(James), Kritik
* Bewusstseinssupervision *
Bewusstseinstrübung
* Bewusstseinszustand * Bildgebende
Verfahren * Blinder Fleck * Brain
fingerprint * Brainstorming * CT
*
Dämmerzustand
* Delirium * Deklaratives
Gedaechtnis * Denken * Depolarisation
* Dopamin * Dissoziation
* Dösen * Echo Gedaechtnis
* EEG * Empfindung * Engramm
* Enkodieren * Entscheidung:
Libet-Versuch,
Haynes-Versuch * Epiphämomen
Epiphänomenalismus * Episodisch-autobiographisches
Gedaechtnis * Episodisches Gedaechtnis
* EPSP Exzitatorisches
Postsynaptisches Potential * Erinnern * Erleben
* Explizites Gedaechtnis * Exposition
* Fokussieren * Formatio
reticularis * Funktion * Funktionsbereiche
* Ganzes * Ganzheiten *
Gedanken
* Gedankenabreißen * Gedankensperrung
* Gedankenstopp * Gedaechtnis:
Einzelfaelle
(gedächtnisrelevante): Naomi Jacobs,
Clive
Wearing, H.M. ,
William O.
* Gedaechtnishemmungen * Genschere
* Gestalt * Grenzzustände
* Genexpression * Gesetz
der Uebung * Gesichtererkennung
* Gewohnheit * habit * Habituation
* Halluzination * Hebbsche
Lernregel * Hellsehen * Hellsichtig
* Hemmung * Hippocampus
* Hirnstamm * Hypnoid
* Ich-Bewusstsein * Ich-Erleben
* Identität * Identitaets-Bewusstsein
* Identitaetstheorie Leib-Seele-Geist
* Ikonischer Speicher * Implizites
Gedaechtnis * Indexieren * Isocortex
* Katalepsie, kataleptisch * Katatonie,
kataton * Kausalität * Klarheit
* Kollektives Bewusstsein * Koma
* Konsolidierung * Konzentration
* Krankheit,
Krankheitsbegriff, Krankheitsmodelle * Kurzzeitgedaechtnis
* Langzeitgedaechtnis * Lenkung,
Regelung oder Steuerung * Löschen
* LTD Langzeitdepression *
LTP
Langzeitpotenzierung * Lucid traeumen
* Markowitsch * Meditation
* Mentales Training * Modul,
Modularität * Molekulare
Mechanismen von Lernen und Gedaechtnis * MRT * Muede,
Muedigkeit * Multiple
Persönlichkeit(en) * Mustererkennung
* Mutismus * Nahtoderfahrung
* Narkose * Narkolepsie
* narrative Form * natcode
* NCC * Nervenzellen
* Neurogenese * Neuromathematik
* Neuronales Netzwerk * Neuroplastizitaet
* Neurotransmitter * Normalbedingungen
* Ohnmacht * Oneiroid *
P300
* Pareidolie * Penfield
* PET * Prosopagnosie *
Prozedurales
Gedaechtnis * relationales Gedaechtnis
* Schlaf * Schlaefrig *
Schlafstoerungen
* Schlafwandeln * Schwindel
* Selbst * Selbstorganisation
* Semantisches Gedaechtnis * Semiotisch-Terminologisches*
Skript
* Somnambul * Somnolenz
* Sonderzustände * Sopor
* Sperrung *
Striatum *
Stupor
* Synapse * Synaptische
Plastizitaet im Hippocampus * Synergetik
* Synkope * Tagtraum * Teil
* Temporallappen * Transienten
* Trance * Traum * Tunnelblick
*
Ultrakurzzeitgedaechtnis * Unbewusstes
* Verbinden * Verdrängen
* Vergessen * Verwirrt,
Verwirrung * Verzueckung * Vigilanz
* Vorbewusstes * Vorstellung,
vorstellen * Wach, Wachheit * Wachkoma
* Wachtraum * Wahrnehmung
* Wecken * Wissensgedaechtnis
* Wissenssystem * Zeitschriften
Gedaechtnis * Zerstreut * Zustand
*
__
Abrufen
Grundlegende Funktion des Gedächtnisses, über die im Detail
wenig bekannt ist (> erinnern).
-
Abrufen einer Fähigkeit oder Fertigkeit
-
Abrufen einer Erinnerung
-
Abrufen eines Gedaechtnisinhaltes
__
Abspaltung (Dissoziation) Wichtiger
seelischer Mechanismus, Sachverhalte zu trennen und wegzublenden. > Abwehr-
und Neutralisationsmechanismen. Die psychologische Elementarfunktion ist
das Trennen (Gegensatz: verbinden).
__
Abwehr,
Abwehrmechanismen, Neutralisationsmechanismen.
__
Abwesend (Geistesabwesenheit)
alltägliche
Variante einer Trance.
__
affektiv, Affekt,
affektiver Apparat Im engeren Sinne heftigere Gemütsbewegungen.
Im weiteren Sinne gehört zum affektiven Apparat alles, was gefühls-
oder wertbesetzt ist: Wünsche, Wollen, Gefühle, Stimmungen, Bedürfnisse,
Motive, Ziele, Werte.
__
Achromatopsie Verlust Farben oder
bestimmte Formen sehen und sich vorstellen zu können.
__
adaptives Gedaechtnis
Bear et al. (2009), S. : "Temporallappen und adaptives Gedächtnis"
__
Aktionspotential [W]
__
Amygdala (Mandelkern)
Wichtig für die emotionale Bedeutung von Ereignissen und die Langzeitspeicherung.
__
Amnesie Gedächtnisverlust;
vor (retrograde) oder nach (anterograde) einem (traumatischen) Ereignis.
__
Anatomie der Bewusstseinsstrukturen
-
Hirnstamm [W]
-
Medula oblongata (verlängertes Rückenmark) [W]
-
Formatio reticualris [W]
__
Anfall plötzliches, meist unangenehm
erlebtes Ereignis oder Geschehen.
__
Anfallsleiden z.B. Ohnmacht, Epilepsie,
Migräne, Wut, Essanfälle, Trinkanfälle (Dipsomanie).
__
ARAS aufstrebendes retikuläres Aktivierung
System, wichtige Region für "das" Bewusstsein. [W]
__
Arbeitsgedaechtnis
Nach Roth (2003), S. 159f : "Das Arbeitsgedächtnis hält für
wenige Sekunden einen bestimmten Teil der Wahrnehmungen und die hiermit
verbundenen Gedächtnisinhalte und Vorstellungen im Bewusstsein fest
und konstituiert dadurch den typischen »Strom des Bewusstseins«.
Man nimmt an, dass das Arbeitsgedächtnis Zugriff auf die unterschiedlichen,
in aller Regel unbewusst arbeitenden Systeme für Sinnes- und Gedächtnisleistungen
und für die Handlungssteuerung hat und nach bestimmten Kriterien Informationen
aus diesen Systemen »einlädt«; diese werden dann aktuell
bewusst. Auch das Arbeitsgedächtnis ist modulartig aufgebaut; dies
zeigt sich daran, dass wir verschiedene Elemente umso besser für kurze
Zeit in unserem Gedächtnis behalten können, je unähnlicher
sie in ihren physikalischen Eigenschaften und ihren Inhalten sind. Während
ich vom Telefonbuch zum Telefon gehe, kann ich meine Wohnungseinrichtung
oberflächlich betrachten, ohne die nachgeschlagene Telefonnummer zu
vergessen. Wird mir jedoch dabei zufällig eine zweite Telefonnummer
zugerufen, so ist die erste meist unweigerlich fort.
Das Arbeitsgedächtnis bildet den berüchtigten »Flaschenhals«
unseres Kurzzeitgedächtnisses; es ist für die berühmten
»fünf plus/ minus zwei« Elemente von N. Miller verantwortlich,
die wir gleichzeitig im Bewusstsein behalten und mit denen wir aktuell
arbeiten können (daher der Ausdruck »Arbeitsgedächtnis«).
Dabei handelt es sich allerdings nicht nur um fünf (plus/minus zwei)
Namen oder Zahlen, sondern um Bedeutungseinheiten, was dazu führt,
dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses erheblich erweitert
werden kann, wenn wir bestimmte Sachverhalte zu einfachen Bedeutungseinheiten
zusammenfassen (englisch chunking genannt) oder mithilfe von »Eselsbrücken«
verbinden können (z. B. eine räumliche Anordnung abstrakter Dinge).
Umstritten ist allerdings, ob diese Enge, Beschränkung und Langsamkeit
aus der begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses selber
herrührt oder aus der zeitlichen und/oder inhalt-[>160] licher Beschränktheit
des Zugriffs und Abrufens von Informationen aus den Sinnes-, Gedächtnis-
und Handlungssteuerungssystemen."
__
Assoziieren, Assoziation
Grundbegriff
der Verbindung von Elementen. Als Brainstormingstechnik
freie Einfälle erzeugen.
__
Assoziatives Gedaechtnis
unklarer
Gedächtnisbegriff. Im Lexikon der Neurowissenschaft erscheint der
Ausdruck im Abschnitt "Verteiltes Gedächtnis in neuronalen Ensembles":
"Die entscheidende Grundlage für die Speicherung und Reaktivierung
von Gedächtnisinhalten in Nervenverbänden sind die Synapsen.
Jedes Neuron ist mit anderen Neuronen über bis zu 10000 solcher Kontaktstellen
verbunden. Diese Verknüpfung ist nicht starr, sondern relativ flexibel.
Dadurch können in der Entwicklung Störungen kompensiert werden,
aber auch einschneidende Prägungen erfolgen. Bis ins hohe Alter bleiben
Stärke und Art der Kontakte veränderbar und sind die entscheidende
Voraussetzung für Lernen und Gedächtnis. Mittlerweile sind schon
viele Details der biochemischen, cytologischen und morphologischen Veränderungen
bekannt, die der Gedächtnisbildung zugrunde liegen. Maßgeblich
für das assoziative Gedächtnis scheint insbesondere die Langzeitpotenzierung
zu sein, bei der verschiedene Reize durch synaptische Modifikationen miteinander
verknüpft werden." [Online gedaechtnis/4050"]
__
Attraktor Wichtiger Begriff dynamischer
Systeme.
__
Aufmerksam,
Aufmerksamkeit Elementarfunktion, die man dem Bewusstsein
zuordnen kann, die aber nicht unbedingt auf Bewusstheit beschränkt
ist.
__
Aufmerksamkeitslenkung Alltägliches
ständiges Tun, ohne dass es besonders bewusst ist. Man macht es dauernd,
aber man bemerkt es meistens nicht. Das ist gut so, weil es sonst natürlich
stört. Es ist aber jederzeit möglich, seine Aufmerksamkeit ganz
gezielt zu lenken (wichtig für das Mentale Training oder Bewusstseinslenkung)
__
Auf der Zunge liegen Vorübergehend
erschwerter Gedächtniszugriff mit dem Gefühl, dem Gesuchten ganz
nahe zu sein. Am besten das Gesuchte nicht verbissen erzwingen wollen,
sondern sich anderem zuwenden. Oft fällt es einem danach plötzlich
ein. [, SPON,
11.9.13, Gehirn und Geist 21.6.12, BdW
23.11.6, dS
17.8.5, ]
__
Aufwachen alltägliche Erfahrung
vom Bewusstseinszustand Schlaf in den Bewusstseinszustand Wach
zu gelangen. Hierbei gibt es Grenzübergänge (halb wach, noch
nicht ganz wach). Aufwachen über einen Wecker liefert einen Alltagsbeweis,
dass es nicht bewusste Wahrnehmung gibt.
__
Aura Vorstadium (Ankündigung)
eines nahenden Anfalls (Epilepsie, Migräne)
__
Autobiografisches Gedaechtnis
(selbsterklärende Namensgebung): Die Universität Bielefeld führt
hierzu aus: "Das autobiographische Gedächtnis stellt eines der fünf
Langzeitgedächtnissysteme dar. Es ist das komplexeste Gedächtnissystem.
Zu den wichtigen Merkmalen dieses Systems zählt die Tatsache, dass
die autobiographischen Inhalte in die Dimensionen von Zeit und Ort eingebettet
sind und weiterhin, dass diese Inhalte an das Bewusstsein und die Selbstreflexion
gekoppelt sind. Eine autobiographische Erinnerung ist also immer
verbunden mit der Erinnerung an einen Ort und einen bestimmten Zeitpunkt,
an dem das persönliche Erlebnis stattgefunden hat.
Das autobiographische Gedächtnissystem ist
weiterhin stets an emotionale, affektbezogene Inhalte gebunden und erlaubt
uns dadurch, die persönliche Vergangenheit zu erinnern. Beispiele
für autobiographische Erinnerungen sind der erste Schultag, das Abitur,
die eigene Hochzeit u.ä.. Häufig erinnern wir uns an besonders
schöne, fröhliche oder besonders traurige Erlebnisse." [Abruf
16.04.2016]
Anmerkung immer: Ich habe Zweifel, ob
diese starke Generalisierung tatsächlich immer gilt oder ob man stattdessen
nicht besser sagen sollte in der Regel.
__
Axon [W]
Verbindungsteil (Band, Schlauch, Ast) eines Neurons zu anderen.
__
Bahnen
Wichtiger neurophysiologischer Begriff. Er bedeutet so viel wie einen
Weg eröffnen, eine Information wird z.B. von einem Ort A zu einem
Ort B gebahnt. Manchmal ist auch Optimierung eines Weges gemeint,
also besonders schnell von A nach B zu gelangen. Kein SR-Eintrag in Schiepek
(2011, Hrsg.).
Im Wörterbuch der Neurophysiologie (Burkhardt
1969) wird ausgeführt: "94 Bahnung facilitation,
Die (zeitlich begrenzte) Verstärkung nervöser Erregung durch
andere nervöse Erregungen. Man unterscheidet: 1. zeitliche Bahnung:
von zeitlich nacheinander eintreffenden Erregungen führen die späteren
zu einem größeren Erfolg als die früheren. 2. räumliche
Bahnung: gleichzeitig von verschiedenen Seiten her an einem Erfolgsorgan
eintreffende Erregungen führen gemeinsam zu einem Erfolg, welchen
die einzelnen Erregungen für sich nicht auszulösen vermögen.
— Die Begriffe der Bahnung und -> Summation werden vielfach gleichbedeutend
verwandt. Mitunter wird der Begriff der Summation für unterschwellige,
der der Bahnung für überschwellige Erregungsvorgänge angewandt.
Zweckmäßiger ist es, den Begriff der Summation für den
Fall echter additiver Überlagerung beizubehalten, den der Bahnung
für alle Fälle nichtlinearer Überlagerung. Die zeitliche
Summation wäre demnach dadurch gekennzeichnet, daß die erste
eintreffende Erregung einen Vorgang der Größe a hervorruft;
die zweite Erregung, welche für sich allein den Vorgang mit der Größe
b auslöst, trifft auf einen Bruchteil delta a des von der ersten
Erregung ausgelösten Vorganges und bewirkt so insgesamt einen Vorgang
der Größe delta(a) + b. — Bei zeitlicher Bahnung hingegen kann
1. die Reaktion auf die erste Erregung ganz abgeklungen sein, die zweite
Erregung löst dennoch eine größere Reaktion aus. 2. Ist
die erste Reaktion noch nicht abgeklungen, so löst die zweite Erregung
einen größeren Erfolg aus als delta(a) + b. — Bahnungsvorgänge
spielen in der Physiologie des Nervensystems eine große Rolle. Beispielsweise
können durch Bahnung mehrere für sich allein unterschwellig bleibende
synaptische Erregungen gemeinsam eine überschwellige Erregung auslösen.
Zeitliche Bahnungen sind zumeist kurzfristige Phänomene (im Bereich
von msec bis min), jedoch wird mitunter spekulativ angenommen, daß
Bahnungserscheinungen einen möglichen Übergang zwischen den ohne
Nachwirkung verlaufenden Leistungen des ZNS und seinen langfristigen Leistungen
(—> Lernen, —> Gedächtnis, —> bedingte Reflexe) darstellen. Die räumliche
Bahnung spielt vor allem bei der —> Koordination von Erregungsmustern eine
Rolle. —> Summation, —> Hemmung und —> Synapse."
__
Benommen, Benommenheit durch
ein Ereignis oder Geschehen erfahrene Bewusstheitseinschränkung,
nicht voll da, infolgedessen in Aktion und Reaktion eingeengt.
__
Bewusst, Bewusstheit
Wird oft fälschlich mit Bewusstsein gleichgesetzt. Das wache Bewusstsein
kann man mit Bewusstheit identifizieren, wobei es unterschiedliche Stadien
oder Ausprägungen von Bewusstheit gibt: hellwach, wach, gedämpft
oder eingeschränkt wach (müde).
__
Bewusstsein > Lexikon der Neurowissenschaft
(Spektrum).
Das Wort Bewusstsein
hat viele Bedeutungen und ist ein Tummelplatz für unendliche und unergiebige
Diskussionen. Hier betrachte ich ausschließlich das Wachbewusstsein
des Gewahrwerdens. Bewusst sein kann man als Wahrnehmung der Wahrnehmung
auffassen. Damit werden zwei Systeme eingeführt: das System der Wahrnehmung
und das Meta-System der Wahrnehmung der Wahrnehmung. Der Mensch wird damit
in Subjekt (Meta-System) und Objekt (System) gedacht. Auch die Wahrnehmung
der Außenwelt wird innerlich erfasst und ins Bewusstsein projiziert.
Mein Beobachten oder Wahrnehmen des Äußeren findet innerlich
statt. Seit Jahrtausenden rätselt man darüber nach, was nun der
Sinn dieser Verdoppelung der Wahrnehmung sein könnte. In einer ersten
Näherung mögen vielleicht einige Gleichnisse nützlich sein:
-
Die Beobachtung (Wahrnehmung der Wahrnehmung) einer Videoüberwachung
(Wahrnehmung).
__
Bewusstseinseinengung Kein
guter, obwohl eingeführter Begriff der Psychopathologie, weil in der
Regel eine Einengung des Denkens gemeint ist.
__
Bewusstseinslenkung Genau
genommen sollte das Wort besser Aufmerksamkeitslenkung heißen. Das
zumindest ist damit gemeint. Wachbewusstsein ist nur ein Projektionsraum,
indem sich Erlebensvorgänge wahrnehmbar abspielen. Dadurch besteht
die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf diesen oder jenen Bewusstseinsinhalt
zu lenken. Sehr wichtige Methode in der kognitiven und anderen Therapieverfahren,
manchmal auch als mentales Training bezeichnet. Wird tagtäglich vermutlich
Hunderte von Malen natürlicherweise eingesetzt, hat aber im Alltagsleben
keinen eigen Namen, wahrscheinlich, weil es so selbstverständlich
ist. Man kann es aber auch bewusst und gezielt einsetzen, was vor allem
dann angesagt ist, wenn man bei psychischen Störungen zum negativen
Grübeln, bei Phobien und Angstzuständen zum Katastrophieren und
Hineinsteigern oder bei Depressionen zum "Einsumpfen" in Negativismus und
Pessimismus gerät. Es kann aber auch als positive Tagtraumtechnik
oder als zielgerichtete Methode "positiven Denkens" eingesetzt werden.
__
Bewusstlos Von kurzer Ohnmacht
über tiefe Narkose bis hin zum Koma.
__
Bewusstseinsspaltung Grundgegebenheit
durch 1) das Phänomen, ich nehme wahr, dass ich wahrnehme; 2)
die unterschiedlichen Zustände, die Bewusstsein annehmen kann; 3)
Abwehrvorgänge (blinder Fleck) und 4) andere, hier nicht erfasste
Möglichkeiten, z.B. multiple Persönlichkeiten, in Psychosen oder
im Wahn eine andere Persönlichkeit annehmen.
__
Bewusstseinsspanne Zeiteinheit
innerhalb derer dem Bewusstsein aufgenommene oder bearbeitete Inhalte zur
Verfügung stehen oder gegenwärtig sind.
__
Bewusstseinsstrom
__
Bewusstseinsstrom (James)
Der Ausdruck wird erstmals William James zugeschrieben. In seiner Psychologie
(dt. 1909, S. 148-174) findet sich das Kapitel XI: "Der Strom des Bewusstseins".
Dort entwickelt er seine Theorie, die allerdings schon in den Grundlagen
nicht überzeugt, wenn er S. 149 ausführt:
"Vier Eigentümlichkeiten dos Bewußtseins.
Wie findet es statt? In der Beantwortung dieser Frage bemerken wir sofort
vier wichtige Eigentümlichkeiten, an dem Prozeß, der in dem
gegenwärtigen Kapitel seine allgemeine Behandlung finden soll,
1. Jeder „Zustand" tritt auf mit dem Anspruch Teil eines persönlichen
Bewußtseinseins zu sein.
2. Innerhalb jedes persönlichen Bewußtseins wechseln
die Zustände fortwährend.
3. Jedes persönliche Bewußtsein ist merklich kontinuierlich.
4. Es interessiert sich ausschließlich für bestimmte
Teile des ihm gegenübertretenden Objekts mit Vernachlässigung
anderer und ist beständig beschäftigt aufzunehmen oder abzuweisen,
kurz zu wählen unter seinen Gegenständen."
Kritik
der Bewusstseins-Terminologie von William James:
1) Das Bewusstsein hat keinen Anspruch, auch keinen
persönlichen. Aber es ist jeweils ein persönliches,
an ein ganz bestimmtes Subjekt gebundenes. Es ereignet sich und kann gelenkt
werden (James Punkt 4).
2) Es ist hier unklar, was James mit "Zustände"
meint. Die Bewusstseinsinhalte wechseln nicht fortwährend. Denn man
kann sich konzentrieren und auf einen Inhalt fokussieren, der dann eine
gewisse Zeitdauer relativ konstant bleibt.
3) Diese erscheint mir sehr zweifelhaft. Die alltäglich
und psychopathologische Erfahrung lehrt, dass das Bewusstsein unterbrochen
sein, Löcher und Lücken haben kann.
4) Die Bewusstseinslenkung ist meist nicht Gegenstand
des Bewusstseins. Wir erleben gewöhnlich nicht, dass und wie wir lenken,
aber wir tun es. Die Bewusstseinsinhalte sind lenkbar, wie jeder aus seinem
Alltagsleben weiss und überprüfen kann, wenn wir auch keine Lern-
und Lenkkultur zu den Bewusstseinsinhalten ausgebildet haben und es an
einer klaren operationalen Terminologie fehlt. Lenkung und Wechsel von
Figur und Hintergrund durch Auswahl ist nachvollziehbar.
Es hat den Anschein, als trennte James nicht zwischen
Bewusstseinsinhalt ("Film") und dem Träger, auf den der Bewusstseinsinhalt
projiziert oder dargestellt wird.
__
Bewusstseinssupervision
Dass es so etwas wie Bewußtseinssupervision gibt, ohne dass uns diese
bewusst ist, belegt folgende einfache Alltagserfahrung: Ich will etwas
einkaufen, sagen wir Milch und Kaffe. Ich begebe mich auf den Weg und denke
nicht mehr an die beiden Güter. Ich treffe diesen und jenen, schaue
da und dort hin, denke dieses und jenes. Nach 10 Minuten bin ich am Einkaufsziel,
und
auf einmal ist wieder in meinem Bewusstsein: du wolltest Milch
und Kaffe kaufen. Dieses Einfallen zum rechten Zeitpunkt ist das Werk der
Organisation, die hier Bewusstseinssupervision genannt wird.
__
Bewusstseinstruebung
Benommenheit, Grade: Somnolenz < Sopor < Koma I < Koma II <
Koma III < Koma IV.
__
Bewusstseinszustand
Das Bewusstsein kann verschiedene
Grundzustände annehmen: Wach, Schlaf, Traum, Trance, Bewusstlos.
__
Bildgebende Verfahren CT,
EEG,
fMRT,
MRT,
PET.
__
Blinder
Fleck
__
Brain
fingerprint
__
Brainstorming
__
CT Computer Tomographie Bildgebung.
__
Daemmerzustand getrübte
oder eingeengte Bewussheit. Nicht voll oder richtig da.
__
Delirium [W]
Das ICD-10 Lexikon, Dilling
(2009): "Delirium1, 2 (F05): (lat. delirare - verrückt sein) Ein ätiologisch
unspezifisches zerebrales organisches Syndrom, das durch gleichzeitig begehende
Störungen des Bewusstseins (Bewusstseinstrübung) und der Aufmerksamkeit,
der Orientierung zu Zeit, Ort und Person, der Wahrnehmung, des Denkens,
des Immediat- und des Kurzzeitgedächtnisses, der Psychomotorik (Unruhe,
Schreckreaktion), der Emotionalität und des Wach-Schlaf-Rhythmus (nachts
Verschlechterung) gekennzeichnet ist. Das delirante Zustandsbild ist vorübergehend
und von wechselnder Intensität; in den meisten Fällen bildet
es sich innerhalb von vier Wochen oder kürzerer Zeit zurück,
jedoch sind auch Delirien, die bis zu sechs Monaten oder länger andauern,
möglich. Synonym: akuter oder subakuter Verwirrtheitszustand."
__
Deklaratives Gedaechtnis
für
Ereignisse und Fakten.
__
Denken
Denken heißt geistige Modelle bilden oder zueinander in Beziehungen
setzen. Beim Denken brauchen wir also Zugriff auf unsere geistigen Modelle
und auf Strukturen, die Beziehungen organisieren.
__
Depolarisation [W]
Die Membran wird weniger negativ. (Bear 2009), S.83.
__
Dopamin Neurotransmitter, der mit
vielen Funktionen u.a. auch mit positiven Affekten zusammenhängen
soll ("Glückshormon"); die Wirkung hängt vom Rezeptortyp (D1-D5)
ab. Dopaminerg heißen Verbindungen, in denen Dopamin eine Rolle spielt
mit Einflüssen auf Bewegung, Glückserleben, Motivation und Handeln,
Prolactinsteuerung.
__
Dissoziation > Abspaltung.
__
Doesen Bewusstheitsbegriff: herunterregeln,
absenken, abschalten, absichtliches Halbschlafen, Wachschlafen.
__
Echo Gedaechtnis Speicher
für akustische Informationen.
__
EEG Ableitung und Darstellung der Hirnströme.
__
Element (Bewusstseinselement)
Bewußtseinselemente können z.B. sein: eine äußere
oder innere Wahrnehmungen, Gedanken, Erinnerung, Bedürfnis, Wunsch,
Interesse, Stimmung, Gefühl, Plan, Ziel, Vorsatz, Abwägung,
Befindlichkeitszustand, Vorstellung, Phantasie, Erfahrungen.

__
Empfindung Baustein von Wahrnehmungen.
__
Engramm
"Der Begriff Engramm geht auf Lashley (ich glaube: In search of the
engram- müsste als PDF im Netz zu finden sein) zurück, der vor
über 60 Jahren einen Begriff dafür suchte, wo denn die mentale
Funktionen im Gehirn sitzen. Im deutschsprachigen Raum wurde in den 90er
Jahren der Begriff motorisches Engramm von Carl, Martin und Lehnertz für
das sportliche Techniktraining wieder aufgegriffen (hierbei ging es um
das einschleifen von stabilen Engrammen im Training). Greift man die Frage
nach dem Sitz mentaler Funktionen bzw. motorisches Programme unter dieser
Perspektive heute wieder auf, dann sitzt ein Engramm in den Stärken
unserer Synapsen und umfasst damit beides: Veränderungen in den Aktionspotenzialen
und strukturelle Veränderungen. Beide bedingen sich gegenseitig. Neuronale
Aktivierungen führen zu strukturellen Veränderungen, die wiederum
die neuronale Aktivitätscharakteristik bestimmen. Mentale oder motorische
Aktionen gehen mit kohärent aktivierten Neuronenensembles einher,
deren Topologie durch die Eigenschaften der eingebundenen Neurone und insbesondere
deren Synapsen bestimmt wird. (Bei Handlung/Aktion wird aus einer in den
Synapsen „schlafenden“ Repräsentation eine aktive). Wiederholt „erfolgreiche“
Repräsentationen werden im neuronalen Netzwerk über strukturelle
Veränderungen zunehmend als „abgrenzbares“ Neuronenensemble ausgewiesen…
Ich hoffe, ich hab’s nicht allzu verwirrend beschrieben"
Quelle: Gute
Frage 19.5.2010
__
"Enkodieren ist die Verarbeitung von
Informationen zur Eingabe in ein Gedächtnissystem, etwa durch das
Herstellen eines Bedeutungszusammenhangs. Die Encodierung ist aus der Sicht
der Wahrnehmungspsychologie die initiale Phase der Informationsverarbeitung,
wobei in einen mehrstufigen Prozess aus den physikalischen Trägerprozessen
wie Licht- oder Schallwellen die aufgeprägten Informationen wie Frequenz-
oder Amplitudenmodulationen in einen neuronalen Code übersetzt werden,
den das Zentralnervensystem entschlüsseln und schließlich weiterverarbeiten
kann. Lässt sich die Information etwa bestehenden Gedächtniszuständen
zuordnen, findet Bedeutungserkennung statt. Der theoretische Ansatz der
Verarbeitungstiefe bzw. der Verarbeitungsebenen besagt, dass wahrgenommene
Stimuli durch verschiedene Encodierungsoperationen verarbeitet werden,
wobei die Analyse von der oberflächlichen physikalischen Beschaffenheit
eines Reizes über die phonemische Struktur bis zur hin zu einer semantischen
Analyse der Bedeutung verläuft. Die Verarbeitungstiefe wird in den
Regel von den bewussten oder unbewussten Absichten des Individuums, der
Reizspezifik und auch der verfügbaren Zeit bestimmt, wobei der kognitive
Aufwand mit der Verarbeitungstiefe normalerweise steigt.
Die Enkodierung dessen, was ein Sprecher oder Schreiber meint, ist
eine Voraussetzung dafür, dass der Hörer oder Leser sie richtig
aufnehmen kann. Daher geht das schlechtere Erinnern gespeicherter Informationen
häufig auf einen Mangel an effektiven Strategien zurück, wenn
etwa bei der Enkodierung keine zusätzlichen Informationen mit aufgenommen
wurden, die einen späteren Abruf erleichtern, wobei auch die mangelnde
Strukturierung eines Materials bei der Enkodierung dazu beiträgt,
dass dieses nur schlechter erinnert werden kann. Gedächtnisstrategien
wie Chunking, Rehearsal, Organisationsbildung oder Elaborierung sind dabei
Enkodierungsstrategien, die sich nicht allein auf das Kurzzeitgedächtnis
beschränken, sondern auch die Speicherung im Langzeitgedächtnis
erleichtern. Enkodierungsstrategien, die von manchen Menschen spontan nicht
angewendet werden, lassen sich durch Training aktivieren, zudem können
neue Enkodierungsstrategien erworben werden. Als Enkodierungshilfen gelten
semantische Hinweise wie das Aufzeigen der strukturellen Gemeinsamkeiten
zwischen Lerneinheiten, oder Mnemotechniken wie die Zusammenfassung
von Lerneinheiten in Vorstellungsbildern.
Quelle: Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik http://lexikon.stangl.eu/3409/enkodieren/
__
Entscheidung
Die Neurowissenschaftler unterscheiden meist nicht zwischen Entscheidung
und Entschluss:
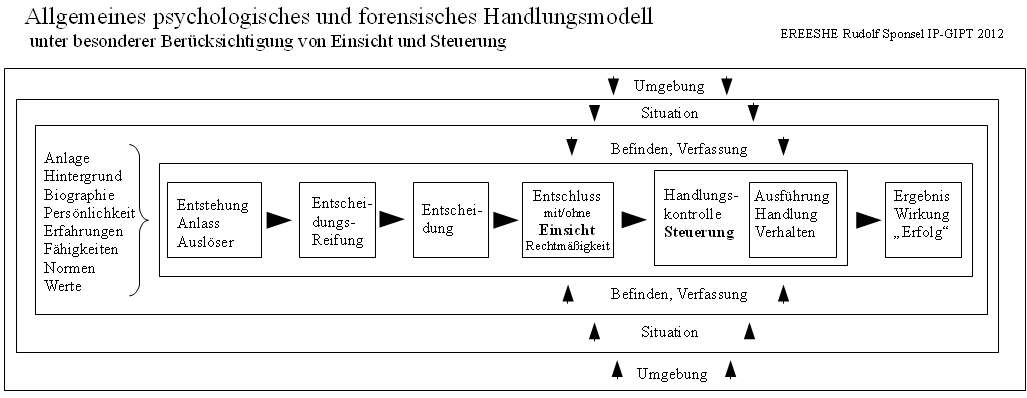
_
Libet-Versuch
Haynes-Versuch
SdW: Herr Haynes, die Ergebnisse Ihrer jüngsten
Studie zum Prozess der neuronalen Entscheidungsfindung könnten die
Gemüter in der Debatte um den Begriff der Willensfreiheit erneut erhitzen.
Wie hat man sich den Hergang des Experiments genau vorzustellen?
Haynes: Wir führen Testpersonen zur Messung ihrer Hirnaktivität
in einen Kernspintomografen ein. Mit Hilfe dieses bildgebenden Verfahrens
erreicht man eine sehr hohe räumliche Auflösung der Prozesse
im Gehirn und kann so die Gedanken einer Person gut sichtbar machen. Die
Probanden bekommen in die linke und die rechte Hand jeweils einen Knopf.
Sie werden schließlich gebeten, sich zu irgendeinem vollkommen selbstbestimmten
Zeitpunkt für die linke oder rechte Seite zu entscheiden und dann
den entsprechend Knopf zu drücken. Parallel dazu laufen auf einem
Bildschirm Buchstaben mit, die sich jede halbe Sekunde ändern. Die
Probanden merken sich, welcher Buchstabe auf dem Bildschirm zu sehen ist
zu dem Zeitpunkt, da sie ihre Entscheidung fällen. Damit können
wir dann zurückrechnen und uns die Hirnaktivität anschauen, die
einer bewussten Entscheidung vorausgeht. Auf der Basis der gewonnenen Daten
versuchen wir vorherzusagen, wie sich jemand entscheiden wird. Dazu verwenden
wir spezielle Mustererkennungssoftware – vergleichbar mit den Programmen,
die man benutzt, um Fingerabdrücke zu erkennen.
SdW: Wie früh kann man eine solche Entscheidung
detektieren?
Haynes: Bereits etwa sieben bis acht Sekunden vor einer Entscheidung
können wir diese anhand der gemessenen Hirnaktivität vorhersagen.
Allerdings weist die Kernspintomografie eine drei- bis viersekündige
Verzögerung auf. Das bedeutet, es vergehen tatsächlich mindestens
zehn Sekunden, bevor die Information zu einer Entscheidung im Gehirn präsent
ist.
Quelle: http://www.spektrum.de/alias/r-hauptkategorie/hirngespinst-willensfreiheit/968930
__
Epiphänomen Epiphänomenalismus
gr.,
Neben- oder Begleiterscheinung, d.h. ohne eigene Bedeutung. Verschiedene
materialistisch, naturwissenschaftlich, biologisch orientierte BewusstseinstheoretikerInnnen
- z.B. Rohracher, betrachten z.B. das Bewusstsein als ein sog. Epiphänomen,
ohne besondere eigenständige Bedeutung wie z.B. das Bild, das man
in einem Spiegel oder spiegelnden Medium sehen kann, z.B. das Spiegelbild
eines über einen See fliegenden Vogels, dem man auch keine eigene
Bedeutung zuspricht: Epiphänomenalismus. Psychologisch ist das wichtigste
Argument gegen die Bedeutung des Bewusstseins, etwa als Stätte des
freien Willens, dass alle wesentlichen Entscheidungen oder Erscheinungen,
wenn sie im Bewusstsein erscheinen, bereits als Bewirktes angesehen werden
müssen, so dass sich bei oberflächlicher Betrachtung der Eindruck
ergibt, bewusste Entscheidungen gäbe es gar nicht und in der Folge
dann auch keinen freien Willen. Dies kann leicht durch folgendes Alltagsbeispiel
widerlegt werden: Nehmen wir an, ich spüre Durst. Das Bedürfnis
Durst gelangt mir zum Bewusstsein. Keine Willensfreiheit gäbe es,
wenn ich z.B. das Trinkbedürfnis nicht zurückstellen könnte.
Tatsächlich wird sich, je nach Situation, eine Abwägung ergeben,
was, wann und wo ich wie viel trinken werde. [Ursprungsquelle]
__
Episodisch-autobiographisches
Gedaechtnis
__
Episodisches Gedaechtnis
"Das
episodische oder autobiographische Gedächtnis speichert Ereignisse,
die uns unmittelbar betroffen haben" [Stangl Online Lexikon für Psychologie
und Pädagogik"]
__
EPSP
Exzitatorisches Postsynaptisches Potential
Vorübergehende Depolarisation der postsynaptischen Membran setzt
Neurotransmitter frei.
__
Erinnern
Grundlegende Gedaechtnisfunktion, die ständig geschieht, aber
der Prozess bleibt dem Bewusstsein in der Regel verborgen. So merkwürdig
es klingt: Der Prozess des Erinnerns ist im Detail noch ziemlich unerforscht
(17.04.2016) - erstaunlich angesichts des Rummels um die bildgebenden Verfahren.
__
Erleben Grundbegriff
der Psychologie.
__
Explizites Gedaechtnis
Relationales, deklaratives oder explizites G. in Lexikon der Neurowissenschaft:
"unmittelbar bewußt, schnell und flexibel, aber nicht immer verfügbar".
__
Exposition Aussetzen oder konfrontiert
werden mit einer speziellen Reizumgebung. In der Verhaltenstherapie versteht
man unter Expositionsbehandlung eine Konfrontation mit den Unbehagen auslösenden
Reizen. Dies kann zunächst nur in der Vorstellung (Desensibilisierung)
oder auch in der Realität - graduell (systematische Desensibilisierung)
oder massiert (Reizüberflutung oder Flooding) durchgeführt werden.
__
fMRI englische Abkürzung für
funktionelle Magnetresonanztomographie (deutsches Kürzel fMRT),
auch Kernspintomographie. Mit dieser Technik werden Durchblutungsstörungen
und Stoffwechselvorgänge im Gehirn sichtbar.
__
Fokussieren Die Aufmerksamkeit
auf etwas richten, bei gerichteter und verdichteter Aufmerksamkeit kann
man von Konzentration sprechen. Anwendung: Diagnostik un Kontrolle bei
neurochirurgischen Eingriffen.
__
Formatio reticularis [W]:
"Mit einer rhythmischen Erregung der kortikalen Pyramidenzellen durch das
ARAS entsteht das, was wir Bewusstsein nennen, aber nur, wenn die Frequenz
schneller als 6 Hz ist, und wir werden immer wacher, je schneller der Rhythmus
wird, bis zu etwa 40 Hz. Wenn der Rhythmus langsamer als 6 Hz ist, schläft
der Mensch, bei 3 Hz ist er in Tiefschlaf oder Narkose, und die Null-Linie
im EEG wird als sicheres Todeszeichen angesehen. Eine weitere Funktion
des ARAS besteht in der Modulation eines Weckreizes. Man kennt die filtrierende
Wirkung des Thalamus, der nur starke oder „wichtige“ Informationen ins
Bewusstsein lässt. „Tor zum Bewusstsein“ wird der Thalamus in der
Anatomie schon lange genannt, und die Frequenz des ARAS bestimmt, wie weit
dieses Tor offen ist. Starke Reize bewirken augenblicklich eine Beschleunigung
der Schrittmacherfrequenz, um sofort hellwach zu machen, das Tor zum Bewusstsein
weit zu öffnen. Eine weitere Funktion ist die Steuerung der Aufmerksamkeit,
die so verständlich wird: Weil im Thalamus die von den Sinnesorganen
einströmenden Daten und die retikulären Strukturen des ARAS in
unmittelbarer Nähe und Verbindung sind, können die Sinneserregungen
dort auf die Aktivität des ARAS in der Art Einfluss nehmen, sodass
genau jene Projektionsfelder des Cortex aktiviert werden, in welche die
stärksten Sinneseindrücke projiziert werden. Da vom Cortex auch
efferente Fasern zum Thalamus führen, kann der Cortex die Aktivität
des ARAS beeinflussen und die Aufmerksamkeit unabhängig von äußeren
Reizen in jedes kortikale Gebiet lenken."
__
Freier
Wille [Libet,
Beweis
zur Willensfreiheit Sponsel 2006]
__
Funktion Wichtiger grundlegender
wissenschaftlicher Begriff. Was hat dieses oder jenes für eine Funktion?
Wie funktioniert etwas? Was und wie ist der Zusammenhang zwischen verschiedenen
Größen, Bereichen, Ganzen und Teilen?
__
Funktionsbereiche Zusammenfassung
einzelnen Funktionen zu einem Bereich, z.B. Fuktionsbereich Bewegung mit
aufstehen, setzen, sitzen, liegen, gehen, laufen, sprinten, springen, hüpfen,
spazieren, wandern u.a.m. mit verschiedenen Operatoren wie Geschwindigkeit
(schneller, langsamer) oder Richtung. Ein wichtiger Funktionsbereich ist
z.B. die Befindlichkeit, zu der viele unterschiedliche Funktionen beitragen.
__
Ganzes Aus Teilen zusammengesetzt (gedacht).
Der ganze Mensch besteht im standardisierten Normalfall der Außenerscheinung
aus Kopf, Rumpf mit den "Extremitäten" Arme und Beine. Im Inneren
besteht er aus "Organteilen" (Gehirn, Herz, Leber, Niere, ...), die wiederum
immer weiter zerlegt werden können bis hinunter zu den kleinsten Bauteilen,
Zellen, Zellteilen, Molekülen, Atomen, ...
__
Ganzheiten Gestaltpsychologischer Grundbegriff.
Die Lehre vom Ganzen und seinen Teilen hat aber eine lange philosophische
(Mereologie) und mathematische (durch
die Mengenlehre erschüttert) Tradition.
__
Gedanken
Haynes: Ja! Wir haben Mustererkennungsverfahren benutzt, um herauszufinden,
wie sich jemand zwischen zwei und mehr Alternativen entschieden hat. Wir
können Gedanken von Probanden aus ihrer Hirnaktivität dekodieren.
The European: Mustererkennungsverfahren – das müssen
Sie erklären.
Haynes: Das Verfahren beruht auf einer speziellen Computersoftware,
die versucht, in den gemessenen Datenpunkten im Gehirn Unterschiede bzw.
Muster zu entdecken. Die Grundidee dahinter ist, dass jeder Gedanke mit
einem unverwechselbaren Aktivitätsmuster des Gehirns einhergeht."
Quelle: http://www.theeuropean.de/john-dylan-haynes/9109-entwicklungen-in-der-hirnforschung
__
Gedankenabreissen schwierig
zu erfassende und abzugrenzende Denkstörung (Gedankensperrung, Gedankenverlust,
Faden verlieren, normales Stocken beim geistigen Suchen) im psychotischen
Bereich. Scharfetter
(1976), S. 101: "Der Kranke empfindet selbst die plötzliche Unterbrechung
seines Gedankenganges. Das Gedankenabreißen ist ähnlich wie
die Sperrung am plötzlich stockenden Sprechen zu erkennen." > AMDP
(GB)
__
Gedankensperrung Scharfetter
(1976), S. 101: "Plötzlicher Abbruch des Gedankenganges. Der Kranke
stockt mitten im Gespräch, schweigt, „verliert den Faden", greift
dann unter Umständen das Gespräch mit einem anderen Thema wieder
auf. Sperrungen ereignen sich bei klarem Bewußtsein und dürfen
nicht mit der Unterbrechung des Gedankenflusses durch eine Absence verwechselt
werden. Sperrungen gibt es auch als Folge plötzlich einsetzender völliger
Ratlosigkeit, im Schreck, im Gefühl innerer Leere usw. Bei der Schizophrenie
gibt es auch ein „aktives" Sperren aus Negativismus."
__
Gedankenstopp > Mentales
Training, Bewusstseinslenkung.
__
Gedaechtnis
Umfassender und dadurch sehr vieldeutiger Grundbegriff. Es werden mehrere
Gedächtnisarten unterschieden: Ultrakurzzeit-,
Kurzzeit-,
Arbeits-
und Langzeitgedächtnis;
autobiographisches,
deklaratives,
explizites,
implizites,
prozedurales,
relationales,
semantisches
G. Für die Gedächtnisforschung erlangten einige besondere Einzelfälle
Beachtung und Bedeutung:
Einzelfaelle (gedächtnisrelevante)
-
Naomi Jacobs, 32-jährige alleinerziehenden
Mutter aus England, wachte eines Morgens aufwacht und hatte die letzten
17 Jahre ihres Lebens vergessen. Sie erkannte weder sich selbst noch ihre
Wohnung oder ihren Sohn. Quelle: Die Welt 15.10.2015: Wenn ein und derselbe
Tag immer-wiederkehrt.
-
"Clive Wearing etwa, ein britischer
Musikwissenschaftler und Dirigent, zog sich 1985 eine Gehirnentzündung
durch ein Herpes-simplex-Virus zu, die unter anderem seinen Hippocampus
und die Amygdala schädigte. Wie Henry Molaison konnte er sich nichts
Neues merken und vergaß zum Beispiel auch seine musikalische Ausbildung.
... Doch eines war bei Wearing auffällig: Trotz seiner Probleme konnte
er nach wie vor exzellent Klavier spielen und einen Chor dirigieren – obwohl
er nicht mehr wusste, dass er das gelernt hatte." Quelle: Die Welt 15.10.2015:
Wenn ein und derselbe Tag immer-wiederkehrt.
-
H.M. Berühmter Fall, dem Hippocampus und
Amydala entfernt wurde, worauf keine neuen Erinnerungen mehr gebildet werden
konnten, wohl aber das Gedächtnis für Ereignisse vor dieser Entfernung
noch funktionierte. Daraus zog man den Schluss: Hippocampus und Amygdala
sind für die Gedächtnisbildung zwar notwendig, sie sind aber
nicht das Gedächtnis selbst. Das Gedächtnis ist über das
gesamte Gehirn verteilt.
-
William O. Rätselhafter Fall von Gedächtnisverlust.
W.O. hat nur noch einen Tag aus seinem Leben zur Verfügung, den 14.
März 2005. Quelle: Die Welt 15.10.2015: Wenn ein und derselbe Tag
immer-wiederkehrt.
__
Gedaechtnishemmungen
W160418:
"Als Gedächtnishemmung bezeichnet man in der Lernpsychologie den Effekt,
dass Schwierigkeiten, sich einen Lernstoff einzuprägen, unter anderem
mit Ereignissen zusammenhängen können, die vor oder nach dem
Lernen stattgefunden haben. Der österreichische Psychologe Hubert
Rohracher (1963) unterschied folgende Formen von Gedächtnishemmungen:
-
retroaktive Hemmung (rückwirkende Hemmung): Das Lernen und
Behalten eines zuerst gelernten Stoffes wird durch Lernstoffe, die später
eingeübt werden, behindert. Dies lässt sich besonders dann beobachten,
wenn der zweite Lerninhalt mit dem ersten Lerninhalt Ähnlichkeiten
aufweist. Beispielsweise wird eine Telefonnummer leicht vergessen, wenn
man sich eine andere Telefonnummer merkt.
-
proaktive Hemmung (vorauswirkende Hemmung): Ein unmittelbar vorhergehender
Lernprozess beeinträchtigt das Lernen darauffolgender Inhalte.
-
Ähnlichkeitshemmung (Ranschburgsche Hemmung): Störende
Interferenzen zwischen zwei Lernprozessen sind besonders stark, wenn sich
die Lernstoffe inhaltlich ähnlich sind.
-
assoziative Hemmung (reproduktive Hemmung): Gedächtnisinhalte,
die bereits mit anderen assoziiert sind, lassen sich schwerer mit neuen
Inhalten verbinden, als wenn dies nicht der Fall ist.
-
ekphorische Hemmung (Erinnerungshemmung): Die Wiedergabe eines früher
gelernten Materials wird negativ beeinflusst, wenn kurz vor der Reproduktion
neuer Stoff gelernt wird.
-
affektive Hemmung: Treten zwischen Einprägung und Wiedergabe
eines Lernstoffs starke affektive Erregungen auf (z. B. ein Streit), so
beeinträchtigt dies die Wiedergabe der gelernten Inhalte."
__
Gestalt Grundlegende Idee ganzheitlichen
- hauptsächlich - Wahrnehmens. > Gestaltpsychologie.
__
Grenzzustaende Dämmerzustand,
Delirium, Einschlafen, Entrückt, Erwachen, Katalepsie, Katatonie,
Oneiroid, Psychose, Rausch, Sterben, Stupor, Tagtraum, Trance, Verwirrtheit,
Verzückung.
__
Genexpression bezeichnet den
Vorgang, der die genetische Information umsetzt und für die Zelle
nutzbar macht (Spektrum Kompaktlexikon der Biologie).
__
Genschere (Chrispr / Cas 9)
"CRISPR / Cas9 - die Genschere Leicht anwendbar, präzise, preiswert
und einfach Mit CRISPR / Cas9 , einem gentechnischen Verfahren, laiensprachlich
auch "Genschere" genannt, gelingen rückstandfreie, buchstabengenaue
Eingriffe im Erbgut bei Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren oder Menschen,
denn CRISPR / Cas9 funktioniert in praktisch jedem Organismus. ..." [3sat
April 2016]
" Crispr / Cas9 Mit "Copy and Paste" im Erbgut redigieren Crispr /
Cas9 schaltet Gene aus, verändert oder ersetzt sie durch andere. Jedes
Genom kann mit dieser Genschere überarbeitet werden, auch die menschliche
Keimbahn. Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna haben als erste gezeigt,
dass man die von Bakterien zur Phagenabwehr entwickelte Genschere Crispr
/ Cas9 dazu benutzen kann, jede beliebige DNA-Sequenz anzusteuern und zu
zerschneiden. Programmiert und dirigiert wird die Genschere über eine
Führungs-RNA. Die Genschere gehört zum bakteriellen Immunsystem.
Bakterien und Archebakterien wehren sich damit gegen Bakteriophagen. Das
sind Viren, die sich auf Bakterien spezialisiert haben. Falls die Bakterien
ihre erste Begegnung mit einem Bakteriophagen überleben, bauen sie
ein kurzes Stück seiner DNA in ihr Erbgut ein, quasi als molekulares
Erinnerungsfoto an den unterlegenen Feind. ..." [3sat April 2016]
__
Gesetz der Uebung (Thorndike)
Wiederholungen einer Handlung erleichtern sie künftig.
__
Gesichtererkennung Spezifikation
der Mustererkennung. Erstaunliche Fähigkeit, aus wenigen Merkmalen
in vielen unterschiedlichen Situationen, Richtungen, Winkeln, Beleuchtungsverhältnissen
ein Gesicht zu erkennen. Spielt im Alltag eine außerordentliche Rolle,
aber auch in der Kriminalistik (Identifikation, ZeugInnen).
__
Gewohnheit Überdauerndes
Verhaltensmuster. Gewohnheiten erleichtern das Lebens sehr, können
aber auch bei quasi automatischen und unkritischen Anwendungen zu
Fehlern führen. So gesehen hat die Gewohnheit ein zwiespältiges
Doppelgesicht. Gewohnheiten gehen meist leicht und mühelos von der
Hand, erfordern wenig Aufwand und Energie. Im Sozialbereich werden dadurch
Vorurteile sehr gefördert.
__
habit Gewohnheitsstärke H, Begriff
des amerikanischen Psychologen Hull ("Neobehaviorist")
__
Habituation Gewöhnungsprozess,
sich etwas angewöhnen.
__
Halluzination Wahrnehmungstäuschung
(Fehlleitung, "Fehlzündung" im Gehirn). Erleben einer Wahrnehmung
von Realcharakter ohne übliche (äußere) Wahrnehmungsquelle.
__
Hebbsche Lernregel [W160416]
"Das bedeutet: Je häufiger ein Neuron A gleichzeitig mit Neuron B
aktiv ist, umso bevorzugter werden die beiden Neuronen aufeinander reagieren
(„what fires together, wires together“). Dies hat Hebb anhand von Veränderungen
der synaptischen Übertragung zwischen Neuronen nachgewiesen.
Als endgültige Bestätigung von Hebbs Thesen
gelten die Experimente von Terje Lømo und anderen in den 1960–1970er
Jahren[1] und der direkte Nachweis der Veränderung von Signalübertragung
als Teil des Mechanismus für Lernprozesse und Gedächtnis im Jahr
2014.[2]
Hebb gilt damit als der Entdecker des Modells der
synaptischen Plastizität, welche die neurophysiologische Grundlage
von Lernen und Gedächtnis darstellt.[3]"
__
Hellsehen Im allgemeinen nicht als besonderer
Zustand des Bewusstseins gemeint, sondern die Annahme oder Behauptung einer
paranormalen Fähigkeit, nämlich die Zukunft vorhersehen zu können.
> Grenzwissenschaften.
__
Hellsichtig Vorhersehen können.
Wissenschaftlich umstrittene paranormale Fähigkeit > Grenzwissenschaften.
__
Hemmung Wichtiger allgemeiner und wissenschaftliche
Begriff, besonders auch in der Lerntheorie und Verhaltenstherapie.
-
proaktive. Vorangehende Lerninhalte erschweren das Erinnern nachfolgender.
-
retroaktive. Nachfolgende Lerninhalte erschweren das Erinnern vorangehender.
-
rekurrente (Renshaw): Rückwärtshemmung [> Lexikon der Neurowissenschaft]
__
Hippocampus
Hirnregion mit besonderer Bedeutsamkeit für
das Gedaechtnis (Schaltstellwerk).
Nach Roth (2003), S. 167: "Unbestritten ist auch, dass der Hippocampus
und die ihn umgebende Rinde nicht die eigentlichen Orte der Einspeicherung
für deklarative Gedächtnisinhalte sind, sondern nur der Ort,
an dem festgelegt wird, wo, wie stark und in welchem Kontext Inhalte abgespeichert
werden bzw. wie und in welchem Maße sie abrufbar sind. Der Speicherort
für das deklarative Gedächtnis ist der Isocortex, wahrscheinlich
in erster Linie der assoziative Cortex. Das Abspeichern geschieht modalitäts-,
qualitäts- und funktionsspezifisch. Dies bedeutet, dass sich das Objektgedächtnis
in visuellen Cortexregionen befindet, die mit Objekterkennung befasst sind,
das Farbgedächtnis in den farbverarbeitenden Cortexarealen, das auditorische
Gedächtnis in den auditorischen Regionen, sprachliche Erinnerungen
in den Sprachzentren usw. Dies bedeutet außerdem, dass es praktisch
ebenso viele Gedächtnisse gibt, wie Bedeutungskategorien der Wahrnehmung
existieren; diese Gedächtnisse bilden innerhalb der Großhirnrinde
relativ unabhängig voneinander arbeitende Module."
"Langzeitgedächtnis in der Hirnrinde Das Gehirn
speichert Verknüpfung von Sinneseindrücken in der Großhirnrinde,
nicht im Hippocampus Wo und wie das Gehirn Gedächtnisinhalte festhält,
ist eine der interessantesten Fragen der Neurowissenschaften. Lange galt
der Hippocampus als ein Gedächtniszentrum im Gehirn, in dem Erinnerungen
dauerhaft abgelegt werden. Mazahir T. Hasan vom Max-Planck-Institut für
medizinische Forschung in Heidelberg und José Maria Delgado-Garcìa
von der Universität Pablo de Olavide in Sevilla haben herausgefunden,
dass Erinnerungen an miteinander verknüpfte Sinneswahrnehmungen in
der Großhirnrinde liegen und nicht im Hippocampus, wie in den meisten
Lehrbüchern beschrieben. Die Ergebnisse der Studie verändern
die bisherige Vorstellung vom Gedächtnis fundamental, nach der der
Hippocampus als Speicherort genutzt wird. Stattdessen werden manche Gedächtnisinhalte
in der motorische Großhirnrinde gespeichert." [MPG 27. August 2013]
"Sieht er wirklich aus wie ein Seepferdchen? Über
das Aussehen mag man streiten, über die Funktion nicht: Bei der Einspeicherung
neuer Gedächtnisinhalte spielt der Hippocampus die entscheidende Rolle
– wem er fehlt, der kann sich nichts Neues merken.
Der Hippocampus ist ein „eingerolltes“ Stück
Cortex, das – einem Wurm nicht unähnlich – innen am Temporallappen,
am Boden der Seitenventrikel liegt. Er ist ein Teil des limbischen Systems,
das mit der „Erzeugung“, der „Archivierung“ und dem „Abruf“ von Inhalten
des Langzeitgedächtnisses zu tun hat. Und er ist einer der wenigen
Orte im Gehirn, an dem zeitlebens neue Nervenzellen geboren werden." Quelle:
dasgehirn.info.
__
Hirnstamm [W],
[dgi]:
"Der Hirnstamm kontrolliert aber auch Blutdruck und Herzfrequenz, steuert
Atmung und Schwitzen. Zudem reguliert er Wachen und Schlafen bis ins Detail,
koordiniert also, wie aktiv das Gehirn gerade ist beziehungsweise in welcher
Traumphase wir uns befinden. Als entscheidende Schaltzentrale erweist er
sich auch bei einigen lebenswichtigen Reflexen wie Schlucken, Brechen oder
Husten."
__
Hypnoid [W160417]
"Als Hypnoid bezeichnet man in der Psychologie eine Vorstellung, Vorstellungsgruppe
oder einen Gedächtnisinhalt, der dem Bewusstsein entzogen ist. Hypnoide
sind vollwertige psychische Einheiten, die verhaltenswirksam sind.
Der Begriff wird gelegentlich in der Hypnotherapie
verwendet (siehe auch posthypnotischer Auftrag), vor allem aber in der
klassischen oder freudschen Psychoanalyse, da er ein Konzept beinhaltet,
welches von Freud und Josef Breuer in ihren Studien über Hysterie
von 1895 erstmals psychodynamisch begründet, später aber von
Freud durch die Verdrängung weitgehend ersetzt wurde."
__
Hysterie Vielfältig schillernder,
bedeutungswechselnder, historisch vorbelasteter und wissenschaftlich unbrauchbarer
Begriff, der Bleulers
scharfes Wort vom autistisch undisziplinierenden Denken in der Medizin
bestätigt und zeigt, wie sehr es in der Heilkunde an Definitionsqualität
mangelt. Historisch umfassend informiert Engels, gegenwartsbezogen-aktuell
Faust.
* Überblick Diagnostik (besonders
WIF)
__
Ich-Bewusstsein Unter Normalbedingungen
bei allen Menschen alltäglich selbstverständlich vorhanden: das
Verständnis da zu sein, zu erleben und zu handeln als "ich". Ich schreibe
mir mein Erleben, meinen Körper, mein Verhalten und Handeln zu. Das
Ich-Bewusstsein kann gestört sein (Übergangszustände schlafen/wachen;
Trance; Psychosen; Persönlichkeitsstörungen, insbesondere multiple
Persönlichkeiten, die ein "ich" wechseln können..
__
Ich-Erleben der Funktionsbereich erleben
des Ich-Bewusstsein.
__
Identitaet
__
Identitaets-Bewusstsein Unter
Normalbedingungen
weiß der Mensch um seine Identität; er ist orientiert über
sich selbst und weiß, wer er ist. Das Identitätsbewusstsein
kann beeinträchtigt werden - vorübergehend - sogar verschwinden,
besonders in Übergangszuständen (schlafen/wachen); Trance; Psychosen;
Persönlichkeitsstörungen.
__
Identitaetstheorie
Leib-Seele-Geist
Die Identitätstheorie postuliert: alles seelisch-geistige Geschehen
ist an materielles Geschehen gebunden, es ist nur ein Aspekt oder eine
Dimension der materiellen Prozesse, die in ihren unterschiedlichen Realisationsstufen
aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden können. Geist
und Seele beeinflussen den Körper, weil sie körperlich
sind. Der Körper beeinflusst Seele und Geist, weil diese
körperlich sind, wenn uns auch unser Erleben nicht körperlich
erscheint.
Seele und Geist sind "nur" unterschiedliche Aspekte ein und derselben körperlich-materiellen
Vorgänge; Seele und Geist sind "nur" spezielle Erscheinungsformen
des Körperlich-Materiellen. Die Geschichte der Identitätstheorie
ist im Grunde identisch mit dem Materialismus, der schon in der Antike
beginnt:
"Wie schon erwähnt hat der Materialismus eine
lange Tradition in der europäischen Philosophiegeschichte, die bei
den Atomisten Leukipp (geb. ca. 480/470 v.u.Z.) und Demokrit (um 460-370
v.u.Z.) im antiken Griechenland beginnt. Auch Epikur (341-271 v.u.Z.)
vertrat eine materialistische Auffassung: ihm zufolge ist auch die Seele
genauso wie der Leib aus Atomen zusammengesetzt, sodaß alle menschlichen
Funktionen als Ergebnisse von Prozessen zwischen den Atomen aufgefaßt
werden können. In der Neuzeit entwickelte v.a. Thomas Hobbes (1588-1679)
eine umfassende materialistische Theorie. ... Im 18. Jahrhundert
wurde der Materialismus von einigen französischen Denkern wieder aufgegriffen,
von denen v.a. Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) große
Beachtung verdient. Nach seiner in L’homme machine (1748) vertretenen
berühmten Auffassung existiert der Mensch wie eine Maschine: die Bewußtseinsvorgänge
sind rein physiologisch als Funktionen körperlicher Zustände
zu erklären."
__
Ikonischer Speicher Speicher
für visuelle Informationen.
__
Illusion Täuschung, Irrtum. Im allgemeinen
keine Bewusstseins-, sondern eine kognitive Verarbeitungsstörung (Deutung,
Interpretation), die aber durch Müdigkeit, Übergangszustände
(einschlafen, aufwachen) oder Sonderzustände (Trance) erleichtert
bzw. gefördert werden kann.
__
Implizites Gedächtnis
lexikon.stangl:
"Das implizite Gedächtnis ist jener Teil des menschlichen Gedächtnisses,
der sich auf Erleben und Verhalten des Menschen auswirkt, ohne dabei ins
Bewusstsein zu treten, und grenzt diesen zum expliziten Gedächtnis
ab, dessen Gedächtnisinhalte bewusst sind und daher auch berichtet
werden können. Ein zentraler Teil des impliziten Gedächtnisses
ist das prozedurale Gedächtnis, in dem automatisierte Handlungsabläufe
wie Gehen, Radfahren usw. gespeichert sind. Wirksam wird das implizite
Gedächtnisses unter anderem beim Priming, d.h., wenn ein Reiz implizit
Gedächtnisinhalte aktiviert, kann dadurch die Verarbeitung eines nachfolgenden
Reizes beeinflusst werden. Auch der Mere-Exposure-Effekt, nach dem Menschen
Dinge nach bloßer Wahrnehmung positiver bewerten, beruht meist auf
dem impliziten Gedächtnis, so dass man etwa Aussagen nur deshalb als
zutreffend ansieht, da man sie schon öfter gehört hat."
__
Indexieren [W160417]
z.B. ein Sachgebiet nach Schlagworten ordnen.
__
Isocortex [W160417]
__
Katalepsie, kataleptisch
[W160418]
"Katalepsie (griechisch ... - das Besetzen, Festhalten, deutsch auch Starrsucht,
auch stupor vigilans ist eine neurologische Störung. Sie äußert
sich darin, dass aktiv oder passiv eingenommene Körperhaltungen übermäßig
lange beibehalten werden. Wird zum Beispiel ein Bein passiv von der Unterlage
abgehoben, bleibt dieses nach dem Loslassen in der Luft. Die Störung
tritt vor allem bei schizophrenen Erkrankungen auf, aber zum Teil auch
bei organischen Hirnerkrankungen. Die Katalepsie ist von der Kataplexie
zu unterscheiden.
Die Katalepsie ist oft vergesellschaftet mit einer
starken psychomotorischen Verlangsamung und einer ausgeprägten Störung
des Antriebs, ein Zustand, der als Stupor bezeichnet wird. Von einer Katalepsie
Betroffene weisen nicht selten eine wächserne Erhöhung des Muskeltonus
bei passiven Bewegungen auf, die sogenannte Flexibilitas cerea, das heißt,
die Gelenke lassen sich mit geringer Mühe passiv beugen und behalten
die gegebene Stellung bei.[1]
Neben der krankhaften Form kann die Katalepsie auch
bei einer hypnotischen Trance als eines der sogenannten hypnotischen Phänomene
auftreten oder gezielt der in Trance befindlichen Person vom Hypnotiseur
suggeriert werden."
__
Katatonie, kataton psychomotorisches
Syndrom (Kahlbaum) mit den Hauptausprägungen: Erstarrung, Anspannung,
Erregung.
__
Kausalitaet
__
Klarheit Bewusstheitsmerkmal.
__
Kollektives Bewusstsein Konstruktion
von Bewusstseinsmerkmalen, die Kollektiven zukommen, wahrscheinlich aufgrund
gemeinsamer Sozialisationserfahrungen und soziokulturellen Hintergründen
oder Einbettungen. C. G. Jung nahm ein kollektives Unbewusstes an und konstruierte
sog. Archetypen. Forschungsbelege sind schwierig.
__
Koma Koma I < Koma II < Koma III <
Koma IV. Glasgow Coma Scale: [Notmed.info]
__
Konsolidierung Festigung
einer Entwicklung, z.B. eines Lernens. > Lexikon der Neurowissenschaft.
__
Konzentration sowohl gerichtete
als auch verdichtete Aufmerksamkeit, wegblenden von anderem Nicht-dazu-Gehörendem,
Störenden.
__
Krankheit,
Krankheitsbegriff, Krankheitsmodelle > Überblick.
__
Kurzzeitgedaechtnis Das
Lexikon der Neurowissenschaft: "Kurzzeitgedächtnis s, Immediatgedächtnis,
Neugedächtnis, Primärgedächtnis, Abk. KZG, E short-term
memory, Gedächtnis für Informationen, das maximal wenige Minuten
anhält, in der Regel nur einige Sekunden. Seine Kapazität wird
auf 100 bis 400 Bit geschätzt. Es ist ein Temporärspeicher und
basiert auf vorübergehenden Veränderungen der Stärke synaptischer
Kontakte (Synapsen), also auf elektrochemischen Erregungsmustern in mehr
oder weniger großen Gruppen von Nervenzellen und von diesen Aktivitäten
ausgelösten biochemischen Stoffwechselkaskaden."
__
Langzeitgedaechtnis Lexikon
der Neurowissenschaften: "Langzeitgedächtnis s, E long-term memory,
Gedächtnis für Informationen, das Tage, Monate oder sogar ein
ganzes Leben lang anhält. Seine Kapazität wird auf 10 Milliarden
bis 100 Billionen Bit geschätzt. ..."
__
Lenkung,
Regelung oder Steuerung
Ein Flugzeug kann auf Autopilot eingestellt werden, es fliegt dann
nach einem Programm, das vielleicht auch eine Rückschaltung auf den
Piloten enthält, wenn bestimmte kritische Ereignisse eintreten. Die
Überwachung der Ereignisse entspricht der Wahrnehmung, die Steuerung
der Lenkung.
__
Loeschen
(Exstinktion)
__
LTD Langzeitdepression
[W]
__
LTP Langzeitpotenzierung
[W]
__
Lucid traeumen einerseits
wissen, dass man träumt, andererseits Einfluß nehmen auf den
Verlauf des Traumes. [Q]
__
Luzidität Dimension der Bewusstseins"helligkeit",
also Klarheit, Schärfe.
__
Markowitsch Bio-Psychologe und
Gedächtnisforscher, der mit bildgebenden Verfahren arbeitet. [W]
__
Meditation
__
Mentales Training oder Bewusstseinslenkung.
Spezielle geistige oder Erlebensübungen, besonders geeignet um unerwünschte
Bewusstseinsinhalte oder Prozesse zu unterbrechen oder zu verändern.
__
Modul, Modularitaet
Teil, Teilaufgaben. Beschränkung auf bestimmte Funktionen oder
Regionen. Vermutlich gibt es z.B. ein Erinnerungsmodul, über das wir
aber kaum etwas wissen. Wir wissen, dass wir uns erinnern
können und tun dies auch andauernd, aber wir wissen meist nicht, wie
wir das tun. Wahrscheinlich wird ausgehend vom einem Basissachverhalt über
Assoziationen mehr und mehr Erinnerung reaktiviert.
__
Molekulare
Mechanismen von Lernen und Gedaechtnis
-
Kandel & Hawkins (1992) "Molekulare Grundlagen des Lernens", Spektrum
der Wissenschaft, 66-76 (online verfügbar).
-
Bear et al. (2009), Kapitel 25.
-
Stangl: "Die Chemie des Lernens"
-
Uli Müller und Martin Schwärzel (2005) Die molekularen Grundlagen
von Lernen und Gedächtnis.
__
MRT Magnetresonanztomographie. [W]:
"Die Magnetresonanztomographie (MRT, kurz auch MR; Tomographie von altgriechisch
... tome ‚Schnitt‘ und ... graphein ‚schreiben‘) ist ein bildgebendes
Verfahren, das vor allem in der medizinischen Diagnostik zur Darstellung
von Struktur und Funktion der Gewebe und Organe im Körper eingesetzt
wird. Es basiert physikalisch auf den Prinzipien der Kernspinresonanz (NMR),
insbesondere der Feldgradienten-NMR, und wird daher auch als Kernspintomographie
bezeichnet (umgangssprachlich gelegentlich zu Kernspin verkürzt).
Die ebenfalls zu findende Abkürzung MRI stammt von der englischen
Bezeichnung Magnetic Resonance Imaging."
__
Muede, Muedigkeit Alltägliche
Erfahrung, das ein Bedürfnis nach Erholung (Pause, Schlaf. Nickerchen)
anzeigt, weil Erleben und Verhalten Energie verbraucht.
__
Multiple Persönlichkeit(en)
[W]
__
Mustererkennung Hochdifferenzierte
Wahrnehmungsleistungen von Lebewesen.
__
Mutismus Schweigekrankheit, von mutare
= schweigen. Auch elektiver oder selektiver Mutismus, wenn das Schweigen
auf bestimmte Situationen, z.B. in der Schule, Familie, Kontakte, beschränkt
ist.
__
Nahtoderfahrung [W]
__
Narkose Medizinisch herbeigeführter
Zustand der Bewusstlosigkeit, um schmerzhafte körperliche Eingriffe
durchzuführen.
__
Narkolepsie Schlafkrankheit.
__
narrative Form W:
"Eine Erzählung (lat.: narratio) ist eine Form der Darstellung. Man
versteht darunter die Wiedergabe eines Geschehens in mündlicher oder
schriftlicher Form. Deren Ergebnis, eine Geschichte im Sinne des englischen
Begriffs story, nennt man Narration. Der Akt des Erzählens wird Narrativität
genannt. Das Attribut narrativ wird auch für die Methode verwendet,
Sachverhalte und Lehren in Form von stories zu vermitteln.
Eine Minimaldefinition von Erzählung ist: Jemand
erzählt jemand anderem, dass etwas geschehen ist. Wesentlich ist dabei
die dynamische Verbindung zwischen dem, was erzählt wird und dem,
wie es erzählt wird. Eine Erzählung lässt sich also daran
erkennen, dass sie doppelwertig ist. Dies kann auch in zeitlicher Hinsicht
formuliert werden. Dann geht es um den interaktiven Zusammenhang zwischen
der Zeit, in der das Erzählte spielt, im Verhältnis zu derjenigen
Zeit, in der erzählt wird, was geschehen ist. Sind keine Interaktionen
zwischen zwei Faktoren dieser Art auszumachen, ist es keine Erzählung.[1]"
__
natcode > Identitätstheorie,
besonders Natcode.
Ein wichtiger biopsychischer Hilfsbegriff der Identitätstheorie
zur Kodierung psychischer und biologischer Vorgänge. Jedes Erleben
bedarf einer biologischen Basis, aber nicht umgekehrt. Die meisten biologischen
Vorgänge werden nicht erlebt. Da die naturwissenschaftliche Kodierung
vieler Erlebensvorgänge - noch - nicht bekannt ist, soll die technische
Hilfs-Variable "natcode" diese - noch - unbekannten Vorgänge repräsentieren.
Das Erleben selbst ist an das Leben gebunden. Nur Lebende können erleben.
Aber auch das Erleben muss biologisch kodiert sein. Zum Erleben gehören
zwei Kodierungen: (1) der biologische Vorgang und (2) das Erleben dieses
Vorganges. Damit findet der uralte Dualismus eine scheinbare Entsprechung
in diesem Modell.
Allgemeine Kodierungs-Schemata:
-
natcode(bio): die naturwissenschaftliche Kodierung eines biologischen Vorganges,
der unabhängig vom Erleben erfolgen kann..
-
natcode(erleben(natcode(bio)))) die naturwissenschaftliches Kodierung des
Erlebens eines biologisches Vorganges.
__
NCC neuronal correlates consciousness [Chalmers2000]:
Die Suche nach neuronalen Korrelaten des Bewusstseins (oder NCC) wird als
Grundstein des Wiederauflebens der Wissenschaft des Bewusstseins angesehen.
Folgende Vorschläge über die Art und Lage der neuronalen Korrelate
des Bewusstseins wurden z.B. gemacht:
-
40-Hz-Schwingungen in der Großhirnrinde (Crick und Koch 1990)
-
Intralaminare Kerne im Thalamus (Bogen 1995)
-
Re-intrant Schleifen in thalamokortikalen Systeme (Edelman 1989)
-
40-Hertz-rhythmische Aktivität in thalamokortikalen Systemen (Llinas
et al 1994)
-
Erweitertes retikuläres Thalamus-Aktivierungs-System (Newman und Baars
1993)
-
Neurale Bereiche gebunden durch NMDA (Flohr 1995)
-
Bestimmte neurochemischen Ebenen der Aktivierung (Hobson 1997)
-
Bestimmte Neuronen im inferior temporalen Kortex (Sheinberg und Logothetis
1997)
-
Neuronen im extrastriären visuellen Kortex, projiziert in präfrontale
Bereichen (Crick und Koch 1995)
-
Visuelle Verarbeitung im ventralen Strom (Milner und Goodale 1995)
__
Nervenzellen (Neuronen) [W]
Bei den Nervenzellen werden Neurone und Gliazellen unterschieden. Man schätzt
ca. 100 Milliarden Neurone.
__
Neurogenese > Nervenzellen.
Neubildung von Nervenzellen (im Erwachsenenalter). Schiepek (2011,
Hrsg.), S. 86-94: Die Neuentstehung von Nervenzellen im erwachsenen Gehirn.
Die DGN teilt am 18.09.2014 mit: "Neue Nervenzellen nach Schlaganfall?
Mit der aus der Archäologie bekannten Radiokarbonmethode können
Forscher erstmals das Alter von Nervenzellen exakt bestimmen. Sie gehen
damit einer zentralen Frage der Neurologie nach: Erholt sich das Gehirn
nach einem Schlaganfall?
18. September 2014 – Das menschliche Gehirn kann
auch im Erwachsenenalter neue Nervenzellen bilden – mit dieser Meldung
machte vor einigen Jahren die Neurowissenschaft Furore. Denn bis dahin
galt eisern: Erwachsene Gehirne bilden keine neuen Nervenzellen mehr. Allerdings:
Die Neubildung von Neuronen, die sogenannte Neurogenese, konnte beim gesunden
Erwachsenen bisher nur im Hippocampus nachgewiesen werden, einem kleinen,
tiefer sitzenden und evolutionär sehr alten Areal im Gehirn. Seitdem
suchten die Wissenschaftler auch nach neugebildeten Zellen in der Großhirnrinde
(Neokortex), in der alle höheren Funktionen des Gehirns angelegt sind,
etwa das Sprechen, Verstehen und Entscheidungszentren. Und im Tierversuch
sah es in jüngster Zeit ganz danach aus, dass auch hier neue Zellen
entstünden – eine hervorragende Basis für neue Therapieansätze
nach einem Schlaganfall. Diese Forschung hat nun mithilfe der aus der Archäologie
bekannten Radiokarbonmethode eine überraschende Wendung erfahren,
teilt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie heute auf der Neurowoche
in München mit: Offenbar werden im Kortex doch keine neuen Zellen
gebildet – weder im Gesunden noch bei Patienten mit Schlaganfall. „Die
Wiederherstellung von verlorenen Gehirnfunktionen nach einem ischämischen
Schlaganfall im Kortex muss auf andere Ursachen, wie Plastizitätseffekte,
zurückgehen“, sagt PD Dr. Hagen B. Huttner, Oberarzt der Neurologie
am Universitätsklinikum Erlangen und Erstautor der Studie eines internationalen
Forscherteams, die vor Kurzem in Nature Neuroscience erschienen ist. Allerdings
können geschädigte Nervenzellen ihr Erbgut reparieren und so
überleben. ...."
Quellen:
-
Huttner HB et al: The age and genomic integrity of neurons after cortical
stroke in humans. Nat Neurosci. 17(6):801-3.
-
Spalding KL et al: Dynamics of hippocampal neurogenesis in adult humans.
Cell. 153(6):1219-27
-
Gestörte Neurogenese Bock, Jörg & Braun,
Katharina (2012), S. 152.
__
Neuromathematik
Bentz, Hans-Joachim & Dierks, Andreas (2013) Neuromathematik
und Assoziativmaschinen. Berlin: Springer-Vieweg. Vorwort: "Dieses Buch
richtet sich vornehmlich an Studierende und Dozenten der Informatik, Informationstechnologie,
Mathematik, einschließlich der zugehörigen Lehrämter, Ingenieur-
und Neurowissenschaften. Es bietet einen Ansatz zur Neuromathematik und
eine ins Einzelne gehende Darlegung des Aufbaus, der Eigenschaften und
Programmierweisen von Assoziativmaschinen. Dieses sind frei programmierbare
Maschinen, deren Programm- und Datenspeicher aus Assoziativspeichern aufgebaut
sind. Da Assoziativmaschinen kein Rechenwerk sondern ein Assoziierwerk
besitzen, müssen sie bei Bedarf ihre Rechenfertigkeiten erst erlernen.
Das kann auf verschiedene Weise geschehen, wie die ausführlichen Erläuterungen
im Kapitel über das Assoziative Rechnen zeigen. Dabei gelangt man
zum Einsatz von Variablen, in denen sich Eindrücke und Begriffe sammeln
und die unter anderem ein Rechnen auf natürliche Weise beschreiben
lassen."
__
Neuronales Netzwerk
__
Neuroplastizitaet [W160417]
"Unter neuronaler Plastizität versteht man die Eigenart von Synapsen,
Nervenzellen oder auch ganzen Hirnarealen, sich zwecks Optimierung laufender
Prozesse in ihrer Anatomie und Funktion zu verändern. Je nach betrachtetem
System spricht man zum Beispiel von synaptischer Plastizität oder
kortikaler Plastizität.
Der Psychologe Donald Olding Hebb gilt als der Entdecker
der synaptischen Plastizität. Er formulierte 1949 die Hebbsche
Lernregel in seinem Buch The Organization of Behavior.[1]"
__
Neurotransmitter Überträgerstoffe,
z.B. Acetylcholin, Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, die in Millisekunden
Potentialänderungen hervorrufen.
__
Nicht Bewusstes Das meiste Geschehen
in uns ist uns nicht bewusst (> Carus).
__
Normalbedingungen allgemeinwissenschaftliche
wichtige Randbedingungen für die eine Aussage gelten soll. Viele wissenschaftliche
Aussagen gelten regelhaft oft nur unter "Normalbedingungen", die jeweils
zu definieren sind.
__
Ohnmacht (Synkope) meist kurzfristiger
Verlust des Bewusstseins. [W]
__
Oneiroid traumartige Desorientierung.
_
P300
Brain Fingerprinting Laboratories, Inc. hat nach Dr. Lawrence Farwell
patentierte EEG/P300 basierte Prüfsysteme entwickelt, die mit extrem
hoher Genauigkeit feststellen, ob oder ob nicht spezifische Informationen
im Gedächtnis einer Person gespeichert werden. Der Test mißt
einzelne Gehirnwellen-Reaktionen (P300 Welle) zu relevanten Wörtern,
zu Abbildungen oder zu Tönen, die durch einen Computer dargestellt
werden. Die Maße werden nach der Reizvorgabe im Bruchteil einer Sekunde
erfaßt, noch bevor die ProbandIn in der Lage ist, zu antworten oder
Kontrolle auszuüben. Als sehr wichtig hat sich für die Firma
die Anwendung und Zulässigkeit als Beweismittel vor Gericht ergeben.
Die Technologie hat viele aufregende Anwendungen in einigen sehr großen
Märkten: Staatssicherheit, Geheimdienste, Polizei, medizinische Diagnose,
Werbung, Versicherungsbetrug und vor Gericht.
Anmerkung: Sämtliche Links die Fehler 404 produzierten wurden
gelöscht.
Prof. Engel äußerte sich auf der Tagung im turmdersinne
2004 kritisch zur Eindeutigkeit des P300
Signals.
__
Pareidolie "'Hineinsehen' von Gestalten
in ein unklar strukturiertes visuelles Erlebnisfeld (z.B. alte Mauerwerke,
Wolken, Tapeten, Teppichmuster u.ä.)." [Scharfetter 1976, S. 136]
__
Penfield
"Der Neuropsychologe Erich Kasten schreibt: "Wilder Penfield stimulierte
als erster seit Mitte der 30er Jahre die Hirnrinde von Patienten elektrisch.
Diese Versuche wurden insbesondere an Patienten mit Hirntumor durchgeführt.
Bei geöffnetem Schädel wird der Neocortex hier mit schwachen
elektrischen Strömen stimuliert. Auf eine solche Reizung erfolgten
bei den Patienten, abhängig vom Ort der Stimulation, lebhafte akustische
oder visuelle Halluzinationen, welche die Patienten trotz der nüchternen
Atmosphäre des Operationssaales als überwältigend real erlebten
und mitunter bis ins kleinste Detail schilderten. Diese Detailtreue führte
Penfield zu der Annahme, dass das Gehirn praktisch eine vollständige
Erinnerung an alle Ereignisse des Lebens bewahrt. Penfield (1930, 1950,
1954) stellte bei Reizung des Okzipitalpols unbewegte, bei Stimulation
der Okzipitalkonvexität aber bewegte Photopsien fest. Auch bei Reizung
des Temporallappens entstanden visuelle Halluzinationen, die allerdings
im gesamten Gesichtsfeld und nicht nur halbseitig auftraten (Penfield &
Perot, 1963)."
An anderer Stelle heißt es auf der Homepage
von Privatdozent Dr. Erich Kasten, Neuropsychologe am Institut für
Medizinische Psychologie des Universitätsklinikums der Otto-von-Guericke
Universität in Magdeburg: "Einen frühen Hinweis darauf,
dass Halluzinationen in erster Linie einen ungeordneten Abruf von im Gedächtnis
gespeicherten Informationen darstellen, lieferte der Neurochirurg Wilder
Penfield schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Penfield stimulierte
während Hirnoperationen die Cortexoberfläche von Patienten elektrisch
und ließ sich die wahrgenommenen Veränderungen beschreiben.
Auf eine solche Reizung erfolgten, abhängig vom Ort der Stimulation,
lebhafte akustische oder visuelle Halluzinationen, welche die Patienten
trotz der nüchternen Atmosphäre des Operationssaales als überwältigend
real erlebten und mitunter bis ins kleinste Detail schilderten. Diese Detailtreue
führte Penfield zu der Annahme, dass das Gehirn praktisch eine vollständige
Erinnerung an alle Ereignisse des Lebens bewahrt. Die eigentliche Leistung
des Verstandes besteht wohl darin, die riesige Menge von Erinnerungen,
die man im Lauf des Lebens aufnimmt, abzukapseln und nur auf Abruf bewusst
werden zu lassen." Und:
"Träume zeigen, dass nicht nur eine neuronale
Hyperaktivität des Gehirns Ursache für Halluzinationen sein muss,
sondern offenbar ebenso eine Unterversorgung mit aktuellen Informationen.
Einen Großteil unserer menschlichen Intelligenz hat der Mensch sich
damit erkauft, dass er nun ein Gehirn besitzt, das nach ständiger
Stimulation verlangt. Bleibt diese längere Zeit aus, so holt sich
das Gehirn hier aus den Gedächtnisspeichern irgendwelche Informationen,
meist völlig ohne äußere Reizgeber und ohne auf die Sinnesorgane
angewiesen zu sein. Zum Teil werden Tageserlebnisse nachempfunden oder
auch antizipiert. Zum anderen Teil tauchen aber häufig auch uralte
Informationen aus der Jugend oder der Kindheit auf, die wir längst
vergessen glaubten und die Penfields Ansicht, dass das Gehirn fast alle
Erinnerungen speichert, wirkungsvoll unterstreicht." [IP-GIP
Sekundär-Quelle]
__
PET
__
Plastizität Anpassungsfähigkeit
an Gegebenheiten oder Aufgaben. > Neuroplastizität.
__
Priming > Bahnung,
Vorbereitung. Bereits Erfahrenes wird schneller erkannt, quasi durch Voreinstellung.
Darin kann auch eine Gefahr für Vorurteile und Fehler liegen. Das
Lexikon
der Psychologie führt aus: "Priming-Effekt, auch: assoziative
Aktivierung, Aktivierungsausbreitung, Kontext-Effekt, “Zündung”, nach
Lashley die unterschwellige Aktivierung von Assoziationen. Beispiel: Die
Beantwortung einer Frage wirkt sich auf die nachfolgenden Fragen aus. Wird
z.B. nach einem Objekt gefragt, das eine besonders negative Bewertung hervorruft,
kann sich diese negative Bewertung auf alle anderen nachfolgenden mit dem
Objekt assoziierten Fragen auswirken. Priming liegt also vor, wenn das
Auftreten eines Ereignisses A die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des
Ereignisses B, das mit dem Ereignis A verbunden ist, vergrößert
(Informationsverarbeitung, Gedächtnis)."
__
Prosopagnosie Verlust der Gesichter-Erkennung
__
Prozedurales Gedaechtnis
LexikonStangl:
"Das prozedurale bzw. implizite oder nicht-deklarative Gedächtnis
beinhaltet Fertigkeiten, die automatisch, ohne Nachdenken eingesetzt werden.
Dazu gehören vor allem motorische Abläufe (Fahrradfahren, Schwimmen,
Tanzen, Skifahren, etc.). Der Inhalt des prozeduralen Gedächtnisses
kann nur im Kontext einer bestimmten Prozedur, eines bestimmten Verhaltens
abgerufen werden. Das Sitzen auf einem Fahrrad löst, falls man Radfahren
gelernt hat, bestimmte motorische Aktivitäten aus, die bei anderen
Verhaltensweisen, etwa beim Klavierspielen, nicht verwendet werden."
__
relationales Gedaechtnis
vom
Lexikon der Neurowissenschaft auch explizites
Gedächtnis genannt. rG hat weder in Eysenck et al. noch
im Dorsch oder bei Hoffmann & Engelkamp einen eigenen (Sachregister)
Eintrag. Die Wortschöpfung sollte erwarten lassen, dass es bei diesem
Gedächtniskonstrukt um verbundene (relationale) Gedächtnisinhalte
geht. Das dürfte aber kein zweckmäßiges Unterscheidungskriterium
sein, weil in allen Gedächtnisarten Verbindungen eine Rolle spielen.
__
Schlaf [W]
__
Schlaefrig zum Schlafen zu Mute; müde.
__
Schlafstoerungen In der Anamnese
kann man zunächst grob erfassen: Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen,
Alpträume, Erholungswert des Schlafes.
__
Schlafwandeln (Somnambulismus) [W]
__
Schwindel > HNO-Ärzte im
Netz. Vielfältige Erscheinung mit mannigfachen Ursachen oder Auslösern,
die auch zu Ohnmachten führen kann.
__
Selbst
__
Selbstorganisation Grundlegender
neuerer Wissenschaftsbegriff. Organisation ohne "Zentralregierung".
__
Semantisches Gedaechtnis
der
Bedeutungen (Faktenwissen)
__
Semiotisch-Terminologisches
1)
Mit
dem griechischen Buchstaben Theta J
(nach Jerapeia
(therapeia): Heilung) kennzeichnen wir Psychische Funktionen, wenn sie
Heilmittel oder Heilwirkfaktoren Qualität (Funktion) annehmen,
z. B. J
einsehen, J
zulassen unterdrückter Erinnerungen, J
stellen (konfrontieren), J
sich überwinden und
J
mutig sein,
J
differenzieren, J
entspannen, J
lernen, J
loslassen, J
beherrschen ... Und um deutlich zu machen, dass wir ein Wort nicht
alltagssprachlich, sondern im Rahmen einer psychologisch-psychotherapeutischen
Fachsprache verwenden, kennzeichnen wir das Wort mit dem griechischen Buchstaben
y
(Psi, mit dem das griechische Wort für Seele = yuch,
sprich: psyche, beginnt). Störungs Funktor. Begriffe, die eine
Störung repräsentieren sollen, kennzeichnen wir mit dem Anfangsbuchstaben
Tau (t) des griechischen Wortes für Störung
tarach
(tarach). Viel
Verwirrung gibt es in und um die Psychologie, weil viele ihrer Begriffe
zugleich Begriffe des Alltags und anderer Wissenschaften sind. Um diese
babylonische Sprachverwirrung, die unökonomisch, unkommunikativ und
entwicklungsfeindlich ist, zu überwinden, ist u. a. das Programm der
Erlanger Konstruktivistischen Philosophie und Wissenschaftstheorie entwickelt
worden: Kamlah & Lorenzen (1967). Zu einigen psychologischen Grundfunktionen
siehe bitte: vorstellen.
Ausführlich
zur Terminologie.
Querverweise
(Links) zum Terminologie-Problem in der Psychologie, Psychopathologie,
Psychodiagnostik und Psychotherapie:
__
Skript vieldeutiges Homonym [W]
In der Psychotherapie (Transaktionsanalyse, NLP) ein Programm, das im Rahmen
von Therapiezielen und - plänen aktiviert oder deaktiviert werden
soll.
__
Somnambul a) Schlafwandeln. b)
schlafähnlich (Hypnoseschlaf),
__
Somnolenz Erster, leichter Benommenheits-
oder Bewusstseinstrübungsgrad.
__
Sonderzustaende
__
Sopor Bewusstseinstrübung
(3. Grad).
__
Sperrung psychopathologisches Symptom,
nicht gut definiert und operationalisiert und daher meist nicht ganz einfach
oder hinreichend sicher festzustellen. Peters (1987): "Sperrung (KRAEPELIN).
Für Schizophrenie sehr typisches Symptom: Der Gedankenfaden reißt
plötzlich ab, wodurch eine Pause im Denken (und Sprechen) entsteht.
In schwereren Fällen versiegt der Gedankenstrom für längere
Strecken ganz. Der Unterschied zu dem verwandten Symptom der Hemmung bei
Depression entspricht dem der Physik entnommenen Bild. Der Lauf eines Rades
wird durch eine Last erschwert, gehemmt, aber durch Sperrvorrichtung verhindert.
Ist die Sperre beseitigt, so ist das Tempo der Bewegung normal. Schizophrene
entwickeln zu dieser von ihnen selbst wahrgenommenen Denkstörung oft
einen Erklärungswahn und erleben sie als von außen gemacht,
durch Hypnose oder Apparate beeinflußt. Die Bez. wurde ursprünglich
von KRAEPELIN verwendet, um die Eigenart der Bewegungsstörung bei
Katatonie zu beschreiben, dann aber von BLEULER analog zur Kennzeichnung
schizophrener Denkstörung gebraucht. fr: barrage; e: barrage, stroking
blocking". In dieser Charakterisierung ist störend, dass Sperrung
über Gedankenabreißen, auch ein schizophrenes Symptom, bestimmt
wird. Beide - Gedankensperrung und Gedankenabreißen - braucht man
nicht.
__
Striatum [W]
Bear et al. (2009), S. 852: "Striatum und prozedurales Gedaechtnis"
__
Stupor Erstarrung. [W]
__
Synapse Neuronale Basisschnittstelle zwischen
Nerven- und Effektorzellen. Im Durchschnitt hat eine Nervenzelle ungefähr
1000 ausgehende und ca. 10000 eingehende Kontakte (> Lexikon der Neurowissenschaft).
__
Synaptische
Plastizitaet im Hippocampus
Bear et al. (2009), S. 883.
__
Synergetik Zusammenwirken.
__
Synkope > Ohnmacht.
__
Tagtraum (selbsterklärender Name).
__
Teil Herausgelöst aus einem Ganzen
zu dem es gehört.
__
Temporallappen [W]
Bear et al. (2009), S. : "Temporallapen und adaptives Gedächtnis"
__
Transienten Begriff neuronaler
Netzwerke.
__
Trance eigener Bewusstseinszustand,
der für Suggestionen besonders empfänglich macht. Gedankenloren,
geistesabwesend.
__
Traum REM-Schlaf-Traum, NREM-Schlaf
Traum, Luzider Traum.
__
Tunnelblick [W]
scheinbar einen fernen Punkt fixieren: kann eine besondere Konzentration
und Abwesenheit (Trance) bedeuten.
__
Ultrakurzzeitgedaechtnis
prüft,
ob Informationen von Interesse sind und an das Kurzzeitgedächtnis
weitergeleitet werden sollen.
__
Unbewusstes
Die neutrale Bedeutung ist Nichtbewusstes. Durch Freud und die Psychoanalyse
wurde eine weitere spezielle Bedeutung begründet, was sich etwa darin
ausdrückt, dass vom "System Ubw" gesprochen wird. Damit ist ein grundlegender
Bereich gemeint, der den Menschen bestimmt.
Freud (1916): "All dies alte Infantile, was einmal
herrschend und alleinherrschend war, müssen wir heute dem Unbewußten
zurechnen, von dem unsere Vorstellungen sich nun verändern und erweitern.
Unbewußt ist nicht mehr ein Name für das derzeit Latente, das
Unbewußte ist ein besonderes seelisches Reich mit eigenen Wunschregungen,
eigener Ausdrucksweise und ihm eigentümlichen seelischen Mechanismen,
die sonst nicht in Kraft sind." Und später, S. 292f: "Ich will
Ihnen auseinandersetzen, welche theoretischen Vorstellungen sich allein
brauchbar erwiesen haben, um den Begriff der Verdrängung an eine bestimmtere
Gestalt zu binden. Es ist vor allem dazu notwendig, daß wir von dem
rein deskriptiven Sinn des Wortes »unbewußt« zum systematischen
Sinn desselben Wortes fortschreiten, das heißt wir entschließen
uns zu sagen, die Bewußtheit oder Unbewußtheit eines psychischen
Vorganges ist nur eine der Eigenschaften desselben und nicht notwendig
eine unzweideutige. Wenn ein solcher Vorgang unbewußt geblieben ist,
so ist diese Abhaltung vom Bewußtsein vielleicht nur ein Anzeichen
des Schicksals, das er erfahren hat, und nicht dieses Schicksal selbst.
Um uns dieses Schicksal zu versinnlichen, nehmen wir an, daß jeder
seelische Vorgang - es muß da eine später zu erwähnende
Ausnahme zugegeben werden - zuerst in einem unbewußten Stadium
oder Phase existiert und erst aus diesem in die bewußte Phase übergeht,
etwa wie ein photographisches Bild zuerst ein Negativ ist und dann durch
den Positivprozeß zum Bild wird. Nun muß aber nicht aus jedem
Negativ ein Positiv werden, und ebensowenig ist es notwendig, daß
jeder unbewußte Seelenvorgang sich in einen bewußten umwandle.
Wir drücken uns mit Vorteil so aus, der einzelne Vorgang gehöre
zuerst dem psychischen System des Unbewußten an und könne dann
unter Umständen in das System des Bewußten übertreten.
Die roheste Vorstellung von diesen Systemen ist die für uns bequemste;
es ist die räumliche. Wir setzen also das System des Unbewußten
einem großen Vorraum gleich, in dem sich die seelischen Regungen
wie Einzelwesen tummeln. An diesen Vorraum schließe sich ein zweiter,
engerer, eine Art Salon, in welchem auch das Bewußtsein verweilt.
Aber an der Schwelle zwischen beiden Räumlichkeiten walte ein Wächter
seines Amtes, der die einzelnen Seelenregungen mustert, zensuriert und
sie nicht in den Salon einläßt, wenn sie sein Mißfallen
erregen. Sie sehen sofort ein, daß es nicht viel Unterschied macht,
ob der Wächter eine einzelne Regung bereits von der Schwelle abweist
oder ob er sie wieder über sie hinausweist, nachdem sie in den Salon
eingetreten ist. Es handelt sich dabei nur um den Grad seiner Wachsamkeit
und um sein frühzeitiges Erkennen. Das Festhalten an diesem Bilde
gestattet uns nun eine weitere Ausbildung unserer Nomenklatur. Die Regungen
im Vorraum des Unbewußten sind dem Blick des Bewußtseins, das
sich ja im anderen Raum befindet, entzogen; sie müssen zunächst
unbewußt bleiben. Wenn sie sich bereits zur Schwelle vorgedrängt
haben und vom Wächter zurückgewiesen worden sind, dann sind sie
bewußtseinsunfähig; wir heißen sie verdrängt. Aber
auch die Regungen, welche der Wächter über die Schwelle gelassen,
sind darum nicht notwendig auch bewußt geworden; sie können
es bloß werden, wenn es ihnen gelingt, die Blicke des Bewußtseins
auf sich zu ziehen. Wir heißen darum diesen zweiten Raum mit gutem
Recht das System des Vorbewußten. Das Bewußtwerden behält
dann seinen rein deskriptiven Sinn. Das Schicksal der Verdrängung
besteht aber für eine einzelne Regung darin, daß sie vom Wächter
nicht aus dem System des Unbewußten in das des Vorbewußten
eingelassen wird. Er ist derselbe Wächter, den wir als Widerstand
kennenlernen, wenn wir durch die analytische Behandlung die Verdrängung
aufzuheben versuchen."
Freud, Sigmund (1969) Vorlesungen
zur Einführung in die Psychoanalyse. Und Neue Folge. Studienausgabe
Bd. I. Frankfurt aM: S, Fischer.
__
Verbinden Grundlegender allgemeiner
und wissenschaftlicher Begriff. Wichtige seelische Grundfunktion, Sachverhalte
zu verbinden.
__
Verdraengen unbewusst motiviertes
vergessen; ein Konzept (Abwehrmechanismus)
Freuds und der Psychoanalyse, bis heute nicht richtig nachgewiesen. Schon
von Kant
erwähnt.
__
Vergessen Wichtiger und mehrdeutiger
Grundbegriff der Gedächtniswissenschaften. Ganz allgemein: nicht mehr
zugängliche Information wird meist als vergessen bezeichnet. Hierbei
kann nur der Zugriff behindert, gehemmt oder gestört sein oder die
Information selbst verblassen oder zerfallen gedacht werden. Gegen zerfallen,
verschwinden oder auflösen spricht, dass die neurobiologische
Forschung (> Materialien)
bestreitet, dass es ein Löschen gibt.
__
Verwirrt, Verwirrung besonderer
Bewusstseinszustand, der oft mit mehr oder minder Desorientierung einhergeht.
__
Verzueckung besonderer und intensiver
Bewusstseinszustand.
__
Vigilanz Wachheit; quantitativ:
Ausprägung der Wachheit.
__
Vorbewusstes etwas aktuell nicht
Bewusstes, aber grundsätzlich bewusstseinsfähiges.
__
Vorstellung,
vorstellen
__
Wach, Wachheit Grundlegender Bewusstheitszustand.
__
Wachkoma (apallisches Syndrom) [W]
__
Wachtraum traumartiges Erleben im Wachzustand
> Tagtraum. Zur Erforschung des Erlebens sind Normierungen hilfreich.
__
Wahrnehmung [W]
__
Wecken schönes, einfaches Alltagsbeispiel
für nicht bewusstes wahrnehmen. Der Wecker ruft aus dem Schlafzustand
in das Erwachen.
__
Willensfreiheit
[Libet, Beweis
zur Willensfreiheit Sponsel 2006]
__
Wissensgedaechtnis >
explizites, deklaratives, semantisches Gedächtnis.
__
Wissenssystem
Hier stellt sich die Frage, wie Wissen im Gedächtnis oder im Gehirn
organisiert ist und welche Varianten und Formen vorkommen. Die Gedächtnisfähigkeiten
der Menschen sind sehr unterschiedlich, so dass die Annahme naheliegt,
dass unterschiedliche Organisations- und Aneignungsformen vorliegen, die
teilweise auch durch Lernen und Übung verbessert werden können.
__
Zeitschriften
Gedaechtnis.
__
Zerstreut Wie der Namen in seiner allgemeinen
Bedeutung sagt, ist die Aufmerksamkeit zerstreut. Das ist einerseits eine
jedem bekannte alltägliche und vorübergehende Erfahrung. Andererseits
kann es sich auch um eine grundlegendere Störung wie bei der Aufmerksamkeitsdefizitstörung
(AD-H-D), die auch als sekundäres
Syndrom bei Stress, psychotischen oder psychoorganischen Störungen
auftreten kann.
__
Zustand wichtiger wissenschaftlicher
Grundbegriff neben Ereignis und Geschehen, in dem sich ein betrachtetes
Objekt oder System von Objekten befindet. Beim Bewusstsein sind es natürlich
die Grundzustände Wach, Schlaf, Traum, Trance, Bewusstlos.
__
Querverweise
Standort: Neurowissenschaftliche Psychotherapieforschung
*
-
Beweis und beweisen in Psychologie, Psychopathologie
und Psychotherapie.
-
Psychotherapieforschung,
Evaluation und Qualitätssicherung in der GIPT-Praxis.
-
Der Wissenschaftsbegriff
und seine aktuelle Bedeutung.
-
Die
grundlegenden Probleme und Aporie jeglicher Einzelfall- und damit Therapieforschung.
Grundzüge
einer idiographischen Wissenschaftstheorie.
-
Konzepte Idealer Psychologischer
Grundlagen Experimente zur operationalen Normierung psychischer
Elementarfunktionen. Definieren._*
-
Norm, Wert,
Abweichung (Deviation), Krank (Krankheit), Diagnose. "Normal", "Anders",
"Fehler", "Gestört", "Krank", "Verrückt".
-
Wissenschaftlicher
Grundbegriff Vergleichen. * Allgemeine
Theorie und Praxis Vergleichen._*
-
Die
grundlegenden Probleme und Aporie jeglicher Einzelfall- und damit Therapieforschung:
Grundzüge
einer idiographischen Wissenschaftstheorie.
Bissige
Kritik des numerologischen Szientismus in der Psychologie.
-
Die
Meta-Analyse von GRAWE et al. 1994 (Erfassung bis Ende 1983).
-
Meta-Analyse:
Was sind und was sagen Meta-Analysen aus?.
-
Zahlen und neue Zahlen zum
Messen im Unscharfen, Flüchtigen, Subjektiven und idiographischen.
-
Konstruktivismus - Formen
& Varianten.
Vulgärkonstruktivismus*
Welten
* Wirklichkeit und Sprache
*
-
Eine wissenschaftlich faire
Literaturanalyse zur Wissenschaftlichkeit der Psychotherapieverfahren
durch Erhebung von veröffentlichten Arbeiten zu oder mit folgenden
Themen: Dokumentation, Evaluation, Fallberichte, Indikation und Outcome
(Wirkungsforschung).
-
Überblick
der Signaturen: Dokumentations- und Evaluationssystem Allgemeine und Integrative
Psychotherapie.
*
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS). Neurowissenschaftliche
Psychotherapieforschung. Eine kritische Analyse am Beispiel Roth/Strüber
(2014): "Die Wirkungsweise der Psychotherapie aus Sicht des Neurowissenschaftlers".
Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie
IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/ptf/nwPTF.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_Neurowissenschaftlihe
PTF_Datenschutz_Überblick_Rel.
Aktuelles_Rel.
eständiges_
Titelblatt_
Konzept_
Archiv_
Region_
Service-iec-verlag__Wichtige
Hinweise Links u. Heilmittel
kontrolliert:
17./18.04.2016 irs
Änderungen wird
gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen
und Kritik willkommen
20.04.16 Wie
LSD das Ich auflöst - Studie zur Gehirnaktivität unter Drogen.
18.04.16 Nach
Prüfung auf Linkfehler ins Netz gestellt.
00.10.15 Ich
habe die Seite im Oktober 2015 angelegt und mit der Materialsammlung, Konzeption
und Darstellung begonnen. Als Beispiel habe ich die Arbeit von Roth &
Strüber gewählt: Die Wirkungsweise der Psychotherapie
aus Sicht des Neurowissenschaftlers.

