(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=02.04.2013 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 07.12.19
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_Zitierung & Copyright
Syndromverzeichnisse
> Symptomverzeichnis
von Rudolf Sponsel, Erlangen.
Editorial: Diese Seite ist eine Hilfsseite zu verschiedenen Ausarbeitungen
allgemeiner und spezieller, z..B. forensisch-psychopathologischer, Diagnostik,
Differentialdiagnostik und dem Befund, die auch für die Geschichte
der Psychodiagnostik von Interesse sein kann. Insbesondere sollen mit diesen
Arbeiten die terminologischen Probleme der Psychodiagnostik mehr und mehr
überwunden werden. Die operationalen internationalen Klassfikationssysteme
haben hier wichtige Impulse gegeben und eine Verbesserung des unerträglichen
Durcheinanders in der Psychodiagnostik auf den Weg gebracht. Ein wichtiges
und bis heute nicht befriedigend gelöstes Problem ist hierbei die
Syndromfrage, also eine typisch gedachte Symptomkonfiguration.
Zur
formalen Struktur, Zusammenhang Symptom und Syndrom. Erschwert wird
eine Lösung durch das Phänomen der Komorbidität.
Syndrombegriff.
Name für eine als typisch gedachte Konfiguration von Symptomen,
wobei nach dem medizinischen Krankheitsmodell einem Syndrom unterschiedliche
Störungen mit Krankheitswert oder Erkrankungen zugeordnet sein sein
können, so daß sich hier die Differentialdiagnose der Ätiologie
stellt.
Gross (1969, S.15f) führt zur Geschichte des
Syndrombegriffs aus:
"Heute hat sich unter dem Eindruck des Standardwerkes
von LEIBER und OLBRICH [84] sowie ähnlicher ausländischer Publikationen
[33, 277] sozusagen zwischen Symptom und Krankheit das Syndrom (.......
= zusammenlaufend, übereinstimmend) geschoben. Der Ausdruck Syndrom
wurde bereits von Hippokrates sowie von Galen als Begriff für eine
Gruppe von Krankheitszeichen benutzt. Werden Syndrome — wie das gelegentlich
geschieht — als reine Symptomkombinationen verstanden, haben sie allenfalls
Bedeutung im Sinne einer Vereinfachung. Symptomenkomplexe (oder „Syndrome"
in diesem allgemeinen Sinn) dürfen nicht mit Diagnosen verwechselt
werden.
Eine Anämie oder ein Pleuraerguß sind
z. B. solche Symptomenkomplexe, die allenfalls symptomatische Maßnahmen
erlauben. Erst die Diagnosen: 'Perniciöse Anämie' bzw. 'Tuberkulöse
Pleuritis' erlauben eine kausale Behandlung.
In einigen neueren amerikanischen Arbeiten (z.B.
[37]) wird Syndrom weitgehend identifiziert mit den Clusters (Gruppen,
Haufen) der Sets einer medizinischen Taxonomie (s. dazu auch Abschnitt
4.24).
Ohne weiteres Eingehen auf die komplizierte Abgrenzung
[84, 368] sei hier zusammengefaßt, daß die meisten Kliniker
heute unter einer Krankheit eine Gruppe von Symptomen mit einheitlicher
Entstehung (Pathogenese) und einheitlicher tieferer Ursache (Ätiologie,
s. u.), unter einem Syndrom eine ähnliche Gruppe von Symptomen mit
unbekannter der verschiedener Ursache verstehen. LEIBER [84] definiert
in gleichem Sinn: „Ein symptomatologisch einheitliches Krankheitsbild,
dessen Auslösungs- und Gestaltungsfaktoren unbekannt, vieldeutig oder
plurikausal (... polyätiologisch ... polypathogenetisch ...)
sind." Auch in der treffenden Formulierung wird man ihm folgen müssen,
daß der Syndrombegriff ein erstes, großes, weit gefaßtes
nosologisches Sammelbecken, ist, gewissermaßen für die „Krankheiten
im Wartestand". Dagegen halte ich die Einbeziehung der individuellen physischen
und psychischen Reaktionen in den Syndrombegriff für verfehlt. Hier
wird die Polarität zwischen Krankheiten (in deren Vorfeld LEIBER mit
Recht auch das Syndrom verlegt) und Kranken, zwischen nosologischer Typisierung
und Berücksichtigung der individuellen Reaktion (s. Kap. 1.2) verwässert
— gewiß zum Schaden der begrifflichen Klarheit. Auch sonst hat es
nicht an Kritik des Syndrombegriffes gefehlt. So muß verlangt
werden, daß die Kombination von Symptomen eine mehr als zufällige
ist [361] — eine theoretisch einleuchtende, aber bei den oft seltenen Syndromen
schwer zu erfüllende Forderung. Verständlicherweise ist die Tendenz
zur Aufteilung von Krankheitseinheiten relativ groß, besonders wenn
die Verknüpfung mit einem Eigennamen der per-[>16]sönlichen oder
nationalen Eitelkeit entgegenkommt. Da viele Syndrome aber statt langatmiger
Aufzählung der Merkmale mit einem Namen (oft: welchem von vielen?)
ausreichend gekennzeichnet sind, werden wir wohl auch in Zukunft mit ihnen
zu tun haben.
LEIBER [368] gab neuerdings folgende Zahlen:
Sein Buch enthält 1600 Syndrome, seine Kartei 3500 (auf deren Aufführung
er zum Teil wegen ihrer Unbestimmtheit verzichtet hat). Er rechnet mit
derzeit etwa 30 000 Krankheiten und Syndromen sowie mit mindestens einer
Verdoppelung innerhalb der nächsten 10—12 Jahre. Vergleichsweise enthält
der derzeit beste klinische Diagnosenschlüssel in deutscher Sprache
von IMMICH [67] rd. 8000 nosologische und 750 topographische Begriffe,
die parallel benutzt werden sollen. Eine amerikanische Schätzung kommt
auf etwa 10 000 bekannte Krankheiten und 100 000 erfaßbare Befunde
[409]. Alle diese Zahlen sind allerdings noch um einen gewissen Prozentsatz
von Synonyma zu vermindern, die teilweise erst eine künftige taxonomische
Klassifizierung aufdecken wird (s. auch Abschnitt 4.24).
Die Diagnose als Verknüpfung von Symptomen
und Krankheiten hat von der Tatsache auszugehen, daß die meisten
Symptome bei mehreren Erkrankungen vorkommen und umgekehrt — ja, daß
die bereits genannten unspezifischen Symptome bei einer Vielzahl von Krankheiten
beobachtet werden. Ausgehend von einem Leitsymptom, wie z, B. Schwindel,
wird man also eine Anzahl von Krankheiten unterscheiden müssen. Dieses
Ziel nennt man Differentialdiagnose, den Weg dorthin Differentialdiagnostik.
Streng genommen gibt es zwei Arten von Differentialdiagnostik:
Eine allgemeine (semiologische), die von bestimmten Krankheitserscheinungen
ausgehend die möglichen Ursachen katalogisiert, und eine spezielle
(nosologische), die für die einzelnen Krankheiten aufzählt,
von welchen ähnlichen sie mit welchen Mitteln abgegrenzt werden müssen.
Tatsächlich sind die meisten Lehrbücher der Differentialdiagnostik
Kombinationen aus beiden Ansprüchen. Es wird auch wenig beachtet,
daß „Differentialdiagnose" ein schlechter Ausdruck, ein typisch lateinisch-griechischer
[griechisch] ("Sag eines mit zwei Worten") ist: Differentiare heißt
unterscheiden, [griechisch oder griechisch]
ist die Unterscheidung, zusammen also: Die Unterscheidung des Unterschiedes
oder des Unterscheidbaren. Auch der Gebrauch von "Differentialdiagnose"
ist verschieden: Man gelangt zur Differentialdiagnose, d.h. zur Feststellung
der tatsächlich vorliegenden Krankheit. Bei der systematischen Darstellung
von Krankheiten werden andererseits deren Differentaldiagnosen, d. h. gerade
die in diesem Fall nicht zutreffenden, abzugrenzenden Erkrankungen aufgezählt."
PSE Syndromverzeichnis nach Wing et al. (dt. 1982) S. 40ff
"Tabelle 4.1: Symbole (Abkürzungen) zur Bezeichnung der Syndrome
1 (NS) Kernsyndrom (Nuclear syndrome) [RS: Symptome
ersten Ranges nach Kurt Schneider]
2 (CS) Katatones Syndrom (Catatonic syndrome)
3 (IS) Inkohärente Sprache (Incoherent
speech)
4 (RS) Residualsyndrom (Residual syndrome)
5 (DD) Depressive Wahninhalte und Halluzinationen
(Depressive delusions and hallucinations)
6 (SD) Einfache Depression (Simple depression)
7 (ON) Zwangssyndrom (Obsessional syndrome)
8 (GA) Allgemeine Angst (General anxiety)
9 (SA) Situationsbedingte Angst (Situational
anxiety)
10 (HT) Hysterie (Hysteria)
11 (AF) Affektverarmung (Affective flattening)
12 (HM) Hypomanie (Hypomania)
13 (AH) Akustische Halluzinationen (Auditory hallucinations)
14 (PE) Verfolgungswahn (Delusions of persecution)
15 (RE) Beziehungswahn (Delusions of reference)
16 (GR) Größenwahn und religiöser Wahn (Grandiose
and religious delusions)
17 (SF) Sexuelle und phantastische Wahninhalte (Sexual
and fantastic delusions)
18 (VH) Optische Halluzinationen (Visual hallucinations)
19 (OH) Geruchshalluzinationen (Olfactory hallucinations)
20 (OV) Überaktivität (Overactivity)
21 (SL) Verlangsamung (Slowness)
22 (NP) Unspezifische psychotische Symptome (Non-specific psychosis)
23 (DE) Depersonalisation (Depersonalisation)
24 (ED) Besondere depressive Symptome (Special features of depression)
25 (AG) Agitiertheit (Agitation)
26 (NG) Vernachlässigung des Äußeren (Self-neglect)
27 (IR) Einfache Beziehungsideen 1 (Ideas of reference)
28 (TE) Spannungsgefühl (Tension)
29 (LE) Energieverlust (Lack of energy)
30 (WO) Sorgen, etc. (Worrying, etc.)
31 (IT) Reizbarkeit (Irritability)
32 (SU) Unbehagen in Gesellschaft (Social unease)
33 (IC) Interessenverlust und Konzentrationsschwierigkeiten
(Loss of interest and concentration)
34 (HY) Hypochondrie (Hypochondriasis)
35 (OD) Andere Symptome der Depression (Other symptoms of depression)
36 (OR) Organische Leistungsminderung (Organic impairment)
37 (SC) „Subkulturelle" Wahninhalte oder Halluzinationen
(„Subcultural" delusions or hallucinations)
38 (DI) Adäquatheit des Interviews (Doubtful
interview)
2. Die Auswahl der Syndrome
Es gibt drei Hauptgründe für die Gruppierung der Symptome
wie sie in Anhang 4.1 dargestellt ist. Der wichtigste Grund war, daß
der Prozeß der Diagnosefindung eine stufenweise Reduktion der verfügbaren
Informationen erfordert, bis sich schließlich nur eine oder einige
wenige Kategorien herausgebildet haben. Diese Reduktion muß aber,
soll sie logisch sein, Gleiches mit Gleichem verbinden, gemäß
den Regeln des diagnostischen Systems, das nachgeahmt wird. So ist das
Syndrom 1 (NS) aus Symptomen zusammengesetzt, die von Schneider (1959,
1971) als Symptome "ersten Ranges" angesehen wurden, in dem Sinne, daß
sie mit Wahrscheinlichkeit die Diagnose einer Schizophrenie festlegen,
falls keine organischen Störungen vorliegen. Diese Symptome werden
von denen des Syndroms 13 (AH) unterschieden; dieses beinhaltet Halluzinationen
mit Stimmen, die eher zum als über den Patienten sprechen. Wenn das
Symptom scharf genug definiert ist, (so daß affektiv oder subkulturell
bedingte Halluzinationen ausgeschlossen werden können), ist es wahrscheinlich
ebenso bezeichnend für eine Schizophrenie wie irgendein Symptom des
Syndroms 1 (NS), aber es wird so lange getrennt betrachtet bis gezeigt
ist, daß es spezifisch beurteilt werden kann. Es ist sehr einfach,
im Categoprogramm Syndrome wie 1 (NS) und 13 (AH) zusammenzufassen. Es
ist aber schwierig sie zu trennen, wenn sie einmal zusammengefaßt
sind.
In ähnlicher Weise hielt man es aus klinischen
Gründen für vernünftig, auf dieser Stufe das Syndrom einfache
Depression, 6 (SD), vom Syndrom depressive Wahninhalte, 5 (DD), und von
anderen Syndromen wie 21 (SL), 24 (ED) und 35 (OD) zu trennen. Die an diesen
Syndromen beteiligten Symptome können im Lichte von Untersuchungsergebnissen
neuverteilt werden; eine solche Neuverteilung ist dann aber an anderen
Daten zu überprüfen. Das gleiche gilt von Syndromen wie Hypomanie,
12 (HM), Größenwahn und religiöser Wahn, 16 (GR), Verfolgungswahn,
14 (PE) und Überaktivität, 20 (OV). Auf der Syndromebene wurden
Symptome zu Gruppen zusammengefaßt, da sie klinische Einheiten zu
sein scheinen, deren diagnostische Bedeutung je nach der Verbindung, in
der sie vorkommen, wechselt. So ergeben die drei Syndrome 12 (HM), 16 (GR)
und 20 (OV) zusammen ein klares diagnostisches Bild einer Manie, aber die
drei Syndrome 13 (AH), 14 (PE) und 16 (GR) nur mit Wahrscheinlichkeit die
Diagnose einer Schizophrenie. Der wichtigste Zweck der Syndromebene ist
die Bildung von Einheiten, die dem aktuellen Symptommuster des einzelnen
Patienten entsprechen und auf die man diagnostische Regeln anwenden kann,
um schließlich zu Kategorien zu gelangen. Dies [>41] hat zur Folge,
daß bestimmte Syndrome, wie z.B. 22 (NP), absichtlich als Sammelbecken
für Restgruppen von Symptomen gedacht sind.
Ein zweiter Grund für die Bildung von Syndromen
besteht darin, deskriptive Profile zu erzeugen, die graphisch dargestellt
werden können. Solche Profile können auf vielerlei Arten abgeleitet
werden, z.B. können alle Sinnestäuschungen oder alle Wahrnehmungsstörungen,
wie in Kapitel 7 des IPSS-Reports beschrieben, zusammengestellt werden.
Syndromscores können auch zur Beschreibung von zeitabhängigen
Veränderungen sinnvoll sein.
Der dritte Grund für die Konstruktion von Syndromen
ist der, daß man zur Erfassung klinischer Informationen aus Krankenberichten
oder anderen Quellen der Krankheitsanamnese eine wenig aufwendige Methode
benötigt. Für die Beurteilung aller Symptome sind im allgemeinen
nicht genügend Einzelinformationen verfügbar, aber die diagnostisch
wichtigen Syndrome können mit Hilfe der Syndromliste beurteilt werden."
Literatur (Auswahl)
- AMDP System (1981, 4. A). Das AMDP-System. Manual zur Dokumentation psychiatrischer Befunde. Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie. Berlin: Springer.
- AMDP System (1995, 5. A). Das AMDP-System. Manual zur Dokumentation psychiatrischer Befunde. Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie. Berlin. Berlin: Springer.
- AMDP-System (2007). Das AMDP-System. Manual zur Dokumentation psychiatrischer Befunde (8., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Douglas, J.E.; Burges, A.W. & - A.G. & Ressler, R.K. (1992) Crime Classifikation Manual. New York: Lexington. [PDF]
- Gross, Rudolf (1969). Medizinische Diagnostik. Grundlagen und Praxis. Berlin: Springer.
- Lange, H.-J. & Vogel, Th (1965). Statistische Analyse von Symptomenkorrelationen bei Syndromen. Methodik der Information in der Medizin, Vol 4,2, 83-. Abstract:
- Sponsel, R. (1997). Theorie und Praxis einer allgemeinen und speziellen psychologischen Heilmittellehre, Psychotherapiesprache und Methodologie. Sonderdruck des Vortrags auf dem 4. Dt. Psychologentag des BDP, 19. Kongreß für Angewandte Psychologie 2.-5. Oktober 1997 in Würzburg. 34 S., mit über 20 Illustrationen und Graphiken. Erlangen: IEC-Verlag. Ringheftung.
- Stieglitz, R. D.; Erdmann, Fähndrich & Möller, Hans-Jürgen (1988, Hrsg) Syndromale Diagnostik psychischer Störungen. Göttingen: Hogrefe.
- Weber, Adrian (1984). Automatische Syndromerkennung in der Psychiatrie. Stuttgart: Enke.
- Wing, J. K., Cooper, J. E., Sartorius, N. (1982) Die Erfassung und Klassifikation psychiatrischer Symptome. Beschreibung und Glossar des PSE (Present State Examination) - ein Verfahren zur Erhebung des psychopathologischen Befundes. Deutsche Bearbeitung M.v. Cranach. Weinheim: Beltz.
- "Probleme der statistischen Analyse von Symptomenkorrelationen
werden modellmaßig demonstriert. Der Eindruck einer Symptomen (correlation
bei einer bestimmten Krankheit kann im Rahmen der arztlichen Gesamterfahrung
durch die Heterogenität zwischen der Häufigkeitsverteilung der
Symptome bei Fallen der betreffenden Krankheit und Gesunden bzw. anders
Kranken zustande kommen. Auch in den weiteren diagnostischen Stufen ist
eine echte Korrelation zwischen den Symptomen von Heterogenitätseffekten
uneinheitlichen Materials zu unterscheiden. Man erwartet das überzufällige
Auftreten einer als Syndrom angesprochenen Symptomenkombinalion im Rahmen
einer übergeordneten Krankheitseinheit.
Untersuchungen über die Häufigkeit des KENNEDY-Syndroms bei Stirnhirntumoron bzw. Tumoren der vorderen Schädelgrube ergaben, daß das KENNEDY-Syndrom, das für solche Fälle typisch sein soll, nur im Rahmen des Zufalls auflritt. Für diese Analyse wurden 63 Fälle des Patientenmaterials der Universitäts-Nervenklinik in Bonn nach ätiologischen Gesichtspunkten zur Untersuchung herangezogen. Als Vergleidisgruppe dienten 35 Fälle mit Tumoren im Keilbeinbereich, für die das sog. Keilbein-Syndrom typisch sein soll. Auch bei diesen Fällen lag die als Syndrom angesprochene Symptomenkombination im Zufallsbereich."
Links (Auswahl: beachte) > Literatur: Befund-Fehler > Potentielle Fehler > Explorations-Fehler > Untersuchungs-Fehler.
- Symptomverzeichnis.
- Übersicht Diagnostik in der IP-GIPT.
- Potentielle Fehler in forensischen Gutachten.
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Ätiologie > Herkunft einer Störung mit Krankheitswert oder Erkrankung > Krankheit.
__
Befund
__
Datum (Daten)
- Abgrenzbare Einheit eines registrierbaren Ereignisses.
Elementare Daten heißen diejenigen, die bezüglich einer Betrachtungsebene,
nicht weiter zerlegbar sind.
Diagnose
- Nach bestimmten Regeln vergebener Name für
eine zugrunde liegend gedachte Störung mit Krankheitswert für
eine Konfiguration von Befunden.
Komorbidität
__
Krankheit
Bio-Psycho-Soziales Krankheitsmodell
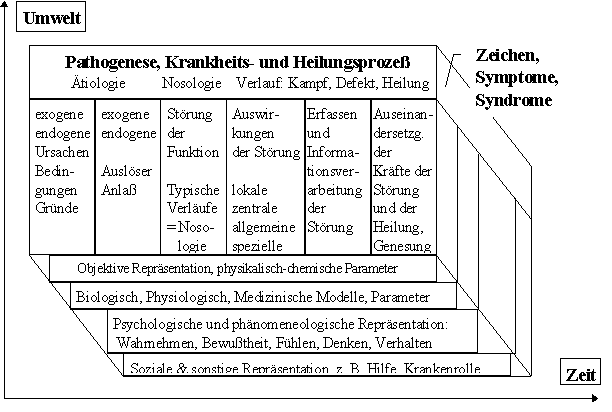
Im allgemeinen Modell wird von einem Systemstörungsmodell ausgegangen, bei dem wir folgende Entwicklungsstadien unterscheiden: 1) Ursachen, Bedingungen und Auslöser der Störung. 2) die Bewertung einer Störung als Krankheit. Zum Wesen der Krankheit definiert man zweckmäßig eine - wichtige - (Funktions-) Störung (nach Gustav von Bergmann [1878-1955] 1932). 3) unterschiedliche Auswirkungen (lokale, zentrale, allgemeine, spezielle) der Störung. 4) Erfassen und Informationsverarbeitung der Störung und 5) aus Wiederherstellungsprozeduren: der Auseinandersetzung zwischen den Kräften der Störung und der Heilung. Störungen können exogener (ausserhalb des Systems) oder endogener (innerhalb des Systems) Natur sein. Störungen haben im allgemeinen Ursachen, womit sich in der allgemeinen Krankheitslehre die Ätiologie beschäftigt. Entwickelt sich eine Störung in der Zeit, wie meistens, heißt dieser Vorgang Pathogenese. Unklar ist meist der Symptombegriff, der eine dreifache modelltheoretische Bedeutung haben kann:
1) es ist ein Zeichen der Störung (z. B. bestimmte Antigene im Körper; Angst);
2) es ist ein Zeichen der Spontanreaktion auf die Störung (z. B. bestimmte Antikörper gegen die Antigene; Vermeiden);
3) es ist ein Zeichen der Wiederherstellungsprozedur, also Ausdruck des "Kampfes" zwischen Krankheit und Heilungsvorgängen (z. B. Fieber; Ambivalenzkonflikt zwischen Vermeiden und Stellen).
Das Ursachenproblem ist wissenschaftstheoretisch problematisch aus zwei prinzipiellen und aus einem vermeidbaren Grund: (1) Im Kausalitätskonzept gibt es streng betrachtet nur einen vielfach verzweigten Baum von Ursachen. Jede ausgemachte Ursache kann prinzipiell wiederum auf andere Ursachen zurückgeführt oder zumindest auf andere zurückgeführt gedacht werden. Welche dieser vielen Ursachen soll als die besondere ausgezeichnet werden? In der Wirklichkeit handelt es sich wohl meist um einen Ursachenkomplex, ein Netzwerk von Bedingungen. (2) Man muß zwischen Bedingungen (Rahmen- oder Randbedingungen), Anlässen oder Auslösern, Neben- und Begleiterscheinungen unterscheiden, was häufig sehr schwierig ist.
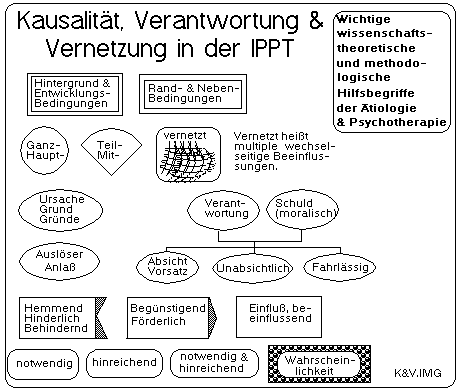
Praktische Anwendung und Veranschaulichung:
Das
Buch Eva -Ticket ins Paradies.
(3) Die psychischen Ereignisse können mehrperspektivisch betrachtet werden: z. B. physikalisch, biologisch, chemisch, physiologisch, neurologisch, internistisch, psychopharmakologisch, immunologisch, kybernetisch, psychologisch, sozial-ökonomisch, sozialpsychologisch, sozial-rechtlich und kommunikativ. Hinzu kommt, daß in der Computermetapher Hardware als körperlich und Software als psychisch die Realisation im "Betriebssystem Mensch" vielfach miteinander verflochten und vernetzt ist. Man kann es den biokybernetischen Ereignissen im Körper nicht unbedingt ansehen, ob sie "Hardware" oder "Software" repräsentieren. So finden wir häufig in den Mitteilungen und Büchern drei Ebenen durcheinander gehend: a) Perspektive (z. B. physikalisch, chemisch, biologisch, medizinisch, psychologisch, sozial), b) Hard- oder Software-Repräsentation, c) Ursache, Neben- und Begleiterscheinung oder Wirkung. Unbeschadet der Probleme, ist die konzeptionelle Vorsehung einer oder mehrerer Ursachen (Bäume oder Zweige) natürlich sinnvoll und vernünftig. Die Neigung mancher SystemikerInnen und VulgärkonstruktivistInnen, das Ursachenproblem herunterzuspielen oder gänzlich für überflüssig zu erklären, können wir in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie weder teilen noch akzeptieren. > Krankheitsbegriff.
Psychiatrie Enquete 1975
- "Im Rahmen der "68er Bewegung" wurde auch die Psychiatrie als
gesellschaftliches Phänomen stark kritisiert. Neben der Antipsychiatrie
gab es auch im Deutschen Bundestag Reformbestrebungen. 1970 wurde eine
"Sachverständigenkommission Psychiatrie" gegründet die 1975 einen
"Bericht zur Lage der Psychiatrie" vorlegte. Forderungen waren:
- bessere Integration der Psychiatrie in die allgemeine Medizin
- Verbesserung der Versorgungskontinuität
- Verkleinerung der psychiatrischen Großkrankenhäuser, Sektorisierung
- Vernetzung mit medizinischen und sozialen Einrichtungen
- Ausbau flankierender Einrichtungen
- vermehrte Prävention und Rehabilitation
- Bericht im ZDF von 1973 zur Psychiatrie.
- Rede von Gesundheitsministerin Andrea Fischer zur Psychiatrie-Enquete (2000).
- Psychiatrienetz - PDF-Datei 25 Jahre Psychiatrie-Enquete
- Hans Bangen - Geschichte der medikamentösen Therapie der Schizophrenie [update]
Vieles konnte in den folgenden Jahren, auch wegen der allgemeinen
Steigerung des Wohlstands, umgesetzt werden. Problematisch blieb die Versorgung
der chronisch psychisch Kranken.
Störung > Norm, Wert, Abweichung (Deviation), Krank (Krankheit), Diagnose. "Normal", "Anders", "Fehler", "Gestört", "Krank", "Verrückt".
__
Symptom > Symptomlisten.
- Kleinste Einheit für eine Störung, die aus Daten nach Regeln
erschlossen und gedacht werden.
Standort: Syndromverzeichnisse.
*
* Überblick Diagnostik.* Symptomverzeichnis. * Überblick forensische Psychologie.
*
Suchen in der IP-GIPT, z.B. mit Hilfe von "google": |
Information für Dienstleistungs-Interessierte.
*
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS). Syndromverzeichnisse. Abteilung Diagnostik und Differentialdiagnostik. Erlangen: https://www.sgipt.org/diagnos/Syndrom.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich erwünscht. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert: irs 02.04.2013
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
00.00.13