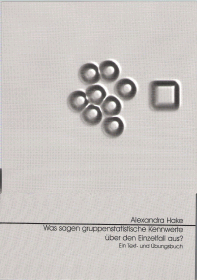(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=19.05.2008 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung TT.MM.JJ
Impressum: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel
Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen * Mail:_sekretariat@sgipt.org_Zitierung & Copyright
Anfang Statistische Falschschlüsse Gruppe/Einzelfall_ Überblick Rel. Aktuelles _ Rel. Beständiges _Titelblatt _Konzept _Archiv _Region _Service-iec-verlag _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Bücher, Literatur und Links zu den verschiedensten Themen, hier die Buchpräsentationen:
_
|
im Spannungsfeld zwischen Aggregat und Einzelfall: eine Bestandsaufnahme und kritische Evaluation.
bei Pabst Science Publisher; Lengerich 2002. |
Was sagen gruppenstatistische Kennwerte
über den Einzelfall aus?
Ein Text- und Übungsbuch.
bei Verlag empirische Pädagogik. |
präsentiert von Rudolf Sponsel, Erlangen
Bibliographie * Verlagsinfos * Inhaltsverzeichnisse * Leseproben * Ergebnisse * Bewertungen * Literatur * Links * Querverweise *
| Hake, Alexandra (2002). Trugschlüsse
in der Statistik im Spannungsfeld zwischen Aggregat und Einzelfall. Eine
Bestandsaufnahme und kritische Evaluation. Lengerich [u.a.]: Pabst
Science Publisher.
[ISBN 3-936142-60-2] |
Hake, A. (2001). Was sagen gruppenstatistische Kennwerte über den Einzelfall aus? (Materialien für Lehre, Aus- & Weiterbildung 24). Landau: Verlag empirische Pädagogik. [ISBN-10: 3-933967-59-7] |
Verlagsinfos
| Verlagsinfo2002: "Untersuchungsgegenstand sind Fehlinterpretationen, die auftreten, wenn gruppenstatistische Kennwerte auf Einzelfälle angewandt werden. Im theoretischen Teil wird der erste Entwurf eines Erklärungsmodells vorgestellt, welches drei verschiedene theoretische Ansätze integriert: das kognitive Modell von Valsiner (1986), die Theorie der sozialen Identität (Tajfel, 1978, 1981) und die Theorie sozialer Repräsentationen (Moscovici, 1981, 1984). Teilaspekte des Modells wurden in einer empirischen Studie überprüft. 12 Personalfachleute und 12 eignungsdiagnostisch tätige Berater nahmen hierzu an einem Interview teil. Als Vergleichsgruppe fungierten 16 Studenten der Psychologie. Das verwendete Interview sah eine Reihe von Szenarien vor, in denen die Interviewteilnehmer die Bedeutung gruppenstatistischer Kennwerte für Einzelfälle abschätzen und ihre Stellungnahme begründen sollten. Die Antworten der Interviewteilnehmer wurden inhaltsanalytisch ausgewertet und die Ergebnisse der Codierung deskriptiv-statistischen Analysen unterzogen. Im Rahmen der Auswertung sind darüber hinaus eine Vielzahl qualitativer Einzelfallanalysen erstellt worden. Die Analyseergebnisse geben zahlreiche Hinweise darauf, dass die Aggregat-/Einzelfallproblematik von den Berufspraktikern und angehenden Psychologen in nur unzureichendem Ausmaß reflektiert wird: In allen drei Untersuchungsgruppen traten in hohem Maße einzelfallbezogene Fehlinterpretationen der untersuchten gruppenstatistischen Kennwerte auf. Wieweit das der Studie zugrundegelegte theoretische Konzept trägt und wie erklärungskräftig es ist, bedarf weiterer Klärung. Die untersuchten Fehlinterpretationen sind von Bedeutung für die Aus- und Weiterbildung sowie für die Qualitätssicherung innerhalb der Psychologie." | Verlagsinfo2001: Aus dem Vorwort von Prof. Dr. M. Amelang (Universität Heidelberg): „Der vorliegende Text gilt einer diffizilen Materie: Immer wieder nämlich ist zu beobachten, wie in Forschung und praktischer Anwendung gruppenstatistische Kennwerte ... unzulässigerweise auf Einzelfälle übertragen werden. ... Alexandra Hake hat eine Reihe realitätsnaher Szenarien konzipiert und diese verschiedenen „Experten“ vorgelegt; zusammen mit den dabei registrierten Fehlinterpretationen bilden diese das Herzstück des hier vorgelegten Buches. Die Autorin belässt es aber nicht bei der bloßen Präsentation dieses Materials; vielmehr sind die Leser angehalten – und das macht das Buch als Arbeitsgrundlage zusätzlich wertvoll – eigene Stellungnahmen abzugeben, die sie dann mit Erläuterungen im Sinne von „richtigen Antworten“ vergleichen können. Durch die dadurch intendierte aktive Auseinandersetzung mit dem Stoff ist ein besonders großer und nachhaltiger Lerngewinn gewährleistet – kaum jemand, der sich auf diese Weise mit den Limitierungen gruppenstatistischer Daten befasst haben wird, dürfte noch den Versuchungen von Fehlinterpretationen unterliegen“. |
Inhaltsverzeichnis
| I Einleitung
II Forschungsstand
4.3 Retest-Reliabilitäts- bzw. "Stabilitätskoeffizienten"
20
III Erklärungsansätze
IV Empirie
V Schluß
Literaturverzeichnis |
Was sagen gruppenstatistische Kennwerte über den
Einzelfall aus? l
Vorwort 3
A. Interpretationsmöglichkeiten und Interpretations-
II Mittelwerte 21
III Komparative Betrachtung korrelativer
IV Retest-Reliabilitäts- bzw. "Stabilitätskoeffizienten"
42
V Statistische Syllogismen 54
VI Das Konzept der prädiktiven Validität
64
VII Die Präzision von Vorhersagen 70
B. Das Phänomen der einzelfallbezogenen Interpretation
Literatur 96
|
Leseprobe:
| S.9: 2 Wissenschaftstheoretische
Grundlagen
Im folgenden Abschnitt werden verschiedene wissenschaftstheoretische Aspekte der Gruppen- und Einzelfalluntersuchung vorgestellt, die sich als grundlegend für einen reflektierten Umgang mit gruppenstatistischen Kennwerten bei der Einzelbetrachtung erweisen. Dies betrifft die Definition und Abgrenzung unterschiedlicher Hypothesenarten (l), die Frage nach der differentiellen Indikation unterschiedlicher methodischer Herangehensweisen in Abhängigkeit von der Hypothesenart (II) und die Frage nach der Generalisierung bei Einzelfallanalysen (III). (I) Definition und Abgrenzung von Hypothesen Hypothesen, die sich auf Aggregate (Populationen, Kollektive) beziehen, sind von solchen abzugrenzen, die Aussagen über Individuen treffen (Bunge, 1967; Westmeyer, 1989). Aggregathypothesen sind dadurch gekennzeichnet, daß sie nicht den einzelnen Personen einer Klasse Eigenschaften zusprechen, sondern einer Klasse insgesamt. Beispiele für solche Eigenschaften sind Verteilungsfunktionen, Mittelwerte, Varianzen, Korrelationen, Proportionen, Trends oder auch statistische Strukturen. Hypothesen, die auf singuläre und nicht kollektive Subjekte gerichtet sind, lassen sich in unterschiedliche Hypothesenarten [>10] untergliedern. Zu ihnen zählen u.a. die singulären , die quasi-universellen oder auch die universellen Hypothesen (s. Exkurs). Exkurs: Einzelfallbezogene Hypothesenarten
|
S. 7: "EINLEITUNG
Das vorliegende Buch sensibilisiert für Trugschlüsse, die auftreten, wenn gruppenstatistische Kennwerte auf den Einzelfall! angewandt werden. Eingeführt sei in die Thematik anhand eines konkreten Beispiels: „Die vielschichtige Eigenschaft der Intelligenz beruht vor allem auf den Erbanlagen. Zu etwa 70% gleichen sich die IQs der Eineiigen. 70% der IQ-Unterschiede in der breiten Bevölkerung sind damit auf unterschiedliche Gene zurückzuführen: Wenn dort einer dümmer ist als der andere, hat er das zu zwei Dritteln seinen Genen zu verdanken " (Bäumler, 1992, S. 54). Bei den ersten Sätzen handelt es sich um gruppenbezogene Aussagen.
Der letzte Satz ist auf den Einzelfall bezogen und soll sich aus den gruppenbezogenen
Aussagen ergeben. Bewerten Sie die Folgerung als zulässig oder unzulässig?
Wie begründen Sie Ihre Stellungnahme? Diese und andere Aufgabenstellungen
können Sie im ersten Teil des Buches bearbeiten. Stets geht
es darum, die Bedeutung von gruppenstatistischen Befunden für Einzelfälle
abzuschätzen und zu begründen.
|
| S.147: "Als Erhebungsinstrument wurde
ein offenes, halbstandardisiertes Interview eingesetzt. Im Zentrum des
Interviews standen eine Reihe von Aufgabenstellungen, in denen die Interviewteilnehmer
die Bedeutung von gruppenstatistischen Kennwerten für Einzelfälle
abschätzen und ihre jeweilige Stellungnahme begründen sollten.
Das erhobene Datenmaterial wurde mit Hilfe von Codierleitfäden inhaltsanalytisch
ausgewertet. Die Ergebnisse der Codierung wurden anschließend deskriptiv-
statistischen Analysen unterzogen. Die Vorgehensweise wurde durch qualitative
Einzelfallanalysen ergänzt, um eine Gesamt- bewertung der Ergebnisse
zum jeweiligen gruppenstatistischen Kennwert vornehmen zu können.
Die Ergebnisse der Studie lassen sich im wesentlichen in drei Punkten zusammenfassen: 1. In allen drei Untersuchungsgruppen wurden die gruppenstatistischen Kennwerte von den Interviewteilnehmern in hohem Ausmaß auf Einzelfalle bezogen. Das Phänomen konnte im Umgang mit jedem der in die Untersuchung einbezogenen Kennwerte nachgewiesen werden. 2. Die Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen in den prozentualen Anteilen einzelfallbezogener Interpretationen erwiesen sich für die Mehrzahl der Kennwerte als relativ gering. Sie wiesen in einigen Fällen in die zu erwartende Richtung, in anderen nicht. [>148] 3. Bei einigen der Kennwerte traten in den Untersuchungs- gruppen tendenziell höhere prozentuale Anteile einzelfallbezogener Interpretationen auf als bei anderen Kennwerten. Eindeutige Hinweise auf die angenommenen berufsgruppen- spezifischen Aspekte konnten mithin nicht identifiziert werden. Es scheint sich bei dem untersuchten Phänomen vielmehr um ein ubiquitäres Phänomen zu handeln, das nicht spezifisch für bestimmte Personengruppen ist: Für die überwiegende Zahl der Kennwerte lagen die prozentualen Anteile einzelfallbezogener Interpretationen in allen drei Untersuchungsgruppen oberhalb von 50,0%." |
[S. 94f] "IV RELEVANZ DES UNTERSUCHTEN
PHÄ- NOMENS UND PRAKTISCHE KONSEQUENZEN
Die Relevanz des Phänomens der einzelfallbezogenen Interpretation gruppenstatistischer Kennwerte ist sowohl im Bereich der sozialwissenschaftlichen Forschung wie auch der Berufspraxis anzusiedeln. Für beide Bereiche ergeben sich aus der Existenz des in zahlreichen Anschauungsbeispielen demonstrierten Phänomens (s. Teil A des Buches) praktische Konsequenzen. Für die psychologische Forschung ist nicht nur relevant, wie die Daten interpretiert, sondern auch, welche methodischen Ansätze gewählt werden: Wann ist es sinnvoll, statistisch-gruppenbezogen vorzugehen und wann nicht? Unter dem Gesichtspunkt handlungsleitender Prinzipien ergibt sich die Frage, auf welchen Untersuchungsgegenstand das Forschungsinteresse gerichtet ist, Handelt es sich um kollektive Subjekte, also Gruppen von Personen, oder singuläre Subjekte? Im ersten Fall hat man es mit sogenannten Aggregathypothesen zu tun, im zweiten mit einzelfallbezogenen Hypothesen. Wie in diesem Buch an anderer Stelle bereits ausführlich dargelegt, sind in Abhängigkeit von der Hypothesenart unterschiedliche methodische Herangehensweisen in Form von Gruppen- und Einzelfallanalysen erforderlich. Hier sollte auf eine Stimmigkeit zwischen Hypothesenart, d.h. Untersuchungsgegenstand, und methodischer Herangehensweise geachtet werden. Ein solches Kriterium kann auch vor der Gefahr eines methodischen Rigorismus schützen, der sich im gegenwärtigen psychologischen Forschungsalltag in einer Dominanz gruppenbezogener Analysen äußert, die auf die Überprüfung von Aggregathypothesen gerichtet sind. Einzelfallbezogene Analysen weisen hingegen eine nur untergeordnete Bedeutung auf. Auch im Bereich der eignungsdiagnostischen Berufspraxis geht es nicht darum, den Wert der Statistik generell in Frage zu stellen, sondern wiederum um eine Reflexion der Mittel und Ziele. Das handlungsleitende Prinzip ist hier also gleichermaßen bindend. ... " |
Bewertung: Die beiden Werke der Autorin betreffen ein hochbrisantes Thema und einen Dauerbrennpunkt empirischer Forschung, Anwendung und Interpretationsmethodologie. Nämlich die letztlich entscheidende Grundfrage: was darf ich aus den Ergebnissen der jeweiligen experimentellen Labor- oder Feldversuche bzw. von Datenerhebungen überhaupt schließen? Hierbei werden die wichtigsten Paradigmen aufbereitet, kritisch erörtert und empirisch untersucht. Man kann nur hoffen, dass die Arbeiten Hakes Eingang in die Seminare des Grundstudiums der Psychologie (Methoden, Tests, Diagnostik, Statistik, Evaluation) und der Wissenschaften finden, die sich mit dem Menschen beschäftigen, u.a. also auch Medizin, Biologie, Sozial- und Kulturwissenschaften.
Links (Auswahl: beachte)
Veränderte URLs ohne Weiterleitung wurden entlinkt.
Google: Fälschung Statistik * Fehlschlüsse Statistik * Irrtum Statistik * Trugschlüsse Statistik. * Wissenschaftstheorie Statistik * Fehlschlüsse Wissenschaft * Irrtum Wissenschaft * Fälschung Wissenschaft * Trugschlüsse Wissenschaft *
Pressemitteilungen – Personalien – Nr. 3 und 4 / 98
"Dipl.-Psych. Alexandra HAKE, Psychologisches Institut, wurde von der
Deutschen Gesellschaft zur Förderung der Psychologie mit dem Georg-Sieber-Preis
ausgezeichnet, der für originelle und anwendungsorientierte Diplomarbeiten
vergeben wird. In ihrer Arbeit untersucht sie den Umgang von Personalfachleuten
mit psychodiagnostischen Daten."
IP-GIPT-Links:
- Absurdität, Antinomie, Aporie, Konfusion, Paradoxie, Pseudo-Paradoxie, Sophisma, Widerspruch, X-Strittiges/Sonstiges.
- Überblick Statistik in der IP-GIPT.
- Literatur und Linkliste (LiLi): Irrtum, Betrug, Tricks, Täuschung, Fälschung, Risiko, Versagen und anderes Fehlverhalten in Forschung, Wissenschaft und Technik.
- Der Signifikanztest in der Wissenschaft, Psychologie, klinischen und Psychotherapieforschung. Szientismus zwischen numerologischer Esoterik, Gaukeln und Betrug?
- Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben.
- Die grundlegenden Probleme und Aporie jeglicher Einzelfall- und damit Therapieforschung. Grundzüge einer idiographischen Wissenschaftstheorie.
- Konzepte Idealer Psychologischer Grundlagen Experimente zur operationalen Normierung psychischer Elementarfunktionen. Verallgemeinerung einer Toman'schen Idee.
- Überblick Hochstapelei.
- Wissenschaftliches Arbeiten.
Literatur (Auswahl)
Beide Bände von Hake beinhalten ausführliche Literaturverzeichnisse (6 bzw. 3 Seiten).
Siehe auch Literaturliste Signifikanztest und die Literaturliste Irrtum, Betrug, Tricks, Täuschung, Fälschung, Risiko, Versagen und anderes Fehlverhalten in Forschung, Wissenschaft und Technik sowie die Sammelseiten Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben, besonders auch Beweis und beweisen in der Statistik; zur Problematik der Prognostik hier.
Weitere Literatur (Auswahl) zur spezifischen Problematik:
- Borovcnik, M. (1984). Was bedeuten statistische Aussagen. Schriftenreihe für Didaktik der Mathematik. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky.
- Gigerenzer, Gerd (2002). Das Einmaleins der Skepsis. Über den richtigen Umgang mit Zahlen und Risiken. Berlin: Berlin.
- Grawe, Klaus (1991). Über den Umgang mit Zahlen. In: Grawe et al. (1991, Hrsg.). Über die richtige Art Psychologie zu betreiben. Göttingen: Hogrefe. S. 89-105.
- Huff, Darrell (1954, 1973f). How to Lie With Statistics. Penguin.
- Krämer, Walter (1991). So lügt man mit Statistik. Frankfurt: Campus.
- Krämer, Walter (1996). Denkste! Trugschlüsse aus der Welt des Zufalls und der Zahlen. Frankfurt: Campus.
- Sekeley, Gábor J. (1990). Paradoxa. Klassische und neue Überraschungen aus Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischer Statistik. Frankfurt: Deutsch.
- Stelzl, Ingeborg (1982). Fehler und Fallen der Statistik. Für Psychologen, Pädagogen und Sozialwissenschaftler. Bern: Huber.
Glossar, Anmerkungen und Endnoten
GIPT = General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
___
Bewertung. Bewertungen sind immer subjektiv, daher sind wir in unseren Buchpräsentationen bemüht, möglichst viel durch die AutorInnen selbst sagen zu lassen. Die Kombination Inhaltsverzeichnis und Zusammenfassungen sollte jede kundige oder auch interessierte LeserIn in die Lage versetzen selbst festzustellen, ob sie dieses oder jenes genauer wissen will. Die BuchpräsentatorIn steht gewöhnlich in keiner Geschäftsbeziehung zu Verlag oder den AutorInnen; falls doch wird dies ausdrücklich vermerkt. Die IP-GIPT ist nicht kommerziell ausgerichtet, verlangt und erhält für Buchpräsentationen auch kein Honorar. Meist dürften aber die BuchpräsentatorInnen ein kostenfreies sog. Rezensionsexemplar erhalten. Die IP-GIPT gewinnt durch gute Buchpräsentationen an inhaltlicher Bedeutung und Aufmerksamkeit und für die PräsentatorInnen sind solche Präsentationen auch eine Art Fortbildung - so gesehen haben natürlich alle etwas davon, am meisten, wie wir hoffen InteressentInnen und LeserInnen. Beispiele für Bewertungen: [1,2,3,]
___
Anm. Vorgesehene. Wir präsentieren auch Bücher aus eigenem Bestand, weil wir sie selbst erworben haben oder Verlage sie aus verschiedenen Gründen nicht (mehr) zur Verfügung stellen wollen oder können.
___
Bäumler, 1992, S. 54. Bäumler wird im Literaturverzeichnis nicht aufgeführt. Die Autorin teilt (2001, S. 17 unten) hierzu mit: "(Das Ihnen zur Beurteilung vorgelegte fiktive Zitat ist von seinem Aussagegehalt her dem Artikel „Die Lehre vom doppelten Lottchen" der Zeitschrift „Geo Wissen: Intelligenz und Bewußtsein" [Evers, 1992, S. 54] entnommen.)
___
Falsch-, Fehl- und Trugschlüsse. Fehl- und Trugschluss werden sowohl in der Umgangs- als auch in der Wissenschaftssprache synonym verwendet. Das erscheint insofern nicht sinnvoll, als es ja den irrtümlichen Falschschluss und den absichtlichen, sophistisch-rabulistisch manipulativen Falschschluss gibt. In der IP-GIPT unterscheiden wir daher Fehl- von Trugschlüssen. Irrtümliche Falschschlüsse heißen Fehlschlüsse. Den absichtlichen Falschschluss nennen wir Trugschluss.
___
Standort: Statistische Falschschlüsse Gruppe/Einzelfall.
*
Buch-Präsentationen, Literaturhinweise und Literaturlisten in der IP-GIPT. Überblick und Dokumentation.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
Forensische Psychiatrie site:www.sgipt.org. |
Information für Dienstleistungs-Interessierte.
*
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS). Buchpräsentation: Statistische Falschschlüsse Gruppe/Einzelfall. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/lit/pabst/Hake.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert: irs 18.5.8
Änderungen Kleinere
Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet
und ergänzt.
05.04.15 Linkfehler geprüft und korrigiert.