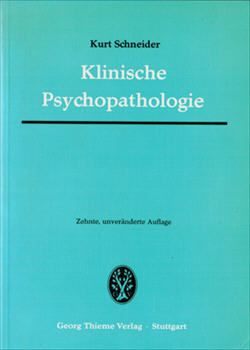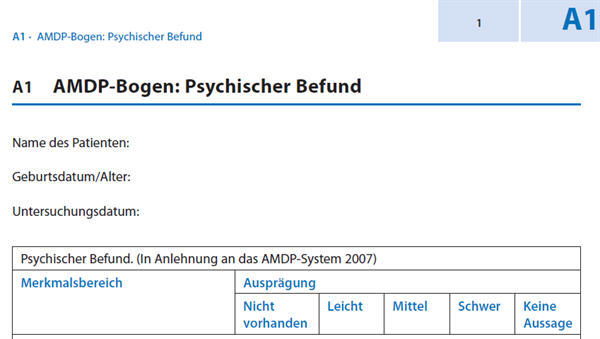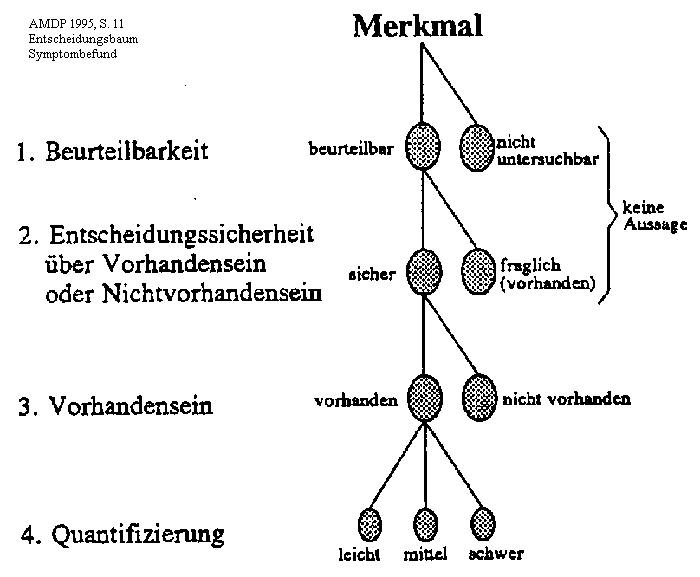(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=02.04.2013 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 07.12.19.
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_Zitierung & Copyright
Symptomverzeichnisse
Hilfsseite zu Differential-Diagnostik und Befund-Fehler
von Rudolf Sponsel, Erlangen.
Editorial: Die Seiten Symptom- und Syndromverzeichnisse sind als Hilfsseiten für die Seite Befund-Fehler in der forensischen Psychiatrie entstanden. Anlass waren unglaubliche, oft (macht-) politisch motivierte Psychiatrisierungen als Disziplinierungsmittel des Staates, die nicht etwa in Diktaturen, sondern mitten in Deutschland stattfanden und stattfinden, als die eklatantesten erwähne ich den hessischen Steuerfahnderskandal und den Fall Mollath in Bayern. Hier zeigte sich ebenso überraschend wie erschreckend, dass es inzwischen eine extrem verbreitete psychiatrische Schlechtachterindustrie gibt, besonders auch bei der "crème de la crème" (O-Ton Dr. Merk). Hier "feiert" okkultue Parapsychopathologie ohne persönliche Untersuchung und Exploration (>Dinger) mit viel freier Assoziation, Phantasie, Mutmaßen, Meinen, Spekulieren, für möglich halten, pseudowissenschaftlichem Wähnen - wie es pflichtvergessenen RichterInnen und Herrschaftswünschen entspricht - ohne persönliche Untersuchung und Exploration unsägliche Triumphe.
Aber nicht nur aus diesen Gründen, ist die Psychiatrie zu Recht extrem in Verruf geraten. Das wissenschaftliche Niveau der Psychiatrie war - besonders in Kontrast zu der sonstigen Entwicklung in der Medizin - bis in die Gegenwart umstritten, obwohl sie auf dem Gebiet der Diagnostik, Befundung und Dokumentation sich wirklich auf den Weg begeben hat - wie diese Seite zeigt und hier auch deutliche Fortschritte vermelden kann. Das wurde allerdings auch nötig nach katastrophalen Objektivitäts-, Reliabilitäts- und Validitätsststudien (>Kendell, Rosenhanstudie [inzwischen in Zweifeol gezogen], und sich daran anschließender Kritik in den 1960er und 1970er Jahren, aber auch durch teilweise schlimme Verhältnisse in der Psychiatrie, die zur Psychiatrie-Enquete 1975 und Reformbestrebungen führten.
Allerdings leiden sämtliche Symptomlisten und Befund-Systeme am Fehlen klarer Regeln (RED-ES) und Beispiellisten über die den Symptomen zugrunde liegenden Daten.
Rosenhanstudie "Rosenhan (1973)
ließ zwölf freiwillige Versuchspersonen ohne jegliche psychische
Störungen in verschiedene psychiatrische Kliniken einweisen. Bei der
Aufnahme sollten die Pseudopatienten lediglich ein Symptom berichten, ansonsten
jedoch völlig zutreffende Angaben über sich und ihre Lebensumstände
machen. Als Symptom wählte der Autor ein Verhalten aus, das noch nie
in der Fachliteratur beschrieben worden war: Die Versuchspersonen sollten
angeben, sie hörten Stimmen, die (in deutscher Übersetzung) "leer",
"hohl" und "bums" sagten. Unmittelbar nach der Aufnahme berichteten die
"Patienten" nicht mehr von diesem Symptom und verhielten sich auch ansonsten
völlig normal. Trotzdem wurden alle Patienten als psychotisch diagnostiziert
(elfmal als schizophren, einmal als manisch-depressiv). Es lag also ein
außerordentlich hohes Ausmaß an diagnostischer Übereinstimmung
vor. Dennoch waren alle Diagnosen falsch, sie besaßen also keine
Validität." [nach > Margraf,
1994, Mini-DIPS, S. 7]
Inzwischen sind Zweifel an der Studie geäußert
geworden (22.6.2018, updated 2.11.2019 New York Post). Cahalan, Susannah
(2019) The Great Pretender: The Undercover Mission That Changed Our Understanding
of Madness. Hachette Nashville: Grand Central Publishing.
Symptome ersten Ranges
für die Schizophreniediagnose nach Kurt Schneider
| „Zu diesen
Symptomen 2. Ranges gehören nach Kurt Schneider die nicht schon
als Symptome l. Ranges aufgezählten Sinnestäuschungen, der Wahneinfall,
die Ratlosigkeit, depressive Verstimmungen, eine erlebte Gefühlsverarmung
und weitere Symptome.
Die Symptome 1. Ranges müssen für die Diagnose der Schizophrenie nicht dasein; zumindest sind sie nicht stets sichtbar. Wir sind oft genötigt, die Diagnose Schizophrenie auf Symptome 2. Ranges, vielleicht ausnahmsweise sogar einmal auf bloße Ausdruckssymptome, wenn sie entsprechend dicht und deutlich sind, zu gründen." [Zitiert nach Wieck, H.H. (1967). Lehrbuch der Psychiatrie. Stuttgart:
Schattauer. S. 276]
|
Querverweise: 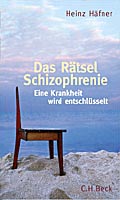 |
Das AMDP-System und seine Entwicklung [AMDP]
Seit 2007 gibt es die 8. überarbeitete Auflage zu der ausgeführt wird [Online]:
"AMDP-System (= A; Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie) [engl. DP-system], [KLI], psychiatrisches Fremdbeurteilungsverfahren bestehend aus einem Anamneseteil ( Anamnese), dem Psychischen Befund sowie dem Somatischen Befund. Kernstück des A. ist der Psychische Befund mit insgesamt 100 Symptomen ( Symptom), die sich auf folgende Merkmalsbereiche verteilen: Bewusstseinsstörungen, Orientierungsstörungen, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen, Formale Denkstörungen, Befürchtungen und Zwänge, Wahn, Sinnestäuschungen, Ich-Störungen, Störungen der Affektivität, Antriebs- und psychomotorische Störungen, circadiane Besonderheiten sowie andere Störungen. Aus den 100 Symptomen lassen sich insgesamt 8 Syndrome ( Syndrom) bilden: paranoid-halluzinatorisches Syndrom, depressives Syndrom, psychoorganisches Syndrom, manisches Syndrom, Hostilitätssyndrom, vegetatives Syndrom, apathisches Syndrom sowie Zwangssyndrom. Die 40 Symptome des Somatischen Befundes beinhalten neben Symptomen, die Nebenwirkungen von psychopharmakologischen Behandlungen abbilden, auch Symptome, die im Kontext von psychiatrischen Diagnosen von Bedeutung sind (z.B. Schlafstörungen, Appetitstörungen für die depressive Episode der ICD-10; International Classification of Diseases (ICD)). Für die Symptome des Psychischen und Somatischen Befundes liegt ein Glossar mit einer einheitlichen Darstellung der Symptome vor (Definition, Erläuterungen und Beispiele, Hinweise zur Graduierung, Abzugrenzende Begriffe). Das A. ist seit fast 50 Jahren in der Anwendung, zunächst primär im Bereich der Forschung, zunehmend jedoch auch im Bereich der klinischen Praxis (u.a. Ausbildung in Psychopathologie). Voraussetzung für die adäquate Anwendung ist ein mehrtägiges Training. Seit erstmaliger Publikation des Systems sind mehrere hundert Arbeiten hierzu erschienen. Aktuell ist das A. in der 8. Auflage in Anwendung. Es existieren zahlreiche fremdsprachige Versionen (u.a. französisch, spanisch, englisch, italienisch). AMDP 2007, Baumann & Stieglitz 1983. R.-D. Stieglitz"
Zur Geschichte des
AMDP-Systems
Stand 1995 (5.A.): "Die Arbeitsgemeinschaft für
Methodik
und Dokumentation in der Psychiatrie (AMDP)
wurde 1965 aus der Verbindung einer deutschen (Bente, Engelmeier, Heinrich,
Hippius, Schmitt) und einer schweizerischen Arbeitsgruppe (Angst, Battegay,
Cornu, Dick, Heimann, Pöldinger, Schmidlin, Weis) unter dem Namen
AMP gegründet, der sich kurz darauf die Wiener Klinik (Berner) anschloß.
Beide Gruppen hatten in mehrjähriger Erfahrung Dokumentationssysteme
erarbeitet, die bei der Gründung der AMDP zusammengefaßt wurden.
In den folgenden Jahren wurde von den AMDP-Mitarbeitern das System für
die Dokumentation der psychiatrischen Anamnese sowie des psychopathologischen
und somatischen Befundes auf Markierungsleserbelegen weiterentwickelt."
Befundordnung im AMDP-System
Stand 1981 (4.A.): Die 12 psychischen Befundkategorien (Syndrome) sind
in 100 Symptome aufgeteilt, die somatischen Befundkategorien in 40 Symptome.
Eine Symptomliste finden Sie hier [PDF].
|
|
|
|
_ _ _ _ |
Klare Regeln, wie man zur Ausprägungsbeurteilung eines Merkmalsbereichs
kommt, habe ich nicht gefunden. Das ist nicht sehr differenziert, aber
immerhin ein praktisch-brauchbarer Erstansatz, wenn man bedenkt, dass die
moderne Psychiatrie seit über 100 Jahren nicht in der Lage ist, eine
fundierte Ausprägungstheorie zu entwickeln.
Weiterentwicklung 1995
"Die hier vorgelegte 5. und überarbeitete Auflage des AMDP-Manuals
unterscheidet sich von der 4. korrigierten Auflage (Springer-Verlag) durch
eine gründliche Überarbeitung im Bereich der 140 Merkmale des
Psychischen und Somatischen Befundes.
Für die Belege "Psychischer Befund" und "Somatischer Befund" (Beleg
4 und 5) wurden alle Merkmale nach einer einheitlichen Struktur dargestellt
(Definition, Erläuterungen und Beispiele, Hinweise zur Graduierung,
abzugrenzende Merkmale). Veränderungen der Definitionen wurden vor
allem aufgrund zahlreicher Diskussionen bei Trainingsseminaren und innerhalb
der AMDP-Trainergruppe präzisiert, ohne daß die traditionellen
Grundlagen der deskriptiven Psychopathologie verlassen wurden. Erläuterungen
und Beispiele sollten die Definition plastischer machen und so zur Verbesserung
der Interrater-Reliabilität beitragen. Erstmals wurden Angaben zur
Quantifizierung gemacht, wobei der Versuch unternommen wurde, die Schwellen
anzugeben, ab wann ein Merkmal überhaupt markiert werden soll ("leicht")
und ab wann es als "schwer" zu markieren ist, obwohl auch noch schwerere
Ausprägungsgrade denkbar sind.
Die Hinweise auf abzugrenzende Merkmale sollen den Untersucher veranlassen,
sich bei der Beurteilung der einzelnen Symptome zu vergewissern, ob tatsächlich
der beobachtete Sachverhalt gemeint ist oder nicht ein verwandtes Phänomen.
Die Anamnesebelege l bis 3 sind unverändert aus der 4. Auflage
übernommen, obwohl die Revisionsgruppe der Meinung war, daß
man Lebensereignisse (Beleg 2) heute nicht mehr so abbilden würde."
(1995, S. V)
Die Definitionen und Musterbeispiele im AMDP (1995) S. 85 - S. 90
"2.7 Wahn
Vorbemerkungen
In dieser Rubrik müssen immer mindestens zwei Markierungenvorgenommen
werden, eine formale (Merkmale 34 - 38) und eine inhaltliche (Merkmale
39 - 46). Davon ausgenommen ist das Merkmal Wahnstimmung (Nr. 33). Zum
Zusammenhang der Merkmale 34 - 36 beachte: Wahneinfälle und Wahnwahrnehmungen
gehen den Wahngedanken (zeitlich gesehen) in der Regel voraus. Dies bedeutet,
daß zusätzlich zu "Wahngedanken" die Merkmale "Wahnwahrnehmung"
bzw. "Wahneinfall" nur markiert werden dürfen, wenn sie auch in dem
definierten Beobachtungszeitraum aufgetreten sind. [>86]
Wahn entsteht auf dem Boden einer allgemeinen Veränderung des
Erlebens und imponiert als Fehlbeurteilung der Realität, die mit apriorischer
Evidenz (erfahrungsunabhängiger Gewißheit) auftritt und an der
mit subjektiver Gewißheit festgehalten wird, auch wenn sie im Widerspruch
zur Wirklichkeit und zur Erfahrung der gesunden Mitmenschen sowie zu ihrem
kollektiven Meinen und Glauben steht. Der Kranke hat im allgemeinen nicht
das Bedürfnis nach einer Begründung seiner wahnhaften Meinung,
ihre Richtigkeit ist ihm unmittelbar evident.
Wahn gibt es bei verschiedenen psychischen Störungen, er ist nicht
spezifisch für die Schizophrenie. Überwertige Ideen (falsche,
aber bedeutende und das Leben leitende Vorstellungen) sollen hier nicht
markiert werden.
Vorbemerkung zur Graduierung der inhaltlichen Wahnmerkmale:
Die Graduierung der inhaltlichen Wahnmerkmale wird einheitlich nach
folgenden Gesichtpunkten vorgenommen:
1. Zu beurteilen ist die Beeinträchtigung im gewohnten sozialen
Rahmen (Beruf, Familie und Freizeitbereich). Maßstab ist dabei das
Funktionsniveau, das vor dem Ausbruch der Wahnsymptomatik bestanden hat.
2. Es muß ein Zusammenhang zwischen der Wahnsymptomatik
und den erkennbaren Behinderungen vorhanden sein.
Beispiel: Ein Patient glaubt sich durch ein Verbrechersyndikat
verfolgt und bespitzelt, vermag aber dennoch seiner Arbeit nachzugehen
und seine familiären Pflichten zu erfüllen (= leichte Ausprägung).
Ein anderer Patient mit einem hypochondrischen Wahn wandert von einem
Arzt zum anderen, liegt ansonsten [>87] tagelang in seinem Bett, gibt frühere
Interessen auf, geht nicht mehr an seinen Arbeitsplatz mit Hinweis auf
seine unheilbare Krankheit (= schwere Ausprägung).
33. Wahnstimmung
(sF)
Definition:
Ist die erlebte Atmosphäre des Betroffenseins, der Erwartungsspannung
und des bedeutungsvollen Angemutetwerdens in einer verändert erlebten
Welt oder auch durch ein verändert erlebtes Ich. Diese Stimmung besteht
in einem Bedeutungszumessen und Inbeziehungsetzen, Meinen, Vermuten und
Erwarten, das von Gesunden nicht nachvollzogen werden kann.
Dabei gibt es die verschiedensten Grundtönungen der Stimmung;
am häufigsten ist die Stimmung der Unheimlichkeit, des Mißtrauens,
des Verändertseins (des Kranken selbst oder seiner Umgebung), des
Erschüttert- und Erschrecktseins, der Bedrohung, der Angst, des Argwohns,
der Ratlosigkeit, manchmal auch der Gehobenheit, Euphorie und Zuversicht.
In der Wahnstimmung ist der Wahninhalt in der Regel nicht definiert,
deshalb kann der Patient keine Gründe für sein Erleben angeben.
Erläuterungen und Beispiele:
Das Merkmal muß unmittelbar beobachtet oder überzeugend
geschildert werden.
"Es liegt etwas in der Luft, alles um mich herum ist merkwürdig
verändert, alles so seltsam; die Leute machen so ein böses Gesicht,
da muß doch was passiert sein, oder?" [>88]
"Plötzlich machte sich ein unheimliches Glückgefühl
breit; ich spürte, daß etwas Großartiges geschehen müßte,
hatte aber noch keine richtige Vorstellung davon. Erst am Abend ist es
mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen."
Wahnstimmung wird vor allem initial bei akuten psychotischen Störungen
beobachtet.
Hinweise zur Graduierung:
"leicht" Die Wahnstimmung beschränkt sich
nur auf wenige Bereiche des Erlebens (Beispiel: Der Patient berichtet über
merkwürdige atmosphärische Veränderungen am Arbeitsplatz,
die ihn mit Argwohn und Angst erfüllen).
"schwer" Das Erleben des Patienten ist überwiegend durch
Wahnstimmung geprägt. Für den Patienten hat die gesamte Umwelt
ihre vertraute und bisher selbstverständliche Bedeutung verloren,
alles wird unheimlich und verändert erlebt.
Abzugrenzende Merkmale:
38 Wahndynamik.
34. Wahnwahrnehmung
(Sf)
Definition:
Reale Sinneswahrnehmungen erhalten eine abnorme Bedeutung (meist im
Sinne der Eigenbeziehung). Die Wahnwahrnehmung ist also eine wahnhafte
Fehlinterpretation einer an sich richtigen Wahrnehmung. [>89]
Erläuterungen und Beispiele:
"Daß der Arzt mit dem Kopf nickte, als er mir zum Abschied die
Hand gab, bedeutet, daß ich Krebs habe!"
Hier auch "mnestische Wahnwahrnehmung" als besondere Form der Wahnerinnerung
eintragen (Beispiel: "Als Kind hatte ich eine Gabel, auf der eine
Krone eingraviert war. Jetzt habe ich die Bedeutung begriffen, daß
ich nämlich in Wirklichkeit fürstlicher Abstammung bin!").
Hier auch Personenverkennungen markieren, sofern sie den Charakter
einer Wahnwahrnehmung besitzen.
Hinweise zur Graduierung:
"leicht" Die Wahnwahrnehmungen
beschränken sich auf einzelne Themen des Erlebens (l - 2 Wahnwahrnehmungen
im Beobachtungszeitraum).
"schwer" Das Erleben des Patienten wird
durch die Wahnwahrnehmungen geprägt (mehr als 5 unterschiedliche Wahnwahrnehmungen
im Beobachtungszeitraum).
Abzugrenzende Merkmale:
35 Wahneinfall, Merkmalsbereich Sinnestäuschungen, insbesondere
47 Illusionen.
35. Wahneinfall
(SF)
Definition:
Wahneinfall nennt man das gedankliche (im Gegensatz zur "Wahnwahrnehmung")
Auftreten von wahnhaften Vorstellungen und Überzeugungen. Diese treten
meist plötzlich und unvermittelt auf. [>90]
Erläuterungen und Beispiele:
"Gestern ist mir aufgegangen, daß ich den Friedensnobelpreis
erhalte, weil ich die Supermächte telepathisch ausgesöhnt habe."
"Heute morgen ist mir sonnenklar geworden, daß mein Sohn gar
nicht von mir stammt."
Hier auch "mnestischen Wahneinfall" als besondere Form der Wahnerinnerung
markieren (Beispiel: Einem Patienten fallt plötzlich ein, daß
er schon als Kind übernatürliche Kräfte gehabt habe).
Das Merkmal kann unmittelbar beobachtbar sein oder plausibel für
den Beobachtungszeitraum berichtet werden. Wahneinfälle werden in
der Regel nicht begründet.
Hinweise zur Graduierung:
"leicht" Die Wahneinfälle
beschränken sich auf einzelne Themen des Erlebens (1-2 Wahneinfälle
im Beobachtungszeitraum),
"schwer" Das Erleben des Patienten wird
durch die Wahneinfälle geprägt (mehr als 5 unterschiedliche Wahneinfälle
im Beobachtungszeitraum).
Abzugrenzende Merkmale:
34 Wahnwahrnehmung, 36 Wahngedanken."
Es folgen 36. Wahngedanken, 37. Systematisierter
Wahn, 38. Wahndynamik und danach einzelnen. häufigere Wahnformen,
z.B. 39. Beziehungswahn, 40. Beeinträchtigungs- und Verfolgungswahn
...
PSE Symptomverzeichnis nach Wing et al. (dt. 1982) S. 218ff
"Die Nummer des Symptoms ist in Klammern angegeben.
Die Seitenangaben bezieht sich auf die Definition im Glossar.
Ablenkbarkeit (114) 199
Adäquatheit des Interviews (140) 211
Affekt, siehe Stimmung
Agitiertheit (111) 198
Aktivitätsverlust (110) 198
Alkoholmißbrauch (99) 194
Amnesie (97) 193
Antriebslosigkeit, Gefühl der (36) 162
Angst
-, als Folge von Wahninhalten (13) 151
-, ängstliche Vorahnung (12) 150
-, beobachtete (120) 202
-, freiflottierende, mit vegetativen Begleiterscheinungen
(11) 149
-, Menschen zu treffen (16) 152
-, Panikattacken (14) 151
-, situationsabhängige, mit vegetativen
Begleiterscheinungen (15) 151
-, spezifische Phobien (17) 153
-, Vermeidung angstauslösender Situationen
(18) 153
-, Vorrangigkeit von Angst oder Depression (26)
158
Argwohn (125) 203
Bewußtseinseinengung (100) 194
Bewußtseinstrübung (102) 195
Beziehungsideen
-, einfache (31) 160
- mit Schuldinhalten (32) 161
Bizarre Körperhaltung (116) 200
- Körperhaltung (116) 200
Denken, Gefühl des ineffizienten (19) 154
Denkstörungen, siehe Gedanken, Sprache,
Depression
-, beobachtete (121) 202
-, Beziehungsideen mit Schuldinhalten (32) 161
-, depressive Verstimmung (23) 156
-, herabgesetztes Selbstwertgefühl (29)
159
-, krankhafte Schuldgefühle (33) 161
-, morgendliche depressive Verstimmung (27) 159
-, prämenstruelle Verschlechterung (39)
163
-, Suicidabsichten oder -Handlungen (25) 157
-, Vorrangigkeit von Angst oder Depression (26)
158
Depersonalisation (48) 167
Derealisation (47) 167
Dissoziative Zustände (100) 194
Distanzloses Verhalten (113) 199
Drogenmißbrauch (98) 194
Erinnerungslücken (97) 193
Erregung (112) 199
Fugues (97) 193
Gedanken, Störungen der
-, Gedankenblock und Gedankenentzug (58) 173
-, Gedankendrängen (42) 165
-, Gedankenecho und kommentierende Gedanken (57)
173
-, Gedankeneingebung (55) 170
-, Gedankenlautwerden und Gedankenausbreitung
(56) 172
-, Gelesen werden der Ged. (59) 174
-, gemachte Ged. (55) 170
[>219]
Gedächtnisstörungen, organisch bedingte
(103) 195
Gefühllosigkeit, Gefühl der (54) 170
Gereiztheit, feindselige (124) 203
Gesundheit, körperliche (Einschätzung
durch den Pat.) (1) 145
Gewalttätigkeit (112) 199
Gewichtsverlust (34) 162
Größenideen und entsprechende Handlungen
(43) 165
Halluzinationen
-, andere (70) 180
-, auffälliges Verhalten infolge von (118)
201
-, dissoziative (64) 177
-, einen Geruch auszuströmen (69) 179
-, nicht verbale (60) 174
-, olfaktorische (68) 179
-, optische, bei klarem Bewußtsein (66)
178
-, optische, in delirantem Zustand (67) 179
-, Pseudohalluzinationen (65) 178
-, sexuelle (86) 190
-, verbale, affektiv bedingte oder nicht spezifische
(61) 175
-, verbale, nicht affektiv bedingte (Stimmen
sprechen über den Pat.) (62) 176
-, verbale, nicht affektiv bedingte (Stimmen
sprechen zum Pat.) (63)176
Hoffnungslosigkeit (24) 157
Hypochondrie (9) 148
Hypomanische Stimmungslage (123) 203
Ideenflucht (137) 209
Inadäquater Affekt (129) 205
Inkohärenz der Sprache (136) 209
Interessen, Nachlassen der (22) 155
Irreführende Antworten (139) 210
Katatone Bewegungsstörungen (119) 201
Konversionssymptome (101) 195
Konzentrationsschwierigkeiten (20) 154
Körperhaltung, bizarre (116) 200
Krankheit oder Behinderung, körperliche
(2) 146
Krankheitseinsicht (neurotische Symptome) (105)
196
Krankheitseinsicht (psychotische Symptome) (104)
196
Libidoverlust (38) 163
Manierismen (116) 200
Morgendliche depressive Verstimmung (27) 159
Müdigkeit und Erschöpfung (6) 147
Muskuläre Verspannung (7) 148
Mutismus (133) 207
Neologismen (135) 208
Nervöse Anspannung (10) 149
Panikattacken (14) 151
Phobien, spezifische (17) 153
Prämenstruelle Symptomverschlechterung (39)
163
Psychosomatische Symptome (3) 146
Ratlosigkeit (126) 204
Rededrang (131) 206
Reizbarkeit (40) 163
Ruhelosigkeit (8) 148
Schamloses Verhalten (115) 200
Schlafstörungen
-, Einschlafstörungen (35) 162
-, frühzeitiges morgendliches Erwachen (37)
163
Schuldgefühle, krankhafte (33) 161
Selbstvertrauen, Mangel an (30) 160
Selbstwertgefühl, herabgesetztes (29) 159
Sorgen (4) 146
Soziale Beeinträchtigung
- als Folge der neurotischen Symptomatik
(106) 197
- als Folge der psychotischen Symptomatik
(107) 197
Soziale Zurückgezogenheit (28) 159
Spannungszustände
-, Muskuläre Verspannung (7) 148
-, Müdigkeit und Erschöpfung (6) 147
-, Nervöse Anspannung (10) 149
-, prärmenstruelle Verschlechterung (39)
163
-, Spannungsschmerzen (5) 147
Sprache
-, Einschränkung der Sprachäußerungen
(134) 207
-, Ideenflucht (137) 209
-, Inkohärenz (136) 209
-, irreführende Antworten (139) 210
[>220]
Sprache, Mutismus (133) 207
-, Neologismen (135) 208
-, Rededrang (131) 206
-, Sprachverarmung (138) 210
-, verlangsamte Sprache (130) 206
Stereotypien (117) 201
Stimmung
-, Affektlabilität (127) 204
-, Affektverarmung (128) 205
-, ängstliche (11) 149
-, Argwohn (125)203
-, beobachtete Angst (120) 202
-, beobachtete Depression (121)202
-, expansive (41)164 -, depressive (23)156
-, feindselige Gereiztheit (124) 203
-, Gefühl des Affektverlustes (54) 170
-, Gefühl der Gefühllosigkeit (54)
170
-, hypomanische (123) 203
-, inadäquater Affekt (129) 205
-, Ratlosigkeit (126) 204
-, Reizbarkeit (40) 163
-, Wahnstimmung (49) 168
Stupor (102) 195
Suicidabsichten oder -handlungen (25) 157
Theatralisches Verhalten (122) 203
Tics (117) 201
Verlangsamung (110) 198
-, Gefühl der (36) 162
Verlangsamte Sprache (130) 206
Vernachlässigung des Äußeren
(108) 197
- durch Grübeln (21) 155
Vorahnung, ängstliche (12) 150
Wahn und Wahninhalte
-, auffälliges Verhalten als Folge von (96)
193
-, das Aussehen betreffend (89) 192
-, ausweichendes Verhalten bei (94) 193
-, außergewöhnliche Fähigkeiten
(76) 180
-, Beziehungsideen (72) 182
-, Beschäftigung mit (95) 193
-, Depersonalisation (90) 192
-, Eifersuchtswahn (84) 190
-, Erinnerungsfälschungen (87) 191
-, Erklärungen mit Hilfe paranormaler Vorstellung
(79) 187
-, Erklärungen mit Hilfe physikalischer
Prozesse (80) 187
-, fremde Kräfte, die den Körper durchdringen
(81) 188
-, einen Geruch auszuströmen (69) 179
-, Größenwahn (77) 186
-, hypochondrischer (91) 193
-, Katastrophenwahn (92) 193
-, Konfabulationen
(87) 191
-, Mißdeutungen (73) 183
-, phantastische (87) 191
-, primärer (82) 188
-, religiöser (78) 186
-, Schuldwahn (88) 191
-, schwanger zu sein (85) 190
-, sexuelle (86) 190
-, Störungen des Icherlebens (71)180
-, subkulturell beeinflußter (83) 189
-, unterstützt zu werden (75) 185
-, Verfolgungswahn (74) 184
-, wahnhafte Verarbeitung anderer Halluzinationen
(70) 180
Wahnstimmung (49) 168
Wahrnehmung
-, abgeschwächte (51) 169
-, erhöhte (50) 168
-, veränderte (52) 169
-, verändertes Zeiterleben (53) 169
Zeiterleben, verändertes (53) 169
Zurückgezogenheit, soziale (28) 159
Zwänge
-, Kontroll- und Wiederholungszwang (44)
165
-, Sauberkeitszwang und ähnliche Rituale
(45) 166
-, Zwangsgedanken und Zwangsgrübeln (46)
166"
Problembeispiel Konfabulation
Die Begriffsbestimmung einer Konfabulation ist einfach, der Nachweis oder die Evaluation allerdings sehr schwierig. Bei Wing et al. (1982) wird Konfabulation nicht aufgeführt.
AMDP (1981), S. 57:
"13. Konfabulationen: Erinnerungslücken werden mit Einfallen
ausgefüllt, die vom Patienten selbst für Erinnerungen gehalten
werden. Dabei können vom Patienten immer wieder andere Inhalte für
dieselbe Erinnerungslücke angeboten werden.
(Dieser letzte Punkt ist wichtig zur Unterscheidung
gegenüber pseudologischem Fabulieren.)"
AMDP (1995), S. 66f:
"13. Konfabulationen (F)
Definition:
Erinnerungslücken werden mit Einfällen ausgefüllt, die
vom Patienten selbst für Erinnerungen gehalten werden.
Erläuterungen und Beispiele:
Bei mehrmaligem Nachfragen werden vom Patienten immer wieder andere
Inhalte angeboten; wenn im Interview der Eindruck entsteht, daß der
Patient konfabuliert, sollte dieselbe Frage mehrfach gestellt werden.
Hinweise zur Graduierung:
"leicht" Konfabulationen werden
im Interview ein- oder zweimal beobachtet, der Patient hat im übrigen
jedoch keine wesentlichen Erinnerungslücken.
"schwer" Mehrmals bestehen Erinnerungslücken,
die vom Patienten durchweg mit Konfabulationen ausgefüllt werden.
Abzugrenzende Merkmale:
Jede mnestische Störung kann zu Konfabulationen führen und
ist zusätzlich zu markieren.
Wahnerinnerungen sind unter den inhaltlichen Wahnsymptomen (Merkmale
34 - 36) zu markieren."
Literatur (Auswahl) > Literatur: Befund-Fehler > Potentielle Fehler > Explorations-Fehler > Untersuchungs-Fehler.
- AMDP System (1981, 4. A). Das AMDP-System. Manual zur Dokumentation psychiatrischer Befunde. Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie. Berlin: Springer.
- AMDP System (1995, 5. A). Das AMDP-System. Manual zur Dokumentation psychiatrischer Befunde. Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie. Berlin. Berlin: Springer.
- AMDP-System (2007). Das AMDP-System. Manual zur Dokumentation psychiatrischer Befunde (8., überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Fähndrich, Erdmann & Stieglitz, Rolf D (2006) Leitfaden zur Erfassung des psychopathologischen Befundes - Halbstrukturiertes Interview anhand des AMDP-Systems. Göttingen: Hogrefe.
- Gebhardt, R., Pietzcker A., Strauss A., Stoeckel, M., Langer C. & Freudenthal, K. (1983). Skalenbildung im AMDP-System. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, 233, 223-245.
- Griesser, G. (1965) Symptomenstatistik. Methodik der Information in der Medizin. Vol 4,2,79-82. Abstract:
- Schneider, Kurt (1973). Klinische Psychopathologie. 10. A. Stuttgart: Thieme.
- Wieck, H.H. (1967).Lehrbuch der Psychiatrie. Stuttgart: Schattauer.
- Wing, J. K., Cooper, J. E., Sartorius, N. (1982) Die Erfassung und Klassifikation psychiatrischer Symptome. Beschreibung und Glossar des PSE (Present State Examination) - ein Verfahren zur Erhebung des psychopathologischen Befundes. Deutsche Bearbeitung M.v. Cranach. Weinheim: Beltz
- "Für die Stellung der Diagnose ist eine genauere
Kenntnis der subjektiven und objektiven Krankheitsmerkmale (Symptome und
Krankheitszeichen) und der (relativen) Häufigkeit ihres Vorkommens
notwendig. Die Kenntnis dieser Größen, die nicht nur als Mittel
für eine „elektronische Diagnostik", sondern als ein wesentlicher
Bestandteil der modernen klinischen Medizin anzusehen ist, wird im Sinne
einer klinischen Grundlagenforschung durch Präzisierung, Einordnung
und Gewichtung eine schärfere Abgrenzung der Krankheitsbilder als
bisher ermöglichen. Dazu sind aber eine weitgehende Übereinstimmung
in Gehalt und Terminologie der diagnostischen Begriffe und einwandfreie,
nicht mit systematischen Fehlern behaftete Erhebungsmethoden die Voraussetzungen
für derartige, nur überörtlich durchführbare Forschungsvorhaben."
Links (Auswahl: beachte) > Literatur: Befund-Fehler > Potentielle Fehler > Explorations-Fehler > Untersuchungs-Fehler.
Glossar, Anmerkungen und Endnoten > Syndrom.
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
___
Standort: Symptomverzeichnisse.
*
Suchen in der IP-GIPT, z.B. mit Hilfe von "google": |
Information für Dienstleistungs-Interessierte.
*
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS). Symptomverzeichnisse. Abteilung Diagnostik und Differentialdiagnostik. Erlangen: https://www.sgipt.org/diagnos/Symptom.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich erwünscht. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert: irs 02.04.2013
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
07.12.19 Zweifel am Rosenhanstudie vermerkt.
17.09.16 AMDP-Auspraegungen im Befund.