(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=13.10.2018 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 22.06.20
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_ Begriffsanalyse Wissenschaftstheorie, Logik, Methodologie_Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_ Überblick Wissenschaft _ Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:
Begriffe, Begriffsanalyse und Gebrauchsbeispiele in der Wissenschaftstheorie, Logik und Methodologie
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
Haupt- und Verteilerseite
Begriffsanalysen (Überblick).
Zur Haupt- und Verteilerseite
Begriffsanalyse Begriff.
Definition
Begriff.
Signierung
Begriffe und Begriffsmerkmale (BM).
Übersicht und Stand Wissenschaftstheorie, Methodologie und Logik:
Status/Stand der Signierungen: m=markiert (), s= signiert (BM...), k=korrigiert, t=teilweise signiert]
- Kamlah / Lorenzen: Das Problem des Anfangs.
- Begriff in der Logischen Propädeutik von Kamlah & Lorenzen (1973). [s]
- Begriffsformen und -arten nach Stegmüller. [t]
- Gabriel (1991) Wissenschaftliche Begriffsbildung. [s]
- Begriffe nach Mittelstraß (2005), S. 137ff. [s]
- Begriff nach Menne (1992). [m]
- Begriffsbestimmung nach Dubislav (1931). [m]
- Begriff nach dem Woerterbuch der Logik (dt. 1978, russ. 1975). [m]
- Marxististische Wissenschaftstheorie: Der Begriffsaufbau in der Wissenschaft. [m]
- Begriff in der Logik von Port Royal (1662). [m]
- Begriff nach Bolzanos Wissenschaftslehre (1837). [m]
- Fogarasi Begriff und dialektische Logik. [s]
- Frege:
- Freytag-Löringhoff:
- Borowski
- Logik von Port Royal
- Notizen.
Anfangsproblem
Kamlah & Lorenzen (1973) § 2 Das Problem des Anfangs (der "Fundamentalphilosophie"), S. 15-22, hier S. 15 (fett für g e s p e r r t e Hervorhebung):
- "Die Phänomenologie und Existenzphilosophie
unseres Jahrhunderts haben jenes „immer schon“ zu beachten gelehrt, das
soeben zitiert wurde: Wir müssen „immer schon“ sprechen, wenn wir
Wissenschaft oder Philosophie treiben. Wir existieren „immer schon“ in
einem „Vorverständnis“ der Welt und unserer selbst, ehe wir nachzudenken
und zu forschen beginnen, und dieses Vorverständnis artikuliert sich
sprachlich. Wie sollen wir also beginnen, die Sprache als Bedingung der
Möglichkeit vernünftigen Redens und Denkens zu untersuchen, wenn
wir keinerlei Untersuchung beginnen können, ohne bereits zu sprechen
? Geraten wir hier in einen unvermeidlichen Zirkel, oder haben wir
Aussicht, einen Anfang unseres Nachdenkens zu finden, von dem her
wir zirkelfrei und schwindelfrei Vorgehen können "
- S. 21: "Doch es handelt sich gar nicht um die
Aufgabe, mit dem Denken von einem absoluten Nullpunkt neu anzufangen. Keineswegs
haben wir, wie DESCARTES vermeinte, eine Situation zu fingieren, in der
ein Ich „ohne Körper und ohne Sinne“ die Welt und die Mitmenschen
noch gar nicht zu Gesicht bekommen und in der es das erste Wort noch gar
nicht gesprochen hat. Diese Denker der Aufklärung, KANT wiederum eingeschlossen,
haben „Erkenntnis“ so verstanden, als müsse nicht allein die vernünftige,
die wissenschaftliche Erkenntnis, sondern auch unser vorwissenschaftlicher
Weltbezug allererst gestiftet werden, und haben sich damit zweifellos übernommen.
Statt dessen ist allen Ernstes „davon auszugehen“, daß wir „immer
schon sprechen“, miteinander sprechen als Menschen unter Menschen und als
Menschen in der Welt. Was wir einklammem, gleichsam vorerst auslöschen,
sind lediglich die Sprache der Wissenschaft und damit alle Behauptungen,
die in wissenschaftlicher (oder philosophischer) Sprache formuliert wurden
oder formuliert werden können. Selbstverständlich wird von dieser
Einklammerung auch alles dasjenige betroffen, was hier bisher schon behauptet
wurde im Sinne vorläufiger Präliminarien.
Freilich entschließen wir uns zu dieser Revision unseres vernünftigen Denkens auf Grund der Erfahrungen, die wir mit der Vernunft seit THALES gemacht haben. Der jetzt neu Anfangende ist nicht ein „Anfänger“ schlechthin, sondern sozusagen ein enttäuschter Kenner (darin wieder ähnlich dem skeptischen DESCARTES). Was kann er also tun, damit ihm nicht mitgebrachte Überzeugungen (die er wie jeder andere zweifellos hat) das Geschäft von vornherein verderben ? Er kann es vermeiden, solche Überzeugungen zu „denken“, d. h. zu formulieren, auszusprechen, indem er den Standpunkt einnimmt, daß er die Wörter, die er dazu verwenden müßte, noch gar nicht zur Verfügung hat KL-FN1.
- KL-FN1: ’Nur
am Rande sei daran erinnert, daß HEGEL seine „Wissenschaft• der Logik"
mit der Frage beginnt: „Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht
werden?" Dieser Anfang ist aber für Hegel „das reine Sein“. Das erste
Buch seiner Logik trägt den Titel „Die Lehre vom Sein“, das I. Kapitel
handelt vom „Sein", vom „Nichts“ und vom „Werden" — Hegels Fragestellung
führt also sogleich auf einen Weg, der sich sowohl von der traditiondien
wie von der modernen Logik weit entfernt und auch mit der hier versuchten
Sprachkritik nichts gemeinsam hat."
_
S. 23: "I. KAPITEL: DIE ELEMENTARE PRÄDIKATION
§1. Vorbereitung des Neu-Anfangs
Damit wir diesen Standpunkt einnehmen können
(daß wir eine wissenschaftliche Sprache noch gar nicht besitzen),
müssen wir nicht allein (wie es ja auch hier weiterhin geschieht)
„immer schon sprechen“. Wir müssen auch schon wissen — und wissen
es als enttäuschte Kenner —, daß es bisher so etwas wie „wissenschaftliche
Sprache“ gegeben hat im Unterschied von einer anspruchsloseren Sprache,
die wir die „Umgangssprache“ nennen. Dieses „Vorverständnis“ eines
Unterschieds gleichsam zweier Sprachebenen können wir schon zu Anfang
nicht entbehren, indem 'wir seine Vorläufigkeit freilich im Auge behalten.
Und wir tun gut daran, im Rückgriff auf geläufige Redeweisen
diesen Unterschied jetzt (immer noch vorläufig) zu verdeutlichen.
Wir sprachen bisher schon
und sprechen weiterhin, indem wir uns einer Sprache bedienen, die wir auch
die „natürliche Sprache“ nennen. Jeder von uns hat als Kind eine bestimmte
natürliche Sprache als seine „Muttersprache“ erlernt. Der Ausdruck
„natürliche Sprache“ ist also insofern irreführend, als gerade
die Muttersprachen geschichtliche Gebilde sind, als überhaupt die
menschliche Sprache die Vorgegebenheit der „Natur“ nicht hat, sondern vom
Menschen erst hervorgebracht wurde. „Natur“ steht hier nicht im Gegensatz
zu „Geschichte“, sondern in dem älteren Gegensatz zu „Kunst“: natura
— ars, (griechisch). Die Umgangssprache unterscheidet sich als natürliche
Sprache von künstlichen Sprachen der artes, der Wissenschaften. Zwar
ist auch sie Menschenwerk, nicht aber vorgeplantes Kunstwerk. Wir beginnen
von vom, indem wir jene „Kunstausdrücke“ vermeiden, jene „termini
technici“, die sich äußerlich oft dadurch verraten, daß
sie im Gewande des „Fremdwortes“ auftreten. Wir versetzen uns also in eine
Situation, in der wir noch nicht wissen, was „Realität“ ist oder „Bewußtsein“,
„subjektiv“ oder „philosophisch“, „Elektron“ oder „Kohlenwasserstoff“,
„Begriff“ oder „logischer Schluß“, „Eschatologie“ oder „Sozialstruktur“
und so fort. Wir verbieten uns, den unvorbereiteten Gesprächspartner,
Hörer oder Leser in der heute überall üblichen Weise mit
solchen Ausdrücken zu überfallen. [>24] Wie auch immer solche
„Kunstausdrücke“ eingeführt sein mögen, sie unterscheiden
sich von den „Gebrauchsausdrücken“ der natürlichen Sprache, die
auf jene schwer greifbare Weise entstanden sind, in der eine Sprache gleichsam
wächst, ohne doch Natur zu sein, in der sie von Menschen hervorgebracht
wird, ohne doch geplantes Gerät zu sein. Jeder von uns hat diese Ausdrücke
nicht in der Schule, sondern schon im Elternhaus erlernt, im Vollzüge
des Gebrauchs, des „Sprachgebrauchs“. (Damit führen wir, weiter im
Blick auf jenen Unterschied von wissenschaftlicher Sprache und Umgangssprache,
vorläufig gewisse Kunstausdrücke ein oder wieder ein.) Eine Sprache
wie die unsrige zeichnet sich dadurch aus, daß sie eine schwer abgrenzbare
Masse von Kunstausdrücken (oder „Fachausdrücken“) enthält.
Und diese Ausdrücke werden keineswegs nur in wissenschaftlicher, in
„theoretischer“ Absicht gebraucht, sondern sind vielfach in die Umgangssprache
eingegangen, mit der wir uns alltäglich verständigen, indem wir
einem anderen etwa Vorhalten, seine Ansicht sei „sehr subjektiv“ oder er
leide an „Minderwertigkeitskomplexen“. Dieser Umstand macht es schwierig,
in jedem einzelnen Falle zu unterscheiden, ob wir ein Wort jener oberen
Sprachebene zuzurechnen haben, auf die wir uns vorerst nicht begeben wollen.
Wir müssen und können uns mit einer ungefähren Unterscheidung
beider Ebenen begnügen.
In der Tat beginnen wir nun
„vertrauensvoll inmitten“, indem wir immer schon sprechen und weiterhin
sprechen, nämlich unsere Umgangssprache gebrauchen. Unser skeptisches
Mißtrauen richtet sich gegen die Bildungssprache, in der von „Werten“
oder von „Fundamentalontologie“ gesprochen wird, dagegen nicht gegen die
Sprache des Alltags, in der von „Gemüse“, „Abreise“, „Sprechen“ gesprochen
wird — auch dies wieder auf Grund unserer geschichtlichen Erfahrung.
Wir versuchen also keineswegs,
„fundamentalontologisch“ so etwas wie „Prinzipien des Seins“ oder der „Gegenstandskonstitution“
in die Hand zu bekommen. Wir versuchen auch nicht, die „Erkenntnis“ eines
Wesens zu begründen, das noch nicht einmal einen Farbfleck gesehen,
noch nie einen Gedanken gedacht hat. Mit dergleichen Fabelwesen befassen
wir uns nicht. Und wie wir nicht „hinter“ das Sein und nicht „unter“ die
Erkenntnis zu gelangen versuchen, so erkennen wir auch in gewisser Weise
(in der angegebenen Weise) die Nichthintergehbarkeit der Sprache an. Wir
fingieren weder eine Kaspar-Hauser-Situation, noch vertiefen ?wir uns in
die Probleme der Lern- oder Kinderpsychologie.
Freilich werden, wir hernach
noch genauer klären müssen, inwiefern wir einerseits auf dem
Boden der natürlichen Sprache beginnen und andererseits dennoch von
Grund auf beginnen. Was die Rolle der natürlichen Sprache als Vorbedingung
betrifft, so werden wir insbesondere auf folgendes zu achten haben: Benutzen
wir die Umgangssprache lediglich als Erläuterungssprache, etwa so,
wie im Klavierunterricht erläuternd gesprochen wird, ohne daß
von dem Klavierspiel selbst gesagt werden kann, es knüpfe an irgend
etwas an, was wir als schon immer Sprechende bereits können? Oder
knüpft der Aufbau des wissenschaftlichen Sprechens eben in dieser
Weise rückgreifend an das schon immer vorgegebene Sprechen können
an? In diesem zweiten Falle erhielte das „inmitten“ eine erheblichere Bedeutung
als im ersten Falle.
Der erste Fall bestünde
dann, wenn die zu erlernenden ersten Schritte des wissenschaftlichen Sprechens
von der Art der ersten Schritte des Rechnens wären. Zwar kennen wir
kein noch so primitives Sprechen, das nicht bereits mit primitivem Zählen
und Rechnen verbunden wäre. Wir können aber aus einer natürlichen
Sprache die Zahlwörter und die Ausdrücke für einfache Rechenoperationen
ohne Schwierigkeit gleichsam herausschneiden, eine Anfangssituation fingieren,
in der das Zählen noch gar nicht bekannt ist, und dann z, B. durch
wiederholtes Zeichnen von Strichen die ersten Handlungen in Gang setzen,
die zum Zählen und Rechnen führen. Die Umgangssprache würde
dabei in derselben Weise wie beim Klavierspiel oder beim Halma als bloße
Erläuterungssprache dienen.
In unserem Falle ist die Ausgangssituation
offenkundig eine andere. Wir werden uns hernach mit „Sätzen“, des
genaueren mit „Aussagen“ befassen, weiterhin mit „Wörtern“ verschiedener
Art. Aber wir können uns keine natürliche Sprache denken, in
der nicht bereits Wörter und Sätze vorkämen, in der nicht
Handlungen schon bekannt und eingeübt wären wie eben diejenigen,
die wir „Sätze“ nennen. Und wir haben keinen stichhaltigen Grund,
nicht auch die Verwendung von Wörtern wie „Wort“ oder „Satz“ bereits
als eingeübt vorauszusetzen. In unserem Falle werden wir also nicht
allein erläuternd, sondern auch rückgreifend, an bereits Bekanntes
und Gekonntes appellierend, von der Umgangssprache Gebrauch machen, dabei
indessen zu fragen haben, ob wir einfache sprachliche Handlungen nicht
wenigstens rekonstruieren können in einer Weise, die uns zu der Zuversicht
berechtigt, daß wir gleichsam nachträglich ihrer Geburtsstunde
beigewohnt haben."
Begriff in der Logischen Propädeutik von Kamlah & Lorenzen (1973), S. 86
"Sehen wir nun von der Lautgestalt eines Terminus ab und achten nur auf seine normierte Verwendung (auch dann, wenn der Terminus durch Exempel und Prädikatorenregeln bestimmt wurde), so sprechen wir von einem (BMDefiniens) Begriff (BMDefiniendum).
Ein Begriff (BMDefCha), (BMdiff ) ist also nicht ein „gedankliches Gebilde“, das der Verlautbarung im Wort vorausginge, sondern zunächst nichts anderes als ein Terminus; jedoch abstrahieren (BMabsgen) wir von der beliebigen Lautgestalt eines Terminus, wenn wir ihn „Begriff“ (BMDefCha) nennen."
- Kommentar: > Definition
Begriff.
Begriffsformen nach Stegmueller (1970, II., A. S.1 ). [ts]
Stegmüller unterscheidet fünf Faktoren bei der wissenschaftlichen Begriffsbildung
- willkürlichen Konventionen (BMWBBK) (Festsetzungen),
- empirischen Befunden (BMWBBTF) (Tatsachenfeststellungen),
- hypothetischen Annahmen (BMWBBHA) (Verallgemeinerungen aus den empirischen Befunden),
- Einfachheitsüberlegungen (BMWBBE)
- Fruchtbarkeitsbetrachtungen (BMWBBF).
- klassifikatorische oder qualitative (BMWBFq),
- topologische oder komperative (BMWBFk),
- quantitative oder metrische (BMWBFm)
"Ein besonderes Gewicht wird auf die Untersuchung des Zusammenspiels
von fünf Faktoren bei der wissenschaftlichen Begriffsbildung gelegt:
willkürlichen
Konventionen (Festsetzungen) (BMWBBK),
empirischen
Befunden (BMWBBTF)
(Tatsachenfeststellungen), hypothetischen Annahmen
(BMWBBHA) (Verallgemeinerungen
aus den empirischen Befunden), Einfachheitsüberlegungen
(BMWBBE) und Fruchtbarkeitsbetrachtungen
(BMWBBF). Es wird gezeigt,
daß die oft geäußerte Auffassung, wonach ein Begriffssystem
nur auf Festsetzungen beruht, unhaltbar ist. Vielmehr stellt sich heraus,
daß bereits auf der einfachsten Stufe der Begriffsbildung alle vier
anderen Faktoren eine bedeutsame Rolle spielen. Sogar bei der logisch elementarsten
Klassifikation, der Aufgliederung eines Gegenstandsbereiches in zwei Teilbereiche,
muß man sich im allgemeinen auf Erfahrungen und Hypothesen stützen.
Der Sachverhalt wird zunächst in abstracto geschildert und dann an
verschiedenen Beispielen illustriert. Es läßt sich ferner zeigen,
daß bereits auf dieser elementaren Stufe die endgültige Wahl
eines Begriffssystems häufig von der Beantwortung der Frage abhängig
gemacht wird, welches unter den vorgeschlagenen möglichen Systemen
das einfachste ist. Auch Fruchtbarkeitsüberlegungen spielen bereits
hier eine ausschlaggebende Rolle. Bei Überlegungen dieser Art trachtet
man danach, die Frage zu beantworten: „Welches Begriffssystem führt
zu möglichst einfachen und zu möglichst zahlreichen Gesetzmäßigkeiten?“
Für die Einführung komparativer
oder topologischer Begriffe (BMWBFk)
werden zwei verschiedene Methoden angegeben. Diese Begriffe können
entweder auf der Basis von zwei Grundbegriffen oder auf der Basis eines
einzigen Grundbegriffs eingeführt werden. In beiden Fällen geht
es darum, einen Gegen-(>2)standsbereich nicht bloß in Teilklassen
zu zerlegen, sondern in ihn eine bestimmte Ordnung einzufuhren (auch Quasiordnung
genannt, da verschiedene Objekte des Bereiches dieselbe Position in der
Ordnung einnehmen können). Ob es wirklich geglückt ist, eine
solche Ordnung zu konstruieren, hängt davon ab, ob die beiden Grundrelationen
(bzw. die eine Grundrelation bei der zweiten Methode des Aufbaues) bestimmte
Adäquatheitsbedingungen erfüllen. Diese Bedingungen haben die
Form von Allsätzen, die außerdem in der größeren
Anzahl von Fällen keine logischen Folgerungen der Definitionen darstellen.
Damit ist gezeigt, daß auch beim Aufbau eines komparativen Begriffssystems
empirisch-hypothetische Annahmen als gültig vorausgesetzt werden müssen.
Abermals wird der Sachverhalt an verschiedenen konkreten Beispielen illustriert.
Bei der Einführung quantitativer
oder metrischer Begriffe (BMWBFm)
erfolgte aus Gründen der Ökonomie sowie der Anschaulichkeit eine
Beschränkung auf solche BegrifFe, die dadurch Zustandekommen, daß
zunächst ein komparativer Begriff eingeführt und die entstandene
Quasiordnung nachträglich metrisiert wurde. Es wird eine zweifache
Klassifikation vorgenommen. Die erste betrifft die Unterscheidung in Metrisierungen,
die zu extensiven Größen (z. B. Länge, Gewicht) führen,
und solche, die zu intensiven Größen (z. B. Temperatur) fuhren.
Die Regeln für die Einführung extensiver Größen sind
einfacher, da hier eine Kombinationsoperation zur Verfügung steht,
welche eine formale Ähnlichkeit mit der arithmetischen Addition besitzt.
Die zweite Klassifikation betrifft die Unterscheidung in primäre oder
fundamentale Metrisierung und in abgeleitete Metrisierung. Die erste ist
von größerem wissenschaftstheoretischen Interesse, da es hier
darum geht, einen Größenbegriff erstmals zu konstruieren, während
im zweiten Fall quantitative Begriffe durch Zurückführung auf
bereits verfügbare andere metrische Begriffe eingeführt werden.
Damit die Bedingungen für eine adäquate Metrisierung erfüllt
sind, müssen zahlreiche allgemeine Prinzipien (Maßprinzipien)
gelten, die abermals zum größten Teil die Natur empirisch-hypothetischer
Annahmen besitzen. Nicht einmal die Frage, ob eine Größe eine
extensive oder intensive Größe ist, läßt sich a priori
beantworten. Dies wird am Beispiel der Geschwindigkeit erläutert:
Nach der vorrelativistischen Auffassung ist die Geschwindigkeit eine extensive
Größe, nach der relativistischen Auffassung hingegen eine intensive
Größe."
Wissenschaftliche Begriffsbildung
"Zusammenfassung »Wissenschaftliche Begriffsbildung« (BMwissB) bedeutet zweierlei: Begriffsbildung (BMBBinW) in den Wissenschaften und Begriffsbildung (BMBBnwG) nach wissenschaftlichen Grundsätzen. Entsprechend gibt es zwei Arten der Beschäftigung mit wissenschaftlichen Begriffsbildungen (BMwissB). Man kann erstens die faktischen Begriffsbildungen (BMBBinW) in den Einzelwissenschaften untersuchen und zweitens Begriffsbildungen (BMBBnwG) vornehmen oder vorschlagen, die normativen Vorstellungen von Wissenschaft entsprechen. Beide Vorgehensweisen treffen zusammen in wissenschaftstheoretischen Grundlagendiskussionen. Diese bestehen weitgehend in einer normativen Beurteilung faktischer Begriffsbildungen (BMnormB), (BMBBnwG), (BMMetaM), (BMTheoSys)."
Quelle: Gabriel, Gottfried (1991) Wissenschaftliche Begriffsbildung und Theoriewahldiskurse. In (177-189) Zwischen Logik und Literatur pp
_
Begriff in der Wissenschaftstheorie, Methodologie und Logik
Begriffe
nach Mittelstraß (2005), S. 137ff [GB]
Mittelstraß, Jürgen (2005) Zur Philosophie des Erkennens.
In (133-142) Lessl, Monika & Mittelstraß, Jürgen (2005,
Hrsg.) Von der Wahrnehmung zur Erkenntnis - From Perception to Understanding.
Symposium der Schering Forschungsgesellschaft zu Ehren von Prof. Dr. Dr.
h.c. Günter Stock, Februar 2004. Berlin: Springer.
"13.3 Begriffe
(BMAnalyse)
(BMAnalyse)
?
Im Unterschied zur gemeinhin schlampigen Verwendung des Ausdrucks ,Begriff
(BMuonS)‘,
auch in wissenschaftlichen Kontexten (weitgehend synonyme Verwendung von
,Wort‘, ,Ausdruck‘, ,Terminus‘ und ,Begriff‘(BMuonS)
),
sind in einer logisch geklärten Verwendung
Begriffe
(BMLogB)
(intensionale) Bedeutungen von Prädikaten – wie Gegenstände Bedeutungen
von Eigennamen sind. Wie Prädikate über eine Äquivalenzrelation
,sprachgleich‘ abstraktiv aus Äußerungen gewonnen werden, so
Begriffe
(BMabsgen) über
eine Äquivalenzrelation ,bedeutungsgleich‘ (bzw. ,intensional äquivalent‘
oder ,synonym‘) abstraktiv aus Prädikaten. Als Vertreter eines Begriffs
(BMTerm)
ist ein Prädikat dann ein Terminus. Alle Termini im Definiendum der
Definition eines Terminus, d. h. des Definiens, sind wiederum Merkmale
dieses Terminus und damit des durch ihn dargestellten
Begriffs
(BMTerm)
(womit sie auch zu dessen Intention oder Inhalt gehören).
Begriffesind
folglich nichts, was man etwa auf eine Tafel schreiben könnte (BMBna).
Vielmehr ist die Rede von Begriffen eine
besondere Art der Rede über Prädikate (BMBbRuP).
Wir sagen statt ,das Wort Baum‘ oder ,das Prädikat Baum‘ ,der Begriffe
(BMbegriff)
Baum‘, wenn es uns allein auf die mit Baum getroffene Unterscheidung (etwa
gegenüber Sträuchern) ankommt, nicht auf die Wortgestalt. Die
Wortgestalt ,Baum‘ lässt sich z. B. bedeutungsäquivalent auch
durch ,tree‘ oder ,arbre‘ ersetzen (BMBaequi).
Noch einmal: Begriffe (BMabstr)
sind abstrakte Gegenstände, gewonnen aus Prädikaten hinsichtlich
einer Relation ,bedeutungsgleich‘ zwischen diesen Prädikaten (BMBaequi).
Wir sagen deshalb auch, dass bedeutungsgleiche Prädikate denselben
(abstrakten)
Begriff (BMBaequi)
darstellen. Begriffe liegen
also nicht herum; sie werden auch keineswegs in Definitionen gebildet (BMBnDef).
Sie sind vielmehr das Ergebnis einer besonderen [>138] Weise, über
Unterscheidungen (artikuliert in Prädikaten) zu reden. Orientierungen,
auch wahrnehmungsbezogene, beginnen nicht mit
Begriffen
(BMKonstruk);
sie resultieren in Begriffen
(BMKonstruk).
Insofern aber sind Begriffe (BMKonstruk)
von vornherein Bestandteil von Konstruktionen, d. h. einer konstruktiven
Konstitution der Wirklichkeit. Sie stellen ein Begreifen dar, dessen Wahrheit
nicht die Welt, wie sie ist, sondern die Welt, wie wir sie machen (,sehen‘),
ist. Begriffe (BMKonstruk)
sind eine bestimmte Sicht der Dinge – nicht die Sicht der Dinge.
Als klassische Beispiele dafür mögen
die Begriffe der
Kausalität und des Gesetzes (in
den Naturwissenschaften) gelten (BMBspGeg).
Wenn wir von Kausalität oder Gesetz reden, dann nicht im Hinblick
auf etwas, das sich empirisch zeigt, sondern in der erklärten Absicht,
empirische Vorgänge unter bestimmten Gesichtspunkten, nämlich
kausalen und gesetzmäßigen, zu erklären. Die Begriffeder
Kausalität und des Gesetzes (BMKauGes)
gehören insofern nicht zur Natur oder zur ,Realität‘, sondern
zu unserer Sicht der Natur bzw. der Realität. Anders ausgedrückt:
in der Begriffsbildung (BMKonstruk)
– und das gilt natürlich, wie wir gleich sehen werden, auch von der
Theoriebildung insgesamt – verschaffen wir uns ein zusätzliches Organ,
mit dem wir die Welt ,sehen‘, nicht, wie sie ist, sondern wie sie unsere
Welt ist. Die moderne Wissenschaftstheorie diskutiert diesen Umstand unter
anderem unter dem Begriff (BMTheoSys)
der Theoriebeladenheit, gemeint ist die Bestimmung oder Beeinflussung von
Beobachtungen bzw. Beobachtungssätzen durch theoretische Annahmen
(z. B. in Form von theoretischen Begriffen
(BMtheoB) )
oder Hintergrundüberzeugungen, womit die zuvor erwähnte Unterscheidung
zwischen einer Beobachtungssprache, d. h. einer theorieunabhängigen
Beschreibbarkeit von (wahrnehmungsbezogenen) Sachverhalten, und einer Theoriesprache
aufgegeben wird."
Begriff nach Menne (1992), S. 25ff
"1.232 Vom Begriff (BMBons).
Über das, was ein Begriff (BMBons)
sei und welche überragende Tragweite dem Begriff
(BMBons) zukomme, darüber
ist in Psychologie, Logik, Erkenntnistheorie und Metaphysik in den letzten
zwei Jahrhunderten eine Riesenfülle von Worten vergeudet worden, ja,
ein Großteil der Philosophie ließe sich geradezu als „metaphysischer
Begriffssalat
(BMMBS)“ abtun vom logischen
Standpunkt aus.
Worte können direkt ein Ding bezeichnen. Sie
können aber auch unsere Vorstellung von einem Gegenstand meinen. Eine
solche intellektuelle Vorstellung — nicht zu verwechseln mit der sinnlichen
Anschauung — kann als mentales Zeichen für einen Gegenstand betrachtet
werden, und als solche mentalen Zeichen könnte man Begriffr
(BMmz)
interpretieren. Sie sollten zwar klar und deutlich sein, aber sie sind
es oft eben nicht. Ein Mittel zur Verdeutlichung von Begriffen
() stellt die Definition dar. „Begriff
()“ ist selbst ein Grundbegriff (),
der sich nicht definieren läßt; man kann nur einige seiner Aspekte
beleuchten, um verständlich zu machen, worum es in etwa geht.
Das Bilden eines Begriffes
(), das Haben eines Begriffes beruht für den einzelnen Menschen auf
einem psychischen Prozeß, ist also ein reales Ereignis. Doch dieses
Ereignis erschöpft sich nicht darin, ein solches Ereignis zu sein,
es hat eine Intentionalität, die darüber hinausweist. Dies Ereignis
intendiert einen Bewußtseinszw/w/i. Dieser Bewußtseinsinhalt
ist der subjektive
Begriff () dessen,
an dem sich der entsprechende psychische Prozeß vollzogen hat. In
einem erneuten psychischen Prozeß erinnert man sich an diesen subjektiven
Begriff
(). Der subjektive
Begriff () hat im
Bewußtsein seines Trägers Bestand, besteht nicht ohne ihn und
geht mit ihm zugrunde. Die Auffassung, der Begriff
() bestehe nur im psychischen Prozeß, wird Psychologismus genannt,
die Auffassung, der Begriff () bestehe
nur als subjektiver
Begriff () im Bewußtsein,
vertritt der Conceptualismus, der sich schon bei Wilhelm von Ockham findet.
Wenn der Begriff () als subjektiver
Begriff
() nur im jeweiligen individuellen Bewußtsein besteht, so wird er
auch jeweils durch dies individuelle Bewußtsein subjektiv gefärbt
sein, und es wird problematisch, ob zwei verschiedene Subjekte wirklich
den gleichen subjektiven
Begriff
() haben können. Wenn das nicht möglich wäre, wäre
auch kein intersubjektiv verbindliches, eindeutiges wissenschaftliches
Denken möglich. Die Lösung, zwei an sich nicht ganz gleiche subjektive
Begriffe
() seien dann als gleich zu betrachten, wenn sie sich auf ein und denselben
Gegenstand bezögen, wird dadurch problematisch, daß, ganz im
Gegenteil, ein und derselbe
Begriff
() Pferd auf individuell verschiedene wirkliche Pferde bezogen werden kann:
z. B. einen Rappen, einen Schimmel, einen Hengst, eine Stute; ja, Begriffe
() kann es sogar von Gegenständen geben, die in Wirklichkeit gar nicht
existieren, wie z. B. imaginäre Zahlen oder den „Kaiser vom Monde“
oder „viereckige Kreise“. Bernard Bolzano hat deshalb mit Nachdruck die
Lehre vertreten, daß die subjekiven Begriffe
() der einzelnen Menschen nicht direkt auf wirkliche Gegenstände bezogen
seien, sondern auf einen gemeinsamen objektiven Begriff
(), den er „Vorstellung an
sich“ nannte. Das, was den Vorstellungen bzw. Begriffen
() gemeinsam ist, die ein Grieche kyklös, ein Lateiner circulus, ein
Engländer circle, ein Franzose cercle, ein Däne kreds, ein Finne
ympyrä, ein Türke daire, ein Niederländer kring, ein Rumäne
cerc, ein Schwede ring, ein Spanier circuio, ein Bulgare kreg nennt und
ein Deutscher Kreis, das meint die Vorstellung an sich „Kreis". Dieser
Vorstellung an sich kommt keine Existenz zu, doch sie ist gegeben und wird
in dem subjektiven Begriff () intendiert
oder ergriffen. Andere sagen, sie hat Geltung. Nach Platon richtet sich
unsere Erkenntnis auf die Idee,
und die wirklichen Dinge existieren nur durch Teilhabe an der ewig und
unveränderlich existierenden Idee.
Seit der Logik
von Port-Royal wird ausdrücklich der Inhalt und der Umfang des Begriffes
() unterschieden. Jedoch sind beide Ausdrücke von verschiedenen Autoren
im Laufe der Zeit verschieden verstanden worden : versteht man als Inhalt
des Begriffes () alle diesem übergeordneten
Begriffe
() und als Umfang des
Begriffes
() alle diesem untergeordneten
Begriffe
(), dann läßt sich bei Beachtung einiger präzisierender
Randbedingungen das sog. Reziprozitätsgesetz vertreten: Vermehrung
des Inhaltes eines Begriffes ()
bewirkt Verminderung des Umfanges und umgekehrt. Versteht man aber unter
Umfang des Begriffes () die Anzahl
der Individuen, die unter den Begriff
() fallen, und unter Inhalt die Gesamtheit der Bestandteile, aus
denen der Begriff () besteht,
gilt das Reziprozitätsgesetz nicht. Bernard Bolzano hat darauf hingewiesen,
daß beim Inhalt des Begriffes
() auch die Konfiguration der Bestandteile relevant sei, da andernfalls
die beiden Begriffe () „gelehrter
Sohn eines ungelehrten Vaters“ und „ungelehrter Sohn eines gelehrten Vaters“
denselben Inhalt hätten. ... ..."
Begriffsbestimmung nach Dubislav [m]
"Zweites Kapitel
Die Begriffsbestimmung
()
Drei Auffassungen über die ,,Natur“ der Begriffe (), von vielen anderen zu schweigen, sind für uns von Interesse. Sie sind aber, um das vorweg zu bemerken, nicht immer in voller Reinheit vertreten worden, sondern werden häufig von seiten einzelner Autoren miteinander vermengt. Wir wollen sie die empiristische (die psychologistische), die idealistische (die Platon-Bolzanosche) und die formalistische (die nominalistische) nennen.
Der empiristischen Auffassung zufolge stellt sich ein Begriff () oder, wie man gelegentlich auch sagt, eine Allgemeinvorstellung [>114] oder eine abstrakte dar als eine Vorstellung besonderer Art, die zunächst negativ dadurch charakterisiert wird, daß man sie als eine von jeder Anschauung verschiedene Vorstellung hinsteüt. Dabei werden die Anschauungen zumeist als Wahrnehmungen bzw. als die Gedächtnisbilder von solchen bzw. als die Gedächtnisbilder von ehemals wahrgenommenen Objekten betrachtet. Von diesem Standpunkte aus versucht man fernerhin das Zustandekommen eines Begriffes () zu schildern, um dadurch den Begriff () als solchen näher charakterisieren zu können, nämlich als ein psychisches Gebilde, das auf die und die Weise aus der Bearbeitung von Anschauungen entsteht.
Die sozusagen landläufige Theorie der Begriffsentstehung bei Zugrundelegung dieses Standpunktes ist die sogenannte Abstraktionstheorie. Ihr zufolge soll es primär zur Bildung von Begriffen () kommen, wenn wir Abstraktionsprozesse vollziehen, d. h. an verschiedenen Objekten etwas ihnen gleichermaßen Eigentümliches herausheben bzw. an demselben Objekte zu verschiedenen Zeiten unter Absehung von denjenigen Beschaffenheiten, die ihnen nicht gemeinsam seien. So sei etwa der als Zahl „drei“ gekennzeichnete Begriff () nichts anderes als die Vorstellung, die resultiere, wenn man sich die allen Tripeln von Objekten gleichermaßen zukommenden Beschaffenheiten vereinigt denke. Es ist aber hervorzuheben, daß eine empiristische Auffassung von der Natur der Begriffe () nicht notwendig an die skizzierte Abstraktionstheorie gebunden ist, welche übrigens erweislich nicht zutrifft.
Gemäß der zweiten, der idealistischen Auffassung, die auf Platon zurückgeht, und von Bolzano und neuerdings z. B. von H. Lotze (wenn auch mehr gelegentlich) und von E. Husserl vertreten worden ist, bilden die Begriffe () keineswegs irgendwelche psychischen Gebilde besonderer Art. Sie sind vielmehr überhaupt nicht als wahrnehmbare Objekte anzusprechen. Sie sind kurz gesagt zwar existierende Gebilde, aber sie besitzen keine wirkliche Existenz, sondern lediglich, wie man gesagt hat, eine ideale. Im Sinne dieser Auffassung hat man z. B. den Begriff „Wahrheit" als eine Geltungseinheit im unzeitlichen Reiche der Ideen angesprochen, oder in etwas anderer Wendung, als eine Idee, deren Einzelfaü im evidenten Urteil aktuelles Erlebnis ist. In ähnlicher Weise hat man sich nun auch die anderen Begriffe () als unzeitliche Gebilde gewisser Art zu denken. Bolzano, der diese Auffassung mit außerordentlicher Schärfe verfochten hat, unterschied dem-[>115]entsprechend an Vorstellungen zwei Klassen: Die Vorstellungen an sich oder die „objektiven Vorstellungen“) wie er sic nannte, und die Vorstellungen im Sinne psychischer Gebilde, die von ihm sogenannten „subjektiven“ oder „gedachten Vorstellungen“. Diese Gebilde charakterisiert er u. a. folgendermaßen FN1):
Eine subjektive oder gedachte Vorstellung sei eine Erscheinung in unserem Gemüte, deren besondere Arten wir mit Sehen, Hören usw. bezeichnen, sofern es nur keine Urteile sind. Jede derartige subjektive Vorstellung setze ein lebendiges Wesen als das Subjekt voraus, in welchem sie vorgehe. Im Unterschiede nun zu diesen subjektiven Vorstellungen, die ihm also, um das nochmals hervorzuheben, als etwas Wirkliches, in der Zeit Seiendes, Wirkungen Habendes gelten, behauptet Bolzano, daß es zu jeder derartigen Vorstellung eine objektive oder Vorstellung an sich gebe, die ein nicht in der Wirklichkeit zu suchendes Etwas sei, das den nächsten und unmittelbaren Stoff der subjektiven Vorstellung ausmache und nicht wie diese eines Subjektes bedürfe, von dem sie vorgestellt werde. Des weiteren charakterisiert er die objektive Vorstellung als ein Etwas, das zwar nicht ein Seiendes sei, aber doch als ein gewisses Etwas existiere, auch wenn kein einziges denkendes Wesen sie auffassen sollte. Sie wird dadurch, daß mehrere Wesen sie denken, nicht vervielfacht, wie eine ihr zugehörige subjektive Vorstellung, die dann mehrfach vorhanden ist. Er warnt schließlich noch davor, sie mit dem Gegenstande oder den Gegenständen zu verwechseln, auf den oder auf die sie sich gegebenenfalls bezieht, noch mit dem Zeichen, daß man ihr gegebenenfalls zuordnet.
Innerhalb der Klasse dieser objektiven Vorstellungen unterscheidet dann Bolzano Anschauungen und Begriffe () in der Weise, wie wir das bei der Behandlung der Aristotelischen Definitionslehre ausgeführt haben. Dieselbe Einteilung überträgt er auf die subjektiven Vorstellungen, indem er eine subjektive Vorstellung, eine Anschauung bzw. einen Begriff () nennt, je nach dem die mit ihr gekoppelte Vorstellung an sich eine Anschauung an sich bzw. ein Begriff () an sich ist.
Wir kommen zur dritten und letzten Auffassung von dem, was ein Begriff () ist, zu der von uns sogenannten formalistischen, die wir vertreten. Darnach sind Begriffe () im Sinne der Logik [>116] lediglich Zeichen besonderer Art. Und zwar Zeichen in Gestalt von Aussage- oder, wio man sie auch genannt hat, Satzfunktionen einer Variablen. Unter einer derartigen Aussagefunktion — wir kamen auf diese Dinge schon bei Gelegenheit der Peanoschcn Unterscheidung von eigentlichen und scheinbaren Variablen zu sprechen — versteht man, um es zunächst anschaulich zu sagen, eine Gießform für Aussagen1), d. h. ein Gebilde, welches nach bestimmten Anweisungen behandelt, und zwar ausgefüllt, eine Aussage liefert. Genauer: Eine Aussagefunktion einer Variablen resultiert, wenn man sich innerhalb einer Aussage ein Zeichen durch eine Variable im früher angegebenen Sinne des Wortes ersetzt denkt. Und zwar derart ersetzt denkt, daß man als Variabilitätsbereich (als Wertbereich) für die betreffende Variable die Klasse aller derjenigen Zeichen wählt, von denen jedes, anstelle der Variablen in den betreffenden Aussagetorso gesetzt, eine Aussage liefert.
So erhalten wir z. B. aus der Aussage: ,,Siebzehn ist eine Zahl, die genau zwei Teiler hat“, wenn wir „Siebzehn“ durch eine Variable ersetzen, den Ausdruck: „x ist eine Zahl, die genau zwei Teiler hat“, wobei wir für die Variable x auch ein nichts umschließendes Klammerpaar, eine sogenannte Leerstelle, setzen könnten. Wählen wir hierbei als Wertbereich der Variablen die Klasse der natürlichen Zahlen, so repräsentiert diese Aussagefunktion den Begriff () „Primzahl“, wohl zu unterscheiden von den unter ihn fallenden Objekten, den Primzahlen, die man üblicherweise nur durch eine Gebrauchsdefinition definiert und die gemäß der Hierarchie der Typen von niederem Typus als der Begriff () „Primzahl“ sind.
Man sagt nun von einem Zeichen, das an Stelle einer Variablen einer Aussagefunktion (von einer Variablen) gesetzt, eine wahre Aussage hervorbringt, es befriedigt die Satzfunktion bzw. es fällt unter den Begriff (), den die betreffende Satzfunktion der formalistischen Auffassung zufolge ausmacht; anderenfalls es befriedigt die betreffende Aussagefunktion nicht bzw. es fällt nicht unter den betreffenden Begriff (). Man pflegt des weiteren die Klasse derjenigen Bestandteile, aus denen eine Aussagefunktion im Rahmen eines als bekannt geltenden Systems von Grundvoraussetzungen einer Theorie gebildet ist, ihren Inhalt zu nennen. Entsprechend bezeichnet man die Klasse der eine Aussagefunktion befriedigenden Gebilde als ihren Umfang oder ihre Extension oder ihren Wertverlauf. [>117]
§ 59, Diese in der Hauptsache auf G. Frege zurückgehenden Bemerkungen bedürfen aber noch einer nicht unwichtigen Ergänzung. Wir haben nämlich bei obiger Erläuterung mit dem Terminus Aussage operiert, ohne denselben näher zu fixieren und ohne Kriterien anzugeben, die uns instand setzen, sinnlose Sätze, d. h. Sätze von der Art: „Der Bruch 3/4 ist keine Primzahl“, von wahren bzw, falschen Sätzen, den sogenannten sinnvollen Sätzen oder Aussagen, zu unterscheiden. ... ... "
Begriff nach dem Woerterbuch der Logik [m]
"Begriff (): I. komplexe Gesamtheit von Gedanken über Unterscheidungsmerkmale eines untersuchten Objekts, die in Urteilen ausgesprochen werden und im Kern die allgemeinsten und gleichzeitig wesentlichen Merkmale des Objekts angeben sollen (s. a. Begriffsbestimmung (); Begriffsinhalt (); Begriffsumfang (), Einteilung; Logik, traditionelle, IV.4.; logische Form I.; Wahrheit II.). ... "
Anmerkung: Der Wörterbucheintrag enthält mehrere Fehler, z.B. ist die zitierte Ansichts Engels - "Definitionen sind für die Wissenschaft wertlos, weil stets unzulänglich" - völliger Uninn, aber auch die unter IV. geäußerte Ansicht ist mehrfach falsch /fett-kursiv markiert):
"IV, [1] Der B. () hängt untrennbar mit seiner materiellen sprachlichen Hülle zusammen. [2] Die Realität eines jeden B.s () äußert sich in der Sprache. [3] Der B. () entsteht auf der Grundlage von Wörtern und kann nicht außerhalb der Wörter existieren. [4] Das Wort ist der Träger des B.s. () Ein Wort, das einen genau definierten B. aus einem Gebiet in Wissenschaft und Technik bezeichnet, heißt Terminus. [1] Obwohl der B. () untrennbar mit dem Wort verbunden ist, ist er mit dem Wort nicht identisch. Das ist schon aus der Tatsache ersichtlich, daß in verschiedenen Sprachen ein und dieselben B.e () in verschiedenen Wörtern registriert und fixiert werden."
Marxistische Wissenschaftstheorie: Der Begriffsaufbau in der Wissenschaft (S. 173-199) [m]
Autorenkollektiv (1968) Die Wissenschaft von der Wissenschaft. Leipzig: Dietz.
Autorenkollektiv Institut für Philosophie Karl-Marx-Universität Leipzig: Karel Berka, Siegfried. Bönisch (wiss. Sekretär), Frank Fiedler, Siegfried Gitter, Alfred Kosing (Leiter), Horst Kramer, Senate Kramer, Lothar Kreiser, Werner Müller, Reinhard Mocek, Klaus-Peter Noack, Rudolf Rochhausen, Helmut Seidel, Harald Schliwa, Karl-Heinz Schwabe, Gerhard Terton, Eberhard Thomas, Dieter Weigert
Die ausführliche und interessante Arbeit mit gut 26 Seiten zum Der Begriffsaufbau in der Wissenschaft ist wie folgt gegliedert:
- Begriff und Begriffssystem 173
Präzisierung von Begriffen 180
Probleme der Begriffsbildung in deduktiven und hypothetisch-deduktiven Systemen 189
Im folgenden einige Ausschnitte:
"2. Der Begriffsaufbau in der Wissenschaft
Begriff: und Begriffssystem
Der begriffliche Aufbau der Wissenschaften, der im engen Zusammenhang
mit ihrem deduktiven und induktiv-deduktiven System steht, ist eine sehr
umstrittene Problematik der heutigen Wissenschaftstheorie. Das ist wesentlich
durch zwei Ursachen bedingt. Einmal gehen in die Begriffsbildung
() als eine gesellschaftlich bedingte Tätigkeit eine ganze Reihe unterschiedlicher
Komponenten ein, wie logische, sprachliche, methodologische, psychologische,
erkenntnistheoretische
usw. Andererseits ist sie eng mit der historischen Entwicklung und systematischen
Fassung der betreffenden wissenschaftlichen Disziplinen verbunden. Infolge
dieser Komplexität und Kompliziertheit der mit dem Begriff
() verbundenen Probleme ist es auch bis heute noch nicht gelungen, eine
befriedigende Definition des Begriffes „Begriff"
() zu geben. Der von uns behandelte Aspekt der Begriffsbildung
() erfordert eine Abgrenzung von psychologischen und erkenntnistheoretischen
Untersuchungen. Selbstverständlich werden erkenntnistheoretische Aussagen
benutzt, aber eben nur in dem Sinne benutzt, wie auf diese die Wissenschaftstheorie
insgesamt angewiesen ist.
Wir betrachten zunächst das Verhältnis
von Begriff () und Name bzw. Wort
und geben daran anschließend die diesen Untersuchungen zugrunde gelegte
Definition des Begriffes „Begriff“ ().
Für die Bestimmung des Verhältnisses zwischen
Begriff
() und Namen haben wir allgemein ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten
mit zwei Extremfällen zur Verfügung. Eine Identifizierung des
Begriffes
() mit der sprachlichen Gestalt (Namen) einerseits, was einen sehr primitiven
Nominalismus darstellt, und eine Trennung beider als [>174] selbständige
Existenzen andererseits, was einen extremen Platonismus darstellt.
Um diese beiden Konzeptionen, die für die marxistische Philosophie
unannehmbar sind, zu vermeiden, gehen wir von folgender Auffassung aus.
Da es verschiedene Sprachen gibt, können wir offensichtlich nicht
von einer ihrer konkreten Formen ausgehen. Die objektive Realität
ist für alle Menschen die gleiche - wenn wir von der Entwicklungsstufe
der gesellschaftlichen Lebensbedfngungen absehen, unter der sie für
eine relativ abgeschlossene Gemeinschaft erscheint -, die entsprechenden
Abbilder werden aber in den verschiedenen Sprachen durch unterschiedliche
sprachliche Zeichen fixiert. Das sprachliche Zeichen ist die Existenzform
der Abbilder. Die sprachlichen Zeichen unterscheiden sich von beliebigen
anderen Objekten der Realität dadurch, daß sie etwas ausdrücken
und etwas bezeichnen. Dergestalt hat man auch die Möglichkeit, das
Verhältnis von Sprache und Denken richtig zu fassen. Wir unterscheiden
zwei semantische Grundkategorien: Name und Aussage.
Da wir es im folgenden mit der Analyse des Begriffes
() zu tun haben, werden wir uns nur auf den Namen beschränken.
Dem Namen entspricht in der Umgangssprache ein Wort oder eine Gruppe von
Wörtern, aber nicht umgekehrt entspricht jedem Wort bzw. jeder Wortgruppe
ein Name.
Entsprechend seinen zwei Funktionen hat jeder Name
Sinn und Bedeutung. Sein Sinn ist der Begriff
(), seine Bedeutung das Objekt, das er bezeichnet. Den Sinn kann man als
seine Intension und die Bedeutung als seine Extension auffassen. Diese
Festlegung können wir auch auf andere Weise formulieren. Der Sinn
des Namens ist mit dem Begriffsinhalt
() und seine Bedeutung mit dem Begriffsumfang
() gleichgesetzt.25 Damit ist nicht [>175] ‘gesagt, daß man in verschiedenen
Untersuchungen einmal den Begriffsinhalt
(), ein anderes Mal den Sinn eines Namens erörtert bzw. einmal den
Begriffsumfang
(), ein anderes Mal die Bedeutung eines Namens. Das hängt auch mit
der Tatsache zusammen, daß man die Problematik der Begriffsbildung
() von verschiedenen Aspekten her untersuchen kann. In keinem Falle wird
durch unsere Auffassung der Begriff
() - weder seinem Inhalt noch Umfang nach - mit der sprachlichen
Gestalt der Namen (als konkretes Zeichen oder als abstraktes Zeichen aufgefaßt)
identifiziert.
Bei der Bestimmung eines Begriffes
() muß stets seine Stellung im System beachtet werden. Man
muß das Begriffsnetz () betrachten, in das dieser Begriff „eingeflochten"
ist. Der Name als sprachliche Gestalt kann in verschiedenen Kontexten vorkommen
und dabei unterschiedlichen Sinn haben. Das hängt mit der Funktion
der Sprache zusammen, mit dem abstrakten Charakter der sprachlichen Zeichen.
So hat z. B. der Name „Arm" in verschiedenen Zusammenhängen einen
unterschiedlichen Sinn. Daraus kann man nicht auf die Mehrdeutigkeit des
Begriffs
() schließen, den dieser Name z. B. in der Physik und in der Biologie
zum Ausdruck bringt. Hier geht es um Systeme mit inhaltlich unterschiedenem
Begriffsnetz
(). Dabei darf man sich nicht irreführen lassen, daß in unterschiedlichen
Systemen ein Name derselben sprachlichen Gestalt vorkommt. Das ist durch
die Tatsache bedingt, daß sich das Erkennen in erster Linie in der
differenzierten
Begriffsbildung () und
erst von hierher nachfolgend auf die entsprechenden sprachlichen Mittel
bezieht. Die Umgangssprache, derer man sich in der Wissenschaft als Metasprache
bedient, hat universellen Charakter in einer bestimmten Sprachgemeinschaft,
aber die Begriffsbildung () ist stets
auf ein bestimmtes, einen gegebenen Gegenstandsbereich abbildendes System
bezogen. Es wäre für die Umgangssprache eine zu große Belastung,
wenn man eine eindeutige Zuordnung zwischen jedem Begriff
() und seiner sprachlichen Form fordern würde. Man müßte
die Ausdrucksmittel der Umgangssprache bei jeder Vertiefung, Erweiterung,
Begrenzung unseres Wissens ändern und würde nicht die potentielle
Fähigkeit der Sprache ausnutzen, die materielle Existenzform der Begriffs
() [>176] bildung zu sein. Diese Tatsache wird besonders mißverstanden,
wenn man die Begriffe () verschiedener,
aber doch in gewisser Hinsicht ähnlicher Begriffssysteme
() beurteilt. Der Name „Raum" bezeichnet in der euklidischen und in der
nichteuklidischen Geometrie verschiedene Begriffe
(), und in der alltäglichen Praxis hat er noch einen anderen Sinn.
Auch der Name „Atom" hat im philosophischen System des Demokrit einen anderen
Sinn als im System der modernen Kernphysik. Kann man in beiden Fällen
den Versuch machen, diese Unterschiede durch eine breitere Auffassung zu
überbrücken, in der ein Begriff festgelegt wird, der die verschiedenen
Begriffw
() einschließt, die durch einen Namen derselben Gestalt ausgedrückt
sind? Grundsätzlich ist das nur dann möglich, wenn dieser Begriff
() in einem System vorkommt, der die anderen Systeme derart einschließt,
daß sie durch jeweilige Aufnahme von Zusatzbedingungen aus ihm hervorgehen.
So kann man im ersten Falle im System der sogenannten absoluten Geometrie
einen komplexen Begriff () des Raumes
festlegen, der durch weitere Spezifizierung dann jeweils in den der euklidischen
bzw. nichteuklidischen Geometrie übergeht. Im zweiten Falle ist das
wohl nicht möglich. Wir haben kein System zur Verfügung, welches
das philosophische System von Demokrit und das System der modernen Kernphysik
in sich einschließt. Ein weiteres Beispiel: Unter „Operation" versteht
ein Chirurg etwas ganz anderes als ein Soldat oder ein Mathematiker. Können
wir nun einen allumfassenden Begriff
() der Operation bilden, der dann innerhalb eines bestimmten Systems anzuwenden
wäre? Es müßte sich hier offensichtlich um eine Art intersystemare
Auffassung handeln. Eine Begriffsbildung
() ohne Bezug auf ein bestimmtes Begriffsnetz
() halten wir für fehlerhaft. Eine solche Konzeption widerspricht
der Systemauffassung der Widerspiegelungstheorie, die sich selbstverständlich
auch auf die Begriffsbildung () bezieht,
gleichgültig, ob sie in einem axiomatischen oder in einem nichtaxiomatischen
System vollzogen wird. Und so ist auch ein wissenschaftlicher Meinungsstreit
nur sinnvoll bezüglich eines möglichst exakt angegebenen Begriffssystems
(). Für jeden dieser unterschiedlichen Begriffe
() einen neuen Namen zu suchen, würde die Flexibilität der Umgangssprache
stark beeinträchtigen. Im folgenden wird oft statt von Begriffsnetz
() von einem Begriffssystem () gesprochen."
...
S. 182 Definition: "... Die Definition eines Begriffes
(), der stets ein Element der Begriffsnetze
() eines wissenschaftlichen Systems ist, muß in Beziehung zu Definitionen
anderer Begriffe () in diesem System
stehen. Nur so kann der definierte Begriff
() klar von den anderen abgegrenzt und in bezug auf die Bedürfnisse,
die Aufgaben und die Forschungsaufgaben erläutert werden. Aus diesen
Gründen wollen wir von relevanten und nichtrelevanten Merkmalen sprechen,
wobei die Relevanz bzw. Nichtrelevanz relativ zum ganzen wissenschaftlichen
System ist."
Die Logik von Port Royal 1662
Aus S. 46ff: Arnauld, Antoine & Nicole, Pierre (dt. 1972, fr 1662f). Die Logik oder Kunst des Denkens
"Idee" kann in diesem Text auch als Begriff gelesen werden, wie der Sachregistereintrag "Begriff > Idee" unterstreicht, und ist nicht im Sinne Platons gemeint. Die neue Übersetzung des Textes von 1662 liest sich erstaunlich klar, flüssig und modern.
"Kapitel VI
Über die Ideen () hinsichtlich ihrer Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit
Obgleich alle existierenden
Dinge einzelne sind, haben alle Menschen mittels der Abstraktionen, die
eben erklärt wurden, verschiedene Arten von Ideen
(). Die einen nämlich stellen uns nur ein einziges
Ding dar, wie die Idee (),
die jeder von sich selbst hat, und die anderen Ideen
() stellen, und zwar in gleicher Weise, mehrere Dinge
dar, wie jemand ein Dreieck sich vorstellt, ohne dabei auf etwas anderes
zu achten als darauf, daß es eine Figur mit drei Linien und drei
Winkeln ist; dann kann ihm die Idee, die er sich davon gebildet hat, dazu
dienen, alle anderen Dreiecke sich vorzustellen. [>47]
Die Ideen
(), die nur ein einziges Ding repräsentieren,
heißen einzelne oder individuelle, und das, was sie darstellen, Individuen;
die Ideen (),
die mehrere Dinge repräsentieren, heißen universelle, gemeinsame
oder allgemeine.
Die Namen, die zur Bezeichnung
der ersten Ideen ()
dienen, heißen Eigennamen: Sokrates, Rom, Bukephalos. Und diejenigen,
welche zur Bezeichnung der letzteren dienen, heißen gemeinsame Namen
oder Appellativa, wie „Mensch“, „Stadt“, „Pferd“. Und sowohl die universellen
Ideen als auch die gemeinsamen Namen können allgemeine Worte genannt
werden. Es ist aber noch anzumerken, daß die Wörter auf zwei
Arten allgemein sind: die eine nennt man eindeutig, wenn nämlich die
Wörter mit den allgemeinen Ideen
() verbunden sind, so daß dasselbe Wort mehreren
Dingen zukommt, sowohl nach dem Laut als auch nach einer gleichen Idee
(), die mit jenem Wort in Verbindung gebracht wird:
solche sind die Wörter, von denen eben gesprochen wurde, wie Mensch,
Stadt, Pferd.
Die andere nennt man mehrdeutig,
und zwar, wenn der gleiche Laut von den Menschen mit verschiedenen Ideen
() verbunden wurde, so daß der gleiche Laut
mehreren Dingen zukommt, nicht jedoch auf Grund einer und derselben Idee
(), sondern auf Grund von verschiedenen Ideen, mit
denen er im Gebrauch in Verbindung gebracht worden ist: so bedeutet das
Wort „canon“ im Französischen eine Kriegsmaschine, ein Konzildekret
und eine Art Maß; aber es bezeichnet sie nur auf Grund von ganz verschiedenen
Ideen
().
Diese mehrdeutige Universalität
hat jedoch zwei Unterarten. Denn die verschiedenen, mit einem und demselben
Laut verbundenen Ideen haben entweder keine natürliche Beziehung zueinander,
wie bei dem Wort „kanon“, oder sie haben eine, wie wenn man ein hauptsächlich
mit einer Idee ()
verbundenes Wort mit einer anderen Idee
() nur verbindet, weil diese in einer Beziehung der
Ursache oder der Wirkung oder des Zeichens oder der Ähnlichkeit zu
der ersten steht; und dann heißen diese Arten mehrdeutiger Worte
analoge; wie wenn das Wort gesund sowohl dem Tier als auch der Luft und
dem Fleisch zugesprochen wird. Denn die mit diesem Wort verbundene Idee
() ist hauptsächlich die Gesundheit, die nur
dem Lebewesen zukommt, aber man verbindet mit dem Wort eine andere dieser
nahestehende Idee (),
nämlich Ursache der Gesundheit zu sein, und diese läßt
uns sagen, daß die Luft gesund ist, daß ein Fleisch gesund
ist, denn sie dienen dazu, die Gesundheit zu bewahren.
Wenn wir aber hier von allgemeinen
Wörtern sprechen, so ver-[>48]stehen wir die eindeutigen darunter,
die mit universellen und allgemeinen Ideen
() verbunden sind.
Nun gibt es in diesen universellen
Ideen
() zwei Dinge, deren Unterscheidung sehr wichtig
ist, nämlich den Inhalt und den Umfang. Ich nenne Inhalt der Idee
() die Attribute, die die Idee in sich schließt,
und die man von ihr nicht entfernen kann, ohne die Idee
() zu zerstören, so wie der Inhalt der Idee
() des Dreiecks Ausdehnung, Gestalt, drei Linien,
drei Winkel und die Gleichheit dieser drei Winkel mit zwei rechten usw.
in sich schließt.
Ich nenne Umfang der Idee
die Subjekte, denen diese Idee
() zukommt, die man auch die einem allgemeinen Wort
Untergeordneten nennt, wobei dieses im Hinblick auf sie das übergeordnete
heißt, wie sich die Idee des Dreiecks überhaupt auf alle verschiedenen
Arten von Dreiecken erstreckt.
Obgleich sich allerdings die
allgemeine Idee ()
unterschiedslos auf alle Subjekte, denen sie angemessen ist, das heißt
auf alle ihr untergeordneten Falle, die alle der gemeinsame Name bezeichnet,
erstrecht, gibt es gleichwohl folgenden Unterschied zwischen den Attributen,
die sie in sich einschließt, und den Subjekten, die sie umgreift:
man kann keines ihrer Attribute aus ihr wegnehmen, ohne sie zu zerstören,
wie wir gerade gesagt haben, wahrend man sie im Hinblick auf ihren Umfang
verengen kann, indem man sie nur auf irgendeines der Subjekte, denen sie
zukommt, anwendet. Diese Verengung oder Einschränkung der allgemeinen
Idee
() hinsichtlich ihres Umfangs kann nun in einer zweifachen
Art und Weise geschehen.
Erstens dadurch, daß
man eine andere, getrennte und bestimmte Idee
() mit ihr verbindet, wie wenn ich der allgemeinen
Idee
des Dreiecks die vom Haben eines rechten Winkels hinzufüge: das schränkt
diese Idee ()
auf eine einzige Dreiecksart, nämlich die des rechtwinkligen Dreiecks,
ein.
Zweitens kann ich mit ihr
lediglich eine unselbständige und unbestimmte Idee
() vom Teil verbinden, wie wenn ich sage, irgendein
Dreieck: in diesem Fall sagt man, daß der allgemeine Ausdruck zu
einem besonderen wird, weil er sich jetzt nur auf einen Teil der Subjekte,
die er zuvor umfing, erstreckt, ohne daß man trotzdem bestimmt hätte,
welcher dieser Teil ist, auf den man ihn jetzt eingeschränkt hat."
- Kommentar:
Begriff nach Bolzanos Wissenschaftslehre (1837)
Bolzano verwendet eine sehr eigene Terminologie, die den Zugang zu seiner vierbändigen Wissenschaftslehre (Schultz Ausgabe, Neudruck der 2. Auflage 1929; B1. 577, Bd. 2. 570, Bd. 3. 578, Bd. 4. 717, also 2442 Seiten) erschwert. Sein Grundbegriff ist "Vorstellung", aber nicht im psychologischen Sinne. In Bd.1, § 48, S. 216 schreibt Bolzano:
- "... eine Vorstellung, auch eine subjective Vorstellung von mir
heißt ...., dass ich sage, es sey mir alles dasjenige, was als Bestandtheil
in einem Satz vorkommen kann, für sich allein aber noch keinen Satz
ausmacht."
Das Sachregister (im 4. Bd.) weist unter "Begriff"
folgende Einträge auf (die Zahlen bedeuten Paragraphen, nicht Seiten):

Das Sachregister weist unter "Vorstellung(en)"
folgende Einträge auf (die Zahlen bedeuten Paragraphen, nicht Seiten)::

War Bolzano
Platonist?
Zur Beantwortung dieser Frage, können wir
einerseits nach Stellen suchen, in den denen Bolzano Plato, Platoniker,
Platonisten bespricht, andererseits Bolzanos Begriffslehre hinsichtlich
Universalienstatus befragen. Die folgende Textstelle in Bd. 3, § 287,
S. 98 spricht m.E. nicht dafür:

Zu den 5 Universalien der Alten äußerz sich Bolzano im § 117, Bd. 1. S. 545-556.
Platon wird im Namensregister wie folgt erwähnt (hier bedeuten
die Zahlen Seitenzahlen und nicht Pararaphen):
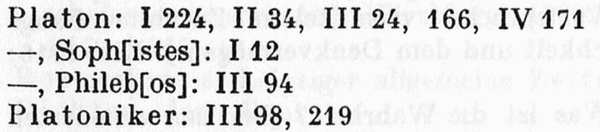
- Kommentar:
Aus Eisler:
BOLZANO. Nach ihm ist ein Satz »jede... Rede, wenn durch sie
irgend etwas ausgesagt oder behauptet wird« (Wissensch. I, §
19, 63. 76). »Satz an sich« ist der Sinn des Satzes, er ist
dasjenige, was man sich unter dem Worte Satz notwendig vorstellen muß.
Er ist »eine Aussage, daß etwas ist oder nicht ist. gleichviel
ob diese Aussage wahr oder falsch ist, ob sie von irgend jemand in Worte
gefußt oder nicht gefußt, ja auch im Geiste nur gedacht oder
nicht gedacht worden ist« (l. c. S. 77). Der Satz an sich hat keine
(raum-zeitliche) Existenz. »Ein Dasein kommt nur gedachten, ingleichen
für wahr gehaltenen Sätzen, d.h. Urteilen zu, nicht aber den
Sätzen an sich, welche der Stoff sind, den ein denkendes Wesen in
seinen Gedanken und Urteilen auffaßt« (l. c. § 122 ff.,
B. 4). Von den Anschauungssätzen sind die Begriffssätze zu unterscheiden
(l. c. § 133, S. 33 ff.. vgl. CRUSIUS, Weg zur Gewißheit, §
222, 231).
Anmerkung InbegriffTbegIn
bei Bolzano
Krickel, Frank (1995) Teil und Inbegriff. Bernard Bolzanos Mereologie.
St. Augustin: Academia. S. 70:
"... Die durch “Inbegriff”TbegIn
ausgedrückte Vorstellung an sich wäre somit ein Konkretum zu
dem Abstraktum <Zusammengesetztheit>. Synonym zu “Inbegriff’ sind
demnach die Ausdrücke “zusammengesetzter Gegenstand” oder “Zusammengesetztes”.
(Gl) für alle x: x ist ein InbegriffTbegIn
gdw. x ist zusammengesetzt.
Die Unterscheidung zwischen zusammengesetzten und einfachen Gegenständen
ist zunächst einmal Gegenstand der Ontologie, so daß wir es
mit dem Wort “Inbegriff’TbegIn
bei Bolzano dem ersten Anschein nach mit einem ontologischen Ausdruck zu
tun haben. Daß wir diesen Begriff aber vor allem im Rahmen der Logik
betrachten, rechtfertigt sich u.a. aus einem spezifischen sprachphilosophisch-logischen
Zugang zu den InbegriffenTbegIn,
der in Kapitel III dargestellt werden soll.
Neben dieser Erklärung gibt Bolzano auch einige Umschreibungen
des in Frage stehenden Begriffes. Gleichbedeutend mit dem Ausdruck “ein
InbegriffTbegIn
gewisser Dinge” sind z.B. “eine Verbindung oder Vereinigung dieser Dinge”,
“ein Zusammenseyn gewisser Dinge”, “ein Zusammen, in welchem gewisse Dinge
als Theile erscheinen”, “ein Ganzes, in welchem sie als Theile vorkommen”
oder “ein aus gewissen Theilen bestehendes Ganzes”. Außerdem
betont Bolzano, daß in sprachlichen Ausdrücken, in denen das
Bindewort “und” verwendet wird, stets von Inbegriffen die Rede ist.
Ein InbegriffTbegIn
ist ein zusammengesetzter Gegenstand, und das, woraus er zusammengesetzt
ist, woraus er besteht, sind seine Teile. Diese Teile bilden miteinander
ein “Ganzes”, ein “Zusammen” oder eine “Vereinigung”. Die Begriffe “Zusammengesetztheit”
und “Teil” stehen im Mittelpunkt dieser Erklärungsversuche. ..."
Fogarasi Begriff und dialektische Logik [s]
Aus, S.112-115, Fogarasi, Bela (1953) Dialektische Logik. - mit einer Darstellung erkenntnistheoretischer Begriffe. Berlin: Aufbau. (auch Rotdruck 1971)
"Viertes Kapitel
DER Begriff ()
Der Begriff () ist die Grundeinheit
der Struktur des menschlichen Denkens. Nur der Mensch bildet Begriffe
(BMannar), (BMfragl).
Primitive Elemente, Keime des Denkens finden sich auch bei höher entwickelten
Tieren, aber zum kontinuierlichen, zusammenhängenden Denken sind die
Tiere nicht fähig, denn sie vermögen keine Begriffe
zu bilden (BMfragl), (BMBTier),
(BMBTAffen), (BMBTfisch),
(BMBTSaeug), (BMBTVoeg).
Der Begriff (BMerkM)
ist das höchste Mittel zur Erkenntnis der Wirklichkeit. Der richtige
Gebrauch der Begriffe (BMBGebr)
ermöglicht die Fixierung, Erweiterung, Verallgemeinerung, Vertiefung
unserer durch Reflexe, Empfindungen, Vorstellungen gewonnenen Erkenntnisse.
Das Verhältnis des Begriffs zur Wirklichkeit
(BMontS) ist eine alte Zentralfrage
der Philosophie. In der Theorie des Begriffs
(BMTheoSys) kommt der
Kampf zwischen Materialismus und Idealismus, sowie auch der grundlegende
Unterschied zwischen dem metaphysischen und dialektischen Standpunkt zum
Ausdruck. Auf die geschichtliche Entwicklung der Auffassung des Begriffs
() gehen wir im Rahmen dieser Arbeit nicht ausführlich ein. In Verbindung
mit der Theorie des Begriffs () sollen
jedoch Hinweise auf geschichtliche Zusammenhänge gegeben werden.
Die Klassiker des Marxismus messen dem Begriff
() als einer mächtigen Waffe des wissenschaftlichen Erkennens große
Bedeutung bei; sie geben grundlegende Gesichtspunkte zur dialektisch-materialistischen
Wertung des Begriffs, zur Kritik der Mängel der formalen Logik. Die
Theorie des Begriffs () wurde jedoch
in systematischer Form bisher nur von der traditionellen Logik, der formalen
Schullogik bearbeitet. Die formale Logik systematisiert auf Grund beschreibender,
klassifizierender Gesichtspunkte unsere Erkenntnisse über den Begriff
().
Wir werden im Folgenden die Lehren der formalen
Logik über den Begriff () darstellen.
Wir können jedoch nicht dabei stehenbleiben. Mit Hilfe der materialistischen
Erkenntnistheorie und der Dialektik müssen wir für die wissenschaftliche
Theorie des Begriffs () eine Grundlage
schaffen. Ein Mangel der traditionellen Logik besteht darin, daß
ihr Beispielmaterial beinahe ausschließlich dem Gebiete der Natugeschichte,
der beschreibenden Naturwissenschaften und der elementaren Mathematik entnommen
ist. Die zeitgemäße Behandlung der Fragen der Logik erfordert
eine wesentliche [>113] Ausdehnung des Stoffes. Wir müssen die neuen
Ergebnisse der Naturwissenschaften berücksichtigen. Wir müssen
die großen Leistungen des Marxismus-Leninismus auf dem Gebiete der
Ausarbeitung und Analyse der gesellschaftlichenBegriffs
() für die Logik verwerten.
Die materialistische Auffassung stellt hinsichtlich
des Begriffs () zwei Grundsätze
auf. Der erste wendet den allgemeinen Satz des Materialismus vom Primat
des Seins auf den Begriff () an. Dieser
Satz lautet in Lenins äußerst präziser, exakter Formulierung:
„Die Begriffs () sind das höchste
Produkt des Gehirns, des höchsten Produktes der Materie.“1
Der andere Satz wendet den erkenntnistheoretischen Grundsatz des Materialismus,
den Satz von der Widerspiegelung auf den Begriff
() an. Wiederum in Lenins Formulierung: „...die Form der Widerspiegelung
der Natur in der menschlichen Erkenntnis, und diese Form sind auch die
Begriffs
(), die Gesetze, die Kategorien, etc.“2 Diese Sätze stellen
wir hier nur als Richtlinien auf, ihre ausführliche Darlegung erfolgt
später.
In der idealistischen Auffassung ist der Begriff
() von der Materie unabhängig. Der Idealismus geht auch in der Frage
des Begriffs () vom Primat des Denkens
aus. Hierin stimmen der objektive und der subjektive Idealismus miteinander
überein. Die Vertreter des subjektiven Idealismus halten den Begriff
() für eine „freie“ Schöpfung des Subjekts, d. h. des Bewußtseins,
für ein von der Wirklichkeit unabhängiges Produkt. Sie leugnen
die Widerspiegelung der Wirklichkeit durch den Begriff
(). Der objektive Idealismus (so auch Hegel) hält den Begriff
() nicht für ein Produkt des subjektiven Bewußtseins, aber auch
nicht für das höchste Produkt der Materie, sondern für die
höchste Form der von der Materie unabhängigen, ihr vorausgehenden
geistigen Wirklichkeit.
Was verstehen wir unter Begriff? Welches sind die
Kennzeichen des Begriffs ()? Was ist
der Begriff ()? Fassen wir die in der
Literatur der Logik vorkommenden Definitionen des Begriffs
() ins Auge und prüfen wir, welche von ihnen annehmbar wäre.
- a) „Der Begriff () ist das Eine
in dem Vielen.“ (Platon.)
b) „Der Begriff () ist im Gegensatz zur Anschauung eine allgemeine [>114] Vorstellung oder die Vorstellung dessen, was mehreren Gegenständen gemein ist, also eine Vorstellung, insofern sie in verschiedenen Gegenständen enthalten ist.“ (Kant.)
c) „Der Begriff () ist eine Vorstellung, welche die Gesamtheit der wesentlichen Merkmale des entsprechenden Gegenstandes (der entsprechenden Gegenstände) enthält.“ (Überweg.)
d) „Der Begriff () ist eine Vorstellung von bestimmter, eindeutiger, beständiger, gemeinsam festgestellter Bedeutung.“ (Sigwart. Ähnlich Höfler.)
e) „Der Begriff () ist eine Satzfunktion.“ (Frege und Russell.)
f) „Der Begriff () ist die Bedeutung eines Wortes“ (Lipps), „die fixierte Bedeutung eines Wortes.“ (Külpe.)
g) „Der Begriff () ist eine Vorstellung an sich.“ (Bolzano.)
Diese Definitionen heben teilweise einzelne Merkmale,
Kennzeichen des Begriffs () hervor;
aber einerseits sind sie unvollständig, andererseits von verschiedenen
Gesichtspunkten aus unrichtig. Platons Definition entspricht seiner metaphysischen
Auffassung, wonach der Begriff () als
Idee in irgendeiner Weise ontologisch, seiend ist, ihm eigene Existenz
zukommt. Die andere extreme, unrichtige Ansicht ist der reine Nominalismus,
wonach der Begriff () nur die Bedeutung
eines Wortes hat. Wie wir aus den Zitaten ersehen, war die angebliche Entdeckung
der „Semantiker“ in der Literatur schon längst bekannt. Die Auffassung
beruht auf der Verwechslung des Begriffa
() mit seinem sprachlichen Ausdruck, dem Wort, und bedeutet die Leugnung
des Begriffs (). Was die übrigen
angeführten Definitionen betrifft, so besteht ihr gemeinsamer Fehler
darin, daß sie den Begriff ()
als Vorstellung bestimmen. Auch die Vorstellung ist ein Produkt des Gehirns,
aber nicht dessen höchstes. Die Vorstellungen sind Produkte von niedrigeren
Gehirntätigkeiten als die Begriffe
(). Nach der dialektischen Entwicklungstheorie besagt ein Grundsatz der
richtigen wissenschaftlichen Erklärung, daß nicht von den niedrigeren
Erscheinungen aus die höheren, sondern von den höheren aus die
niedrigeren erklärt werden. Aus der Anatomie des Menschen erklären
wir die Anatomie des Affen, sagt Marx, und nicht umgekehrt. Die Vorstellung
hat anschaulichen, der Begriff () abstrakten
Charakter; auch hierin offenbart er sich als höhere Entwicklungsstufe.
Der Unterschied von Begriff () und Vorstellung
ist, psychologisch betrachtet, ein relativer, das ändert aber nichts
daran, daß Begriff () und Vorstellung
in erkenntnistheoretischer, logischer Beziehung verschiedenartige Begriffe
() sind.
Einzelne Definitionen heben hervor, daß der
Begriff
() eine „bestimmte“, „eindeutige“ Vorstellung von „beständiger Bedeutung“
sei - aber es ist nicht klar, warum und wodurch die bestimmten, eindeutigen
usw. Vorstellungen von den unbestimmten und nicht eindeutigen sich absondern.
Übrigens ist auch der Begriff ()
der „bestimmten Vorstellung“ selbst unbestimmt, und einzelne Vorstellungen
sind viel „eindeutiger“ als gewisse Begriffe
(). Überweg hebt richtig im Begriff
() das Widerspiegelungsmoment hervor; sein Fehler aber ist, daß er,
wie auch die anderen Logiker des 19. Jahrhunderts, den Begriff
() von der allgemeinen Vorstellung nicht unterscheidet. Trotzdem müssen
wir bemerken, daß unter den bekannten Logikern des 19. Jahrhunderts
Überweg dem erkenntnistheoretischen Standpunkt des Materialismus am
nächsten steht.
Den Begriff ()
als Funktion deuten (Frege, Russell, Couturat), heißt den universalen
Charakter des Begriffes (), den Begriff
() als allgemeine Form der Widerspiegelung der Wirklichkeit leugnen, die
Geltung des Begriffs auf ein Gebiet beschränken. Die Funktion ist
ein Begriff (), aber nicht jeder Begriff
() ist eine Funktion. Zweifach unrichtig ist es, den Begriff
() eine Satzfunktion zu nennen, denn einerseits erschöpft sich der
Begriff
() nicht im Funktionsbegriff, andererseits ist der Begriff
() ein Bestandteil, Element nicht des Satzes, sondern des Urteils. Der
Satz ist die sprachliche Form des Urteils, der Satz ist eine gewisse, bestimmte
Verbindung von Wörtern, das Urteil eine Verbindung von Begriffen.
Die Logistik (auch Lipps und Külpe) vermengen die Formen der Sprache
und des Denkens. Die Vertreter der alten Überlieferung der Schullogik
hingegen lassen die logische Bedeutung der Zusammenhänge von Sprache
und Denken außer Acht. Die zitierten Definitionen, die wir nur als
Beispiele aus vielen ähnlichen angeführt haben, sind auf diese
Weise - wie es sich zeigt - unannehmbar.
- 1 Lenin, Aus dem philosophischen Nachlaß, Dietz Verlag 1949,
Seite 85.
2 Ebenda, Seite 101. "
- Kommentar:
Frege [m, tk]
Über die wissenschaftliche Berechtigung einer Begriffsschrift. Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik, N.F. 81 (1882), 48—56.
- "Wir würden uns ohne Zeichen auch schwerlich zum begrifflichen
Denken erheben. Indem wir nämlich verschiedenen, aber ähnlichen
Dingen dasselbe Zeichen geben, bezeichnen wir eigentlich nicht mehr das
einzelne Ding, sondern das ihnen Gemeinsame, den Begriff.(TbegG).
Und diesen gewinnen wir erst dadurch, daß wir ihn bezeichnen; denn
da er an sich unanschaulich ist, bedarf er eines [>50] anschaulichen Vertreters,
um uns erscheinen zu können. So erschließt uns das Sinnliche
die Welt des Unsinnlichen.
..."
Kommentar: (1) "Wir würden uns ohne Zeichen auch schwerlich zum begrifflichen Denken erheben." ist eine empirisch inhaltliche Behauptung, die zu belegen wäre, auch wenn sie ab dem Schulalter intuitiv richtig erscheint. Begriffe können rein auf Wahrnehmungen beruhen, die erinnert und als Vorstellungen in Teilen oder als Ganzes aufgerufen und zueinander in Beziehung gesezt werden. Beweis durch entsprechende Vorstellungen [die natürlich funktionieren müssen, was nicht zwingend ist] bislang unbekannter und mit keinem Namen versehener Objekte. (2) Warum sollte ein Begriff unbedingt allgemein sein? Ein Astloch in meiner Holzdecke im Arbeitszimmer ist z.B., sofern genau das konkret gemeint ist, nicht allgemein. Ich kann es mit einem Eigennamen versehen, z.B. "Astloch Adam". Aber ich habe auch einen Begriff von meiner Frau, und der ist gant konkret. Wenn ich siehe, kann ich sie im allgemeinen problemlos als "meine Frau" identifizieren. Auf das Problem geht Frege in einem folgenden Absatz ein:
"... Von vielen Beispielen mag nur eine durchgehende Erscheinung hier erwähnt werden: dasselbe Wort dient zur Bezeichnung eines Begriffes (TbegI) und eines einzelnen unter diesen fallenden Gegenstandes. Überhaupt ist kein Unterschied zwischen Begriff und Einzelnem ausgeprägt. „Das Pferd“ kann ein Einzelwesen, es kann auch die Art bezeichnen, wie in dem Satze: „Das Pferd ist ein pflanzenfressendes Tier.“ Pferd kann endlich einen Begriff bedeuten wie in dem Satze: „Dies ist ein Pferd.“ ..."
- FREGES SCHRIFTEN (nach Patzig 1966)
1. Rechnungsmethoden, die sich auf eine Erweiterung des Größenbegriffs gründen. (Habilitationsschrift) Jena 1874.
2. Über eine Weise, die Gestalt des Dreiecks als complexe Größe aufzufassen. Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. 12 (1878), Suppl.-Heft XVII.
3. Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. Halle 1879 (Neudruck Darmstadt u. Hildesheim 1964), X, 88 S. (online)
4. Anwendungen der Begriffsschrift. Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. 13 (1879), SappL-Heft II, 29-33.
5. Über den Zweck der Begriffsschrift. Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. 16 (1882), Suppl.-Heft I, 1-10.
6. Über die wissenschaftliche Berechtigung einer Begriffsschrift. Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik, N.F. 81 (1882), 48-56.
7. Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl. Breslau 1884 (Neudruck Breslau 1934 und Darmstadt u. Hildesheim 1961); XXIII, 119 S. Dt.-Engl. Ausgabe (mit engl. Übers, v. J.L. Austin) New York 1950. Italien. Übers, in: G. Frege, Aritmetica e logica, Traduzione e note del L. Geymonat, Torino 1948, 15-187.
8. Über formale Theorien der Arithmetik. Sitz.-Berichte der Jena- ischen Gesellschaft f. Medizin u. Naturwiss. (Suppl. z. Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 19.) (1885), 94-104.
9. Über das Trägheitsgesetz. Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik. N. F. 98 (1891), 145-161.
10. Function und Begriff. Jena 1891, II, 31 S.
11. Über Sinn und Bedeutung. Zeitschr. f.Philos. u. philos.Kritik, N.F. 100 (1892), 25-50.
12. Über Begriff und Gegenstand. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philosophie 16 (1892), 192-205.
13. Le nombre entier. Rev. de metaph. et de mor. 3 (1895), 73-78.
14. Kritische Beleuchtung einiger Punkte in E. Schröders Vorlesungen über die Algebra der Logik. Arch. f. syst. Philosophie 1 (1895), 433-456.
15. Lettera del sig. G. Frege all’Editore (dt. Brief an G. Peano, dat. 29. 9. 1896). Rev. de Mathem. (Riv, di Mat.) 6 (1896—1899), 53-59.
16. Über die Begriffsschrift des Herrn Peano und meine eigene. Ber. d. Vhdl. d. Kgl. Sächs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig. Ma th.-Phys. Classe 48 (1897), 361-378.
17. Über die Zahlen des Herrn H. Schubert. Jena 1899. VI, 32 S.
18. Grundgesetze der Arithmetik, begriffsschriftlich abgeleitet. Bd. I; XXII, 254 S. Jena 1893. Bd.II: XV, 265 S. Jena 1903 (Neudruck Darmstadt u. Hildesheim 1962).
19. Was ist eine Funktion? Festschr. L. Boltzmann gew. z. 60. Geburtstag (1904), 656-666.
20. Über die Grundlagen der Geometrie. I.-III. Jahresber. d. dt. Math.-Ver.lt 12 (1903), 319-324; II: ebd. 368-375; III/l: 15 (1906), 293-309; III/2: ebd. 377-403; ??/3: ebd. 423-430.
21. Antwort auf die Ferien plauderet des Herrn Thomae. Jahresber. d. dt. Math.-Ver. 15 (1906), 586-590.
22. Die Unmöglichkeit der Thomaeschen formalen Arithmetik aufs Neue nachgewiesen. Jahresber. d. dt. Math.-Ver. 17 (1908), 52-55. Schluß bemerkung: ebd. 56.
23. Der Gedanke. Eine logische Untersuchung (= Log. Unt. I). Beitr. z. Philos, d. Dt. Idealism. 1 (1918/19), 58-77.
24. Die Verneinung. Eine logische Untersuchung (= Log. Unt. ?). Beitr. z. Philos, d. Dt. Idealism. 1 (1918/19), 143-157.
25. Gedankengefüge (= Log. Unt. III). Beitr. z. Philos, d. Dt. Idealism. 3 (1923-1926), 36-51.
26. Rezension von G. Cantor: Zur Lehre vom Transfiniten. Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik. N. F. 100 (1892), 269-272.
27. Rezension von E.Husserl: Philosophie der Arithmetik. Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik. N.F. 103 (1894), 313-332.
28. Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege ed. by P.Geach and M.Black. Oxford/New York (1952) I9602. (Enthält engl. Übers, von (10), (11), (12), (14), (19), (24) und von Auszügen aus (3), (18), (27).)
29. Ausführliche briefliche Mitteilungen Freges sind abgedruckt in:
Jourdain, The development of the theories of mathematical logic and the principles of mathematics: Gottlob Frege. The Quarterly Journal of pure and applied Mathematics 43, 1912, 237-269.
Freytag-Löringhoff
[m]
Logik (1961): "Alles Meinbare
kann also für die Logik Begriff sein, und meinbar ist bekanntlich
alles, ..."
S. 22f: "Das A, von dem in den Grundsätzen
die Rede war, bedeutet einen beliebigen Begriff
und kann durch „diese Lampe“, durch „Rot“, durch „Gerechtigkeit“ und beliebig
Anderes ersetzt werden. Wir wollen versuchen, uns darüber klar zu
werden, was in der Logik „Begriff“ heißt,
welche Arten von Begriffen da zu unterscheiden sind und wie wir zu Begriffen
kommen.
Begriff ist
für die Logik alles, was wir als isoliert, als von allem Anderen divers,
meinen können. Wörtlich hängt „Begriff“
mit Begreifen zusammen, mit „Erfassen“ eines Gegenstandes, eines von unserem
Meinen unabhängigen Sachverhaltes. Aber davon hat man in der Logik
der Meinung, mit der wir es zuerst zu tun haben, abzusehen. Das würde
erst in die Logik des Erkennens, eine Erkenntnistheorie, gehören.
Für die Logik sind Inhalt und Gegenstand eines Begriffes
identisch. Statt „Begriffslehre“ dürfte
dieses Kapitel auch „Gegenstands-“ oder „Sachverhaltslehre“ heißen.
Wir bleiben bei der alten Bezeichnung und sagen: Begriff
ist für die Logik alles, was gemeint werden kann.
Über „Meinen“ muß dazu Erläuterndes
gesagt werden. Meine ich einen Gegenstand, er mag wirklich oder unwirklich
sein, so steht er damit zu mir in der Relation des Gemeintwerdens, ohne
daß dieser Umstand ihn in seiner ontologischen Selbständigkeit,
welcher Art die auch sein mag, berührt. Das wird im Meinen anerkannt.
Er wird als in dieser Weise unabhängig gemeint. Allem Gemeinten wird
solche Selbständigkeit im Meinen zugebilligt.
Die Logik handelt in ihrer Begriffslehre
nicht vom Meinen. Das tut die Ontologie der gnoseologischen Relation. (Vgl.
Günther Jacoby, Allgemeine Ontologie der Wirklichkeit.) Die Logik
des Begriffes handelt nur vom Gemeinten,
vom Gegenstand selbst. Der ist für die Logik Begriff.
Z.B. ist der Begriff „Caesar" für
die Logik dasselbe wie Caesar selbst, der wirkliche Caesar, den wir meinen,
wenn wir meinend, urteilend und schließend diesen Begriff
verwenden.
Alles Meinbare kann also für die Logik Begriffsein,
und meinbar ist bekanntlich alles, Wirkliches wie Unwirkliches, Vorstellbares
wie Unvorstellbares, Widerspruchsfreies und sogar gelegentlich Widerspruchsvolles.
Man kann nichts angeben, was nicht meinbar wäre, denn gäbe man
es an, so hätte man es bereits gemeint.
Dieses weiteste Feld der Gegenstände ist,
angesehen als Feld des Meinbaren, das der Begriffe
im weitesten Sinne."
Quelle: Freytag-Löringhoff,
Bruno Baron von (1961) Logik ihr System und ihr Verhältnis zur Logistik.
Stuttgart: Kohlhammer.
Logik von Port Royal
Borowski
Notizen
[Intern in Erwägung:
- Begriffe nach Wittgenstein ().
- Begriffe nach Frege ().]
Literatur > Hauptseite.
Links > Hauptseite.
Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
Standort: Begriffsanalys Wissenschaftstheorie, Logik, Methodologie ...
*
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen (Überblick).
Zur Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalyse Begriff.
Definition Begriff.
Signierung Begriffe und Begriffsmerkmale (BM).
Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Wissenschaft site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, R. (DAS). Begriffe, Begriffsanalyse und Gebrauchsbeispiele in der Wissenschaftstheorie, Logik und Methodologie. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/BABegriff/BA_WthML.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_ Begriffsanalys Wissenschaftstheorie, Logik, Methodologie_Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_
noch nicht end-korrigiert
Aenderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
22.06.20 Anmerkung Inbegriff bei Bolzano nach Krickel.
10.11.19 Erfassung Marxististische Wissenschaftstheorie: Der Begriffsaufbau in der Wissenschaft.
17.10.19 Einige Signaturen bei Menne eingetragen.
13.10.18 Erstmals ins Netz gestellt.
00.09.18 Seit Semptember 2018 in Bearbeitung.