(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=24.02.2002 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 30.01.19
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Allgemeine und Integrative Kommunikationstheorie
Quelle: Sponsel,
Rudolf (1995), S. 223-242)
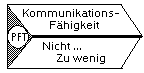
Inhaltsübersicht
4.1 Kommunikationstheorie
und Regeln in der Psychotherapie und ihren Schulen
4.1.1 Kommunikationstheorie
und Regeln der Psychoanalyse
- Gesprächsregeln
der Psychoanalyse nach TOMAN (1978, S. 144)
Gesprächsregeln der Analytisch Orientierten Psychotherapie (E4) nach TOMAN
4.1.3 Kommunikationstheorie und Regeln der Gesprächspsychotherapie (ROGERS)
4.1.4 Kommunikationstheorie und Regeln der Gestalt-Therapie
4.1.5 Kommunikationstheorie der Transaktionsanalyse
4.1.6 Kommunikationstheorie und Regeln der Kommunikations-und Strategischen Therapie (WATZLAWICK)
4.1.6.1 Grundbegriffe der WATZLAWICKschen Kommunikationstheorie
- (1) SEMIOTIK:
SYNTAKTIK, SEMANTIK, PRAGMATIK.
- Zum ersten "Axiom": Analyse einer vermeintlichen Paradoxie: Ist es wirklich "unmöglich, nicht zu kommunizieren"?
- Zum Beispiel: 10 mögliche Bedeutungen von Schweigen in einer kommunikativen Interaktion
- Zum zweiten Axiom: Beziehung als Meta-Kommunikation: Bestimmt die Beziehung tatsächlich immer den Inhalt?
- Zum dritten Axiom: Kommunikation hat keinen Anfang und kein Ende: Ist es wirklich immer richtig, keine Ursachen zu suchen?
- Zum vierten Axiom: Hat digitale Kommunikation wirklich keine Beziehungssemantik?
- Zum fünften Axiom: Jede Kommunikation ist symmetrisch oder nicht? Hängt das nicht sehr vom interpunktiven Segment ab?
- Was hat die metamathematische Typentheorie mit der Psychotherapie zu tun?
- Braucht man die mathematische Gruppentheorie in der Kommunikationstheorie oder Psychotherapie?
(2) FUNKTION, BEZIEHUNG, EINSTELLUNG und anderes
(3) VERSTECKTES AXIOM: DIE VERGANGENHEIT IST UNWICHTIG
(4) Sind die WATZLAWICKschen kommunikationstheoretischen Axiome sinnvoll oder gar nötig?
4.1.7.1 Objekt- und Metasprache
4.1.7.2 Einführung in die Grundbegriffe
4.1.7.3 Der Aufbau der allgemeinen Psychologischen Kunstsprache L-PSYCHO
4.1.7.4.1 Die allgemeinen Hauptkategorien psychologisch- psychotherapeutischer Leistung
4.1.7.4.2 Spezifische Leistungen
4.1.7.4.3 Die praktischen kommunikativen Umsetzungshilfsmittel
Literatur:
Endnoten und Amerkungen
Querverweise
4.1 Kommunikationstheorie und Regeln in der Psychotherapie und ihren Schulen
Liest man das psychotherapeutische Schrifttum unter dem Aspekt Kommunikationstheorie und Kommunikationsregeln, so wird man erstaunt feststellen, daß selbst oder gerade die sog. großen Schulen weder über eine Kommunikationstheorie noch über explizite und begründete Regeln zu Rollen- und Situations-Parametern verfügen. Eine Ausnahme ist die Gesprächspsychotherapie, deren Regeln allerdings extrem dogmatisch, auf ganze drei reduziert und in der Anwendung auch völlig ungeregelt sind. Sie werden der psychotherapeutischen Problemvielfalt in keiner Weise gerecht. Völlig unbedarft und naiv ist hier ausgerechnet die Verhaltenstherapie. War es doch ein wesentliches Motiv für die Entstehung des Behaviorismus, der zugegebenermaßen wirklich schwierigen Faßbarkeit der Bewußtseinsinhalte und ihrer Erforschung zu entgehen ("Problemlösung" durch Verleugnung oder Vermeidung). Die Behandlung der Sprache als physikalische Signale und nicht als semantische Äußerungen ist denn auch nie konsequent angegangen, geschweige denn jemals durchgeführt worden. Obwohl also der Behaviorismus kognitiven Prozessen traditionell am skeptischsten gegenübersteht, und hier, wie es auch sonst seiner Tradition entspricht, besondere Kontrollen einbauen müßte, hat die Verhaltenstherapie hier offenbar weder ein Problembewußtsein noch ein Konzept. Erneut ein Paradoxon der Psychotherapiegeschichte.
Große Bedeutung nimmt der Kommunikationsaspekt zwar in der Kommunikations- bzw. Strategischen Therapie von WATZLAWICK und in der systemischen Psycho- und Familientherapie ein, ein explizites und ausgearbeitetes Regelwerk findet man aber seltsamerweise auch dort nicht. Und ein völlig undurchsichtiges, meist nicht expliziertes Chaos herrscht im psychoanalytisch-psychodynamischen Raum. Abermals eine seltsame Paradoxie: obwohl die Kommunikation das genuine Handwerkszeug der PsychotherapeutInnen ist, sind die Psychotherapieschulen offensichtlich nicht in der Lage oder willens, ihr Reglement darzulegen und zu begründen. In der GIPT wollen wir das nicht nur offen und transparent machen, sondern auch vernünftig entwickeln und begründen. Kommunikation in der Psychotherapie dient der Heilung und ist formal ein verzweigtes Netz von kommunikativen Interaktionen mit dem Ziel, Heilmittel zu aktivieren.
4.1.1 Kommunikationstheorie und Regeln der Psychoanalyse
"... In der analytischen Behandlung geht nichts anderes vor als ein Austausch von Worten zwischen dem Analysierten und dem Arzt. Der Patient spricht, erzählt von vergangenen Erlebnissen und gegenwärtigen Eindrücken, klagt, bekennt seine Wünsche und Gefühlsregungen. Der Arzt hört zu, sucht die Gedankengänge des Patienten zu (E1) dirigieren, mahnt, drängt seine Aufmerksamkeit nach gewissen Richtungen, gibt ihm Aufklärungen und beobachtet die Reaktionen von Verständnis oder von Ablehnung, welche er so beim Kranken hervorruft." nach: FREUD 1915/16 in: FREUD (1975, Bd. I, S. 43)
Dieter FLADER und Klaus SCHRÖTER (1982, S. 8) erklären in der Aufsatzsammlung Psychoanalyse als Gespräch in ihrem Einführungsartikel: "Zunächst ist festzustellen, daß der sprachliche Kommunikationsvorgang in der Form, in der er in einer Behandlungssitzung zwischen Analytiker und Analysand stattfindet, bislang kaum untersucht worden ist. Die »Sprachdiskussion«, die in den letzten Jahren von einzelnen Analytikern angeregt wurde, hat hier - trotz erster Ansätze bei Goeppert/ Goeppert (1973 und 1975) - nicht viel zur Klärung beigetragen. Sie steht in Verbindung mit Untersuchungen, die sich mit der wissenschaftstheoretischen Klärung der besonderen Erkenntnismethode des Analytikers befaßten (Loch 1966; Lorenzer 1970; Thomä/ Kächele 1973)." Das ist ein bemerkenswertes Zitat, zeigt es uns doch wieder einmal das Verhältnis zwischen Anspruch und Wirklichkeit wissenschaftlicher Bemühungen in der Psychoanalyse.
Das seltsame kommunikative Verhältnis zwischen AnalytikerIn und AnalysandIn wird sehr trefflich durch den Titel der bissig-ironischen POTTER-Studie (E2) charakterisiert: "Die Kunst der Psychoanalyse oder Einige Aspekte einer strukturierten Situation bestehend aus einer Zweier- Gruppen- Interaktion unter Berücksichtigung bestimmter Grundprinzipien der Oneupmanship." (E3)
Wenngleich die Psychoanalyse so gut wie keine Kommunikationsforschung zu ihrem Therapieprozeß betrieben hat, so hat sie doch schon immer Regeln darüber, was psychoanalytisch zu tun ist. Typisch ist allerdings auch hier wieder, daß diese Regeln von AnalytikerIn zu AnalytikerIn zu variieren scheinen. Eindrucksvoll bekennt GREENSON (1975, S. 15), der ein ziemlich gutes und operationales Buch zur psychoanalytischen Technik geschrieben hat: "Diese Verwirrung und Unsicherheit {über die Handhabung der psychoanalytischen Technik, RS} wird auch durch die alarmierende Tatsache bestätigt, daß das Komitee zur Bewertung psychoanalytischer Therapie der Amerikanischen Psychoanalytischen Vereinigung sich 1953 auflöste, nachdem man sechseinhalb Jahre lang ohne Erfolg versucht hatte, eine annehmbare Definition der psychonanalytischen Therapie zu finden (Rangell, 1954)."
Wir wollen uns daher nicht weiter mit dem psychoanalytischen Chaos beschäftigen, sondern einem großen Kenner der psychoanalytischen Szene das Wort erteilen, der aus seiner Sicht einige Gesprächsregeln kurz und bündig, klar und operational zusammengefaßt hat.
Gesprächsregeln der Psychoanalyse nach TOMAN (1978, S. 144)
"In der Freudschen Psychoanalyse als psychotherapeutischer Behandlungsform wird der Klient ermuntert, alles zu sagen, was ihm einfällt (d. h. frei zu assoziieren). Dabei hilft ihm der Therapeut, innere Widerstände gegen das Bewußtwerden unbewußter Motive zu überwinden und sein Übertragungsverhalten (jene Affekte und Motive des Klienten, die sich ohne Provokation durch den Therapeuten auf den Therapeuten beziehen) zu verstehen. Der Therapeut verhält sich selbst »abstinent«. Er gibt keine Informationen über sich selbst und seine Meinungen preis. Er hilft nicht konkret oder materiell. Er kommentiert und deutet vielmehr lediglich die Äußerungen, Affekte und Motive des Klienten sowie gegebenenfalls seine Träume. Er hilft dem Klienten bei der Entdeckung und Wiederaufnahme verloren geglaubter Möglichkeiten der Motivbefriedigung aus seiner Vergangenheit und Gegenwart. Jung, Adler, Sullivan (und deren Schüler) selegieren in den freien Äußerungen ihrer Klienten etwas anderes als Freud (und dessen Schüler), verhalten sich aber im wesentlichen ähnlich. Stekel, Rank, Ferenczi, Alexander, French, Schultz-Hencke, Deutsch, Murphy, Balint und andere versuchten, die psychoanalytische Therapieform in einzelnen Aspekten zu variieren (z. B. zum Zwecke der Beschleunigung des therapeutischen Prozesses oder der Verkürzung der Behandlungsdauer)."
Gesprächsregeln der Analytisch Orientierten Psychotherapie (E4) nach TOMAN
TOMAN (1978, S. 147) nennt folgende Gesprächsführungsregeln:
"1. Aufmerksam und neutral-wohlwollend zuhören.
2. Selbst kein Thema einführen, aber den Klienten nach Beispielen
seiner Themen fragen und ihre Entfaltung ermöglichen.
3. Nur auf Themen zurückkommen, die der Klient schon angesprochen
hat. Dabei ältere Themen rezenteren, affekt- oder konfliktgeladene
den neutralen Themen vorziehen und bei Übertragungsverhalten des Klienten
nach Anlässen desselben in der Vergangenheit und Alltagswirklichkeit
des Klienten suchen.
4. Die objektiven Lebensumstände des Klienten in Vergangenheit
und Gegenwart beachten und registrieren.
5. Das Gespräch durch Fragen, Kommentare und Deutungen (die nach
Möglichkeit in der Redeweise des Klienten gegeben werden sollen) in
Gang halten.
6. Mit dem Klienten mitdenken und die Inhalte und Themen des Klienten
sowie die eigenen Interventionen laufend bzw. nach der jeweiligen Behandlungsstunde
auf innere Konsistenz und auf Zusammenhänge prüfen."
4.1.2 Kommunikationstheorie und Regeln der Verhaltenstherapie
Dieser Abschnitt ist sehr kurz: die Verhaltenstherapie hat keine Kommunikationstheorie - wohl aber Kommunikationsprogramme für PatientInnen. Da historisch alles Geschehen außerhalb des Verhaltensbereiches für den Behaviorismus eine undurchsichtige black box repräsentiert, ist es vielleicht konsequent und sicher am einfachsten, sich diesem Problem zu entziehen, indem man so tut, als gäbe es das gar nicht (E5).
4.1.3 Kommunikationstheorie und Regeln der Gesprächspsychotherapie (ROGERS)
Die Gesprächspsychotherapie kann als Kommunikationstherapie interpretiert werden, die nach den drei Kernvariablen zu erfolgen hat: (1) Echtheit, (2) Einfühlung, (3) unbedingte Wertschätzung. Die konkrete Anwendung, wann, wie, wie sehr, auf welche Weise, welche Kernhaltung angebracht ist, also die konkrete Indikation, wird nirgendwo geregelt. Gibt es in einer Therapiestunde 50 verbale Interaktionen zwischen PatientIn und PsychotherapeutIn, dann gibt es in einer solche Stunde 850 (!) prinzipielle Möglichkeiten, wenn wir zwischen den Grundvariablen folgende Beziehungen zulassen: 0, 1, 2, 3, 12, 13, 23, 123, wobei 0 = Nichtreagieren (schweigen, übergehen) bedeute. Hierbei ist überhaupt noch nicht berücksichtigt, daß Echtheit, Einfühlung und unbedingte Wertschätzung sehr differenziert geäußert werden können. Obwohl also die GT eine genuin kommunikative Therapie mit extrem einfacher Theorie und Struktur ist, ergeben sich aufgrund der Unstrukturiertheit astronomische Möglichkeiten. Erneut stoßen wir auf ein seltsames Paradoxon: je einfacher und unstrukturierter eine Theorie ist, desto astronomischer werden offenbar die Reaktionsmöglichkeiten. Nun, komplexe Theorien, wie die GIPT, reduzieren die Vielfalt durch ihre Differenziertheit sehr schnell. Komplexe Theorien, so unübersichtlich sie auf den ersten Blick wirken mögen, sind in der praktischen Gestaltung, Anleitung und Lehre also letztlich einfacher. [Zu den Problemen der Kombinatorik der Heilmittel und Methoden siehe bitte auch 1 * 2 * 3]
4.1.4 Kommunikationstheorie und Regeln der Gestalt-Therapie
Auch dieser Abschnitt ist - technisch bedingt - kurz: die Gestalt-Therapie
verfügt, wie die Verhaltenstherapie, über keine ausdrückliche
Kommunikationstheorie. Aber das Thema "Kontakt" spielt in der Gestalt-Therapie
eine zentrale Rolle. Und da der Kontakt sicher als der zweieiige Zwillingsbruder
der Kommunikation angesehen werden kann, hat die Gestalt-Therapie eine
Kommunikationstheorie sozusagen nur unter anderem Namen (E6).
Kontakt wird von der Gestalt-Therapie als wesentliche Bedingung und als
Rahmen für Entwicklung, Wachstum und Veränderung angesehen. Und
zu richtigen Kontakten im Sinne der Gestalt-Therapie gehören: (1)
Hier und Jetzt (Authentizität), (2) Persönlicher Bezug (ich fühle,
meine, will, denke ...) und nicht über ... sprechen, (3) Echtheit.
Ein guter Kontakt oder auch eine gute Kommunikation im Sinne der Gestalt-Therapie
ist demnach eine, die authentisch, persönlich und echt ist (POLSTER,
WALTER). Wir haben den Eindruck gewonnen, als ob diese generell für
wünschenswert erachtete Lebenseinstellung zur Bedeutung und Gestaltung
der Kontakte auch die PatientIn- PsychotherapeutIn- Kommunikationsbeziehung
bestimmt. Das hieße, eine Gestalt-TherapeutIn funktioniert auch als
persönliches Modell, was realtherapeutische (GLASSER > Reader), vielleicht
heilsame, aber auch problematische "Ohrfeigen" für die PatientInnen
bedeuten kann.
Betrachtet man die Integrative Therapie PETZOLDs als eine höher
entwickelte Tochter der Gestalt-Therapie, so findet man eine knappe und
essentielle Kommunikationstheorie in RAHM et al. (1993, Kapitel 4.8 "Praktische
Aspekte von Ko-respondenz") (E7).
4.1.5 Kommunikationstheorie der Transaktionsanalyse
Die Transaktionsanalyse kann zu einem wesentlichen Teil als Kommunikationstherapie angesehen werden. Die Konflikte, die sich zwischen den verschiedenen Ich-Zuständen von KommunikationspartnerInnen ergeben, sind ein praktisches Modell und zugleich ein Konfliktlösungsansatz. Noch bedeutsamer erscheint das spielanalytische Konzept. In SCHLEGEL (1984, S. 57) lesen wir: "BERNE hat drei Kommunikationsregeln aufgestellt: (1.) «Solange die Botschaften parallel verlaufen, kann sich die Kommunikation ungestört unendlich lange fortsetzen.» ... (2.) «Die Kommunikation bricht ab, wenn eine gekreuzte Transaktion geschieht. Umgekehrt gesagt: Wenn eine Kommunikation abbricht, dann ist dies eine Folge einer gekreuzten Transaktion.» ... (3.) «Das Verhalten, das der Transaktion mit unterschwelligen Botschaften folgt, richtet sich nach dem, was auf der unterschwelligen Ebene vor sich geht.» ..." Insgesamt kann man aber wohl nicht davon sprechen, daß die Transaktionsanalyse eine hinreichend allgemeine und umfassende Kommunikationstheorie vorgelegt hat.
4.1.6 Kommunikationstheorie und Regeln der Kommunikations-und Strategischen Therapie (WATZLAWICK)
WATZLAWICK et al. (1974) lieben es, Modell-Beispiele aus Mathematik, Logik und Kybernetik zu benutzen. Wir werden nachher sehen und zeigen, daß dies mehr verwirrt als es erhellt und vermutlich nur ein ebenso guter wie sachlich unnötiger Trick WATZLAWICKs ist.
4.1.6.1 Grundbegriffe der WATZLAWICKschen Kommunikationstheorie
(1)
SEMIOTIK: SYNTAKTIK, SEMANTIK, PRAGMATIK.
SEMIOTIK (E8) heißt die Lehre (Metasprache)
von den Zeichen. (a) SYNTAKTIK heißt die Teildisziplin, die sich
mit den Regeln und der Bedeutung der Anordnung der Zeichen und Zeichenfolgen
beschäftigt. (b) SEMANTIK heißt die Lehre von der Bedeutung
der Zeichen, was sie also repräsentieren. (c) Und die PRAGMATIK beschäftigt
sich mit der Beziehung der Zeichen und ihrer Benutzer. Beispiel: (a) SYNTAKTIK:
(a1) die Anordnung von Lichtscheiben mit unterschiedlichen Stellungen und
Farben im Straßenverkehr heißt Ampel; (a2) die Zeichenfolge
[Ich bin da]0 besteht aus [drei Worten]1. Worte sind
durch ein Leerzeichen voneinander getrennt. (b) SEMANTIK: (b1) bei einer
Ampel hat die Beleuchtung "rot" die Bedeutung <halte an!>. (b2) Im Kontext
einer gestalttherapeutischen Sitzung ist mit dem Ausdruck "Ich bin da"
gemeint, daß jemand wach, zugewandt und aufmerksam bei der Sache
ist. (c) PRAGMATIK: (c1) es hält jemand bei Rot an der Ampel; (c2)
Der Ausdruck "Ich bin da" wird von Hans mit der Absicht gebraucht, mitzuteilen,
daß er wach, zugewandt und aufmerksam bei der Sache ist. (c3) Der
Ausdruck "Steig auf den Stuhl!" kann zur Folge haben, daß der Betreffende,
der diese Aufforderung an sich gerichtet sieht, die entsprechende Handlung
vollführt.
(2)
FUNKTION, BEZIEHUNG, EINSTELLUNG und anderes
Um eine Funktion zu erklären, braucht man wirklich keine Mathematik,
es genügt die Heizung hochzudrehen oder das Fenster aufzumachen. Aber
auch ein Mensch- Ärgere- Dich- Nicht Spiel ist gut geeignet. Und die
Kritik am psychologischen Funktionsbegriff - wahrnehmen, empfinden, erinnern,
vorstellen usw. - ist völlig unberechtigt, da die Analogie so schlecht
auch wieder nicht ist, da es für jede solche psychologische Funktion
wie in der mathematischen Funktion einen bestimmten Wertevorrat (x) gibt,
der zu veränderten Bewußtseinsinhalten (y) oder sogar zu anderen
Funktionen (z), z. B. handeln, führen kann.
(3)
VERSTECKTES AXIOM: DIE VERGANGENHEIT IST UNWICHTIG
Dieses versteckte Axiom durchzieht die gesamte kommunikationstherapeutische,
strategische und systemische Literatur und Lehre (a.a.O. S. 27). Hier wird
im Gegensatz zur Psychoanalyse das andere Extrem dogmatisch vertreten.
Die GIPT hingegen vertritt das Axiom: die Kenntnis der Vergangenheit kann
wichtig, nützlich oder nötig sein oder nicht. Das hängt
vom Einzelfall und seinem Kontext ab. Wir halten die Dogmatik beider Extreme,
der Psychoanalyse wie auch der Kommunikationstherapie, für falsch
und unnötig.
(4) Sind die WATZLAWICKschen kommunikationstheoretischen Axiome sinnvoll oder gar nötig?
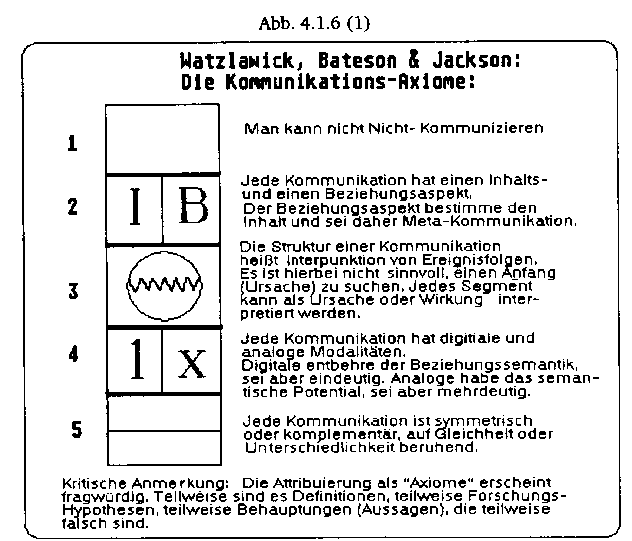
Zum ersten "Axiom": Analyse einer vermeintlichen Paradoxie: Ist es wirklich "unmöglich, nicht zu kommunizieren"?
Dieses Axiom WATZLAWICKs ist natürlich äußerst fragwürdig und daher hat er gut daran getan, seine These "Die Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren" in dem Kapitel "Pragmatische Axiome - Ein Definitionsversuch" abzuhandeln. Schon diese Formulierung ist wissenschaftstheoretisch wenig sinnvoll. Handelt es sich nun um Axiome - also um angenommene wahre erste Aussagen, aus denen mit Hilfe empirisch-inhaltlicher Sätze und mit Hilfe der Logik neue Aussagen gewinnbar sind - oder um Definitionen? Wir müssen uns aber fragen: kann etwas, das beweisbar falsch ist, sinnvoll zum Axiom oder zur Definition erhoben werden? Natürlich nicht. Jeder, der Partner- und Familientherapie praktisch gemacht hat, weiß, daß es ein großes Zentral- und Kardinalproblem allerersten Ranges ist,wenn ein Partner oder Familienmitglied die Kommunikation verweigert, sich nicht öffnet, sich nicht mitteilt, "mauert", "eisern schweigt", sich zurückhält, einfach nicht mitmacht und nicht sagt, was er möchte, fühlt, will, meint. WATZLAWICK hat recht, wenn er auf höherer Ebene interpretiert, daß der "Maurer" auch etwas mitteilt, nämlich daß er nicht will, daß er sich verweigert, daß er eben "mauert". Aber auch vom Sprachgebrauch her ist es wenig sinnvoll, Schweigen und "Mauern" als Kommunikation mißzuverstehen. Wer absichtlich nichts sagt, kommuniziert nicht etwa, er handelt, und seine Handlung heißt schweigen. Weiß er gar nicht, warum er nicht kommuniziert, so verhält er sich, und sein Verhalten heißt in diesem Fall ebenfalls schweigen. Es ist einfach unsinnig, schweigen als Kommunikation zu mißdeuten. Im Schweigen ist einer nur für sich. In der Kommunikationstheorie der GIPT sagen wir stattdessen: Wer die Kommunikation durch Schweigen verweigert, handelt oder verhält sich antikommunikativ. Er teilt über sein Schweigen mit: ich kann oder ich mag nicht kommunizieren. Das ist auch keine Metakommunikation, da Schweigen ja kein kommunikativer Akt ist. Wo keine Objektsprache ist, gibt es natürlich auch keine Metasprache.
Zum Beispiel: 10 mögliche Bedeutungen von Schweigen in einer kommunikativen Interaktion
Wenn wir Schweigen deuten, so deuten wir eine Handlung oder ein Verhalten. Allerdings könnten wir per definitionem einführen, daß Schweigen in einer kommunikativen Interaktion folgende kommunikative Mitteilung ausdrücken soll: (1) ich weiß nichts dazu; (2) ich mag dazu jetzt nichts sagen. (3) Ich mag dazu überhaupt, auch später nichts sagen. (4) Ich kann dazu nichts sagen, mir verschlägt es die Sprache; ich bin platt. (5) Ich kann, obwohl ich etwas sagen möchte, nichts sagen und weiß nicht, warum ich nicht fähig bin, zu sprechen (selektiv mutistische Reaktion). (6) Ich weiß, was ich sagen möchte, finde aber die entsprechenden Worte nicht (selektive Aphasie Reaktion). (7) Ich weiß noch, daß ich etwas sagen wollte, aber mir ist der Gedanke abgerissen (Gedankenabreißen als selektive schizophrenoforme Reaktion). (8) Ich weiß noch, daß ich etwas sagen wollte, aber plötzlich war es weg und ich kann es im Moment nicht wieder finden (selektives spontanes (vorübergehendes) Vergessen als alltägliche Reaktion ohne besonderen Störungswert). (9) Ich sammle mich noch und "arbeite" an einer Antwort. (10) Sonstige Bedeutung. Wie um Himmels willen, soll dieses Schweigen denn nun kommunikativ gedeutet werden?
Zum
zweiten Axiom: Beziehung als Meta-Kommunikation,
Bestimmt die Beziehung tatsächlich immer den Inhalt?
Wenn mich meine Frau fragt, ob die Balkontür auf ist, wo sollte da ein Beziehungsaspekt versteckt sein? Und wieso sollte in genuin informativen Gesprächen oder Kommunikationen die Beziehung den Inhalt der Information bestimmen? Die Idee einer Sachlichkeit und Neutralität im Kommnunikations- und Informationswesen wäre nach diesem Axiom eine Fiktion oder schlicht falsch. Wir bestreiten die Richtigkeit dieser Aussage. Und wir bestreiten, daß eine solche Aussage überhaupt sinnvoll zum Gegenstand eines Axioms gemacht werden sollte, da hier grundsätzlich prüfbare Behauptungen aufgestellt werden. Das zweite Axiom erscheint völlig abwegig. Sinnvoll schiene allenfalls die Arbeitsregel: sei immer wachsam, ob sich in den kommunikativen Inhalten nicht subtile Beziehungsangelegenheiten verstecken.
Zum
dritten Axiom: Kommunikation hat keinen Anfang und kein Ende
Ist es wirklich immer richtig, keine Ursachen zu suchen?
Es ist natürlich Unsinn zu postulieren, daß durch Interpunktion charakterisierbare Ereignisse oder Sachverhalte keine Ursachen haben. Sinnvoll ist die psychotherapeutische Arbeitsregel, daß es nicht sinnvoll ist, nach solchen Ursachen zu suchen, da man meist vor einem "Henne- oder- Ei- Problem" steht. Es sind also pragmatische Überlegungen, in der Therapie keine Entwicklungen zu fördern, die nichts bringen (Spiele ohne Ende). Das ist die eine Sache. Die andere ist, daß es natürlich falsch ist, zum Dogma zu erheben, daß es grundsätzlich falsch ist, nach Ursachen zu suchen. Auch hier wird wieder das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet. Entscheidend für jede Psychotherapie ist, daß man sich in jedem Einzelfall und Segment der Therapie fragt: ist hier ein Ansatz sinnvoll, der bewußt absieht von der Ursachensuche oder ist hier ein Ansatz sinnvoll, der bewußt die Ursachenforschung bemüht?
Zum
vierten Axiom: Hat digitale Kommunikation wirklich keine Beziehungssemantik?
Wenn ich feststelle, daß ich ein sehr ambivalentes Verhältnis
zur Psychoanalyse habe, ihr also mit sehr gemischten Gefühlen gegenüberstehe,
während mein Verhältnis zu WATZLAWICK et al. längst nicht
in dem Maße ambivalent ist; und ich vieles bewundere, manches
falsch, manches ärgerlich finde, dann habe ich doch sehr differenziert
meine Beziehung zu diesen Therapieschulen ausgedrückt, so richig in
Druckbuchstaben, also digital. Wenn Sie, verehrte LeserIn, mich jetzt auch
noch verstanden haben, dann können wir das vierte Axiom als falsche
Aussage zur Seite legen.
Zum
fünften Axiom: Jede Kommunikation ist symmetrisch oder nicht
Hängt das nicht sehr vom interpunktiven Segment ab?
Obwohl der Satz seiner Struktur nach immer wahr ist, also eigentlich
gar keine Information enthält, ist er seiner Intention nach wahrscheinlich
auch falsch. "Oben" und "unten", Überlegenheit und Unterlegenheit
wechseln in Kommunikationen und ihren Verläufen wie auch sonst im
Leben, weil es oft ganz darauf ankommt, um was es genau geht, an welcher
Stelle man sich befindet.
Sind Kenntnisse der Motive für eine Kommunikationsanalyse wirklich
nur nebensächlich?
Seite 74 (a. a. O.) enthält in einer Fußnote die Behauptung,
"daß für die Zwecke einer Kommunikationsanalyse die Motive der
beiden Partner nebensächlich sind." Diese These widerspricht im Grunde
auch der Bedeutung, die dem Beziehungsaspekt gegeben wird. Die Beziehung
ist ja immer von Affekten und wechselseitigen Bedürfnissen bestimmt,
woraus ja unmittelbar zu folgern ist: wenn die Affekte die Beziehung
bestimmen und wenn die Beziehung die Kommunikation bestimmt, dann bestimmen
die Affekte auch die Kommunikation.
Was hat die metamathematische Typentheorie mit der Psychotherapie zu tun?
Die Typentheorie, also z. B. die Unterscheidung zwischen Objekt- und Metasprache, von WHITEHEAD & RUSSELL war eine mächtige Antwort auf die logischen Paradoxien, die zur sog. "Grundlagenkrise" der Mathematik geführt hatten. Analog angewandt auf die Psychotherapiesituation, würde das bedeuten, daß die konkrete Durchführung einer Psychotherapie der Objektsprache entspricht und die Reflexion darüber, wie dieses Geschehen begriffen und damit erforscht werden kann, der Metasprache angehört. Metasprachliche Ausdrücke in der Psychotherapie sind danach z. B.: [Beziehung, Klären, Bewältigen]1. Eine BeobachterIn, die eine Therapie durch die Einwegscheibe supervidiert und das Geschehen protokolliert - z. B. jetzt wird die Vaterbeziehung geklärt -, wäre metapsychotherapeutisch zum Psychotherapiegeschehen aktiv. Allgemein können wir sagen, daß Geschehen, das von außerhalb betrachtet und damit zum Objekt gemacht wird, eine Metaperspektive erhält, die wiederum als Objektgeschehen mit einer eigenen Metaperspektive betrachtet werden kann ad infinitum. Also: Psychotherapieforschung, Supervision, Autosupervision, Therapieplanung, Evaluation kann als Metapsychotherapie interpretiert werden. In der Logik gehört z. B. die Behauptung der Gültigkeit einer Schlußfolgerung zur Metaebene (E9) und ist nicht mehr Bestandteil des logischen Objektkalküls. Psychotherapieforschung ist demnach ein Zweig der Metapsychotherapie, Supervision und Erfolgskontrolle ein anderer.
Braucht man die mathematische Gruppentheorie in der Kommunikationstheorie oder Psychotherapie?
Die mathematische Gruppentheorie ist insofern von allgemeiner Bedeutung, als sie durch die Betrachtung allgemeiner mathematischer Strukturen einen hohen Grad von Verallgemeinerung und damit auch der Beweisvereinfachung förderte. Kann man etwas für alle Menschen beweisen, so gilt es natürlich auch für die Franken. Kann nun für ein mathematisches Gebilde G gezeigt werden, daß es zur Struktur S gehört, so gelten alle Sätze, die für die Struktur S gefunden wurden, auch für das Gebilde G. So behaupten z. B. GRAWE et al. (1994), daß für alle Psychotherapien die drei Dimensionen (> Kap. 5.6.1.1) [Beziehung, Klären, Bewältigen]1 bedeutungsvoll sind, und zwar unabhängig davon, was eine PsychotherapeutIn dazu meint oder tut. Damit wäre klar, daß Psychotherapieschulen, die für alle drei Dimensionen kein klares und ausreichendes Konzept ausweisen, nicht dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Das ist für die traditionellen Schulen der Fall. Die GIPT beachtet selbstverständlich diese drei Dimensionen nicht nur theoretisch, konzeptionell und praktisch, sondern wir schlagen auch vor, als weitere Dimension die Handhabung von Abwehr und Widerstand (Übertragung zählen wir zur Beziehung) hinzuzufügen. Nach diesem System [Beziehung, Abwehr, Klären, Bewältigen]1 decken die GT nach ROGERS, traditionelle Psychoanalyse und Verhaltenstherapie ungefähr jeweils 1/3 dieses Psychotherapieraumes ab. Wenn für alle Psychotherapien gilt, daß für sie auch ein Placeboeffekt wirksam ist, dann hat jede Zuwendung, die Psychotherapiecharakteristika erfüllt, auch diesen Effekt. Die Ausarbeitung der allgemeinen Heilwirkfaktoren, die in allen Psychotherapien wirksam sind, wäre ein Analogon zur Gruppentheorie. J. D. FRANK (dt. 1981 > Reader) hat diese allgemeinen Heilwirkfaktoren auf einer ziemlich abstrakten und allgemeinen Ebene in brillanter Weise erforscht und dargestellt. Die extreme kombinatorische Vielfalt, die in einer psychotherapeutischen Dyade liegt (150 Billionen Möglichkeiten war eine Schätzung > 6.2) erfordert sehr allgemeine metapsychotherapeutische Betrachtungen, weil man sonst in einem unfruchtbaren Massenempirismus landet, der mehr verwirrt als er aufhellt. Die ganze Forschung müßte viel mehr Metaüberlegungen anstellen.
Gesamtbeurteilung: Insgesamt müssen wir feststellen, liefert
die Kommunikationstheorie von WATZLAWICK et al. sehr interessante, pragmatische
und heuristisch- kreative Ideen zur Psychotherapiepraxis, aber lehr- und
lernbar erscheint das doch sehr analog Vorgebrachte wenig. Vieles bedarf
noch der rationalen Rekonstruktion.
4.1.7
Allgemeine Einführung in die Integrative Psychologisch-Psychotherapeutische
Kommunikationstheorie
4.1.7.1 Objekt- und Metasprache
"Meta" bedeutet "über". In der Kommunikations- und Sprachphilosophie bedeutet Metasprache über eine Sprache sprechen. Zur Illustration:

Die Metasprache
der deutschen Sprache ist üblicherweise die Grammatik. Um völlig
unmißverständlich klar zu legen, in welcher sprachlichen Funktion
(Objektsprache, Metasprache 1. Stufe, Metasprache 2. Stufe usw.) wir einen
sprachlichen Ausdruck verwenden, führen wir eckige Klammern mit Indizes
ein: der Index [ ... ]0 repräsentiere die Basissprache
unterster Ebene, der Index [ ... ]1 repräsentiere
die zu [ ... ]0 erste metasprachliche Ebene, [ ...
]2 repräsentierte dann die Metasprache 2. Stufe,
also die Metasprache der Metasprache 1. Stufe. usw. Wir können
jetzt vereinbaren, daß wir objektsprachliche Äußerungen
nicht indizieren, da es genügt, nur die metasprachlichen zu kennzeichnen.
Nur in den Fällen, wo es didaktisch geboten erscheint, werden wir
auch die objektsprachlichen Ausdrücke indizieren. Z. B. [bei]0
ist ein [Wort]1 aus drei Buchstaben vom Typ [Präposition]1
in der Metasprache der Grammatik und ein [Relator]1 in der Metasprache
L-PSYCHO der Ortsnähe und im übertragenen Sinne: nahe sein."
[Watzlawick]0 ist ein [Eigenname]1 und ein [Hauptwort]1.
[Wort]1, [Relator]1, [Eigenname]1 und
[Hauptwort]1 sind metasprachliche Ausdrücke der ersten
Stufe. In der Kommunikationstheorie sind metakommunikative Äußerungen
z. B.: [er drückt sich schwer verständlich aus]1,
[sie läßt ihn kaum zu Wort kommen]1. Metapsychotherapeutische
Äußerungen sind z. B.: [die Therapie stagniert]1,
[x hat seine Gegenübertragung nicht bemerkt]1, [y weiß
gar nicht, was in ihr geschieht]1.
4.1.7.2 Einführung in die Grundbegriffe
[Informationen]1 haben ein bestimmtes [Sende-Subjekt]1. Wer teilt etwas mit? [Informationen]1 haben einen bestimmten [Empfänger]1. [Kommunikation]1 kann nun einen ständigen Wechsel zwischen [Sender]1 und [Empfänger]1 bedeuten, was die deutsche Sprache mit [Gespräch]1 bezeichnet. Ein solches [Gespräch]1 kann [ausgeglichen-symmetrisch]1 sein, also ein [ständiges Hin- und Her]1 bedeuten, es kann aber auch [einseitig]1 sein, daß einer mehr [Sender]1, der andere mehr der [Empfänger]1 ist. Für den [Austausch der Informationen]1 gelten mehr oder minder explizite [Meta-Regeln]2, z. B. der eine [öffnet]1 und [offenbart]1 sich, der andere ist hier [sehr zurückhaltend]1. Man kann hier auch sagen, da gewisse [Kommunikationsregeln Interaktion und Informationsaustausch]1lenken. Diese [Kommunikationsregeln]1 hängen im wesentlichen von zwei Kriterien oder Bedingungen ab: (1) Rollen-Parameter (z. B.: Vorgesetzter, KäuferIn, Untergebener, VerkäuferIn, PatientIn, TherapeutIn), (2) spezifische Situations- Parameter (z. B.: PatientIn sucht Bestätigung, Verständnis, will Rat; TherapeutIn möchte die Gefühle der PatientIn erfahren, möchte mehr von / über ... wissen). Siehe auch > 5.6.1.9 (3), S. 310.
Wem wird es mitgeteilt? [Informationen]1 betreffen
ein bestimmtes [Informations- oder Nachrichten-Objekt]1. Über
wen oder was wird informiert? Informationen haben einen bestimmten [Inhalt]1.
Was wird mitgeteilt? Und sie werden auf bestimmte Weise ausgedrückt,
haben [Ausdruck, Ton, Form, Stil]1. Der [Ausdruck]1
von Informationen hat [mehrere Perspektiven]1, die mehr oder
weniger [kongruent oder inkongruent]1 sein können. Die
[Inhalte]1 sind mehr oder minder [wahr]1 mit diesen
oder jenen [Gültigkeitscharakteristika]1. Welchen [Wahrheitswert]1
hat die [Mitteilung]1? Der [Sender]1 hat ein bestimmtes
[Interesse]1. Wozu wird die [Mitteilung]1 gemacht?
Was möchte der [Mitteiler]1 erreichen? Die [Informationsverarbeitung]1
hängt ab von der [Situation]1, der [Beziehung]1
zu [Objekt]1 und [Empfänger]1 und dem [Kontext]1.
Wer ist [Zeuge]1 der [Mitteilung]1? Welche Leute
sind dabei? Welche [Beziehung besteht zwischen Sender, Empfänger und
Nachricht]1? Ein und dieselbe [Information]1 kann
in [verschiedenen Kontexten]1 und unter [verschiedenen Bedingungen]1
völlig unterschiedlich beurteilt werden. Eine [Kommunikation]1
besteht in unserer Systematik aus den acht Hauptelementen: [Sender (yKS)
(E10), Sender-Intentionen (yKI),
Forum (yKF), Information
& Nachrichten (yKN),
Empfänger (yKE),
Interpretation (Deutung) durch den Empfänger (yKD),
Kontext (yKK),
Wirkung (yKW),
Regeln (yKR)]1.
Das allgemeine Kommunikationssystem ist Grundlage der psychologischen,
psychodiagnostischen, psychotherapeutischen Kunstsprache L-PSYCHO (> Kap.
8 INTEGRATIVE PSYCHODIAGNOSTIK).
Da Sprache wesentlich der Kommunikation dient, gehört die Sprache
auch in eine allgemeine Kommunikationstheorie eingebettet.
4.1.7.3 Der Aufbau der allgemeinen Psychologischen Kunstsprache L-PSYCHO
Wir geben im folgenden einen Überblick über die Sprachelemente von L-PSYCHO, die ursprünglich (1985) deshalb so explizit konstruiert wurde, weil ein Weg gesucht wurde, komplexe diagnostische Information so in der EDV abzuspeichern, daß sie eindeutig für Forschungszwecke wiedergefunden werden kann. Im wesentlichen gibt es hier zwei Wege: (1) Hat man ein Programm, das in der Lage ist, die natürliche Sprache zu interpretieren, kann man sich den Aufbau einer Kunstsprache sparen. Ein solches Programm wäre aber sehr speicherintensiv und komplex. (2) Verfügt man nicht über die Möglichkeiten von (1), muß man die natürliche Sprache in eine eindeutige Kunstsprache transformieren. Der einfachste Weg scheint hier, jedem Sprachelement die Information hinzuzugeben, die es eindeutig macht. {A lieben B} wird eindeutig, wenn klar ist, wer Subjekt und wer Objekt ist. Aufgrund mehrerer Überlegungen habe ich mich für den zweiten Weg entschieden. Hierbei wurden nun folgende Sprachelemente kreiert:
- Sender-Fähigkeit zur Kommunikation, Sender-Verfassung
- (1) Sachverhalt zwecks Information mitteilen (lehren, lernen,
unterrichten, unterweisen).
(2) Eine Meinung beeinflussen, bewirken
(3) Einen Affekt beeinflussen, bewirken
(4) Eine Handlung beeinflussen, bewirken
- (1) Öffentlich, d. h. es gibt ZuhörerInnen, ZeugInnen. (2)
Privat, d. h. es gibt keine ZuhörerInnen, ZeugInnen. (3) Gar nicht
(Sender und Empfänger können in diesem Fall über dieselbe
Information verfügen, ohne daß sie sie austauschen müssen,
etwa durch gemeinsames Wissen oder bedeutsam etwa im Konzept der romantischen
Liebe: Gleichklang der Seelen, Verstehen ohne Worte usw.)
INFORMATION
(Nachricht)
Träger
Codierung
- Zeichenvorrat, Alphabet
Ziffern 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Buchstaben abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Buchstabensonderzeichen äöüÄÖÜ
Sonderzeichen .:,;!?()[]{} "'*^+-/~
Silben, Worte, Sätze, Abschnitt, Seite, Kapitel, Texte, Themen
Weg
Ausdruck: Gebärden, Form, Ton, Stil
Grammatik (Meta-Sprache)
- Informatoren in Zeichensequenzen
- Signifikator (Kenner für Zeichenbedeutung: das Zeichen
bedeutet sich oder einen Code für etwas anderes)
Lexikator (Kenner für bestimmtes Begriffswörterbuch, z. B. ICD-10)
Semantor (Kenner inhaltliche Bedeutung)
Subjektor (Kenner Aktionsquelle)
Individuator (Kenner für Individuum)
Generator (Kenner für Geschlecht)
Prädikator (Kenner für Prädikation, Ausgesagtes)
Publikator (Kenner für Informationsform:
explizit (öffentlich oder privat), implizit.
Interpretor (Kenner für direkte oder metaphorische Bedeutung)
Objektor (Kenner Aktionsziel)
Quantor (Kenner für Ausprägungen)
Relator (Kenner für Relationen)
Temporator (Kenner für Zeitbezüge, Zeitrelator)
Situator (Kenner für typische Situationen)
Numerator (Kenner für Zahlen)
Mensurator (Kenner für Maßeinheit)
Residuator (Kenner für Rest- und Auffangkategorie)
- Beziehung zum SENDER, Einstellungen, Erfahrungen, Erwartungen, Motivation,
Ziele, Affektivität, Bewußtseinsstatus, Befinden, Verfassung
INTERPRETATION
DURCH DEN EMPFÄNGER
- Intention des SENDERs verstanden versus mißverstanden
- Interessegeleitete Situation versus neutraler oder wahrheitsmotivierter
Situation
- Meinung, Affekte, Verhalten
MODERATOR
REGELN (Meta-Kommunikation)
- Rollen-Parameter, Situations-Parameter, Regeln, "Spiele"
_
Wir wollen diesen abstrakten Zweig der GIPT-Kommunikationstheorie nun
wieder verlassen und therapierelevantere Gesichtspunkte betrachten.
4.1.7.4 Klassifikation von Kommunikationssegmenten nach beabsichtigter Hauptwirkung
Die zwischen PatientIn und PsychotherapeutIn stattfindende Kommunikation läßt sich grob einteilen in Hauptkategorien, spezifische Leistungen und in die ganz konkreten praktischen Umsetzungsmittel.
4.1.7.4.1 Die allgemeinen Hauptkategorien psychologisch- psychotherapeutischer Leistung
Ziele erkennen oder klären, Probleme verstehen, Lösungen herbeiführen (Erkennen, Verstehen, Verändern) auf dem Boden und im Rahmen einer tragfähigen Beziehung (aufbauen und pflegen). Die Hauptkategorien kennzeichnen so etwas wie den Psychotherapieraum (GRAWE 1994, 1995 > Kap. 5.6.1.1.(1), S. 292).
4.1.7.4.2. Spezifische Leistungen:
Sie richten sich nach den spezifischen Heilmitteln (Atome, Moleküle, komplexe Moleküle, Programme, Meta-Programme), die zur Anwendung gelangen (Indikation, Therapieplan) > Kap. 3, Lexikon der Heilmittel. Hier geht es dann z. B. um solche Fragen, wie eine Entspannung gelernt und durchgeführt wird, wie ein bestimmtes Problem durchgearbeitet wird, wie man die Erinnerung an Problemsituationen, sich einer unangenehmen Situation stellen fördern oder was man tun kann, um sich zu einer unangenehmen Aufgabe zu überwinden.
4.1.7.4.3 Die praktischen kommunikativen Umsetzungshilfsmittel
Hier geht es nun um die ganz konkreten und praktischen Lenkungsmittel im Therapieprozeß, um den Therapieplan zu verwirklichen; im Detail: Anleiten, anregen, beraten, Beispiel erfragen oder geben, bestätigen, bekräftigen, beurteilen, bewerten (evaluieren), deuten, empathisch reagieren, erklären, Feedback geben, fragen, hinweisen, humorvoll reagieren, informieren, ironisieren, Interesse zeigen, kommentieren, konfrontieren, Kritik üben, loben, orientieren, provozieren, spiegeln, suggerieren, trainieren, übereden, übertreiben, umdeuten, überzeugen, unterstützen, vormachen (Lernen am Modell), zeigen.
Literatur: ARBEITSGRUPPE BIELEFELDER SOZIOLOGEN (1981, Hg.). Aristoteles (~335, Dt. 1966). Aschenbach, G. (1984). Bandler, R., Grinder, J. (1981, 1982, 1983). Bodenheimer, A. R. (1984). Cherry, C. (1967). Engelkamp, J. (1974). Fast, J. (1971). Flader Et Al. (1982). Goeppert, S. & H. C. (1973). Hayakawa, S. I. (Dt. 1967). Henne, H., Rehbock, H. (1979). Hörmann, H. (1978). Kamlah, W., Lorenzen, P. (1967). Köhnken, G. (1990). Lang, N. (1983, Hg.). Lay, R. (1980). Lorenzer, A. (1976). Morris, C. W. (1981). Morris, D. (1986ab). Pontalis, Laplanche (1973). Röhrich, L. (1977). Samuels et al. (1991). Scheflen, A. E. (1976). Scherer, K. R., Wallbott, H. G. (1979, Hg.). Schneider, W. (1979). Schulz Von Thun, F. (1981). Schütz et al. (1979, 1984). Watzlawick, P. (1969, 1976, 1977, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986, 1988). Weber, W. (1976). Whorf, B. L. (1963).
4.1: Logische Gliederung nach Handbuch. Anmerkung: Im Handbuch wird einleitend ausgeführt: "In diesem Kapitel werden drei für die Psychotherapie ganz besonders wichtige Themen untersucht: das zentrale Medium der Psychotherapie, die Kommunikation; der zentrale Rahmen, der sie wesentlich konstituiert, moduliert und innerhalb dessen sie sich abspielt: die therapeutische Beziehung; sowie der Gesichtspunkt der Entwicklung und des Verlaufs: der therapeutische Prozeß."
_______________
(E1) Hervorhebungen in fett und italic von Sponsel. Diese Zeilen widerlegen die angebliche Nondirektivität der AnalytikerIn bereits durch des Meisters eigene Worte. Man muß gar nicht erst den gesunden Menschenverstand, eigene Beobachtung oder Psychotherapieforschung bemühen, um die nondirektive Propaganda zu entlarven. TherapeutInnen beeinflussen immer. Und wer sich das nicht eingestehen und verantwortlich handhaben kann, sollte den Psychotherapieberuf nicht ergreifen. Er belügt sich, seine PatientInnen und die Gesellschaft. Ein solches Verhalten auch noch mit Krankenkassengeldern zu belohnen, erscheint paradox und absurd.
_______________
(E2) Wir entnehmen diese Information Jay HALEY (dt. 1978, orig. 1963), Epilog "Die Kunst der Psychoanalyse", S. 246 - 257. Die 3-bändige Potterstudie soll nie veröffentlicht worden und nur in einigen Exemplaren ausgesuchten Persönlichkeiten zugänglich gemacht worden sein. Die Zusammenfassung bei HALEY ist ein einzigartig vernichtendes Dokument über eine vollendete Pathologie der zwischenmenschlichen Beziehung, die beansprucht zu heilen.
_______________
(E3) Interpretiert hört sich das so an: "... Eine vollständige Definition des >terminus technicus< »Oneupmanship« würde ein ziemlich umfangreiches Lexikon füllen, ja, hat es bereits gefüllt. Dieser unübersetzbare Begriff kann hier knapp als die Kunst definiert werden, einen anderen »one-down« zu setzen. Der Terminus »one-down« wird technisch als jener psychologische Zustand definiert, in dem sich ein Individuum befindet, das nicht »one-up« ist." (a. a. O., S. 246) Im folgenden wird der ganze analytische Prozeß und seine Theorie unter diesem Gesichtspunkt der »Oneupmanship« beißend ironisch analysiert.
_______________
(E4) TOMAN gebraucht die Formulierung "für den klassischen Psychotherapeuten", meint aber die Psychoanalyse FREUDscher Orientierung. Wir machen das mit unserer Wortwahl eutlicher.
_______________
(E5) So sucht man auch im Basislehrbuch "Verhaltenstherapie - Theorien und Methoden - von HEYDEN, T. et al. (19957) im Sachregister das Stichwort "Kommunikation" vergeblich. Der dicke Band von WILSON, G. T. et al. (1989) ignoriert das Thema "Kommunikation", auch im Kapitel 8 "Klinische Fragen und Strategien in der verhaltenstherapeutischen Praxis". Immerhin wird das Problem des Widerstandes gesehen und man wagt mittlerweile von einer Integration psychoanalytischer Ansätze in die Verhaltenstherapie zu sprechen (a. a. O., S. 445).
_______________
(E6) Es ist aber nicht meine Aufgabe, die Kommunikationstheorie der Gestalt-Therapie über ihre Kontakt-Theorie zu interpretieren. Das sollen die Gestalt-VertreterInnen selber tun.
_______________
(E7) Die Autorinnen unterscheiden vier Aspekte von Interaktionen: (1) den Impuls-/Bedürfnis-Aspekt, (2) den Beziehungs-Aspekt, (3) den Kommunikations- Aspekt, (4) den Kooperations- und Konsens-Aspekt. [S. 158]. Kommunikation wird hier traditionell- semantisch und nicht systematisch WATZLAWICKisch verstanden.
_______________
(E8) begründet von Charles S. PEIRCE (1839 - 1914).
_______________
(E9) DOPP (1969, S. 31 Fußnote)
______________
(E10) Das Zeichen " " ist der Kenner (Identifikator) dafür, daß in der Sprache L-PSYCHO gesprochen wird. " KS" bedeutet Kommunikationselement SENDER in der Bedeutung der Sprache L-PSYCHO.
Standort: Kommunikationstheorie in der IP-GIPT.
*
* Kommunikationsregeln für Nahestehende * Kritik, ein wichtiges soziales Heilmittel *
Allgemeines und Integratives Psychologisch-Psychotherapeutisches Manifest.
Beispiele Lenkungsmittel im Leben, Kommunikation, Beratung, Training und Therapie.
Übersicht wichtige sozialpsychologische Heilmittel.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Kommunikation site:www.sgipt.org. * Therapiekonzept site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
- Überblick der Signaturen: Dokumentations- und Evaluationssystem Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
- Über den Aufbau einer präzisen Wissenschaftssprache in Psychologie, Psychopathologie, Psychodiagnostik und Psychotherapie
- Übersicht Wichtige Sozialpsychologische J Heilmittel
- Beziehung, Beziehungen, Beziehungstheorie, Taxonomie und Klassifikation der Beziehungen in der GIPT
- Welten und die Konstruktion unterschiedlicher Wirklichkeiten in der GIPT
- Die grundlgenden Probleme und Aporie jeglicher Einzelfall- und damit Therapieforschung. Grundzüge einer idiographischen Wissenschaftstheorie
- Spezielle Theorie und Praxis der Vergleichbarkeit und des Vergleichens von Psychotherapiesystemen. 13 GIPT-Kriterien und Fehlermöglichkeiten vergleichender Psychotherapieforschung
- Allgemeine und Integrative Symboltheorie
- Überblick Arbeiten zur Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung
Sponsel, Rudolf (DAS). Allgemeine und Integrative Kommunikationstheorie. Aus der Abteilung Kommunikation. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/kom/giptkom.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Mail:_ sekretariat@sgipt.org_ Zwei wichtige Hinweise
end-korrigiert am:
30.01.19 Nachtrag der Quelle.
27.08.15 Linkfehler geprüft und korrigiert.
06.01.06 Kleine Korrekturen. Layout. Links.