(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=21.04.2014 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 18.06.19
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail: sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_Problemfeld Rechtsbegriffe_Datenschutz_ Überblick_ Rel. Aktuelles_ Rel. Beständiges _ Titelblatt_ Konzeption_ Archiv_ Region_ Service_iec-verlag _ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Problemfeld Rechtsbegriffe
aus der Perspektive eines forensischen
Sachverständigen
Originalarbeit von Rudolf
Sponsel, Erlangen
_
_
Abstract
- Zusammenfassung - Summary
Rechtsbegriffe, unbestimmte Rechtsbegriffe und Generalklauseln.
> Materialien.
Zwei Hauptbedeutungen des Wortes Rechtsbegriff
Der Wort Rechtsbegriff ist mindestens zweitdeutig:
(1) Als Begriff von Recht_BvR,
also das, was unter Recht verstanden werden soll (> Hörster
1987, Sieckmann 2018) oder (2) ein Begriff
des Rechts_BdR
aus der Rechtssprache, oft ein Tatbestandsmerkmal, z.B. ein rechtsrelevanter
Sachverhalt in einem Gesetz. Auf dieser Seite geht es um die Rechtsbegriffe
als Begriffe aus der Rechtssprache und nicht um den Begriff des Rechts.
Die Gerichts- und Rechtssprache ist deutsches Kauderwelsch
Die Gerichtssprache ist nicht deutsch (§ 184 GVG), sondern deutsches
Kauderwelsch - bestehend aus meist unbestimmten Rechtsbegriffen, Alltagssprache,
Bildungs- und Fachsprachen-Begriffen, aber man weiß meist nicht hinreichend
sicher, was nun aus welcher Sprache ist, weil es an klaren Kennzeichnungen
fehlt (die schon Herberger & Simon 1980, S. 271 vorschlugen). Man fragt
sich daher, was oder mit welchem Verständnis die RechtswissenschaftlerInnen
eigentlich arbeiten, wenn ein solches verwirrendes Begriffs-Durcheinander
das Resultat ist. Alljährlich werden Zigtausende von Seiten Papier
produziert mit dem Ergebnis, dass sich das Begriffs-Durcheinander stetig
vermehrt. Im forensisch psychologisch-psychopathologischen Bereich sind
die grundlegenden Unklarheiten eine Katastrophe. Ziel dieser Arbeit ist
es daher, das Problemfeld Gerichtssprache zu analysieren und daraus erste
Vorschläge zur Überwindung des verwirrenden Begriffs-Durcheinanders
zu entwickeln mit dem Oberzielen Klarheit, Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit,
Kontrolle. Hierzu ist auch eine Beispielsammlung von (Rechts-) Begriffen
aus Rechtstexten in Arbeit, in denen die Begriffe nach ihrer mutmaßlichen
Sprachbedeutung indiziert werden: alltagssprachlicher, bildungsprachlicher,
fachsprachlicher oder Rechtsbegriff.
Grundfragen zur Rechtsbegriffsbildung
- Wie entsteht aus einem Begriff ein Rechtsbegriff? Darüber findet man in rechtswissenschaftlichen Büchern und juristischen Methodenlehren meist nichts.
- Wer hat die Befugnis oder Kompetenz zur Rechtsbegriffsbildung? Darüber findet man in rechtswissenschaftlichen Büchern meist nichts.
- Wie geht die Bildung eines Rechtsbegriffs, wie muss sie erfolgen, vonstatten gehen?
- Werden die drei Dimensionen der Rechtsbegriffsbildung bzw. Definition (Name, Inhalt, Referenz) erkannt und benannt? > Semiotisches Dreieck.
- Wird kritisch gesehen, dass Rechtsbegriffsbildung häufig durch bloße nominalistische Benennung und Behauptung frei phantasiert und gemeint wird, statt Inhalt und Referenz des Rechtsbegriffs zu begründen?
- Wird erörtert, woran man einen Rechtsbegriff erkennt?
- Wird erörtert, ob und wie Rechtsbegriffe kenntlich gemacht werden sollen?
- Wird der Indizierungsvorschlag von Herberger & Simon (1980), S. 271 erörtert?
Woran kann man einen Rechtsbegriff erkennen ?
Das Recht hat bislang keinerlei Kennzeichen für einen Rechtsbegriff entwickelt, was dem Sinn des Eingangszitates widerspricht. Dabei wäre das ganz einfach zu lösen, z.B. durch Kursiv-, Fett Formatierung oder Indizierung, wie schon von Herberger & Simon 1980, S. 271 vorgeschlagen. Der Laie muss also meist raten. Gänzlich unproblematisch oder einfach ist es natürlich, wenn ein Begriff ausdrücklich ein Rechtsbegriff genannt wird (Beispiel). Das ist aber in Entscheidungen eher selten, in Kommentaren kommt es hingegen öfter vor. Im Regelfall muss man sich aus der Textumgebung mühsam und unsicher erschließen, ob ein Begriff gerade als Rechtsbegriff verwendet wird oder nicht. In Entscheidungen kann als Kriterium dienen, wenn die Merkmale eine Begriff in der Entscheidung erörtert werden (Beispiel). Sehr viele Rechtsbegriffe finden sich in Gesetzestexten, aber sie werden auch dort nicht als solche gekennzeichnet. Woher soll der Laie nun also wissen, ob hier gerade von einem Rechtsbegriff, Alltagsbegriff, Bildungsbegriff oder Fachbegriff gesprochen wird? Das weite und unklare Feld der Rechtsbegriffe ist ein einzigartiges Chaos, das dem Gebot der Verständlichkeit, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle völlig entgegengesetzt ist.
1. Was ist ein Rechtsbegriff
?
Die einfachste Antwort lautet: Ein Rechtsbegriff ist ein Begriff, wie
ihn das Recht versteht. Definiert kann und darf man nicht sagen, weil die
übergroße Mehrheit der Rechtsbegriffe aus sog. unbestimmten
Rechtsbegriffen besteht, die gerade nicht definiert, sondern bestenfalls
grob charakterisiert sind.
Im Prinzip begegnen uns in Wissenschaft und Leben
folgende grundlegenden Typen von Begriffen: Alltagsbegriffe, bildungssprachliche
Begriffe, fachliche und fachwissenschaftliche Begriffe. Die Rechtsbegriffe
gehören zu den Fachbegriffen, die den Wenigsten außerhalb des
Rechtssystems bekannt sind, weil sie von ihrer Wortform her nicht als solche
erkennbar sind (Wörter sind die
Kleider - und nicht selten
die Verkleidungen - der Begriffe). Das ist die erste große und verheerende
Sprachsünde der Justiz und Rechtswissenschaft.
Das Problem am Beispiel: "Einwilligungsfähigkeit
als “schwammiger Rechtsbegriff”. Der Vorsitzende des Hartmannbundes Dr.
Klaus Reinhardt wird im Ärzteblatt zitiert mit: „Bei der vermeintlich
so einfachen Bestimmung der Einwilligungsfähigkeit des Patienten treten
in der täglichen Praxis Tausende Grenzfälle auf“, sagte der HB-Vorsitzende.
Es sei inkonsequent und inakzeptabel, Ärzte aufzufordern, die Einwilligungsfähigkeit
der Patienten zu bestimmen, ihnen aber als Grundlage dafür nur schwammige
Rechtsbegriffe an die Hand zu geben. [Original DÄB 23.7.2012] Sekundär-Quelle:
psychiatrienogo am August 1, 2012 in Zwang und Gewalt]
Mit dieser Kritik ist ein Wesensmerkmal von den
meisten Rechtsbegriffen benannt, nämlich ihre Unbestimmtheit, Ungefährheit
("Schwammigkeit") und, der positive Aspekt, ihre Offenheit und Anpassungsfähigkeit
für die Vielfalt des Lebens, die Zug um Zug durch die Rechtsprechung
konkreter ausgefüllt und bestimmt wird. Kurz und bündig könnte
man sagen: Rechtsbegriffe - und zwar fast alle - sind nur teilbestimmte
und offene Begriffe. Vielleicht wäre die Gattungsbezeichnung Entwicklungsbegriffe
richtig.
Ein Begriff wird zum
Rechtsbegriff, wenn er aus der Perspektive von Recht und Gesetz betrachtet,
beurteilt und bewertet wird. Dabei gehen u.U. manche Merkmale "verloren",
manche werden anders gesehen, beurteilt und bewertet, neue kommen vielleicht
hinzu. Das rechtlich Beachtliche
an einem Begriff macht einen beliebigen Begriff zu einem Rechtsbegriff.
_
| Zum Wesen des Rechtsbegriffs gehört die rechtliche Wertung, nämlich welche Merkmale oder Sachverhalte für rechtlich bedeutsam bzw. für nicht bedeutsam betrachtet werden. Denn ob, wie sehr und welche Sachverhalte für rechtlich bedeutsam angesehen werden, ist natürlich eine Wertung (Auswahl). Das kann man z.B. sehr schön am Beispiel - vom Recht nicht anerkannter - relativer Geschäftsfähigkeit sehen: Ob jemand einem Rechtsgeschäft geistig gewachsen ist, hängt im wesentlichen von folgenden Faktoren ab: 1) der geistigen Fähigkeit, 2) der Komplexität und Kompliziertheit des Rechtsgeschäfts und 3) von der Erfahrung mit solchen Rechtsgeschäften. Das dürfte für die sachliche Erfahrungsebene fast jeder einsehen. Das Bestreiten natürlich auch JuristInnen nicht. Wohl aber die rechtliche Bedeutsamkeit und das ist eine Wertung, angeblich aus Gründen der sog. Rechtssicherheit, was die Gerissenen und Skrupellosen begünstigt und die weniger Intelligenten, Erfahrenen oder Gebildeten benachteiligt. |
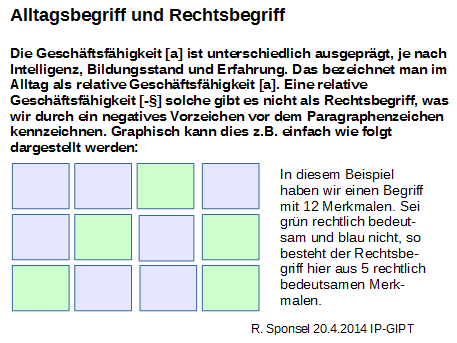 |
Es geht um Deutungshoheit oder
Definitionmacht
Den JuristInnen geht es hierbei um die Deutungshoheit oder Definitionsmacht,
die sie sich unter keinen Umständen nehmen oder einschränken
lassen wollen. Die rechtliche Bedeutsamkeit ist
reine Rechts-
und JuristInnensache. In diesem Anspruch stecken sowohl Machtanmaßung
als auch Willkür. Denn die Unabhängigkeit der dritten Gewalt
kann ja nicht bedeuten, dass es im demokratischen Rechtsstaat keinerlei
Kontrolle des Rechtssystems mehr gibt.
Die Justiz bedient sich bei schwierigeren Sachfragen
sog. Sachverständiger. Ihre Aufgabe ist es, Sachverhalte zu erforschen
("Befundtatsachen") und für die Justizorgane nachvollziehbar und schlüssig
aufzubereiten. Die rechtliche Bewertung, was von den Sachverhalten als
rechtlich bedeutsam angesehen wird, ist Sache der Justizorgane, also in
erster Linie des Gerichts.
Ein Rechtsbegriff ist daher ein Begriff, der die
rechtlich bedeutsamen Merkmale eines Begriffs umfasst und die rechtlich
nicht bedeutsamen vernachlässigt.
| Definition: Rechtsbegriffe
sind erstens mehr oder weniger teilbestimmte und damit offene
Begriffe (unbestimmte, Entwicklungsbegriffe), die durch die Rechtsprechung
im Laufe der Zeit konkreter ausgefüllt und näher bestimmt werden.
Rechtsbegriffe sind fiktionale Ideale, die praktisch nie erfüllt sind,
die nur näherungsweise erreicht werden können.
Zweitens wird ein Begriff zu einem Rechtsbegriff, wenn er unter rechtlichen Gesichtspunkten beurteilt und bewertet wird. Drittens sind Rechtsbegriffe direkt nicht als solche erkennbar, weil sie in Form und Ausdruck nicht kenntlich gemacht werden, obwohl es ein Leichtes wäre, dies zu tun. Ob ein Begriff als Rechtsbegriff gebraucht wird, ergibt sich gewöhnlich nur aus dem Kontext. Das sind die Gründe für die vielen Verständnisprobleme zwischen JuristInnen und anderen, u.a. auch Sachverständigen. Das Recht erfüllt damit ein wichtiges Gebot nicht, nämlich verständlich zu sein. Daher ist auch die Formel "Im Namen des Volkes" eine Anmaßung und falsch. Politisch funktionell dient die Erfindung und letztliche Beliebigkeit der Rechtsbegriffe der Macht der JuristInnen. Was von der Welt als rechtlich bedeutsam angesehen wird, ist sozusagen Sache der JuristInnen, was sehr tief und grundlegend in Politik, Gesellschaft und Individuum eingreift. Es könnte sein, dass die Grundidee von letztlich offenen Begriffen, die der Vielfalt des Lebens entgegenkommen und damit auch der Lebenserfahrung, dass man nicht alles perfekt und vollständig erfassen kann, richtig ist. Man umreißt einen Sachverhalt ungefähr und lässt für den Einzelfall offen, ob das ungefähr Gemeinte hier nun zutrifft, wie sehr oder nicht. Wir sehen ja auch im Alltag, dass Kommunikation gerade mit den unscharfen Begriffen ziemlich gut funktionieren kann. |
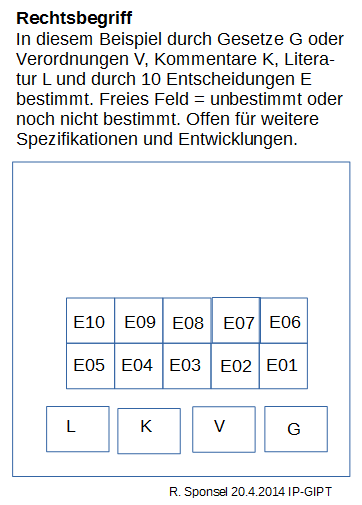 |
2. Was sind
unbestimmte Rechtsbegriffe und sog. Generalklauseln ?
Unbestimmte Rechtsbegriffe wie z.B. Treu und Glauben, Lärm,
Zuverlässigkeit, Dunkelheit, Kindeswohl, schuldfähig sind,
wie die Bezeichnung schon sagt, nicht genau und klar, sondern inhaltlich
offen und werden durch die Rechtsprechung mehr und mehr präzisiert,
wobei das grundlegende Problem darin besteht, dass jeder Einzelfall seiner
Natur nach einmalig ist und daher wiederum keine Allgemeingültigkeit
beanspruchen kann. Hier ist das Recht
widersprüchlich.
Eine genaue Betrachtung zeigt, dass unbestimmte
Rechtsbegriffe im Grunde bloße Worthülsen sind, die JuristInnen
mit projektiver Phantasie füllen, die meist nicht mitgeteilt wird.
Als praktisches Beispiel für eine solche leere Worthülse mag
der Begriff der "hinreichenden Wahrscheinlichkeit
des Bundesverwaltungsgerichts" dienen. In 17 untersuchten Entscheidungen
von 2002 bis 2016 bleibt "hinreichende Wahrheinlichkeit" eine leere
Worthülse.
Rechtssprechung und Rechtswissenschaft finden für
ihre Arbeit offensichtlich "Variable" (Worthülsen") ohne echte, operational
nachvollziehbare Bedeutung nützlich und wichtig. Man gebraucht Worte,
denen die Begrifflichkeit und damit die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit
fehlt. Wie ein solches Vorgehen mit dem Anspruch von "wissenschaftlich"
einhergehen kann, ist mir unverständlich. Ich kann darin auch kein
"Recht" oder eine "Rechtssicherheit" erkennen. Die Justiz phantasiert sich
eine projektive Geisterwelt zusammen, die dem gesunden
Menschenverstand und der Wissenschaft entzogen ist. Sehr praktisch,
dann ist und bleibt man unter sich.
3. Die Widersprüchlichkeit
des Rechts > Rechtswissenschaft
ohne Rechtsbegriff.
Das Recht beansprucht Klarheit, Verständlichkeit, Berechenbarkeit,
Zuverlässigkeit und damit Sicherheit. Das alles wird
durch die Schwammigkeit, Unbestimmtheit und Offenheit der Rechtsbegriffe
und Juristensprache gerade nicht gewährleistet, sondern das Gegenteil.
Das sprachliche Chaos sorgt erst richtig für Rechtsunsicherheit. Und
es wird zudem extrem schlecht kommuniziert, was eine unverständliche
Gleichgültigkeit gegenüber dem Volk und der Gesellschaft zum
Ausdruck bringt.
4.
Eine einfache Lösung des sprachlichen Problems: Indizierung.
Den Worten sieht man es aber nicht an, für welche Bedeutung sie
gerade stehen, welchen Begriff sie gerade repräsentieren. Worte als
die Kleider der Begriffe bergen gewöhnlich vielfältige
Begriffe und sind genau betrachtet vielfache Homonyme,
sogar bei ein und demselben Menschen, dessen Wissen und Kognitionen ja
auch im Fluss und von seiner Situation abhängig sein können.
Die Begriffsindizierung wurde bereits 1980, S. 271 von Herberger &
Simon vorgeschlagen.
Eine erste lebenspraktische Einteilung könnte
wie folgt aussehen:
- alltagssprachliches Bedeutungsfeld: Kennungsvorschlag "a" als Index oder Kennzeichner in Klammern hinter dem Wort [a]
- bildungssprachliches Bedeutungsfeld (Lexika): Kennungsvorschlag "b" als Index oder Kennzeichner in Klammern hinter dem Wort [b]
- fachliches oder fachwissenschaftliches Bedeutungsfeld spezifiziert nach Arbeits- und Berufsfeldern und nach Wissenschaften: Kennungsvorschlag "f" als Index oder Kennzeichner in Klammern hinter dem Wort [f], spezifiziert z.B. psychologisch [psy], forensisch psychologisch [fpsy], denkpsychologisch [dpsy], psychopathologisch [ppath], psychiatrisch [piat], mathematisch [math]. chemisch [chem], physikalisch [physik], linguistisch [lin], Begriff aus dem Umfeld Betreuung [betr]
- juristische Bedeutung: die Rechtsbegriffe durch ein Paragraphzeichen [§]
Wie wird aus einem Begriff ein Rechtsbegriff?
Die Frage liest sich einfach, sie wird aber in der Rechtswissenschaft
nicht gestellt und daher auch nicht beantwortet (Belege).
Eine Liste der Rechtsbegriffe sollte eigentlich vom Bundesjustizministerium
oder den höchsten Gerichten (BVerfG, BGH, BVerwG, BFH, ...) öffentlich
geführt weerden. Darin sollte auch unter besonderer Berücksichtigung
von § 184 GVG erklärt sein, wie aus einem Begriff ein Rechtsbegriff
wird und wer die Befugnis hat, Rechtsbegriffe zu bilden?
Wer hat die Befugnis Rechtsbegriffe zu
bilden?
Auch diese Frage wird von der Rechtswissenschaft nicht gestellt und
daher auch nicht beantwortet (Belege).
_
Zur Ergänzung oder
Vertiefung der Rechtsbegriffproblematik möchte ich auf folgende
Ausarbeitungen verweisen:
- In der wissenschaftstheoretischen Analyse rechtswissenschaftlicher Arbeiten werden bei 20 AutorInnen die Kategorien Begriffsbildung im allgemein wissenschaftlichen Sinne, juristische Begriffsbildung, Rechtsbegriffe und unbestimmte Rechtsbegriffe ausgewertet.
- Exkurs zum juristisches Denken und seinem naiv-unkritischen Universaliengebrauch.
- Exkurszusatz Erklärung des Kommunikationsparadoxes: Weshalb funktioniert der naiv-unkritische Universaliengebrauch so gut in der Praxis?
- Exkurs II: Das sprachliche Grundproblem zwischen Juristen und Nicht-Juristen und seine Lösung.
- Die Lösung des sprachlichen und begrifflichen Grundproblems.
- Formale Hilfsmittel der interdisziplinären Begriffsanalyse, Korrespondenz- und Zuweisungsregeln.
Materialien zum RechtsbegriffBvR als Begriff vom Recht
Hörster 1987 * Klein 1990 * Sieckmann (2018) *
_
Auswertung Hoerster 1987
Fundstellen für "Rechtsbegriff" (RS 14p fett markiert):
| 01 S. 181: "... Worum es in der Allgemeinen Rechtslehre vor allem geht, soll dieser Aufsatz zeigen; denn der Rechtsbegriff, der sein Thema bildet, steht in ihrem Mittelpunkt. ..." | An dieser Stelle ist noch unklar, in welcher Bedeutung "Rechts- begriff" gebraucht wird. |
| 02 S. 182: "III. Rechtsbegriff
und normative Verbindlichkeit"
S. 182 FN "3) Hierzu eingehend die modernen Darstellungen von Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 1982, und Koch-Rüßmann, Juristische Begründungslehre, 1982. Vgl. auch Hoerster, JuS 1985, 665 ff |
wie 01
|
| 03 S. 184: "IV. Rechtsbegriff
und Moral "
S. 184: "Selbst wer der hier vertretenen Auffassung von einem begrifflich notwendigen Zusammenhang zwischen Recht und Zwang zustimmt, muß sich mit der oben angeführten zweiten These zur spezifischen Charakterisierung einer Rechtsordnung auseinandersetzen. Denn es könnte sein, daß der Rechtsbegriff in einem notwendigen Bezug sowohl zur Moral als auch zur Androhung und Anwendung von Zwang aufzufassen ist, daß also eine gewisse Übereinstimmung mit der Moral ein zusätzlich erforderliches Element des Rechtsbegriffs ist. Die Frage nach dem begrifflichen Verhältnis von Recht und Moral steht im Zentrum des Streites um die Richtigkeit des sogenannten „Rechtspositivismus". Anhänger des Rechtspositivismus, wie die oben genannten Denker Kelsen, Ross und Hart, sind der Meinung, daß der Rechtsbegriff moralneutral, d. h. so zu definieren sei, daß in seine Verwendung nicht bereits im Wege der Definition moralische Elemente eingehen. Sie lehnen eine begriffliche Verknüpfung und damit einen logisch notwendigen Zusammenhang zwischen Recht und Moral ab. Rechtsnormen können nach ihrer Auffassung jeden beliebigen (moralischen oder unmoralischen) Inhalt haben; sie büßen auch dadurch ihren Charakter als Rechtsnormen nicht ein, daß sie etwa Maßnahmen anordnen, die die meisten von uns als extrem ungerecht oder unmoralisch betrachten würden. Man denke etwa, um besonders deutliche Beispiele zu nennen, an staatliche Gesetze, die Sklaverei oder Rassendiskriminierung zum Inhalt haben." |
wie 01, Tendenz Rechtsbegriff im Sinne
von Begriff vom Recht.
|
| 04 S. 185: "Dieser Einwand mag bei oberflächlicher Betrachtung plausibel wirken. Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, daß er an der Sache vorbeigeht. Das ist aus mindestens zwei Gründen der Fall. Erstens beruht der Einwand auf einer gewaltigen Überschätzung jener Wirkung, die der Rechtsphilosoph durch die Art und Weise, wie er den Rechtsbegriff definiert, auf das Verhalten des Bürgers (ob Jurist oder Laie) nehmen kann. Tatsächlich geht der durchschnittliche Bürger einer bestimmten Rechtsgemeinschaft, sofern in einem konkreten Fall mit unmoralischem Recht konfrontiert, bei seiner Reaktion entweder von dem positivistischen, moralneutralen oder von dem antipositivistischen, moralbehafteten Rechtsbegriff aus. Oder aber, was wohl noch wahrscheinlicher ist, er schwankt zwischen beiden Begriffen hin und her - ohne sich dabei über seinen insoweit inkonsequenten Sprachgebrauch überhaupt klar zu werden. In jedem Fall dürfte das Sprachverhalten des durchschnittlichen Bürgers (einschließlich des praktizierenden Juristen) in dieser Frage weitgehend unreflektiert, ja zufällig sein. Die Annahme nun, der Rechtsphilosoph könne dieses Sprachverhalten durch seine in einem wissenschaftlichen Kontext vertretenen Defmitionen wesentlich beeinflussen, erscheint als einigermaßen naiv. Selbst wenn der Kritiker des Rechtspositivismus also mit seiner These, ein moralbehafteter Rechtsbegriff verdiene im praktischen Rechtsleben den Vorzug, Recht haben sollte: Der Rechtsphilosoph ist kaum die geeignete Instanz, der Durchsetzung eines solchen Rechtsbegriffs in der Bevölkerung in nennenswertem Maße Vorschub zu leisten. Wenn überhaupt jemand, so dürften schon eher der Medienvertreter und der Politiker hierzu in der Lage sein." | Es sieht so aus, als würde Rechtsbegriff
im Sinne von Begriff vom Recht, verwendet.
|
| 05 S. 186: "Zweitens und entscheidend: Ist denn die Annahme, wonach ein moralbehäfteter Rechtsbegriff im praktischen Rechtsleben den Vorzug verdient, überhaupt gerechtfertigt? Sie wäre sicher dann gerechtfertigt, wenn die Verwendung eines solchen Rechtsbegriffs der einzige oder doch der geeignetste Weg wäre, die Berücksichtigung wichtiger Moral- und Gerechtigkeitsforderungen im praktischen Rechtsleben sicherzustellen. Dies ist aber in Wahrheit nicht der Fall; es gibt im Prinzip einen sehr viel wirksameren Weg, das gewünschte Ziel zu erreichen. Dieser Weg besteht darin, die betreffenden Forderungen von vornherein zum Bestandteil der geltenden Rechtsordnung zu machen. Das kann prinzipiell auf zweierlei Weise geschehen. Erstens kann man die Forderungen (vollständig oder teilweise) im einzelnen in die Rechtsordnung aufnehmen. Diesen Weg hat unsere eigene Rechtsordnung beispielsweise insoweit gewählt, als sie in ihrer geschriebenen Verfassung, dem Bonner Grundgesetz, einen Katalog individueller Grund- und Freiheitsrechte enthält, die man sämtlich wohl auch als wichtige Forderungen der Moral ansehen kann. Zweitens kann man in die Rechtsordnung an bestimmten Punkten durch Verwendung einer Generalklausel einen generellen Verweis auf gewisse Prinzipien bzw. Anschauungen der Moral oder der Gerechtigkeit aufnehmen. Auch dieses Mittels hat sich unsere eigene Rechtsordnung bedient - etwa insoweit sie im Bürgerlichen Gesetzbuch auf die „guten Sitten" oder auf „Treu und Glauben" verweist. Beide Wege können also nebeneinander beschritten werden" | Auch in dieser Textstelle sieht es so
aus, als würde Rechtsbegriff im Sinne von Begriff vom Recht, verwendet.
|
| 06 S. 186: "... Der Rechtspositivist wird allerdings
darauf bestehen, daß eine solche Einverleibung moralischer
Forderungen ins Recht keinesfalls eine notwendige Konsequenz des Rechtsbegriffs ist, sondern allein von der Ausgestaltung der jeweiligen konkreten Rechtsordnung abhängt. Um das an einem Beispiel zu verdeutlichen: Ebenso wie eine Rechtsordnung etwa die Institution der Skalverei unmittelbar verbieten oder nicht verbieten kann, so kann sie auch einen verbindlichen Verweis auf die entsprechende moralische Norm enthalten oder nicht enthalten. ..." |
Auch in dieser Textstelle sieht es so
aus, als würde Rechtsbegriff im Sinne von Begriff vom Recht, verwendet.
|
| 07 S. 186: "Der Gegner des Rechtspositivismus hat mit seiner Diagnose, daß das Individuum unmoralische Rechtsnormen oft nicht ändern kann, ohne Zweifel recht. Eine andere Frage ist, ob er auch die geeignete Therapie anbietet. Er möchte das Problem durch seine Definition des Rechtsbegriffs offenbar auf einen Schlag und für alle möglicherweise unmoralischen Rechtsordnungen gleichzeitig lösen. Damit macht er sich die Sache jedoch zu einfach. Denn man kann durch die bloße Definition eines Begriffes nicht die Wirklichkeit ändern. Ein moralisch fragwürdiges, aber im Rahmen der geltenden Rechtsordnung erlassenes Gesetz besitzt nun einmal - ob der Rechtsphilosoph es als „gültiges Recht" bezeichnet oder nicht - von seiner Unmoral abgesehen sämtliche Eigenschaften, die auch ein moralisch einwandfreies Gesetz besitzt: Es ist im Einklang mit der geltenden Verfassung zustandegekommen. Es wird vom Rechtsstab angewendet und durchgesetzt. Und wer ihm (etwa wegen seiner Unmoral) den Gehorsam verweigert, muß mit den üblichen Konsequenzen einer Rechtsverletzung rechnen. All diese Fakten lassen sich auch dadurch, daß man sich für die antipositivistische, moralbehaftete Definition des Rechtsbegriffs entscheidet, nicht aus der Welt schaffen." | Auch in dieser Textstelle sieht es so
aus, als würde Rechtsbegriff im Sinne von Begriff vom Recht, verwendet.
|
| 08 S. 187: "... Im Fall der Rechtsordnung scheint nun aber dem Gegner der rechtspositivistischen Trennungsthese ein Begriff, der eine solche wertneutrale Aufgabe erfüllen könnte, nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Er versäumt es jedenfalls regelmäßig zu sagen, welches gebräuchliche Wort unserer Sprache den von ihm moralisch aufgeladenen Rechtsbegriff in seiner wertneutralen Funktion ersetzen könnte. ..." | Auch in dieser Textstelle sieht es so
aus, als würde Rechtsbegriff im Sinne von Begriff vom Recht, verwendet.
|
| 09 S. 187: "... Wenn man eine bestimmte Maßnahme als „Unrecht" bezeichnet, bringt man damit offenbar zwar ein moralisches Unwerturteil zum Ausdruck, nicht aber auch, daß diese Maßnahme im Einklang mit einer faktisch geltenden Rechtsordnung steht. Andererseits stehen dem Rechtsethiker oder Rechtspolitiker hinreichend viele und eindeutige sprachliche Mittel zur Verfügung, die es ihm ermöglichen, auch auf der Basis eines positivistisch wertneutralen Rechtsbegriffs seinem moralischkritischen Anliegen Ausdruck zu geben: Er kann eine geltende Rechtsordnung insgesamt oder eine einzelne gültige Rechtsnorm unter moralischem Aspekt ohne weiteres etwa als „unrichtig", „ungerecht" oder „illegitim" bezeichnen sowie die moralische Forderung aufstellen, ihr keinen Gehorsam zu leisten. ..." | Auch in dieser Textstelle sieht es so
aus, als würde Rechtsbegriff im Sinne von Begriff vom Recht, verwendet.
|
| 10 S. 187: "Diese und ähnliche, mögliche rechtsethische Grundauffassungen wären zu klären und auf ihre Akzeptabilität hin kritisch zu untersuchen. Vor dieser Aufgabe steht der Rechtspositivist ebenso wie sein Gegner. Nur: Der Rechtspositivist erörtert diese Fragen unverschleiert als das, was sie sind, nämlich Fragen der Ethik. Sein Gegner dagegen läuft nicht nur Gefahr, ihren ethischen Charakter zu verdecken, indem er sie durch Definition in den Rechtsbegriff verlagert. Er bringt dadurch den Rechtsbegriff auch unvermeidlich in Abhängigkeit von schwierigen und kontroversen rechtsethischen Positionen. Warum will man die Allgemeine Rechtslehre, nachdem man sie als eigenständige Disziplin mit spezifischen Fragestellungen innerhalb der Rechtsphilosophie etabliert hat, noch zusätzlich mit den - im Ursprung ganz andersartigen - Problemen der Ethik belasten? | Auch in dieser Textstelle sieht es so
aus, als würde Rechtsbegriff im Sinne von Begriff vom Recht, verwendet.
|
| 11 S. 187: Um die rechtspositivistische Sichtweise noch einmal in einem zentralen Punkt zu verdeutlichen: Es geht dem Rechts- positivisten bei seiner moralneutralen Definition des Rechts- begriffs keineswegs, wie ihm nicht selten von Kritikern unterstellt wird, darum, irgend jemandem (ob dem normalen Bürger oder dem Richter) in irgendeiner Rechtsordnung irgendwelche Normen - nämlich die von ihm jeweils als „Recht" bezeichneten - in normativer Absicht zur Befolgung zu empfehlen und damit in Wahrheit irgendwelche mit den Normen verbundenen Werte - sei es auch nur den generellen Wert der Rechtssicherheit - zu propagieren. Der Rechtspositivist enthält sich vielmehr, insoweit er den Rechtsbegriff definiert, gegenüber den betreffenden Normen und ihrer Befolgung jeder eigenen Wertung. Er bringt durch seine Definition lediglich zum Ausdruck, daß die betreffenden Normen, insoweit er sie als „Recht" bezeichnet, vom Standpunkt derjenigen aus, die die betreffende Rechtsordnung akzeptieren und ihr damit zur Geltung verhelfen, einen Wert darstellen und Befolgung verlangen. Sein eigener Standpunkt bleibt ein ausschließlich extern beschreibender. Er möchte das betreffende rechtlich normierte Verhalten durch seine Definition so wenig beeinflussen wie etwa der Sportexperte, der das Golfspiel und seine Regeln analysiert und erläutert - was ja ebenfalls nicht ausschließt, daß dieser Experte das Spiel auch selbst praktiziert und möglicherweise den Regeln gegenüber gut begründete Änderungswünsche hat. | Auch in dieser Textstelle sieht es so
aus, als würde Rechtsbegriff im Sinne von Begriff vom Recht, verwendet.
|
| 12 S. 187: Daß der Rechtspositivist durch seinen Rechtsbegriff nicht das Sozialverhalten der Bürger beeinflussen möchte, bedeutet allerdings nicht, daß er mit diesem Rechtsbegriff lediglich das Ziel verfolgte, einen unter den Bürgern faktisch herrschenden Sprachgebrauch kritiklos wiederzugeben. Abgesehen davon, daß eine theoretisch so komplexe Frage wie die hier anstehende („Verwendet der deutsche Sprachbenutzer einen moralneutralen Rechtsbegriff oder nicht?") kaum eine einheitliche Antwort zulassen dürfte: Der Sprachgebrauch des durchschnittlichen Sprachbenutzers ist häufig derart wenig durchdacht und konsequent, daß er, so wie er ist, dem Bedürfnis des Wissenschaftlers nach Klarheit und innerer Folgerichtigkeit nicht genügen kann. Unter diesen Umständen ist es nicht nur legitim, sondern sogar wün[>188] schenswert, eine sprachliche Festsetzung vorzunehmen, die gegenüber dem vorgefundenen Sprachgebrauch eine Präzisierung und Korrektur enthält." | Auch in dieser Textstelle sieht es so
aus, als würde Rechtsbegriff im Sinne von Begriff vom Recht, verwendet.
|
| 13 S. 187: Daß der Rechtspositivist durch seinen Rechtsbegriff nicht das Sozialverhalten der Bürger beeinflussen möchte, bedeutet allerdings nicht, daß er mit diesem Rechtsbegriff lediglich das Ziel verfolgte, einen unter den Bürgern faktisch herrschenden Sprachgebrauch kritiklos wiederzugeben. Abgesehen davon, daß eine theoretisch so komplexe Frage wie die hier anstehende („Verwendet der deutsche Sprachbenutzer einen moralneutralen Rechtsbegriff oder nicht?") kaum eine einheitliche Antwort zulassen dürfte: Der Sprachgebrauch des durchschnittlichen Sprachbenutzers ist häufig derart wenig durchdacht und konsequent, daß er, so wie er ist, dem Bedürfnis des Wissenschaftlers nach Klarheit und innerer Folgerichtigkeit nicht genügen kann. Unter diesen Umständen ist es nicht nur legitim, sondern sogar wün[>188] schenswert, eine sprachliche Festsetzung vorzunehmen, die gegenüber dem vorgefundenen Sprachgebrauch eine Präzisierung und Korrektur enthält." | Auch in dieser Textstelle sieht es so
aus, als würde Rechtsbegriff im Sinne von Begriff vom Recht, verwendet.
|
| 14 S. 188: "Der Rechtspositivist ist der Auffassung, daß sein moralneutraler Rechtsbegriff insofern besser, nämlich zweckmäßiger als ein moralbehafteter Rechtsbegriff ist, als er eher eine eindeutige und durchsichtige Formulierung und Erörterung der wichtigsten theoretischen und moralisch-praktischen Themen und Probleme im Zusammenhang mit dem sozialen Phänomen des Rechts gestattet. Der Vorschlag mancher Gegner des Rechtspositivismus, in theoretischen Disziplinen wie der Rechtsgeschichte und der Rechtssoziologie einen moralneutralen, in praxisrelevanten Disziplinen wie der Rechtsethik sowie im politischen Alltag dagegen einen moralbehafteten Rechtsbegriff zugrundezulegen, ist in der Sache unbegründet und würde nur Verwirrung stiften: Es ist dasselbe soziale Phänomen einer staatlichen Zwangsordnung, das wir in theoretischer Absicht zu beschreiben und zu erklären suchen und mit dessen Wert oder Unwert wir uns in moralisch-praktischer Absicht auseinandersetzen. | Auch in dieser Textstelle sieht es so
aus, als würde Rechtsbegriff im Sinne von Begriff vom Recht, verwendet.
|
| 15 V. Zusammenfassung
Die Lehre vom Rechtsbegriff steht im Zentrum der Allgemeinen Rechtslehre, die zusammen mit der Rechtsethik und der Juristischen Methodenlehre den Gegenstandsbereich der Rechtsphilosophie bildet. Recht kann defmiert werden als eine stufenförmig strukturierte Normenordnung, die in einer Gesellschaft Verbindlichkeit besitzt, Ausübung von physischem Zwang vorsieht und sich anderen derartigen Normenordnungen gegenüber im Konfliktsfall durchsetzt. Moralische Forderungen in den Rechtsbegriff aufzunehmen und damit die Grenzziehung zwischen Allgemeiner Rechtslehre und Rechtsethik zu verwischen, erweist sich als unzweckmäßig. Denn auch ein Phänomen, das man unter wertendem Aspekt kritisieren oder ändern möchte, sollte man zunächst so, wie es sich in der Realität darstellt, zur Kenntnis nehmen und beschreiben" |
Hier gibt es keinen Zweifel, dass Rechtsbegriff
im Sinne von Begriff vom Recht, verwendet wird.
|
Ergebnis-Analyse Hörster
(1987)
Was Hörster unter Rechtsbegriff versteht, wird eingangs nicht
definiert. Spätestens ab der 04. Textstelle ist jedoch klar, dass
es hier nicht um Rechtsbegriffe geht, sondern um den Begriff von Recht.
Kaufmann, Arthur (1994) Rechtsbegriff und Rechtsdenken. Archiv für Begriffsgeschichte.| Archiv für Begriffsgeschichte - Bd. 37, 21 - 100.
"Das Wort »Recht" hat verschiedene Bedeutungen. Da ist zum einen
die Unterscheidung von Recht im objektiven Sinn als der Rechtsnormen, die
das soziale Leben verbindlich regeln, und Recht im subjektiven Sinn als
der Befugnisse,
die die Rechtsnormen gewähren. Zum anderen versteht man unter
»Recht" einerseits abstrakt-allgemeine Regeln, die eine Mehrzahl
möglicher Fälle normieren, andererseits aber das konkrete Recht,
das durch Anwendung jener Regeln auf den Einzelfall, also durch Rechtsprechung
und überhaupt durch rechtes Handeln entsteht."
Den Rechtsbegriff als Begriff des Rechts, aus der
Rechtssprache, erwähnt Kaufmann gar nicht.
Rechtswissenschaft ohne Rechtsbegriff (Klein 1990)
Im gesamten Inhaltsverzeichnis taucht das Wort "Rechtsbegriff" tatsächlich nicht auf. Ob der Titel so gemeint war? Der Autor kommt in seiner Untersuchung in seinem Schlußwort zu dem vernichtenden Ergebnis:
- "Kelsen hat darauf hingewiesen, daß die 'Aufgabe wissenschaftlicher
Erkenntnis nicht nur darin (besteht), Fragen, die wir an sie richten,
zu beantworten, sondern uns auch zu lehren, welche Fragen wir an sie als
sinnvoll richten können.' [FN1]
Nicht 'sinnvoll' an das menschliche Denken können Fragen nach einem 'richtigen', 'gerechten', 'legitimen' oder 'geltenden' Recht gerichtet werden, auch nicht Fragen nach einer 'Normlogik', nach 'Ansprüche stellenden Werten', einer 'vorschreibenden Vernunft', einem 'objektiven Rechtsgefühl', 'objektiven Gemeingeist', einem wandelbaren oder absoluten 'Naturrecht', nach 'fordernden Ideen' oder einer 'gedachten Grundnorm' - um nur einige Beispiele zu nennen.
Stellen die traditionellen Rechtslehren nicht nur diese Fragen, sondern geben sie auch positive Antworten auf ein 'richtiges Recht', benutzen sie nicht nur Scheindefinitionen [FN2] und 'Leerworte', sondern ergehen sich auch in Zirkeln, Widersprüchen, Tautologien und Pleonasmen. ..."
Sieckmann, Jan Reinhard (2018) Rechtsphilosophie. Tübingen: Mohr Siebeck.
S.5f: "B. Der Begriff des Rechts
Unklare Verwendungen.
Materialien RechtsbegriffRS als Begriff der Rechtssprache
Rechtsbegriff im DRL Deutschen Rechts Lexikon
2001
"Rechtsbegriflf ist ein zur Darstellung einer rechtlichen Sollensanordnung
verwendeter Begriff. Er kann überwiegend Begriff der besonderen Rechtssprache
oder überwiegend Begriff der Allgemeinsprache sein. Er kann sehr abstrakt
oder sehr konkret sein.
Innerhalb der Rechtsbegriffe unterscheidet man vor
allem —> deskriptive (beschreibende) und —> normative (wertungsbedürftige)
Tatbestandsmerkmale. Außerdem stehen neben den bestimmten Rechtsbegriffen
die unbestimmten Rechtsbegriffe, welche zu ihrer Anwendung einer näheren,
durch —> Auslegung zu gewinnenden Bestimmung bedürfen (zB Gemeinwolil,
öffentliche Sicherheit und Ordnung, öffentliches Interesse),
wobei im Falle von wertungsbedürftigen unbestimmten Rechtsbegriffen
nicht nur ein Ergebnis gefunden werden kann, sondern wegen des notwendigerweise
mit ihnen verbundenen Beurteilungsspielraums mehrere verschiedene Ergebnisse
möglich sind (zB Eignung eines Kindes für höhere Schule),
was wiederum eine Einschränkung des Umfangs der gerichtlichen Überprüfung
nach sich zieht. (Kö)!
Materialien unbestimmter RechtsbegriffRS
- Karl Engisch (1956)
S. 108f:
"1.) Unter einem unbestimmten Begriff [FN118b] verstehen wir einen Begriff, dessen Inhalt und Umfang weitgehend ungewiß ist. Absolut bestimmte Begriffe sind innerhalb des Rechts selten. Immerhin dürfen hierher die auch im Recht verwendeten Zahlbegriffe (insbesondere in der Verbindung mit Maß- und Zeit- und Geldbegriffen) gerechnet werden (50 km, Frist von 24 Stunden, 100 DM). Überwiegend sind die Rechtsbegriffe wenigstens teilweise unbestimmt. Dies gilt z. B. schon von solchen in das Recht übernommenen natürlichen Begriffen wie „Dunkelheit", „Nachtruhe", „Lärm", „Gefahr", „Sache". Es gilt noch mehr von den eigentlichen Rechtsbegriffen wie „Mord", „Rechtswidrigkeit", „Verbrechen", „Verwaltungsakt", „Rechtsgeschäft" usw. Mit Philipp Heck [FN119] kann man bei den unbestimmten Begriffen einen Begriffskern und einen Begriffshof unterscheiden. Soweit wir uns über Inhalt und Umfang der Begriffe im Klaren sind, haben wir es mit dem Begriffskern zu tun. Wo die Zweifel sich einstellen, beginnt der Begriffshof. Daß in einer mondscheinlosen Nacht um die zwölfte Stunde im nichterleuchteten Freien in unseren Breiten Dunkelheit herrscht, ist klar; Zweifel erregen z. B. die Stunden der Dämmerung. Daß Grundstücke, Möbel, Lebensmittel „Sachen" sind, ist über jeden Zweifel erhaben; anders steht es etwa mit der Elektrizität oder einer Rauchfahne (Reklameschrift) am Himmel. Daß mit der glücklichen Vollendung der Geburt eines Kindes menschlicher Eltern ein „Mensch" im Rechtssinn vorhanden ist, ist sicher, ob und wann da gegen schon während des Geburtsvorganges (nach Einsetzen der Wehen) ein „Mensch" (und nicht mehr bloß eine „Leibesfrucht") vorhanden ist, ist nicht so sicher; die Frage wird sogar für verschiedene Rechtsteile verschieden beantwortet: nach bürgerlichem Recht haben wir einen „rechtsfähigen" Menschen erst nach Vollendung der Geburt vor uns, während nach strafrechtlicher Beurteilung schon „während der Geburt" (aber von welchem Moment an?) ein „Mensch" da ist, der Gegenstand eines Mordes oder Totschlags oder einer fahrlässigen Tötung sein kann. Unbestimmte Begriffe können aber innerhalb der Rechtssätze nicht nur im sog. „Tatbestand" vorkommen, sondern auch innerhalb der „Rechtsfolge". Ein Beispiel bietet § 231 StPO: dem in der Hauptverhandlung erschienenen Angeklagten gegenüber kann der Vorsitzende „die geeigneten Maßregeln treffen", um seine Entfernung zu verhindern."
Unbestimmte RechtsbegriffeRS nach Raabe et al. (2012) S. 226f
"10.2.3.6 Unbestimmte Rechtsbegriffe
Unbestimmte Rechtsbegriffe sind Begriffe, zu welchen der Gesetzgeber
keine Definitionsansätze mitliefert und deren Symbol auch nicht unmittelbar
allgemeinverständlich oder einer Fachsprache entlehnt ist. Allerdings
ist das Symbol aus Worten zusammengesetzt, die eine allgemein- oder fachsprachliche
Bedeutung haben. Der Gesetzgeber erzeugt ein Kunstwort, welches auf dem
klassischen Weg der juristischen Auslegung (vgl. Abschn. 4.2.2) geschärft
werden muss. Bei der Prüfung des Wortlautarguments wird das Kunstwort
zunächst in seine Bestandteile zerlegt und deren Bedeutung ermittelt.
Auf dem Wege des systematischen Arguments wird dann der Kontext berücksichtigt,
in welchem der Gesetzgeber den unbestimmten Rechtsbegriff einsetzt. Hierdurch
können eine Reihe möglicher Interpretationen bereits ausgeschlossen
werden. Das historische Argument liefert Hinweise auf die konkreten Beispiele,
die der Gesetzgeber bei der Prägung des unbestimmten Rechtsbegriffs
vor Augen hatte. Über das teleologische Argument kann anschließend
auf weitere, möglicherweise durch die Veränderung der Lebenswirklichkeit
hinzu gekommene Beispiele geschlossen werden.
Am Ende des Auslegungsprozesses steht ein Ergebnis,
welches Ähnlichkeiten zu einem Typus aufweist. So lassen sich am Ende
der Prüfung des Wortlaut- und systematischen Arguments oftmals Merkmale
angeben, die für jede Instanz des Begriffs notwendig sind. Ferner
sind aus den Beispielen des historischen und teleologischen Arguments hinreichende
Merkmalskombinationen herleitbar. Ein Beispiel für einen unbestimmten
Rechtsbegriff sind die „sachlichen Verhältnisse“ in § 3 Abs.
1 BDSG.
Aufgrund der Notwendigkeit der Auslegung sind die Anforderungen des
nachfolgenden Abschnitts für wertbehaftete Begriffe auch auf unbestimmte
Rechtsbegriffe übertragbar. Viele unbestimmte Rechtsbegriffe sind
nicht nur unbestimmt, sondern haben gleichzeitig wertenden Charakter. Hier
wäre als Beispiel das „schutzwürdige Interesse“ aus § 28
Abs. 1 BDSG zu nennen. Hinsichtlich der Darstellung des Ergebnisses der
Auslegung kann aufgrund der Ähnlichkeit zu Typenbegriffen auf die
dort genannten Anforderungen verwiesen werden.
Anforderung R.10.2.3.2.d (Reduktion des unbestimmten Rechtsbegriffs)
ID |
R.10.2.3.2.d |
|
Reduktion des unbestimmten Rechtsbegriffs |
Beschreibung |
Ein unbestimmter Rechtsbegriff muss durch Auslegung auf einen Typus mit Regelbeispielen reduziert werden. |
Beispiel |
Die „sachlichen Verhältnisse“ in § 3 Abs. 1 BDSG stellen einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, der jedoch auf einen Typus reduzierbar ist, da sich einerseits Merkmale angeben lassen die notwendig sind (ein Verhältnis) und auch solche die hinreichend sind (eine Eigentums- oder Besitzbeziehung)." |
Quelle: Raabe, Oliver et al. (2012), S. 226
Duden Recht
"unbestimmter Rechtsbegriff
ein Begriff (z. B. »öffentliches Interesse«, »Eignung«,
»gute Sitten«), der nicht durch einen fest umrissenen Sachverhalt
ausgefüllt wird, sondern bei der Rechtsanwendung im Einzelfall präzisiert
werden muss. Ein u. R. erscheint, anders als das Ermessen im gesetzlichen
Tatbestand, nicht auf der Rechtsfolgenseite. Da es in rechtlicher Sicht
nur eine richtige Entscheidung geben kann, erfordert die Anwendung von
u. R. im Einzelfall eine Wertung und Abwägung der unterschiedlichen
Gesichtspunkte. Ihre Handhabung unterliegt der vollen richterlichen Überprüfung,
soweit nicht der Behörde ein Beurteilungsspielraum eingeräumt
ist."
Quelle: Duden Recht A-Z. Fachlexikon für Studium,
Ausbildung und Beruf. 3. Aufl. Berlin: Bibliographisches Institut 2015.
Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.
Beispiel Rechtsbegriff wichtiger Grund (Namensrecht) VG Stuttgart 1 S 1335/13: Familienname, Form, Namensrecht - 19.02.2014
Schlagworte: Sri Lanka, Wichtiger Grund, Zusicherung, Unbestimmter Rechtsbegriff, Familienname, Form, Anwendungsbereich, Namensrecht, Heimatstaat, Beschränkung
"a) Nach § 3 Abs. 1 NÄG darf der Name einer Person nur dann geändert werden, wenn ein wichtiger Grund die Änderung rechtfertigt. Die Voraussetzung des „wichtigen Grundes“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der in vollem Umfang der verwaltungsgerichtlichen Nachprüfung unterliegt (vgl. BVerwG, Urt. v. 29.09.1972 - VII C 77.70 - Buchholz 402.10, § 3 NÄG Nr. 32). Ein die Namensänderung rechtfertigender „wichtiger Grund“ liegt vor, wenn bei Abwägung aller dafür und dagegen streitenden Belange das schutzwürdige Interesse des die Namensänderung Beantragenden so gewichtig ist, dass es die Belange der Allgemeinheit, die vor allem in der sozialen Ordnungsfunktion des Namens und in dem sicherheitspolizeilichen Interesse an der Beibehaltung seines bisherigen Namens zum Ausdruck kommen, sowie die Interessen Dritter überwiegt (vgl. BVerwG, Urt. v. 05.09.1985 - 7 C 2.84 - NJW 1986, 740; Beschl. v. 01.02.1989 - 7 B 14.89 - Buchholz 402.10, § 11 NÄG Nr. 3; Urt. v. 26.03.2003 - 6 C 26.02 - Buchholz 402.10, § 11 NÄG Nr. 5). Bei der Abwägung sind die Wertungen des Bürgerlichen Gesetzbuches zum Namensrecht für den entsprechenden Lebensbereich zu berücksichtigen. Die öffentlich-rechtliche Namensänderung hat Ausnahmecharakter. Sie dient allein dazu, Unzuträglichkeiten zu beseitigen, die bei der Führung des nach bürgerlichem Recht zu tragenden Namens auftreten, nicht aber die Wertungen des bürgerlich-rechtlichen Namensrechts zu revidieren."
Quelle: https://www.jusmeum.de/urteil/vg_stuttgart/bb251b4889bd1f40ce105b62a3a7c13520e4e4dd94a3d380bd6662993c82b153?page=4
Einzelbeispiele für RechtsbesgriffeRS als Begriffe der Rechtssprache
Beispielsammlung
Rechtsbegriffe [Im Aufbau/ In Arbeit]
Beispiele- und Gegenbeispiele Organisation:
-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-
Zum tieferen Verständnis der Rechtsbegiffsproblematik ist eine
Sammlung von Beispielen und Gegenbeispielen
hilfreich, um den undurchdringlichen Begriffsbedeutungs- und -beziehungs-Dschungel
deutlich zu machen, wenn in der Erklärung eines Rechtsbegriffs wieder
zahlreiche andere auftauchen, die nicht kenntlich gemacht werden. Schnell
entstehen unübersichtliche Begriffsbeziehungsnetzwerke, wobei auch
manche Rechtsbegriffe als regelrechte geistige Ungetüme erscheinen,
z.B. der Rechtsbegriff "Eisenbahn".
Kurz und bündig ist ein Rechtsbegriff ein Begriff,
wie ihn "das" Recht versteht. Ein Rechtsbegriff enthält die
Merkmale, auf die es juristisch ankommt. Zu den Rechtsbegriffen zählen
eben diese, die sog. unbestimmten Rechtsbegriffe oder/und die Generalklauseln.
Die eindeutige Kennzeichnung als Rechtsbegriff erfolgt hier durch den Index
"§" in Abgrenzung zu den Alltagsbegriffena
[Index "a"], bildungssprachlichenb [Index "b"],
fachlichen und fachwissenschaftlichenf [Index "f"
], allgemein wissenschaftlichenwis [Index "wis"]
Begriffen.
Die meisten Rechtsbegriffe finden sich in den Gesetzen,
allerdings nicht ausgewiesen. Die Gesetzestexte, Kommentare, Entscheidungen
und rechtswissenschaftlichen Werke sind in deutschem Kauderwelsch verfasst.
Sie bestehen oft aus verschiedenen Sprachelementen: Alltägliche, bildungssprachliche,
Fachworte, Fremdworte und Rechtsbegriffe. Und daher sind die Forderungen
im Eingangszitat so gut wie nie erfüllt.
Auch gleichlautende Rechtsbegriffe, genau genommen
die Worte, können in verschiedenen Rechtsgebieten z.B. Zivilrecht,
Strafrecht, Öffentliches Recht auch Unterschiedliches bedeuten. Das
verkompliziert den Begriffsdschungel noch einmal. So ist der Mensch im
Strafrecht mit der Einleitung der Geburt rechtsbegrifflich ein Mensch,
während er im Zivilrecht erst mit dem Ende der Geburt rechtsbegrifflich
als Mensch existiert. Am unerträglichsten haust das Recht bei den
sog. unbestimmten Rechtsbegriffen, die den größten Teil der
Rechtsbegriffe abdecken. Und sehr unklar und nebelhaft sieht es bei den
forensisch-psychopathologischen Rechtsbegriffen aus, z.B. bei der Prozessfähigkeit§.
Literatur:
- Nomos-Verlag (2017) Taschen-Definitionen
- Tilch, Horst & Arloth, Frank (2001, Hrsg.) Deutsches Rechts-Lexikon.
Beispiele Rechtsgebietliche Spezifikationen (die sich überschneiden, unter- oder übergeordnet sein können):
Hinweis: Indizierungen in Zitaten von Rechtstexten sind von mir. Der Index "?" bedeutet unklar.
| Begriff§
Nicht näher spezifizierter
Rechtsbegriff Begriff§Arb Arbeitsrecht Begriff§Bau Baurecht Begriff§Btr Betreuungsrecht Begriff§Fam Ehe- und Familienrecht Begriff§Erb Erbrecht Begriff§EU Europarecht Begriff§Ha Handelsrecht |
Begriff§Int Internationales
Recht
Begriff§Med Medizinrecht Begriff§Miet Mietrecht Begriff§Öf Öffentliches Recht Begriff§Priv Privatrecht Begriff§Sch Schuldrecht Begriff§SR Sozialrecht Begriff§Steu Steuerrecht Begriff§Str Strafrecht |
Begriff§Urh Urheberrecht
Begriff§Vf Verfassungsrecht Begriff§Ver Verkehrsrecht Begriff§Verw Verwaltungsrecht Begriff§Völ Völkerrecht Begriff§Waf Waffenrecht Begriff§WPR Wertpapierrecht Begriff§WR Wirtschaftsrecht Begriff§Ziv Zivilrecht |
Anmerkung: beck-online [Abruf Feb 2015] erfasst die Teilgebiete: Arbeitsrecht, Bankrecht, Baurecht, Datenschutzrecht, Erbrecht, Energierecht, Europarecht, Familienrecht, Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht, Lebensmittelrecht, Miet- und Wohnungsrecht, Pharmarecht, Privatversicherungsrecht, Sozialrecht, Steuerrecht, Strafrecht, Umweltrecht, Verfassungsrecht, Vergaberecht, Verkehrsrecht, Versicherungsrecht, Verwaltungsrecht, Zivilrecht.
- "Ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen
oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Raumstrecken auf metallener
Grundlage, welche durch ihre Konsistenz, Konstruktion und Glätte den
Transport großer Gewichtmassen, beziehungsweise die Erzielung einer
verhältnismäßig bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung
zu ermöglichen bestimmt ist, und durch diese Eigenart in Verbindung
mit den außerdem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzten Naturkräften
(Dampf, Elektricität, thierischer oder menschlicher Muskelthätigkeit,
bei geneigter Ebene der Bahn auch schon der eigenen Schwere der Transportgefäße
und deren Ladung, u. s. w.) bei dem Betriebe des Unternehmens auf derselben
eine verhältnismäßig gewaltige (je nach den Umständen
nur in bezweckter Weise nützlich, oder auch Menschenleben vernichtende
und die menschliche Gesundheit verletzende) Wirkung zu erzeugen fähig
ist." Reichsgericht, Urteil vom 17.03.1879, RGZ 1, 247 (252)."
Anmerkung: Den Begriff Bahnhof problematisierte das Bayerische Staatsministerium für Finanzen 2005 (Q).
Gegenbeispiele Keine Rechtsbegriffe sollen z.B. sein:
- Mobbing "Der Begriff Mobbing ist
kein Rechtsbegriff, Schadensersatzansprüche wegen Mobbings gibt es
deshalb nicht. Erforderlich ist ggf. der Nachweis eines Schadensersatzanspruchs
z.B. gem. § 823 Abs. 1 BGB oder wenigstens einer > Belästigung
im Rechtssinne." Kortstock in Nipperdey Lexikon Arbeitsrecht, 23. Edition
2014
Quotenregelung, politischer, kein Rechtsbegriff nach Friedrich, Walter J. (1996)
_
Wissenschaftlicher Apparat:
- Aliprandis, Nikitas (1974) Rechtsgrundbegriffe und rechtliche Relevanz, Rechtstheorie 5 (1974), S. 47
- Avenarius, Hermann (1985) Kleines Rechtswörterbuch. Freiburg: Herder.
- Creifelds Rechtswörterbuch (2011). 20.A. München: C.H. Beck. [Inf]
- Blodig, Hermann (1894) Die Selbstverwaltung als Rechtsbegriff : Eine verwaltungsrechtl. Monographie. Leipzig: Braumüller.
- Breimesser, Florian Christof (2016) Urheberrecht und Rechtsbegriff : eine Untersuchung am Beispiel des Designrechts. 1. Auflage. Baden-Baden: Nomos.
- Bydlinski, Franz (1991) Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff (Auflage 1982 H20/PI 3010 B993)
- Canaris, Claus-Wilhelm & Larenz, Karl (2013) Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Berlin: Springer.
- Clauss, Karl: Zum Begriff der Unklarheit, JZ 1960, S. 306
- Coester, Michael (1983) Das Kindeswohl als Rechtsbegriff : die richterliche Entscheidung über die elterliche Sorge beim Zerfall der Familiengemeinschaft. Frankfurt am Main: Metzner.[Online]
- Creifelds Rechtswörterbuch PLUS
- Engisch, Karl (1956-2010) Einführung in das juristische Denken. Stuttgart: Kohlhammer (Urban TB)
- Engisch, Karl (1973) Begriffseinteilung und Klassifikation in der Jurisprudenz, Festschrift für Larenz. München: Engisch, Karl (1983) Formale Logik, Begriff und Konstruktion in ihrer Bedeutung und Tragweite für die Rechtswissenschaft, Festschrift für Klug. Köln:
- Engisch, Karl (1958) Die Relativität der Rechtsbegriffe, in: Deutsche Landesreferate zum V. internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in Brüssel 1958, Berlin:
- Engisch, Karl (1973) Begriffseinteilung und Klassifikation in der Jurisprudenz, Festschrift für Larenz, München.
- Forsthoff, Ernst (1964) Recht und Sprache, Prolegomena zu einer richterlichen Hermeneutik. Darmstadt:
- Frauenfelder, Max (1938) Das Geld als allgemeiner Rechtsbegriff : eine Untersuchung über das Verhältnis des rechtlichen zum wirtschaftlichen Begriff des Geldes.
- Friedrich, Walter J. (1986) Rechtskunde für jedermann. 5. Auflage. München: Beck.
- Friedrich, Walther J. (1996) Rechtsbegriffe des täglichen Lebens. München: Beck (dtv).
- Gerathewohl, Peter (1987) Erschließung unbestimmter Rechtsbegriffe mit Hilfe des Computers : ein Versuch am Beispiel der "angemessenen Wartezeit" bei § 142 StGB
- Geiger/Mürbe/Wenz (1996) Beck'sches Rechtslexikon. München: Beck/dtv.
- Glaser, Ivan () Sprachphilosophie und rechtswissenschaftliche Begriffsbildung, Jahrbuch Bd. 2, S. 246
- Griller, Stefan & Rill, Heinz Peter (2011) Rechtstheorie: Rechtsbegriff - Dynamik - Auslegung. Wien: Springer. [intvorh]
- Gutmann, Thomas (2001) Freiwilligkeit als Rechtsbegriff. München: Beck.
- Hart, H. L. A. (2011) Der Begriff des Rechts. Berlin: Suhrkamp.
- Hatz, Helmut (1963) Rechtssprache und juristischer Begriff : vom richtigen Verstehen des Rechtssatzes
- Haueisen, Fritz (1973) Zahlenmäßige Konkretisierung („Quantifizierung") unbestimmter Rechtsbegriffe,
- Herberger, Maximilian & Simon, Dieter (1980) Wissenschaftstheorie für Juristen. Logik — Semiotik — Erfahrungswissenschaften. Frankfurt: Metzner.
- Herberger, Maximilian (1983). Unverständlichkeit des Rechts. Anmerkungen zur historischen Entwicklung des Problems und des Problembewußtseins. Recht und Sprache, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 199, 1983, S. 19 - 39.
- Hoerster, Norbert (1987) Die rechtsphilosophische Lehre vom Rechtsbegriff. Jus 1987, 188.
- Jesch, Dietrich (1957) Unbestimmter Rechtsbegriff und Ermessen in rechtstheoretischer und verfassungsrechtlicher
- Kamitz, Reinhard jun. (2009) Rechtsbegriff und normenlogischer Handlungskalkül im Logiksystem nach Stig Kanger. Wien: Lit.
- Kantorowicz, Hermann (1963) Der Begriff des Rechts. Göttingen: Vandenhoeck.
- Kappeler, Alfred (1867) Der Rechtsbegriff des öffentlichen Wasserlaufs, entwickelt aus den Quellen des römischen Rechts.
- Kaufmann, Arthur (1994) RECHTSBEGRIFF UND RECHTSDENKEN. Archiv für Begriffsgeschichte
- Kelsen, Hans (1979) Allgemeine Theorie der Normen. Wien: Manz.
- Klein, Tilo Wilhelm (1990) Rechtswissenschaft ohne Rechtsbegriff. Kritische Anmerkungen zu traditionellen Lehren von Recht, Gesetz und Macht. Dissertation JurFak Marburg.
- Klüver, Jürgen (1981) Begriffsbildung in den Sozialwissenschaften und in der Rechtswissenschaft, in: Lübbe-Wolff, Gertrude: Rechtsfolgen und Realfolgen: Welche Rolle können Folgenerwägungen in der juristischen Regel- und Begriffsbildung spielen? Freiburg, München:
- Knöpfle, Robert (1966) Der Rechtsbegriff "Wettbewerb" und die Realität des Wirtschaftslebens. Köln ; München [u.a.] Heymann.
- Koch, Unbestimmte Rechtsbegriffe
- Koch, Hans-Joachim (1979) Unbestimmte Rechtsbegriffe undund Ermessensermächtigungen im Verwaltungsrecht, Eine logische und semantische Studie zur Gesetzesbindung der Verwaltung. Frankfurt a. M.:
- Koller, Peter (1997) Theorie des Rechts. Eine Einführung. Wien: Böhlau.
- Krawietz, Werner (1976, Hrsg.) Begriffsjurisprudenz. Darmstadt: WBG.
- Kucsko-Stadlmayer, Gabriele (1992) Rechtsnormbegriff und Arten der Rechtsnormen. In (21-35): Walter, Robert (1992, Hrsg) Schwerpunkte der Reinen Rechtslehre (= Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Bd 18). Wien: Manz.
- Kuntze, Johannes Emil (1892) Der Gesammtakt, ein neuer Rechtsbegriff. Leipzig: Veit. [Online]
- Lecheler, Helmut (1979) „Funktion" als Rechtsbegriff?, NJW, 2273.
- Liermann, Hans (1927) Das deutsche Volk als Rechtsbegriff im Reichs-Staatsrechte der Gegenwart
- Lübbe-Wolff, Gertrude (1981) Rechtsfolgen und Realfolgen: Welche Rolle können Folgenerwägungen in der juristischen Regel- und Begriffsbildung spielen? Freiburg, München:
- Luhmann, Niklas (1993), Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt (Suhrkamp).
- Maaßen, Wolfgang (1977) Privatrechtsbegriffe in den Tatbeständen des Steuerrechts, Zur Grundlegung
- Martens, Wolfgang (1969) Öffentlich als Rechtsbegriff Bad Homburg v.d.H. [u.a.]: Gehlen.
- Nienvetberg, Rüdiger: Rechtswissenschaftlicher Begriff und soziale Wirklichkeit, Berlin 1983
- Nomos-Verlag (2017) Taschen-Definitionen : Zivilrecht, Strafrecht, Öffentliches Recht. 3. A. Baden-Baden: Nomos
- Oertmann, Paul (1921) Die Geschäftsgrundlage : ein neuer Rechtsbegriff. Leipzig [u.a.]: Deichert
- Pawlowski, Tadeusz (1980) Begriffsbildung und Definition, Berlin, New York: de Gruyter (Sammlung Göschen)
- Petöfi, Janos S.; Podlech, Adalbert & Savigny. Eike von (1975, Hrsg.) Fachsprache, Umgangssprache. Kronberg/Ts.: Scriptor.
- Raabe, Oliver; Wacker, Richard; Oberle, Daniel; Baumann, Christian & Funk, Christian (2012) 10. Begriffliche Ebene. In: Oliver Raabe, Richard Wacker, Daniel Oberle, Christian Baumann und Christian Funk (2012) Recht ex machina. Formalisierung des Rechts im Internet der Dienste. Berlin: Springer.
- Rill, Heinz Peter (2011) Grundlegende Fragen bei der Entwicklung eines Rechtsbegriffs_BvR. In (1-19) Griller, Stefan & Rill, Heinz Peter (2011)
- Rittner, Fritz (1962) Unternehmen und freier Beruf als Rechtsbegriffe. Tübingen:
- Rüthers, Bernd (1999) Rechtstheorie. Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts. München: Beck.
- Rüthers, Bernd; Fischer, Christian & Birk, Axel (2015) Rechtstheorie. Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts. 8. A. München: Beck.
- Ryu, Paul L.; Silving, Helen & Piedras, Rio (1973) Was bedeutet die sogenannte „Relativität der Rechtsbegriffe“?: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy Vol. 59, No. 1 (1973), pp. 57-86.
- Saerbeck, Klaus (1974) Beginn und Ende des Lebens als Rechtsbegriffe Berlin [u.a.]: de Gruyter
- Schima, Hans (1968) Der unbestimmte Rechtsbegriff. Graz: Böhlau.
- Schrader, Paul Tobias (2017) Wissen im Recht : Definition des Gegenstandes der Kenntnis und Bestimmung des Kenntnisstandes als rechtlich relevantes Wissen. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Schröder, Heinz (1961) Der Rechtsbegriff der Gleichheit.
- Schubert, Thure(1999) Der Gemeinsame Markt als Rechtsbegriff : die allgemeine Wirtschaftsfreiheit des EG-Vertrages. München: Beck
- Schultz, Dietrich (1958) Der Rechtsbegriff der Genossenschaft und die Methode seiner richtigen Bestimmung : entwickelt am Problem der Produktivgenossenschaft. Düsseldorf: Triltsch
- Schultze, Hans-Dieter (1973) Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung als Rechtsbegriff : zur Rechtskontrolle von Raumordnungsplänen. Hannover: Jänecke.
- Schweizer Sektion Basel (2004) Menschenwürde als Rechtsbegriff : Tagung der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosopie (IVR), Schweizer Sektion Basel, 25. bis 28. Juni 2003. Tagung der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosopie (IVR). Stuttgart: Steiner
- Spohn, Wolfgang (1975) Theoretische Begriffe und explizit geregelte Sprachen, in: Petöfi/Podledd v. Savigny, Fachsprache.
- Tiedemann, Paul (2012) Menschenwürde als Rechtsbegriff: Eine philosophische Klärung. Berlin: BWV.
- Tilch, Horst & Arloth, Frank (2001, Hrsg.) Deutsches Rechts-Lexikon. 3 Bde: A-F, G-P, Q-Z München: Beck.
- Tilch, Horst & Arloth, Frank (2003, Hrsg.) Deutsches Rechts-Lexikon. Ergänzungsband zur 3. Auflage. München: Beck.
- Viotto, Regina (2009) Das öffentliche Interesse : Transformationen eines umstrittenen Rechtsbegriffs
- Weinberger, Ota (1970) Rechtslogik. Wien-New:
- Wiethölter, Rudolf (1982) Theoretische Ansätze. Entwicklung des Rechtsbegriffs (am Beispiel des BVG-Urteils zum Mitbestimmungsgesetz und - allgemeiner - an Beispielen des Sonderprivatrechts. In (38-59) Gessner, Volkmar & Winter, Gerd (1982, Hrsg.) Rechtsreformen der Verflechtung von Staat und Wirtschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag. [intvorh]
- Windhorst, Tobias (2001) Der Rechtsbegriff der "schweren Gesundheitsschädigung": zugleich ein Beitrag zum 6. StrRG. Frankfurt am Main [u.a.]: Lang.
- Wolf, Rainer (1986) Der unbestimmte Rechtsbegriff „Stand der Technik“: Zum Problemhorizont der Rechtswissenschaft, Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Forschung Band 75. Springer VS.
- Zezschwitz, Friedrich von (1967) Das Gemeinwohl als Rechtsbegriff.
vom richtigen Verstehen des Rechtssatzes. Stuttgart: Kohlhammer
NJW, 641.
Sicht, AöR 82, 163.
Vol. 37 (1994), pp. 21-100.
Berlin [u.a.]: Dümmler.
einer steuerrechtlichen Hermeneutik. Berlin:
Transformationen eines umstrittenen Rechtsbegriffs. 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos.
Lübbe-Wolff, Rechtsfolgen,
Schulze, Werner: Tatbestand und Rechtsfolge.
Ein Beitrag zur juristischen Erkenntnistheorie,
Berlin und Leipzig 1909.
Links (Auswahl: beachte)
Seiten, die ihre URL-Adresse geändert aber keine Weiterleitung eingerichtet haben, wurden entlinkt.
- "12. Die Beherrschbarkeit des Risikos ist ein unschwer zu konkretisierender unbestimmter Rechtsbegriff ..." [jusmeum]
- jusmeum: Urteile mit dem Schlagwort Unbestimmter rechtsbegriff: https://www.jusmeum.de/urteile?tag=unbestimmter+rechtsbegriff&page=1
- https://www.juraforum.de/lexikon/unbestimmter-rechtsbegriff
- Wörterbucher:
Glossar, Anmerkungen und Endnoten: > Eigener wissenschaftlicher Standort.
1) GIPT=
General
and Integrative
Psychotherapy, internationale Bezeichnung
für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Beachtlich§
Die Beachtlichkeitfunktion könnte geradezu als typische Funktion
angesehen werden, ein Begriffmerkmal zu einem rechtsbegrifflich bedeutsamen
Merkmal zu machen.
__
Begriff >
Literatur.
Zur Einstimmung eine Mahnung vor 2350 Jahren auch und gerade für
JustizJuristInnen (Entlehnt
von.)
|
|
welche ihre Gedanken untereinander austauschen wollen, etwas voneinander verstehen; denn wie könnte denn, wenn dies nicht stattfindet, ein gegenseitiger Gedankenaustausch möglich sein? Es muß also jedes Wort bekannt sein und etwas, und zwar eins und nicht mehreres, bezeichnen; hat es mehrere Bedeutungen, so muß man erklären, in welcher von diesen man das Wort gebraucht." Aus: Aristoteles (384-322) Metaphysik. 11. Buch, 5 Kap., S. 244 (Rowohlts Klassiker 1966). |
| Die erste Grundfrage lautet: was ist ein Begriff? Mit dieser
Frage befinden wir uns auf der sog. Metaebene. Hierauf gibt es verschiedene
Antworten, je nachdem, bei welcher Wissenschaft wir nachfragen.
Die allgemeinste und vernünftigste Bestimmung ist wohl: ein Begriff fasst Merkmale zum Zwecke der Unterscheidung von anderem zu einem Ganzen zusammen. Begriffe bilden spielt in vielen Wissenschaften eine Rolle. Der Vorgang der Begriffsbildung selbst gehört zur Psychologie. Denken heißt in meiner Konzeption: geistige Modelle bilden oder zueinander in Beziehung setzen. Begriff wird hier einem geistigen Modell oder Beziehungen zwischen solchen gleichgesetzt. Die benötigten Grundbegriffe sind Merkmal, unterscheiden und vergleichen, verbinden oder trennen zu einer Einheit: dem Begriff. Eine zentrale Rolle spielen Begriffe beim Definieren und der Definition. Die Terminologie ließe sich noch abstrakt vereinfachen. Denn im Grunde braucht man nur den Elementarbegriff Sachverhalt. |
 |
- Klassische Philosophie: Aristoteles; Definitionslehre nach Eisler: "Begriffsbestimmung, Abgrenzung des Inhaltes eines Begriffes von dem anderer, Angabe der Merkmale, die den Inhalt eines Begriffes constituieren, Bewußtmachung des Begriffsinhalts in einem Urteil. Die Nominaldefinition besteht darin, daß die Bedeutung eines Wortes durch Zurückgehen auf ein allgemeineres oder bekannteres geklärt wird. Die Realdefinition (Sacherklärung) gibt durch Zergliederung des Begriffs zugleich das Wesen (s. d.), das Typische, Allgemeine, Gesetzmäßige einer Gruppe von Objecten (das »genus proximum«) und dazu die besonderen, unterscheidenden Merkmale der Art (die »differentiae specificae«) an. ..."
- Wissenschaftstheorie: Nach G.G. in Mittelstraß, S 439: "Definition (griech. ..., lat. definitio, ursprünglich: Umgrenzung), im weitesten Sinne jede Art der Feststellung oder Festsetzung einer Zeichenverwendung. Das zu definierende (oder definierte) Zeichen heißt Definiendum (oder Definitum), das definierende Zeichen heißt Definiens. Man unterscheidet zwischen syntaktischen und semantischen D.en. Syntaktische D.en lassen die inhaltliche (semantische) Interpretation der Zeichen zunächst unberücksichtigt und regeln lediglich deren Gebrauch in formalen Kalkülen. Bedeutungsvoll werden diese Kalküle dann im nachhinein dadurch, daß die Zeichen einer semantischen Interpretation in Form bestimmter Zuordnungsdefinitionen (-> Korrespondenzregel) unterworfen werden. Insofern haben syntaktische D.en immer vorläufigen Charakter und gehen letztlich in semantische, die Bedeutung berücksichtigende D.en über. Im folgenden ist daher nur noch von semantischen D.en die Rede.
- Logik. Das Wörterbuch der Logik führt S. 119f aus: "Definition [definitio lat., Bestimmung]: ein Satz, der wesentliche und kennzeichnende Merkmale von Gegenständen angibt oder die Bedeutung des entsprechenden Terminus aufdeckt (s. a. Begriff I.). Oft wird in der D. auf die nächste Gattung hingewiesen, zu der der gegebene Gegenstand gehört, sowie auf den Artunterschied dieses Gegenstandes gegenüber allen übrigen Arten, die die Gattung bilden. ..."
- Mathematik. Im Duden Rechnen und Mathematik 5. A. 1994, S. 92: "Definition: Festlegung und Beschreibung eines Begriffs. Dabei benutzt man meistens einen umfassenderen Begriff (Oberbegriff) und gibt dann eine kennzeichnende Eigenschaft für den zu definierenden Begriff an.
- In der Logischen Propädeutik von Kamlah & Lorenzen (1973) wird S. 86 - nicht ganz einfach - ausgeführt: "§ 4. Lautgestalt, Bedeutung, Begriff (die Abstraktion)
Die semantischen D.en lassen sich einteilen in solche, die die Bedeutung eines Zeichens feststellen, und solche, die die Bedeutung eines Zeichens festsetzen. Feststellende D.en sind -> Aussagen über den faktischen Sprachgebrauch und können daher wahr oder falsch sein. Da man sie vor allem in Wörterbüchern und Lexika findet, heißen sie meist lexikalische D.en. Festsetzende D.en sind keine Aussagen und können daher auch nicht wahr oder falsch sein. Als -> Sprechakte betrachtet reichen sie von Willensbekundungen (z.B. in einem Vortrag ein bestimmtes Wort stets in einem bestimmten Sinne zu gebrauchen) und Selbstverpflichtungen - soweit der private Sprachgebrauch betroffen ist - über Aufforderungen und Empfehlungen bis zu verbindlichen Wortverwendungsnormen (z.B. in Form juristischer D.en) - soweit der öffentliche Sprachgebrauch betroffen ist. Einsprechend ihrem Status als Sprechakt kann eine festsetzende D. unterschiedlichen Bewertungen unterzogen werden. Die (negativen) Bewertungen reichen von »unzweckmäßig« und »irreführend« über »inadäquat« und »unbegründet« bis zu »manipulativ« und »unmoralisch« (wenn z.B. eine bestimmte Personengruppe per definititionem von bestimmten Rechten ausgeschlossen ist). Die in der Wissenschaftstheorie verbreitete Ansicht, daß festsetzende D.en »willkürlich« und daher lediglich nach Zweckmäßigkeitsgesichlspunkten beurteilbar seien, ist demnach nicht haltbar. ... "
Beispiel: Eine Raute (zu definierender Begriff) ist ein Parallelogramm (Oberbegriff) mit vier gleich langen Seiten (kennzeichnende Eigenschaft)."
Hat man die Verwendung eines Terminus auf eine der hier beschriebenen Weisen explizit vereinbart, so wird man von der Lautgestalt des Terminus unabhängig und kann sie durch ein anderes Zeichen ersetzen. Besonders gut sichtbar wird das an der Definition, die ja selbst bereits die Ersetzung eines sprachlichen Ausdrucks durch einen anderen angibt: Wurde z. B. „Terminus" in der angegebenen Weise definiert, so kann man nicht allein „explizit vereinbarter Prädikator" durch „Terminus" ersetzen, sondern man kann dieses Wort weiterhin ersetzen, z. B. durch ein anderssprachliches Wort. ...
Sehen wir nun von der Lautgestalt eines Terminus ab und achten nur auf seine normierte Verwendung (auch dann, wenn der Terminus durch Exempel und Prädikatorenregeln bestimmt wurde), so sprechen wir von einem B e g r i f f. ..."
Operationalisierung
- Vieles, was wir Seele und Geist zurechnen, ist nicht direkt beobachtbar.
Die Merkmale von Seele
und Geist sind Konstruktionen. Daher sind Aussagen über Seele
und Geist (befinden, fühlen, denken, wünschen, wollen, eingestellt
sein, ...) besonders anfällig für Fehler. Damit man sich nicht
in rein geistigen Sphären bewegt, ist es daher in vielen Fällen
sinnvoll, ja notwendig, unsere Konstruktionen seelischer Merkmale und Funktionsbereiche
an Konkretes, Sinnlich-Wahrnehmbares, Zählbares
zu knüpfen. Damit haben wir die wichtigsten praktisches Kriterien
für Operationalisiertes benannt (in Anlehnung an das test-theoretische
Paradigma; Stichwort Operationalisierung
bei Einsicht und Einsichtsfähigkeit)
Ein Begriff kann demnach als operationalisiert gelten, wenn sein Inhalt durch wahrnehm- oder zählbare Merkmale bestimmt werden kann. Viele Begriffe in der Psychologie, Psychopathologie, in Gesetzen und in der Rechtswissenschaft sind nicht direkt beobachtbare Konstruktionen des menschliches Geistes und bedürften daher der Operationalisierung. Welcher ontologischer Status oder welche Form der Existenz ihnen zukommt, ist meist unklar.
Das Operationalisierungsproblem von Fähigkeiten. Ob einer etwas kann oder nicht, lässt sich im Prinzip leicht prüfen durch die Aufforderung, eine Fähigkeitsprobe abzulegen in der eine Aufgabe bearbeitet wird, z.B. die Rechenaufgabe 12 - 7 + 1 = ? Hierbei gibt es eine ganze Reihe richtiger Lösungen, z.B.: (1) die Hälfte des ersten Summanden, (2) 5 + 1, 7 - 1 oder (3) die, an die die meisten zuerst denken: 6. Will man prüfen, ob jemand rechtmäßige von unrechtmäßigen Handlungen unterscheiden gibt kann, gibt man z.B. 10 Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vor und lässt diese bearbeiten, etwa als einfacher Ja-Nein-Test oder als Begründungs- oder Erörterungsaufgabe, wenn tiefere Einblicke gewünscht werden. Doch wie will man herausbringen, ob jemand vor drei Monaten, am TT.MM.JJJJ um 13.48 Uhr als man einen Gegenstand (z.B. einen Fotoapparat) in seiner Tasche wiederfand, wusste, dass dieser Gegenstand nicht in seine Tasche hätte gelangen dürfen?
> Drei Beispiele Innere Unruhe, Angst, Depression (Quelle)
| Merkmal (latente Dimension) | Operationalisierung(en) |
| (a) Innere Unruhe | Ich bin innerlich unruhig und nervös. |
| (b) Angst | Ich fühle Angst. |
| (c) Depression | Nicht selten ist alles wie grau und tot und in mir ist nur Leere. |
Hayakawa (1967) zitiert S. 241 Bridgman kurz und bündig: "Um die Länge eines Gegenstandes herauszufinden, müssen wir bestimmte physikalische Operationen vornehmen. Der Begriff der Länge wird daher festgestellt, wenn die Operationen, durch die die Länge gemessen wird, festgestellt sind .... Im allgemeinen verstehen wir unter irgend einem Begriff nicht mehr als eine Anzahl von Operationen; DER BEGRIFF IST SYNONYM MIT DER ENTSPRECHENDEN ANZAHL VON OPERATIONEN. "(3)"
Zur
Geschichte des Operationalisierungsbegriffs in der Psychopathologie
Kendell (1978) berichtet, S. 27f: "Vor einigen Jahren machte der Philosoph
Carl Hempel einem Publikum von Psychiatern und klinischen Psychologen,
die an Fragen der Diagnose und der Klassifikation interessiert waren, in
taktvoller Weise den Vorschlag, sie sollten das Problem dadurch angehen,
daß sie „operationale Definitionen" für alle die verschiedenen
Krankheitskategorien in ihrer Nomenklatur entwickelten (Hempel 1961). Dies
war wirklich der einzige Rat, den ein Philosoph oder Naturwissenschaftler
überhaupt hätte geben können. Der Ausdruck operationale
Definition wurde ursprünglich von Bridgman (1927) geprägt, der
ihn folgendermaßen definierte:
„Die operationale Definition eines wissenschaftlichen
Begriffes ist eine Übereinkunft des Inhalts, daß S auf alle
die Fälle - und nur auf die Fälle - anzuwenden ist, bei denen
die Durchführung der Testoperation T das spezielle Resultat 0 ergibt."
Wie Hempel selbst zugibt, muß im Rahmen der psychiatrischen Diagnose
der Ausdruck „operational" sehr großzügig interpretiert werden,
um auch noch bloße [>] Beobachtungen mit einschließen zu können.
Im Grunde genommen sagt er nicht mehr, als dass die Diagnose S auf alle
die Personen, und nur auf die, angewandt werden sollte, die das Merkmal
Q bieten oder die dem entsprechenden Kriterium genügen, wobei nur
die Voraussetzung erfüllt sein muß, daß O „objektiv" und
„intersubjektiv verifizierbar" ist und nicht nur intuitiv oder einfühlend
vom Untersucher erfaßt wird.
Daraus ergibt sich die Schwierigkeit, wie man eine
ganze Reihe klinischer Bilder, von denen viele quantitativ variieren und
kein einzelnes gewöhnlich ausreicht, die fragliche Diagnose zu stellen,
auf ein einziges objektives Kriterium 0 reduzieren kann. Dies ist offensichtlich
eine schwierige und verwickelte Aufgabe. Ein großer Teil dieses Buches
ist direkt oder indirekt mit der Art und Weise befaßt, wie dieses
Ziel erreicht werden könnte. Deshalb ist es angezeigt, an dieser Stelle
zwei allgemeine Prinzipien, die sich hierauf beziehen, aufzustellen. Erstens
müssen Einzelsymptome oder Merkmale, die verschiedene Ausprägungsgrade
haben können, in dichotome Variable umgewandelt werden, indem man
ihnen bestimmte Trennungspunkte zuteilt, so daß die Frage nicht länger
lautet: „weist der Patient das X auf? " oder auch „wieviel X weist er auf?
sondern „weist er soviel X auf? ". Zweitens muß das traditionelle
polythetische Kriterium in ein monothetisches umgewandelt werden. Dies
läßt sich ganz einfach durchführen. Anstatt zu sagen, die
typischen Merkmale der Krankheit S seien A, B, C, D und E, und die Mehrzahl
von ihnen müßte vorhanden sein, bevor die Diagnose gestellt
werden kann, müssen A, B, C, D und E algebraisch kombiniert werden,
sodaß eindeutig festgelegt ist, welche Kombinationen dem Kriterium
O genügen und welche nicht.
Man könnte z.B. die Übereinkunft treffen,
daß beliebige drei oder vier der fünf Merkmale dem Kriterium
0 genügen, aber andere, komplexere Kriterien wären ebenfalls
zu akzeptieren unter der Voraussetzung, daß sich jede mögliche
Kombination damit abdecken ließe."
Prozessfaehigkeit
Herz- und Kernstück der Frage der Prozess-UN-fähigkeit ist: Wie wird genau nachgewiesen, dass eine psychische Störung zu den fraglichen Zeiten, die psychopathologischen Entsprechungen der freien Willensbestimmung bei den Prozesshandlungen H1, H2, ..., .Hn aufgehoben hat? Blickt man in die psychopathologische Fachliteratur, stellt man erstaunt fest, dass die Prozesshandlungen selbst gar nicht genannt und gelistet werden - im Grunde ein untragbarer Zustand, weil sich Prozessfähigkeit ja nicht abstrakt feststellen lässt, sondern nur an konkreten operationalen Sachverhalten oder Handlungen gezeigt werden muss. Das Sachregister von Cording & Nedopil (2014) enthält keinen Eintrag "Prozesshandlung". Auch das Sachregister von Venzlaff & Foerster (2004) enthält keinen Eintrag "Prozesshandlung", ebenso nicht das fünfbändige Handbuch der Forensischen Psychiatrie.
Erschwerend kommt hinzu, dass Zweifel bei der Geschäftsfähigkeit oder Prozessunfähigkeit ungleiche Folgen haben. Während Zweifel an der Gechäftsfähigkeit diese nicht einschränken oder gar aufheben, ist dies bei der Prozessfähigkeit, jedenfalls nach herrschender Meinung, umgekehrt. Dies kritisiert: Musielak, HJ (1997). Die Beweislastregelung bei Zweifeln an der Prozessfähigkeit. NJW 50:1736–1741
__
Rechtssicherheit Der Rechtsbegriff Rechtssicherheit <=> Rechtssicherheit§ <=> Rechtssicherheit [§].
[hier sammle ich noch Material]
__
Unklare Verwendungen / Bedeutung
Wiethölter, Rudolf (1982) Theoretische Ansätze Entwicklung
des Rechtsbegriffs (am Beispiel des BVG-Urteils zum Mitbestimmungsgesetz
und — allgemeiner — an Beispielen des sog. Sonderprivatrechts). In (38-59)
Gessner, Volkmar & Winter, Gerd (1982, Hrsg.) Rechtsformen der
Verflechtung von Staat und Wirtschaft / . — Opladen: Westdeutscher Verlag,
1982. (Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie; Bd. 8).
- I. Zur Zielsetzung des Beitrages:
Formale („klassische") wie materiale („moderne") Rechtskonzeptioneu geraten allerorten in Sackgassen. Ihre häufige wechselseitige Ausspielung wie ihre zeitweilige Versöhnung sind taktisch nützlich, pragmatisch brauchbar, aber weder für die Rechtstheorie noch für die Rechtsdogmatik tauglich. Die Kernthese meines Beitrages lautet: In den richtungweisenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (zur Mitbestimmung) vom 1.3.1979 und des Bundesarbeitsgerichts (zur Aussperrung) vom 10.6.1980 sind anschauliche Belege für (zwar nicht schon paradigmatisch
zu nennende, aber im paradigmatischen Sinne — als Anomalien — bedeutsame) grundsätzlichere Umorientierungen des Rechtsbegriffes zu finden.
Il. Zur Verwendung der Worte „Rechtsbegriff", „Rechtskategorie", „Rechtsform"
Sie zielen auf die Elemente in der Übersetzung von Gesellschaftsverhältnissen
in Rechtsverhältnisse, in denen sich etwas spezifisch „Rechtliches"
erst erfassen läßt als eine Bestimmung (Bestimmtheit, Bestimmbarkeit)
des Verhältnisses von Positivität und Richtigkeit (des Rechts).
Ohne (irgendeine) Vorstellung von solcher Richtigkeit gibt es keine Positivität.
Getroffen werden soll eine wissenschaftstheoretisch-methodologische wie
gesellschaftlich-inhaltliche Verklammerung von leitenden und angeleiteten
Grundsätzen in der Rechtsarbeit. Dieser Beitrag beteiligt sich nicht
an der („materialistischen") Diskussion, ob die Rechtsform notwendig zirkulär-unwandelbar
sei, so daß sich Gesellschaftsverhältnisse, nicht aber
Rechtsformen ändern könnten (dies ist ein Thema genuin linker
Rechtstheorie).
__
Standort: Problemfeld Rechtsbegriffe.
*
Überblick Forensische Psychologie.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Forensische Psychologie site: www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Rudolf Sponsel (DAS). Problemfeld Rechtsbegriffe. Aus der Perspektive eines forensischen Sachverständigen. Erlangen IP-GIPT: https://www.sgipt.org/forpsy/RechtsB/PFRB0.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
.
zuletzt korrigiert: irs 20.04.2014
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
28.05.19 Neugliederung und Überarbeitung.
26.05.19 Grundfragen zur Rechtsbegriffsbildung. * Vorschlag Indizierung von Herberger & Simon Fundstelle angegeben.
08.09.18 Kritische Ergänzungen zum unbestimmten Rechtsbegriff.
29.04.17 Linkfehler geprüft und korrigiert.
11.02.17 Kendell Zitat korrigiert und ergänzt.
26.02.16 Ergänzungen. Linkfehler geprüft und korrigiert.
21.02.15 Linkfehler geprüft und korrigiert.
22.04.14 Glossarstichwort Operationalisierung.
Intern: Überprüfen:
Rottmann, Verena S. () Wörterbuch der Rechtsbegriffe Wichtige Rechtsbegriffe des Alltags verständlich erklärt. Ein fundiertes Nachschlagewerk. Typische Beispiele aus der Praxis.
Studien zur Geschichte des Rechtsbegriffs
Puchta, Georg Friedrich et al. (1877) Pandekten führt in
seinem Sachregister das Wort "Rechtsbegriff", "Begriff" oder "Begriffsbildung"
nicht auf. On den Institutionen von 1856 findet sich der Ausdruck "Rechtsbegriff"
zwei Mal im Text, S. 31 und 626 im Sonne des Begriffs vom Recht. Im Gewohnheitsrecht
1. und 2. Bd. von 1828, 1837 wird im Text das Wort "Rechtsbegriff" nicht
gefunden.
Ihering (1858), Theorie der husristischen Technik, S.21 Fußnote :"4 Der Eifer gegen die juristische Terminologie, das Verlangen, daß die Jurisprudenz möglichst sich der Ausdrücke des gewöhnlichen Lebens bedienen solle, zeugt von einer zu großen Unkenntniß der praktischen Lebensgesetze nicht bloß der juristischen, sondern einer jeden Wissenschaft, als daß ich ein Wort dagegen, verlieren möchte. Ob man für die lateinischen Ausdrücke: culpa, dolus u. s. w. deutsche wählt, nützt dem Bürrger und Bauer für das Verständniß des Rechts nicht das mindeste, es handelt sich nicht um das Verständniß von Ausdrücken, sondern von Begriffen, und so wenig der Bauer eine algebraische Formel darum versteht, weil sie mit gewöhnlichen Buchstaben, Zahlen u. s. w. geschrieben ist, ebensowenig versteht er unsere juristischen Formeln, wenn wir statt culpa Schuld, dolus Betrug u. s. w. sagen. Daß aber die Ausdrücke einer todten Sprache für die Terminologie vortheilhafter sind, als die einer lebendigen, bedarf schwerlich eines Nachweises. Der Sinn, in dem die Wissenschaft die Worte der Muttersprache gebraucht, wird und muß nothwendigerweise ein anderer sein, als in dem das Leben sie nimmt, schon darum weil die Bedeutung des Ausdrucks im Leben sich nicht selten ändert, während die Wissenschaft bei der bisherigen verbleiben muß, und umgekehrt, weil das Leben sich durch die scharfe Begriffsbestimmung der Wissenschaft seinerseits nicht abhalten läßt, den Ausdruck on seinem Sinn zu nehmen. Die Sprache der Wissenschaft und des Lebens sind zwei verschiedene Sprachen."
Hecker 1912 Die Begriffsjurispridenz, on Krawietz 1976, S. 191: "Die
ältere Methodenlehre des gemeinen Rechts hatte den Richter, wie oben
hervorgehoben, auf die Subsumtion unter Rechtsgebote, auf die Anwendung
objektiver Rechtsnormen beschränkt und jede Befugnis zur Gebotsergänzung
verneint. Tatsächlich wurde aber die abhängige Gebotsergänzung
geübt, in der Form der Gesetzes- und der Rechtsanalogie. In dieser
Form wurde auch die wertende Ergänzung in großem Umfange gehandhabt.
Neben und über ihr stand aber als besonderes Verfahren die Lückenergänzung
durch Konstruktion von Rechtsbegriffen 1, die man auch als technische Begriffshurisprudenz
oder als Inversionsmethode bezeichnet.
Dieses Verfahren bestand darin, daß man die
Allgemeinvorstellungen, welche die Wissenschaft aus den einzelnen Gesetzesgeboten
abstrahierte, als Quelle für die Gewinnung fehlender Gebote verwendete.
Die Wissenschaft ordnet den überlieferten Gesetzesinhalt zu Zwecken
der Übersicht in ein System. Die gemeinsamen Elemente werden zu allgemeinen
und immer allgemeineren Begriffen zusammengefaßt. Diese Begriffe
werden genau definiert. So wird z. B. aus den. einzelnen, vom Rechte als
wirksam anerkannten Geschäften, der allgemeine Begriff des Rechtsgeschäfts
gebildet. Diese Begriffe wurden nun zur Ausfüllung von Lücken
verwendet, indem man aus der Definition die Entscheidung des neuen Falls
ableitete. Deshalb kann man dies Verfahren auch als Inversionsmethode bezeichnen.
Fußnote 1: Vgl. über die
konstruktive Begriffsjurisprudenz und über die verschiedenen Formen:
Rümelin ([B. Windscheid und sein Einfluß auf Privatrecht und
Privatreditswissenschaft]) (1907) S. 40 ff., ferner Briitt, [Die Kunst
der Reditsanwendung] (1907) S. 73 ff."