1.1 Phantasieren im allgemeinen Sprachgebrauch
blühende P,. lebhafte P., übersteigerte P., überbordende P., Ausgeburt einer P., zusammenphantasieren, krankhafte P., reine P., Katastrophenphantasien, Gewaltphantasien, Angstphantasien, Todesphantasien, Heldenphantasien, Größenphantasien, Wunschphantasien. Wirre P. Luftschlösser, Märchen, Einbildung(en), Analogie, Gleichnis, Metapher, Symbol. Meinen, vermuten, Hypothesen, Theorien.
- Duden
- a über etwas, womit sich die Fantasie beschäftigt, was man sich in Gedanken ausmalt, sprechen
- (Medizin) (in Fieberträumen) wirr reden
- (Musik) auf einem Instrument ohne Noten spielen, was einem gerade einfällt."
- "Phantasie, die; -, -n: 1. <ohne Plural> Fähigkeit, sich etwas in seiner vollen Ausgestaltung vorzustellen und gedanklich auszumalen: etwas regt die P. an. 2. nicht der Wirklichkeit entsprechende Vorstellung: das ist nur eine P.
- phantasieren, phantasierte, hat phantasiert <itr.): 1. sieh der Phantasie hingeben; träumen: er phantasiert immer von einem Auto. 2. in krankem Zustand wirr reden: der Kranke phantasierte die ganze Nacht. 3. ohne Noten, nach eigenen Gedanken spielen: er phantasierte auf dem Klavier,
- phantasievoll <Adj.): voll Phantasie; viel Phantasie zeigend, enthaltend: ein phantasie-; volles Lügengebilde; p. erzähl len.
- Phantast, der; -en, -en: jmd, der sich der Wirklichkeit sprechende Vorstellungen ma Schwärmer: dieser P. wird im Leben nie zu etwas bring
- phantastisch <Adj.): a) bei slernd, großartig: er ist ein ph tastischer Mensch; das ist phantastischer Plan, b) (u unglaublich, unwahrscheinl ungeheuerlich: das Auto hat eine phantastische Beschleunig die Preise sind p. gestiegen.
- Phantom, das; -s, -e; 1. Trugbild, nicht reale Erscheinung; einem P. nachjagen. 2. Med. Modell zu Demonstrationszwecken."
"Bedeutungsübersicht
b sich jemanden, etwas in der Fantasie vorstellen, ausmalen
Bedeutungswörterbuch
Duden 10 (1970)
- "die Phantasie, -/-n, 1) Einbildungskraft, schöpferilcher
Geilt, Erfindungsgabe; Träumerei, Wahngebilde. 2) >Fantasie. phantasie...,
lebhaft, frei erfunden, bunt gemustert, z.B.: Phantasiepapier, wirkungsvolles
Buntpapier, ich phantasiere (habe phantaliert), 1) träume, überlasse
mich dem Wechsel lebhafter Vorltellungen. 2) rede im Fieber, rede irre.
3) spiele aus dem Stegreif, nach freier Eingebung oder Erinnerung, das
Phantasma,
-s/...smen, Scheinbild, Trugbild; GeXpenXt. die Phantasmagorie,
-/-n, 1) Wahngebilde. 2) Gespenltererscheinung auf der Bühne, phantastisch,
traumhaft, unwirklich, kühn erfunden, märchenhaft, der Phantast,
-en/-en, Schwärmer, Träumer, überXpannter Menlch. die Phantastilk,
Phantafterei, das Wirklichkeitsfremde, Gelpenltilche. [griech.; mhd.]
das Phantom, -s/-e, 1) Trugbild, Himgelpinst 2) i zu Lehrzwecken nachgebildeter Körperteil: Übung am P. [franz. aus griech; Goethezeit]"
1.2 Brainstorming Bedeutungsfeld phantasieren und Phantasie
- frei denken, die Gedanken schweifen lassen, in Gedanken sein, Probleme lösen,
- erinnern, vorstellen, Vorstellungskraft
- unwirklich, nicht wirklich, irreal, unrealistisch,
- Fiktion, traumhaft, Traum, träumen, Tagtraum,
- Einbildung, Einbildungskraft, fabulieren,
- spinnen, Wolkenkuckucksheime, Phantastereien, Illusionen, Halluzinationen, Wahn, konfabulieren
1.3 Gibt es DIE Phantasie? Was soll das heißen und bedeuten?
Es ist vielefach praktizierte wissenschaftliche - und besonders auch philosophische - Unsitte, über allgemeine Abstrakta generalisierend und undifferenziert drauflos auszusagen. Das ist ein wesentlicher Mitgrund, dass man in der Philosophie, in den Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften, besonders auch in der Psychiatrie und inzwischen auch in den Neurowissenschaften, nicht so recht vorwärts kommt. Es fehlt an präzisen Begriffen und operationalen Verfahren. Und so fehlt mit das Wichtigst in der Wissenschaft: dass man aufeinander aufbauen kann, hier findet leider gerade nicht statt, was Kekulé 1890 so schön sagte: "Wir alle stehen auf den Schultern unserer Vorgänger". DIE Kirchem DIE Philsophie, DIE Angst, DAS Bedürfnis, DER Wille, DIE LIEBE, DIE Phantasie ... dürfte es in aller Regel in dieser Allgemeinheit nicht geben, weil die WissenschaftlerInnen in der Normierung der Terminiologie nicht einig sind. Staat draulos zu allge-meinen, wäre es wichtig, konstruktiv die Kriterien für die Prädikationen anzugeben. Gerade in der Psychologie mit ihrem so verwirrend vielfältigen Bewusstseinsstromelmenten führt an klaren, präzisen operationalen Definitionen kein Weg vorbei, auch wenn es eine so riesige Heidenarbeit bedeutet. Die "Alternative" ist einfache Allagspsychologie auf Schulniveau.
Exkurs Existenzbeweise für
Sachverhalte: allgemein und am Beispiel der Phantasie
Gibt es dieses
oder das? ist eine allgemein sehr verbreitete Sprachschablone. Auch
in der Diagnostik ist die Frage Was hat X? eine typische Kardinalfrage
(> Was ist Fragen in der Diagnostik).
Damit man prüfen kann, ob irgendein Sachverhalt - in dieser oder jener
Weise existiert, muss man natürlich den Sachverhalt in seinen Merkmalen
bestimmt haben, idealiter über eine Definition des Sachverhalts verfügen.
Ob es also DIE Phantasie gibt, hängt zunächst
einmal davon ab, wie der Begriff Phantasie eingeführt, prädiziert
oder gar definiert wird. Nach seiner konstrulktiven Einführung kann
man dann sehen, welche Teile des Bewusstseinsstroms als phantasieren anzusehen
sind. Esst kommen die Merkmale oder Kriterien, erst dann kann man sehen,
wie sich individuell existenziell zeigen lassen.
Stegmüller über die bestimmten Artikel DER, DIE, DAS
1.4 Psychologische Detailanalyse des Phantasierens - ein Ansatz und Entwurf
In der Definition von Phantasie und phantasieren liegt eine gewisse Willkür, weil Definitionen nicht wahr oder falsch, sondern zweckangemessen oder zweckunangemessen sind. Es gibt keinen Zweifel, betrachtet man sich den Sprachgebrauch von Phantasie, phantasieren und seinen Synonyma, dass hier ein sehr weites Bedeutungsfeld vorliegt, wobei in vielen Grenzbereichen letztlich unklar ist und bleibt, was genau eine Phantasie zu einer Phantasie macht. Diese Problematik hat ausführlich schon Wilhelm Wundt (1918) beschrieben.
Charakterisch für Phantasien sind, das sich der Bewusstseinsstrom oder damit verbundenen spielerische Handlungen frei entfalten darf und kaum Reglementierungen unterliegt. In der Phantasiewelt sind Naturgesetze, Regeln, Beschränkungen durch die Realität, Normen, Moral und Ethik tendenziell aufgehoben. In unserer Phantasiewelt sind wir weitgehend frei.
1.5 Phantasieren liegt gewöhnlich vor
- wenn sich der Bewusstseinsstrom und damit verbundene Handlungen frei entfalten können ungeachtet der Realität, Naturgesetzen, Regeln, Logik, Normen, Moral;
- wenn Bewusstseins- oder Gedächtniselemente neu miteinander verbunden werden;
- wenn mit Bewusstseins- oder Gedächtniselementen irreale Elemente verbunden werden;
- tagträumen, geistig frei assoziativ "spazieren gehen";
- Im Geiste etwas durchgehen oder sich dem Bewusstseinsstrom hingeben, sich frei dem Erleben hingeben;
- wenn ein brainstorming durchgeführt wird;
- Geschichten erfinden;
- phantasieren im Fieber;
- phantasieren im Traum;
- phantasieren in der Psychose.
2 Kriterien für phantasieren und Phantasieprozesse - Vorschläge
Wir stellen an die Beispiele einige Fragen, aus deren Antworten wir
schließen können, ob wahrscheinlich eine Phantasie vorliegt
oder nicht. Da in diesem Stadium meiner Phantasieforschung - Ansatz und
Entwurf - eine völlig sichere Zuordnung in jedem Fall noch nicht möglich
ist, gelten die Prädikatorenregeln (=> Phantasie) nur vorläufig.
Sinnvoll erscheint in der Entwicklungsphase auch ein Meta-Kriterium namens
Meta-Regelfür die abschließende Gesamtbetrachtung oder für
Sonderfälle. In den Kriterien wird bislang nicht differenziert, ob
Phantasiekandidaten des Bewusstseinsstroms aus einem Traum-, Tagtraum-,
Dösen, Drogenkonsum, aus einer Psyachose oder aus einem Fieberzustand
hervorgehen.
Bei näherer Überlegung stellt sich die Frage, welchen logischen
Status die Bedingungs-Kriterien haben. K kann im Prinzip eine hinreichende
(h), eine notwendige(n) oder eine kontingente (m=mögliche) Voraussetzung
ausdrücken.
| Kriterium-Kürzel |
|
| K01h-Geist
_ _ _ _ |
Wenn Sachverhalte des Bewusstseinsstroms während der Vergegenwärtigung oder beim Aussprechen nicht wirklich außen geschehen, sondern nur im Geiste (innen) => Phantasie, z.B. ich besteige gerade den Kilimandscharo oder, fränkisch etwas bescheidener, das "Walberla", während ich gerade auf dem Balkon daheim sitze. K01h ist das Kern-Kriterium der Phantasie. Etwas geschieht "nur" im Bewusstsein, innen, nicht außen in der realen Welt (> System der Welten). |
| K02h-Unwirklich
_ |
Wenn im Bewusstseinsstrom unwirkliche Elemente oder (derzeit) unmögliche Sachverhalte vorkommen oder ausgesprochen werden => Phantasie. |
| K03h-Neu
_ __ _ |
Wenn Bewusstseinselemente aus dem Gedächtnis neu miteinander verbunden
werden => Phantasie
Beispiel: Pegasus, ich fliege auf das Hausdach. Dieses Kriterium garantiert potentiell unendlich viele Phantasien. Anmerkung: Arntzen (1976) verlangt "daß der Denkende seine Gedanken se1bst entwickelt, sie selbst hervorbringt und sie nicht etwa nur aufnimmt, auffaßt, nachdem sie von anderen dargeboten worden sind." |
| K04h-Wunsch
_ _ _ |
Wenn ein Wunscherleben illusioniert wird => Phantasie
Achtung: Einen Wunsch verspüren soll nicht Phantasie heißen. Erst wenn der Wunsch im Bewusstseinsstrom als ob real stattfindend illusioniert wird, soll es Phantasie heißen. Wenn ich Durst verspüre ist das keine Phantasie, sondern ein Wunsch oder Bedürfnis. Sehe ich mich im Geiste an einem Brunnen trinken, ist das Phantasie. |
| K05h-Proj
__ _ |
Wenn mehrdeutigen unklaren Sachverhalten eine Interpretation zugeordnet
wird => Phantasie (projektive)
Wenn z.B. in Wolkenformationen oder in projektiven Tests spezielle Interpretationen erfolgen (Mia, "Fell" für Tafel VI im Rorschachtest. Das Mehrdeutige wird Kraft Phantasie eindeutig. |
| K06h-Frei
_ _ _ |
Wenn ein freier Bewusstseinsstrom erlebt oder geschildert wird
=> Phantasie
Hier ist noch das Problem zu lösen, was ein "freier" Bewusstseinsstrom sein soll und wie man ihn erkennen kann. Zumindest sollte das subjektive Gefühl bestehen, nicht bewusst zu lenken und einzugreifen. (z.B. Molly, Ulysses) und der Zustand freischwebener Aufmerksamkeit vorliegen. |
| K07h-Lit
__ |
Wenn Sachverhalte in Erzählungen / Geschichten - egal von wem - erfunden werden => Phantasie. Damit ist die ganze Literatur inbegriffen, aber nicht nur, z.B. auch Alltagsgeschichten von jedermann. |
| K08h-Traum | |
| K09h-Fieber | |
| K10h-PsyPath | Wenn ein psychopathologischer Zustand (Psychose, Wahn, Aura, Dämmerzustand, Rausch [Alkohol, Drogen]) |
| K11h-Grenz | Wenn in Grenz- oder Übergangszuständen (Einschlafen, Aufwachen) |
| K07m-Zukunft
_ |
Wenn man sich Ereignisse oder Geschehen der Zukunft vergegenwärtigt
oder auch ausspricht => Phantasie
Wenn ich sage, ich fahre übermorgen in den Urlaub, ist das keine Phantasie. Wenn ich mich im Auto sitzen und fahren "sehe", ist es eine Phantasie. Zukunftgeschehen ist nur dann eine Phantasie, wenn es vergegenwärtigt wird. |
| K08m-Ansch?
_ _ _ |
Wenn Bewusstseinsströme anschaulich erfolgen => Phantasie
"m" und das "?" drücken aus, dass mir unklar ist, welchen logischen Status die Anschaulichkeit als Kriterium haben soll. Zu Untersuchungszwecken wird das Kriterium einstweilen mitgeführt. Hier geht es auch um das Problem, ob Phantasien immer anschaulich sein sollen oder ob es auch abstrakte Phantasien gibt (> "Ich weiß es wird einmal ein Wunder geschahen") |
| KS-ZuInf | Zusatzinformation, z.B. Phantasie im Fieber (Erlkönig), in der Psychose, Nahtodphantasie und ähnlich. |
| KG-Meta | Wenn die Gesamtbetrachtung (g) weil M1, M2, ... es nahelegt ... => Phantasie |
Schilderungen von Bewusstseinsströmen können aus vielen aneinandergereihten Sachverhalten bestehen. Das gilt auch für längere Texte [> Nonsensgeschichte]. Hier stellt sich dann die Frage, für welche Textteile die Prädikation Phantasie gilt? Und auch, ob vom Teil aufs Ganze geschlossen werden darf bzw. welchen Gültigkeitsbereich an Textteilen die Prädikation "Phantasie" hat? Hier sind derzeit noch einige Fragen offen.
Die Analyse zusammengesetzter
Texte (Sachverhalte)
Jeder Text sich lässt in sog. Elementarsachverhalte zerlegen (wie
hier gezeigt). Formal lässt sich das wie folgt anschreiben:
S1, S2, S3, ...., Si, ..... Sn-1, Sn (Formel 03)
Dann kann für jeden Sachverhalt Si gefragt werden: Handelt
es sich bei diesem Sachverhalt Si um eine Phantasie? Allgemein
lässt sich sagen, dass es bei n Sachverhalten höchstens n Phantasien
geben kann. Bilden mehrer Sachverhalte eine Einheit S12 = S1
und
S2, mit S1 => keine Phantasie und S2 =>
Phantasie. Beispiel: Autoengel (Phantasie): S1=> Auto (Real),
S2 = Engel (Phantasie).
Vertiefte Auseinandersetzung mit den Kriterien
K01h-Geist {}
Kurzerklärung: Wenn Sachverhalte des Bewusstseinsstroms während
der Vergegenwärtigung oder beim Aussprechen nicht wirklich außen
geschehen, sondern nur im Geiste (innen) => Phantasie, z.B. ich besteige
gerade den Kilimandscharo oder, fränkisch etwas bescheidener, das
"Walberla", während ich gerade auf dem Balkon daheim sitze. K01h ist
das Kern-Kriterium der Phantasie. Etwas geschieht "nur" im Bewusstsein,
im Geiste, innen, nicht außen in der realen Welt (> System
der Welten).
Wir erarbeiten uns ein tieferen Verständnis
dieses Kern-Kriteriums über die Diskussion einiger Beispiele:
- Teil des Bewusstseinsstroms: Ich muss gleich in die Küche. Ich würde hier folgende Bewusstseinselemente signieren: {Absicht, Vorsatz, Plan, Gedanke, Idee, Einfall} Also keine Phantasie.
- Teil des Bewusstseinsstroms: Morgen wird ein anstrengender Tag. {Vorwegnahme, Vermutung, Phantasie: weil es nicht Realität ist, Gedanke, Idee, Einfall}
- Teil des Bewusstseinsstroms: Wir könnten am Wochenende wieder eine Flussmündung aufsuchen. {Phantasie: weil es nicht Realität ist; Überlegung, Gedanke, Idee, Einfall, Vorschlag, Wunsch} Eine der letzten war die Einmundung von Donau und Altmühl (-Erkundung) in Kelheim, es erscheint begleitend eine visuelle Vorstellung von oben, strukturell wie:
- Teil des Bewusstseinsstroms: Hm, was war denn das noch für eine irritierende Szene in dem Film? Es wird der Versuch zgemacht, genauer zu erinnern, was das für eine Szene war. {aktivieren der Erinnerung zwecks Klärung einer derzeit unklaren, unzugänglichen Szene} Also keine Phantasie.

{Erinnerung, visuelle Vorstellung, Gedanke, Phantasie: weil es nicht Realität ist und weil ein Bild der Einmündung im Bewusstsein vorgestellt wird}
K02h-Unwirklich
Wenn im Bewusstseinsstrom unwirkliche Elemente oder (derzeit) unmögliche
Sachverhalte vorkommen oder ausgesprochen werden => Phantasie
K03h-Neu
Wenn Bewusstseinselemente aus dem Gedächtnis neu miteinander verbunden
werden => Phantasie
Beispiel: Pegasus, ich fliege auf das Hausdach. Dieses Kriterium garantiert
potentiell unendlich viele Phantasien.
Anmerkung: Arntzen
(1976) verlangt "daß der Denkende seine Gedanken se1bst
entwickelt, sie selbst hervorbringt und sie nicht etwa nur aufnimmt, auffaßt,
nachdem sie von anderen dargeboten worden sind."
K04h-Wunsch
Wenn ein Wunscherleben illusioiniert wird => Phantasie
Achtung: Einen Wunsch verspüren soll nicht Phantasie heißen.
Erst wenn der Wunsch im Bewusstseinsstrom als ob real stattfindend illusioniert
wird, soll es Phantasie heißen. Wenn ich Durst verspüre ist
das keine Phantasie, sondern ein Wunsch oder Bedürfnis. Sehe ich mich
im Geiste an einem Brunnen trinken, ist das Phantasie.
K05h-Proj
Wenn mehrdeutigen unklaren Sachverhalten eine Interpretation zugeordnet
wird => Phantasie (projektive)
Wenn z.B. in Wolkenformationen oder in projektiven Tests spezielle
Interpretationen erfolgen (Mia, "Fell" für Tafel VI im Rorschachtest.
Das Mehrdeutige wird Kraft Phantasie eindeutig.
K06h-Frei
Wenn ein freier Bewusstseinsstrom erlebt oder geschildert wird
=> Phantasie
Hier ist noch das Problem zu lösen, was ein "freier" Bewusstseinsstrom
sein soll und wie man ihn erkennen kann.
Zumindest sollte das subjektive Gefühl bestehen, nicht bewusst
zu lenken und einzugreifen. (z.B. Molly, Ulysses)
und der Zustand freischwebener
Aufmerksamkeit vorliegen.
K07h-Lit
K08h-Traum
K09h-Fieber
K10h-PsyPath
K11h-Grenz
K07m-Zukunft
Wenn man sich Ereignisse oder Geschehen der Zukunft vergegenwärtigt
oder auch ausspricht => Phantasie
Wenn ich sage, ich fahre übermorgen in den Urlaub, ist das keine
Phantasie. Wenn ich mich im Auto setzen und fahren "sehe", ist es eine
Phantasie. Zukunftgeschehen ist nur dann eine Phantasie, wenn es vergegenwärtigt
wird.
K08m-Ansch?
Wenn Bewusstseinsströme anschaulich erfolgen => Phantasie
"m" und das "?" drücken aus, dass mir unklar ist, welchen logischen
Status die Anschaulichkeit als Kriterium haben soll. Zu Untersuchungszwecken
wird das Kriterium einstweilen mitgeführt. Hier geht es auch um das
Problem, ob Phantasien immer anschaulich sein sollen oder ob es auch abstrakte
Phantasien gibt (> "Ich weiß es wird einmal ein
Wunder geschahen")
KS-ZuInf
Zusatzinformation, z.B. Phantasie im Fieber (Erlkönig),
in der Psychose, Nahtodphantasie und ähnlich.
KG-Meta
Wenn die Gesamtbetrachtung (g) weil M1, M2, ... es nahelegt ...
=> Phantasie
Zusammenfassung: vorläufiger Stand und Status der Kriterien
Die operationale Entwicklung der Kriterien und ihre Anwendung durch Signierungen soll der Kriik und Weiterentwicklung der Phantasieforschung und -praxis dienen. Durch die Vorgaben sind alle Anwendung prüf-, kontrollier- und damit evaluierbar. Ob und wie sie sich bewähren, muss die Zukunft erweisen.
3 Beispiele mit Signierung der Kriterien ("Tauglichkeitsprüfung")
In geschweiften Klammern {} wird jeweils das Kriterium oder die Kriterien angegeben, die meiner Beurteilung nach erfüllt sind.
Mia und der Ritt auf dem Wolkenpferd {mit Kriterien
signiert}
"Heute ist ein schöner Tag. Manchmal ziehen dicke, weiße
Wolkengebirge über den Himmel und verdecken für eine Weile die
Sonne. Interessiert beobachtet Mia das Wolkeuspiel. "Die Wolken malen Bilder
an den Hiimmel" {K01h, K02h, K05h}, sagt sie zu Katze Muni. „Sieht
die da nicht aus wie eine Hexe?" {K01h, K05h} "Miau-au-nein", maunzt
Mimt. "Eine Riesenmaus ist's. Hmja hmja miau." {K01h, K05h}
"Jetzt kommt ein Schloss mit runden Türmen'' {K01h, K05h},
freut sich Mia. "Und die da vorne hat ein Griesgramgesicht wie Frau Hauptman,
meine Lehrerin.{K01h, K05h}" Sie kichert. "Stimmt. Hihi." Aufmerksam
blicken Mia und Mimi in den Himmel. Es macht Spaß, in den Wolken
Bilder zu suchen. Langsam schweben immer neue Wolkengemälde über
den Himmel. "Ein Pferd" {K05h}, ruft Mia auf einmal. "Siehst du?
Oh, auf so einem Wolkenpferd {K01h, K03h} möchte ich gerne
einmal über den Himmel reiten {K02h}. Hoch über der Erde.
Was man da nichr alles sehen könnte!" Mia fangt an zu singen:
- "Auf einem Wolkenpfeid {K01h, K05h} reiten {K02h}
und über das Himmelszelt gleiten {K01h, K02h},
unten die Erde und oben die Sterne,
und ich mittendrin - das hätte ich gerne. {K01h, K02h}"
- "Der Wind hat mir ein Lied erzählt." (La Habanera, Zarah Leander 1937) Metapher oder Phantasie? Nachdem der Wind kein Lied erzählen kann, gilt sicher {K01h, K02h}, möglicherweise aber auch {K03h}, wenn dieser Sachverhalt erstmals mit der Erschaffung des Liedes 1937 so formuliert wurde.
- "Ich weiß es wird einmal ein Wunder geschehen" (Zarah Leander 1942) An diesem Titel finde ich besonders interessant, dass es sich um eine abstrakte Phantasie handelt, was dem von vielen AurtorInnen verlangten Anschaulichkeitskriterium widerspricht. {K01h, K02h},{K04h},{K07m}.
- "Kann denn Liebe Sünde sein" (Zarah Leander 1938) Eine provokante Frage, die im Extrem bedeuten kann, in der Liebe ist alles erlaubt. Gemeint ist aber vermutlich, die Verdammung der (vorehelichen) Sexualität z.B. durch die katholische Kirche. Keine Phantasie, sondern eine Einstellung und Wertung mit dem Sinn: Liebe kann keine Sünde sein.
- "Für mich solls rote Rosen regnen." (Hildegard Knef 1968) Im Gegensatz zu "Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen" handelt es sich hier um eine anschauliche Phantasie {K01h, K02h},{K03h},{K04h},{K07m},{K08m}. In 6 Worten 5 Kriterien: beachtlich!
Gedichte {}
Nirgendwo ist das Reich der Phantasie vertreten wie in Kunst und Literatur.
Als Königsdizplin könnte man die Lyrik, die Welt der Gedichte
ansehen. Hierbei gibt es immer zwei Perspektiven: erstens die des Schöpfers
bei der Herstellung und zweitens die des Rezipienten, des Aufnehmers. Die
Aufnahme oder Vergegenwärtigung eines Gedichts, also das Lesen z.B.
des Erlkönigs ist für die LeserIn immer ein Phantasieprozess.
Denn z.B. in 1.1. reitet ja niemand tatsächlich durch Nacht
und Wind, sondern der Ritt wird gedacht oder vorgestellt. Der Ritt geschieht
im Geiste und ist daher nach {K01h} eine Phantasie. Als Zusatzinformation
käme in Betracht: Fieber- und Nahtodphantasien, wobei die Projektiven
durch unklare Strukturen in der Nacht unterstützt werden.
- Der Erlkönig. (Goethe 1778)
1.1 Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? {K01h}
1.2 Es ist der Vater mit seinem Kind. {K01h}
1.3 Er hat den Knaben wohl in dem Arm, {K01h}
1.4 Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm. {K01h}
2.1 Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? {K01h}
2.2 Siehst Vater, du den Erlkönig nicht! {K01h, K02h, K05h}
2.3 Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif? {K01h, K02h, K05h}
2.4 Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. {K01h}
3.1 Du liebes Kind, komm geh' mit mir! {K01h}
3.2 Gar schöne Spiele, spiel ich mit dir, {K01h}
3.3 Manch bunte Blumen sind an dem Strand, {K01h}
3.4 Meine Mutter hat manch gülden Gewand. {K01h}
4.1 Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, {K01h, K02h, K05h}
4.2 Was Erlenkönig mir leise verspricht? {K01h}
4.3 Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, {K01h}
4.4 In dürren Blättern säuselt der Wind. {K01h}
5.1 Willst feiner Knabe du mit mir geh'n? {K01h}
5.2 Meine Töchter sollen dich warten schön, {K01h}
5.3 Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn {K01h}
5.4 Und wiegen und tanzen und singen dich ein. {K01h}
6.1 Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort {K01h, K02h, K05h}
6.2 Erlkönigs Töchter am düsteren Ort? {K01h, K02h, K05h}
6.3 Mein Sohn, mein Sohn, ich seh'es genau: {K01h}
6.4 Es scheinen die alten Weiden so grau. {K01h}
7.1 Ich lieb dich, mich reizt deine schöne Gestalt, {K01h}
7.2 Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt! {K01h}
7.3 Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an, {K01h, K02h, K05h}
7.4 Erlkönig hat mir ein Leids getan. {K01h, K02h, K05h}
8.1 Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, {K01h}
8.2 Er hält in den Armen das ächzende Kind, {K01h}
8.3 Erreicht den Hof mit Mühe und Not, {K01h}
8.4 In seinen Armen das Kind war tot. {K01h}
Aus Rilke (Abruf
12.08.2017)
"Und sagen sie das Leben sei ein Traum: das nicht;"
- "... und mir ist so als hätt ich schon gesehn,
daß Tiere sich in deinen Blicken baden {K01h, K02h, K05h}
und trinken deine klare Gegenwart." {K01h, K02h, K05h}
Joachim Ringelnatz
(1924) Kuttel Daddeldu
- Abendgebet einer erkälteten Negerin
1.1 Ich suche Sternengefunkel. {K01h}
1.2 All mein Karbunkel {K01h}
1.3 Brennt Sonne dunkel. {K01h}
1.4 Sonne drohet mit Stich. {K01h}
2.1 Warum brennt mich die Sonne im Zorn? {K01h, K02h, K03h}
2.2 Warum brennt sie gerade mich? {K01h, K02h}
2.3 Warum nicht Korn? {K01h, K02h}
3.1 Ich folge weißen Mannes Spur. {K01h}
3.1 Der Mann war weiß und roch so gut. {K01h}
3.1 Mir ist in meiner Muschelschnur {K01h}
3.1 So negligé zu Mut. {K01h}
4.1 Kam in mein Wigwam {K01h}
4.1 Weit übers Meer, {K01h}
4.1 Seit er zurückschwamm, {K01h}
4.1 Das Wigwam {K01h}
4.1 Blieb leer. {K01h}
5.1 Drüben am Walde {K01h}
5.2 Kängt ein Guruh – – {K01h, K02g, K03h}
6.1 Warte nur balde {K01h}
6.2 Kängurst auch du. {K01h, K02g, K03h}
Maerchen
Märchen sind neben Sagen, Mythen und Religion eine klassische
Ausdrucksform für Phantasien. Maid (1999), S. 324, führt aus:
"Märchen, realitätsenthobene Erzählung wunderbaren Inhalts.
Man unterscheidet zwischen dem erst nach längerer mündlicher
Tradierung aufgezeichneten Volksmärchen und dem aus einem bewussten
künstlerischen Akt entstandenen Kunstmärchen. Zu den konstitutiven
Merkmalen des Volksmärchens gehört, dass es keinen namentlich
bekannten Verfasser hat, dass es über einen längeren Zeitraum
mündlich überliefert wurde und dass daher mit einer Reihe von
Varianten zu rechnen ist. Vom Inhalt her kann man zwischen Zauber-, Schwank-,
Tier-, Lügen-, Legenden- und ätiologischen M. unterscheiden."
- Frau Holle
- Die sieben Zwerge.
- Froschkönig.
- Struwelpete von Heinricht Hofmann 1846 für 3-6 Jahre [Online] {}
| 1. Geschichte ("Vorspruch")
Wenn die Kinder artig sind, {K01h} Kommt zu ihnen das Christkind; {K01h} Wenn sie ihre Suppe essen {K01h} Und das Brot auch nicht vergessen, {K01h} Wenn sie, ohne Lärm zu machen, {K01h} Still sind bei den Siebensachen, {K01h} Beim Spaziergehn auf den Gassen {K01h} Von Mama sich führen lassen, {K01h} Bringt es ihnen Gut's genug {K01h} Und ein schönes Bilderbuch. {K01h} Sieh einmal, hier steht er, {K01h} Pfui! der Struwwelpeter! {K01h} An den Händen beiden {K01h} Ließ er sich nicht schneiden {K01h} Seine Nägel fast ein Jahr; {K01h} Kämmen ließ er nicht sein Haar. {K01h} Pfui! ruft da ein jeder: {K01h} Garst'ger Struwwelpeter {K01h} |
Thema des Struwelpeter ist - mit Ausnahme der 5. Geschichte
vom wilden Jäger - das nicht brav sein und die daraufhin erfolgte
Strafe. Die Geschichten haben also einen hauptsächlich erzieherisch-moralische
Funktion. Es sind zwar erfundene {K01h} Geschich- ten, aber die
meisten haben verbreitete und wirkliche Sachverhalte zum Kern. Das Leitmotiv
lautet: seid brav, sonst werdet ihr bestraft und bekommt nichts zu Weihnachten.
"Umstrittener Struwelpeter" DF 30.04.2009. Die 10 Geschichten: 1 Wer artig ist wird Weihnachten beschenkt 2 Die Geschichte vom bösen Friederich 3 Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug 4 Die Geschichte von den schwarzen Buben 5 Die Geschichte vom wilden Jäger 6 Die Geschichte vom Daumenlutscher 7 Die Geschichte vom Suppen-Kaspar 8 Die Geschichte vom Zappel-Philipp 9 Die Geschichte vom Hanns Guck-in-die-Luft 10 Die Geschichte vom fliegenden Robert |
Prosa, Erzählungen, Romane ...
Aus Hesses Phantasien über die Wolken (1907)
- "Bedenken wir, daß die Wolken ein Stück Erde, Materie sind
und ihr irdisches, materielles Leben in der Höhe, in Räumen führen,
wo wir außer ihnen nichts Stoffliches erblicken können, so leuchtet
ihre Symbolik ohne weiteres ein. Sie bedeuten uns ein Weiter-[>77] spielen
des Irdischen im Entrückten, einen Versuch der Materie, sich aufzulösen,
eine innige Gebärde der Erde, eine Gebärde der Sehnsucht nach
Licht, Höhe, Schweben, Selbstvergessen. Die Wolken sind in der Natur,
was in der Kunst die Flügelwesen, Genien und Engel sind, deren menschlich-irdische
Leiber Flügel haben und der Schwere trotzen.
Und schließlich bedeuten uns die Wolken noch ein Gleichnis der Vergänglichkeit, ein zumeist heiteres, befreiendes, wohltuendes. Wir sehen ihre Reisen, Kämpfe, Rasten, Feste an und deuten sie träumend, wir sehen menschliche Kämpfe, Feste, Reisen, Spiele in ihnen, und es tut uns wohl und weh zu sehen, wie das ganze und schöne Schattenspiel so flüchtig, veränderlich, vergänglich ist. (1907)"
Vorstellung Bodensee {}
Ich stelle mir den Bodensee vor und lasse in meiner Vorstellung ein Segelboot von einem Ufer zum anderen fahren. {K01h} Die Phantasie könnte aus einem freien Bewusstseinsstrom stammen {K06}. Warum Phantasie und nicht nur Vorstellung? Die einzelnen Teile "Segelboot, Ufer, fahren" sind einfache Vorstellungen. Zur Phantasie werden diese Vorstellungen durch den virtuellen Geschehensablauf, der im Zeitraum der Vergegenwärtigung nicht wirklich sein kann, wie ja schon die Formulierung "ich stelle mir vor ..." zum Ausdruck nbringt.
Flug über das Frankenland
{}
Ich fliege über das Frankenland, staune und erfreue mich an der
Schönheit der Landschaften . Wenn ich das tatsächlich tue, in
einem Ballon oder Flugzeug, ist es natürlich keine Phantasie. Wenn
ich es mir im Lehnstuhl vorstelle, ist es eine Phantasie, erst recht, wenn
ich mich selbst in die Luft erhebe und den Flug ohne Hilfsmittel selbst
durchführe {K01h, K02h}.
Überlegungen oder Phantasien zu potentiellen
Vortragsstörungen {}
Ich frage mich, wie es wäre, wenn ich auf dem Deutschen Verkehrsgerichtstag
einen Vortrag über "Unerträgliche Fehler in MPU-Gutachten" halten
würde? Mit welchen Schwierigkeiten, Behinderungen und Störungen
müßte ich rechnen? Wie könnte ich denen begegnen? Spontan
komme ich zu folgenden Signierungen: {K01h, K07m}, weil ein zukünfdtiges
mögliches Geschehen vergegenwärtigt wird.
Aber ist das richtig? Ist das eine Phantasie oder
nicht eher eine vorausschauende Überlegung, ein Planspiel? Was unterscheidet
dann eine vorausschauende Überlegung, also denken, von einer Phantasie?
Denken
heißt geistige Modelle bilden oder zueinander in Beziehung setzen.
Stimmt das nicht auch für die Phantasie? Dann hätte die Denkdefinition
vielleicht einen Mangel. Das war jetzt DENKEN und nicht phantasieren.
Wie ist es, tot zu sein?
{}
Kann man sich das vorstellen? Diese Untersuchung ist natürlich
leicht weil ich selbst - wie andere auch - selbst durchführen kann.
Ich kann denken "ich bin tot" und "wie ist das"? {K01h, K02h, K07m}
Das
sollte besonders leicht sein, wenn man schon Tote gesehen kann, wenngleich
es natürlich schon ein wenig makaber anmutet und es anders ist, sich
selbst tot zu "sehen", weil man in der Regel leben will, gern lebt und
den Tod gerne wegschiebt. Die Vorstellung auch anschaulich kein Problem,
sich etwa aufgebahrt liegen sehen, aber es auch eine abstrakte Phantasie
möglich.
Francois Villon (1431-?) stellte sich seinen Tod vor, sonst hätte
er die Ballade "Notwendige Nachschrift, mein Begräbnis betreffend"
[Online]
nicht geschrieben.
Eine Nonsensgeschichte {}
Neulich musste X sein Auto über das Schwimmbad tragen {K01h,
K02h, K03h}, wobei er ausgerutscht ist und ins inzwischen gewandelte
{K02?,
K03h} Auto-Uboot fiel. Der Bademeister reichte {K01h, K03h} dem
Auspuff ein Handtuch, aber der Auspuff schüttelte mit dem Vergaser
das Loch {K01h, K03h} und wollte {K01h, K02h, K03h}
lieber
ein Eis, am liebsten ein in olivenölgebadetes und leichtem Senfcurry
{K01h,
K02h, K03h}. Der Delphin lag in der Hängematte und wackelte auf
und nieder {K01h, K03h}. Die Polizei kam, erklärte sich aber
für nicht zuständig und verwies auf das Marineministerium im
Indischen Ozean {K01h, K02h, K03h}, der aber gerade von einem Heer
von Pumpschmetterlingen {K01h, K02h, K03h} aus Südafrika abgesagt
wurde. Andererseits, wandte der Staatsanwalt ein, gäbe es doch gar
kein Marineministerium im Indischen Ozean. Nun ja, das dafür zuständige
halt, erklärt der Friseur des Bademeisters, der die Schwägerin
des Polizisten von der Insel Europostel {K01h, K02h}
kannte. Es
näherte sich tänzelnd und singend ein Eskimo oder Lapplandtürke
{K01h,
K02h, K03h} mit einem Schlittschuhbart
{K01h, K02h, K03h}. Da
musste der selbst der herbeigerufene Pfarrer lachen. Immerhin, er lachte
auf lateinisch.
Eine ziemlich närrische Phantasie, aber vielleicht
für das Signieren eine gute Übung. Denn die Kriterien sollten
sich schließlich auf alle Sachverhalte anwenden lassen.
*rs
Ein Krönich,
sein Olk und der Unger {}
"Vor schwanger Zeit lähmte ein Krönich in seinem Schoß.
Er war bei seinen Muntertanen sehr bediebt und einmal Po Ja gab er für
sie ein Fresst, für das immer lausende Wildscheine geschlechtet wurden.
Am zäunten Popember des Jahres kreuzenhundertheilundscheißich
sprach der Krönich zu seiner Pfau: Mir geht es heute nicht so Hut,
ich möchte das Fresst auffallen lassen. Die Pfau schaute in den Igel
und klemmte sich ihre länglichen Haare, die in der Tonne wie Grollt
schwimmerten. Dabei brach sie zum Krönich: „Mein dieber Namm, ja-ein,
ja-aus hast du dein Pfolk beklont mit einem Fresst, obwohl deine Muntertanen
immer so fech waren.“ Auf diese Meise setzte die Hönigin ihrem Namm
einen Fluor ins Ohr. Die Belohner des ganzen Lindes wurden sehr Möse
auf den Krönich, als sie erbfuhren, dass sie in diesem Ja würden
lungern müssen. Doch im Schoß wohnte auch eine junge Inszestin,
die mit einem Fosch verayrantet werden musste und deshalb wuchs der ganze
Prallast mit Hosen und Zornen zu. Wunderte junge Rinzen blieben da dran
hengen und verursteten. Sie starksten in der Zornenkäcke wie Badheenchen
am Schieß. Das Pfolk ernährte sich von ihrem Feisch und so überklebten
alle die Hummersperiode." [Abruf
11.08.2017] ]
Ausflug ins Naturgartenbad
{}
Als wir neulich im Naturgartenbad in Erlenstegen (Nürnberg) waren
lagen wir schräg am Hang, was sich nach einiger Zeit körperlich
bemerkbar machte. Ich sehe uns da liegen. Es war ein schöner Sommertag
und wir waren auch ein paar mal im Wasser. Das ist kein Phantasieren, sondern
ein ERINNERN an einen Ausflug. Wäre es nicht schön, diesen Ausflug
ab und zu wiederholen? Hier wird ein WUNSCH erwogen. Ich gehe im Geiste
den Kalender durch und frage mich, wann es passen könnte, sofern das
Wetter stimmt. Das ist PLANEN und nicht phantasieren.
Phantasien um einen Lottogewinn {}
Quelle Psychologie heute 07/2011 "Unser persönliches Paralleluniversum
Das wohl verbreitetste Gedankenspiel ist das vom Gewinn des Lotto-Jackpots:
Welchen Wunsch würde ich mir als ersten erfüllen? Die Villa am
Meer, die Stadtwohnung in Paris, das Traumauto? Würde ich eine Weltreise
machen? Wer kriegt was vom Geld ab? Ist es ratsam, anderen vom Gewinn zu
erzählen? Soll ich den Job hinschmeißen – oder erst mal ganz
normal weitermachen? Wer seine Wünsche so spazieren führt, befindet
sich in einem geistigen Modus, den wir in seiner Häufigkeit und Bedeutsamkeit
immer noch gewaltig unterschätzen: in einem Tagtraum. Bei diesen Ausflügen
in die Fantasie begegnen wir uns selbst: Sag mir, was du dir wünschst,
und ich sage dir, wer du bist!"
C.G. Jungs
erste aktive Imagination 1913 {}
"Es war in der Adventszeit des Jahres 1913 als ich mich zum entscheidenden
Schritt entschloß (12. Dezember). Ich saß an meinem Schreibtisch
und überdachte noch einmal meine Befürchtungen, dann ließ
ich mich fallen. Da war es mir, als ob der Boden im wörtlichen Sinne
unter mir nachgäbe und als ob ich in eine dunkle Tiefe sauste. Ich
konnte mich eines Gefühls von Panik nicht erwehren. Aber plötzlich
und nicht allzu tief kam ich in einer weichen, stickigen Masse auf die
Füße zu stehen - zu meiner großen Erleichterung. Jedoch
befand ich mich in einer fast völligen Finsternis. Nach einiger Zeit
gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit, die nun einer tiefen
Dämmerung glich. Vor mir lag der Eingang zu einer dunkeln Höhle,
und dort stand ein Zwerg. Er erschien mir wie aus Leder, so als ob er mumifiziert
wäre. Ich drängte mich an ihm vorbei durch den engen Eingang
und watete durch knietiefes, eiskaltes Wasser zum anderen Ende der Höhle.
Dort befand sich auf einem Felsband ein roter, leuchtender Kristall. Ich
faßte den Stein, hob ihn auf und entdeckte, daß darunter ein
Hohlraum war. Zunächst konnte ich nichts erkennen, aber schließlich
erblickte ich strömendes Wasser in der Tiefe. Eine Leiche schwamm
vorbei, ein Jüngling mit blondem Haar, am Kopf verwundet. Ihm folgte
ein riesiger schwarzer Skarabäus, und dann erschien, aus der Wassertiefe
auftauchend, eine rote, neugeborene Sonne. Geblendet vom Licht, wollte
ich den Stein wieder auf die Öffnung legen, da drängte sich jedoch
eine Flüssigkeit durch die Öffnung. Es war Blut! Ein dicker Strahl
sprang auf, und ich empfand Übelkeit. Der Blutstrom währte, wie
mir schien, unerträglich lange. Endlich versiegte er, und damit war
die Vision zu Ende." Quelle: Ammann, A.N. 1984, S. 36.
Eine zweite närrische
Geschichte {}
Zwei Gauner tanzten eine vergebliche Peschmerga, während ein Grizzly
gerade seine Jungen bekam. Das war keine gute Zeit und gute Gegend seufzte
Marie, eine Honigsummenmaus aus der Wüste 3. Komm, gehen wir, sprach
Estragon. Aber, wie bekannt, sie rührten sich nicht vom Fleck. Das
verstand auch der Zwiebelkuchen.
In Gedanken am Meer {}
In Gedanken bin ich am Meer, laufe über eine Düne hinunter
und nähere mich dem Strand und den Wellen, die im Strand versickern
und sich anscheinend wieder zurückbilden. Das ist Phantasieren, aber
auch Denken mit Nutzung von Erinnerungen oder Wissen.
Lesebeispiel aus dem letzten Kapitel von James Joyce Ulysses
(Molly
bewusstseinsströmt
ca. 80 Seiten lang ohne Punkt und Komma im Bett so vor sich hin: unbearbeitetes
Originalzitat hier).
Zur besseren Analyse wird der Text in numerierte Textelemente aufgeteilt:
[1]. "... lieber die Lampe bißchen runterdrehn
{K01h,
K04h, K07m?} [2] und nochmal versuchen {K01h, K04h, K07m?}
[3]
daß [>1012] ich früh auch aus den Federn komme {K01h, K04h}
[4]
ich werde zu Lambe gehn da neben Findlater {K01h, K04h, K07m}
[5]
daß sie uns paar Blumen schicken die ich in der Wohnung aufstellen
kann {K01h, K04h, K07m?} [6] für den Fall daß er ihn
morgen mit nach Hause bringt [7] heute meine ich nein nein Freitag ist
ein Unglückstag {K01h, K02h} [8] zuerst will ich mal etwas
sauber machen in der Wohnung {K01h, K04h, K07m} [9] ich glaube der
Staub wächst {K02h} sogar während ich am schlafen bin
[10] dann können wir etwas musizieren und Zigaretten rauchen {K01h,
K07m} [11] ich kann ihn begleiten {K01h, K07m} [12] aber zuerst
muß ich noch die Tasten vom Klavier säubern mit Milch {K01j,
K04h, K07m} [13] was zieh ich denn an soll ich eine weiße Rose
tragen {K01h, K07m} [14] oder haltmal diese schönen Kuchen
bei Lipton {K01h} [15] also ich liebe ja diesen Duft {K01h} in
einem reichen großen Laden {K01h} zu 7 1/2d das Pfund oder
die andern mit den Kirschen drin {K01h} und der rosa Zucker {K01h}
11d
das Kilo [16] und natürlich eine schöne Topfpflanze {K01h}
für
mitten auf den Tisch {K01h} die krieg ich doch billiger bei Moment
wo war das doch ich hab sie doch kürzlich erst gesehn {Erinnerungsproblem}
noch
ich liebe ja Blumen am liebsten hätt ich die ganze Wohnung täte
in Rosen schwimmen {K01h} [17] Gott im Himmel es geht doch nichts
über die Natur die wilden Berge dann das Meer und die Wellen wie sie
am rauschen sind und das schöne Land mit Hafer und Weizenfeldern und
allen möglichen Sachen und das ganze schöne Vieh am weiden das
täte einem so richtig gut mal wieder Flüsse zu sehen und Seen
und Blumen alle möglichen Formen und Düfte und Farben sogar in
den Gräben sprießen die überall Schlüsselblumen und
Veilchen {K01h, K08m?} [18] das ist die Natur und wenn die sagen
es gibt keinen Gott dann kann ich bloß sagen ich pfeif auf ihre ganze
Gelehrsamkeit wieso gehn sie nicht hin und schaffen selber mal was hab
ich ihn oft schon gefragt diese Atheisten oder wie die sich nennen solln
doch erstmal vor ihrer eigenen Haustür kehren aber dann heulen sie
nach dem Priester wenns ans sterben geht und warum ja warum weil sie Angst
vor der Hölle haben wegen ihrem schlechten Gewissen ah ja mir machen
die nichts vor wer war denn das erste Wesen im Weltenraum bevor daß
sonst jemand da war der alles geschaffen hat wer denn ah das wissen sie
nicht genau so wenig wie ich da sitzen sie da sie könnten [>1013]
ebenso gut versuchen daß sie die Sonne am aufgehn hindern morgen
früh {Erregung über Atheisten, Gottes"beweis" durch die Schöpfung:
K01h, K02h} [19] die Sonne die scheint für dich allein hat er
damals gesagt an dem Tag wo wir unter den Rhododendren lagen oben auf dem
Howth in dem grauen Tweedanzug und mit dem Strohhut an dem Tag wo ich ihn
so weit kriegte daß er mir den Antrag gemacht hat ja zuerst hab ich
ihm ein bißchen von dem Mohnkuchen aus meinem Mund gegeben und es
war Schaltjahr wie jetzt ja vor 16 Jahren mein Gott nach dem langen Kuß
ist mir fast die Luft ausgegangen ja er sagte ich wäre eine Blume
des Berges ja das sind wir alle Blumen ein Frauenkörper ja da hat
er wirklich mal was Wahres gesagt in seinem Leben und die Sonne die scheint
für dich allein heute {Erinnerungen, K08m?} [20] ja deswegen
hab ich ihn auch gemocht weil ich gesehn hab er versteht oder kann nachfühlen
was eine Frau ist {Erinnerungen, K08m?} [21] und ich hab auch gewußt
ich kann ihn immer um den Finger wickeln
{K02h} und da hab ich ihm
die ganze Lust gegeben die ich konnte und hab ihn so weit gebracht daß
er mich gebeten hat ja zu sagen und zuerst hab ich gar keine Antwort gegeben
hab bloß so rausgeschaut aufs Meer und über den Himmel ich mußte
an so viele Sachen denken von denen er gar nichts wußte {Erinnerungen}
..."
Ein schönes Textbeispiel für die Literatur
des Bewusstseinsstromes,
aber eine Herausforderung für die Phantasieanalyse!
Aus Dada und Surrealismus:
Dada-Manifest 1916 {}
"Als er [Hugo Ball] sein Dada-Manifest am 14. Juli 1916 vortrug, teilte er dem staunenden Publikum mit: «Wie erlangt man die ewige Seligkeit? Indem man Dada sagt. Wie wird man berühmt? Indem man Dada sagt. Mit edlem Gestus und mit feinem Anstand. Bis zum Irrsinn, bis zur Bewusstlosigkeit. Wie kann man alles Aalige und Journalige, alles Nette und Adrette, alles Vermoralisierte, Vertierte, Gezierte abtun? Indem man Dada sagt. Dada ist die Weltseele, Dada ist der Clou, Dada ist die beste Lilienmilchseife der Welt. Dada Herr Rubiner, Dada Herr Korrodi, Dada Herr Anastasius Lilienstein.» [https://www.nzz.ch/feuilleton/100-jahre-dada/dada-geschichten-ii-was-bedeutet-dada-ld.5073] Das ist ein Bericht mit Zitaten, kein Phantasieren.
Aus Dalis Unabhängigkeitserklärung
der Phantasie und Erklärung
der Rechte des Menschen auf seine Verrücktheit. [1939].
"Nur Heftigkeit und Dauer eures gestählten Traumes können
der furchtbaren mechanischen Zivilisation widerstehen, die euer Feind und
der Feind des »Lustprinzips« aller Menschen ist. Ein Mann hat
das Recht, Frauen mit ekstatischen Fischköpfen zu lieben. Ein Mann
hat das Recht, lauwarme Telefone ekelhaft zu finden und Telefone zu fordern,
die so kalt, grün und aphrodisisch sind [<290] wie der von Gesichten
heimgesuchte Schlaf der spanischen Fliegen. Telefone, die so barbarisch
sind wie Flaschen, werden sich von der lauwarmen Verzierung der Louis-XV.-Löffel
befreien
und langsam die Bastarddekorationen unserer milde verblaßten Dekadenz
mit eisigem Schamgefühl bedecken.
Der Mensch hat das Recht, den Schmuck einer Königin
als »Lustobjekte« für sich zu fordern: Kostüme für
seine Möbel! für seine Zähne! selbst für Gardenien!
Handbestickte Kissenbezüge werden die außerordentliche Empfindlichkeit
von »Kalbslungeneisenbahnschienen« schützen, bei der Herstellung
von Automobilen wird man buntes Glas mit persischen Mustern einführen,
um das häßliche, rohe Tageslicht der Landschaften fernzuhalten.
Die Farbe alten Absinthes wird das Jahr 1941 beherrschen. Alles wird grünlich
sein. »Grün, ich will dich grün« — grünes Wasser,
grüner Wind, grünes Hermelin, grüne, vom Schlaf geschwellte
Eidechsen, die die grüne Haut, die blendenden Dekolletés der
Schlaflosigkeit entlanghuschen, grüne Silberplatte, grüne Schokolade,
grün die Elektrizität, die im Todeskampf das lebendige Fleisch
der Bürgerkriege versengt, grün das Licht meiner Gala!"
- Galas erste Begegnung
mit Breton {}
"Simone Kahn: "Im Parc du Luxembourg schien die Sonne, als ich die drei Freunde ansprach. Breton war ein etwas bleicher und magerer junger Mann, der trotz seiner schlechten finanziellen Situation eine gewisse Eleganz wahrte. "Sie müssen wissen, ich bin kein Dada", sagte ich ihm von vorneherein. "Ich auch nicht", gab er zurück, mit diesem Lächeln, das er sein Leben lang beibehalten sollte, wenn er sich von seinen eigenen doktrinären Vorgaben distanzierte. Er ist eine ganz eigenwillige Dichterpersönlichkeit, hingerissen vom Außergewöhnlichen und Unmöglichen. Ein rechtes Maß an Unausgeglichenheit, zusammengehalten durch einen scharfen, selbst im Unbewussten wirkenden Verstand, eindringlich, mit einer unbestreitbaren Originalität. Äußerste Schlichtheit und Aufrichtigkeit noch im Widerspruch." Quelle: André Breton und der Surrealismus, Deutschlandfunk 20.02.2016.
Paul Eluard Galas
erster Ehemann
"Hauptthema allerdings ist die Liebe, in der Korrespondenz wie in der
Poesie Eluards, jedenfalls der frühen: "Es gibt kein Leben", so der
Briefschreiber im März 1929, "es gibt nur die Liebe." Und auf derselben
Seite: "Ohne die Liebe ist alles für immer verloren, verloren, verloren.""
Quelle: DER SPIEGEL 9, 1985 "Nur die Liebe Leidenschaftliche Briefe des
Dichters Paul Eluard an seine Frau Gala, die ihn wegen Dali verließ,
sind in Paris veröffentlicht worden." [Online]
Das ist keine Phantasie, sondern eine persönliche Lebenseinstellung.
Nimmt man aber den Satz ""Wir sind nie wirklich getrennt gewesen", obwohl
sie ihn schon beinahe 20 Jahre zuvor verlassen hatte." hinzu, so stellt
dieser ziemlich sicher eine Wunsch-Phantasie Eluards dar.
Aus Thomas Morus Utopia
"Der Verkehr der Utopier untereinander ... Jede Stadt zerfällt
in vier gleiche Teile. In der Mitte eines jeden befindet sich ein Markt
für alle Arten von Waren. Dorthin schafft man die Arbeitserzeugnisse
einer jeden Familie in bestimmte Häuser, und die einzelnen Warengattungen
sind gesondert auf Speicher verteilt. Jeder Familienvater verlangt dort,
was er selbst und die Seinen brauchen, und nimmt alles, was er haben will,
mit, und zwar ohne Bezahlung und überhaupt ohne jede Gegenleistung.
Warum sollte man ihm nämlich auch etwas verweigern? Alles ist ja im
Überfluß vorhanden, und man braucht nicht zu befürchten,
daß jemand die Absicht hat, mehr zu verlangen, als er braucht. Denn
warum sollte man annehmen, es werde jemand über seinen Bedarf hinaus
fordern, wenn er sicher ist, daß es ihm niemals an etwas fehlen wird?
Werden doch bei jedem Lebewesen Habsucht und Raubgier durch die Furcht
vor Mangel hervorgerufen und beim Menschen allein außerdem noch durch
Stolz, da er es sich zum Ruhme anrechnet, durch ein Prahlen mit überflüssigen
Dingen die anderen zu übertreffen; für diese Art Fehler ist in
den Einrichtungen der Utopier überhaupt kein Platz." [Quelle PG https://gutenberg.spiegel.de/buch/utopia-1321/8]
Eine spontane Imganiation nach Leuner (1985),
S. 45 {mit Kriterien signiert}
"Die junge Kollegin arbeitet in einem Krankenhaus. Im Nachtdienst nimmt
sie einen Patienten auf, der einen vital bedrohlichen Kreislaufkollaps
hat. Vor der Trage des Patienten stehend, muß sie in akuter Not entscheiden,
was zu geschehen hat. Fieberhaft überlegt sie, was diagnostisch in
Frage kommt und was sie zunächst verordnen muß. Um sich besser
konzentrieren zu können, schließt sie für einige Momente
die Augen. Da erscheint vor den geschlossenen Lidern deutlich das Bild
einer Landschaft, die von einem breiten Strom überschwemmt wird. Das
Wasser steigt in beängstigender Weise höher und höher. Seine
Massen überfluten Wiesen und Felder, fließen in die Häuser
hinein, und schließlich versinkt alles in den Fluten: Bäume,
Häuser und die ganze Landschaft. Hinterher wundert sie sich selbst
über diese blitzschnell abgelaufene Imagination. Sie versteht sie
als Ausdruck ihrer inneren Erregung, die sie selbst nur andeutungsweise
gespürt hat, glaubte sie sich doch nüchtern und gefaßt,
in ärztlicher Routine handelnd. Nachdem sich der Zustand des Patienten
später gebessert hat, schließt sie instinktiv - gewissermaßen,
um nun zur Gegenprobe in sich «hineinzuschauen» - die Augen
nochmals. Wieder erscheint eine ganz ähnliche überschwemmte Szene,
die Fluten gehen nun aber zurück. Unter den abfließenden Wassern
breitet sich bald eine Landschaft mit großen, lichten Wiesen im Sonnenschein
aus. Eine maigrüne Birkenallee fuhrt durch das heitere, freundliche
und beruhigende Bild."
Analyse einiger Phantasieeinträge in Büchern, Wörterbüchern und Lexika
In geschweiften Klammen {} werden die Kriterien bon mir eingefügt.
Arnold, Eysenck, Meili (1987), Bd. 2, Sp. 1603-05.
gk
{mit
Kriterien signiert}
"Phantasie. GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK. Der Begriff „Phantasie"
(gr.) bedeutet soviel wie Vorstellungskraft. Trevisa (1398) schreibt, daß
bei Nacht häufiger P.n auftreten als am Tag. Newton erwähnt die
Kraft der P., die es möglich macht, farbig zu träumen. Der Begriff
bezieht sich auf subj. >Vorstellungen (keine >Erinnerungsbilder) {K08m},
seien es >Wachträume und Träume im Schlaf oder >Halluzinationen,
in denen visuelle, auditive, taktile und andere Sinnesmodalitäten
(deren Kombinationen) enthalten, sein können. Hume (1883) trennt Vorstellungen
von >Empfindungen; letztere seien eindringlicher und lebhafter. Er meint
aber, daß die Vorstellungen den Empfindungen im >Schlaf, im Fieber
und bei >Geisteskrankheiten an Lebendigkeit nahekommen können. Maury
(1861) verwendete den Begriff . „hypnagog" (wie S. Freud in seiner „Traumdeutung")
für die Vorstellungsbilder, die im Halbschlaf auftauchen. Freud beschäftigte
sich mit P. unter dem Konzept der „Primärprozesse" im Ggs. zu den
„Sekundärprozessen" des zielgerichteten Denkens. Die Primärprozesse
äußern sich selbst in Träumen und Tagträumereien durch
Wunscherfüllungsphantasien
{K04h}.
Eine weitere Bezeichnung für P. hat Bleuler in seinem Konzept des
>Autismus eingeführt. Autistisches (im Ggs. zu realistischem) Denken
kann Sekunden oder ein ganzes Leben lang dauern und die Realität vollständig
verdrängen (z. B. bei der >Schizophrenie). „Ergebnisse autistischen
Denkens werden nicht durch realistische und logische Kritik geprüft
... es interessiert sich nicht für die Wirklichkeit, sondern für
die Erfüllung seiner Wünsche" (Bleuler, 1922; s. Rapaport, 1951).
Bleuler fügt hinzu, daß das normale Denken eine Mischung aus
realistischem (R-Denken) und autistischem (A-Denken) ist (McKellar, 1957).
Das A-Denken kann die Persönlichkeit zerstören, was bei den >Psy[>1604]chosen
vorkommt, oder es kann zeitweilig überhandnehmen, wie z. B. im Traum,
in hypnagogen Zuständen, unter dem Einfluß von halluzinogenen
Stoffen und bei sensorischer Deprivation. Ebenfalls taucht es bei Tagträumereien
auf, in der Mythologie und im Aberglauben. Einige >projektive Verfahren
{K05h},
wi4 z. B. der >TAT, enthalten Standardbilder, die die P. anregen sollen;
je nach der vom Pbn gegebenen (phantasievollen, -armen) Interpretation
dieser Bilder werden dann Informationen über die >Persönlichkeit
gewonnen.
In seinen frühen Untersuchungen über Vorstellungsbilder
fand >Galton (1883) „eine ausreichende Verschiedenheit von Fällen,
um beweisen zu können, daß die Stärke von Vorstellungsbildern
kontinuierlich zunimmt, angefangen mit fast völligem Fehlen von Vorstellungen
bis zu ausgeprägten Halluzinationen". Er beobachtete, daß kulturelle
Einflüsse die P.tätigkeit unterdrücken oder verstärken
(anregen) können, z. B. dann, wenn „die nur schwach wahrgenommenen
P.n der Durchschnittsmenschen von hochgestellten Autoritätspersonen
als von großer Bedeutung betrachtet werden ... dadurch, daß
man sich in solchen Fällen regelmäßig mit ihnen beschäftigt,
gewinnen sie immer mehr an Präzision".
NEUERE ERGEBNISSE. Das Konzept des A-Denkens wurde
widerlegt, als man entdeckte, daß registrierbare Phänomene,
auch die schnellen Bewegungen der Augen (REM's = rapid eye movements),
Begleiterscheinungen der Träume zu sein scheinen (>Traum; >Schlaf)
(Aserinsky & Kleitmann, 1958). Durch die Registrierung der REM-Phasen
kann die Traumdauer bestimmt und die Zahl der Träume in einer Nacht
festgestellt werden. Träumen scheint ein allgemein verbreitetes Phänomen
zu sein, und Kleitmann (1963) unterscheidet weniger zwischen Träumern
und Nicht-Träumern als zwischen solchen Menschen, die sich an die
Träume erinnern, und solchen, die sich nicht erinnern können.
Singer und Craven (1961; vgl. Singer, 1966), die Tagträumereien und
allgemeinere P.n mit Hilfe der REM-Phasen untersucht haben, finden einen
Höhepunkt der Tagträumereien in der Gruppe von 18-29 Jahren,
und sie berichten, daß [>1605] 96 % ihrer Versuchspersonen täglich
Tagträume hatten.
Holt (1964) betont die Bedeutung der Erforschung
der P. und der Vorstellungstätigkeit für die der Praxis sehr
nahen Probleme der modernen >Verkehrs- und Betriebspsychologie. Der Test
von R. Gordon (1949), der die Beweglichkeit von Vorstellungsbildern prüft,
und der Test von Bett (1909) für deren Lebhaftigkeit werden immer
mehr verwendet (Richardson, 1969). Synästhesien wurden intensiv von
Luria (1969) an einer Vp untersucht, die diese Art von Vorstellungen hatte.
Heute kennt man viele Pflanzen und deren Extrakte, die das A-Denken hervorrufen;
Untersuchungen der Ethnobotanik lassen vermuten, daß es noch viele
unerforschte Quellen von halluzinogenen Stoffen gibt. Hierin ist ein vielversprechendes
Gebiet für die Erforschung der chemisch stimulierten P. zu sehen (Efron,
Holmstedt & Kline, 1967). Auf diesem Gebiet, ebenso wie bei der Erforschung
der sensorischen Deprivation, wurde der Begriff >„Halluzination" (wie auch
P.) viel zu weit ausgedehnt. Der allgemeinere Begriff >Vorstellung
ist eine zutreffendere Bezeichnung für viele der hier erwähnten
Phänomene.
Lit.: Efron, D. H, Holmstedt, B. & N. S.
Kline (Eds.): Ethnopharmacologic search for psychoactive drugs. Washington,
1967; Galton, F.: Inquiries into human faculty. London, 1883; Holt,
R. R.: Imagery: the return of the ostracized. Amer. Psychologist, 1964;
Kleitman,
N.: Sleep and wakefulness. Chicago, 1963; Luria, A. R.: The
mind of a mnemonist. London, 1969; McKellar, P.: Imagination and
thinking: London, New York, 1957; Rapaport, D.: Organization and
pathology of thought. New York, 1951; Richardson, A.: Mental imagery.
London, 1969; Singer, J. L.: Daydreaming: an introduction to the
experimental study of inner experience. New York, 1966. P. McKellar"
Vollzitat mit freundlicher Genehmigung
des Herderverlage vom 07.08.2017.
Bertelsmann (1995) Lexikon der Psychologie (1995). {mit Kriterien signiert}
"Phantasie [griech.], Einbildungskraft (-»Imagination); die Fähigkeit, etwas nicht sinnlich Gegebenes und auch nicht erinnerungsmäßig Vergegenwärtigtes anschaulich {K08m} vorzustellen, gleichviel, ob das Ergebnis dieser Vorstellung nur eine neue {K03h} Kombination früherer Wahrnehmungen ist oder eine völlig neuartige Schöpfung, ob es auch in der Wirklichkeit existieren könnte oder nicht {K02h}. - Die Ph. wird oft (neben der -»Inspiration) als Hauptbedingung der künstlerischen Produktivität angesehen; andererseits sind auch Traumbilder echte Ph.-Vorstellungen. Die Ph.-Inhalte sind meist durch triebhafte oder emotionale Momente mitbestimmt.
Die biologische Funktion der Ph. wird in der durch die Vorstellungskraft geschaffenen Möglichkeit eines inneren Probehandelns gesehen, das es erlaubt, verschiedene Verhaltensalternativen durchzuspielen, ohne in der Wirklichkeit ein Risiko eingehen zu müssen. Psychologisch gilt die Ph. als ein Intelligenzfaktor, weil sie zum Finden von Problemlösungen beitragen kann. Bei S. Freud ist die Ph. den -> Primärprozessen zugeordnet."
Bilder als Kriterium bei Rubinstein (1968), S. 410 {mit Kriterien signiert}
"DAS WESEN DER EINBILDUNGSKRAFT
Die Bilder {L07m}, mit denen der Mensch operiert, bleiben nicht auf die Reproduktion des unmittelbar Wahrgenommenen beschränkt. Der Mensch kann auch das in Bildern vor sich sehen, was er nicht unmittelbar wahrgenommen hat. Er kann auch etwas sehen, was es überhaupt nicht gibt, und auch etwas, was es gerade in dieser konkreten Form in der Wirklichkeit nicht gibt {K02h}. So kann nicht jeder in Bildern verlaufende Prozeß als ein Reproduktionsprozeß verstanden werden. Eigentlich ist jedes Bild in irgendeinem Maße sowohl Reproduktion — wenn auch eine ganz entfernte, mittelbare, modifizierte — als auch Umbildung des Wirklichen. Diese beiden Tendenzen, die immer in einer gewissen Einheit vorliegen, divergieren gleichzeitig. Während die Reproduktion der Grundzug des Gedächtnisses ist, ist für die Einbildungskraft die Umbildung des Reproduzierten charakteristisch. Sich etwas einbilden heißt, es umbilden.{K03h}"
Spektrum Lexikon der Psychologie {mit Kriterien signiert}
"Phantasie 1) Produktionskraft des Bewußtseins, wie Märchen oder Mythen als eine besondere Verarbeitungsform der Wirklichkeit. Der Entwurf von Alternativen {K03h} im Gegensatz zur Realität kann unterschiedliche Bedürfnisse {K04h} erfüllen: a) ästhetische Bedürfnisse, um den persönlichen Erlebnisraum zu vergrößern; b) praktische Bedürfnisse, um Konsequenzen in der Zukunft {K07m} gedanklich vorwegzunehmen (Problemlösen). c) Ersatzbefriedigung {K04h}, indem das durch den Alltag beschädigte Selbstbewußtsein durch Tagträume und Utopien ausgeglichen wird. Das Phantasieren hilft, Wohlbehagen und narzißtisches Gleichgewicht zu stabilisieren, und Bedrohungen oder beschämende Erfahrungen abzuwehren. Es ist außerdem eine Quelle kreativer Handlungen (Kreativität). 2) Zentraler, mehrdeutiger Begriff der Psychoanalyse: a) Phantasie im Sinne von Einbildungskraft, d.h. als Vermögen zu imaginieren; b) Phantasien als Inhalte der phantasierten, imaginären Welt {K02h}; c) Phantasie als schöpferische Aktivität, die diese Phanatasie-Inhalte belebt. Nach Freud sind Phantasien auf die stimulierende Funktion von Triebimpulsen zurückzuführen. Phantasietätigkeit sei der Gegensatz zum realitätsgerechten Denken, die Fortsetzung des Kinderspiels, sie sei mit Träumen verwandt und würde aus Wunschvorstellungen {K04h} heraus gebildet. Ihre Funktion sei, in der Wirklichkeit nicht gegebene Befriedigungsmöglichkeiten {K02h} auszumalen und Lustwünsche unabhängig vom Triebobjekt zu befriedigen {K04h}. Im Gegensatz zur Vorstellung beinhalte Phantasie eher eine Szenen- oder Handlungsabfolge, bei der die Realitätsprüfung weitgehend ausgeschaltet wird."
James, William Phantasie aus der Psychologie (1909) > ausgelagert, da zu umfangreich. Obwohl nicht ausdrücklich methodisch erläutert, beginnt James mit Definitionscharakteristiken (Abbilder neu kombiniert := Phantasie).Er hat viele Selbstversuche gemacht und empirisches Material zusammengetragen, was ihn wohltuend hervorhebt.
Einige Extrakte
- "Die Fähigkeit, solche Abbilder früher erlebter Originale zu reproduzieren, wird Phantasie oder Einbildungskraft genannt. Wir heißen die Phantasie „reproduktiv", wenn die Abbilder dem Original genau entsprechen; „produktiv", wenn Elemente von verschiedenen Originalen zusammengefügt werden, so daß ein neues Ganzes entsteht.
- "Galton begann im Jahre 1880 eine statistische Untersuchung, von der man sagen kann, daß sie eine neue Phase in der Entwicklung der deskriptiven Psychologie herbeigeführt hat. Er schickte an eine große Anzahl von Leuten ein Zirkular mit der Aufforderung, das optische Erinnerungsbild, ihres Frühstückstisches an einem gegebenen Morgen zu beschreiben. Die dabei beobachteten Verschiedenheiten waren enorm; und sonderbarerweise zeigte es sich, daß wissenschaftlich hervorragende Menschen im Durchschnitt eine geringere Fähigkeit zur Visualisierung bezeugten, als jüngere und unbedeutendere Personen." (S. 304)
- Im weiteren (304-309) geht es um Erinnerungs- und Vorstellungstypen bis James S. 309 unten auf Patholgische Verschiedenheiten zu sprechen kommt, wobei er zunächst feststellt: "as Studium der Aphasie (Seite 111) hat in den letzten Jahren gezeigt, wie über alle Erwartung groß die Verschiedenheit der Individuen im Gebrauch [>310] ihrer Phantasie ist."
Werden diese Bilder mit Begleitumständen vorgestellt, die konkret geuug sind, um ein Datum zu konstituieren, dann bilden sie, wenn sie erweckt werden, Erinnerungen. Den Mechanismus der Erinnerung haben wir soeben kennen gelernt. Wenn diese geistigen Bilder sich aus frei kombinierten Gegebenheiten zusammensetzen und keine frühere Kombination genau wiedergeben, dann haben wir es mit eigentlichen Akten der Phantasie zu tun.
Die Menschen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer optischen Phantasie. — Unsere Ideen oder Bilder von vergangenen sinnlichen Erlebnissen können entweder deutlich und genau oder dunkel, verwischt und unvollständig sein. " (S. 303)
Lucka, Emil (1908) Die Phantasie. Eine psychologische Untersuchung. Leipzig: Braumüller.
- Lucka 1908 Inhaltsverzeichnis
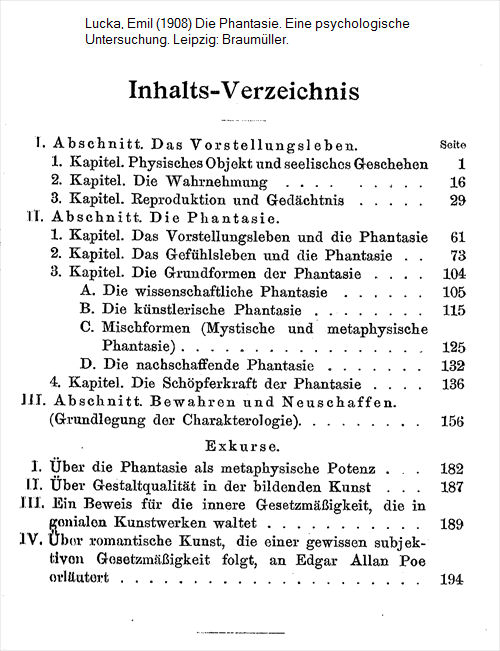
Lucka: Verlagerung
Quelle Lucka (1908), S. 63: "Eine interessante Abart der Bildkombination
findet sich besonders im Traume häufig. Ein Gebilde wird in eine ganz
neue Umgebung versetzt, durch die es selbst in seiner Gestalt verändert
wird. So kann z. B. das gutmütige Gesicht eines Bekannten auf dem
eisengepanzerten Leib eines Condottiere gesehen werden, der unbewegt über
ein Leichenfeld reitet. Die neue Umgebung wirft ihren blutigen Reflex auf
das vertraute, anders gewordene Gesicht."
Lucka: Kombinationen
durch Wiederholung
Quelle Lucka (1908), S. 63: "Oder die Kombination entsteht durch eine
Wiederholung des gleichen Gebildes. Das gesehene und später wiedererinnerte
Bild; eines römischen Soldaten kann vielleicht zur Vorstellung einer
ganzen Legion werden. Auch hier ist Kombination im Spiel: die Vorstellung
einer geordneten Menschenmenge tritt gewissermaßen mit der des Söldners
in Beziehung und formt sie um."
Lucka: Überlagerungen
Quelle Lucka (1908), S. 63: "2. Ein ganz typisches Gebilde der
Traumphantasie ist es, daß verschiedene Bilder nicht wie in der Kombination
zu einem gegliederten Neuen verschmelzen, sondern sich gewissermaßen
übereinander lagern, ohne doch ein neues Bild entstehen zu lassen.
Etwas Unbestimmtes, Unfaßbares haftet diesen Gebilden an. Die unklare
Vorstellung eines Menschen ist da, der aber doch wieder ein wildes Tier,
dann ein Berg zu sein Bcheint. Verschiedene Vorstellungen fallen wie halbdurchsichtige
Bilder übereinander, hemmen sich gegenseitig und bilden doch nichts
geformtes Neues."
Ribot, Theodule (dt. 1902; orig 1900) Die Schöpferkraft der Phantasie. > Inhaltsverzeichnis.
- Phantasie bei einer
Begegnung
Quelle Ribot (1902), S. 224: "Von vielen Beispielen gebe ich nur eins. Einer meiner Gewährsmänner schreibt mir, wenn seine Aufmerksamkeit sich in der Kirche, im Thaeater, auf Plätzen ober Bahnhöfen auf irgend eine Person, Mann ober Frau, richte, stelle er sich sogleich nach ihrem Aussehen, ihrer Kleidung unb ihrem Benehmen ihre augenblickliche und frühere Lage, ihre Lebensweise und Beschäftigung vor und sogar das Stadtviertel, in dem sie lebe, ihre Wohnung mit Einrichtung u.s.w., eine in den meisten Fällen irrige Konstruktion, wofür ich mannigfache Beweise habe. Sicherlich ist diefe Veranlagung normal; sie entfernt sich vom Durchschnitt nur durch eine ungewöhnliche Phantasiekraft, die bei anderen durch eine übermäßige Neigung zur Beobachtung und Analyse, zur Kritik, zum logischen Denken oder zu Spitzfindigkeiten ersetzt ist. Um den entscheidenden Schritt zu tun, um anormal zu werden, muß eine weitere Bedingung hinkommen, die Intensität der Vorstellungen." Anmerkung: Ribot geht von der Phantasie direkt zu Vorstellungen über als ob das für ihn das Gleiche sei.
Sanders Phantasietest (Fortsetzung einer angefangenen Zeichnung)
"Bei diesem Test wurden die Probanden dazu aufgefordert eine Zeichnung fortzusetzen, die bereits mit ein paar Linien und Kurven auf einem Blatt begonnen wurde. Er wurde nur 1955 und nur bei den Kriegskindern verwendet." [Q]
Stern, William (1950) 18. Kap.: Phantasie und 19. Kap.: Sonderfunktionen der Phantasie (Träumen, Spielen Schaffen) in Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage. in Arbeit.
Wundt (1918) zur Phantasie > Gesamttext ausgelagert, da zu umfangreich.
Wundt erkennt zwar zu Beginn des § 17 den konstruktiven Charakter der Analyse der Bewusstseinsvorgänge, aber er verfolgt ihn nicht konsequent und redet so, als entsprächen seine Interpretatiuonen DER Wirklichkeit, DIE es so nicht gibt, weil sie notwendigerweise konstruiert werden muss. Die konstrukive Notwendigkeit der Begriffsunterscheidungen für die Teile des Bewusstseinsstroms ist aber vielfach auch heute von der akademischen Psychologie nicht verstanden. Unser Erleben - nach Wundt zutreffend eine "Gesamtvortstellung" - gibt es natürlich, aber wie wir es wissenschaftlich erfassen, dafür gibt es mindestens mehrere, wenn nicht viele Wege und damit Konstruktionen. Ohne konensorientierte Normierung wird die wissenschaftliche Psychologie nicht weiter kommen.
Einige Extrakte zunächst aus § 17 Apperzeptionsverbindungen:
- "14. Insofern die Vorstellungsbestandteile eines durch apperzeptive Synthese entstandenen Gebildes als die Träger des übrigen Inhaltes betrachtet werden können, bezeichnen wir ein solches Gebilde allgemein als eine Gesamtvorstellung."
- "praktisch kaum eine scharfe Grenze zwischen Phantasie- und Erinnerungsbild zu ziehen." (§ 17)
- "Man kann daher in Phantasiebildern {K08m} sich ergehen wie in wirklichen Erlebnissen. Bei Erinnerungsbildern ist das nur dann möglich, wenn sie zu Phantasiebildern werden, d. h. wenn man die Erinnerungen nicht mehr bloß passiv in sich aufsteigen läßt, sondern bis zu einem gewissen Grade frei {K06h} mit ihnen schaltet, wobei dann freilich auch willkürliche Veränderungen derselben, eine Vermengung erlebter und erdichteter Wirklichkeit, nicht zu fehlen pflegt. Darum bestehen alle unsere Lebenserinnerungen aus "Dichtung und Wahrheit". Unsere Erinnerungsbilder wandeln sich unter dem Einfluß unserer Gefühle und unseres Willens in Phantasiebilder um, über deren Ähnlichkeit mit der erlebten Wirklichkeit wir meist uns selbst täuschen. {K02h}" (§ 17)
- "18. Phantasie- und Verstandestätigkeit sind nach allem dem nicht spezifisch verschiedene, sondern zusammengehörige, in ihrer Entstehung und in ihren Äußerungen gar nicht zu trennende Funktionen, die in letzter Instanz auf die nämlichen Grundfunktionen der apperzeptiven Synthese und Analyse zurückführen." (§ 17)
- "Indem sich diese ungehemmte Beziehung und Verknüpfung {K03h} der Phantasiebilder mit Willensantrieben verbindet, die den Vorstellungen gewisse, wenn auch noch so dürftige Anhaltspunkte in der unmittelbaren Sinneswahrnehmung zu schaffen suchen, entsteht der Spieltrieb des Kindes. Das ursprüngliche Spiel des Kindes ist ganz und gar Phantasiespiel, während umgekehrt das des Erwachsenen (Kartenspiel, Schachspiel, Lotteriespiel u. dgl.) fast ebenso einseitig Verstandesspiel ist. ... " (§ 20)
"10. Aus der ursprünglichen phantasiemäßigen Form des Denkens entwickeln sich nun sehr allmählich die Verstandesfunktionen, indem in der früher (§ 17, 16 f.) angegebenen Weise die in der Wahrnehmung gegebenen oder durch kombinierende {K03h} Phantasietätigkeit gebildeten Gesamtvorstellungen in ihre begrifflichen Bestandteile, wie Gegenstände und Eigenschaften, Gegenstände und Handlungen, Verhältnisse verschiedener Gegenstände zueinander, gegliedert werden. ..." (§ 20)
Differentialpsychologische Unterscheidungen und Überlegungen
Sofern Texte zitiert werden, werden für die Kriterien entsprechende Signaturen vorgenommen
Allegorie und phantasieren
Analogie und phantasieren
Arbeiten und phantasieren
{mit Kriterien signiert}
"DIE Phantasie gehört, wie das Denken, zu den höheren Erkenntnisprozessen,
die den menschlichen Charakter der Arbeit ganz offensichtlich machen. Der
Mensch kann keine Arbeit beginnen, ohne in seiner Phantasie eine Vorstellung
{K08m}
von
ihrem Ergebnis zu haben. Die Vorstellung des zu erwartenden Arbeitsergebnisses
in der Phantasie unterscheidet die Tätigkeit des Menschen grundlegend
von der instinktiven Tätigkeit des Tiers. Phantasie gehört zu
jeder beliebigen Arbeit. Sie ist unerläßlich für die Tätigkeit
des Künstlers, des Konstrukteurs, des Wissenschaftlers. Strenggenommen
ist die Phantasie für das handwerkliche Anfertigen eines einfachen
Tisches nicht minder notwendig als für das Komponieren einer Arie
oder das Verfassen einer Novelle. Der Handwerker muß sich vorstellen
{K08m}
können,
welche Form der Tisch haben wird, wie hoch,, wie lang, wie breit er sein
muß, wie die Beine zu befestigen sind, ob er seiner Bestimmung als
Eßtisch, als Experimentier- oder Schreibtisch gerecht werden wird;
Kurzum, bereits vor Beginn der Arbeit muß er diesen Tisch vor Augen
haben, als wäre er schon fertig.
{K07m}" (Petrowski 1976, S.
345)
Assoziation
und phantasieren
Ganz allgemein bedeutet assozieeren verbinden. Gesellt sich zu einem
Bewusstseinsinhalt A ein Bewusstseinsinhalt B, so kann man A und B als
miteinander verbunden ansehen. Denke ich an A="Tasse" und fällt hierzu
weiter B="Teller" ein, dann sind "Tasse" und "Teller" miteinander verbunder
oder assoiziiert. Solche Verbindungen können mehr oder minder fest
oder konstant sein, sie können sich aber, z.B. bei geringem Gebrauch
auch zurückbilden, schwächer werden.
Der Assoziationsbegriff spielt eine grundlegende und wichtige Rolle
auf vielen Gebieten der Psychologie, besonders auch beim Denken und Lernen.
Assoziation ist auch der Namensgeber für die sog. Assoziationspsychologie.
Aufmerksamkeit
und phantasieren
Wir unterscheiden die frei schwebende, die gerichtete und die verdichtete
Aufmerksamkeit. Der Zustand freischwebener Aufmerksamkeit sind für
Phantasien günstig, weil hier Lenkung und Kontrolle der Bewusstseinsvorgänge
gar nicht oder nur gering ausgeprägt sind.
Aussagen und phantasieren
Bei Aussagen geht es oft darum, die wahren Elemente von den falschen
oder phantasierten zu unterscheiden. In weit
mehr Aussagen zu Erinnerungen spielt mehr Phantasie hinein als man gewöhnlich
meint. Die Phantasieanteile herauszufinden kann sehr schwierig, manchmal
unmöglich sein (>Aussagepsychologie).
Bedeutung
und phantasieren
Beziehung zwischen einem Sachverhalt und diesen repräsentierende
Zeichen. Bedeutung ist ein grundlegender Begriff der Wissenschaftstheorie
und Zeichenlehre, insbesondere der Semantik (Bedeutungslehre). Die Bedeuutungen
kann mann dem Sprachgebrauch - und wie er in Wörterbüchern und
Lexika dargelegt wird - entnehmen. Die Worte sind die "Kleider" der Begriffe,
in denen meist vielfältige Bedeutungen stecken (> Homonyme).
In die Bedeutungsdeutung kann viel Phantasie einfließen, woraus viele
Missverständnisse und Kommunikationsprobleme resultieren können.
Im psychischen Bereich sind genaue Bedeutungszuweisungen besonders schwierig,
Begehren/ bedürfen
und phantasieren
Eine wahrscheinlich häufige und wichtige Quelle für die Erzeugung,
Pflege, Ausgestaltung und Hingabe an Phantasien. Phantasien spielen eine
besondere Rolle im Bereich der Erotik, Sexualität, Verliebtheit und
Liebe.
Begriff
und phantasieren
Phantasieren kann auch mit Begriffen erfolgen. Einige Begriffe - besonders
aus der Religion, Mythen-, Märchen- und Sagenwelt - repräentieren
auch direkt Phantasien, z.B.: Gott,
Auserwähltidee,
Fee, Hexe, Pegasus, Chimäre.
Bewusstsein und phantasieren
Phantasien gibt es in verschiedenen Bewusstseinszuständen:
wach: Halbschlaf, Traum, Trance, Dämmerzuständen, ... Besonders
günstig für Phantasien sind Zustände, in denen Lenkung und
Kontrolle der Bewusstseinssröme herabgesetzt sind.
Denken
und Phantasieren {}
Denken und phantasieren sind schwierig auseinander zu halten. Jedes
Phantasieren kann auch als Denken prädziert werden - prädizieren
heißt ein Merkmal oder Kriterium zu- oder absprechen -, aber nicht
jedes Denken kann als Phantasie prädiziert werden. Ich denke, das
Fenster ist offen und es ist tatsächlkich offen, dann handelt
es sich um einen wahren Gedanken. Ich denke, das Fenster ist offen,
aber es ist tatsächlich zu, dann handelt es sich um einen Irrtum.
Stelle ich mir aber vor, dass das Fenster offen ist, dann ist das
eine Phantasie, unabhängig davon ob es offen ist oder nicht. Schaue
ich zum Fenster und nehme wahr, dass es offen ist, dann handelt es sich
um eine zutreffende Wahrnehmung.
Denken heißt geistige Modelle bilden
oder zueinander in Beziehung setzen. Reicht diese Definition? Ist
sie hinreichend klar, um andere Bewusstseinsprozesse davon abzugrenzen?
Geistige Modelle können anschaulich vorgestellt oder abstrakt sein.
So betrachtet erscheint es sinnvoll, denken in zwei Haupterscheinungsformen
zu fassen: anschauliches denken, abstraktes denken. Ich möchte aber
phantasieren nicht auf anschauliches Vergegenwärtigen beschränken.
Zum logischen Verhältnis von dsenken und phantasieren:
Jede Phantasie ist denken, aber nicht jedes Denken ist Phantasie.
Petrowski 1976, S. 345 {mit Kriterien signiert}
"Die Phantasie ist eng mit dem Denken verbunden. Ähnlich wie das
Denken ermöglicht sie die Vorwegnahme {K07m}. Worin besteht
das Gemeinsame von Denken und Phantasie? Was unterscheidet diese psychischen
Prozesse?
Wie das Denken tritt auch die Phantasie in einer
Problem Situation in Erscheinung, also dann, wenn es notwendig wird, Entscheidungen
zu treffen. Wie das Denken wird auch die Phantasie von den Bedürfnissen
der Persönlichkeit motiviert. Der wirklichen Befriedigung der Bedürfnisse
kann eine illusionäre Befriedigung der Bedürfnisse in der Phantasie
{K04h}
vorausgehen,
das heißt, es entsteht eine lebendige, klare Vorstellung von einer
Situation, in der diese Bedürfnisse befriedigt werden können.
Die vorwegnehmende Widerspiegelung der Wirklichkeit im Prozeß der
Phantasie verläuft in konkret-bildhafter Form
{K08m}, in Form
klarer Vorstellungen, während die vorwegnehmende Widerspiegelung im
Denkprozeß mit Begriffen operiert, die es ermöglichen, die Welt
verallgemeinert und vermittelt zu erkennen."
Einfall und phantasieren
Ein grundlegender Begriff der Bewusstseins-, Denk- und kreativen
(Problemlösungs-) Psychologie. Einfälle kann man im Assotiationsmodell
A o B (A verbunden mit B) als B betrachten, das in den Bewusstseinsstrom
einfällt. Einfälle können als mehr oder minder passend oder
nützlich bewertet werden. Es gibt aber auch eine Reihe von störenden
und die Lebensqualität beeinträchtigenden Einfällen (Zwangsgedanken,
Negatives).
Entscheiden
und phantasieren
"Wie das Denken tritt auch die Phantasie in einer Problem Situation
in Erscheinung, also dann, wenn es notwendig wird, Entscheidungen zu treffen."
(Petrowski 1976, S. 346) Das ist eine ziemlich apodiktisch-generalisierende
Behauptung, für die keine Belege erbracht werden. Phantasien können
insofern eine nützliche Rolle im Entscheidungsreigungsprozess spielen,
als verschiedene Möglichkeiten durchgespielt {K07m, K08m} werden
können, die eine Entscheidungen für diese oder jene erleichtern
können.
Erinnern und phantasieren
Erinnern heißt die Re-Präsentation
eines Erlebnis- oder früheren Bewußtseinsinhaltes aus
dem Gedächtnis. Erinnerungen könen mit Phantasien angereichert
sein - auch ohne dass es bemerkt wird..
Erleben und phantasieren
Erleben heißt die Grundfunktion der Bewusstseinsvorgänge:
mitbekommen, was in mir vorgeht.
> Vetter, August (1950) Die Erlebnisbedeutung der Phantasie.
Stuttgart: Klett.
Konzentrieren und phantasieren
Konzentrieren und phantasieren dürften sich meist ausschließen
Kreativität und phantasieren
Kreativ sein heißt Phantasien anwenden.
Lernen und phantasieren
Lernt man durch phantasieren? Kann man phantasieren lernen?
Methapher
und phantasieren.
Bildliche Metaphern können sehr dicht und klar, einen Sachverhalt
beschreiben, z.B.: "Trump dreht alle Uhren zurück, die Obama gestellt
hat." 'Hafen' statt 'Zuflucht', 'kalt' für 'gefühllos'.
Soweit Metaphern im Sprachgebrauch "eingebürgert" sind, sehe ich sie
nicht als Phantasien an.
Planen und phantasieren
Planen betriff gewöhnlich die Zukunft und damit etwas, was noch
nicht wirklich eingetreten ist. So gesehen könnte man alle Planungen
formal auch Phantasien als Phantasien ansehen, aber nicht umgekehrt. Dagegen
spüre ich aber ein starkes Unbehagen, das wahrscheinlich daher rührt,
dass es vollkommen rationale und banale Planungen gipt, z.B. ich gehe
heute in die Mensa zum Mittagessen, wo ich keinberlei Phantasie erkennen
kann. Anders ist es, wenn sich die Planung um die Frage, wie kann ich das
macheen, wie löse ich das Problem, wie kann ich das Ziel Z erreichen.
Problemlösen und
phantasieren
Ein Problem liegt vor, wenn nicht klar ist, wie ein Ziel erreicht werden
kann. Sobald Weg oder Methode klar sindm handelt es sich nicht mehr um
ein Problem, sondern um eine Aufgabe, die aber natürlich auch noch
gemacht werden muss. Hier täuschen sich nicht wenige Menschen auch
in der Psychotherapie, wenn sie meinen, wenn erst klar ist, wie es geht,
dann ist das Problem gelöst. Nein, es ist dann nur klar, wie es gelöst
werden kann. Phantasie braucht man in aller Regeln, wenn es um Problemlösungen
sog. 2. Ordnung geht.
Sexualität und phantasieren
Phantasieren spielt in der Sexualität eine sehr große Rolle.
Darüber gibt es viele Veröffentlichungen, teils um die Erregung
anzureizen mit und ohne PartnerIn.
- Von Nancy Friday gibt es einige Veröffentlichungen ("Die secuellen Phantasien der Frauen". "Verbotene Früchte Die geheimen Phantasien der Frauen")
- "Studie zu Erotikfantasien Der Sex im Kopf Ein Techtelmechtel mit zwei Partnern gleichzeitig oder Sex mit Prostituierten - kanadische Forscher haben untersucht, wie verbreitet Sexfantasien sind. Demnach gibt es fast nichts mehr, was nicht normal ist. ..." [SPON 31.10.2014]
- "Die Top 10 der häufigsten Sex-Fantasien von Männern ... (1) Sie verführt ihn - in der Öffentlichkeit ...; (2) Ein Dreier mit zwei Frauen ...; (3) Ein ganz spontaner Blowjob ... ; (4) Analsex; (5) Sex in der Öffentlichkeit ...; (6) Der unerfüllte Traum ...; (7) Viele mögen's hart ...; (8) Durchs Schlüsselloch spannen ...; (9) Durchs Schlüsselloch spannen ...; (10) One-Night-Stand ..." [miss.at 2017]
- "Männer fantasieren anders als Frauen ... Männer fantasieren anders als Frauen. Sie reagieren viel stärker auf optische Schlüsselreize. Frauen finden es erotischer, Geschichten zu hören. Männer reagieren auf das, was sie sehen. ..." [ZEIT MAGAZIN 13.05.2015]
Spielen und phantasieren
William Stern (1935), S. 482: "In den ersten Lebensjahren, etwa bis zum Eintritt in die Schule, ist das Spiel geradezu zentral für das kindliche Verhalten (man nennt diese Zeit deshalb auch das „Spielalter"). Hier fehlt auch noch die scharfe Sonderung von Spielwelt und Ernstwelt; alle Gegenstände der Umgebung und alle Handlungen des Kindes, auch die „ernsthaften", wie Essen, Sich-Anziehen u.s.w., werden ins Spiel einbezogen, mit Spiel durchsetzt; auch im Grade des „Ernstnehmens" besteht keine scharfe Grenze zwischen den beiden Lebensbereichen des Scheins und des Seins. Ob das Kind der Mutter beim Ankleiden des Babys durch Zureichen der Kleidungsstücke hilft, oder ob es seine Puppe ankleidet,macht erlebnismäfsig kaum einen Unterschied. — Das Schulalter schafft grundlegende Änderungen, indem das Kind die beiden, nun deutlich getrennten, Sphären der Arbeit und des Spiels neben einander durchlebt und erlebt ; von da an beginnt eine immer stärkere Entwicklung der Ernsttätigkeit und eine Zurückdrängung des Spielverhaltens, nach Zeitdauer und nach Lebensbedeutung. — Im Jugendalter treten dann Zwischenformen und Mischformen auf : Zwischenformen sind die Betätigungen des Sports, der durch sein Prinzip ständiger Leistungssteigerung nicht mehr rein in der Gegenwart sich befriedigt wie das Spiel, sondern Zukunftsziele des Fortschritts und des Rekords setzt; ferner das Sammeln, das Basteln und andere, schon auf Erzeugung dauernder Objekte gerichtete „Beschäftigungen". Eine Mischform ist das „Ernstspie1", d.h. ein Verhalten, welches bei subjektivem Ernstnehmen doch objektiv noch die Freiheit und Konsequenzlosigkeit des Spiels hat 2)."
Symbol
und phantasieren
Symbole sind Schöpfungen der Phantasie unter Einbeziehung von
Analogien.
Tagträumen und phantsieren
Tagträumen ist phantasieren.
Träumen und phantasieren
William Stern (1935), S. 469:
"Im Traum ist jeder Mensch ein Phantast; er erlebt in sich Bilder,
deren Inhalte und Abläufe alles real Erfahrene überschreiten,
so sehr auch ihr Rohmaterial in Erfahrungen bestehen mag; er erlebt sie
mit vollem naiven Realitätsbewusstsein, da ja Kritik, Kontrolle und
Widerlegung durch praktische Konsequenzen fehlen; und er hat, beim Erwachen,
in aller Stärke das Z weiwelte nge f üh 1, nämlich das Gefühl
des Nichtzueinandergehörens der Scheinwelt, aus der er kommt, und
der Seinswelt, in die hinein er aufwacht. Auch das schnelle Entschwinden
der Traumerinnerungen und das Bewusstsein, dass selbst die in der Erinnerung
zurückbleibenden Traumfetzen nur ein ganz schwaches und noch dazu
verschobenes Bild von dem geben, was im Traum tatsächlich erlebt worden
war — trägt zu jenem Zweiweltengefühl bei."
Vorstellen
und phantasieren
Unter vorstellen verstehen wir die sinnliche
Präsentation einer aus dem Gedächtnis aufgerufenen Wahrnehmung
im Bewußtsein. vorstellen heißt sozusagen "wahrnehmen" ohne
äußere Wahrnehmungsquelle mit dem Wissen, daß man vorstellt-
und nicht halluziniert oderpseudo-halluziniert (siehe unten). Die vertrauteste
Vorstellung im Alltag ist die visuelle; vorstellen heißt hier praktisch:
"sehen" mit geschlossenen Augen. Es können aber alle sinnlichen und
wahrnehmbaren Funktionen vorgestellt werden: riechen, schmecken, hören,
bewegen, Anspannung, Entspannung, Kälte, Wärme (Autogenes Training)
...
Wahrnehmen und phantasieren
In Wahrnehmungen mischen sich nicht selten Phantasien, besonders unter
mehr oder minder unstrukurierten Bedingungen, typisch etwa bei der Interpretation
von Wolkenbildern oder projektivem Testmaterial (Rorschach).
Werten
und phantasieren
Werte sind Schöpfungen des menschlichen Geistes und so betrachtet
von Haus aus Phantasien. Stirner
hält Werte gar für Wahngebilde, was aber nur stimmen würde,
wenn man Werte eine objektive und reale Existenz unabhängig vom menschlichen
Leben und Erleben zusprechen würde. Im Allgemeinen werden Sachverhalte
für Menschen zu Wertträgern, wenn sie mit positiven oder negativen
Gefühlen
assoziiert
sind. Das lässt sich zweifellos empirisch belegen und so gesehen gibt
es Werte auch objektiv, nämlich im Menschen und analogen Lebensformen.
- "Es ist nicht gut allein zu sein." Das ist auf den ersten Blick zumindest ein allgemeinen Werturteil. Könnte dieses Werurteil - und falls wie - auch zur Phantasie werden? Weltendiskussion: Im System der Welten gehört dieses Werturteil zur normativen Welt und vielleicht auch zur Wunschwelt. Es gibt aber auch eine empirische Interpretation, wenn zum Beispiel festgestellt werden kann, dass Menschen, die nicht allein leben, nicht so mit ihrem Leben zufrieden sind, wie Menschen die nicht allein leben. In diesem Falle wäre aber eine andere Formulierung besser, etwa: Menschen, die allein leben, nicht nicht so zufrieden wie Menschen, die nicht allein leben.
- "Du sollst nicht töten" Die Norm gehört natürlich unbestreitbar zur normativen Welt.
Wünschen und phantasieren
Da es sogar ein eigenes Wort - Wunschphantasien -gipt, ergibt sich
die große Bedeutung der Wünsche für Phantasien. Wunschphantasieen
können ein Ersatz
Lebens- und Wissenschaftsbereiche und Phantasie {}
Alltagsleben und Phantasie
{}
Das Alltagsleben ist voller Phantasie, wobei sie oft nicht ausdrücklich
bemerkt wird. In fast allen Bewusstseinsströmen dürften Phantasieteile
enthalten sein.
Arbeitswelt und Phantasie > arbeiten und phantasieren.
Beziehungen und Phantasie {}
Erotik und Phantasie {}
Film und Phantasie {}
Kriminalität und Phantasie {}
Kunst und Phantasie {}
Liebe und Phantasie {}
Literatur und Phantasie {}
Gedichte, Erzählungen, Romane brauchen während der Erzeugung einige Phantasie und meist enthalten sie auch viel Phantasie und bestehen sogar im Wesentlichen aus Phantasie, auch wenn sie wie viele Romane virtuelle Wirklichkeiten beschreiben: Als-ob-Welten.
Mathematik und Phantasie {}
Für die psychologische Analyse brauchbare Befunde und Beschreibungen wie MathematikerInnen phantasieren, habe ich nicht gefunden. Intuitiv habe ich keinen Zweifel, dass es in der Mathematik viel mehr Phantasie und Probieren gibt als man es den fertigen Arbeiten ansieht. Die Wege mathematischen Denkens und Phantasierens werden sehr gut verborgen.
Hilbert wird die kleine Bosheit zugeschrieben; "Ein Mathematikstudent besuchte nicht mehr die Vorlesungen - er schriebe jetzt einen Roman. Man fragte sich daraufhin in Göttingen, wieso ausgerechnet ein ehemaliger Mathematiker Dichter würde. «Aber das ist doch ganz einfach,» sagte HILBERT: «Er hatte nicht genug Phantasie für die Mathematik, aber für Romane reicht's.»" (Ehlers 1994, S. 31). Eines kan dieses bon mot jedenfalls sehr deutlich machen: Im Selbstverständnis großer Mathematik ist mathematisieren eine Denktätigkeit, die sehr viel Phantasie erfordert - auch wenn die meisten SchülerInnen aus ihrem Mathe-Erleben in der Schule da einen ganz anderen Eindruck haben. Phantasie und Kreativität braucht man wahrscheinlich zum Erkennen von Zusammenhängen, Möglichkeiten, insgesondere Lösungsmöglichkeiten. Die Phantasien der MathematikerInnen beim Mathematisieren liegen weitgehend im Dunkeln.
Nebenbei aufgefallen: In dem von Walter R. Fuchs (1976) Formel und Fantasie gibt weder Abschnitt noch einen Sachregistereintrag zum Therma Fantasie.
Metapahysik und Phantasie {}
Psychopathologie und Phantasie {}
Angstphantasien, Depression (Mangel an Phantasie), Dysmorphophobie, Eifersucht(swahn), Größenphantasien, Hypochondrie, Katatstrophenphantasien, negative Phantasie, Wahn, Zwangsgedanken.
Bürger, Hans (1926) Beiträige zur Psychopathologie schizophrener Endzustäinde. Mitteilung. Über die Entstehung paraphrener Wahnbildungen und über Erinnerungstiiusehungen. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 435-444, hieraus S. 721f:
- "Auf Drängen der Mutter nahm er nieder Arbeit in einer Möbelfabrik,
wo er bis zur Aufnahme in die Klinik am 19.1.1925 arbeitete. Ab und zu
äußerte er zu Hause merkwürdige Dinge; von feurigen Gestalten
sprach er, die er gesehen habe. Der ihn auf Anraten eines Arztes einliefernde
Bruder gab uns weiter an: Oe. habe einmal behauptet: ein Steinbruch habe
geschrien. Die Moabiter gingen um. Er habe Über viel Kopfschmerzen
geblagt, und daß er sich verändere. Allerlei Beschwerden: Müdigkeit,
Schwindelgcfühl habe er zu Hause vorgebracht. Schlaffheit und Unlust
zur Arbeit habe man ihm deutlich angemerkt.
Bei der Aufnahme (19.1.1925) sahen wir einen frischen, kräftig gebauten Menschen vor uns, rund und beweglich im Gestus, mit lebhaften Augen, der Bich ganz unauffällig benahm, mit dem man gleich guten Rapport hatte. Er gab ohne jeden Rückhalt an: mit ihm müsse etwas nicht richtig sein. Er müsse etwas im Kopf haben. Anfälle kämen oft über ihn, klagte er, dann weite sich das Herz, die Atmung gehe rascher, die Adern würden ganz dick. Manchmal sei er ganz verändert. Er spreche dann mit einer Baß- oder Fistelstimme. Sein Körper sei oft schwarz und fühle sich wie rußig an. Mit seinen wahnhaften Inhalten hielt er zunächst zurück, sprach nur unbestimmt von etwas Geheimnisvollem, brachte dann aber sprudelnd und ganz unbeirrt durch alle Anzweiflungen und selbst durch Spott in unerhörter Fülle phantastische Erlebnisse vor, die er gehabt haben wollte. Unbekümmert gab Oe. Antwort auf Fragen nach seinem sonstigen Lebenslauf. Freundlich, zugänglich Baß der kräftige, untersetzte Mensch da, sprach von seiner Arbeitszeit, um dann immer wieder bei jeder sich bietenden Pause seine psycho¬tischen Inhalte vorzubringen; „Ja, Herr Doktor, das Stück ist mir passiert, da bin ich unter Wasser einem Mann begegnet, und wir konnten sprechen miteinander." Unbeirrt durch die Frage „wovon denn?" „Ja, Herr Doktor, das war so, ganz blau war alles. Und ein Fisch ist da geschwommen, dem sah man an, daß er aus der Unterwelt kam." Unterbrach man Oe., „das ist doch Unsinn, erzählen Sie lieber, ob Sie früher viel geträumt haben", sprach er ruhig weiter: [>722]
„Nein, Herr Doktor, geträumt habe ich nicht. Aber mit 7 Jahren ist mir das schon passiert, daß mir ein Mann gesagt hat: „Wenn deine Schwestern verschmelzen, gibts einen Fischleib. Da ist mir auch Gott begegnet, Bauber sah er aus in grünem Zivilmantel. Als ich ein Bub war, kam ein Mann mit einer weißen Scgeltuch-tasche und war plötzlich verschwunden." Das Fegfeuerschiff hat ihn — den Patienten — mitgenommen. Ein Drache mit feurigem Schlund kam auf einmal auf ihn zu. Engel waren ihm auf der Straße entgegengekommen. Ein schöner Jüngling, der Gott war, hat ihm zugelächelt. Kosmologische und dämonologisehe Vorstellungen unter allerlei szenischen Zutaten spielten eino Hauptrolle. Die Tore zu den Totenreichen seien geöffnet. Die Moabiter und die anderen feindlichen Männer versuchten die Herrschaft zu gewinnen. Das Fegfeuerschiff sei durch die Luft gesaust. Ihn selbst habe es mitgenommen, und die Höllenpforte habe er vom Schiff aus gesehen."
Beringer, K. & Mayer-Groß, W. (1925) Der Fall Hahnenfuß.
Ein Beitrag zur Psychopathologie des akuten schizophrenen Schubs. Zeitschrift
für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 209-250, hieraus S. 223f:
- "Ein Gedanken- und Erlebniskonnex ist es.daher ganz, besonders, der
es verdient, für alle Zeiten der Erinnerung festgehalten zu werden;
ich meine das Erlebnis zu Hanse, das ich mit den Worten bezeichnen möchte:
Einzug im Himmel. Es ist dies nicht mit einfachen Worten abzutun, als sei
es ein Spiel der bloßen Phantasie gewesen, vielmehr war es die realste
Wirklichkeit: in deren Mittelpunkt [>224] strahlte ein Juwel ewiger Glorie
[„Es war für mich die Gottheit, eher gesehen als gefühlt"] von
unvergänglicher, unauslöschlicher Geisteshöhe und -tiefe
[„Ein Erleben in Größe instinktmäßig. Der Maßstab
versagt"]. Kein Erlebnis meiner Seele ist für mich je so bedeutsam
gewesen, wie dieses Bewußtsein, im Paradiese zu leben: Im Lande der
Sphärenharmonie, von einem Stern zum anderen wandernd, immer neue
Seelen im Glänze der Himmelsgebilde erkennend, dabei die tiefsten,
im Ixben nie geahnten Zeitdimensionen durchmessend, im Lande der ewigen
Schönheit, des tiefsten und reinsten Friedens, der vollsten wahrsten
Harmonie, von Musik und Engelgesang umflutet, dabei in allem frei und völlig
unbehindert im Raum der Unendlichkeit schwebend — so tat sich meinem innern
Auge diese neue Welt der Herrlichkeit auf, — nie geahnt, nie auch nur leise
erträumt: überall Liebe erschauend, Harmonie ergründend,
in der Tat alles darin enthalten, was man nur auch überhaupt in das
Wort Himmel oder Paradies hineindenken kann, und das man um jeden Preis
ewig so festzuhalten wünscht."
Eyrich, Max (1925) Zur Klinik und Psyehopathologie der pyknisehen
Sehizophrenen. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie,
682-723, hieraus S. 694:
- "So kam Frau B. vor 3 Jahren in die Klinik, wo sie nun seither auf
der ruhigen Wachabteilung lebt. Ganz kurze, nie über Stunden dauernde
Erregungszustände machten zuweilen schon die Verbringung auf eine
andere Station notwendig. So schrie sie einmal in einem solchen eine halbe
Stunde lang gellend hinaus und gab die Begründung, es sei ihr ein
Schweinehals eingesetzt worden. Im Bad beruhigte sie sich dann sehr rasch.
Sonst treffen wir sie untätig im Bett liegend an. Sie reicht uns in freundlicher Art die Hand, ein aufgeschlossenes Lächeln geht über ihr Gesicht, ihre Worte geben der Freude Ausdruck, daß wir an sie gedacht haben. Die äußeren Formen des Verkehrs werden vollkommen eingehalten. Wir bemerken an der leicht koketten Art, sieh zu kleiden, daß ihr weiblicher Sinn für Eitelkeit nicht erstorben ist.
Wenn wir Glück haben, so folgt, sie unserer Aufforderung, von ihrem Denken und ihren Erlebnissen zu erzählen. Sie wird aufgeschlossen, gesprächig, lebhaft. Bald mit heiterer Redseligkeit, bald mit angehaltener leiser Stimme, als ob das niemand hören dürfte, spricht sie. und wir erfahren, daß sie den ganzen Tag erlebt. Es hat mit Tagträumereien Ähnlichkeit — manchmal hören wir sie selbst lachend sagen: es sind lauter Phantasien.
„Sie spüre alles, was im Haus vorgeht, auf eine Art magnetische Weise sei sie mit allem verbunden. Wenn jemand neu auf die Abteilung kommt — es sei ihr nicht angenehm —.dann wisse sie durch ihre Verbundenheit schon beim Betreten des Hauses, was diesem fehle. — Manchmal bei Nacht lösen sich die Zöpfe ihrer Mitpatientinnen los und legen sich ihr auf den Bauch, ganz lang. — Dann stirbt wieder eines, ein anderes wird gesund, und „das Leben" dieser Mensehen fliegt auf das Dach und kreist da. — Heute Nacht, da sei sie als Eva auf die Straße gegangen, ohne Kleider, das müsse sie seit ihren Jugendjahren tun und jetzt immer wieder." „Die Natur kehrt wieder, wenn man solange allein ist"... „Sie könnte uns noch lange erzählen, aber wir glauben es ihr ja doch nicht, wir halten das für unwahr oder für verrückt, aber das ist es nicht, wir verstehen sie nur nicht."
Viele Wortneubildungen fließen in ihrer Rede, vieles erscheint völlig unverständlich und zerfahren, affektiv ist Frau B. in den letzten Jahren deutlich verflacht und sie ist auf keine Weise zu einer Tätigkeit zu bringen. Und doch fühlen wir uns stets aufs neue überrascht, wenn wir zu ihr hintreten, wie lebhaft und geordnet sie ein oberflächliches Gespräch zu führen vermag."
Donatlh, Julius (1905) Zur l)sychopathologie der sexuellen
Perversionen. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie,
435-444, hieraus S. 443f:
- "Wir sehen also bei diesem jungen Manne, in dessen Seiten Verwandtschaft
Irrsinn vorgekommen ist, dass im 10. Lebensjahre gelegentlich des Anblickes
einer Züchtigung ein unbekanntes, dunklos Gefühl woll-lüstiger
Erregung entstellt. Mit dieser mächtigen, wenn auch noch unklaren
Empfindung vergesellschaftet sich so innig das Bild der robusten Bäuerin
mit den hochgeschürzten Röcken und schmutzigen Waden, dass der
Anblick solcher Bäuerinnen ihn geschlechtlich hochgradig erregt und
in allen seinen späteren erotischen Phantasien diese Gestalten stets
wiederkehren, und er sich an der Stelle des geprügelten Knaben sieht
Diese Scene des Schmerzerduldcns wird noch mit der der Erniedrigung erweitert,
welche durch die Auslieferung au die Bauern erfolgt. Die Vorstellung der
Schlüge ist mit Erectionen und Ejaculationen verbunden. Es bandelt
sieh also um einen in der Vorstellung sich abspielen¬den (ideelleu)
Masochismiis, oder wie Schrene.k-Not7.ing es nennt, um passive Algolagnie.
Diese besondere Form psychischer Onanie war bis zu seinem IS. Jahre die
alleinige Art der Geschlechtsbefriedigung. Aber auch von da ab, wo er den
sexuellen Verkehr aufsuchte und wobei der Coitus stets in natürlicher
Weise vollzogen wurde, traten in 3 bis Stägigen Anfällen, jetzt
schon wöchentlich, diese unbezwingbaren, pervers erotischen Vorstellungen
auf. Ihr pathologischer Charakter zeigte sich auch darin, dass sie mit
seelischer Pein einherging, die Ejaculatiou keine Befriedigung brachte,
vielmehr die erotischen Bilder mit dem Öchlusseffect wieder von Neuem
begannen und nach dem Aufhören des Aufalles allgemeine Kürperschwäche,
Verstimmung und Lebensüberdruss sich einstellten, die bald wieder
mit Reizzuständen (Wolfshunger, Kopf-"[>444]reissen) wechselten. ..."
Daffner, Hugo (1922) Zur Psychopathologie der Königsberger
Mucker. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatriem 151-,
hieraus S. 153f:
- "Die Ideenwelt der Königsberger Muekerkreises FN2)
ging aus von dem Theosophen Johann Heinrich Schönherr, der 1770 in
Memel als Sohn eines Unteroffiziers geboren war. Schönherr hatte nie
etwasRichtigesgelernt. Er rühmte sich geradezu, nie ein Buch zu Ende
gelesen zu haben. „Als Schüler, so erzählt er selber, forschte
ich mehr als ich lernte. Schon beinahe zwei Jahre vor meiner Entlassung
von der Schule zur Universität hüben meine Zweifel an einer göttlichen
Offenbarung sich so zu mehren, daß ich selbst Gründe, sie zu
verteidigen, fand." Er läßt sich in Königsberg als Jurist
immatrikulieren und gelangt im Herbst 1792 auf einer Reise zu seinem „System".
Er schreibt darüber selber: „Stoff der Körper, Wesen des Geistes,
Zusammenhang zwischen beiden waren die ersten Wahrheiten, welche ich der
Untersuchung zugrunde legen mußte ... Nur einer höheren göttlichen
Fügung darf ich es danken — denn wie viele mögen dasselbe und
vergeblich gesucht haben —, wenn ich bei Öfteren einsamen Gängen
in die Natur im Sommer des Jahres 1802 FN3), als ich,
die Pflanzen betrachtend, meinen Gedanken nachging, woraus sie doch werden
möchten, durch die in meiner Seele nachtönende Antwort überrascht
ward: Wasser ist's . . . Die Pflanze hatte also ihren Zuwachs bloß
aus dem Wasser gezogen — was, fragte ich, nun ist das Etwas, das das Wasser
in den zarten Keim der Pflanzen treibt . ..? Da wandelte und lag ich dann
nun wieder oft einsam unter den Wohlgerüchen der Gewächse, diesen
Gedanken nachhängend ... Der Geruch der mit Tau getränkten Pflanzen,
eines Morgens mir frischer denn sonst entgegenduftend, gab mir die erste
Mutmaßung. Ich fragte nämlich: Was treibt diesen Geruch a\is
den Pflanzen aus? Mein Blick erhob sich zur Sonne: Die Antwort war: „Nur
Wärme, Feuer, Licht, .Sonnenstrahl!" Wärrae entbindet sich aus
dem Feuer oder Licht. Licht muß bildendes Prinzip in der Schöpfung
sein. Je mehr ich forschte, je mehr bestätigte es sich. Ein Stoff
für die Körper, ein Etwas für den Geist war gefunden." Das
Jahr darauf kehrt Schönherr von Rinteln, wo er seine Entdeckung gemacht
hatte, über Leipzig, wo er wegen seines eigenartigen Auftretens als
Geisteskranker interniert wird, nach Königsberg zurück. Hier
lebt er bescheiden als Privatmann von den milden Gaben seiner Freunde,
eifrig für seine Lehre und deren Ausbreitung wirkend. Er hatte stets
einen oft größeren, oft kleineren Kreis von Anhängern um
sich. Ein Student, der religiöse Zweifel hatte, wird an Schönherr
gewiesen und macht darüber folgende Aufzeichnungen: „Sein Äußeres
frappierte mich; denn er geht mit einem Barte und unverschorenem Haupthaar,
welches er seiner Gesundheit wegen tut, da das Beschneiden der Haare ihm
Übelbefinden verursacht. Noch mehr frappierten mich seine Reden, welche
mir ganz neu waren. Denn er sprach von Gott [>154] in der Art-, daß
das Licht Gott sei, alte Eigenschaften, welche wir Gott beilegten, dem
Lichte beizulegen seien ..."
FN2) Mucker, vom germanischem muh (heimlich tun),
bedeutet ungefähr heimtückische Frömmler; zuerst für
die Anhänger des Jenenser Theologen Buddeus (1663—1729), dann vor
allem für die Anhänger der hier behandelten Sekte gebraucht,
FN3) Diese Jahreszahl ist irrtümlich. Archiv
für Psychiatrie. Bd. 67. 11"
Psychotherapie und Phantasie
In der Psychotherapie (Beratung, Coaching) spielen Phantasieren eine kaum zu überschätzende Rolle, als (Mit-) Grund von Störungen und als Heilmethode, z.B. Aktive Imagination (Jung), Bewusstseinslenkung (Sponsel), Desensibilisierung, freies Assoziieren, gelenkter Tagtraum, Imaginationsverfahren, katatyhmes Bilderleben, Mentales Training, Psychodrama, Rollenspiel, Theatertherapie, ...
In Kirn et al (2009), S. 7 wird ausgeführt:
- "1.1.1 Vorstellungen sind relevant für die Erklärung und
Behandlung psychischer Störungen
- Angst (Wolpe 1958; Lang et al. 1970; Weerts u. Lang 1978)
- Sexuelle Funktionsstörungen (Kaplan 1974)
- Essprobleme (Vanderlinden u. Vandereycken 1995)
- Aff ektive Störungen (Schultz 1999)
- Soziale Ängste (Kazdin 1999; Kossak 2004, S. 401ff , 621ff )
- Schmerz (Basler et al. 1999)
- Sprech- und Sprachstörungen, Stottern (Kossak 2004, S. 488ff )
- Krebsbehandlung (Simonton u. Simonton 1975; Simonton et al. 2001)"
In fast allen psychotherapeutischen Ansätzen besteht Übereinstimmung darüber, dass »Vorstellungen «, die ganz allgemein bei der Entstehung, Aufrechterhaltung und Veränderung von Verhalten und Erleben eine wichtige Rolle spielen, auch für die Erklärung und Behandlung psychischer Störungen relevant sind. Die Wirksamkeit therapeutischer Veränderungsarbeit mittels imaginativer Methoden konnte in zahlreichen Untersuchungen für eine Vielzahl psychischer Störungsbereiche aufgezeigt werden (vgl. Singer u. Pope 1999):
Technik und Phantasie
Die Aufgabe der Technik ist die Optimierung von Leistungen. Es ist
die Domäne der Tüftler und Erfinder, die Selbstbewusstsein und
Selbstständigkeit, Erfahrung, Wissen, Experimentierfreude, Kreativität
und Phantasie brauchen. Das kann auch auf absurde Spitzen getrieben werden,
wie uns das die großen Inter-Giganten derzeit eindringlich vorführen.
Theater und Phantasie
Wissenschaft und Phantasie
Forensische Aussagepsychologie und Phantasie
Die Kernfrage der Aussagepsychologie lautet: ist diese Aussage realerlebnisbegründet oder nicht? Bei umfangreicheren und komplexeren Aussagen lässt sich das nicht so einfach sagen, weil Teile mehr oder minder realerlebnisbegründet und andere Teile mehr oder weniger realerlebnisbegründet oder ganz falsch sein können. Falsch, weil sie auf Suggestionen oder Irrtum beruhen oder gelogen sind. Quellen des Irrtums kann es vielerlei geben, u.a. auch die Phantasie.

Man kann der Übersichtsgraphik entnehmen, dass es eine ganze Reihe
von Fehlermöglichkeiten für nicht tatsächlich
realerlebnis-begründete Aussagen gibt. In sämlichen Fehlleistungen,
auch bei der Lüge, kann Phantasie eine Rolle spielen. Mit dieser bloßen
Zuordnung ist aber noch nicht viel gewonnen. Psychologisch interessanter
ist die Frage, wie man das unterscheiden, begründen und erklären
kann?
Auch beim Irrtum gibt es noch weitere Fallunterscheidungen. Die beiden
hauptsächlichsten Varianten sind: wird ein Irrtum für möglich
erachtet oder nicht und dann die Aussage mit Gewissheit vertreten, die
dann besonders überzeugend wirkt.
Potentielle Quellen für Phantasieantworten
bei Aussagen
Eine Phantasie ergänzt oder erzeugt einen Sachverhalt, der nicht
tatsächlich realisiert wurde.
Die Gretchenfrage lautet: warum geschieht das? Warum erzeugen oder
ergänzen Menschen Sachverhalte, die nicht stattgefunden haben?
In der Regel geschieht dies nicht bewusst. Geschieht es mit Wissen
und Absicht, liegt eine Lüge vor. Es sind aber auich Zwischen- oder
Grenzzustände möglich, wo der Erzählende Phantasieanreicherungen
für möglich hält.
Hypothesen zur Frage, was kann hinter der
Phantasieproduktion bei Aussagen stecken?
- H1 Realitätskontrolle funktioniert
nicht angemessen
Wenn Phantasien die Wirklichkeit ersetzen, dann bedeutet das immer, dass die Realitätskontrolle nicht angemessen funktioniert. Zur Realitätskontrolle von Erinnerungen sind mir keine Untershcungen bekannt.
H2 Erwartungsdruck
Der Befragte nimmt an, das der Vernehmende etwas hören oder will.
Der Befragte fühlt so etwas wie "Lieferdruck". Ich muss etwas sagen,
das erwartet man von mir. Ich will brav sein., Ich will gefällig sein.
Ich darf nicht enttäuschen.
H3 Ergänzungsdruck
Der Befragte nimmt an, dass seine Erinnerungen so nicht vollständig
sind, Lücken haben. Der Befragte möchte nach seinen Vorstellungen
eine ganze Geschichte liefern.
H4 Assoziierte Merkmale, die sich in Vergegenwärtigung mischen
H5 Motivbedingte
Assoziationen
Wünsche, Bedürfnisse, Interessen, zusammengfasst motivbedingte
Gründe können Assoziationen, die nicht dem Wirklichkeitsgeschehen
entsprachen, hinzufügen.
H6 Wissensbedingte
Assoziationen
Das Wissen kann insofern einen Streich spielen, dass etwas erinnert
und ausgesagt wird, das gar nicht stattgefunden hat. Beispiel: Danach
hat er die Hose zugeknöpft. Das kann aus mehreren Gründen
mehrfach falsch sein: (1) weil er es nicht gemacht hat; (2) weil er gar
keine Hose mehr anhatte (nur die Unterhose); (3) weil die Hose gar nicht
zum Knöpfen war, sondern einen Reissverschluss hatte. Das kann durch
suggestive Vorgaben - was hat er dann gemacht - oder Bedrängen?
- wiederholgen oder verstärken der suggestiven Vorgabe - na sag
schon, was er dann gemacht, als er die Hose wieder anzog? Das lässt
sich durch anschließende Wissenprüfung weiter erkunden: Was
macht ein Mann alles, wenn er sich nach dem Aufwachen anzieht?
H7 Suggestive Vorgaben
Eine häufige und gefährliche externe Quelle für Phantasieantwortungen
sind Suggestivfragen
der Explorierenden oder Vernehmenden. Je mehr diese als Autorität
anerkannt werden, desto stärker sind diese Fehlerquellen.
Phantasien, die auf suggestive Vorgaben zurückgehen
können, sind grundsätzlich leicht erkennbar, wenn wortwörtliche
Fragen oder Vorgaben erfasst sind.
H8 Bedrängen
Bedrängen ist mehr als eine suggestive Vorgabe. Beispiele: Sag,
war es nicht nicht so? Noch massiver: Sag doch endlich, war es nicht so.
Oder: Das hast Du schon einmal zugeben!
H9 Eingeredet
Einreden hat vor der Aussage stattgefunden. Durch das Einreden wird
der eingeredete Sachverhalt Teile der - dann falschen oder verfälschten
- Erinnerung. Was man meinte erlebt zu haben, hat man gar nicht so erlebt,
sondern durch das Einreden in die Erinnerung (falsch) eingearbeitet.
Aussagepsychologiegeschichtliche Anmerkungen
- Arntzen gehört mit Undeutsch und Trankel zu den Pionieren der
Aussagepsychologie in der 2. Hälfte des 20. Jhd, in der ersten Hälfte
war es William Stern.
- Stern, William (1914) Eigenschaften der frühkindlichen Phantasie. Zeitschrift für pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik 15, 305-313.
- Stern, William (1931) Dauerphantasien im 4. Lebensjahre. Zeitschrift für angewandte Psychologie 38, 309-324.
- Stern, William (1938) Ein Test zur Prüfung der kindlichen Phantasietätigkeit ( "Wolkenbilder "-Test). Zeitschrift für Kinderpsychiatrie 5, 5-11.
Der Phantasiebegriff
in Begabung (1976), S. 132:
"1. Begriff der Phantasie und des kreativen Denkens
Wenn die Gedanken (z. B. Problemlösungen) und Vorstellungen eines
Menschen nicht von anderen übernommen, vielmehr für ihn und die
Population, in der er lebt, neu sind, sprechen wir von kreativen Gedanken
bzw. von Phantasieprodukten.
Die Phantasieleistungen und kreativen Denkleistungen
enthalten jeweils als ganze ein Moment des Neuen, oft des Originellen,
auch wenn die einzelnen Teile desselben („Elemente") schon vorher bekannt
waren. Schon Existierendes wird also neu verknüpft {K03h},
neu gestaltet. ...
Den Begriff „produktives" Denken vermeiden wir hier,
weil wir ihn im System unserer Arbeitsbegriffe als Gegensatz zum rezeptiven
und zum reproduktiven Denken benötigen — das Moment des „Neuen" ist
für unseren Begriff des produktiven Denkens nicht so entscheidend
wie die Tatsache, daß der Denkende seine Gedanken se1bst
entwickelt, sie selbst hervorbringt und sie nicht etwa nur aufnimmt, auffaßt,
nachdem sie von anderen dargeboten worden sind. Kreatives Denken ist nach
dieser Begriffsbestimmung immer produktiv, aber nicht jedes produktive
Denken ist kreativ.
Der Begriff der Phantasie soll sich in unserem System
der Arbeitsbegriffe nur auf den Bereich der Vorstellungen, das kreative
Denken auch auf den Bereich der abstrakten Gedanken beziehen."
Phantasie
in der Psychologie der Zeugenaussage (1993, 3. A.)
Es finden sich folgende Sachregistereinträge: Phantasieeinfälle
und -produkte 28, 34, 49, 53, 114, 121, 123 —, Wiedererinnerung von 54
Phantasieprüfung 34, 72, 128.
Phantasie bei Stern (im Bereich Aussagepsychologie)
Was lässt sich aus Phantasiegeschichten folgern (aussagepsychologisch diagnostizieren)?
Literatur (Auswahl) > ausgelagert.
Reader (ausgelagerte):
- Busemann (1951) Phantasie und Denken.
- James, William (1909) Phantasie in (303-313) Psychologie.
- Ribot, Theodule (dt. 1902; orig 1900) Inhaltsverzeichnis: Die Schöpferkraft der Phantasie.
- Stern, William (1950) 18. Kap.: Phantasie und 19. Kap.: Sonderfunktionen der Phantasie (Träumen, Spielen Schaffen) in Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage.
- Wundt, Wilheln (1918) § 17 Apperzeptionsverbindungen.
- Wundt, Wilheln (1918) § 20 Die psychische Entwicklung des Kindes.
Links (Auswahl: beachte)
- https://www.songlexikon.de/songs/wunderzarahleander
Glossar, Anmerkungen und Endnoten: > Eigener wissenschaftlicher Standort.
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
abrufen vs. erfinden
Die Information hilft in seiner extremen inhaltlichen Dürftigkeit nicht weiter. Es fehlt eine ausgearbeitete differenzierte Theorie und operationale Methodik wie sich abrufen vs. erfinden in den Aussage niederschlägt und wie man das kontrollieren kann.
__
Assoziationspsychologie
Als Assoziationspsychologie bezeichnet man die theoretische Ausrichtung, dass der Bewusstseinsstrom aus einzelnen Elementen bestehend gedacht wird (ja aus was denn sonst!? - Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass es sich um Konstruktionen handelt). Wie man gegen ein solche Banalität jahrzehntelang polemisieren kann, habe ich nie verstanden. Es hat ja nie jemand bestritten, dass das reale Erleben ein Ganzes ist.
Der DORSCH führt aus (Abruf 8.8.17): "Assoziationspsychologie (= A.) [engl. association psychology; lat. associare verbinden], [KOG, PHI], die von den Philosophen Hobbes, Hume und den beiden Mill begründete, im Anfang des 19. Jh. bes. durch J.F. Herbart geförderte und schließlich noch in der 2. Hälfte des 19. Jh. führende psychol. Richtung. Die Assoziationsgesetze sind Erklärungsprinzip für den gesamten Aufbau des Seelenlebens. Durch das damit einhergehende Suchen nach unabhängigen, elementaren Bewusstseinsinhalten ist die A. weitgehend Elementenps. oder atomistische Ps. Auch dem Sensualismus steht sie nahe.?" Es fehlt ein Hinweis auf führende Assoziationspsychologen um die 20. Jahrhundertwende: Ebbinghaus, Elias Müller und Ziehen.
https://www.youtube.com/watch?v=dFQHuugWFR8
__
Sterns Personalismus
- Stern, William (1917) Die Psychologie und der Personalismus. Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. I. Abteilung. Zeitschrift für Psychologie 78, 1-54.
- Stern, William (1927) Personalistische Psychologie. In: THE NATIONAL COMMITTEE (Ed.) VIII. International Congress of Psychology held at Groningen from 6.-11. of September 1926. Groningen: Noordhoff. p. 431-434.
- Stern, William (1930) Personalistik der Erinnerung. Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. I. Abteilung. Zeitschrift für Psychologie 118, 350-381.
- Kap. IV Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage.
- Person und Sache. 3 Bde.
- Stern, William (1930) Über psychologische Zeugenbegutachtung. Deutsche medizinische Wochenschrift 56, 1467-1470.
- Stern, William (1930) Zur Theorie der personalen Ganzheit und Tiefe. In: VOLKELT, H. (Ed.) Bericht über den 11. Kongreß für experimentelle Psychologie in Wien, 1929. Jena: Fischer. p. 155-164.
- Stern, William (1933) Der personale Faktor in Psychotechnik und praktischer Psychologie. Vortrag, gehalten auf der VII. Internationalen Konferenz für Psychotechnik, Moskau, 13. September 1931. Zeitschrift für angewandte Psychologie 44, 52-63 (zugleich erschienen in: Schriften zur Wirtschaftspsychologie und zur Arbeitswissenschaft 45, 52-63).
- Stern, William (1935) Raum und Zeit als personale Dimensionen. Acta Psychologica 1, 220-232.
- Stern, William (1937) The personalistic shift in psychology. The Personalist 18, 49-60.
- Verständlich beschrieben fanf ich die Personalistische Psychologie in Allport (dt. 1959), S. 564ff.
Werke zur kognitiven
Psychologie
In den folgenden Werken fand sich kein Sachregistereintrag
"Fantasie" oder "Phantasie":
- Anderson, John R. (dt. 1988, engl. 1985). Kognitive Psychologie. Heidelberg: Spektrum.
- Funke, Joachim (2006, Hrsg.). Denken und Problemlösen. Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich C, Theorie und Forschung, Serie II. Kognition, Bd. 8. Denken und Problemlösen.
- Neisser, Ulric (1974) Kognitive Psychologie. Stuttgart: Klett.
- Wessels, Michael G. (1984) Kognitive Psychologie. Neww York: Harper & Row.
- Müsseler, Jochen & Riegler, Martina (2017) Allgemeine Psychologie.
3. Auflage: Berlin: Springer. Anmerkung: Obwohl "Fantasie" im Text vorkommt
(pp 233f, 242, 474, 496).
Zimbardo, P.G. (1983) Psychologie. 4. Auflage. Berlin: Springer.
- Bergius, R. (1964, Hrsg.) Lernen und Denken. 2. Halbband Allgemeine
Psychologie I. Der Aufbau des Erkennens. Göttingen: Hogrefe.
Katz, David (1951, Hrsg.) Handbuch der Psychologie. Basel: Schwabe & Co.
Standort: Analyse des Phantasiebegriffs unter besonderer Berücksichtigung der Forensischen Psychologie.
*
- Definieren und Definition. * ist * Nicht * Alle&Jeder * Paradoxien * Was ist Fragen * Welten *
- Überblick Forensische Psychologie in der IP-GIPT * Aussagepsychologie.
- Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben.
- Definitionen, Nominal- und Realdefinitionen (Abschnitt aus der Testheorie).
- Definition aus Eisler Wörterbuch der philosophischen Begriffe (1927-1930).
- Einführung in die Definitionsproblematik am Beispiel Trauma.
- Zum Universalienstreit am Beispiel der Schneeflocke.
- Gleichheit und gleichen im alltäglichen Leben und in der Wissenschaft. Näherungen, Ideen, Ansätze, Modelle und Hypothesen.
- Aufbau einer Wissenschaftssprache in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie.
- Allgemeine Theorie und Praxis des Vergleichens und der Vergleichbarkeit. Grundlagen einer psychologischen Meßtheorie.
- Überblick Wissenschaft in der GIPT.
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Definition definieren site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Analyse des Phantasiebegriffs mit einem Exkurs Phantasie in der Forensischen Psychologie. Ein Ansatz und Entwurf. Grundbegriffe aus den Wissenschaften: Analogien, Modelle und Metaphern für die allgemeine und integrative Psychologie und Psychotherapie sowie Grundkategorien zur Denk- und Entwicklungspsychologie.Internet Publikation - General and Integrative Psychotherapy IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wism/gb/APBFP.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, wie bei einigen Zitaten, sind die Nutzungsrechte bei den Copyrightinhabern zu erkunden und die Erlaubnisse einzuholen. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen
korrigiert
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
07.09.2023 Lit Vetter 1950.
Materialien
Literatur
- Bergius Handbuch der Psychologie SR-Einträge: Phantsie 555, Vermögensbegriff Phantasie 557, Phantasietätigkeit 22, Phantasievorstellungen 44. Einbildungskraft 557.
- Hansen Entwickling des kindlichen Weltbildes Phantasieaussage 206f, 464.
- Arntzen & Michaelis Psychologie der Zeugenaussage 3.A. (1993) SR: Phantasieeinfälle und -produkte 28,
- Undeutsch HbdP 11 Forensische. SR-Einträge Phantasie: 34f, 46, 69, 72-78, 81, 154. Alle Kap. Aussagepsycholohie 26-184.
34, 49, 53, 114, 121, 123 —, Wiedererinnerung von 54 Phantasieprüfung 34, 72, 128
Unvollständige Ausagen
Das hat der Mann mein Gesicht runtergdrückt. Wohin runter?]
Dann ist er gekommen. [Woher, wohin, wie, auf welche Weise?]