(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=21.10.2017 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 11.11.20
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_ Ontologie des Psychosozialen_ Datenschutz_ Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Wissenschaft, Bereich Wissenschaftstheorie und hier speziell zum Thema:
Ontologie des Psychosozialen
aus allgemeiner und integrativer psychologischer
Sicht.
"Institutionen handeln nicht, sondern nur Individuen
in oder für Institutionen "
Karl Popper (1962)
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
Einführung Die Ontologie des Psychosozialen
ist für viele Gebiete der Psychologie und ihre Wissenschaftstheorie
wichtig, weil sich gerade im Psychischen und Psychopathologischem, auch
in Soziologie, Kriminologie und im Recht, oft die Frage stellt, in welcher
Weise unsere Konstruktionen existieren oder worauf genau sie
referieren
und wie man das beweisen oder empirisch nachvollziehbar begründen
kann? Wie existiert etwa ein "Persönlichkeitskern", eine Verhaltensdisposition
oder familiäre Bindungen und damit "Familien"? Was haben Gruppen
für eine Ontologie? Existieren sie "objektiv" als selbstständige
Wesenheiten oder "nur" in unseren Köpfen? Ohne Zweifel wird in der
täglichen Lebenspraxis oft so gesprochen als ob viele psychosoziale
Konstruktionen, wie Beziehungen, Bindungen, Paare, Familien, Freundschaft,
Liebe, Gruppen (formelle wie informelle), Milieu, Typ, Sozialisation usw.
usf. existieren - wie Häuser, Landschaften, Dörfer, Städte,
die Erde oder der Mond. Während die Philosophen seit Aristoteles keine
nennenswerte Fortschritte zustande bringen und immer neue Systeme in ebenso
epischer wie meist praktisch unbrauchbarer Breite entwickeln, kümmern
sich die PsychologInnen so gut wie gar nicht um das Thema. Das hat wahrscheinlich
damit zu tun, dass einerseits die Philosophen wenig empirisch Nützliches
anzubieten haben und andererseits die Sprachpraxis weitgehend Problemfreiheit
signalisiert. Kein Mensch hat ein Problem damit, zu verstehen was ein Paar,
eine Familie oder eine Gruppe oder ein Typ ist. Der Alltagssprachgebrauch
scheint
weitgehend reibungslos zu funktionieren. Die Probleme stellen sich bei
genauerer Betrachtung aber sehr schnell ein, wenn man z.B. fragt, ob ein
gewisser Milieueinfluss schädlich, günstig oder neutral in Bezug
auf die Persönlichkeitsentwicklung einzuschätzen ist. Aus diesen
Gründen halte ich es für sinnvoll, die Probleme der Ontologie
des Psychosozialen explizit und ausführlich zum Thema zu machen. Viel
kann man hier von den JuristInnen lernen, die in der Rechtspraxis gar nicht
anders konnten, als die psychosoziale Wirklichkeit in handhabbare Begrifflichkeiten
zu fassen, z.B. Person, juristische Person, Verein, Gesellschaft, Handlungsfähigkeit,
Vertragsfähigkeit, Rechtsfähigkeit u.v.a.m.
- Historischer Exkurs - Aristoteles
Ontologie, ein Ausdruck, der erst im 17. Jhd. aufkam, gilt seit Aristoteles als die allgemeine Wissenschaft vom Seienden und Sein als die "erste Philosophie". Er hat sie in seiner Metaphysik im 4. Buch im 1. Kapitel, hier aus meiner Ausgabe, Rowohlts Klassiker, wie folgt eingeleitet:

Die Ausführungen von Aristoteles sind auch heute noch überwiegend verständlich (aber nicht: "Wesenheit an sich"). Die Ontologie in diesem Sinne geht über die Einzelwissenschaften hinaus und studiert auf einer sehr allgemeinen Ebene das Sein und das Seiende wogegen es grundsätzlich nichts einzuwenden gibt, wie Bochenski ausführlich darlegt. Dazu gehören naturgemäß die Formen des Seins und Nichtseins und ihre Einteilung (Kategorienlehre). Die Ontologie ist von heutigen Standpunkt aus gesehen ein Teil der allgemeinen Wissenschaftstheorie und wird damit hoffentlich ihre philosophischen Fehlleistungen und Gespenster verlieren.
Ontologische Grundvoraussetzungen
Vorausgesetzt und nicht weiter in Frage gestellt wird hier erstens die Existenz einer realen Außenwelt, die unabhängig von den Menschen existiert und wovon der Mensch mit all seinem subjektiven Erleben ein ebenso objektiver Teil ist wie die Erscheinungen der Natur, die naturwissenschaftlichen Objekte und Beziehungen.
Zweitens wird von der Gültigkeit des erkenntnistheoretischen Fundamentalsatzes ausgegangen, dass Erkenntnis immer nur relativ zu einem erkennenden System gilt. Daraus ergibt sich zwanglos, dass die Erkenntnis im Wesentlichen von zwei Parametern abhängt: dem erkennenden System (Subjekt) und den zu erkennenden Sachverhalten (Objekte). Das Ding an sich ist nach diesem Ansatz nicht erkennbar, da jedes Ding oder jeder Sachverhalt, der erkannt wird, immer nur von einem erkennenden System erkannt werden kann und nicht an sich.
Wissenschaftliche Erkenntnisse streben Objektivität an. Im Allgemeinen ist damit gemeint, dass eine Aussage nicht nur für ein Individuum oder eine Gruppe von Individuen gilt, sondern überindividuell allgemein, d.h. intersubjektiv. Idealiter postuliert der Objektivitätsbegriff, dass auch unterschiedliche erkennende Systeme zu gleichen Ergebnissen gelangen. Ob hier z.B. ein Stein liegt, sollte "objektiv" feststellbar sein. Das ist nicht der Fall bei Halluzinationen. Wenn aber Halluzinationen stattfinden, so sind diese nicht weniger objektiv als der alltägliche Sonnenaufgang. Und damit landen wir, jedenfalls scheinbar, in einem Paradoxon. Einerseits gibt es die Halluzination (= Wahrnehmung ohne äußere Wahrnehmungsquelle), deren Gegenstand oder Inhalt von anderen zwar nicht geteilt wird, aber doch real bei dem Individuum, das halluziniert, vorliegt und damit objektiv feststellbar sein sollte. In der Testpsychologie ist Objektivität ein Testgütekriterium. Es besagt, dass ein Testergebnis dann objektiv ist, wenn es unabhängig vom Testabnehmer und Auswerter zum gleichen Ergebnis kommt.
Frei nach Hamlet sind die zwei Grundfragen sein oder nicht sein. Aus menschlicher Perspektive kann die Frage sein oder nicht sein für folgende Wirklichkeitsbereiche praktisch unterschieden werden:
- die wirklichen oder realen Sachverhalte der Welt
- denkbare Sachverhalte
- phantasierte Sachverhalte
- unmögliche Sachverhalte
- mögliche Sachverhalte
- so oder so wahrscheinliche Sachverhalte
- erwünschte Sachverhalte
- gebotene oder verbotene Sachverhalte (Welt der Normen, Moral, Ethik und Recht)
Diese grundlegenden Unterscheidungen können zu einem praktischen
System von Referenzwelten dienen.
Kategorien aus psychosozialer Sicht
Kategorien dienen der Einteilung und Ordnung, im Alltag fragt man z.B. in welche Kategorie gehört der, die oder das? Grundkategorien - Aristoteles schuf 10, Kant 12 - des Seienden und Nichtseienden findet man aus Sicht der Denkpsychologie hier: Der Aufbau der Welt. Praktisch psychologisch finden sich die psychologisch bedeutsamen Kategorien im Allgemeinen psychologischen Referenzmodell. Ganz allgemein stellt sich die Frage:
- Was soll erkannt werden, z.B. ob ein bestimmter Sachverhalt in einem bestimmten Raumzeitgebiet vorliegt oder wie er vorliegt bzw. nicht vorliegt?
- Was soll das erkennende System für Eigenschaften oder Werkzeuge haben? Wie soll das erkennende System beschaffen sein?
Allgemeine
Ontologie des Psychosozialen
Die Gretchenfrage lautet: Existieren die psychosozialen Konstrukte
als eigenständige Sachverhalte wie Häuser, Bäume, Steine,
Planeten (platonistische Einstellung) oder nur in den Köpfen der Menschen
mit psychosozialen Konsequenzen (Konzeptualismus) oder nur als Einbildung
ohne objektive Bedeutung (nominalistischer Nihilismus im Sinne Max
Stirners)? Wobei man beim Konzeptualismus vielleicht noch eine
fiktionale
Varianten im Sinne Vaihingers unterscheiden kann, indem man die
psychosozialen Sachverhalte so behandelt, als ob es sie in der Weise wie
Häuser, Bäume, Steine oder Planeten gäbe. Ontologisch kann
man in der Hauptsache folgende Positionen einnehmen:
- Gruppen existieren real als eigenständig agierende Sachverhalte oder Entitäten (Platonismus).
- Gruppen können als eigenständig handelnde Subjekte konstruiert werden.
- Gruppen existieren nur in den psychomentalen Verfassung - in den "Köpfen" - der Mitglieder und ihrer Betrachter, sind aber sozial wirksam (Konzeptualismus) indem sie Tun und Lassen regulieren bzw. beeinflussen.
- Gruppen sind nur Einbildung (fixe Ideen im Sinne von Stirner), eine Konstruktion ohne reale Bedeutung (radikaler Skeptizismus).
Allgemeines
psychologisches Referenzmodell (Denkpsychologie)
 |
Referierender - Referenz - Referenzierte. Die Graphik zeigt vier Grundmodelle der Referenzierung aus denkpsychologischer Sicht: Ich (Aussagen über mich), Anderer (Aussagen über andere), Natur (Aussagen über die Natur), Kultur (aussagen über Soziokulturelles). Am einfachsten ist zweifellos das Referenzieren auf äußere Dinge, die der Wahrnehmung und gemeinsamer Handlungs- und Lebenspraxis zugänglich sind. So fängt die Sprach- entwicklung auch weitgehend an: Mama, Papa, Auto, Handy, Wauwau, ... Schwieriger kann es werden, wenn es um das Erleben und nicht direkt beobachtbare seelisch-geistige Prozesse eines ich oder selbst oder gar um "höhere" Wahrnehmungsebenen (Laing) geht. Die Referenz der Innenwelt kann den Objekten des Personalpronomens "ich" (bzw. seinen Entsprechun- gen) zugeschrieben werden. Bemerkt ein Mensch, was in ihm vorgeht, so heißt "ich" das Referierende und das, was bemerkt wird, das Referenzierte. Z.B. wenn sich jemand fragt, wie es ihm geht, dann heißt ergehen so und so das Referenzierte. Wenn sich jemand fragt, wie sein Partner meint, dass es ihm geht, gibt es zwei Referenzierungen, nämlich erstens mein Ergehen so und so und wie ich das zweitens in das Erleben meines Partners projiziere. Die Referenzierungen des Erlebens können als unterscheidbare Bewusstseinsinhalte angesehen werden. |
Referenzwelten RWindex
[Quelle
Dialektik]
Bringt man die ontologischen Ebenen oder Referenzwelten durcheinander,
kann man sich schnell verstricken und verheddern. Ich führe folgende
ontologische Ebenen ein, um eindeutig kennzeichnen zu können, in welchen
Referenzwelten wir uns befinden:
- Referenzwelten RWindex der
ontologischen Bereiche OB.
- RWO Objektive Welt (Natur, naturwissenschaftliche Welt) heiße die Referenz-Welt, die es auch gibt, wenn man sich die Menschen hinwegdenkt, wenn auch nicht für immer und ewig, sondern zeitlich begrenzt.
- RWM Welt der Menschen, Individuen, Gruppen, Gemeinschaften, Gesellschaften und Staaten. Auch der Mensch gehört mit zur Natur und kann naturwissenschaftlich betrachtet werden.
- RWME Erlebens-Welt heißt die Referenz-Welt, die der Mensch erlebt. RWME ist Teil der RWM. RWME und RWMW können sich überschneiden, wobei auch nichtbewusste Wahrnehmungen das Erleben beeinflussen können.
- RWMW Wahrnehmungs- oder Wirklichkeitswelt heißt die Referenz-Welt, die der Mensch mit seinem Wahrnehmungs- und Verarbeitungsapparat erfährt und konstruiert. RWMW ist Teil der RWM.
- RWMD Denk- und Begriffswelt, ein Teil der Erlebens-Welt, heißt die Referenz-Welt, die der Mensch mit seinen Begriffsbildungen und ihren Beziehungen konstruiert und erzeugt. Die Denk- Begriffswelt kann als die Sprache des Geistes angesehen werden kann. RWMD ist Teil der RWM. und RWME.
- RWMP Phantasiewelt.
- RWMN Normwelt, die Welt der Gebote, Verbote und des Erlaubten.
- RWMB Wunsch- und Bedürfniswelt, die Welt der Wünsche und Bedürfnisse
- RWMS Sprachliche Welt heißt die Referenz-Welt, die der Mensch in seiner Kommunikationssprache beschreiben kann. RWMS ist Teil der RWM.
- RWMV Verhalten, handeln, tun.
- RWm Möglichkeitswelt, Welt der Wahrscheinlichkeiten.
RWonS Referenzwelt ohne nähere Spezifikation: keine Referenzwelt angegeben, Bezugnahme ohne nähere Spezifikation. Der Normalfall beim Sprechen oder schreiben.
Beispielanalysen für die Ontologie psychosozialer Sachverhalte
Ontologie
der Bindung
im Psychosozialen
Bindung ist ein psychosoziales Konstrukt und von der Entwicklungspsychologie
ziemlich gut grunderforscht. Sie spielt eine große Rolle für
das Aufwachsen und die Persönlichkeitsentwicklung. Nahe Bezugspersonen
sind aneinander gebunden, wobei die Bindungspsychologie wichtige Grundmuster
unterscheidet. Der Prototyp ist die Bindung zwischen Eltern und Kind, also
die Mutter- und Vaterbindung. In welcher Weise existiert nun diese Bindung,
wobei es auch viele andere Bindungen gibt, nicht nur an Menschen, sondern
auch an alles mögliche andere (A-Bindungstheorie)?
Zeichen von Bindung Wie kann sich
Bindung zwischen A und B äußern?
Die folgenden Ausführungen sind potentielle Kandidaten, ob die
jeweiligen Sachverhalte tatsächlich Bindung ausdrücken, muss
im Kontext der jeweiligen Situation geprüft werden. Denn auch ein
Dieb sucht z.B. physikalische Nähe und telefonieren oder mailen kann
man ohne eine Beziehung pflegen zu wollen.
- Innerlich (nicht sichtbar, aber kommunizierbar)
- öfter an den anderen denken
- Erinnerungen an frühere Interaktionen aktivieren
- mit dem anderen ein Vertrautheitsgefühl verbinden
- mit dem anderen zusammensein sein wollen
- mit dem anderen etwas unternehmen wollen
- mit dem anderen sprechen und sich austauschen wollen
- sich an den anderen anlehnen wollen
- sich vom anderen beachtet, anerkannt und angenommen fühlen (wollen)
- Anteil nehmen, wie es dem anderen geht
- am Wohlergehen des anderen interessiert sein
- am Leben des anderen interessiert sein
- die Aufmerksamkeit des anderen aktivieren wollen
- bei Trennung Trennungsschmerz oder Trennungsgefühle
- sich nach Zuwendung sehnen
- Äußerlich (sichtbar, aber mehrdeutig und daher abzusichern)
- Es wird physikalische Nähe gesucht: nahe beieinander sein, auch anklammern bei kleinen Kindern.
- sich auch zusammen zeigen
- zusammen sein
- Berührungen austauschen (Händchen halten, umarmt laufen)
- bis hin zu Zärtlichkeiten und Intimitäten
- sich anblicken, Blick suchen
- anlächeln
- miteinander sprechen
- miteinander etwas unternehmen
- Kontakt pflegen: telefonieren, sms, Mail, Karten, Briefe, ...
- bei Trennung Suchverhalten
- Zuwendung zeigen und suchen
- helfen, unterstützen, fördern
- beschützen, für den andern eintreten
- zusammen leben
- gemeinsame Aktivitäten durchführen
- urkundliche oder urkundenartige gemeinsame Erfassung(en) von Zugehörigkeiten: Telefonkontakte, Mailkontakte, Briefe, Fotos, Videos, Tagebuchaufzeichnungen, Berichte, Familienbuch, Heiratsurkunde, Mitgliedsausweise u.a.m.
- beim Umziehen helfen
- mit in den Urlaub fahren
- Beurteilungen der Beziehung durch andere
- die gehören zusammen, die sind ein Paar, Familie, Freunde, Interessenverbundene
Zusammenfassung
Ontologie der Bindung im Psychosozialen
Bindung ist ein abstrakter Konstruktionsbegriff. Sie wird überdauernd
gedacht, obwohl sie auch dem Wandel unterliegt. Bindungen können sich
verändern. Sie äußern sich im Erleben (innerlich) und Verhalten
(äußerlich) der Menschen, im Normalen (Psychologie) wie im Gestörten
(Psychopathologie). Es gibt daher äußere und innere Zeichen,
äußere Objektivierungen und äußere Beurteilungen
aus der Umgebung. Die äußeren Zeichen kann man beobachten, die
inneren muss man - kunstgerecht
- erfragen. Sofern Bindung auf den Menschen bezogen ist, existiert die
abstrakte Bindungskonstruktion auch höchstens so lange, wie es Menschen
gibt. Menschen können sich an vieles, ja an fast alles binden: An
Menschen, an Umgebungen, an Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Stoffe (Ernährungsgewohnheiten,
Genußmittel, Sucht) [Quelle].
Man kann Bindungen auch nach Qualitäten
unterscheiden. Bindungspotentiale können ruhen oder aktiviert werden
und aktiv sein.
Es gibt auch naturwissenschaftliche Analogien: physikalische
"Bindung" als Anziehung oder Abstossung von Massen, Schwerkraft, Magnetismus;
chemische Bindung von Stoffen; biologische Bindung durch Attraktion für
die Sinnesorgane. Und im Recht gibt es ganz allgemein die Bindung an Verträge
und das Recht selbst.
Ontologie einer
informellen Gruppe
Eine informelle Gruppe besteht aus Mitgliedern ohne bürokratisch
festgehaltene Verfassung (Satzung) oder Regeln. Sie können sich regelmäßig
oder unregelmäßig treffen, man kann sich vielleicht je nach
Lust und Laune zum üblichen Treffpunkt begeben und findet dann den
einen oder anderen dort vor. Man trifft sich vielleicht aus purer Freude
oder Interesse am Kontakt. Man tauscht sich aus, unterhält sich, hört
Musik, sieht sich Bilder oder Videos an und tauscht sie vielleicht auch
aus. Beim Treffen ergeben sich vielleicht weitere Ideen, was man machen
könnte: eine Veranstaltung, eine Gaststätte oder Club besuchen,
durch die Straßen ziehen, da oder dort hingehen.
In welcher Weise existiert diese Gruppe? Nun, sie
scheint real, wenn sie sich trifft, und zwar durch genau das, was ihre
Mittglieder beim Treffen tun oder lassen. Das gesamte Geschehen ist aber
nicht allen gleichermaßen zugänglich, jeder bekommt hauptsächlich
nur den Teil mit, der um ihn herum geschieht.
Wenn sich die Gruppe gerade nicht trifft existiert
sie nur potentiell in den Köpfen der Mitglieder, aktiviert, wenn sich
jemand mit der Gruppe als solcher oder mit ihren Mitgliedern gerade
befasst. Was heißt nun: mit der Gruppe als solcher? Nun, ein
Mitglied könnte denken: wir sind eine dufte Gruppe, ein feiner Haufen,
fast immer ist was los und es ist meist schön, dabei zu sein. Damit
wird eine Aussage über die Gruppe als solche gemacht. Es scheint so,
als wäre diese Gruppe etwas eigenständiges, über die man
etwas sagen kann. Aber ist das konstant? Läuft nicht jedes Treffen
genau betrachtet unterschiedlich ab? (1) Einer checkt vielleicht gerade
seine Mails. (2) Drei unterhalten sich. (3) Zwei sehen sich Bilder an.
(4) Einer aktiviert gerade ein Lied und (5) einer sitzt und hat die Hände
über den Kopf gelegt. Drei Minuten später ist das meiste anders.
"Die Gruppe" zeigt ein sehr heterogenes Leben. Nach voriger Schilderung
gibt es 5 Teilgruppen, die jeweils eigenen Aktivitäten nachgehen.
Was ist hier also "die" Gruppe? Die fünf Teile verbindet die räumliche
Nähe, der Treffpunkt und die Mitglieder (man kennt sich).
In welcher Weise existiert nun diese informelle
Gruppe? Kann diese Gruppe etwas sagen? Kann sie sich verhalten? Wenn sie
eine GruppensprecherIn hat, vielleicht nur zeitweise, dann wird man wohl
zugeben, dass die Gruppe etwas sagen kann, nämlich durch und
mit ihrer SprecherIn. Manchmal liest man in der Zeitung, dass eine Gruppe
grölender Leute durch die Straßen zog, dass eine Gruppe randalierte
oder ein Ständchen brachte. Fast jeder versteht diese Redeweisen.
Literatur (Auswahl) > Literaturverzeichnis Mitglied und Gruppe.
- Aristoteles (384-322) Metaphysik. https://www.zeno.org/Philosophie/M/Aristoteles/Metaphysik
- Aristoteles (384-322) Organon. https://www.zeno.org/Philosophie/M/Aristoteles/Organon
- Aristoteles (384-322) Physik. https://www.zeno.org/Philosophie/M/Aristoteles/Physik
- Avenarius, Hermann (1985) Kleines Rechtswörterbuch. Freiburg: Herder.
- Bochenski, J. M. (1951) Philosophie der Gegenwart. 2. A. Bern: Francke.
- Bochenski, J. M. (1959 ff) Wege zum philosophischen Denken. Freiburg: Herder.
- Carnap, Rudolf (1931/32) Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. In: Erkenntnis 2 (4), 219–241. [u.a. Analyse "Das Nichts nichtet" von Heidegger]
- Falkenburg, Brigitte (2012) Mythos Determinismus. Wieviel erklärt uns die Hirnforschung? Heidelberg: Springer.
- Friedrich, Walter J. (1986) Rechtskunde für jedermann. 5. Auflage. München: Beck.
- Friedrich, Walter J. (1996) Rechtsbegriffe des täglichen Lebens. 10. Auflage. München: Beck.
- Geiger/Mürbe/Wenz (1996) Beck'sches Rechtslexikon. München: Beck/dtv.
- Meixner, Uwe (2004) Einführung in die Ontologie. Darmstadt: WBG.
- Mittelstraß, Jürgen (1980-1996, Hrsg.). Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. 4 Bde. Die ersten beiden Bände erschienen bei BI, Mannheim. Die letzten beiden Bände bei Metzler, Stuttgart. Inzwischen ist eine Neuauflage am Erscheinen.
- Popper, Karl R. (1962) Logik der Sozialwissenschaften Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial-Psychologie, 14.Jhrg., 1962, p.233-248.
- Sartre, Jean-Paul (dt. 1962) Das Sein und das Nichts. Reinbek: Rowohlt. Insbesondere: Die konkreten Verbindungen mit anderen. 3. Teil, 3. Kapitel (464-548).
- Schmid, H.B. & Schweikard, D.P. (2009, Hrsg.) Kollektive Intentionalität. Eine Debatte übger die Grundlagen des Sozialen. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Schmidt / Schischkoff (1961) Philosophisches Wörterbuch. Stuttgart: Kröner.
- Schoeck, Helmut (1973) Soziologisches Wörterbuch. 7. A. Freiburg: Herder.
- Searle, John R. (dt. 2009) Einige Grundprinzipien der Sozialontologie. In (503-533) Schmid, H.B. & Schweikard, D.P. (2009, Hrsg.)
- Vaihinger, Hans (1913) Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit aufgrund eines idealistischen Positivismus. 2. A. Berlin: Reuther & Reichard. Die 8. Auflage von 1922 ist als pdf Online.
- Walther, Gerda (1923?) Zur Ontologie der sozialen Gemeinschaften. Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. [Online]
- Weinberger, Ota (1986) Ontologie, Hermeneutik und der Begriff des geltenden Rechts. Konferenz: Symposium "Rechtsgeltung in Theorie und Praxis", Graz, 1985. In (109-126) Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie e.V. (1986) Rechtsgeltung: Ergebnisse des ungarisch-österreichischen Symposiums der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie / Csaba Varga: Stuttgart: Steiner. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 27.
- Wittgenstein, Ludwig (1960) Schriften von Ludwig Wittgenstein. Tractatus logico philosophicus, Tagebücher, Philosophische Untersuchungen. Frankfurt: Suhrkamp.
Links (Auswahl: beachte) > Querverweise.
Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Abstrakte und allgemeine Begriffe
"Es ist prinzipiell genau zu unterscheiden zwischen abstrakten Begriffen und allgemeinen Begriffen: „Güte, Farbe, Glätte, Gleichheit" sind abstrakte Begriffe, denn die betreffenden Eigenschaften sind von konkreten Dingen durch Isolation losgelöste, aber in Wirklichkeit nicht selbständig vorkommende Qualitäten der Dinge; "Stein, Pflanze, Tannenbaum, Schiff" sind allgemeine Begriffe, welche durch Generalisation aus vielen ähnlichen Einzelerscheinungen zusammengesetzt sind. Die Scheidung ist eine prinzipielle, aber auch nur eine prinzipielle: in praxi wirken die beiden Operationen der Isolation und der Generalisation fast immer zusammen. Um der Klarheit der Darstellung willen ist es jedoch zweckmässig, diese beiden Arten theoretisch genau zu trennen. In den Verhandlungen über Abstraktion, welche von Steinthal, Wundt, Liebmann, Lotze, Caspari, Schuppe, Göring u. A. geführt worden sind, ist jener prinzipielle Unterschied meist nicht genügend zur Geltung gekommen. Condillac (De l'art de penser, Ch. VIII, S. 96) macht zwar eine scharfe prinzipielle Scheidung zwischen idées abstraites und idées générales, wirft aber faktisch doch beides durcheinander. Vgl. Logique (Oeuvres XXII) S. 131ff." (Vaihinger 1922, S. 399, Fußnote 1., Gesperrtschrift bei Vaihinger hier fett)
__
Allgemeinbegriff
"Was ist nun aber im Verhältnis zur realen Wirklichkeit das Allgemeinbild, was der Begriff? Objektiv gibt es nur Einzelnes, gibt es nur Getrenntes. Wir sahen eben, dass der Vorstellung [>401] „Baum" nichts Reales entspricht, was sich mit ihr deckt. Also weicht auch hier das Denken von der Wirklichkeit ab. Alle die geschilderten Operationen und psychischen Prozesse verändern den unmittelbaren Stoff der Wahrnehmung und treiben die Begriffe heraus, in denen allgemeine Typen, denen also nichts Nachweisbares, nichts Wirkliches entspricht, dargestellt werden. Es gibt nur einzelne „Sterne", keinen „Stern", es gibt nur einzelne „Hunde", keinen „Hund" überhaupt. Es gibt nur einzelne „Menschen", keinen „Menschen" überhaupt. Alle diese Vorstellungen stellen absolut nichts Wirkliches dar: wirklich ist nur das einzelne Geschehen, welches der Seele zugetragen wird, welches sie aufnimmt und verarbeitet. In diesem allgemeinen Flusse bilden sich Knotenpunkte, indem sich einige prominente Eigenschaften als Kern konstituieren.
Also „Stern", „Hund", „Mensch" sind Vorstellungen, denen keine Wirklichkeit entspricht. Diese Begriffe sind demnach psychische Gebilde, welche das Denken aus dem gegebenen Material herausarbeitet vermöge des dargelegten psychischen Mechanismus. Allein diese rein mechanischen Produkte des psychischen Lebens erfüllen einen ungeheuer wichtigen Zweck. Der Begriff, die Allgemeinvorstellung für sich bedeuten noch keine Erkenntnis; — abgelöst und isoliert vom Satz sind sie fiktive Gebilde, denen nichts Wirkliches korrespondiert.
Allein an die Allgemeinvorstellung knüpft sich der Satz an, sie drängt von selbst zum Satz. Vermittelst dieses an die Allgemeinvorstellung angehefteten Satzes wird nun der eigentliche Zweck des Denkens erreicht; nur dadurch ist das allgemeine Urteil möglich; und darauf beruht, wie Steinthal S. 21 bemerkt, alles Klassifizieren, Ordnen, alles Begreifen, Beweisen und Schliessen." (Vaihinger 1922, S. 400f, Gesperrtschrift bei Vaihinger hier fett)
Anmerkung: was ist mit einem Wolfsrudel, einer Herde Rinder, einem Ameisenhaufen, einer Fußballmannschaft, einer Schulklasse, einem eingetragenen Verein?
__
an sich sein - für sich sein
Ausdrücke u.a. von Sartre. An sich sein meint unabhängig von einem erkennenden System (Betrachter), also dasselbe wie Kants Ding an sich. Vom an sich sein können wir so wenig wissen wie vom Ding an sich. Da jedes Wissen ein erkennendes System voraussetzt, kann ein Wissen vom an sich sein oder des Dings an sich nicht mehr unabhängig vom erkennenden System sein. Jede Erkenntnis und jedes Wissen ist abhängig von einem erkennenden System. Man kann diese Abhängigkeit aber mindern, wenn man bestimmte subjektive Gegebenheiten ausschaltet oder minimiert, etwa bei typisch menschlichen Wahrnehmungseigenarten, z.B. Farben sehen. Es gibt in der Natur nur unterschiedliche Wellenlängen, wovon das erkennende System Mensch die Wellen 380-780 nm als Farben wahrnimmt. Die Naturwissenschaften kommen dem an sich aber ziemlich nahe.
Für sich sein "... Wir werden sehen, daß das Sein des Für-sich im Gegensatz dazu bestimmt werden muß als das, was es nicht ist, und als nicht das, was es ist." (Das Sein und das Nichts, dt. 1960, S. 33)
__
Bochenski zu Sartres Fürsichsein: "C. DAS FÜRSICHSEIN. Die Antwort auf diese Frage lautet: Dies ist deshalb möglich, weil es in der Welt außer dem vollen, starren, durch das Insichsein bestimmten Seienden noch einen ganz anderen Typus des Seins gibt: nämlich das Fürsichsein (le pour-soi), das spezifisch menschliche Sein. Da aber alles, was ist, Seiendes, also Insichseiendes sein muß, folgert Sartre ganz konsequent, daß dieser andere Seinstypus nur ein Nicht-Sein sein kann, also im Nichts (le neant) besteht. Das Mensch-sein kommt dadurch zustande, daß das Seiende sich nichtet (se neantise). Das Nichts ist hier ganz buchstäblich zu nehmen. Sartre erklärt, daß das Nichts nicht ist; man kann nicht einmal sagen, daß es sich nichtet - nur das Seiende kann sich nichten, und nur im Seienden kann das Nichts als «ein Wurm», als «ein kleiner See» bestehen.
Daß der Mensch als solcher, d. h. das Fürsichseiende, im Nichten besteht, wird in folgender Weise bewiesen. Zuerst stellt Sartre mit Heidegger fest, daß nicht die Negation das Nichts begründet, sondern daß umgekehrt die Negation eine Grundlage im Objekt selbst hat, daß es also «negative Wirklichkeiten» (des negatites) gibt. So können wir z. B., wenn etwas im Auto in Unordnung geraten ist, in den Vergaser sehen, diesen befragen und finden, daß es dort nichts gibt. Nun aber kann das Nichts vom Insichseienden selbst nicht stammen, denn das Insichseiende ist, wie gesagt, erfüllt von Sein und dicht. Also kommt das Nichts durch den Menschen in die Welt. Um aber eine Quelle des Nichts sein zu können, muß der Mensch das Nichts in sich selbst tragen. Und in der [>183] Tat zeigt die Analyse des Fürsichseienden nach Sartre, daß der Mensch nicht nur das Nichts in sich trägt, sondern geradezu im Nichts besteht. Dies ist zwar nicht dahin zu verstehen, daß der Mensch als ganzes ein Nichts wäre; im Menschen findet sich Insichseiendes: sein Körper, sein Ego, seine Gewohnheiten usw. Aber das spezifisch Menschliche besteht darüber hinaus im Nichts"
Quelle S. 183 f: Bochenski, J. M. (1951) Philosophie der Gegenwart. Bern: Francke.
Der Schluss Sartres und Bochenskis ist falsch. Denn aus der Tatsache, wenn sie denn unterstellt wird, das jedes Seiende ein in sich Seidenes sein muss, folgt, dass es nichts anderes gibt. Und wenn es doch etwas anderes geben sollte, nämlich das spezifisch menschliche Sein, dann ist dies sicher nicht Nichts, sondern eben das spezifisch menschliche Sein. Damit wird lediglich ein Widerspruch herbeigeführt: Nämlich spezifisch menschlich Seiendes (für-sich-sein) gibt es, aber jedes Seiende ist ein in-sich-Seiendes und per definitionem kein in-sich-Seiendes. Der zweite Widerspruch ist, dass etwas Seiendes Nichts sein soll. Das alles ist so hochgradig wirr, dass man sich fragt, wie ein solcher Unsinn so berühmt werden konnte.
Anmerkung Sprache Neigen die Philosophen mit wenigen Ausnahmen oft zu unverständlichem Breittreten ihrer Themen, so gebührt den Existenzialisten hierbei ohne Zweifel die Goldmedaille. Wenn etwa Sartre sagt, das das Für-sich-sein das ist, was es nicht ist, und nicht das, was es ist, sträuben sich mir die Haare. Auch Bochenski kann ich nicht folgen. Eine der Grundkrankheiten der Philosophen ist die substantivische, hypostasierend-homunkuleske Sprache. Wittgenstein hat wohl mehr als recht, wenn er die Sprache für den Hauptfeind des klaren Denkens hält: "Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung des Verstandes durch die Mittel unserer Sprache." [Philosophische Untersuchungen 109] Ich fürchte allerdings, die Oberhexe - mit einigen Ausnahmen - ist die Philosophie selbst.
__
Bochenski
Bochenski beschrieb in seinen Werk Wege zum philosophischen Denken S. 94 ff drei Argumente gegen eine Ontologie: "Es gibt nun, wie ich schon sagte, Meinungen, nach welchen es keine Lehre vom Seienden geben kann. Eine solche Meinung ist zuerst durch den erkenntnistheoretischen Idealismus vertreten worden. Er meint, daß alles, was von den Seienden gesagt werden kann, schon in den Einzelwissenschaften gesagt wird — für die Philosophie bleibe nur die Aufgabe, klarzumachen, wie die Erkenntnis in den Einzelwissenschaften zustande kommt, wie sie überhaupt möglich sei. Dazu pflegen die erkenntnistheoretischen Idealisten zu sagen, daß das Seiende auf das Denken zurückzuführen sei.
Die Ontologen antworten aber darauf zweifach. Sie sagen erstens, daß keine Einzelwissenschaft solche Fragen, wie jene der Möglichkeit im allgemeinen, der Kategorien undsoweiter, behandelt oder behandeln kann. Und sie bemerken zweitens, daß das Denken, auf welches man das Seiende zurückführen will, ja ist, also ein Seiendes ist; und daß das ganze Unternehmen nur insoweit überhaupt einen Sinn hat, als man zwei Arten von Seiendem annimmt und dann ihr gegenseitiges Verhältnis untersucht. Das ist aber — so sagen die Ontologen — gerade Ontologie. Sie behaupten also, der erkenntnistheoretische Idealismus sei im Grunde genommen eine Ontologie, nur eine primitive und naive, weil unbewußte Ontologie.
Die andere anti-ontologische Meinung ist die der Positivisten. Sie ist heute — im Gegenteil zum eher verschwindenden erkenntnistheoretischen Idealismus — weit verbreitet, vor allem in den angelsächsischen Ländern. Diese Philosophen behaupten, daß, wenn ich zum Beispiel sage, der Hund sei ein Tier, dies eine sinnvolle [>95] wissenschaftliche Aussage sei; wenn ich aber behaupten würde, er sei eine Substanz — die Substanz ist nämlich ein ontologischer Begriff —, so sage ich überhaupt nichts über die Wirklichkeit. Ich spreche nicht vom Hund, sondern vom Wort "Hund". Die Ontologie soll also durch eine allgemeine Grammatik ersetzt werden.
Die Ontologen fühlen sich jedoch auch durch diese Argumentation nicht betroffen. Sie sagen, es sei nicht klar, warum man bis zu einer gewissen Grenze die Begriffe verallgemeinern dürfe — etwa nach der Reihe Raubtier — Säugetier — Wirbeltier — Tier — Lebewesen —, weiter aber nicht; warum auf einmal, fragen sie, dieser Sprung in das Sprachliche? Jede Realwissenschaft kann mit den Mitteln der heutigen mathematischen Semantik in eine Sprachwissenschaft umgewandelt werden; zum Beispiel statt von den Wirbeltieren zu sprechen, kann man vom Gebrauch des Wortes "Wirbeltier" reden. Ist es aber einmal erlaubt, das Seiende in Tiere und Pflanzen zu teilen, dann darf man vielleicht auch allgemeinere Einteilungen bilden, die nicht mehr der Biologie angehören, sondern einer allgemeineren, der allgemeinsten aller Wissenschaften — und das wäre die Ontologie. Tatsächlich haben sich diese Gegenargumente zuletzt, besonders in den Vereinigten Staaten Amerikas, als sehr einflußreich erwiesen. Gerade unter den führenden Logikern sind es viele, die einmal in ihrer Mehrheit dem Positivismus gehuldigt haben, die heute eifrig Ontologie treiben. Ein klassisches Beispiel ist der bekannte Logiker der Universität Harvard, Professor Quine.
Noch eine dritte Meinung könnte formuliert werden. Man könnte nämlich fragen, ob es überhaupt möglich ist, irgend etwas vom Seienden im allgemeinen zu sa[>96]gen, außer der Trivialität: "Das Seiende ist seiend", oder: "Was ist, ist." Es ist nämlich nicht gleich einzusehen, welche Art von anderen Aussagen in dieser Wissenschaft vorkommen könnte.
Mir scheint nun, daß man diese Frage am besten dadurch beantwortet, daß man einfach Ontologie treibt, daß man ihre Probleme aufstellt und zu lösen versucht. Das ist auch, was alle großen Philosophen der Vergangenheit, von Plato bis Hegel, immer getan haben; und heute, nach einer relativ kurzen Periode ohne Ontologie, besitzen wir wieder eine lange Reihe von überzeugten Ontologen. Wir werden ihnen einfach in einigen ihrer Untersuchungen folgen.
Und zuerst eine ganz kleine und auf den ersten Blick leicht zu lösende Frage — die aber während der letzten Jahrzehnte viele Diskussionen hervorgerufen hat: die Frage um das Nichts. Wir haben gesagt, daß alles, was ist, ein Seiendes ist. Daraus scheint zu folgen, daß es außer dem Seienden nichts gibt. Und daraus könnte man wieder ableiten, daß es ein Nichts gibt, also daß das Nichts in irgendeiner Weise doch ist, existiert. Vielleicht wird dies als ein Sophisma anmuten. Wir pflegen zu sagen, daß etwas nicht ist — oder wie Sartre es noch schärfer formuliert: daß es nichts gibt. Zum Beispiel: wenn der Motor im Wagen streikt, schaut einer in den Vergaser und sagt: „Im Vergaser gibt es nichts." Die Frage lautet nun: ist dieser Satz wahr? Offenbar ist er manchmal wahr. Wenn aber ein Satz wahr ist, dann muß es in der Wirklichkeit so sein, wie er sagt. Das ist die Definition der Wahrheit. Also muß es ein Nichts im Vergaser geben.
Übrigens: wir sprechen sinnvoll vom Nichts, zum Beispiel jetzt rede ich darüber. Wenn ich aber über etwas [>97] sinnvoll rede, dann muß dieses Etwas ein Gegenstand sein. Andernfalls würde ich gar nicht darüber sprechen können. Also ist das Nichts ein Gegenstand. Also ist es. Und doch ist es nichts; also: es ist nicht."
Anmerkung zu Bochenski: Das stimmt natürlich nicht, denn man kann über jeden Unsinn und auch selbst hochgradigen Unsinn reden. Daraus folgt hinsichtlich seiend oder nicht seiend noch gar nichts. Nichts: die Sache mit dem Nichts ist leicht zu lösen. Nehmen wir einen Bierdeckel, worauf ein Glas steht. Jetzt nehme ich das Glas weg und sage: auf dem Bierdeckel steht nichts (mehr), "ist" nichts (mehr). Mit zwei, drei anderen Beispielen ist das "Problem" mit dem Nichts, besser mit dem nicht, erschöpfend geklärt, so dass es auch ein Vorschulkind verstehen kann. Da müssen also keine bedeutungsschwangeren dicken Wälzer (Das Sein und das Nichts) geschrieben werden, die mehr vernebeln, verdunkeln, verwirren und absurdisieren als sie aufklären. Der Existenzialismus scheint doch recht nahe an der Geisteskrankheit (> gesunder Wahn; > normaler Wahn; > rollenfunktioneller Wahn; > wissenschaftlicher Wahn). Ein großer Fortschritt wäre übrigens schon erreicht, wenn man auf Substantivierung (Das Nichts) verzichtete. Nicht oder Nichts ist ein ontologischer Grundbegriff, der, bezogen auf einen Sachverhalt, schlicht ausdrückt, dass der Sachverhalt nicht gegeben ist. So wird das Wort allenthalben, u.a. auch in der Logik mit einem eigenen Negatorzeichen verwendet.
__
Ding an sich bei Kant
Eisler erklärt (Abruf 29.10.17): "Ding an sich. Unter "Ding an sich" versteht Kant die Wirklichkeit, wie sie unabhängig von aller Erfahrungsmöglichkeit, für sich selbst besteht, die absolute Realität. Wir erkennen das Wirkliche nur in den Formen der Anschauung (Raum und Zeit) und des Denkens (Kategorien); diese Formen hat die Wirklichkeit nur in Beziehung auf das erfahrende Bewußtsein, nur als Gegenstand eines solchen, nicht an sich selbst."
Man kann auch in der Online Ausgabe Gesammelte Werke Kants nach <Ding an sich> suchen und sein Verständnis erweitern und vertiefen beim Meister selbst.
__
Fiktion
Vaihinger kommt in seiner Philosophie des Als Ob (1913, 2.A) erst relativ spät zu einer systematischeren Beschreibung, was er mit Fiktion meint. Seine Zusammenfassung der Hauptmerkmale von Fiktionen (Gesperrtschrift bei Vaihinger hier fett-kursiv) findet sich auf S. 171 ff:
- Selbstwiderspruch S. 172: "... Bei den echten Fiktionen zeigt sich der Selbstwiderspruch besonders in Antinomieen, welche aus denselben entstehen (vgl. Kants Antinomieen über das Unendliche; Kant wies eben daraus nach, dass der unendliche Raum subjektiv, in unserer Sprache also fiktiv sei). ..."
- Weghebung Fiktionsbegriffe sind nur vorübergehend nützlich, werden nur provisorisch benötigt und fallen am Ende wieder aus: heben oder kürzen sich weg. S. 173: "... Ebenso folgt der Ausfall der echten Fiktionen im Laufe der Denkrechnung notwendig aus dem Merkmal des Widerspruchs — denn schliesslich wollen wir zu widerspruchslosen Resultaten gelangen: widerspruchsvolle Begriffe können also schliesslich nur zur Elimination da sein; ausserdem ergibt ja auch die Tatsache, dass trotz dieser widerspruchsvollen Begriffe richtige Resultate im Rechnen und Denken erreicht werden, dass jene Fiktionen auf irgend eine Weise beseitigt und die in ihnen begangenen Widersprüche rückgängig gemacht werden müssen."
- Bewusstsein "Das dritte Hauptmerkmal einer normalen Fiktion ist das ausdrücklich ausgesprochene Bewusstsein, dass die Fiktion eben eine Fiktion sei, also das Bewusstsein der Fiktivität, ohne den Anspruch auf Faktizität. Ich sage indessen: einer „normalen"; dies Merkmal trifft nur zu bei solchen Fiktionen, wie sie sein sollen. ..."
- Zweckmäßigkeit S. 174: "Ein weiteres wesentliches Merkmal der Fiktionen, d. h. der wissenschaftlichen, ist, dass sie Mittel zu bestimmten Zwecken sind; also ihre Zweckmässigkeit. Wo eine solche nicht zu sehen ist, da ist die Fiktion eben unwissenschaftlich. Wenn also Hume die Kategorien Fiktionen nennt, so hat er damit zwar faktisch das Richtige erkannt, allein sein Begriff der Fiktion war ein ganz anderer als der unsrige. Sein Begriff der „fiction of thought" ist, dass diese Gebilde bloss subjektive Einbildungen seien; unser Begriff (entlehnt aus dem Gebrauch der Mathematik und Rechtswissenschaft) schliesst ein, dass sie zweckmässige Einbildungen seien. Hierin liegt eigentlich der Schwerpunkt unserer Auffassung, durch den sie sich von den bisherigen Auffassungen wesentlich unterscheidet. Das Wesentliche an der Fiktion nach unserer Auffassung ist nicht etwa, dass sie, wie manche meinen, eine „unsichere Hypothese" sei, was ganz falsch ist, aber auch nicht bloss, dass sie eine bewusste Abweichung von der Wirklichkeit, eine blosse Einbildung sei, — sondern wir betonen die Zweckmässigkeit dieser Abweichung. ...
Durchgangspunkte des Denkens
"Nach diesen Vorausschickungen können wir uns nun daran wagen, zunächst eine allgemeine Theorie aller Fiktionen zu entwickeln; die Theorie der einzelnen Fiktionen dagegen, d. h. die Theorie dieser speziellen Methoden muss der Spezialdiskussion vorbehalten bleiben. Hier handelt es sich um eine Behandlung en bloc, um die Feststellung der allgemeinsten Grundzüge der Methodologie der Fiktion, die freilich schon in ihren wesentlichen Teilen in dem bisher Gesagten, mehr oder minder offen auf der Hand liegend, enthalten ist.
Das Denken macht Umwege: dieser Satz enthält das eigentliche Geheimnis aller Fiktionen; und es handelt sich für die logische Betrachtung vor allem darum, diese Umwege streng zu trennen von den eigentlichen Ausgangs- und Zielpunkten des Denkens, während die Fiktionen eben nur Durchgangspunktedes Denkens, keineswegs des Seins, sind. Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass zwischen den beiden Punkten der Empfindung und Bewegung (die aber auch schliesslich auf Empfindung zu reduzieren ist) die ganze Vorstellungswelt, das ganze subjektive Begriffsgebäude des Menschen mitten drinnen liegt. Freilich, sahen wir, ist die Beurteilung eines Begriffes, einer Methode als Fiktion, als fiktiv, relativ: in Bezug auf eine für Wirklichkeit angenommene Vorstellungsweise ist eine andere Vorstellungsweise fiktiv, während jene selbst dann in Bezug auf eine andere auch wiederum für fiktiv erklärt werden muss. Es ist eben eine stetig und allmählich [>176] ansteigende Verfälschung der Wirklichkeit durch das Denken zu konstatieren, so, dass auf Einem Punkte das Vorhergehende als Wirklichkeit gilt, während es doch selbst schon schliesslich in Fiktionen wurzelt.
Die eigentlich letzte logische Erkenntnis in Bezug auf die Fiktionen ist und bleibt die Betrachtung derselben als Durchgangspunkte des Denkens. ..."
Kritische Anmerkung Fiktion Diese vier Merkmale müsste Vaihinger bei allen seinen Beispielen aufzeigen und nachweisen, was er leider nicht tut, so dass das gewaltige Werk weitgehend über das Vorstadium einer kühnen Forschungshypothese nicht hinauskommt.
__
fiktionale Varianten im Sinne Vaihingers
Hans Vaihingers Philosophie des Als Ob hat zum zentralen Gegenstand den Begriff der Fiktion und ihre Bedeutung in der Wissenschaft und Geistesgeschichte. Eine Fiktion im Sinne Vaihinger ist eine falsche oder keine Realität repräsentierendes geistiges Modell (Konstruktion), das für bestimmte Zwecke und Ziele aber nützlich ist und auf Umwegen der Wahrheit und Erkenntnis dienen kann. S. 17 führt er aus (Gesperrtschrift bei Vaihinger hier fett-kursiv):
- „Wir unterschieden Kunstregeln und Kunstgriffe
des Denkens, eine Einteilung der Denkmittel, welche wir vorläufig
festhalten wollen. Auch bei anderen Funktionen ist diese Unterscheidung
von Wert; Kunstregeln sind das Zusammen aller jener technischen
Operationen, vermöge welcher eine Tätigkeit ihren Zweck, wenn
auch mehr oder weniger verwickelt, so doch direkt zu erreichen
weiss, und welche aus der Natur jener Tätigkeit und der sie reizenden
Umstände unmittelbar folgen, welche insbesondere in keinem Widerspruch
stehen mit der allgemeinen Form der bezüglichen Tätigkeit. Auch
in der Logik nennen wir solche Operationen, wie vor Allem die Operationen
der Induktion, Kunstregeln des Denkens. Kunstgriffe
aber sind solche Operationen, welche, einen fast geheimnisvollen Charakter
an sich tragend, auf eine mehr oder weniger paradoxe Weise dem gewöhnlichen
Verfahren widersprechen, Methoden, welche, dem nicht in den Mechanismus
eingeweihten, nicht so fertig geübten Zuschauer den Eindruck des Magischen
machend, Schwierigkeiten, die das bezügliche Material der betreffenden
Tätigkeit in den Weg wirft, indirekt zu umgehen wissen. Solche
Kunstgriffe hat auch das Denken; sie sind wunderbar zwecktätige Äusserungen
der organischen Funktion des Denkens. Und wie in gewissen Künsten
und Handwerken solche Kunstgriffe geheim gehalten werden, so bemerken wir
auch dasselbe bei dem logischen Geschäfte. ...“
__
Geschaeftsfaehigkeit
__
GmbH
"Randnummer 39 Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist eine selbständige juristische Person (§ 13 Abs. 1 GmbHG). Nach außen handelt sie grundsätzlich durch ihre Geschäftsführer als Organe der Gesellschaft."
Quelle: Büsching in Römermann, Münchener Anwaltshandbuch GmbH-Recht, 3. Aufl. 2014, Rn 38-48
__
Grundprinzipien Sozialontologie (Searle)
__
juristische Person
Avenarius (1985), S. 208, führt aus: "Juristische Person
ist ein rechtstechnischer Begriff, der rechtlich geregelte Organisationen
erfaßt, denen die Rechtsordnung eigene > Rechtsfähigkeit zuerkennt
(so z. B. im Privatrecht der > Verein, im öfftl. Recht die > Gemeinde).
Der Umfang der Rechtsfähigkeit der j. P. ist insoweit beschränkt,
als ihr die den natürlichen Personen vorbehaltenen Rechtsgebiete (insbes.
das Familienrecht, aber auch etwa die Staatsangehörigkeit) verschlossen
sind. Inwieweit sich j. P. auf Grundrechte berufen können, richtet
sich nach dem Wesen des Grundrechts u. nach der Art der j. P. Die j. P.
ist im Prozeß > parteifähig. Sie nimmt durch ihre Organe
(z.B. beim Verein Vorstand u. Mitgliederversammlung) am Rechtsleben
teil (> Handlungsfähigkeit) u. haftet für die von ihren Organen
oder von anderen verfassungsmäßig berufenen Vertretern begangenen
schadenersatzpflichtigen Handlungen (§§ 31, 89 BGB). Aufgaben,
Organisation u. Zuständigkeitenverteilung der j. P. werden durch eine
> Satzung geregelt.
Zu unterscheiden sind j. P. des Privatrechts u. des öffentlichen
Rechts: ... ..."
__
Handlungsfähigkeit
Avenarius (1985), S. 187 "Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit,
rechtlich bedeutsame Handlungen vorzunehmen, insbesondere Rechte zu erwerben
u. Pflichten zu begründen. Sie ist von der > Rechtsfähigkeit
als der jedem Menschen und den > juristischen Personen gegebenen Fähigkeit,
Träger von Rechten u. Pflichten zu sein, zu unterscheiden. Die H.
beruht auf je nach Rechtsgebiet unterschiedlichen Voraussetzungen. Sie
umfaßt u. a. die > Geschäftsfähigkeit, > Deliktsfähigkeit,
> Ehefähigkeit, > Testierfähigkeit. Fehlt einem Menschen die
H., bedarf er eines > gesetzlichen Vertreters. Juristische Personen sind
durch ihre Organe handlungsfähig."
__
Intersubjektiv
Es wird kaum eine Aussage über die Welt geben, der jeder Mensch
zustimmt. Das Kriterium ist daher zu idealistisch und so nicht zu gebrauchen.
Daher scheint es mir sinnvoll ein realistischeres, ein relatives Intersubjektivitätskriterium
zu suchen, z.B. 90% aller Grundgebildeten. Sagen 91% aller Grundgebildeten
z.B., dass die Erde von kugelförmiger Gestalt ist, so wäre das
Kriterium der relativen Intersubjektivität hier erfüllt.
__
Kategorienlehre (Aristoteles)
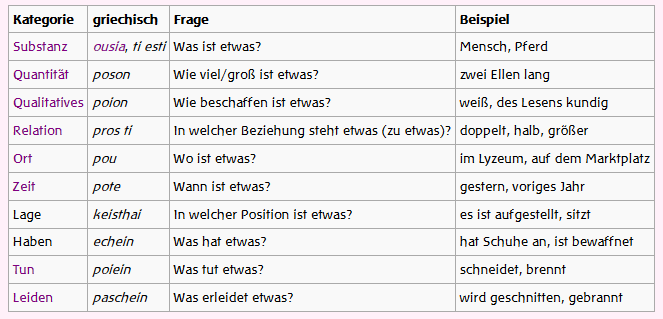
Quelle: https://anthrowiki.at/Kategorien#Die_10_Kategorien_des_Aristoteles
__
Koerperschaft "Körperschaft
ist eine mitgliedschaftlich verfaßte u. unabhängig vom Wechsel
ihrer Mitglieder bestehende Organisation. Es gibt K. des Privatrechts (z.B.
Verein, AG, GmbH) u. solche des öfftl. Rechts (Staat, Gemeinde, Hochschule
u.a.). Eine K. ist i.d.R. rechtsfähig (> Rechtsfähigkeit) u.
damit > juristische Person. Doch kennt vor allem das öfftl. Recht
auch teil- und nichtrechtsfähige K. (teilrechtsfähig ist z. B.
der Fachbereich einer Hochschule, nichtrechtsfähig sind öfftl.-rechtl.
Verbandseinheiten wie die Berliner u. Hamburger Bezirke). Die K. entsteht
im Privatrecht i.d. R. durch Rechtsgeschäft (Satzung) mit sich anschließender
Eintragung im gerichtlichen Register (z. B. Vereinsregister), im öfftl.
Recht grundsätzlich durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes.
Die K. des öfftl. Rechts dienen öfftl. Zwecken. Ihnen
stehen im allgemeinen hoheitliche Befugnisse zu; ..."
Quelle Avenarius (1985), S. 219.
__
Meixner (2004), S. 9: "1. Was ist Ontologie?
Das Thema dieses Einführungsbuches ist die Allgemeine Metaphysik
oder Ontologie. Daneben gibt es die Spezielle Metaphysik, die jedoch nicht
Thema dieser Einführung ist. In der Allgemeinen Metaphysik geht es,
grob gesagt, um die Grundstrukturen des Wirklichen und Nichtwirklichen
auf einer ganz allgemeinen Ebene, d.h. um die allgemeinsten Strukturen
und Unterscheidungen im Wirklichen und Nichtwirklichen.
Die Allgemeine Metaphysik hat dabei rein beschreibenden
Charakter: Die Grundstrukturen des Wirklichen und Nichtwirklichen werden
beschrieben, aber sie werden nicht erklärt. Wenn man nach Erklärungen
sucht, dann ist das vielmehr ein Thema für die Spezielle Metaphysik.
In der Speziellen Metaphysik geht es um Welt und Mensch, und dabei rücken
dann auch gewisse kontingente Gegebenheiten dieser wirklichen Welt in den
Mittelpunkt. Es wird gefragt: Warum bestehen diese kontingenten
Gegebenheiten, wo sie doch als kontingente Gegebenheiten nicht bestehen
müssen?
Aber die Spezielle Metaphysik ist, wie gesagt, nicht das Thema dieser Einführung."
__
Metaphysik
Falkenburg (2012), S. 15f erklärt: "Der Terminus Metaphysik
hat in dieser Liste eine Sonderstellung, denn alle anderen Begriffe
der Liste zählen seit alters her zur Metaphysik, [>16] auch wenn sie
Ihnen zum Teil vom alltäglichen Sprachgebrauch her vertraut sein mögen.
Deshalb erkläre ich diesen Begriff zuerst. Geprägt wurde er,
als spätere Philosophen die Werke des Aristoteles katalogisierten.
Das Buch mit den grundsätzlichsten und abstraktesten Begriffen seiner
Philosophie wurde hinter die Physik-Vorlesung gesetzt und bekam so den
Titel „Meta-Physik“, und das hieß damals wörtlich nur: Schriften,
die nach der Physik kommen. Aristoteles hatte philosophisch vor
allem als Sprachanalytiker gearbeitet; er analysierte, was und wie seine
philosophischen Vorgänger (von den ersten Vorsokratikern bis Platon)
so redeten und was bei ihnen Begriffe wie „Grund“ oder „Ursache“ bedeuteten.
Seine eigenen Definitionen schuf er dann oft, indem er einseitige Begriffsbildungen
seiner Vorgänger zusammentrug und systematisierte. (Ein gutes Beispiel
dafür ist seine Vier-Ursachen-Lehre, die ich weiter unten erläutere
und im 5. Kapitel wieder aufgreife.) Erst die neuzeitlichen Rationalisten
überhöhten die Kategorien einer solchen „Metaphysik“ zu einer
Lehre von Gott und der Welt, die sich – in Abgrenzung gegen die empirischen
Wissenschaften – auf reine Vernunft und nichts als die reine Vernunft gründen
sollte, d. h. auf unser Vermögen zu denken. Kant kritisierte, wie
sie dabei die Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens heillos
überstiegen. Seit Kant, und stärker noch seit der Wissenschaftstheorie
des 20. Jahrhunderts, gelten metaphysische Begriffe als unwissenschaftlich,
soweit sie keinerlei empirische, erfahrungsgestützte Bedeutung haben."
__
Person
Friedrich (1996), S. 290: "Person. Man unterscheidet natürliche
und juristische Personen. Natürl. Person ist jeder lebende
Mensch. Jur. Per. sind Organisationen: Personenzusammenschlüsse, die
einem bestimmten gemeinsamen Zweck dienen (z.B. eingetragener Verein),
oder Vermögensmassen, denen die Rechtsordnung zugesteht, selbständig
Träger von Rechten und Pflichten zu sein (z.B. Stiftung). Sie sind
> rechtsfähig. Es gibt jur. Pers. des a) Privatrechts und b) öffentlichen
Rechts. Beispiel: a) eingetragener Verein, privatrechtl. Stiftung,
Aktienges., GmbH; b) Körperschaften (z.B. Gemeinde), Anstalten (z.B.
Rundfunk), Stiftungen des öffentl. Rechts."
__
Nichts
Ein ontologischer Lieblingsbegriff der Existenzialisten von dem so
gesprochen wird, als gäbe es DAS NICHTS, wobei es auch
homunculusartig tätig sein kann, wenn Heidegger etwa sagt: Das
Nichts nichtet (Analyse und Kritik Carnap 1931/32) Am einfachsten erklärt
man nichts mit wegnehmen: wenn man etwas wegnimmt, etwa ein Glas von einem
Bierdeckel, dann ist es nicht mehr da, an seiner Stelle ist nichts.
__
Rechtsfaehigkeit
Geiger et al. (1996), S. 368: "Rechtsfähigkeit ist die
Fähigkeit, selbst Träger von Rechten und Pflichten zu
sein. Alle Menschen (= natürliche Personen) sind von der Geburt bis
zum Tod rechtsfähig. Auch > juristische
Personen sind rechtsfähig; teilweise müssen sie jedoch vorher
in ein Register (zum Beispiel Handelsregister) eingetragen worden sein.
Im Prozeßrecht entspricht der Rechtsfähigkeit die > Parteifähigkeit.
Von der Rechtsfähigkeit sind die > Geschäftsfähigkeit und
die > Handlungsfähigkeit zu unterscheiden."
__
Seiendes als solches >
Bochenski.
Aristoteles nennt sein erstes Kapitel im Vierten Buch Metaphysik "Die
Wissenschaft vom Seienden als solchen und die Einzelwissenschaften".
"1. Die Einzelwissenschaften untersuchen jeweils einen Teil (..gr..) des
Seienden. - 2. Die Erforschung der Prinzipien und letzten Ursachen und
der Elemente geht auf das Seiende als solches.
(1.) Es gibt eine Wissenschaft (epistime), welche das Seiende [Rn20]
als solches (..gr..) untersucht und das demselben an sich Zukommende. Diese
Wissenschaft ist mit keiner der einzelnen Wissenschaften identisch; denn
keine der übrigen Wissenschaften handelt allgemein von dem Seienden
als solchen, sondern sie scheiden sich einen Teil des Seienden aus und
untersuchen die [Rd25] für diesen sich ergebenden Bestimmungen (..gr..),
wie z.B. die mathematischen Wissenschaften. (2.) Indem wir nun die Prinzipien
und die letzten Ursachen erforschen, ist offenbar, daß diese notwendig
Ursachen einer Wesenheit an sich (..gr..) sein müssen. Wenn nun auch
diejenigen, welche die Elemente des Seienden suchten, diese Prinzipien
suchten, so müs-[Rn30]sen auch die Elemente des Seienden dies nicht
in akzidentellem Sinne sein, sondern insofern sie sind. Auch wir also haben
die ersten Ursachen des Seienden als solchen aufzufassen."
__
substantivische,
hypostasierend-homunkuleske Sprache
DAS Sein, DAS Nichts, DIE Natur, DER Mensch, DIE Schuld, DIE Welt,
DAS ICH, ES, ÜBERICH, DIE Intelligenz, ... usw. usf.. Abstrakta
und Allgemeinbegriffe werden
oft so gebraucht, als wären sie Individuen, Dinge, die selbstständig,
wie eigene Geschöpfe, handeln oder etwas bewirken können.
__
Unwesentlich
Das, was nach Hinzufügen oder Entfernen das Wesen eines Sachverhalts
gleich lässt. Ob man Eis am Stil, im Becher oder in der Waffel isst,
verändert "das Wesen" (Geschmack, Stoffart) des Eises nicht. Die Präsentationsweise
ist also unwesentlich.
__
Urteilsfaehigkeit
__
Vertragsfähigkeit
__
Wesen
Vieldeutiger und gefährlicher philosophischer Begriff über
den sich Tonnen von Papier ergießen. In der GIPT bestimmen wir das
Wesen eines Sachverhalts durch die Invarianzregel bei Veränderungen.
Die Farbe eines Stuhl ist ihm nicht wesentlich, denn wenn er eine andere
Farbe erhält, ist er immer noch ein Stuhl. Wesentlich ist für
einen Stuhl, dass er Beine hat, die ihn tragen, einen Sitz auf dem man
sitzen kann und eine Lehne zum anlehnen. Nimmt man die Lehne weg, ist aus
dem Stuhl ein Hocker geworden. Nimmt man Sitz oder Beine weg ist es kein
Stuhl mehr. Zum Wesen einer Person gehört das, was sie von anderen
unterscheidet und nur ihr zu eigen ist.
Wesentlich heißt oft: unter diesen oder jenen
Aspekten für wichtig erachtet.
Genauer betrachtet hängt die Wesensbeurteilung
aber von den Zielen und Zwecken und der Situation ab. Die Farbe des Stuhls
kann dann wesentlich sein, wenn es um Stil und Ästhetik geht. Bei
Eignungsfragen spielt das Wesen einer Person u.U. eine untergeordnete Rolle,
wesentlich ist dann, was sie für das Anforderungsprofil leisten kann.
So scheint auch für Wesentlichkeitsbetrachtungen ein Relativitätsprinzip
zu gelten: Was wesentlich "ist", hängt von den Zielen und Zwecken
ab, unter denen eine Betrachtung erfolgt. Was hieße, wenn wir als
Ziel und Zweck die "reine Erkenntnis" annehmen? Nun, das hängt davon
ab, was unter "reiner Erkenntnis" verstanden werden soll. Wir können
"reiner" auch weglassen, dann lautet die Frage: Was ist das Wesen des Stuhls
unter dem Gesichtspunkt der Erkenntnis? Denkt man sich Funktion des Sitzens
weg, dann bleibt die Beschreibung eines geometrischen Gebildes: drei oder
vier Säulen, darauf eine Platte und daran eine weitere Platte, Leitern
oder ähnliches.
__
Wesenheit an sich
Unklarer Ausdruck von Aristoteles in seiner Metaphysik.
__
Wirklichkeit
__
Standort: Ontologie des Psychosozialen.
*
Überblick Begrieffanalysen.
Kritik des Sprachgebrauchs in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften.
Mitglied und Gruppe, Version, Element und Menge, Individuum und Klasse, Teil und Ganzes. Eine kritische, wissenschaftstheoretische und empirische Analyse mit besonderer Berücksichtigung sog. OMCG-Rockergruppen.
Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Wissenschaft site: www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, R. (DAS). Ontologie des Psychosozialen aus allgemeiner und integrativer psychologischer Sicht. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/wistheo/OdPS.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_ Ontologie des Psychosozialen_ Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_
korrigiert: irs 04.11; 29.10.2017
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
11.11.2020 Referenzwelten mit Signaturen.
24.04.2019 Endnoten ... Link Wirklichkeit.
11.11.2018 Popper-Eingangs-Zitat.
04.11.2017 Glossareintrag Fiktion.
29.10.2017 Korrektur irs
21.10.2017 Angelegt und mit der Ausarbeitung für die Internetpräsentation begonnen