- Vergleicht man die Fichte-Tabelle mit zweitwertigen
Wahrheitswerttabellen, so drängt sich die Wahrheitswertfunktion des
nicht ausschließenden oders
auf: wwwf. Die Teil-Ganzes-Interpretation der Fichte-Tabelle erscheint
mir intuitiv stimmiger als die zweiwertige Interpretation des nicht ausschließenden
oders.
Hegel, hochgebildet, aber durch und durch naiv-unkritisch, identifizierte - idealistisch entrückt - Sein und Geist als eines (»Das Absolute ist der Geist«), was ihm Referenzieren und echtes Forschen ersparte. Wissenschaftliches Arbeiten war ihm völlig fremd. Er hielt sich und sein eigenes Denken für die Wissenschaft und Wirklichkeit - wie später, wenn auch nicht ganz so extrem, Freud (>Junktim) und die PsychoanalytikerInnen. Sein Glaube, mit seinem System sei die wissenschaftliche Entwicklung und Philosophie abgeschlossen (>Hegel als Ende der philosophischen Entwicklung), ist nicht nur widersprüchlich zur Idee der Dialektik sondern ein guter Kandidat für eine paranoide Größenidee wie seine Systematik für ein Wahnsystem. Dazu passt auch, dass, was er dachte, für die Wirklichkeit schlechthin zu halten. Immerhin: seine Grundidee dass alles Existierende seinen Gegensatz enthält, und aus der Auseinandersetzung und Entwicklung dieses Gegensatzes das Werden, die Bewegung und die Veränderung entsteht, ist originell und kreativ. Aber seine Ausführungen und Erklärungen sind völlig unzulänglich und konfus, weitgehend unerklärt und damit unverständlich, so dass sein System als Mischung aus Wahn, philosophischer science fiction und Geisteslyrik anzusehen ist - bestenfalls als Anregung für die eine oder andere Hypothese. Wie alles Schillernde, Unklar-Diffuse und Vieldeutige ist Hegel natürlich ein Eldorado für Interpreten und sch^3-Syndromatiker, wovon Hegel selbst zweifellos als der derzeitig größte Olympionik aller Zeiten erscheint. Grundsätzlich gilt natürlich, dass Geisteskrankheit und wissenschaftliche oder gar schöpferische Kultur-Leistungen sich nicht ausschließen. Man bedenke immer auch den Huber zugeschriebenen Ausspruch: "Die meisten schizophrenen Menschen sind die meiste Zeit ihres Lebens nicht schizophren".
Im Pathogramm bei Lange-Eichbaum (siehe bitte aber auch Hegel fehlt) wird ausgeführt (S. 45): "Häufig Magenbeschwerden. Schnell erschöpft. Wind- und wetterfühlig. Psychische Depressionen. Heiter und verstimmt. Freundlichkeit und Zomesausbrüche. Liebenswürdig und schnell verstimmt. Nächtens Unruhe. Magenschmerzen (3). Ein Kommilitone sagte zu Hegel: “Hegel, du säufst dir gewiß no der bißle Verstand vollends ab” (6). Hatte als 35jähriger ein Verhältnis mit seiner verheirateten Hauswirtin, aus dem ein Sohn Ludwig hervorging (3, 19). Schizophren (20, 21). Schizophrene Symptome infolge seines chronischen Alkoholismus. Leibhalluzinationen [Alkohol!] und einfache Eigenbeziehung. Also eher pseudoneurotische Schizophrenie entstanden auf der Basis eines verwöhnten und verzärtelten Kindes, das zum Alkoholiker wurde (22)."
Und in der "PSYCHOPATHOGRAPHISCHE WERTUNG" (S 46) wird zusammengefasst: "Untersetzt; schizoid. — Charakter- bzw. Wesenszüge: liebenswürdig, naiv, hochgebildet, besessen, fröhlich, gesellig, einsam, ernst, Würde, Behaglichkeit, Ruhe, Besessensein, klug, Entrüstung, Zorn, verschlossen, streitbar, verletzlich, kritisch, politisch, spekulativ, schwerfällig, Mißlaunigkeit, rastlos, Sorge, unwirtschaftlich, haltlos, paradox, widerspruchsvoll, Bewegungsarmut, Größenideen, unberechenbar, übersteigert, idealistisch, gemütszart, erregbar, verträglich, introvertiert. — Psychodynamisch dominant: Ehrgeiz, Zorn und [innere] Einsamkeit. - Funktionstypologisch: introvertierter Denk- bis Empfindungstypus. - Dominante Temperamentsfaktoren: Minderwertigkeitsgefühl, Stimmungslabilität und Selbstgenügsamkeit. - Intelligenz: überdurchschnittlich. - Begabungstyp: idealistischer und sachlogischer Denker.
Hegel war zweifellos kein gesundes Hochtalent, weder psychisch [Persönlichkeitsstörung] noch organisch [durch Alkoholismus]. Seine widerspruchsvolle Persönlichkeit läßt sich nicht ohne weiteres erklären [dazu die Überlagerung durch den Alkoholismus]. Eine [einfache] Schizophrenie dürfte nicht vorgelegen haben. Und sein plötzlicher Tod ist fast mit Sicherheit auf ein Leberversagen zurückzuführen. Eine ausführliche Psychographie über Hegel fehlt und wäre von hohem wissenschaftlichen Wert. ..."
Literaturhinweise "1 Glück/Nier-Glück 1983, 2 Enggasser (o. J.), 3 Wiedmann 1965, 4 Rosenbranz 1844, 5 Lutz 1989, 6 Koesters 1982, 7 Motzke 1983, 8 Schischkoff 1982, 9 Taylor 1983; 10 Kretschmer 1931; 11 Störig 1978; 12 Révész 1952; 13 Weischedel 1984; 14 Schischkoff 1982; 15 Orthbandt (o. J.); 16 Bonin 1982; 17 Jaspers 1971; 18 Störig 1950; 19 Prause 1950; 20. Treher 1985; 21 Treher 1989; 22 Kemer/Ritter 1988; 23 Regnard 1889-99; 24 Herzberg 1926a; 25 Pabst/Ritter 1989; 26 Kerner/Ritter 1989."
__
Vernunft und Wirklichkeit
"Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig."Alles was wirklich ist, ist vernünftig, und alles was vernünftig ist, ist wirklich" Quelle: Vorrede zu „Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse“, 1833, S. 17, hervorgehoben durch Sperrung und Mittung:
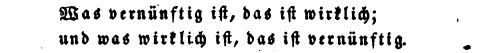
Aufklaerungsgegner
"»Die Aufklärung, diese Eitelkeit des Verstandes, ist die heftigste Gegnerin der Philosophie«
Quelle: Meineke (1832, Hrsg.), Hegel Werke, 12. Bd. "Vorlesungen über die Religion Nebst einer Schrift über die Beweise vom Daseyn Gottes", Zweiter Band, S. 287 [GB]
__
Hegel als Ende der philosophischen Entwicklung
"Dieß ist nun der Standpunkt der jetzigen Zeit, und die Reihe der geistigen Gestaltungen ist für jetzt damit geschlossen. - Hiermit ist diese Geschichte der Philosophie beschlossen. Ich wünsche, daß Sie daraus ersehen haben, daß die Geschichte der Philosophie nicht eine blinde Sammlung von Einfällen, ein zufälliger Fortgang ist. Ich habe vielmehr ihr nothwendiges Hervorgehen aus einander aufzuzeigen versucht, so daß die eine
Philosophie schlechthin nothwcndig die vorhergehende vorausseht, Das allgemeine Resultat der Geschichte der Philosophie ist: 1) daß zu aller Zeit nur Eine Philosophie gewesen ist, denn gleichzeitige Differenzen die nothwendigcn Seiten des Einen Prinzips ausmachen; 2) daß die Folge der philosophischen Systeme keine zufällige, sondern die nothwendige Stufenfolge der Entwickelung dieser Wissenschaft darstellt; 3) daß die letzte Philosophie einer Zeit das Resultat dieser Entwickelung und die Wahrheit in der höchsten Gestalt ist, die sich das Selbstbewuftseyn des Geistes über sich giebt. Die letzte Philosophie enthält daher die vorhergehenden, faßt alle Stufen in sich, »ist Produkt. [>691] und Resultat aller vorhergehenden."
Quelle: Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, Bd. III, letztes Kaptel E Resultat, S. 690f.
__
Hegel im Eisler (1904)
"HEGEL bestimmt das Sein selbst als Denken, das (absolute) Denken (der Begriff, s. d.) ist Sein. Seele und Leib sind »eine und dieselbe Totalität derselben Bestimmungen«, die Seele erscheint im Leibe, dieser ist die Äußerlichkeit jener (Ästh I, 154 ff.)." [Quelle]
"Den »absoluten« Idealismus vertritt HEGEL, d.h. die Ansicht, daß die endlichen Einzeldinge nur Momente, Erscheinungen des allgemein-konkreten, absoluten Seins, der Weltvernunft sind (»Panlogismus«). " [Quelle]
__
Hegel fehlt
Die Literaturangaben zu Treher sind mehrfach falsch. Das Hauptwerk mit 374 Seiten zu Hegel ist nicht von 1989 und auch nicht von 1985, sondern von 1969:
_
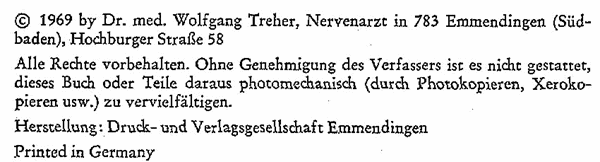
Das Beklagen "Eine ausführliche Psychographie über Hegel fehlt und wäre von hohem wissenschaftlichen Wert. ..." ist angesichts des Werkes von Treher mit seinen 374 Seiten eine Frechheit und spricht nicht für den wissenschaftlichen Wert der Arbeit Lange-Eichbaums. Allerdings ist einzuräumen, dass Treher seine gesamte (Werk-) Analyse nur auf das Werk "Die Phäonomenologie des Geistes stützt" und bei genauerer Betrachtung wissenschaftlich auch sehr zu wünschen übrig lässt (> Trehers Analyse)
Drües (1976) Arbeit - Zur Pathographie Hegels (113-171) - hat immerhin auch 58 Seiten. Die bei Drüe zitierte Stelle A. 121 zu Lange-Eichbaum passt nicht zum Zitat oben. Lange-Eichbaum hat Hegel übrigens schon 1935 in Genie, Irrsinn und Ruhm pathologisiert, S. 258: "So sind manchmal Hochtalente, obwohl anscheinend gesund, doch in Familienstammbäume eingestreut, die in nächster Verwandtschaft mehr oder weniger zahlreiche Psychopathien und Psychosen aufweisen. Sie sind latent labil. Solche „am Abgrund“ waren: Hauff, Justinus Kerner; weiter Richelieu (seine Schwester „etait folle“) und Hegel (auch die Schwester „folle“ n. Moreau 132 S. 523, 529)."
__
Internetseite
Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren, geben wir nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia, DER SPIEGEL)
__
Vorsicht bei Zitaten, insbesondere Zitatensammlungen.
Das Internet ist ein Eldorado für Abschreiber, Fälscher, Trickser, Plagiateure, Behaupter, Meiner, Angeber und Dünnbrettbohrer. Es ist eigentlich eine Unverschämtheit, ohne Quellen, Belege und Fundstellen zu zitieren, aber es wird dauernd gemacht, auch in der Wissenschaft, bevorzugt in der Psychologie, in der der Hochstaplerzitierstil erfunden wurde. Und selbst wenn Fundstellen genannt werden, können diese falsch sein.
__
Trehers Analyse "Hegels Geisteskrankheit"
- Inhaltsverzeichnis.
- Die leitende Idee des Buches.
- Die Schizophrenie des jungen Hegel - Analogie zum Fall Herbert.
- Hegels naturphilosophisches Weltbild.
- Pendelschwung und Ich-Levithian beim jüngeren Hegel.
- Psychopathologische Aspekte der Geschichts-„Philosophie“ des jungen Hegel.
- Trehers Analyse der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes.
- Aus der Schlussbetrachtung.
- Erster Gesamteindruck.
Einen ersten Eindruck vermittelt das
"Inhaltsverzeichnis
- Vorwort 7
I. Abteilung 9
Einführung: Das Prophetentum und seine sozialkatalytische Funktion
9
Die Freiheit des Individuums, die Entstehung des Rechts und sein Verhältnis
zum Staat 36
Die Ich-Reflexion im inneren Freiheitsspielraum (Phantasieraum) und
ihre funktionelle Aufhebung im Augenblick des Krankwerdens 50 Robespierre
68
Die Entphysiognomierung der Wirklichkeit durch Wissenschaft. „Geist“
als wissenschaftlicher Intellekt: Das Problem des Ludwig Klages 80
Ideologie (G. Lukacs) und soziologische Ideologiekritik (E. Topitsch)
in kritischer Spiegelung 93
Das schizophrene Weltbild als Strukturschema der Krankheit.
Betrachtung über Heautoskopie (Sich-selber-Sehen), 1. Teil
109
Das theoretische Schizophreniemodell 121
Phänomenologische Nachlese zu Schreber, Steiner, Hitler 134
Der Mittelpunkt der Münchner Kosmiker: Die Schizophrenie Alfred
Schulers 151
II. Abteilung 173
Psychopathologische Hegel-Forschung heute und ihr Motiv 173
Hegel-Impressionen von Zeitgenossen. Schopenhauers Hegel-Kritik und
die „Enkomiastik“ der Schule 179
Hegels familiäre Belastung mit Schizophrenie 193
Die Schizophrenie des jungen Hegel. Das „Erkennen des Anschauens“.
Betrachtung über Heautoskopie, 2. Teil 196
Hegels naturphilosophisches Weltbild, rekonstruiert nach seinem „ersten
System“ 206
Pendelschwung und Ich-Levitation beim jüngeren Hegel 214
Psychopathologische Aspekte der Geschichts-„Philosophie“ des jungen
Hegel 225
Die Phänomenologie des Geistes, psychopathologisch erschlossen
und bis Seite 418 kommentiert 232
Die Vorrede 232
Die Einleitung. Die „Prüfung des Erkennens“ 265
Die sinnliche Gewißheit; oder das Diese und das Meinen 270
Die Wahrnehmung; oder das Ding und die Täuschung 277
Kraft und Verstand, Erscheinung und übersinnliche Welt 279
Die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst 285
Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewußtseins;
Herrschaft und Knechtschaft 288
Freiheit des Selbstbewußtseins; Stoizismus, Skeptizismus und
das unglückliche Bewußtsein 297
Gewißheit und Wahrheit der Vernunft 304
Beobachtende Vernunft 308
Die Beobachtung des Selbstbewußtseins 312
Die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch
sich selbst 314
Die Lust und die Notwendigkeit 320
Das Gesetz des Herzens und der Wahnsinn des Eigendünkels 323
Die Tugend und der Weltlauf 326
Die Individualität, welche sich an und für sich selbst reell
ist 330
Das geistige Tierreich und der Betrug, oder die Sache selbst 332
Die gesetzgebende Vernunft 342
Die gesetzprüfende Vernunft 345
Der Geist 349
Ende des Kommentars 353
Schlußbetrachtung 359
Literaturverzeichnis 367
Personenregister 369
Sachregister 372"
Die leitende Idee des Buches
Das Buch besteht aus zwei Teilen: I: das (falsche) Prophetentum in
der Geschichte der Menschheit und der Psychopathographie Hegels überwiegend
beschränkt auf die Analyse der Phänomenologie des Geistes,
S. 7f:
- "Im Zentrum der vorliegenden Studien steht die den Vergesellschaftungsinstinkt
auslösende Krankheit, die Schizophrenie, selbst, deren Symptomatologie
an klinischen und historischen Beispielen erläutert wird. Die Kasuistik
schließt mit einem Kommentar der Psychopathologie Georg Wilhelm Friedrich
Hegels, die dieser unter dem Titel „System der Wissenschaft, Erster Teil,
die Phänomenologie des (hinzuzusetzen: kranken) Geistes“ selbst verfaßt
hat.
Die Aussage, daß Hegel geisteskrank gewesen sei, mag zunächst befremden, hat sie doch seit Schopenhauer, den man nicht ernst nehmen mußte, niemand mehr gewagt. Sie steht gegen die Tradition, gegen die angesammelte Macht von Meinungen, die man sich in [>8] generationenlanger Bemühung um die Aneignung des (rational nicht assimilierbaren) Hegelschen Werkes gebildet hat. Vor dergleichen kapitulierte sogar Goethe, der am 11. Juni 1822 zum Kanzler von Müller sagte: „Ein Buch, das große Wirkung hatte, kann eigentlich gar nicht mehr beurteilt werden.“ Hegel kann wahrlich einem Buch von großer Wirkung verglichen werden. Aber es ist jenes Goetheworts ungeachtet nicht ausgemacht, daß die mit Hegels Namen verknüpfte geistige Macht für alle Zeiten unangefochten das Feld behauptet. Gegen sie steht das Material einer Erfahrungswissenschaft, die zu Goethes Zeit noch nicht existierte. Ihre Rolle in einer allgemeinen Anthropologie ist auch heute noch kaum abzuschätzen. -
Sollten sich die Ergebnisse dieser Untersuchungen als stichhaltig erweisen, so wäre es nicht unmöglich, daß die endlos scheinenden Diskussionen um Hegels „Philosophie“ doch eines vielleicht noch fernen Tages zur Ruhe kommen. Würde dies nicht die Überwindung eines Gebirgsriegels bedeuten, der, bisher mehr dumpf geahnt als klar erschaut, den Weg in eine freiere und menschlichere Zukunft versperrt? So lautet die Frage, von der der Autor sich wünscht, daß sie den Leser durch sein Buch begleiten möge. [>9]
I. ABTEILUNG
Einführung: Das Prophetentum und seine sozialkatalytische Funktion
Im Gegensatz zu manchen für „Philosophie“ ausgegebenen Gedankensystemen
erhebt Wissenschaft nicht den Anspruch, das Weltprinzip, den Stein der
Weisen oder das „Absolute“ in Person erkannt zu haben. Ihre Denkgebäude
befinden sich ständig gewissermaßen auf dem Prüfstand.
Freilich hat sie, wie jedermann weiß, die Eigenschaft zu wachsen,
und sie vermag es mit Hilfe von Gedankenentwürfen oder Theorien, die
der Bestätigung durch Erfahrungstatsachen fähig sind. Manchmal
fehlt, um eine Theorie zu sichern, noch ein empirisches Glied, zum Beispiel
in der Evolutionstheorie das berühmte missing link der Paläontologen
oder, in der Astronomie, ein vorausgesagter und schon näher lokalisierter,
aber im Teleskop noch nicht gesichteter Planet. Seine Auffindung ist der
wahre Triumph der Theorie und die Selbstrechtfertigung der Wissenschaft.
Dann aber gibt es auch missing links, die niemand vermißt. Das ungesuchte
missing link der Sozialwissenschaften liegt verschüttet unter einem
Berg von Theorien und kommt auch dadurch nicht zum Vorschein, daß
man die Ursachen seiner malignen Wirkungen, das Netz von Stolperdrähten,
welche das zwischenmenschliche und zwischenstaatliche Leben in so rätselhafter
Weise erschweren und krisenanfällig machen, in den „Ideologien“ gefunden
zu haben meint. Doch trifft es zu, daß es hinter den Ideologien steckt.
Es handelt sich um die Geisteskrankheit Schizophrenie, die als eine apersonale
Kraft in der Einkleidung der von uns so genannten Propheten und ihrer nachgelassenen
„Ideen“ die Entstehung von Weltmächten bewirkt und sie gegeneinander
bewegt.
Soziologie und Anthropologie würden ohne den
Begriff des schizophrenen Propheten unvollständig bleiben. ... [>15f]
Der Durchschnittsmensch bezieht sein moralisches Gewissen niemals aus
seinem autonomen Ich, sondern empfängt es immer von „oben“, von einer
in der Höhe, im Scheitelpunkt eines geistigen Raumes lokalisierten
Spenderpersönlichkeit oder von einer „Idee“, die sich irgendwann von
einer solchen Persönlichkeit abgelöst hat. Diese [>16] Persönlichkeit
(die, wie genauere Untersuchung zeigt, des Personseins gerade entbehrt)
und ihre „Idee“ nennen wir ein Wahrheitszentrum, weil es über eine
„Ausstrahlung“ verfügt, die die Empfängerpersönlichkeiten
plötzlich befähigt, zwischen gut und böse zu unterscheiden.
Sie haben sich unter der Wirkung solcher Ausstrahlung, vergleichbar den
Eisenfeilspänen in einem Magnetfeld, polarisiert.
Der Spender ist immer ein schizophrener Prophet. ..."
Die Schizophrenie des jungen Hegel - Analogie zum Fall Herbert
S. 196 beginnt Treher unter dem Titel "Die Schizophrenie des jungen Hegel. Das 'Erkennen des Anschauens'. Betrachtung über Heautoskopie, 2. Teil" (196-205):
_
- "Am Anfang der Hegel’sehen Philosophie steht die Heautoskopie, das
Sich-selber-Sehen, wovon wir schon ausführlich gehandelt hatten. Um
die Verbindung zwischen der allgemeinen Schizophreniepsychopathologie und
der speziellen Form, in der sie Hegels „Philosophie“ ist, herzustellen,
bringe ich das hegeloide Zustandsbild eines klinischen Patienten. Herbert,
so nennen wir den dreißigjährigen Arztsohn, mußte krankheitshalber
seine Laufbahn als Luftwaffenoffizier aufgeben. Er studierte, bis die Subventionen
der Bundeswehr ausgelaufen waren, Philologie und Psychologie und wurde
schließlich Nachtportier in einem Hotel. Nach seiner Aufnahme im
Krankenhaus berichtete er: „Ich bin jetzt hier, weil ich ein wenig überfordert
war, schlaflich. Ich hatte mich übernommen, ermüdet, meine geistige
Kraft verbraucht. Ich studiere nämlich Psychohistorik. Ein
Psychohistoriker ist ein Mensch, der die Geschichte auf psychoanalytische
Weise zu studieren sich vornimmt. Da hab ich einiges erfahren, psychoanalytisch
Menschen zu erkennen durch Dialoggespräche, die wandeln sich in einen
Monolog, den sprech ich dann selbst. Da hängt ein Wort sich an ein
anderes, das ist die Sprunghaftigkeit von Wort zu Wort. Da kann man Verbindungen
ziehen. Ich kann mir jetzt vorstellen (er schließt die Augen, Hegel
würde sagen: ich tauche in die innere Nacht der Seele) Napoleon auf
dem Zug nach Rußland. Es gibt dann eine Gefühlsverbindung zu
dem, was ich sehe, was ich mir vorstelle als Film. Diese sichtbare
(!) Vorstellung kann ich dann geistig verdauen. Ich komme an die Probleme
der Weltgeschichte heran. Der Deutsche steht hier, der Franzose da. Jetzt
kommt eine Idee. Die Ideen sind in die Welt hineingegeben, und nun kommen
die Menschen, die lassen sich davon erfüllen. Ich selbst war nicht
nur offen für eine Idee, sondern für alle Ideen. Die mußte
ich alle in mich hineinfressen. Dann mußte man die Nervenkraft
haben, das Gute und Böse in der Gewissens-[>197]erforschung rückblickend
wieder zu reinigen, man muß die Kraft haben, die Ideen zu
verdauen.“ Der Patient vergleicht sich einem Adler, der die Speise in seinem
Kropf für die Jungen vorverdaut und ihnen nur gibt, was ihnen zuträglich
ist, die passende Diät. Er sei ein Verdauungsapparat, der das Schlechte
aussondern könne ..."
Aus dieser Einführung mit dem Fall "Herbert" kann ich keinerlei
Zusammenhang zu Hegel, seinem Werk Phänomenologie des Geistes
(PdG) und zur Schizophrenie erkennen. Treher belegt hier auch nichts am
ausgewiesenen Werk (PdG), sondern zitiert andere Autoren (Haym, Hoffmeister,
Rosenkranz, Wiedmann).
_
Hegels naturphilosophisches
Weltbild
Es folgt "Hegel naturphilosophisches Weltbild, rekonstruiert
nach seinem ersten System" (206-213):
- "...
Ehe wir den Leser in diesen ersten kosmologischen Versuch Hegels einführen, machen wir darauf aufmerksam, daß sich dessen krause und bizarre Phantastik schon bei seiner Entstehung mit dem damals erreichten Niveau der naturwissenschaftlichen Forschung nicht vertrug und mit den geringen naturwissenschaftlichen Kenntnissen jener Zeit weder entschuldigt noch erklärt werden kann. ..."
Die starke Wertung "krause und bizarre Phantastik" (206)- die ich im Grundsatz teile - wird von Treher aber nur behauptet, nicht belegt, begründet und abgeleitet. Die Berufung auf Haym, S. 207, wenn sie auch noch so treffend ist, genügt hier nicht:
_
- "... „Niemals vielleicht, weder vor noch nach Hegel, hat jemals ein
Mensch so wieder gesprochen oder geschrieben. Eine Diktion, bald abstrakter
als die des Aristoteles, bald dunkler als die Jakob Böhmes so beschaffen
ist die harte und stachliche Schale, aus der man den noch unausgewachsenen
Kern der Hegelschen Anschauung herausschälen muß“ (S. 94)."
Das kann man so sehen, aber es wäre detailliert zu begründen. Es bleibt mir ein Rätsel, weshalb Treher auf Sekundärliteratur zurückgreift und nicht Hegel direkt zitiert. Sein ganzes Werk ist ein einzigartiger Beleg für eine unwissenschaftliche, wirre und konfuse Theorie und Sprache, tatsächlich eine "krause und bizarre Phantastik", was aber zu zeigen ist (> Beispiele).
_
Pendelschwung und Ich-Levitation beim jüngeren Hegel
Das nächste Kapitel "Pendelschwung und Ich-Levitation beim jüngeren Hegel" (214-224) ist genau so unklar wie das vorhergehende, fast wie Hegels Schriften selbst. S. 214:
_
- "Seit über hundertfünfzig Jahren, seit es eine wissenschaftlich
betriebene Psychiatrie gibt, sucht man nach der „Grundstörung“ der
Schizophrenie, und vor ungefähr 150 Jahren stand Hegels „Philosophie“
in Blüte, die genau diese Grundstörung, nach der die Psychiater
sich blind suchen, zum Inhalt hat. Die Schulkinder lernen aus Hegels Philosophie
den Rhythmus der Trias: These, Antithese, Synthese (> zur Trias-Hypothese
kritisch Winter). Die Entdeckung der Trias als eines angeblichen Grundgesetzes
der Natur, aller lebendigen und zumal der weltgeschichtlichen Entwicklung
wird als Hegels „geniale“ Leistung gepriesen. Es handelt sich dabei aber
bloß um die zu einem „philosophischen“ System ausgebaute schizophrene
Grundstörung, nach welcher so lange vergeblich gefahndet wurde.
Hegels Beschreibung folgend, fassen wir die Grundstörung als eine Dreiecksfigur auf, die das Ich durchläuft, wenn es, zwischen den Hälften seiner geborstenen Seele pendelnd, zugleich über ihnen mittelständig in die Höhe steigt. Wir entnehmen diesen Sachverhalt einem Referat Hoffmeisters, überschrieben: „Vom göttlichen Dreieck“."
Es werden weitere wirre Ideen Hegels (S. 215) zitiert. Aber eine
wirre Theorie ist noch kein zwingendes Symptom für eine Schizophrenie,
Es wäre von Treher zu zeigen, nicht nur zu meinen
und zu behaupten, wie es Psychiater so oft machen.
_
Psychopathologische Aspekte der Geschichts-„Philosophie“
des jungen Hegel (225-232)
Der Abschnitt beginnt zunächst mit Ausführungen zu Hitler
(S. 225), der, neben Steiner (S. 226: "... Man fühlt sich an das bunte
Tiergewimmel in Steiners zum Leichnam gewordener „Erde“ erinnert, denn
ein staatlicher Leichnam ist für Hegel das alte Kaiserreich."), immer
mal wieder zum Vergleich herangezogen wird. Die psychopathologischen Aspekte
der Geschichts-„Philosophie“ des jungen Hegel werden nicht klar analysiert.
_
Trehers Analyse der Vorrede
zur Phänomenologie des Geistes (PdG)
"Die Phänomenologie des Geistes, psychopathologisch erschlossen
und bis Seite 418 kommentiert
Die Vorrede
Hegel macht, wie andere Kranke, seine schizophrene Grundstörung
zum Prinzip der Welterklärung und aller jemals dagewesenen Philosophien
sowie darüber hinaus und im gleichen Atemzuge zum Prinzip des Weltbaus
überhaupt. Die Phänomenologie, sein Hauptwerk oder jedenfalls
sein erstes großes Werk, ist eine monumentale Anhäufung von
Belegen für diese These. Dem Kommentar der Vorrede schicke ich, gekürzt,
eine Rekapitulation der „Grundstörung“ voraus.
Die am Anfang der schizophrenen Psychose stehende Seelenzerreißung
hinterläßt zwei im Verhältnis gegenseitiger Verneinung
befindliche, miteinander unverträgliche, „feindliche“ Seelenhälften,
mit denen sich das Ich des Kranken im Pendelschwunge abwechselnd vereint.
Der Pendelschwung blendet das Ich ab gegen die Tatsache der ständigen
Gegenwart und Simultaneität der Autoaggression auf beiden Seiten der
gespaltenen Seele und erlaubt ihm die Interpretation dieser Auseinandersetzung,
wenn sie als „Denken“ empfunden wird, als zeitliche Aufeinanderfolge logischer
Widersprüche. Die Übertragung eines logischen Widerspruchs in
die Realität würde die Vernichtung der miteinander im Widerspruch
stehenden Parteien bedeuten, sofern beide gleich stark wären und zur
Gänze miteinander reagieren würden. Beispielsweise würde
sich die Vereinigung von gleichen Quanten Materie und Antimaterie in die
Gleichung + 1-1 = 0 fassen lassen, Materie und Antimaterie würden
explosionsartig von der Bildfläche verschwinden. Tatsächlich
findet in den schizophrenen Kranken an den Grenzflächen ihrer Seelenhälften
(Schrebers „Himmelsgewölbe“, Steiners „ätherischer Schädeldecke“,
Hitlers Hauptkampflinie und Hegels „Grenze der Unterschiede“) ständig
eine solche Vernichtung oder „Aufhebung“ von Plus- und Minusquanten statt,
aber sie geht nur in winzigen Portionen vor sich. Sie ist das Prinzip einer
zweiten Gattung „Aufhebung“, die als [>232] Ich-Levitation neben die „Negation“
tritt. Steiners verbrennende „Pflanzensamen", die urzeitliche „Flugzeuge“
in die Höhe tragen, Hitlers „Herzblut der Bewegung“, das als Blutstrom
der Blutzeugen den Führergeist in den Unsterblichkeitshimmel hebt,
und Hegels Geist-Emanation aus der „Verbrennung des Herzens“ erläutern,
welche Bewandtnis es mit dieser Art Aufhebung hat. Da der verbrennende
Seelenstoff portionsweise in winzigen Quanten verbraucht wird und sich
möglicherweise regeneriert (Hitler sieht im „Blutstrom“ das Vermehrungsprinzip
seiner „Bewegung“ und seines „Volkskörpers“, Schreber kennt ein „Strahlenerneuerungsgesetz“
und Hegel spricht vom „Wiedererschaffen des Erschaffenen“), kann sich der
gesamte Verbrennungsprozeß über die Länge eines Lebens
erstrecken. - Nicht in der äußeren Wirklichkeit, sondern ausschließlich
im Innern des Kranken entspricht der pathologischen Autoaggression, die
logisch als Denken in Widersprüchen erscheint, ein ständiges
„Werden“, nämlich die immer weitergehende Fragmentierung der Seelensubstanz
innerhalb der geteilten Seelenhälften, über deren Schuttpyramiden
sich das levitierte Ich erhebt und die optische Täuschung eines wundervollen,
unendlich kreativen Weltprozesses noch unterstützt. Die geistesgesunden
Verehrer solcher Weltbilder und ihrer Propheten machen die Sinnestäuschung
mit, weil sie den logischen Widerspruch nicht als Gleichung +1 — 1=0 durchschauen,
und sie durchschauen ihn nicht, weil ihn das pendelnde Ich nur in zeitlicher
Aufeinanderfolge zur Darstellung bringen kann. In diesem Gewande aber („Du
mußt steigen oder fallen, Amboß oder Hammer sein“) wird er
seit je akzeptiert; jahrtausendealte Gewöhnung läßt ihn
sogar als das Natürlichste von der Welt erscheinen.
Nach dieser zusammenfassenden Erinnerung von schon Gesagtem versuchen
wir, uns an die Vorrede der Phänomenologie heranzumachen. - Hegel
beginnt damit, den Gegensatz des Wahren und Falschen, soweit er auf philosophische
Systeme
angewendet zu werden pflegt, aufzuheben. Es sei gewöhnlich, daß
ein System nach seiner Richtigkeit oder Falschheit abtaxiert werde. Solche
Gewohnheit begreife „die Verschiedenheit philosophischer Systeme nicht
so sehr als die fortschreitende Entwicklung der Wahrheit, als sie in der
Verschiedenheit nur den Widerspruch sieht. Die Knospe verschwindet in dem
Hervorbrechen der Blüte, und man könnte sagen, daß jene
[>234] von dieser widerlegt wird; ebenso wird durch die Frucht die Blüte
für ein falsches Dasein der Pflanze erklärt, und als ihre Wahrheit
tritt jene an die Stelle von dieser. Diese Formen unterscheiden sich nicht
nur, sondern sie verdrängen sich auch als unverträglich miteinander“
(S. 10).
Wir sehen auf den ersten Blick, daß unverträglich miteinander
bloß die Hegelschen Seelenhälften sind, die er in die an seiner
Schizophrenie ganz unschuldige Pflanze hineinprojiziert. Sein pendelndes
Ich macht die verlassene Seelenhälfte, in der sein Ich gerade nicht
steckt, worin es sich aber soeben noch befunden hatte und welche es als
„Leichnam“ hinter sich gelassen hat, zu einer „falschen“ Wirklichkeit,
und er identifiziert dieses in die Unwirklichkeit entrückte Falsche
mit der verflossenen Entwicklungsphase einer Pflanze. Der Projektionsvorgang
ermöglicht es ihm, die an der Pflanzenentwicklung scheinbar demonstrierte
Aufeinanderfolge von Widersprüchen, d. h. die Aufeinanderfolge von
Falschheiten gleichwohl für richtig und lebensnotwendig zu erklären,
und er kann daraus einen scheinbar doppelten Gewinn ziehen, denn er hat
so etwas wie eine Erklärung der Pflanzenentwicklung17 gegeben
und gleichzeitig die Brauchbarkeit seines entwicklungstheoretischen Prinzips
dargelegt. Die „flüssige Natur“ der aufeinander folgenden und sich
verdrängenden Formen, so erklärt er, mache sie „zugleich zu Momenten
der organischen Einheit, worin sie sich nicht nur nicht widerstreiten,
sondern eins so notwendig als das andere ist; und diese gleiche Notwendigkeit
macht erst das Leben des Ganzen aus“ (S. 10). Wie diese „Flüssigkeit“
zustandekommt, werden wir bald erfahren."
So viel als Beispiel für Trehers Analysemethode
der Phänomenologie des Geistes.
Aus der Schlussbetrachtung
(359-366)
Sie beginnt wie folgt:
"Schlußbetrachtung
Doch weil,
was ein Professor spricht,
Nicht gleich
zu allen dringet,
So übt
Natur die Mutterpflicht
Und sorgt,
daß nie die Kette bricht
Und daß
der Reif nie springet.
Einstweilen,
bis den Bau der Welt
Philosopie
zusammenhält,
Erhält
sie das Getriebe
Durch Hunger
und durch Liebe.
- _
Friedrich Schiller behauptet in seinem satirischen Gedicht „Die Weltweisen“ die Existenz eines Sachverhalts, daß nämlich Hunger und Liebe und nicht die Theorien der Weisheitslehrer das „Getriebe“ dieser Welt in Gang hielten. Seine Aussage ist so primitiv und scheinbar selbstverständlich, daß es verwegen erscheint, ihr widersprechen zu wollen, erst recht, nachdem eine große, mit dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit auftretende geistige Bewegung, die Psychoanalyse, ungefähr dasselbe behauptet20. Und doch ist sie im humanen Bereich falsch. Wir wissen heute, daß weder niedere Triebe noch die hohe Göttin Vernunft die menschlichen Dinge regieren. Dies tut stattdessen eine dritte Instanz, eine Sphäre scheinbar übernatürlichen Ursprungs, das „Reich der Ideen“, die jenseitige Heimat der schizophrenen Propheten. Mag man auch außerhalb ihres Einflußbereiches abwertend von Ideologien sprechen; am Ort ihrer Wirkung ist alle Kritik weggefegt und es herrscht unbeschränkt [>360] die vom Propheten induzierte Glaubensmacht, deren positive Leistung der Staatsgründung und der innerkollektivischen Rechtsordnung mit der Bedingung des Krieges nach außen, im Extremfall mit der Forderung nach Weltgeltung und Welteroberung erkauft wird. Gemessen an dieser von der Urzeit bis heute ungebrochenen Wirklichkeit fallen alle Theorien, die eine Abhängigkeit des „Bewußtseins“ vom Entwicklungsstand der Produktionsmittel und -kräfte behaupten, in nichts zusammen. Man kann gar nicht genug darüber staunen, wie unberührt das vielberufene Bewußtsein, sei es der Arbeiterklasse oder irgendeiner anderen gläubigen Gruppe, von den technischen Revolutionen geblieben ist, die man, wie die Entwicklung von Raketen und Computern, bereits nach Generationen zählt. Von einer damit schritthaltenden Entwicklung von Bewußtseinsgenerationen ist an den von den Ideen der Propheten gegängelten Menschen nichts wahrzunehmen."
- FN20: "Freud stützt sich expressis
verbis auf Schiller. Im sechsten Kapitel seiner Schrift über das Unbehagen
in der Kultur sagt er: „Von allen langsam entwickelten Stücken der
analytischen Theorie hat sich die Trieblehre am mühseligsten vorwärtsgetastet...
In der vollen Ratlosigkeit der Anfänge gab mir der Satz des Dichterphilosophen
Schiller den ersten Anhalt, daß ,Hunger und Liebe' das Getriebe der
Welt Zusammenhalten.“"
S. 361: "Verkehrte Welt“ und „Narrenschiff“ (Seb.Brant, 1457—1521) sind gültige Bilder unserer Altvorderen, die möglicherweise das Verkehrte und Närrische unserer Welt schärfer erkannten als wir, wenn ihnen auch die innere Naturnotwendigkeit des Narrenschiffs als gesellschaftlicher Institution ebenso verborgen blieb. ...
Die zyklische oder orthodoxe Geschichte gehorcht dem Alles-oder-Nichts-Gesetz der Hegelschen Dialektik. Ihm ordnen sich alle nicht gelungenen Häresien und die erfolgreichen Revolutionen unter."
Es folgt auf S. 363:
"Ich möchte schließen mit einem Hinweis auf den Historiker, der meinen Auffassungen nahezustehen scheint, auf Franz Altheim, dessen diagnostischen Blick ich bewundere. Vorausschicken möchte ich, daß dieser Autor den Prophetencharakter der „Gewaltigen“ der Geschichte, Alexanders, Attilas, Dschingis Khans erkannt zu haben scheint. Daß Alexander von seinen Soldaten „der makedonische Wahnsinnige“ genannt und gegen Ende seines Lebens mit dem Gott Dionysos identifiziert wurde, „der allgemein als der göttliche Wahnsinnige bekannt war, weil sein Vater Zeus ihn zum Wahnsinn getrieben hatte“, behauptet auch der englische Historiker Arthur Weigall (zit. nach Domarus I, S. 9). Altheim fügt dem hinzu, daß Alexander vorgehabt habe, bis an die äußersten Ränder der Erde, wo sie an den Okeanos grenzt, vorzudringen. Er hatte wahrhaftig die ganze Welt erobern wollen. Noch genauer weiß man durch die „Byzantinische Geschichte“ des Priskos über Attilas Seelenverfassung Bescheid. Attilas Unberechenbarkeit beschert ihm Glück. Die erweiterte Macht bringt ihm in Verbindung mit seinem „irrationalen“ Vorgehen noch mehr Glück und so im Zirkel weiter. Die ihn beobachtenden römischen Gesandten sprechen „offen von seiner mangelnden Fähigkeit, auf andere einzugehen und Maß zu halten. Er werde nie Ruhe geben und werde nicht zögern, nach dem Höchsten zu greifen. Entscheidenden Anteil mißt man seiner Überzeugung zu, von Gott berufen zu sein. Es sind dämonische, irrationale Kräfte, die Attila vorwärts drängen“ (Altheim S. 57). Eine Kuh scharrt aus dem Boden ein Schwert. Der Kuhhirte bringt es zu Attila, der darin das endlich wiedergefundene Schwert des Kriegsgottes „erkennt“ und nunmehr weiß, daß er zum Herrn der Welt berufen ist: „Denn durch Gottes Schwert werde ihm Gewalt über [>364] die Kriege gegeben (S. 59). ..."
Erster Gesamteindruck
Eine umfangreiche Monographie mit 374 Seiten mit vielen interessanten
Aspekten, die in ihrer psychopathologischen Methodik in Bezug auf Hegels
Geisteskrankheit nicht überzeugt, hingegen schon hinsichtlich der
Bedeutung des (falschen) Prophetentums. Die apodiktische Behauptung S.
16 "Der Spender ist immer ein schizophrener Prophet." erscheint mir fraglich
und nicht ausreichend empirisch fundiert.
Querverweise:
- Überblick zu meinen Arbeiten über das Auserwählt-Syndrom.
- Übersicht Differentielle Psychologie und Psychopathologie der Persönlichkeit.
- Übersicht - Psycho-Moden, psychische Epidemien, Epidemiologie und systemimmanente Kunstfehler.
- Herrscher Typen. Ein historisch-politpsychologischer Entwurf.
- Biographie, Lebenslauf, Kritische Lebensereignisse, Entwicklung der Persönlichkeit, Psychographie, Pathographie, Psychopathographie. Forschung, Konzept und Methodik - Literatur und Linkliste.
- Schizophren und Schizophrenie.
- Buchhinweis zu Carola Burkhardt-Neumann: Bin ich wirklich schizophren? Die unsicheren Diagnosen der Psychiatrie und ihre Folgen für die Patienten.
_
Trias-Hypothese
Kritische Interpretation Winter (o.J.) Was ist Dialektik? (PDFOnline.): S.1: "Drittens zeigt die Diskussionserfahrung, dass der Ausdruck Dialektik oft nur als bloßes Schlagwort benutzt wird, um im Vertrauen auf seine geheimnisvolle Wirkung Eindruck zu machen. Häufig werden dann zur „Erklärung“ noch rasch drei weitere Fremdwörter genannt: These, Antithese und Synthese2, die ihrerseits aber genau so ungeklärt sind wie das Wort Dialektik selbst und daher zum Verständnis keinen Beitrag leisten. Es wird sich sogar zeigen, dass die schablonenhafte Verwendung dieser Wörter ungeeignet ist, den Begriff der Dialektik im Sinne Hegels angemessen zu erfassen. Hegel selbst hat sie auch an keiner Stelle seines Werkes verwendet, um den Begriff der Dialektik zu definieren. Vielmehr gehen die Begriffe These, Antithese und Synthese auf Kant und Fichte zurück, die sie aber auch nicht zur Bestimmung von Dialektik, sondern in ganz
anderen Zusammenhängen gebraucht haben.3"
Ausführlich: S. 18ff: "8. Die Problematik der Begriffe „These, Antithese, Synthese“.
S. 20 (Schlusssatz): "Weder Platon noch Heraklit noch Hegel und auch nicht Marx haben sich bei der Bestimmung der Dialektik der Begriffsreihe „These, Antithese und Synthese“ bedient.""
__
Standort: Deutscher philosophischer Idealismus.
*
Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben.
Überblick: Abstrakte Grundbegriffe aus den Wissenschaften.
Wissenschaft in der IP-GIPT.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
* Logik site: www.sgipt.org * Analogie site: www.sgipt.org * |
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS). Der deutsche philosophische Idealismus - eine Geisteskrankheit? Was ist richtig, was ist falsch? Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/Philosophie/DtIdealism.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_Deutscher philosophischer Idealismus _ Überblick_ Rel. Aktuelles _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag_ Mail: sekretariat@sgipt.org_ _ Wichtige Hinweise zu externen Links und Empfehlungen.
_
korrigiert: 28.11.2018 / 26.11.2018
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
29.11.18 * Fichtes Fehlleistung mit seinem Grundbegriff der Anschauung * Fichte und die Wirklichkeit *
28.11.18 * Hegel fehlt * Vernunft und Wirklichkeit * Aufklaerungsgegner * Hegel als Ende der philosophischen Entwicklung * Vorsicht bei Zitaten, insbesondere Zitatensammlungen. * Internetseite * Begriffliche Vorklärungen in Metzlers Handbuch Deutscher Idealismus * Bemerkung * Trehers Analyse * Trias-Hypothese * Definition Mendelsohn 1785 * Schellings Identitaet von Sachverhalt und Begriff * Hegels Identitaet von Sein und Denken * *
26.11.18 Angelegt und eingestellt.