(ISSN 1430-6972)
DAS=08.05.2018 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 16.10.23
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel_ Stubenlohstr. 20 _D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_Materialien Kausalität im Psychosozialen_Datenschutz_Überblick_Rel. Aktuelles _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_Archiv_ Region__ Service-iec-verlag_ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_
und Psychosozialen
zum Hauptartikel:
allgemein, in Wissenschaft und Leben und besonders im Bio-Psycho-Sozialen und im Recht
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
Materialien zur Kausalitaet im Psychischen, Psychopathologischen und Psychoszialen
* Geltung der Kausalitaet für alle psychischischen Ablaeufe nach Allers et al. (1925) * Lewin (1926) Über die Ursachen seelischen Geschehens * Burkamp (1922) * Kaiser-Werbik * Heider * Entwicklungspsychologie des Kausalitätskonzeptes * Kausalität im Lexikon der Psychologie (Arnold et al.), Phänomenale Kausalität im Psychologie-Lexikon (Arnold et al.) * Herzog zur psychischen Kausalitaet bei Wundt * kausale Kette im Lexikon der Psychologie von Spektrum * Kausalitätswahrnehmung im Handbuch der Psychologie * Thomae: Motivbereich als Ursache für Verhalten * Piaget über Realität und Kausalität * Trauma, psychische Krankheit und Kausalität von Wölk * Wörterbuch der Psychotherapie * Kausalität bei William Stern * Bastine Kausalkonzepte psychologischer Störungstheorien * Problemanalyse in der Psychotherapie * Willensstoerungen in der Psychopathologie nach Fuchs (2017) *
Es sind fast alle Gebiete der Psychologie und Psychopathologie berührt, z.B.: Allgemeine Psychologie, differentielle Psychologie der Persönlichkeit, Entwicklungspsychologie, Handlungstheorie, Kommunikationspsychologie, Krankheitslehre, Lernen und Gedächtnis, Psychologie der Sprache, Psychopathologie, Psychosomatik, Psychotherapie, Sozialpsychologie, Verhaltenstheorie,
Geltung der Kausalitaet für alle psychischischen Ablaeufe nach Allers et al. (1925)
Allers, R.; Bauer, J.; Braun, L.; Heyer, R.; Hoepfner, Th.; Mayer, A.; Pototzky, C.; Schilder, P.; Schwarz, O. & Strandberg, J. (1925) Psychogenese und Psychotherapie Körperlicher Symptome. Wien: Springer. [GB]
S. 38 (Fett-kursive Hervorhebung im Text RS):
"1) Inwieweit ist die kausale Betrachtung psychischer Abläufe
berechtigt?
.Man könnte aber sofort fragen, ob denn nach dem oben Auseinandergesetzten
eine kausale Betrachtung (oder funktionale Betrachtung) des Naturgeschehens
überhaupt berechtigt sei? Die Geschichte der Naturwissenschaften gibt
darauf die Antwort. Erst die strenge Anwendung des Kausalprinzips in der
Naturwissenschaft hat deren gewaltigen Fortschritte ermöglicht. Wir
haben allen Grund, an der kausalen Betrachtung der Naturerscheinungen festzuhalten,
nur eben daß selbst im Geschehen der unbelebten Natur sich ein Rest
grundsätzlich dieser Betrachtung entzieht. Wollen wir naturwissenschaftlich
denken, so müssen wir die belebte Natur unter dem gleichen kausalen
Gesichtswinkel betrachten. Wir wissen, daß die Naturkausalität
nicht geschlossen ist, machen aber von diesem Wissen in der naturwissenschaftlichen
Forschung deswegen nicht Gebrauch, weil wir ja gar nicht das Lebendige,
schlechthin Unberechenbare zu erfassen trachten können, sondern nur
das Unbelebte, das Berechenbare im Weltgeschehen. Die Naturwissenschaft
betrachtet die Welt, soweit sie berechenbar ist. Es ist nun gar keine Frage,
daß die Berechenbarkeit im naturwissenschaftlichen Sinne auch für
den Organismus Geltung haben muß und ebenso auch für alles Psychologische.
Wäre das nicht der Fall, so müßten ja in den Rechnungen
der Physik fortwährend unerklärliche Fehler auftauchen, welche
rätselhaften Interventionen des Psychischen entsprechen. Wir haben
gar keinen Grund, die Kausalreihen, in denen Psychisches eine Rolle spielt,
von den allgemeinen kausalen Gesetzmäßigkeiten auszuschließen.
Dies gilt sowohl von den psychischen Kausalreihen, welche mit einer Bewegung
endigen, also der Reihe zwischen dem Entschluß und seiner motorischen
Kundgebung, als auch von der Strecke zwischen dem Auftauchen der Idee und
dem Fassen des Entschlusses, der Strecke Ps1,— Ps2.
Aber ebenso bestehen kausal faßbare Beziehungen zwischen Gedankengängen
überhaupt, also etwa zwischen Ps0,— Ps1. Auch
hier bestehen gesetzmäßige vorausberechenbare Zusammenhänge,
freilich bleibt grundsätzlich ein unberechenbarer Rest zurück,
dessen Natur wir bei den psychischen Abläufen ja genau erkennen. Ich
habe oben versucht, diesen kausal nicht faßbaren Anteil des Erlebens
zu charakterisieren. ..."
S. 62:
"Die Neurose als bedingter Reflex.
Lewin (1926) Über die Ursachen seelischen Geschehens.
Lewin, Kurt (1926) Über die Ursachen seelischen Geschehens.. In (21-29) Vorsatz, Wille und Bedürfnis Mit Vorbemerkungen über die psychischen Kräfte u. Energien u. d. Struktur d. Seele. Berlin: Springer.
Kritik: Sehr allgemein ("... daß ,,Kräfte" den Abfluß eines Geschehens beherrschen ...", S. 25) und wenig überzeugend (eine neues Wort, Adhäsion, S.21, hat noch keinen Erklärungswert, eröffnet lediglich einen neuen Begriffsverschiebebahnhof. Auch der zentrale Begriff der Kraft oder der Kräfte (36 Fundstellen auf 9 Seiten) wird nicht geklärt und ausreichend belegt.
Burkamp
Burkamp, Wilhelm (1922) Die Kausalität des Psychischen Prozesses und der Unbewussten Aktionsregulationen. Berlin: Springer.
Burkamp hat nach seinem Inhaltsverzeichnis, hier vollständig wiedergegeben, eine vielversprechende Arbeit zum Thema Kausalität im Psychischen vorgelegt. Nachdem ich mich ein wenig eingelesen hatte, ergab sich leider, dass er nur sehr allgemeine Ausführungen ohne konkrete genaue Beispiele macht. Ich habe mich daher mit vier Stichproben bis III. - im Inhaltsverzeichnis ausgewiesen - begnügt.
- "Erster Teil. Problemstellung.
1. Die Wissenschaft von Geschehnissen 1
2. Der Zustand 3
3. Die Kausalfunktion 6
4. Zeitliche Fernbestimmtheit von Geschehnissen 10
5. Der Lebensprozeß, als zirkular stationärer Zustand aufgefaßt 12
6. Lebensprozeß, Kausalgesetz und Freiheit 15
7. Autonome und allonome Ursachen 17
8. Psychoreflexologie. 20
9. Die Zurückführung auf bekannte physikalisch-chemische Gesetze 22
10. Objektive Psychologie 25"
Kritik: Sehr allgemeine Ausführungen ohne konkrete und genaue Beispiele.
Zweiter Teil.
Die Kausalität der niederen Regulationen.
I. Aufgabe und allgemeiner Charakter der biologischen Reaktion.
1. Biologische Aufgabe der Reflexe 30
2. Die vier Aufgaben einer Regulation der Reaktionen 30
3. Topik der Bewußtseinsfunktion 32
I. Bindung an Nervenmasse 32
4. Topik der Bewußtseinsfunktion.
II. Bindung an die Großhirnrinde 34
5. Die vier Wege der Untersuchung des bewußtseinsfreien Nervenprozesses
35
Kritik: Sehr allgemeine Ausführungen ohne konkrete und genaue
Beispiele.
II. Die einfache Zuordnung einer Reaktion zu einem Reiz.
1. Zeitlicher Verlauf. 37
2. Qualitative Mannigfaltigkeit der Reizbedingtheit 40
3. Intensitätsmannigfaltigkeit der Reizbedingtheit 41
4. Lokale Mannigfaltigkeit der Reizbedingtheit 42
Kritik: Sehr allgemeine Ausführungen
ohne konkrete und genaue Beispiele.
III. Kombination der Reize als Reaktionsbedingung.
1. Kombination der Reaktionen 46
2. Kombination der Reize 47
3. Hemmungswirkungen der Reize 49
4. Dauernde Zustande als Reaktionsbedingungen 50
5. Reflexverkettung 53
6. Mitbedingende Wirkung früherer Reize 54
7. Verstärkende und schwächende Nachwirkung eines Reizes
auf einen späteren gleichen Reiz 57
8. Gewohnheit 62
9. Gewohnheitsmäßige Periodizität 65
Kritik: Sehr allgemeine Ausführungen
ohne konkrete und genaue Beispiele.
IV. Anpassung durch Probe.
1. Bestimmtheit des Aufenthaltsortes durch den Gegensatz von Ruhe und
Bewegung 69
2. Richtungswechsel bei ungünstiger Veränderung 70
3. Reaktionswechsel bei Andauer ungünstiger Veränderungen
72
4. Richtungsprobe 76
5. Reizprobe 77
V. Assoziative Beeinflussung.
1. Typische Beispiele der assoziativen Beeinflussung bei den niederen
Tieren 78
2. Die drei wesentlichen Momente der primitiven Assoziation und ihre
Zeitlage 80
3. Starre Bestimmtheiten der Momente und ihre Beziehungen in der assoziativen
Wirksamkeit 85
4. Assoziation und Gewohnheit 91
5. Kausale Struktur der assoziativen Beeinflussung 97
6. Bedeutung anderer Regulationsformen für die assoziative Beeinflussung
103
7. Zweifelhafte Fälle assoziativer Wirksamkeit auf niederen Stufen
des Tierreichs 106
8. Der phylogenetische Anfang der assoziativen Wirksamkeit 111
9. Assoziative Wirksamkeit fehlt beim des Großhirns beraubten
Wirbeltier 112
10. Assoziative Wirksamkeit als neue Differenzierung alter Regulationsformen
115
Dritter Teil.
Die psychische Funktion und ihre Kausalität.
I. Allgemeine Züge des Psychoreflexes.
1. Vielheit und Verwickeltheit der psychischen Regulationen 117
2. Labilität des Gleichgewichtes der Psychoreflexe 118
3. Das Gefühl der Lust und Unlust als psychoreflexologisches Moment
120
II. Die Verhaltung.
1. Überlegung mit abschließendem Willensakt als psyohoreflexologische
Grundfunktion . 124
2. Die Überlegung. 127
3. Die elementare Verhaltung. 129
4. Ausdehnung der Hemmung wahrend der Verhaltung 134
5. Einstrebige, mehrstrebige und unbegrenztstrebige Verhaltungen 135
6. Stärkeunterschiede der Verhaltungen 137
III. Der Akt.
1. Der Akt als Lösung der Verhaltung 139
2. Die Ichbedingtheit des Aktes. 141
3. Die Bedingtheit durch das System der Geltungen 142
4. Entstehung der Geltungen aus Willens- und Urteilsakten. 145
5. Die Systemeinheit der Persönlichkeit. 150
6. Reproduktion des Willens und Urteils 153
7. Teilprobleme psycohoreflexologischer Untersuchungen. 156
IV. Die Erkenntnis.
1. Entscheidende Momente für Wille und für Erkenntnis 158
2. Gegebenes und Erkenntnisgesetz 159
3. Funktionen in der Erscheinung 163
4. Begrenztheit und Ziel des Erkennens 164
5. Erkenntnis als psychoreflexologisches Moment und die Umgebung 166
6. Erkenntnisinhalt und Wirklichkeit 169
7. Gleichheit, Zeitlichkeit und Kausalfunktion 173
8. Begriffliches Denken 175
9. Gebundene und freie Setzung von Begriffen und Funktionen 178
10. Kausalität der Erkenntnisfunktion 81
V. Die Praxis: Gefühl, Motiv und Wert.
1. Lust und Unlust als Urmotive 183
2. Das Motiv der Willensentscheidung 188
3. Finalität und Wertbildung. 191
4. Der Wert 195
5. Wert und Gefühl. 197
6. Das Denken als Grundfunktion des psychischen Prozesses 200
7. Trieb und Gefühl. 201
VI. Die Entwicklung des individuellen und des kollektiven Geistes.
1. Persönlichkeitsentwicklung und Urpersönlichkeit 204
2. Variabilität der Persönlichkeit 207
3. Das lch als geltende Norm aller Geltungen 209
4. Die Freiheit des Ich 213
5. Die Bindung an das logische und axiologische Gesetz 210
6. Der Fortschritt der Wertbildungen 221
7. Die Tradition 223
8. Das Verstehen 225
9. Der Kollektivgeist. 229
10. Der normative kollektive Geist und das Persönlichkeitsideal
237
11. Die Gesetzmäßigkeit des Kulturprozesses 240
12. Die Kausalbestimmtheit der Koeffizienten und Gesetze geistiger
Entwicklung 242
VII. Reproduktion und Assoziation.
1. Reproduktion als regulatorische Notwendigkeit 246
2. Bewußtseinsstufen 248
3. Der geschlossene Kreis des Bewußten 250
4. Der teleologische Charakter der bewußten psychischen Funktionen
255
5. Das Assoziationsgesetz der Reproduktion 259
6. Zweck der Reproduktion auf Grund der Assoziation 262
7. Einfluß von Geltungen auf die Reproduktion 264
8. Vorstellungsassoziation als höhere Entwicklungsstufe 266
9. Weitere assoziative Wirksamkeiten 269
Nachweis von Ausdrücken besonderer Bedeutung 273
Kaiser-Werbik Handlungspsychologie (2012)
Sachregistereinträge:
- Kausalbegriff 47, 91,
-gesetz 91
Kausalismus 31 f.
Kausalität 13, 48, 82, 96 KBS
Heider Persönliche und unpersönliche Kausalität
Aus: Heider, Fritz (1977) Psychologie der interpersonalen Beziehungen. Stuttgart: Klett. S. 148-150
"Zusammenfassung
Wir haben versucht, die Komplexität, die Einsichten und das Versagen
der naiven Psychologie der Handlung zu zeigen, indem wir das explizit gemacht
haben, was phänomenal nicht immer explizit ist. In der Analyse wurde
gezeigt, daß „Können" und „Versuchen" die beiden notwendigen
und hinreichenden Bedingungen einer absichtlichen Handlung sind. Jedes
kann in konstierende Elemente zerlegt werden, das Können in persönliche
Macht und Um-[>149]weltfaktoren, das Versuchen in Absicht und Anstrengung.
Sowohl die Art der dispositionalen Eigenschaften als auch die Bedeutung
der persönlichen Kausalität wurden als für das Verständnis
dieser Konzepte besonders bedeutsam hervorgehoben. Die Faktoren, die Bedingungen
der Handlung und ihre Konstituenten beeinflussen, wurden erörtert.
Die naive Faktorenanalyse der Handlung erlaubt es uns, der Handlung
Bedeutung zu verleihen, die Handlungen von Anderen ebenso zu beeinflussen
wie die eigenen und zukünftige Handlungen vorherzusagen. Die Struktur
von vielen Beispielen dieses Kapitels beruht auf der für die naive
Psychologie impliziten Tatsache, daß Können und Versuchen die
Bedingungen der Handlung sind. Daher werden unsere Reaktionen verschieden
sein, je nachdem, ob wir annehmen, daß eine Person vor allem deshalb
versagt hat, weil ihr die nötige Fähigkeit fehlte oder vor allem
deshalb, weil sie die Handlung nicht ausführen wolle. Im ersten Fall
werden wir von ihr erwarten, daß sie Erfolg hat, sobald die Bedingung
„Können" erfüllt ist. Darüber hinaus könnten wir diese
Bedingung dadurch zustande bringen, daß wir die Aufgabe erleichtern,
Widerstände beseitigen, der Person die erforderlichen Fähigkeiten
beibringen, usw. Im zweiten Fall werden wir jedoch nicht erwarten, daß
die Person die Handlung zustande bringt, selbst dann, wenn solche Veränderungen
verwirklicht sind, durch Beeinflussung des Wollens gibt es die Möglichkeit,
die notwendige Bedingung, Versuchen herzustellen. Folglich wird die Richtung
unserer Anstrengungen eine ganz andere sein. Wir könnten versuchen,
die Person davon zu überzeugen, daß dieses etwas ist, was sie
tun will; wir könnten die positiven Merkmale des Ziels hervorheben
oder an ethische Normen appellieren. In diesem Fall stehen die Bedingungen
der Motivation im Mittelpunkt. Bei diesen beiden Fällen könnten
zusätzlich zu Unterschieden bei der Erwartung und Kontrolle auch unsere
Werturteile ganz unterschiedlich sein. Die Person könnte für
das Ergebnis der Handlung in dem einen Fall viel eher verantwortlich gemacht
werden als im anderen.
Da obige Beispiel scheint einzuleuchten. Schließlich war es unsere
Absicht, Verbindungen aufzuzeigen, wie sie die naive Psychologie vorgibt,
die Handlungen und die Interpretation von Verhalten bei alltäglichen
zwischenmenschlichen Beziehungen möglich machen. Wenn wir die „Logik"
der naiven Analyse der Handlung darlegen, dann implizieren wir aber nicht,
daß die darauf basierenden Schlußfolgerungen immer mit der
objektiven Realität übereinstimmen. Manchmal werden, wie wir
gesehen haben, falsche Schlüsse gezogen, wenn die Bedingungen der
Handlung entweder nur teilweise gegeben sind oder wenn egozentrische Einflüsse
die Kognition verzerren.
Es ist schon bemerkenswert, daß die naive Psychologie der Handlung
so gut funktioniert, wie sie es tut, und sich auf so viele Fälle bezieht,
die Handlung beinhalten. Sie erlaubt Feststellungen über die Attribution
der Handlung, die [>150] Kognition ihrer Komponenten und die Vorhersage
und Kontrolle von Verhalten. Wir haben gesehen, daß sich aus der
naiven Analyse der Wahrnehmung ähnliche Funktionen ergeben, und genau
wie bei der Handlung wird in diesem Bereich die bedeutungsvolle Verbindung
des Menschen mit seiner Umwelt und seine Kontrolle über sie ausgeweitet."
Entwicklungspsychologie des Kausalitätskonzeptes
- Kausalitskonzept angeboren oder erworben?
"Nativisten und Empiristen erklären die Ursprünge des Verständnisses für physikalische Ursachen auf grundlegend unterschiedliche Weise. Die Nativisten gehen von der Tatsache aus, dass sich die Welt ohne ein elementares Verständnis der Kausalität nicht in einen sinnvollen Zusammenhang bringen ließe und dass Kinder bereits in frühester Kindheit ein entsprechendes Verständnis zeigen; daraus leiten sie die Annahme ab, dass Säuglinge ein angeborenes Kausalmodul oder eine Kerntheorie der Kausalität besitzen, mit deren Hilfe sie aus den Ereignissen, die sie beobachten, Kausalbeziehungen extrahieren können (z. B. Leslie 1986; Spelke 2003). Dagegen schlugen die Empiristen vor, dass das Verständnis von Säuglingen für Kausalität aus ihren Beobachtungen unzähliger Ereignisse in der Umwelt hervorgeht (z. B. Cohen und Cashon 2006; Rogers und McClelland 2004). In einem Punkt sind sich beide jedoch einig: Kinder lassen von klein auf eindrucksvolle kausale Schlussfolgerungen erkennen."
Quelle: Siegler et al. (2016), S. 255.
__
Kausales Schlussfolgern in der fruehen Kindheit
"Mit ungefähr sechs Monaten nehmen Kinder kausale Verknüpfungen zwischen einigen physikalischen Ereignissen wahr (Cohen und Cashon 2006; Leslie 1986)."
Siegler et al. (2016), S. 256.
Arnold, Wilhelm; Eysenck, Hans Jürgen & Meili, Richard (1974 ff).Lexikon der Psychologie. Freiburg: Herder. Hier Spalte 1054:
- "Kausalität. Die K. ist eine asymmetrische Beziehung zwischen
zwei Begriffen, von denen der vorausgehende die Ursache und der
nachfolgende die Wirkung genannt wird. Diese Begriffe können
Ereignisse, Phänomene oder Objekte sein. Die Beziehung selbst ist
derart, daß das Eintreten der Ursache notwendigerweise die Wirkung
ergibt. Darüber hinaus geht die Ursache immer der Wirkung voraus.
Man unterscheidet oft zwischen der Ursache eines Phänomens und seiner
Erscheinungsbedingung, da die Ursache für dessen Auftreten hinreichend
ist, während die Erscheinungsbedingung dafür notwendig ist.
Das K.prinzip ist das Prinzip, das für jedes Phänomen eine Ursache postuliert. J. B. Grize" (Spalte 1054)
- "Phänomenale Kausalität, von A. Michotte in Abhebung
von philosophischen, insbes. den empiristischen Erklärungsversuchen
wie bei D. Hume in die Psychologie auf der Basis experimentalpsychologischer
Bedingungsanalysen eingeführter Begriff. Stoßen, Schieben, Ziehen
u.a. sind danach in der visuellen Wahrnehmung unmittelbar vorfindbare kinetische
Konfigurationen mit Gestaltcharakteristika eigener Art. Sie bestehen aus
einem aktiven sich bewegenden Gegenstand A und einem passiven B, der gestoßen,
geschoben, gezogen wird usw., wobei während der Dauer der Einwirkung
von A auf B (Kausalität) B zwar sichtbar seinen Ort verändert,
aber erst nach Abklingen der Einwirkung aktive Eigenbewegung erhält.
Die Ausweitung des Bewegungszustands von A auf B wird Ampliation genannt.
Ohne sie kommt Kausalitätswahrnehmung nicht vor. Mit der Ampliation
verbunden ist die phänomenale Verdoppelung des Bewegungszustands von
B, nämlich sowohl durch A bewegt zu werden (auch wenn [>1599] A inzwischen
zum Stehen gekommen ist) als auch gleichzeitig den Ort zu verändern;
obwohl die Reizgrundlage u.U. bei beiden gleich ist, erscheinen sie verschieden.
Für das Zustandekommen der ph. K. entscheidend ist das Zusammenwirken
von integrativen und segregativen Gestaltfaktoren der Bewegung (Einheit,
Gruppierung u. gemeinsames Schicksal) und der Aufgliederung von Figur und
Grund (getrennte bzw. gemeinsame Kontur der beteiligten Objekte A u. B).
Ihr Zusammenwirken erklärt auch nach der Mechanik paradoxe Kausalwahrnehmungen
wie Stoßen, Schieben u. Ziehen über Distanz (Zwischenraum zwischen
A u. B) während der Verursachung, zeitliche Verzögerung des Auftretens
der Wirkung und schneller werden eines sich bewegenden Bs beim Aufprall
von A.
Piaget und Maroun untersuchten den ontogenetischen Aspekt der ph. K. und führen im Unterschied zu Michotte die visuellen kinetischen Konfigurationen, obwohl sie unmittelbar gegeben sind, auf das taktil-kinästhetische Schema zurück, das sich im Wahrnehmen von Kraft und Widerstand beim Kind aufbaut und später beide Wahrnehmungsmodalitäten gleichzeitig umgreift, wodurch es möglich wird, Kraft u. Widerstand nicht nur zu spüren, sondern auch zu sehen. Theoretisch wird ph. K. bei Piaget und Maroun im Zusammenhang mit den Konstanzphänomenen aus dem mathematico-deduktiven System der Konservierungsbegriffe abgeleitet: Causa aequat effectum. Was A verliert, gewinnt B entsprechend der Tatsache, daß ein Gegenstand bei zunehmender Entfernung nicht kleiner erscheint, sondern weiter weg.
Lit.: Michotte, A.: La perception de la causalité. Louvain et Paris, 1946; ders.: Die Kausalwahrnehmung. In: Metzger, W. & H. Erke (Hrsg.): Hdb. der Psychol., Bd. 1,1. Göttingen, 21974; ders. u.a.: Die phänomenale Kausalität. Ges. Werke, Bd. 1, Bern, 1979. W. Lohr"
Herzog zur psychischen Kausalitaet bei Wundt
"8.1.1 Psychische Kausalität
Wundt hat seine Psychologie auf ein Verständnis psychischer Wirklichkeit gebaut, das diese als momentane Präsenz begreift (vgl. Kapitel 1.3.1). Psychisch real ist, was sich aktual im Bewusstsein befindet: „So viel Aktualität so viel Realität“
(Wundt, 1908, S. 293). Das hat ihn dazu geführt, eine der Psychologie eigene Form von Kausalität zu postulieren. Obwohl er es ablehnte, Begriffe einzuführen, die hypothetischen Charakter haben, wollte er, dem Vorbild der Physik folgend, dass auch die Psychologie Kausalerklärungen gibt. Die psychische Kausalität ist aber eine dem Bewusstsein immanente Kausalität und hat nichts mit der Reduktion psychischer Phänomene auf physiologische Zustände zu tun. „Hat die Psychologie die unmittelbare Erfahrung zu ihrem Gegenstande, so kann sie auch ihre eigentlichen Erklärungsprinzipien nur in dieser Erfahrung selbst finden. Sie hat daher […] Psychisches aus Psychischem, nicht Psychisches aus Physischem zu interpretieren“ (Wundt, 1911, S. 143).
Zwar wurde von Wundt anerkannt, das es kein Fühlen, kein Denken und kein Wollen gibt, das nicht von physischen Prozessen begleitet wäre, aber an ein Kausalverhältnis zwischen körperlichen und seelischen Vorgängen wollte er nicht glauben. Die Zurückführung des Psychischen auf Gehirnprozesse hielt er sogar für eine „leere Forderung“ (Wundt, 1919, S. 6), und zwar deshalb, weil Physisches und Psychisches ungleichartige Phänomene sind, Kausalprozesse aber nur zwischen Gleichartigem bestehen können. Von Dingen, die nichts miteinander gemein haben, kann keines die Ursache des anderen sein.
Insofern für beide Kausalitätsformen gilt, dass sie ein „in sich abgeschlossenes Gebiet“ (Wundt, 1911, S. 24) bilden, stellt sich die Frage nach ihrem Ver[>113]hältnis. Wundt (1919) postulierte einen psychophysischen Parallelismus, der „eine letzte nicht zu überschreitende Voraussetzung“ (S. 562) sowohl der Psychologie wie der Physiologie darstellt. Danach gibt es zwei untereinander verbundene, aber nicht ineinander greifende Kausalreihen, wobei Wundt allerdings nicht ausschloss, dass die physische Kausalität Psychisches verursachen kann. FN2"
Quelle: Herzog, Walter (2012) Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie. Wiesbaden: Springer.
[pdf hier: EigDat/E-Books/WisTheo/Herzog_WT_Psychologie.pdf]
Kausalkette in Lexikon der Psychologie (Spektrum)
"kausale Kette, Bezeichnung für mehrere zeitlich aufeinander folgende Ursachen, die in ihrer Kombination einen bestimmten Effekt hervorrufen. In der Attributionstheorie (Attribution) werden im allgemeinen einfache Ursachen-Effekt-Zusammenhänge untersucht. Im wirklichen Leben sind aber Ursachen häufig in komplexer Weise miteinander verbunden, wenn sie einen Effekt hervorrufen. Das gilt insbesondere im Fall von zeitlich aufeinanderfolgenden Ursachen, die einen zeitlich später auftretenden Effekt in Kombination herbeiführen. Wenn zwei kausale Ursachen aufeinanderfolgen, stellt sich die Frage, welche Ursache als wichtiger eingeschätzt wird. Ein alltägliches Beispiel ist ein Jugendlicher, der Ladendiebstähle begeht. Sein Verhalten kann dadurch erklärt werden, daß sein Vater frühzeitig die Familie verlassen hat {RS: wirklich?}. Außerdem kann als Erklärung herangezogen werden, daß seine Mutter zu einem späteren Zeitpunkt Alkoholikerin geworden ist {RS: wirklich?}. Auch in diesem Fall gibt es eine kausale Kette, die zusammengenommen das zu erklärende Ereignis verursacht hat. Das entspricht einem Vorrangeffekt unter kausalen Ursachen. In kausalen Ketten wird die erste Ursache von Beurteilern häufig als wichtiger wahrgenommen als die zweite. Dieser kausale Vorrangeffekt läßt sich nicht durch logische Überlegungen ableiten. Die Auswirkungen dieses Effekts auf die Praxis liegen auf der Hand. Wenn z.B. ein Gericht die Verursachung eines Verkehrsunfalls abwägt, bei dem zunächst Alkohol am Steuer von Fahrer A im Spiel ist und dann die Nichtbeachtung der Vorfahrt durch Fahrer B, sollte die Tendenz bestehen, daß die erste Ursache stärker als die zweite für die Frage der Unfallverursachung als relevant gesehen werden sollte. Daraus können sich Tendenzen in der Schuldzuschreibung ergeben, die nicht objektiv aufgrund größerer Verursachung zustande kommen, sondern durch Urteilstendenzen ausgelöst werden."
lokale Kausalität, Bezeichnung für die Beobachtung, daß sich in statischen Systemen dort, wo man einwirkt, in der Regel am ehesten etwas verändert (System).
Michotte & Thines zur Kausalitätswahrnehmung im Handbuch der Psychologie (1966)

Demonstrationen der phänomenalen Kausalität nach Albert Michotte
https://av.tib.eu/media/30316
Thomae: Motivbereich als Ursache für Verhalten
Hans Thomae (1966) Die Bedeutungen des Motivationsbegriffes. In (3-47) Thomae, Hans (1966, Hrsg.), Handbuch der Psychologie. 2. Band Allgemeine Psychologie, S.. 3:
"Unter dem Begriff der Motivation werden in diesem Band all jene einem Individuum oder einer Gruppe zugeschriebenen Vorgänge zusammengefaßt, welche deren Verhalten erklären bzw. verständlich machen. Diese äußerst vorläufige und einer Revision bedürftige Umschreibung unseres Gegenstandes verweist bereits auf den weiten Umkreis der hier einschlägigen Phänomene, die in der traditionellen „Bewußtseinspsychologie" unter Begriffen wie „Wille", „Wollen", „Streben", „Gefühl", „Affekt", „Interesse", „Bedürfnis", „Trieb" und vielen anderen Bezeichnungen wenigstens zum Teil zusammengefaßt wurden, während sie heute als Erklärungen für das "Warum" des Verhaltens gelten (vgl. S. 14)."
Und S. 17, aaO:
- "III. Der Umfang des Begriffs »Motivation«
- „Interindividuelle Unterschiedlichkeit und relative Situationsunabhängigkeit des Verhaltens; verschiedene Individuen verhalten sich in gleichen äußeren Situationen verschieden oder in verschiedenen Situationen gleich."
- „starker und langanhaltender Kräfteeinsatz, besonders wenn sich Hindernisse in den Weg stellen."
- „gerichteter und geordneter Phasenablauf der psychischen und motorischen Gesamttätigkeit, bis ein ,natürlicher' Abschluß erreicht ist."
- „Auffällige Abweichung der psychischen Funktionsleistungen vom Vorgegebenen, Üblichen, Zweckmäßigen, besonders kraß in sog. Fehlleistungen."
- „Binnenerleben von emotionaler bzw. dranghafter Natur."
So stellt der Begriff „Motivation" in der Gegenwart mehr und mehr einen Oberbegriff dar für alle jene Vorgänge bzw. Zustände, die in der Umgangssprache mit den Begriffen „Streben", „Wollen", „Begehren", „Wünschen", „Hoffen", „Sehnsucht",.„Affekt", „Trieb", „Sucht", „Drang", „Wille", „Interesse", „Gefühl" usf. umschrieben werden, darüber hinaus für alle jene bewußten und unbewußten psychischen Vorgänge, welche in irgend einer Hinsicht zur Erklärung oder zum Verständnis des Verhaltens werden könnten, wenn sie sprachlich fixierbar wären.
Man kann fast sagen, es sei unmöglich anzugeben, welche Vorgänge innerhalb des Organismus bzw. der Persönlichkeit nicht zur Motivation gehören. Keinesfalls zulässig ist jedenfalls die Einengung des Begriffs „Motivation" bzw. dessen des „Motivs" auf bewußte „Beweggründe", wie dies Lindworsky und neuerdings auch Lückert (1957) vorschlagen. Dieser weite Umkreis von Phänomenen, in deren Zusammenhang bzw- zu deren „Erklärung" der Motivationsbegriff unerläßlich zu sein scheint, wird durch Heckhausen in fünf Gruppen zusammengefaßt (1963, S. 4).
Selbst wenn man in Frage stellen kann, ob jede dieser Verhaltensdimensionen
mit dem Begriff „Motivation" erklärbar oder umschreibbar ist, so kann
sich Heckhausen doch für jeden der genannten Punkte auf Auto-[>18]
ren berufen, die in den betreffenden Zusammenhängen den Motivationsbegriff
verwenden. Man könnte sich angesichts dieses unübersehbaren Begriffsumfanges
damit zu helfen suchen, daß man alle „nicht-cognitiven" Vorgänge
den „Motivationen" zuschreibt. Doch ist selbst mit dieser von uns übernommenen
Begrenzung des Motivationsbegriffes eine bedenkliche Einengung vollzogen
worden. ..."
Einwaende gegen die Kausalinterpretation
Thomae (1966) S. 37-39.
Piaget über Realität und Kausalität in:
J. Piaget (1975). Die Entwicklung des Erkennens II. Das physikalische Denken. Gesammelte Werke. Studienausgabe Klett.
"KAPITEL VIII: Die Probleme des physikalischen Denkens: Realität und Kausalität 257
1. Die Entstehung der Kausalität in der Individualentwicklung 260
2. Die Stufen der Kausalität in der Geschichte des wissenschaftlichen Denkens und das Problem der kausalen Erklärung 272
3. Die Kausalität nach Auguste Comte und die positivistische Interpretation der Physik 283
4. Der Nominalismus von P. Duhem und der Konventionalismus von H. Poincaré" 290
5. Der Neopositivismus und die Kausalität nach Ph. Frank 297
6. Die Kausalität nach E. Meyerson 305
7. Die Kausalität nach L. Brunschvicg 312
8. Die physikalische Erkenntnistheorie von G. Bachelard 318
9. Die physikalische Theorie nach G. Juvet 322
10. Schlußfolgerung: Kausalität und physikalische Realität 328"
Trauma, psychische Krankheit und Kausalität von Wölk, W. (2001)
"Zusammenfassung: Die Frage, ob und wieweit ein Trauma für eine psychiatrische Erkrankung von ursächlicher Bedeutung ist, gehört zu den besonders schwierigen Themen in der forensischen Begutachtung. Verzerrte Darstellungen in den Medien und andere außermedizinische Einflüsse haben insbesondere zu einer Emotionalisierung der Thematik des sexuellen Mißbrauchs beigetragen. Auch in Fachkreisen ist es zu Polarisierungen gekommen. In dieser Arbeit wird die These vertreten (und begründet), daß Traumatisierungen nur bei den - als solchen definierten - reaktiven psychischen Erkrankungen als ein essentieller ätiologischer Faktor angesehen werden können. Zwar ist es grundsätzlich möglich, daß Traumatisierungen auch bei anderen psychischen Erkrankungen ein wesentlicher ätiologischer Faktor sein können. Hierzu liegen allerdings für diejenigen Fälle noch keine hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vor, in denen ein enger zeitlicher Zusammenhang von Trauma und Erkrankungsbeginn nicht besteht."
Woerterbuch der Psychotherapie
Stumm & Pritz (2000) , Hrsg.) verwiesen beim Eintrag "Kausalität" wird auf Zirkularität und Systemische Therapie.
Unter "Zirkularität", S. 794f, findet sich: "Zirkularität. Im Gegensatz zu linearen Vorstellungen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge ist zirkuläres Denken Versuch, das Verhalten der Elemente eines Systems als Regelkreis zu beschreiben, dadurch wird die Eingebundenheit dieses Verhaltens in einen Kreisprozeß von Interaktionen sichtbar. Durch den Ansatz des Mailänder Modells (M. Selvini-Palazzoli al., 1981) gewann in der > Systemischen Therapie die Informationserzeugung" während der Sitzung gegenüber der früher [>795] betonten > Schlußintervention (> Familientherapie, strategische; > Familientherapie, strukturelle) an Bedeutung. „Information gewinnen" heißt für das Mailänder Team v. a. „einen Unterschied feststellen". Informationen und Unterschiede werden durch eine speziell dafür entwickelte Fragetechnik gewonnen, nämlich die zirkuläre Befragung: Es handelt sich dabei um eine Interviewmethode, die es erlaubt, gleichzeitig Informationen zu gewinnen (Exploration) und beim Gesprächspartner zu erzeugen (Intervention). Der Grundsatz besteht darin, > Fragen zu stellen, die einen Unterschied ansprechen oder eine Beziehung definieren (Beispiel: „Was denken Sie [Mutter], worüber sich Ihr Mann am meisten Sorgen macht, wenn Ihre Tochter Petra abends um 10 Uhr noch nicht zu Hause ist?"). Dem Aspekt der Zirkularität liegt die Annahme zugrunde, daß lebende Systeme durch kreisförmige Anordnungen gekennzeichnet sind und nicht durch lineare Folgen und Ursachen. Psychotherapie wird als rekursiver Prozeß gesehen, in dem die Interaktionen aller Beteiligten (einschließlich der Therapeuten) rückbezüglich aufeinander wirken. Der Sinn zirkulärer Fragetechnik besteht in der Erzeugung von -» Neugier (Cecchin, 1988). Der Therapeut führt durch seine Fragen die Idee ein, daß ein Thema/Problem in irgendeiner Weise mit den Beziehungen der Personen, die sich mit dem Thema befassen, zu tun haben könnte. Unverbunden Erlebtes (z. B. Krankheit) kann so in einen sich verändernden raumzeitlichen Beziehungskontext gestellt werden. Dadurch verliert das Problem seinen quasi-objektiven Charakter und kann in unterschiedliche Sichtweisen zerlegt und relativiert werden. Ausgehend von der Annahme, daß in einem > Problemsystem jede Sichtweise mit der anderen verknüpft ist, wird auf kleine Veränderungen in Bereichen fokussiert, die vormals übersehen wurden. Durch die Betonung der wechselseitigen Bedingtheit des Verhaltens wird jedes Mitglied des Problemsystems als aktiv Handelnder und damit Verantwortlicher definiert. Lineare Perspektiven der einzelnen Familienmitglieder werden aufgegeben. Auf zirkuläre Fragen ist es fast unmöglich, nicht mit einer Beziehungsbeschreibung zu antworten. Eine andere, gemeinsame Wahrnehmungswelt taucht auf, und die Erkenntnis der eigenen Beteiligung an der Störung oder dem Dilemma nimmt zu.
Cecchin G (1988) Zum gegenwärtigen Stand von Hypothetisieren, Zirkularität und Neutralität: Eine Einladung zur Neugier. Familiendynamik 13(3): 191-203
Selvini-Palazzoli M, Boscolo L, Cecchin G, Prata G (1981) Hypothetisieren - Zirkularität -Neutralität. Drei Richtlinien für den Leiter einer Sitzung. Familiendynamik 6(4): 123-138
Sabine Klar, Gerda Klammer"
Kausalitaet bei William Stern
Sekundärquelle: Lehmann-Muriithi, Kolja (2013) Einige philosophische Grundlagen der Humanistischen Psychologie von Carl Rogers unter besonderer Berücksichtigung der Phänomenologie Edmund Husserls und des Kritischen Personalismus William Sterns. Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie am Fachbereich Psychologie der Universität Hamburg. S. 221:
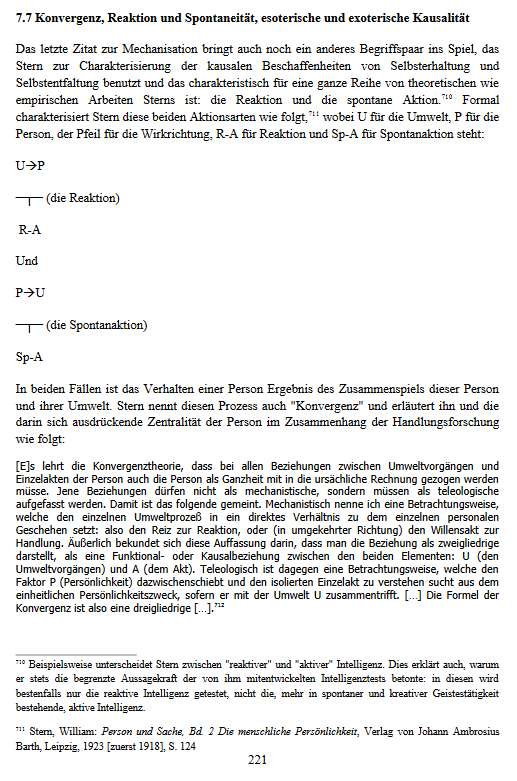
Kausalität in der Psychopathologie und Psychotherapie
Bastine : Klinische Psychologie, Band 1 (1998, 2. A) [Online]
5 ZUR ENTSTEHUNG VON PSYCHISCHEN STÖRUNGEN 36
5.1 KAUSALKONZEPTE PSYCHOLOGISCHER STÖRUNGSTHEORIEN 36
5.1.1. Kausalitätsmodelle 36
5.1.2. Der Entwicklungsprozess psychischer Störungen 37
5.2 DIE ÄTIOPATHOGENETISCHE FORSCHUNG 38
5.2.1. Experimentelle Forschungsansätze 38
5.2.2. ›Natürliche‹ Experimente 38
5.2.3. Epidemiologie 39
5.2.4. Klinische Querschnittsanalysen 40
5.2.5. Längsschnittsanalysen 40
5.2.6. Klinische Einzelfallmethodik 41
5.2.7. Abschließende Diskussion der Forschungsmethoden 41
5.3 PSYCHOLOGISCHE STÖRUNGSTHEORIEN 43
5.3.1. Psychoanalytische Störungstheorien 43
5.3.3.1. Die Störungstheorien von S. Freud 43
5.3.1.2. Die Entwicklungstheorien von Adler, Jung und der Neoanalyse
44
5.3.1.3. Psychoanalytische Ich-Psychologie und Selbst-Psychologie 45
5.3.1.4. Die Objektbeziehungstheorie 45
5.3.1.5. Bewertung der psychoanalytischen Störungstheorien und
ihre empirische Fundierung 45
5.3.2. Verhaltenstheoretische Störungstheorien 46
5.3.2.1. Die Störungstheorien von Pawlow und Watson 46
5.3.2.2. Die Störungstheorie von Wolpe 46
5.3.2.3. Die Störungstheorien von Eysenck 46
5.3.2.4. Die Störungstheorie von Skinner 47
5.3.2.5. Bewertung der klassischen verhaltenstheoretischen Störungskonzepte
47
5.3.2.6. Weiterentwicklungen 47
5.3.3. Kognitive Störungstheorien 47
5.3.3.1. Irrationale Überzeugungen: die rational-emotive
Störungstheorie 47
5.3.3.2. Gestörte Selbstkommunikation 48
5.3.3.3. Attributionen und Kontrollüberzeugungen: Depression und
andere Störungen 48
5.3.3.4. Kognitive Schemata 48
5.3.3.5. Kognitiv-emotionale Streß- und Bewältigungstheorien
49
5.3.3.6. Handlungstheoretische Störungstheorien: Problemlösen,
Plananalyse, mentale Kontrolle 50
5.3.3.7. Selbsttheoretische Störungstheorien 50
5.3.3.8. Zusammenfassende Diskussion 51
5.3.4. Emotionale Störungstheorien 52
5.3.4.1. Emotionspsychologische Grundlagen 52
5.3.4.2. Emotionspsychologische Perspektiven 52
5.3.4.3. Netzwerk-Theorien von emotionalen Störungen 53
5.3.4.4. Emotionsregulation und -bewältigung 54
5.3.4.5. Emotionsentwicklung und frühe Störungen 54
5.3.4.6. Abschließende Diskussion 54
5.3.5. Interpersonale Störungstheorien 54
5.3.5.1. Kommunikationsorientierte Störungstheorien 55
5.3.5.2. Familienorientierte und systemische Störungstheorien
55
5.3.5.3. Die klientenzentrierte Störungstheorie von Rogers
56
5.3.5.4. Bindungstheorie und Bindungsforschung 57
5.3.5.5. Abschließende Diskussion 58
5.3.6. Abschließende Diskussion der psychologischen Störungstheorien
58
5.4 ENTSTEHUNGSBEDINGUNGEN PSYCHISCHER STÖRUNGEN 59
5.4.1. Genetische Bedingungen 59
5.4.1.1. Begriffe der Genetik 59
5.4.1.2. Methoden und Probleme der verhaltensgenetischen Forschung
59
5.4.1.3. Ergebnisse der verhaltensgenetischen Forschung 59
5.4.2. Neurochemische und neuropsychologische Bedingungen 60
5.4.2.1. Neurochemische Bedingungen psychischer Störungen 60
5.4.2.2. Neuropsychologische Bedingungen 61
5.4.3. Kindliche Entwicklung und Entwicklungspsychopathologie 62
5.4.3.1. Psychische Störungen bei Kindern 62
5.4.3.2. Kontinuität und Diskontinuität kindlicher Verhaltensstörungen
bis ins Erwachsenenalter 63
5.4.3.3. Hospitalismus in der frühen Kindheit 64
5.4.3.4. Kindesmißhandlung 64
5.4.4. Klinische Familienforschung 65
5.4.4.1. Eltern-Kind-Interaktion und familiäre Kommunikationsmuster
65
5.4.4.2. Familiäre Einflüsse auf den Verlauf: Expressed-Emotion-Forschung
66
5.4.4.3. Psychische Störungen der Eltern 66
5.4.4.4. Elterliche Konflikte, Trennung oder Scheidung 66
5.4.4.5. Abschließende Bemerkungen 67
5.4.5. Adoleszenz und frühes Erwachsenenalter 67
5.4.5.1. Antisoziales Verhalten und Delinquenz in der Adoleszenz 67
5.4.5.2. Depression in der Adoleszenz 68
5.4.5.3. Mißbrauch und Abhängigkeit von Substanzmitteln
in der Adoleszenz 68
5.4.6. Belastungen und protektive Bedingungen im Erwachsenenalter
68
5.4.6.1. Kritische Lebensereignisse und Übergänge 69
5.4.6.2. Paarbeziehung 69
5.4.6.3. Soziale Unterstützung 69
5.4.6.4. Posttraumatische Belastungsstörung 70
5.4.6.5. Depression 70
5.4.7. Höheres Lebensalter 70
5.4.8. Geschlecht 71
5.4.9. Soziokulturelle, sozioökonomische und ökologische
Bedingungen 71
5.4.9.1. Arbeitsbedingungen, Berentung und Arbeitslosigkeit 71
5.4.9.2. Sozioökonomischer Status 72
5.4.9.3. Migration 73
5.4.9.4. Soziokulturelle und sozioökonomische Bedingungen 73
5.4.9.5. Ökologische Faktoren: die physikalische und situative
Umwelt des Menschen 74
5.4.10. Abschließende Diskussion
Problemanalyse in der Psychotherapie
Bartling, Gisela; Echelmeyer, Liz & Engberding, Margarita (2008) W. Problemanalyse im psychotherapeutischen Prozess: Leitfaden für die Praxis. Stuttgart: Kohlhammer
Hautzinger, Martin (2005) Verhaltens- und Problemanalyse. In (81–86.) Verhaltenstherapiemanual. Heidelberg: Springer.
Kanfer, F. H.; Reinecker, Hans & Schmelzer, Dieter (2013) Selbstmanagement-Therapie: Ein Lehrbuch für die klinische Praxis. Berlin: Springer.
Willensstoerungen in der Psychopathologie nach Fuchs (2017)
Fuchs, T. & Broschmann, D. (2017) Willensstörungen in der Psychopathologie. Nervenarzt 88, 1252–1258
"Fazit Der Überblick zur Phänomenologie und Psychopathologie des Willens hatte zunächst zum Ziel, die komplexe, aber zusammengehörige und einheitliche Dynamik des menschlichen Wollens in ihren hauptsächlichen Strukturmomenten zu beschreiben. Sie lässt sich als Widerstreit zwischen einer konativen vorwärtstreibenden und einer inhibitorischen, retardierenden Komponente auffassen, der sich nach dem Durchgang durch die Volition in der gewählten Handlung auflöst. Diese komplexe Dynamik ist anfällig für vielfältige Störungen, von denen Beeinträchtigungen der Konation der Inhibition und der Volition unterschieden wurden. Sie gehen wie dargestellt sowohl auf organische, psychotische als auch neurotische Störungen zurück, die den klinischen Phänomenen ihr unterschiedliches Gepräge geben.
Wollen zu können, also in Freiheit handeln zu können ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine komplexe Fähigkeit, die von der frühen Kindheit an bis ins Erwachsenenalter hinein erworben und geübt werden muss. Das Vermögen personaler Freiheit als eine komplexe Verknüpfung von Fähigkeiten zum Aufschub unmittelbarer Impulse, zur besonnenen Überlegung und zur Berücksichtigung einer übergeordneten, insbesondere intersubjektiven Perspektive ist zwar in den biologischen Strukturen des Gehirns angelegt, bedarf aber einer langen Ausreifung im Kontext geeigneter Sozialisationserfahrungen, die auch die entsprechende Ausbildung von Hemmungs- und Planungsfunktionen des präfrontalen Kortex ermöglichen. Diese Funktionen sind für den Menschen insbesondere erforderlich, um die primär dominierende Eigenperspektive zugunsten einer übergeordneten Perspektive zu relativieren und so auch zum moralisch verantwortlichen Akteur zu werden.
Als Fähigkeit der Selbstbestimmung, Selbstrealisierung, aber auch Selbstrelativierung stellt der Willen eine zentrale Grundlage für ein gelingendes Leben dar. Da Willensleistungen einen so großen Stellenwert für die Person einnehmen, fallen Fehlentwicklungen und Störungen der Willensfunktionen umso stärker ins Gewicht. Eine differenzielle Phänomenologie und Psychopathologie des Willens kann dazu beitragen, solche Beeinträchtigungen in der psychiatrischen Praxis zu identifizieren und mit dem Patienten an einer Stärkung seiner Willensfunktionen zu arbeiten."
Zusammenfassung
Zu Beginn der modernen Psychopathologie war der Begriff des Willens
noch von hoher Bedeutung. Die Arbeiten von Eugen Bleuler, Emil Kraepelin
oder Karl Jaspers belegen eine intensive Auseinandersetzung mit Willensstörungen
wie der Abulie, der Impulskontrollstörung oder der Ambivalenz. Grund
für eine Zäsur scheint rückblickend vor allem ein Paradigmenwechsel
in der Psychologie gewesen zu sein, der eine Aufgabe des Willensbegriffs
zur Folge hatte. Aufgrund des zunehmenden Interesses an Fragen der Handlungsurheberschaft
und Willensfreiheit könnte seine Reaktivierung heute jedoch eine wichtige
Lücke für die psychopathologische Forschung ebenso wie die klinisch-therapeutische
Praxis schließen. Methodisch lässt sich eine Psychopathologie
der Willensstörungen auf eine differenziell-typologische Phänomenologie
gründen. Dazu wird im Beitrag zunächst eine Einteilung anhand
der Strukturmomente von Konation, Suspension und Volition vorgeschlagen,
sodann eine temporale Einteilung anhand der prädezisionalen, dezisionalen
und postdezisionalen Phase. Ziel der Arbeit ist es, die psychopathologische
Identifizierung unterschiedlicher Willensstörungen zu erleichtern
und damit auch eine Psychotherapie des Willens zu befördern, die sowohl
für die kognitiv-verhaltenstherapeutische als auch für psychodynamische
Ansätze anschlussfähig ist.
Schlüsselwörter Phänomenologie · Abulie ·
Ambivalenz · Impulskontrollstörung · Psychotherapie
des Willens"
Hartmann, F., Kausalität als Leitbegriff ärztlichen Denkens und Handelns, in: Neue Hefte für Philosophie, 32/33 (Themenheft "Kausalität"), Göttingen 1992, S. 50-81.
[In Arbeit]
Heckhausen, Heinz (1983) Entwicklungsschritte in der Kausalattribution von Handlungsergebnissen. In (49-85) Görlitz (1983, Hrsg.), S. 50f:
"1. Ursachenzuschreibung bei Ereignisabläufen in der Umwelt
Aufgrund welcher Prinzipien junge Kinder den Ursachencharakter von
Umweltereignissen erschließen, ist schon mehrfach untersucht worden.
Zum Beispiel verraten die von PIAGET (1930; 1954) beschriebenen präkausalen
Erklärungen in der präoperationalen Phase schon das grundlegende
Kovariationsprinzip
(KELLEY, 1967): Ein Ereignis wird als Effekt jenes anderen Ereignisses
angesehen, mit dem es am engsten kovariiert. Welches der kovariierenden
Ereignisse als Ursache betrachtet wird, ist über die Kovariation hinaus
von weiteren, später hinzutretenden Schlußfolgerungsprinzipien
abhängig, wie der zeitlichen Abfolge, der zeitlichen Kontiguität
(teilweise zeitlicher Überlappung), der räumlichen Kontiguität
(räumlicher Nähe) und der Ähnlichkeit.
SHULTZ und MENDELSON (1975) haben nachgewiesen,
daß einfache Kovariation schon von Dreijährigen angewandt wird,
wenn ein einfacher mechanischer Effekt auf eine Ursache zurückgeführt
werden muß. Dagegen ist in diesem Alter das Schlußfolgerungsprinzip
der zeitlichen Aufeinanderfolge von Ursache und Wirkung noch nicht voll
entwickelt. Die Dreijährigen neigen noch dazu, auch nachfolgende Ereignisse
als Ursache heranzuziehen. Die Vernachlässigung der zeitlichen Abfolge
- wahrscheinlich nur ein "recency"-Effekt
- steht im Einklang mit der PIAGET-Literatur zum Kausaldenken (LAURENDEAU
u. PINARD, 1962; PIAGET, 1930). KUN (1978) zeigte hingegen bei geringeren
Anforderungen an Sprach- und Gedächtnisleistungen der jungen Kinder,
daß Dreijährige durchaus verstehen, daß Ursachen ihren
Wirkungen vorausgehen.
Treten Kovariation und zeitliche Kontiguität
miteinander in Konflikt (MENDELSON u. SHULTZ, 1976), so führten vier-
bis sechsjährige Kinder den Effekt auf ein kovariierendes, aber nicht
unmittelbar vorausgehendes Ereignis zurück, sofern es einen leicht
einsehbaren physikalischen Grund für die Zeitverzögerung gab.
War ein solcher Grund nicht zu erkennen, wurde ein zeitlich unmittelbar
angrenzendes, aber nicht kovariierendes Ereignis als Ursache herangezogen
(vgl. auch SIEGLER u. LIEBERT, 1974). Zeitliche Kontiguität ist zunächst
eher ausschlaggebend als Kovariation. Ähnlichkeit ist vermutlich nur
ein Ersatz-Prinzip, um Ursachen auch dann zu erkennen, wenn Informationen
zur raum-zeitlichen Beziehung von Ursache und Wirkung nicht vorhanden sind
(SHULTZ u. RAVINSKY , 1977). Allgemein läßt sich feststellen,
daß das Bemerken von hemmenden Ursachen bis zum Alter von 7 Jahren
größere Schwierigkeiten bereitet als die Feststellung fördernder
Ursachen (SHULTZ u. MENDELSON, 1975).
Die berichteten Befunde bezeugen, daß schon
3- und 4jährige Kinder über alle wesentlichen Schlußfolgerungsprinzipien
der Ursachenzuschreibung verfügen, die auch der Kausalitätswahrnehmung
von Erwachsenen zugrunde liegen (DUNCKER, 1935; MICHOTTE, 1946). Zwei Dinge
sollten jedoch bei diesen Ergebnissen beachtet werden. Einmal stellen die
verwendeten Aufgaben Anforderungen an das Aufgaben- und Sprachverständnis
des jungen Kindes, die es als nicht abwegig erscheinen lassen, daß
noch jüngere Kinder die Schlußfolgerungsprinzipien phänomenaler
Kausalität erkennen ließen, wenn es gelänge, Aufgaben zu
finden, die noch geringere Anforderungen an den kognitiven Entwicklungsstand
stellen. Zum anderen beschränken sich die Befunde auf die passive
Betrachtung von Ereignissen in der Umwelt. Eine andere Sache ist es, wenn
das Kind selbst aktiv ist und durch sein Tätigsein Umweltereignisse
hervorruft. Der Frage, wann und wie hierbei ein Erleben von Verursachung
zu beobachten ist, wollen wir uns jetzt zuwenden."
Herkner Attribution - Psychologie der Kausalitaet
Herkner, Werner (1980, Hrsg.) Attribution. Psychologie der Kausalität. Bern: Huber. [IV] S. 16:
"2 Theorien über die Entstehung von Attributionen
2.1 Die Theorie von KELLEY
2.1.1 Das Kovariationsprinzip
Die umfassendste und allgemeinste aller bisherigen Attributionstheorien hat KELLEY (1967) formuliert. Der Objektbereich der Theorie ist außerordentlich groß: Sie läßt sich nicht nur auf Personenwahrnehmung und Selbstwahrnehmung anwenden, sondern auch auf Verhaltenskonsequenzen (wie Erfolg und Mißerfolg) und andere Ereignisse. Diese Theorie hat zahlreiche empirische Untersuchungen und theoretische Überlegungen angeregt.
Im Zentrum von KELLEYS Theorie steht das Kovariationsprinzip, das besagt, daß ein «naiver» Beobachter - ähnlich wie ein Wissenschaftler - ein Ereignis auf diejenige seiner möglichen Ursachen zurückführt, mit der es (über die Zeit) kovariiert. «Der Effekt wird derjenigen Bedingung zugeschrieben, die vorhanden ist, wenn der Effekt vorhanden ist, und die abwesend ist, wenn der Effekt abwesend ist» (KELLEY, 1967, S. 194). Der Beobachter stellt Kovariationen bzw. Korrelationen fest, und interpretiert diese als Kausalbeziehungen.
Um solche Kovariationen feststellen zu können, benötigt der Beobachter Informationen über das Ereignis, dessen Ursache ermittelt wer-[>17]den soll, vor allem Informationen darüber, unter welchen Bedingungen das Ereignis auftritt, und wann es nicht auftritt. Dabei sind drei Klassen von Informationen besonders wichtig: Information über Personen, Objekte (Stimuli) und Zeit."
Kausalitaet entwicklungspsychologischer Vorgänge
Die Begriffe Prägung; Instinktverhalten; Entwicklung; Reifung; Gewohnheit; Reflex; bedinkter Reflex; Konditionierung; Lernen; Erziehung; Sozialisation; spontan oder frei motiviertes Verhalten; zufällig, unabsichtlichem Verhalten und manipuliertes oder erzwungenes Verhalten sind von einander abzugrenzen.
Kausalitaetsbegriff und Forschungsergebnisse der Entwicklungspsychologie
Quellen: Siegler et al. (2016), Sachregistereinträge:
- Kausalbeziehung 27, 144, 244
–– Lernen 144
Kausalerklärung 241
kausales Denken 256, 257, 268
–– Kindergartenalter 257
–– Kleinkinder 256
–– und Problemlösen 257
kausales Schlussfolgern 256
–– und Handlungssequenz 256
kausales Verstehen 244
Kausalität 32, 241, 255, 267
–– Grundverständnis 267
–– Kitt des Universums 255
–– Verstehen 254, 255
Kausalmodul 255
- Die Kausalitaet bei wichtigen entwicklungspsychologischen Begriffen
- Zeier, Hans (1976). Wörterbuch der Lerntheorien und der Verhaltenstherapie. München: Kindler (Geist & Psyche).
Praegung > Prägung
als Kausalfaktor in der biologischen Verhaltensforschung.
Quellen: Flammers (2010), Sachregistereinträge:
39, 82, 235-236, 287.228 * Siegler et al. (2016), Sachregistereinträge:
332, 333, 347, 649.
Instinkthandlung > Instinktverhalten
in der biologischen Verhaltensforschung.
Instinkthandlungen in der ethologischen Verhaltensforschung (Lorenz)
angeboren für bestimmte Schlüsselreize. Hehlmann (1965) in seinem
Wörterbuch
der Psychologie: "Instinkt (lat.), „Anreiz“, „Antrieb“; rein ererbtes,
zweckmäßiges Handeln, das nicht erlernt zu werden braucht: Orientierungs-,
Such-, Nist-, Paarungs-, Brut-, Nahrungs-I. u. v. a. Der I.-Begriff ist
umstritten; vielerorts wird er überhaupt abgelehnt. ..."
Gewohnheit
Gewohnheiten können in vielfältiger Weise nützlich und
hilfreich (Alltagsroutinen), aber auch problematisch und schädlich
(Sucht, Zwang) sein. Eingeschliffene Verhaltensweiseb erleichtern die Bewältigung
von vielen Aufgaben, sie sind sozusagen energiesparend. Bei Vorurteilen
und Störungen kann sich das aber übel auswirken. Gewohnheiten
erschweren durch ihren innewohnenden Automatismus die Selbst-Kontrolle.
Gewohnheiten kann man als gesetzesartige Regelhaftigkeit ansehen mit einem
mächtigen Kausalfaktor, der oft nicht einfach veränderbar ist.
Quellen und Querverweise:
Eysenck, Hans Jürgen (1956) Gewohnheiten und bedingte
Reaktionen. In (121-130) Wege und Abwege der Psychologie. Hamburg: rde.
Themen: Bettnässen als psychiatrischen Problem (121ff); Ausmerzen
übler Gewohnheiten durch Substitution und Suggestion (125ff); Der
posthypnotische Auftrag (127f); Die Wiederholungsmethode (129f).
Eysenck, Hans Jürgen (orig 1957, dt. 1978) Persönlichkeit
und Konditionierung. In (247-284) Erkenntnisgrenzen der Psychologie. Vom
Sinn und Unsinn psychologischer Praktiken. München: Goldmann.
Bechterew
Pawlow
Podkopaew, N. A. (1926) Die Methodik der Erforschung der bedingten
Reflexe
Skinner
Mohr, Fritz (1953) Über die therapeutische Verwendung bedingter
Reflexe. In () Neunundfünfzigster Kongress (1953)
Quellen und Querverweise:
Eysenck, Hans Jürgen (orig 1957, dt. 1978) Persönlichkeit
und Konditionierung. In (247-284) Erkenntnisgrenzen der Psychologie. Vom
Sinn und Unsinn psychologischer Praktiken. München: Goldmann.
Lernen
Für die Psychologie ist Lernen ein zentraler und sehr wichtiger
Begriff (Zeier 1976). Aber Lernen ist auch ein vieldeutiger Begriff, den
man daher in wissenschaftlichen Zusammenhängen näher bestimmen
sollte. Die allgemeine Kennzeichnung bei Zeier (1976)
Zeier (1976) "Lernen (learning)
- Im Alltagsgebrauch versteht man unter Lernen vorwiegend den Erwerb
und die Änderung von kognitiven Strukturen wie die Anhäufung
von schulischem Wissen. Lernen sollte aber nicht mit —> Gedächtnis
verwechselt werden.
Die —> Lernpsychologie bezeichnet Lernen als den Erwerb von relativ andauernden Verhaltensänderungen bzw. Änderungen der Verhaltensmöglichkeiten aufgrund von Erfahrung. Sie versucht die Bedingungen zu analysieren, unter denen dieser Prozeß stattfindet. Kurzfristige Änderungen wie —> Adaptation, —» Gewöhnung, Ermüdung oder Drogeneinflüsse sowie auf bestimmte strukturelle Veränderungen des Nervensystems (z. B. Reifung, Altern, Verletzung, Krankheiten) zurückgehende Verhaltensänderungen werden dagegen ausgeschlossen. Lernen kann nicht direkt beobachtet werden, sondern nur die während des Lernvorgangs oder bei der späteren Anwendung gezeigte —> Leistung."
Quellen und Querverweise:
Spontan oder frei motiviertes Verhalten
Links (Auswahl: beachte)
Glossar, Anmerkungen und Endnoten: > Eigener wissenschaftlicher Standort.
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Abschwaechungsprinzip
Erkenntnis aus der Kausalattributionsforschung. Kommen mehrere Ursachen in Frage, so wird der Favorit, die "Hauptursache" oder die plausibelste gesucht, was dazu führt, dass die anderen in ihrer Wirksamkeitsbedeutung schwächer bewertet werden. Die Reihenfolgen können wechseln, wenn neue Informationen bekannt werden. Lit: Herkner (1983), S. 23.
__
Erkenntnisse [Quelle]
- 1984 Dis
...
- In meinem Dissertationsfazit
(methodologischen) habe ich aufgrund der Erfahrungen mit meinen umfangreichen
Partialisierungsanalysen, aus denen praktisch die Beliebigkeit von Korrelationskoeffizienten
hervorging, neben der Bedeutung der Partialisierungstechnik die Idee des
relevanten
Merkmalsraumes entwickelt. Ein solcher kann nur mit Hilfe von Theorie
auf der Basis von Erfahrungswissen erstellt werden.
- Die Ergebnisse der erfolgreichen 11jährigen Fehlersuche nach den
Ursachen des entgleisten partiellen Korrelationskoeffizienten (1.388) wurden
neben zahlreichen anderen Problemen (Relationentreue)
im Zusammenhang in dem Werk Numerisch
instabile Matrizen und Kollinearität in der Psychologie umfangreich
dokumentiert. Über 1000 Korrelationsmatrizen von 1910 bis aktuell
wurden analysiert und dokumentiert. In einer Stichprobe von 769
untersuchten Matrizen wurden 17.9% indefinite, die also ihre semipositive
Definitheit verloren hatten, gefunden. Außerdem wurde die grundlegende
Bedeutung einer Fast-Kollenarität als Gesetz- oder Regelhaftigkeit
erkannt und positiv interpretiert (Punkt 5: Abstract
(1994) Numerisch instabile Matrizen und Kollinearität in der Psychologie).
- In der Psychologie, Psychodiagnostik, Psychotherapie und besonders
auch in der forensischen Psychologie spielt das Thema Kausalität eine
große Rolle. Ich habe daher im Handbuch
für die allgemeine und integrative Psychotherapie ein Grundkonzept
für den praktischen Gebrauch, z.B. für die Psychotherapie der
Schuldgefühle
entwickelt. > Graph Ursache und Wirkung.
- Im Zuge der Aufarbeitung der Ergebnisse von 1994 schälte sich
immer mehr heraus, wie sinnvoll und nützlich Fast-Kollinearitätsanalysen
sind. Sie bedeuten, wenn sie nicht artefiziellen oder fehlerhaften Ursprungs
sind, die Entdeckung von Gesetz- oder Regelhaftigkeiten, also genau
das, was sich WissenschaftlerInnen so sehr wünschen. Durch die unheilvolle
und unkritische Anwendung der Faktorenanalyse ist dieser wichtige Gesichtspunkt
völlig untergegangen.
- Aus der Auseinandersetzung mit dem 3bändigen Werk von Hummell
& Ziegler und seinem zentralen Thema Korrelation und Kausalität
wurde nun die Idee der Eigenwert- und Fast-Kollinearitätsanalyse erfolgreich
auf das Thema angewandt. Ein langer Weg von 30 Jahren hartnäckiger
- numerisch-mathematischer, empirisch-praktischer - Korrelationsforschung
erweist sich zunehmend als außerordentlich ergiebig. Mit Korrelationsmatrizen
ist viel mehr möglich als die signifikanzstatistische Fixierung sieht.
Kontingenz - kontingent
Zusammenhang. In der Lerntheorie meist der Zusammehang zwischen Reiz und Reaktion. Ein Kontingenzschema der verschiedenen Reiz- und Reaktionsvarianten finden Sie bei Wikipedia [Abruf 16.05.18]
__
Kovariation, kovariieren,
"«Der Effekt wird derjenigen Bedingung zugeschrieben, die vorhanden ist, wenn der Effekt vorhanden ist, und die abwesend ist, wenn der Effekt abwesend ist» (KELLEY, 1967, S. 194). Der Beobachter stellt Kovariationen bzw. Korrelationen fest, und interpretiert diese als Kausalbeziehungen.". Herkner (1983), S. 16.
__
recency-Effekt
"Der recency-effect besagt, das die jüngsten Informationen in einer Reihe von Informationen am besten erinnert werden, und steht dem primacy-effect gegenüber. Oft hängt es von der Situation ab, welcher der beiden Effekte stärker ausgeprägt ist. Bei der Reproduktion längerer Ketten von Information werden jedoch generell eher die zuerst und die zuletzt gelernten Begriffe erinnert. Der Recency-Effekt wird wird bei Experimenten auch dadurch begründet, dass die zuletzt dargebotenen Begriffe noch frisch im Gedächtnis gespeichert sind, denn der Effekt geht verloren, wenn kurz nach der Rezeption keine Reproduktion erfolgt sondern beispielsweise eine Pause eingeschoben wird. Im Vergleich zwischen visueller und auditiver Begriffsdarbietung kann beobachtet werden, dass visuell dargebotene Informationen einen höheren Primacy-, auditiv dargebotene Informationen einen höheren Recency-Effekt aufweisen, wobei dieses sinnesabhängige Phänomen als umgekehrter Modalitätseffekt (modality effect) bezeichnet wird."
Quelle: http://lexikon.stangl.eu/4884/recency-effect/#LiBZ9LHcDWb9SkpW.99"
__
Standort: Materialien Kausalität im Psychosozialen.
*
- Definieren und Definition. * ist * Nicht * Alle&Jeder * Paradoxien * Was ist Fragen * Welten *
- Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben.
- Definitionen, Nominal- und Realdefinitionen (Abschnitt aus der Testtheorie).
- Definition aus Eisler Wörterbuch der philosophischen Begriffe (1927-1930).
- Einführung in die Definitionsproblematik am Beispiel Trauma.
- Zum Universalienstreit am Beispiel der Schneeflocke.
- Gleichheit und gleichen im alltäglichen Leben und in der Wissenschaft. Näherungen, Ideen, Ansätze, Modelle und Hypothesen.
- Aufbau einer Wissenschaftssprache in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie.
- Allgemeine Theorie und Praxis des Vergleichens und der Vergleichbarkeit. Grundlagen einer psychologischen Meßtheorie.
- Überblick Wissenschaft in der GIPT.
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Definition definieren site: www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Materialien zur Kausalität im Psychischen, Psychopathologischen und Psychosozialen zum Hauptartikel Kausal und Kausalität, Ursache und Wirkung, Grund und Folge - allgemein und besonders im Psychischen und im Recht. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/gb/Kausal/KausPSY.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen
korrigiert irs 07.05.2018 und 08.05.2018
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
16.10.23 Lewin (1926) Über die Ursachen seelischen Geschehens
16.05.18 Instinkthandlung. * Lernen *
08.05.16 Durchgesehen (kann so erstmals ins Netz und wird weiter ausgearbeitet)
00.09.16 angelegt im September 2016. Seither Material gesammelt und sporadisch daran gearbeitet, intensiver dann im Oktober und November 2017.
Mat aus Zeier
Lernen durch Einsicht (insight-learning)
Einsichtiges Lernen. Verhaltensänderung, die durch spontanes Erfassen der Aufgabenstruktur zustande kommt, ohne daß Reaktionsmöglichkeiten erprobt werden müssen. Gilt als Gegenstück zum —> Lernen durch Versuch und Irrtum. Die typische Form des Lernens durch Einsicht ist das Problemlosen, wenn das Prinzip der Lösung erkannt und auf die Aufgabenstellung übertragen werden kann.
Lernen durch Versuch und Irrtum (trial and error learning)
Lernen am Erfolg, Probierverhalten, Versuch-Irrtums-Lernen. Bezeichnung
für die Tatsache, daß Lebewesen in Situationen, für die
keine angeborene oder erlernte Verhaltensweisen bereitstehen, zunächst
ein vielfältiges, anscheinend ungerichtetes und zufälliges Verhalten
zeigen, aus dem sich allmählich das zum Erfolg führende herausbildet
(-> Effektgesetz, -> Konditionierung, operante. Da in diesem Fall sowohl
am Erfolg als auch am Mißerfolg gelernt wird und der wesentliche
Aspekt das Erfassen der Verhaltenskonsequenzen ist, sollte diese Form des
Lernens eigentlich Lernen durch Versuch und Rückmeldung (—> Feedback)
heißen.