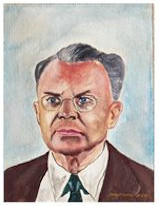(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=31.01.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 01.02.23
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Erleben, Erlebnis und Elementar-Erlebnis bei Rudolf Carnap_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Erleben, Erlebnis und Elementar-Erlebnis
bei Rudolf Carnap
Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen
Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Zusammenfassung Hauptseite *
Zusammenfassung Carnap Der logische Aufbau der Welt
Carnap, Rudolf (1928) Der logische Aufbau der Welt. Berlin: Springer.
[Online]
- 1. Ziel des Werkes.
2. Sprachen in Der logische Aufbau der Welt.
3. Annahmen und unbegründete Behauptungen zu Erlebnissen.
4. Fehlende Definitionen und Beispiele.
5. Unbegründete grundlegende wissenschaftstheoretische Behauptungen.
6. Fundstellen.
7. Fazit.
1. Ziel des Werkes
Der logische Aufbau der Welt war Carnaps Habilitationsschrift 1926. Geier (1992), S.34 berichtet:
- "Als er 1926 wieder nach Wien reist, haben die Mitglieder des Schlick-
Zirkels das Manuskript der ersten Fassung des Logischen Aufbaus
gelesen und beginnen, es gemeinsam mit Carnap sorgfältig zu diskutieren.
Hier ist ein Baugenie zu ihnen gekommen, das gekonnt über die Mittel
der «Principia Mathematica» verfügt und durch seine analytischen
Fähigkeiten ihren Wunsch nach einer Verankerung der Erkenntnis im
Erfahrungsgegebenen mit rein logischen Verfahren zu erfüllen verspricht.
Die Professoren Schlick und Hahn verschaffen Carnap eine Privatdozentur.
Von 1926 bis 1931 lebt und arbeitet er in Wien und verbringt hier die
anregendste, erfreulichste und fruchtbarste Zeit meines Lebens12. Er
ist der führende Kopf und das Arbeitstier des Wiener Kreises, in dem
er all das zur Geltung bringen kann, worauf er intendiert: strenge Wissenschaftlichkeit,
logische Präzision und kooperative Zusammenarbeit. Charakteristisch
für den Zirkel war die offene und undogmatische Diskussionshaltung.
Jeder war bereit, seine Ansichten einer wiederholten Prüfung durch
andere oder durch sich selbst auszusetzen. Der gemeinsame Geist bestand
in Kooperation, nicht in Konkurrenz. Es war die gemeinsame Absicht, zusammenzuarbeiten
im Kampf um Klarheit und Einsicht.13"
Der logische Aufbau der Welt will ein ableitbares Begriffssystem (Begriffs-Stammbaum) einrichten ("konstituieren"). Die elementare Grundrelation und der erste Grundbegriff ist die Ähnlichkeitserinnerung (§ 78, S.110) zwischen Elementarerlebnissen, aus dem alle anderen Begriffe abgeleitet werden bzw. abgeleitet werden können sollen. Damit wird das Elementarerlebnis zu einem weiteren Grundbegriff, auch wenn es Carnap nicht so darstellt. Im Vorwort zur 3. Auflage 1961 führt er hierzu Seite XII aus:
- "Das in dem Buch aufgestellte. System nimmt als Grundelemente die Elementarerlebnisse
(§ 67). Nur ein einziger Grundbegriff wird verwendet, nämlich
eine bestimmte Relation zwischen Elementarerlebnissen („Ahnlichkeitserinnerung",
§ 78). Es wird dann gezeigt, daß die weiteren Begriffe, z. B.
die verschiedenen Sinne, der Gesichtssinn, die Sehfeldstellen und ihre
räumlichen Beziehungen, die Farben und ihre Ahnlichkeitsbeziehungen,
auf dieser Basis definiert werden können. Daß die Beschränkung
auf einen einzigen Grundbegriff möglich ist, ist gewiß interessant.
Aber heute erscheint mir ein solches Verfahren doch als zu künstlich.
Ich würde vorziehen, eine etwas größere Anzahl von Grundbegriffen
zu verwenden, zumal hierdurch auch gewisse in meiner früheren Konstruktion
der Sinnesqualitäten auftretende Mängel (vgl. die Beispiele in
§ 70 und 72) vermieden werden können. Ich würde heute in
Erwägung ziehen, als Grundelemente nicht Elementarerlebnisse zu nehmen
(trotz der Gründe, die im Hinblick auf die Gestaltpsychologie für
diese Wahl sprechen, siehe § 67), sondern etwas den Machschen Elementen
Ahnliches, etwa konkrete Sinnesdaten, wie z. B. „rot einer gewissen Art
an einer gewissen Sehfeldstelle zu einer gewissen Zeit". Als Grundbegriffe
würde ich dann einige Beziehungen zwischen solchen Elementen wählen,
etwa die Zeitbeziehung „x ist früher als y", die Beziehung der räumlichen
Nachbarschaft im Sehfeld und in anderen Sinnesfeldern, und die Beziehung
der qualitativen Ahnlichkeit, z. B. Farbähnlichkeit."
2. Sprachen in Der logische Aufbau der Welt
Das Buch verwendet drei Sprachen, der Ausdruck "Metasprache" kommt nicht vor:
- die übliche, nicht näher erläuterte gewöhnliche Sprache mit den üblichen Satz- und Anführungszeichen in der das Buch ganz überwiegend auch geschrieben ist.
-
eingeklammerter Ausdruck mit Anführungszeichen pSachverhaltssprache
Psychologiep (§ 75, S.106f). Bei Carnap ist das hochgestellte
Schlusszeichen auch noch auf den Kopf gestellt und gespiegelt.
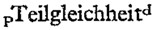
-
eingeklammerter Ausdruck mit Anführungszeichen Kappa kAusdruck
der Konstitiuierungsprachek (§
75, S.106f). Bei Carnap ist das hochgestellte Schlusszeichen auch noch
auf den Kopf gestellt und gespiegelt.

3. Annahmen und unbegründete Behauptungen zu
Erlebnissen
Carnaps Werke enthält einige Annahmen, die nicht klar als solche
ausgewiesen werden und teilweise wie Dogmen wirken. Um einen Allsatz zu
widerlegen genügt übrigens ein einziges Gegenbeispiel.
3.1 Elementarerlebnisse sind unzerlegbare Einheiten.
Diese Behauptung ist mehrfach zu hinterfragen:
3.1.1 "68. Die CA93EE2Elementarerlebnisse
sind unzerlegbare Einheiten."
Das ist zunächst einmal eine - dogmatisch anmutende - Behauptung
(von den PhänomenlogInnen und GestaltpsychologInnen nachhaltig vertreten),
die eines Beweises bedarf oder als Annahme oder Axiom ordentlich eingeführt
und begründet werden müsste. Zuvor müsste zerlegbar
aber definiert, erklärt und erläutert werden, was Carnap nicht
leistet.
3.1.1.1 Blau-Gelb: Beweis der visuellen
Zerlegbarkeit eines Elementarerlebnisses, indem man folgendes Bild "Blaugelb"
betrachte:
 |
Ich nehme das Elementar-Erlebnis wahr, das ich hier zum Zwecke der Kommunikation Blau-Gelb nenne, wobei man auch Oben- und Unten-Ding sagen könnte. Zum Kom- munizieren einer Wahrnehmung braucht man notwendigerweise eine Sprache. Ob- wohl es ein Wahrnehmungs- Erlebnis ist, sehe ich doch sofort zwei Teile, die ich zum Zwecke der Kommunikation hier blau und gelb nenne. Ich sehe blau-gelb, blau und gelb, einmal das Ganze und zugleich die beiden Teile. Die Präsentation ist be- reits bei der Präsentation, im Augenblick oder Moment der Wahrnehmung, zerlegt. Anmerkung: Die Benennung dieser Blau-Gelb Wahrnehmung als Ukraineflagge ist nicht wahrnehmen, sondern erkennen, also begrifflich verarbeitete Wahrnehmung._ |
3.1.1.2 Rechtecke-1-9: Beweis der visuellen
Zerlegheit der Rechtecke 1-9
 |
Der Beweis besteht darin, die Rechtecke 1-9 zu betrachten und zu sagen, welche Rechtecke im ganzen Wahrnehmungserlebnis als zerlegt wahr- genommen werden. Das ist bei mir am 01.02.2023, 10:00 Uhr bei allen der Fall: Bei Rechteck 5 kann ich aber nur sagen, dass ich mehrere ineineinanderschachtelte Rechtecke wahrnehme (zählt man, sind es 8), wobei drei Wahrnehmungsvarianten flach, erhaben (aufgetürmt, Draufsicht), vertieft (Tunnel) möglich sind. Was ist nun das Ganze bei Rechteck 1? Das Ganze besteht aus drei Teilen: 1. den Rahmen, 2. den linken Teil und 3. den rechten Teil, wobei man links und rechts auch vertauschen kann. Wahrnehmungstatsache ist, dass ich auf Anhieb das Ganze zerlegt in zwei Teilen wahrnehme. Auch wenn man nur streng die Wahrnehmung betrachtet und von den Zahlen absieht, liegt zerlegte Wahrnehmung vor, wobei zerlegbar in der Kommunikation eine Sprache für die Teile voraussetzt, wenn wahrnehmen mitgeteilt werden soll._ |
3.1.1.3 Stimmengewirr (mehrere reden
gleichzeitig): Beweis einer auditiven Zerlegbarkeit.
 |
Ich habe heute morgen, 30.01.2023, 10:45-11:45 bein Kiesertrainung aus einem Elementar-Erlebnis Stimmengewirr zwei Mitarbeiterstimmen, die mir vertraut sind, herausgehört. Damit sollte das Elementarerlebnis dreifach zerlegt worden sein: (1) Stimmengewirr, (2) Stimme MitarbeiterIn eins, (3) Stimme MitarbeiterIn zwei. (Bildquelle) |
4. Fehlende Definitionen und Beispiele
Carnap hätte definieren, erklären oder charakterisieren müssen,
was er unter Elementarerlebnis versteht und was ein Elementarerlebnis von
einem Erlebnis unterscheidet. Obwohl Carnap sonst viele Beispiele bringt,
geizt er gerade hier damit, wo es besonders nötig und hilfreich gewesen
wäre.
- RS-CA93EE2: Wie werden EE unterschieden und benannt? Das Sachregister
verweist bezüglich der Definition der Elementarerlebenisse auf §
67. Dort wird ausgeführt:
- "Da wir jedoch von unserem Konstitutionssystem
auch die Berücksichtigung der erkenntnismäßigen
Ordnung der Gegenstände verlangen wollten (§ 54), so müssen wir von
dem ausgehen, was zu allem anderen erkenntnismäßig primär ist, vom
„Gegebenen", und das sind die CA92E1Erlebnisse selbst in ihrerTotalität
und geschlossenen Einheit. Jene Bestandteile bis zu den letzten
Elementen hinunter sind aus diesen CA92E2Erlebnissen durch Inbeziehungsetzung
und Vergleichung, also durch Abstraktion gewonnen. Diese
Abstraktion wird, wenigstens in den einfacheren Schritten, schon im
vorwissenschaftlichen Denken oder in intuitivem Verfahren vorgenommen,
so daß wir gewohnt sind, etwa von einer Gesichtswahrnehmung
und einer gleichzeitigen Gehörwahrnehmung zu sprechen, als
seien es zwei verschiedene Bestandteile desselben CA92E3Erlebnisses. Die Geläufigkeit
solcher schon im täglichen Leben vorgenommenen Zerlegungen
darf uns aber nicht darüber täuschen, daß es sich auch hierbei schon um
Abstraktionen handelt; um so mehr bei den Elementen, die erst die
wissenschaftliche Analyse zum Vorschein bringt. Die gewählten Grundelemente,
jene CA92E4Erlebnissedes Ich als Einheiten (deren Abgrenzung
noch näher angegeben werden wird), bezeichnen wir als „CA92EE2Elementarerlebnisse"
RS-CA92E4 Bis hierin ist das keine Definition. Die Elementarerlebnisse werden auf "jene CA92E4Erlebnisse des Ich als Einheiten (deren Abgrenzung noch näher angegeben werden wird)" verschoben (>Begriffsverschiebebahnof), ohne das Carnap den Fundort angibt.
5. Unbegründete grundlegende wissenschaftstheoretische
Behauptungen:
Jede wissenschaftliche Aussage ist nach Carnap eine (relationale) Strukturaussage
(bei Schlick eine formale Beziehung) und nicht material. Das heißt:
Jede inhaltliche, materiale Aussage, ist unwissenschaftlich. Obwohl es
sich um eine außerordentlich grundlegende wissenschaftstheooretische
Behauptung handelt, habe ich bei Stegmüller, der viel mit Carnap zusammengearbeitet
und veröffentlicht hat, in seinen Hauptströmungen der Gegenwartsphilsophie
(1965), im Abschnitt über Carnaps Der logische Aufbau der Welt,
S. 387-392, keine Bemerkungen darüber gefunden.
- 5.1 Inhaltsverzeichniseinträge
68. Die Elementarerlebnisse sind unzerlegbare Einheiten 83
93. Die „Empfindungen" als individuelle Erlebnisbestandteile 119
116. Die Empfindungen (emp) und die Zerlegungen eines Elementarerlebnisses. 147.
5.2 Sachregistereinträge
Elementarerlebnisse, „meine" Erlebnisse: 65, Def. 67, 68, 69, 74-82,
93, 106, Kunst. 109, x26, 132, 140, 147, 163, 177f
erlebbare Beziehung, s. fundiert
Erlebnis (s. a. Elementarerlebnis): 16, 64f., 163f, 174
Erlebnisse des anderen Menschen:
Konst. 140, 14$
Erlebnisbestandteil: 67, 68,71, 74-77, 93, Konst. 116, 140,168, 174,
177
5.3 Fundstellen im Text
erleb 444, e erleben 6, erlebt 11, E:= Erlebnis...418, EE:=Elementarerlebnis
173.
7. Fazit
Das Werk, ich erwarb es 1970 noch vor meinem Studium in Erlangen, hat
mich schon immer fasziniert, wobei ich einige Probleme erst erkannte, als
ich es zum Erleben und Erlebnisbegriff genauer unter die Lupe nahm. Mit
der wissenschaftlichen Weltauffassung nach Klarheit und Begründetheit
des Wiener Kreises bin ich noch heute einverstanden, ich glaube aber nicht,
dass der formale (formallogische) Ansatz der richtige ist. Erkenntnis ist
material und das Formale ist zwar wichtiges Hilfsmittel und Werkzeug, aber
nicht das Wesentliche. In diesem Punkt unterscheide ich mich grundsätzlich
von Carnaps Strukturaussagen und Schlicks formalen Beziehungen.
Carnaps Psychologie hatte zwar solide und gründliche Ratgeber, z.B.
Bühler, Köhler, Wertheimer, aber die sind mit ihren Ganzheitsthesen
weit über das Ziel hinausgeschossen und in ihrer Begrifflichkeit auch
nicht differenziert genug.
Ende der Zusammenfassung
Fundstellen Elementarerlebnisse 173 (2 im Inhaltsverzeichnis)
Name-Werkkennung-Seite-ed/Ed- "." -AnzahlErwäh/Seite
C
A
z Typ Trenner
z
Lesebeispiel "68. Die CA93EE2Elementarerlebnisse
sind unzerlegbare Einheiten."
C Der Ausdruck Erlebnis stammt von Rudolf Carnap.
A aus seiner Habilitationsschrift
Der logische Aufbau der Welt (1926),
veröffentlicht 1928
93 Seite 93
EE Elementarerlebnis (im Unterschied zu E Erlebnis)
2 Es ist die zweite Erwähnung von Elementarerlebnis Seite 92
Signierungssystem (Quelle)
| e | < Erleben Differenzierung > Erlebnis | E |
| e0 | wach, erlebnisfähig | E0 |
| e1 | dabei, zugegen, Zeuge | E1 |
| e2 | innere Wahrnehmung | E2 |
| e3 | besonders | E3 |
| er | reines Erleben, Erlebnis | Er |
| epr | praktisch reines Erleben, Erlebnis | Epr |
| es | spezielle | Es |
| e? | unklar | E? |
Vorwort-1961, XII:
"Das in dem Buch aufgestellte. System nimmt als Grundelemente
die CAXIIEE1Elementarerlebnisse
(§ 67). Nur ein einziger Grundbegriff wird
verwendet, nämlich eine bestimmte Relation zwischen CAXIIEE2Elementarerlebnissen
(„Ahnlichkeitserinnerung", § 78). Es wird dann gezeigt,
daß die weiteren Begriffe, z. B. die verschiedenen Sinne, der
Gesichtssinn,
die Sehfeldstellen und ihre räumlichen Beziehungen, die Farben
und ihre Ahnlichkeitsbeziehungen, auf dieser Basis definiert werden
können. Daß die Beschränkung auf einen einzigen Grundbegriff
möglich ist, ist gewiß interessant. Aber heute erscheint
mir ein solches
Verfahren doch als zu künstlich. Ich würde vorziehen, eine
etwas größere
Anzahl von Grundbegriffen zu verwenden, zumal hierdurch auch
gewisse in meiner früheren Konstruktion der Sinnesqualitäten
auftretende
Mängel (vgl. die Beispiele in § 70 und 72) vermieden werden
können. Ich würde heute in Erwägung ziehen, als Grundelemente
nicht CAXIIEE3Elementarerlebnisse
zu nehmen (trotz der Gründe, die im Hinblick
auf die Gestaltpsychologie für diese Wahl sprechen, siehe §
67),
sondern etwas den Machschen Elementen Ahnliches, etwa konkrete
Sinnesdaten, wie z. B. „rot einer gewissen Art an einer gewissen Sehfeldstelle
zu einer gewissen Zeit". Als Grundbegriffe würde ich dann
einige Beziehungen zwischen solchen Elementen wählen, etwa die
Zeitbeziehung „x ist früher als y", die Beziehung der räumlichen
Nachbarschaft im Sehfeld und in anderen Sinnesfeldern, und die Beziehung
der qualitativen Ahnlichkeit, z. B. Farbähnlichkeit."
91-RNr: "67. Die Wahl der Grundelemente: die „CA91EE1Elementarerlebnisse"
Nachdem als Basisgebiet das eigenpsychische gewählt ist, also
die Be-
wußtseinsvorgänge oder CA91E1Erlebnisse
des Ich, muß noch festgelegt werden,
welche Gebilde dieses Gebietes als Grundelemente dienen sollen.
Man könnte etwa daran denken, die letzten Bestandteile, die sich
bei
psychologischer und phänomenologischer Analyse der CA91E2Erlebnisse
ergeben,
als Grundelemente zu nehmen, also etwa einfachste Sinnesempfindungen
(wie Mach [Anal]), oder allgemeiner: psychische
Elemente verschiedener Arten, aus denen die CA91E3Erlebnisse
aufgebaut
werden könnten. Bei näherer Betrachtung müssen wir jedoch
erkennen,
daß in diesem Falle nicht das Gegebene selbst, sondern Abstraktionen
daraus, also etwas erkenntnismäßig Sekundäres, als
Grundelemente
genommen werden. Zwar sind Konstitutionssysteme, die von solchen
Grundelementen ausgehen, ebenso berechtigt und durchführbar, wie
[>92]
etwa Systeme mit physischer Basis. Da wir jedoch von unserem Konstitutionssystem
auch die Berücksichtigung der erkenntnismäßigen
Ordnung der Gegenstände verlangen wollten (§ 54), so müssen
wir von
dem ausgehen, was zu allem anderen erkenntnismäßig primär
ist, vom
„Gegebenen", und das sind die CA92E1Erlebnisse
selbst in ihrerTotalität
und geschlossenen Einheit. Jene Bestandteile bis zu den letzten
Elementen hinunter sind aus diesen CA92E2Erlebnissen
durch Inbeziebungsetzung
und Vergleichung, also durch Abstraktion gewonnen. Diese
Abstraktion wird, wenigstens in den einfacheren Schritten, schon im
vorwissenschaftlichen Denken oder in intuitivem Verfahren vorgenommen,
so daß wir gewohnt sind, etwa von einer Gesichtswahrnehmung
und einer gleichzeitigen Gehörwahrnehmung zu sprechen, als
seien es zwei verschiedene Bestandteile desselben CA92E3Erlebnisses.
Die Geläufigkeit
solcher schon im täglichen Leben vorgenommenen Zerlegungen
darf uns aber nicht darüber täuschen, daß es sich auch
hierbei schon um
Abstraktionen handelt; um so mehr bei den Elementen, die erst die
wissenschaftliche Analyse zum Vorschein bringt. Die gewählten
Grundelemente,
jene CA92E4Erlebnisse
des Ich als Einheiten (deren Abgrenzung
noch näher angegeben werden wird), bezeichnen wir als „CA92EE2Elementarerlebnisse"
... [>93] ....
Wenn die CA93EE1Elementarerlebnisse
als Grundelemente gewählt werden,
so wird damit nicht angenommen, der CA93E1Erlebnisstrom
sei aus bestimmten,
diskreten Elementen zusammengesetzt. Vielmehr wird nur vorausgesetzt,
daß über gewisse Stellen des CA93E2Erlebnisstromes
Aussagen
gemacht werden können von der Art, daß eine solche Stelle
zu einer
bestimmten anderen in einer bestimmten Beziehung stehe und dgl.; es
wird aber nicht etwa behauptet, der CA93E3Erlebnisstrom
könne eindeutig in
solche Stellen zerlegt werden."
93 RNr68
"68. Die CA93EE2Elementarerlebnisse
sind unzerlegbare Einheiten
Die CA93EE3Elementarerlebnisse
sollen die Grundelemente unseres Kon-
stitutionssystems sein. Auf dieser Basis sollen alle anderen Gegenstände
der vorwissenschaftlichen und der wissenschaftlichen Erkenntnis konstituiert
werden, somit auch die Gegenstände, die man als Bestandteile
der CA93E4Erlebnisse
oder als Komponenten der psychischen Vorgänge zu bezeichnen
pflegt, und die als Ergebnis der psychologischen Analyse gefunden
werden (z. B.Teilempfindungen einer zusammengesetzten Wahrnehmung,
verschiedene gleichzeitige Wahrnehmungen verschiedener
Sinne, Qualitäts- und Intensitätskomponenten einer Empfindung,
und
dgl.). Hieraus ersteht eine besondere Schwierigkeit."
- RS-CA93EE2: Wie werden EE unterschieden und benannt?
des Konstitutionssystems sein sollen (§ 40). Gehen wir von
irgendwelchen Grundelementen und Grundrelationen aus, so können
nur Gegenstände der folgenden Arten in dem Konstitutionssystem vorkommen:
auf der ersten Konstitutionsstufe nur Klassen von Elementen
und Relationen zwischen Elementen, auf der zweiten Stufe nur erstens
Klassen solcher Klassen oder Relationen erster Stufe und zweitens
Relationen zwischen solchen Klassen oder Relationen erster Stufe oder
Elementen, usf. Es ist augenscheinlich, daß die Konstitution mit Hilfe
dieser Stufenformen nur synthetisch, nicht analytisch weitergeht:
Selbst wenn wir annähmen, die Grundelemente seien selbst wiederum
Klassen noch anderer Elemente, der „Urelemente", so können diese [>94]
Urelemente nicht mit den gegebenen Stufenformen konstituiert werden;
die Grundelemente eines Konstitutionssystems sind nicht
durch Konstitution zerlegbar. Also können die CA94EE1Elementarerlebnisse,
da sie in unserem System als Grundelemente genommen werden
sollen, in diesem System nicht zerlegt werden.
Dieser Sachverhalt stimmt zwar gut zu unserer Auffassung, daß die
CA94EE2Elementarerlebnisse ihrem Wesen nach unzerlegbare Einheiten
sind, aus welcher Auffassung heraus wir ja gerade sie zu Grundelementen
gewählt haben. Aber die vorhin genannte Aufgabe, unter
allen anderen Gegenständen der Wissenschaft auch die bekannten
psychischen Elemente, die sog. Bestandteile der CA94E1Erlebnisse, zu konstituieren,
könnte jetzt als unlösbar erscheinen. Diese Schwierigkeit ist
von grundsätzlicher Bedeutung für die Konstitutionstheorie und erfordert
zu ihrer Überwindung die Aufstellung einer besonderen konstitutionalen
Methode. Darauf soll jetzt näher eingegangen werden.
69. Die Aufgabe der Behandlung unzerlegbarer Einheiten
69 Die aus der Unzerlegbarkeit der CA94EE3Elementarerlebnisse
entstehende
Schwierigkeit wird überwunden durch ein Konstitutionsverfahren,
das,
obwohl synthetisch, von irgendwelchen Grundelementen aus zu Gegenständen
führt, die als formaler Ersatz für die Bestandteile der Grundelemente
dienen können. Als formalen Ersatz bezeichnen wir sie, weil
alle Aussagen, die von den Bestandteilen gelten, in analoger Form über
sie ausgesprochen werden können. Dieses Verfahren bezeichnen wir
als
„Quasianalyse". (Es ist hergeleitet aus dem Frege-Russellschen
„Abstraktionsprinzip", vgl. die Bemerkung am Schluß von §
73.) Es
ist überall da von Bedeutung, wo es sich um die Behandlung unzerlegbarer
Einheiten irgendwelcher Art handelt, d. h. um Gegenstände, die
ihrer unmittelbaren Gegebenheit nach nicht Bestandteile oder Merkmale
oder verschiedene Seiten aufweisen, sondern gewissermaßen nur
punktuell gegeben sind, die daher nur synthetisch behandelt werden
können, denen aber doch als Ergebnis des Verfahrens verschiedene
Merkmale zugeschrieben werden sollen. Merkmale und Bestandteile
sind hier als gleichbedeutend gesetzt; auch bei psychischen Vorgängen
z. B. kann ja der Ausdruck „Bestandteil" nicht im eigentlichen, extensiv-
räumlichen Sinne gemeint sein, also nur im Sinne des ebenfalls
bildlichen
Ausdrucks der „verschiedenen Seiten" oder „Merkmale"
... [>95] ...
Die von der Quasianalyse geforderte Leistung
ist also, wenn
wir sie nicht nur in Anwendung auf den hier gerade vorliegenden Fall
der CA95EE1Elementarerlebnisse,
sondern allgemein formulieren, die folgende:
Es sollen unzerlegbare Einheiten irgendwelcher Art, über die eine
Relationsbeschreibung als gegeben vorausgesetzt wird, mit Hilfe der
konstitutionalen Stufenformen der Klasse und der Relation, also mit
synthetischen Mitteln so behandelt werden, daß das Ergebnis einen
formalen Ersatz für die in diesem Falle nicht anwendbare eigentliche
Analyse, d. h. die Zerlegung in Bestandteile oder Merkmale, bildet.
Wegen der geforderten formalen Analogie zwischen den Ergebnissen
der Quasianalyse und denen der eigentlichen Analyse ist zu vermuten,
daß auch zwischen diesen beiden Verfahren selbst eine gewisse
formale
Analogie bestehen wird. Wir untersuchen deshalb zunächst, welche
formale Beschaffenheit das Verfahren der eigentlichen Analyse auf
Grund einer bloßen Relationsbeschreibung der zu analysierenden
Gegenstände hat. Dann werden wir sehen, wie sich das gesuchte
Verfahren
der Quasianalyse in analoger Weise aufstellen läßt."
99: "Die Wichtigkeit des Verfahrens der Quasianalyse wird deutlich,
wenn wir uns daran erinnern, daß der Charakter als unzerlegbarer
Einheiten
nach unserer Auffassung den CA99EE1Elementarerlebnissen
als den
Grundelementen des Konstitutionssystems zukommt, ferner aber auch
vielen psychischen, insbesondere sinnesphänomenalen Gebilden,
die
die ältere Psychologie als zusammengesetzt ansah. "
102: "74. Über Analyse und Synthese
74 Die Anwendung des Verfahrens der Quasianalyse auf die CA102EE1Elementarerlebnisse
als Grundelemente wird später im Entwurf des Konstitutionssystems
bei der Aufstellung der unteren Stufen dargestellt werden. Es
wird sich'dort zeigen, wie dies Verfahren uns z. B. in den Stand setzt,
die verschiedenen Sinnesgebiete und innerhalb der Sinnesgebiete die
verschiedenen Sinnesqualitäten zu konstituieren, ohne den CA102EE2Elementarerlebnissen
den Charakter der Unzerlegbarkeit zu nehmen.
Vielach hat man in Erkenntnissystemen, die im übrigen (wie be-[>103]
sonders die positivistischen) unserem Konstitutionssystem nahestehen,
74 nicht die CA103E1Erlebnisse
selbst, sondern Empfindungselemente oder sonstige
CA103E2Erlebnisbestandteile
als Grundelemente genommen, ohne ihrenCharakter
als Abstraktionen zu beachten. Der Grund hierfür lag vielleicht
darin, daß es unmöglich zu sein schien, bei der Wahl der
CA103E3Erlebnisse
selbst als Grundelemente alle Gegenstände der Psychologie und
darunter
auch jene „CA103E4Erlebnisbestandteile"
zu konstituieren. Nachdem
diese Unmöglichkeit durch das Verfahren der Quasianalyse als nur
scheinbar erwiesen ist, steht für keine erkenntnistheoretische
Auffassung
(und am wenigsten für eine positivistische) noch etwas im
Wege, den CA103EE1Elementarerlebnissen
den Charakter unzerlegbarer Einheiten
Nieder zuzuerkennen und sie als Grundelemente zu nehmen.
Um jedes Mißverständnis auszuschalten, sei noch einmal hervorgehoben,
daß mit der Auffassung der CA103EE2Elementarerlebnisse
als unzerlegbarer
Einheiten die psychologische Aussage „dieses CA102E5Erlebnis
(oder
dieser Bewußtseinsvorgang) besteht aus einer Gesichtswahrnehmung
mit den und den Einzelheiten, aus einer Gehörwahrnehmung, einem
Gefühl mit den und den Komponenten usw." nicht etwa als falsch
oder
gar als sinnleer hingestellt werden soll. Sondern es wird behauptet,
daß diese Aussage mit „Bestandteilen" nur Quasibestandteile meinen
dürfe, d. h. daß jeder sog. Bestandteil sich zu dem CA102E6Erlebnis
selbst
verhalte, wie in dem behandelten Beispiel (§ 71) die Klangklasse
c zu
dem Klang c-e-g, nämlich als ein durch Verwandtschaftsbeziehungen
konstituiertes Gebilde, als ein „Quasibestandteil".
LITERATUR Diese Auffassung berührt
sich eng mit der von Cornelius: „Der
Wert solcher Analyse besteht eben nicht in einer Erkenntnis
jenes einzelnen Bewußt-
seinstatbestandes, — der als solcher überhaupt keine
Analyse zuläßt —, sondern in
der Erkenntnis des gesetzmäßigen Zusammenhanges
verschiedener solcher Tatbestände"
[Einleitg] 314. Vgl. auch die Zitate in § 67.
Aus der methodischen Unzerlegbarkeit der Grundelemente
irgendeines Konstitutionssystems, die aus der Aufstellung von Klassd
tmd Relation als einzigen Konstitutionsstufen folgt (§ 68), und
aus der
inhaltlich bestimmten Unzerlegbarkeit, die aus der Wahl der
ihrem Wesen nach unzerlegbaren CA103EE3Elementarerlebnisse
folgt (§ 67), ergibt
sich für das allgemeine Verhältnis von Analyse und Synthese
wissenschaftlicher Gegenstände, wofern wir sie als nach
unserem Konstitutionssystem konstituiert auffassen, das Folgende. Da
jeder Wissenschaftsgegenstand aus den Grundelementen konstituiert
ist, so bedeutet seine Analyse zunächst die Zurückverfolgung
des Konstitutionsverfahrens
vom Gegenstande selbst bis zu denjenigen Elementen,
die zu seiner Konstitution erforderlich sind. Soll die Analyse [>104]
noch weiter getrieben werden, so ist das nicht im eigentlichen Sinne
möglich, sondern nur als Quasianalyse. Dasselbe gilt, wenn der
zu
analysierende Gegenstand kein konstituiertes Gebilde, sondern ein
Grundelement ist. Nun führt die Quasianalyse zwar zu Gebilden,
die
wir als Quasibestandteile bezeichnen, um in der Nähe des üblichen
Sprachgebrauchs zu bleiben, der sie Bestandteile nennt; aber sie tut
dies, indem sie aus Elementen Klassen von solchen und weiterhin Relationen
zwischen diesen Klassen bildet, also auf synthetischem, nicht
analytischem Wege. Wir können sagen: die Quasianalyse ist eine
Synthese, die sich in das sprachliche Gewand einer Analyse
kleidet."
104: "2. DIE GRUNDRELATIONEN
75. Die Grundrelationen als Grundbegriffe des Systems
75 Wir haben früher überlegt (§ 6x), daß zur Festlegung
der Basis
eines Konstitutionssystems außer den Grundelementen noch die
ersten
Ordnungssetzungen aufgestellt werden müssen, weil sonst von den
Grundelementen aus keine Konstitution möglich ist. Die Frage,
ob
diese ersten Ordnungssetzungen in Form von Klassen („Grundklassen")
oder von Relationen („Grundrelationen") gegeben werden sollten,
blieb zunächst noch offen. Nachdem aber die Wahl der Grundelemente
getroffen war (§ 67) und die als solche gewählten CA104EE1Elementarerlebnisse
sich ihrem Charakter nach als unzerlegbare Einheiten zeigten, ergab
sich, daß die über sie gegebenen Angaben die Form einer
Relations-[>105]
beschreibung haben müssen (§ 69). Damit ist entschieden,
daß als
75 erste Ordnungssetzungen (eine oder mehrere) Grundrelationen
gewählt
werden müssen. Diese Grundrelationen bilden die undefinierten
Grundbegriffe des Systems, nicht die Grundelemente;
diese werden erst aus den Grundrelationen (als deren
Feld) konstituiert."
105: " Wir wollen die Grundrelationen so bestimmen, daß
sie mit einander
sphärenverwandt (§ 29), also alle von gleicher Stufe sind
(§ 41);
und zwar sollen die Glieder jeder der Grundrelationen ausschließlich
CA105EE1Elementarerlebnisse
sein. Um die Grundrelationen aufzustellen,
muß jetzt überlegt werden, welche Beziehungen zwischen
den CA105EE2Elementarerlebnissen
als grundlegend anzusehen sind. Es handelt
sich hierbei aber nicht um die Frage nach psychologisch grundlegenden
Beziehungen, also solchen, die für den Ablauf der Bewußtseinsvorgänge
von besonderer Wichtigkeit sind. Da die Grundrelationen
als Basis der Konstitution aller (Erkenntnis-) Gegenstände dienen
sollen, so sind die Beziehungen vielmehr derart auszuwählen, daß
durch sie alle (erkennbaren) Sachverhalte ausgedrückt werden können.
..."
...[>106] ...
106: "Um zu erläutern, welche Beziehungen als Grundbeziehungen
gemeint
sind und was für Gebilde aus ihnen konstituiert werden, müssen
wir von den CA106E1Erlebnissen
in der üblichen Sachverhaltssprache, also
hier der Sprache der psychologischen Analyse, sprechen: nämlich
von ihren Bestandteilen, von Sinnesempfindungen, von den verschiedenen
Sinnen, von Qualität und Intensität usw. Die Verwendung
dieser Ausdrücke ist nicht so gemeint, als würden diese Bestandteile
usw. für die Konstitution schon vorausgesetzt; denn das würde
einen
circulus vitiosus bedeuten. Diese Ausdrücke sollen vielmehr nur
dazu
dienen, um auf gewisse bekannteSachverhalte, insbesondere auf grundlegende
Beziehungen zwischen den CA106EE1Elementarerlebnissen
hinzuweisen;
und das kann nur in der Ausdrucksweise geschehen, wie sie bei der
Behandlung von CA106E2Erlebnissen
und ihren Beziehungen üblich ist, also
in der Sprache der Psychologie. Die so zu verstehenden Ausdrücke
wollen wir (in Teil C und D) der größeren Deutlichkeit wegen
in P-
Zeichen einschließen (z. B.: pQualitätenp).
Gehört ein Ausdruck nicht
zur Sachverhaltssprache, ist er also nicht im Sinn des üblichen
Sprachgebrauches
gemeint, sondern bezieht er sich auf das Konstitutionssystem,
also auf eine konstitutionale Definition (die entweder
schon angegeben worden ist oder deren Aufstellung als Aufgabe
behandelt wird) oder auf einen undefinierten Grundbegriff des Systems,
so wird er in k-Zeichen eingeschlossen (z.
B.: kQualitätenk.
(In über-[>107]
75 schriften und literarischen Bemerkungen werden die beiden Bezeich-
nungsweisen nicht angewendet).
BEISPIELE. Wenn von pBestandteilen der
CA107E1Erlebnissed
gesprochen werden wird,
so liegt darin kein Widerspruch zu der Auffassung der CA107EE1
kElementarerlebnissenk
als unzerlegbarer Einheiten. Denn mit diesem Ausdruck „pBestandteiled"
sind die Gebilde
gemeint, die gewöhnlich darunter verstanden werden; durch die
P-Zeichen wird ausgedrückt, daß diese Benennung übernommen
wird, ohne daß damit die Auffassung
zum Ausdruck kommen soll, als handele es sich um eigentliche Bestandteile.
Was
diese Gebilde eigentlich sind, nämlich wie sie konstituiert werden
können und wie sie
dann in konstitutionaler Sprache zu bezeichnen sind, das wird ja noch
als Problem
erörtert.
Wenn später die kQualitätsklassenk
konstituiert oder wenigstens die Art ihrer
Konstitution angegeben worden ist (§ 81), so sind von da ab auch
mit dem Ausdruck
„kEmpfindungsqualitätenk"
oder „ kQualitätenk"
diese Klassen gemeint, im Unterschied zu dem Ausdruck „pEmpfindungsqualitätend"
oder „pQualitätend", mit dem
wir das meinen, was gewöhnlich mit diesem Wort gemeint wird; die
Unterscheidung
ist nötig, um die Frage behandeln zu können, ob die konstituierten
kQualitätenk
auch richtig so beschaffen sind, daß sie die bekannten pQualitätend,
z. B. die pEmpfindungsqualitätend, repräsentieren.
Ebenso ist zwischen kZeitordnungk
und pZeitordnungd zu unterscheiden, usw.
Die CA107EE1pElementarerlebnissed
sind die bekannten pTotalobjekte der Psychologied,
die pBewußtseinsvorgänged. Die CA107EE2
kElementarerlebnissek
sind eigenschaftslose, punktuelle
Relationsglieder. Die CA107EE3 pElementarerlebnissed
haben pBestandteiled, darunter
die pEmpfindungsqualitätend; die CA107EE4
kElementarerlebnissek
haben kQuasibestandteilek,
z. B. die kEmpfindungsqualitätenk
oder kQualitätsklassenk,
zu denen als Klassen sie als Elemente gehören.
76. Die Teilgleichheit
Um die physische Welt konstituieren zu können, brauchen wir ge-
wisse Bestandteile der CA107EE3Elementarerlebnisse,
besonders die Sinnesempfindungen
mit ihren Qualitäts- und Intensitätsbestetunungen,
später auch räumliche und zeitliche Ordnung, die auf eine
gewisse
Beschaffenheit der Empfindungen zurückgehen müssen, die selbst
noch
nicht im eigentlichen Sinne räumlicher bzw. zeitlicher Natur zu
sein
brauchtd.
pDie ,Bestandteile der CA107EE5Elementarerlebnissed
werden sich als Quasibestandteile ergeben müssen, da für uns
ja die CA107EE6 kElementarerlebnissek
als
unzerlegbare Einheiten gelten. pJede Empfindungsqualität,
sei
es eine Farbe, ein Ton, ein Geruch oder dergl.d, wird sich,
ergeben
müssen als pgemeinsame Eigenschaft derjenigen CA107EE7
kElementarerlebnissek,
in denen sie als pBestandteild, d. h. Quasibestandteil,
vorkommt.
Diese pgemeinsame Eigenschaftd wird konstitutional
dargestellt durch
die Klasse der betreffenden CA107EE8 kElementarerlebnissek
(„kQualitätsklassemk").
Früher ist ja ausführlich erörtert worden, daß
eine Klasse nicht das
Ganze oder die Kollektion ihrer Elemente ist, sondern eine ihnen ge-[>108]
meinsame Eigenschaft (§ 37). Diese Klasse könnte z. B. für
jede pEmp -
findungsqualitätd konstituiert werden durch das Verfahren
der Quasianalyse
auf Grund der Beziehung der pÜbereinstimmung zweier
CA108EE1Elementarerlebnisse
in einer solchen Qualitätd Wir heben also diejenige
Beziehung heraus, die pzwischen zwei CA108EE2Elementarerlebnisse
x und y
dann und nur dann besteht, wenn in x ein CA107E1Erlebnisbestandteil
a und in
y ein CA108E2Erlebnisbestandteil
b derart auftreten, daß a und b in allen Bestimmungsstücken
übereinstimmen: in der Qualität im engeren Sinne,
in der Intensität und in dem Lokalzeichen, das der Stelle des
Sinnesfeldes
entspricht, soweit diese Bestimmungsstücke für das betreffende
Sinnesgebiet in Betracht kommen. So heißen also zwei Farbempfindungen
übereinstimmend, wenn sie in Farbton, Sättigung, Helligkeit
und im Lokalzeichen, also damit auch in der Stelle des Sehfeldes, übereinstimmen;
ebenso zwei (einfache) Töne, wenn sie in Tonhöhe und
Tonstärke übereinstimmend. Die erläuterte Beziehung
der pÜbereinstimmung
zweier CA108E3Elementarerlebnisse
in einem CA108E3Erlebnisbestandteils
ist eine Art Teilgleichheit; wir nennen sie kurzweg
,,,Teilgleichheitd". Dieser Beziehung geben wir für die logistische
Formulierung des Konstitutionssystems das Relationszeichen „GI",
so daß „x Gl y" heißt: kdie
CA108EE4
kElementarerlebnissek
(also Elemente des
Konstitutionssystems) x und y sind teilgleichm; und das besagt: pdie
CA108EE5Elementarerlebnisse
x und y sind teilgleichd (in dem vorhin erläuterten
Sinne). Da man die Beziehung der pTeilgleichheitd
als einen ursprünglichen
Sachverhalt der Erkenntnis ansehen kann, so liegt es nahe, die
Relation Gl als Grundrelation aufzustellen. Wir werden aber später
sehen, daß das nicht zweckmäßig ist, da sie aus einer
anderen, ebenfalls
für die Konstitution erforderlichen Beziehung abgeleitet werden
kann,
die ihrerseits aber nicht aus der pTeilgleichheitd abgeleitet
werden
kann"
Literatur (Auswahl)
Die verschiedenen Auflagen von Der logische Aufbau der Welt unterscheiden sich nicht im eigentlichen Teile S.1-290 (ich habe die erste Auflage in der UB ausgeliehen und eingesehen 01.02.2023).
Bibliographie Carnap 1921-1937: https://www.carnap.org/carnapbib.html
Bibliography: https://depts.washington.edu/vienna/carnap/carnapbib.htm
Carnap, Rudolf (1928) Der logische Aufbau der Welt. Berlin: Springer.
[Online]
Carnap, Rudolf (1928) B. Anwendung: Die Erkenntnis vom Fremdpsychischen.
In (31-43) Scheinprobleme der Philosophie.
Geier, Manfred (1992). Der Wiener Kreis. Reinbek:
Rowohlt (romono).
Schlick, Moritz (1925) Allgemeine Erkenntnislehre. 2. Auflage.
Schlick, Moritz (1926) „Erleben, Erkennen, Metaphysik", Kant-Studien
31 (1926), S. 146-158. [Online]
- Carnap, Rudolf (1922) Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre. Berlin: .
- Carnap, Rudolf (1923) Über die Aufgabe der Physik und die Anwendung des Grundsatzes der Einfachstheit. In: Kant-Studien. Band 28, 1923, S. 90–107.
- Carnap, Rudolf (1925) Über die Abhängigkeit der Eigenschaften des Raumes von denen der Zeit. In: Kant-Studien. Band 30, 1925, S. 331–345.
- Carnap, Rudolf (1926) Habilitation mit Der logische Aufbau der Welt.
- Carnap, Rudolf (1926) Physikalische Begriffsbildung. G. Braun, Karlsruhe 1926 (66 S.). Unveränderter reprografischer Nachdruck der Ausgabe Karlsruhe 1926: Physikalische Begriffsbildung. Wissenschaftliche Buchges., Darmstadt 1966 (65 S.).
- Carnap, Rudolf (1928) Scheinprobleme in der Philosophie. Das Fremdpsychische und der Realismusstreit. Berlin-Schlachtensee 1928. Neuauflage Hamburg 2004, ISBN 978-3-7873-1728-8.
- Carnap, Rudolf (1928) Der logische Aufbau der Welt. Berlin-Schlachtensee 1928. Neuaufl. Hamburg 1998. ISBN 978-3-7873-1464-5.
- Carnap, Rudolf (1929) Abriss der Logistik, mit besonderer Berücksichtigung der Relationstheorie und ihrer Anwendungen. Wien 1929.
- Carnap, Rudolf (1930) Die Mathematik als Zweig der Logik. In: Blätter für deutsche Philosophie. Jg. 4, 1930.
- Carnap, Rudolf (1931/32a) Die logizistische Grundlegung der Mathematik. In: Erkenntnis. Jg. 2, 1931/1932, S. 91–105.
- Carnap, Rudolf (1931/32b) Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. In: Erkenntnis. Jg. 2, 1931/1932, S. 219–241[15]
- Carnap, Rudolf (1931/32) Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft. In: Erkenntnis. Jg. 2, 1931/1932, S. 432–465.
- Carnap, Rudolf (1932/33) Psychologie in physikalischer Sprache. In: Erkenntnis. Jg. 3, 1932/1933, S. 107–142.
- Carnap, Rudolf (1934, 1968) Logische Syntax der Sprache. Wien 1934; 2. Auflage 1968.
- Carnap, Rudolf (1936) Testability and Meaning. In: Philosophy of Science. Jg. 3, 1936, S. 419–471, und Jg. 4, 1937, S. 1–40.
- Carnap, Rudolf (1936/37) als Hrsg. mit Otto Neurath und Charles Morris (Hrsg.): International Encyclopedia of Unified Science. Jg. 2 Bände. University of Chicago Press, Chicago / Cambridge University Press, Cambridge 1938 ff.:
- Carnap, Rudolf (1938) mit Otto Neurath, Niels Bohr, John Dewey, Bertrand Russell und Charles W. Morris: Encyclopedia and Unified Science (= International Encyclopedia of Unified Science. Band 1, Nr. 1). Chicago 1938.
- Carnap, Rudolf (1939 ff) Foundations of Logic and Mathematics (= International Encyclopedia of Unified Science. Band 1, Nr. 3). Chicago 1939; 12. Auflage 1967.
- Carnap, Rudolf (1942) Introduction to Semantics. Harvard 1942.
- Carnap, Rudolf (1943) Formalization of Logic. Harvard 1943.
- Carnap, Rudolf (1947) Meaning and Necessity: A Study in Semantics and Modal Logic, Chicago 1947, erw. Ausg. 1956.
- Carnap, Rudolf (1950a) Logical Foundations of Probability. Chicago 1950.
- Carnap, Rudolf (1950b) Empiricism, Semantics, and Ontology, aus Revue Internationale de Philosophie. Jg. 4, 1950 S. 20–40
- Carnap, Rudolf (1952a) The Continuum of Inductive Methods. Chicago 1952.
- Carnap, Rudolf (1952b) Zusammen mit Y. Bar Hillel: An outline of the theory of Semantic information. Research Laboratory of Electronic, Massachusetts Institute of Technology, Report No. 247, 1952.
- Carnap, Rudolf (1954) Einführung in die symbolische Logik, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendungen. Wien 1954, 2. Auflage 1960
- Carnap, Rudolf (1958) Introduction to Symbolic Logic with Applications. Dover 1958.
- Carnap, Rudolf & Stegmüller, Wolfgang (1959) Induktive Logik und Wahrscheinlichkeit. Wien. Springer.
- Carnap, Rudolf (1963) Intellectual Autobiography. In: P. A. Schilpp (Hrsg.): The Philosophy of Rudolf Carnap. Open Court, La Salle (Illinois) 1963 (siehe unten).
- Carnap, Rudolf (1966) Philosophical Foundations of Physics. New York 1966.
- Carnap, Rudolf (1969) Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaft, Originaltitel Philosophical Foundations of Physics, übers. von Walter Hoering, Nymphenburger Verlagshandlung, München 1969.
- Carnap, Rudolf (1971) Studies in inductive logic and probability. Vol. 1, Berkeley 1971.
- Carnap, Rudolf (1973) Grundlagen der Logik und Mathematik (Originaltitel Foundations of Logic and Mathematics [1939]). Übers. mit einem Nachwort und einer kritischen Bibliographie versehen von Walter Hoering, München 1973.
- Carnap, Rudolf (1977) Two essays on entropy. Posthum hrsg. von Abner Shimony, Berkeley 1977.
- Carnap, Rudolf (1980) Studies in inductive logic and probability. Vol. 2, posthum hrsg. von R. C. Jeffrey, Berkeley 1980.
- Carnap, Rudolf (engl. 1963, dt. 1993) Mein Weg in die Philosophie (selbständig erschienene deutsche Übersetzung von „Intellectual Autobiography“ [1963]). Stuttgart 1993.
- Carnap, Rudolf (2022) Tagebücher Band 1: 1908–1919, postum hrsg. von Christian Damböck, Hamburg 2022, ISBN 978-3-7873-4036-1
- Carnap, Rudolf (2022) Tagebücher Band 2: 1920–1935, postum hrsg. von Christian Damböck, Hamburg 2022, ISBN 978-3-7873-4038-5
Geier
Stegmüller
Links(Auswahl: beachte)
Glossar, Anmerkungen und Endnoten: > Wissenschaftlicher Standort * Weltanschaulicher Standort
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Konstituieren
Im Sachregister wird zum Thema ausgeführt:
- Konstitution, konstituieren: Def. 2,
5, Def. 35, 38f., 46, 49, 53, 74, 109-
x56, 176
konstitutionale Definition: 2,
Def. 35, 38f., 40, 48-52, 95-105, 109-119-122, 145, 153, 161, 180
konstitutionale Sprache, s. Sprache
Konstitutionsregel, s. Regel
Konstitutionsstufe, s. Stufe
Konstitutionssystem (s. a. Systemform):
Def. 1, 2, 4, 8, 26, 46, 68, 82, 95f., 103-105, 106, 119, 121f., 144, 156, 179f.
Entwurf des Konstitutionssystems: 8, 1.06-152
Konstitutionstheorie:1,2,26,106, 156, 177f., 183
Thesen der Konstitutionstheorie: 84, 112, 119, 12If., 144, 153, 156
In § 2 erklärt Carnap:
- I. EINLEITUNG
AUFGABE UND PLAN DER UNTERSUCHUNGEN
A. DIE AUFGABE
The supreme maximi in scientific philosophising is this :
Wherever possible, logical constructions are to be substituted
for inferred entities. RUSSELL
I. Das Ziel: Konstitutionssystem der Begriffe
Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen ist die Aufstellung eines
erkenntnismäßig-logischen Systems der Gegenstände oder der Begriffe,
des „Konstitutionssystems". Der Ausdruck „Gegenstand" wird hier
stets im weitesten Sinne gebraucht, nämlich für alles das, worüber eine
Aussage gemacht werden kann. Danach zählen wir zu den Gegenständen
nicht nur Dinge, sondern auch Eigenschaften und Beziehungen,
Klassen und Relationen, Zustände und Vorgänge, ferner Wirkliches
und Unwirkliches.
Das Konstirutionssystem stellt sich nicht nur, wie andere Begriffssysteme,
die Aufgabe, die Begriffe in verschiedene Arten einzuteilen
und die Unterschiede und gegenseitigen Beziehungen dieser Arten zu
untersuchen. Sondern die Begriffe sollen aus gewissen Grundbegriffen
stufenweise abgeleitet, „konstituiert" werden,.so daß sich ein S Lammbaum
der Begriffe ergibt, in dem jeder Begriff seinen bestimmten
Platz findet. Daß eine solche Ableitung aller Begriffe aus einigen wenigen
Grundbegriffen möglich ist, ist die Hauptthese der Konstitutionstheorie,
durch die sie sich am meisten von anderen Gegenstandstheorien
unterscheidet.
2. Was heißt „konstituieren"?
Um den Sinn unseres Zieles, des „Konstitutionssystems", deutlicher 2
angeben zu können, seien gleich hier einige wichtige Begriffe der Konstitutionstheorie
erläutert. Ein Gegenstand (oder Begriff) heißt auf
einen oder mehrere andere Gegenstände „zurückführbar", wenn alle
Aussagen über ihn sich umformen lassen in Aussagen über diese anderen
Gegenstände. (Diese Erklärung mit Hilfe des unstrengen Begriffs der
„Umformung" genügt einstweilen; die folgenden Beispiele machen sie
2 hinreichend deutlich. Die strengen Definitionen der Zurückführbarkeit
und der Konstitution werden später gegeben (§ 35); sie werden nicht
auf Aussagen, sondern auf Aussagefunktionen Bezug nehmen). Ist
a auf b zurückführbar und b auf c, so auch a auf c; die Zurückfübrbarkeit
ist also transitiv.
BEISPIEL. Alle Brüche sind auf die natürlichen (d. h. positiven, ganzen) Zahlen
zurückführbar; denn alle Aussagen über Brüche lassen sich umformen in Aussagen
über natürliche Zahlen. So ist z. B.'/, auf 3 und 7 zurückführbar, 2/, auf 2 und 5;
und die Aussage „'/7 >'/ s" heißt, umgeformt als Aussage über natürliche Zahlen:
„für beliebige natürliche Zahlen x und y ist 3x> zy, wenn 7x = 5y". '
Ferner sind alle r e ell en Z a hien, auch die irrationalen, auf Brüche zurückführbar.
Schließlich sind alle Gebilde der Arithmetik und Analysis auf natürliche
Zahlen zurückführbar.
Ist ein Gegenstand a auf die Gegenstände b, c zurückführbar, so
sind nach der angegebenen Erklärung die Aussagen über a umformbar
in Aussagen über b und c. „a auf b, c zurückführen" oder „a aus b, c
konstituieren" soll bedeuten: eine allgemeine Regel aufstellen, die
angibt, in welcher Weise man in jedem einzelnen Falle eine Aussage
über a umformen muß, um eine Aussage über b, c zu erhalten. Diese
Übersetzungsregel nennen wir „Konstitutionsregel" oder „konstitutionale
Definition" (da sie die Form einer Definition hat, s. § 38).
Unter einem „Konstitutionssystem" verstehen wir eine stufenweise
Ordnung der Gegenstände derart, daß die Gegenstände einer jeden
Stufe aus denen der niederen Stufen konstituiert werden. Wegen der
Transitivität der Zurückführbarkeit werden dadurch indirekt alle
Gegenstände des Konstitutionssystems aus den Gegenständen der ersten
Stufe konstituiert; diese „Grundgegenstände" bilden die „Basis"
des Systems.
BEISPIEL. Ein Konstitutionssystem der arithmetischen Begriffe könnte
z. B. dadurch aufgestellt werden, daß alle arithmetischen Begriffe schrittweise (in
Kettendefinitionen) aus den Grundbegriffen der natürlichen Zahlen und des unmittelbaren
Nachfolgers abgeleitet, „konstituiert" werden.
Die A xiom a tisierung einer Theorie besteht darin, daß sämtliche
Aussagen der Theorie in ein Deduktionssystem eingeordnet werden,
dessen Basis die Axiome bilden, und daß sämtliche Begriffe der
Theorie in ein Konstitutionssystem eingeordnet werden, dessen Basis
die Grundbegriffe bilden. Die Methodik dieser zweiten Aufgabe, der
systematischen Konstitution der Begriffe, hat bisher gegenüber der
ersten Aufgabe, der Deduktion der Aussagen aus den Axiomen, weniger
Beachtung gefunden. Sie soll hier behandelt und auf das Begriffssystem
der Wissenschaft, der einen Gesamtwissenschaft, angewendet werden.
Nur wenn es gelingt, ein solches Einheitssystem aller Begriffe
2
lt
aufzubauen, ist es möglich, den Zerfall der Gesamtwissenschaft 2
in die einzelnen, beziehungslos nebeneinander stehenden Teilwissenschaften
zu überwinden.
Obwohl der subjektive Ausgangspunkt aller Erkenntnis in den Erlebnisinhalten
und ihren Verflechtungen liegt, ist es doch möglich, wie
der Aufbau des Konstitutionssystems zeigen soll, zu einer intersubjektiven,
objektiven Welt zu gelangen, die begrifflich erfaßbar ist und
zwar als eine identische für alle Subjekte.
Struktur RNr 11, S.13f:
"11. Der Begriff der Struktur
Eine besondere Art von Beziehungsbeschreibungen bezeichnen wir
als Strukturbeschreibungen. Diese lassen nicht nur, wie jede Beziehungsbeschreibung,
die Eigenschaften der einzelnen Glieder des Bereiches
ungenannt, sondern auch noch die Beziehungen selbst, die
zwischen diesen Gliedern bestehen. In einer Strukturbeschreibung wird
nur die „Struktur" der Beziehungen angegeben, d. h. ein Inbegriff
aller ihrer formalen Eigenschaften (die genauere Definition der Struktur
wird nachher gegeben). Unter den formalen Eigenschaften einer
Beziehung verstehen wir solche, die sich ohne Bezugnahme auf den
inhaltlichen Sinn der Beziehung und auf die Art der Gegenstände,
zwischen denen sie besteht, formulieren lassen. Sie bilden den Gegenstand
der Relationstheorie. Die formalen Eigenschaften einer Beziehung
lassen sich ausschließlich mit Hilfe logistischer Zeichen definieren,
schließlich also mit Hilfe der wenigen Grundzeichen, die die
Basis der Logistik (symbolischen Logik) bilden; (es sind also nicht
spezifisch relationstheoretische Zeichen, sondern solche, die die Grundlage
für den Aufbau der ganzen Logik — Aussagentheorie, Theorie
der Aussagefunktionen (Begriffe), Klassentheorie und Relationstheorie
— bilden).
Einige der wichtigsten formalen Eigenschaften seien aufgeführt.
Eine Beziehung heißt symmetrisch, wenn sie mit ihrer Konversen (Umkehrung)
identisch ist (z.B. Gleichaltrigkeit), andernfalls nicht-symmetrisch (z.B. Bruder);
eine nicht-symmetrische Beziehung heißt asymmetrisch, wenn sie ihre Konverse
ausschließt (z. B. Vater). Eine Beziehung heißt reflexiv, wenn sie bei Identität
(innerhalb ihres Feldes) stets erfüllt ist (z. B. Gleichaltrigkeit), andernfalls nichtreflexiv
(z.B.Lehrer); eine nicht-reflexive Beziehung heißt irreflexiv, wenn sie die
Identität ausschließt (z. B. Vater). Eine Beziehung heißt transitiv, wenn sie stets
auch zum übernächsten Glied gilt (z. B.Vorfahre), andernfalls nicht- transitiv (z. B.
Freund); eine nicht-transitive Beziehung heißt intransitiv, wenn sie nie zum übernächsten
Glied gilt (z. B. Vater). Eine Beziehung heißt zusammenhängend, wenn
zwischen zwei verschiedenen Gliedern ihres Feldes stets entweder sie selbst oder
ihre Konverse besteht (z. B. für eine Tischgesellschaft von sechs Personen die Beziehung
„ein, zwei oder drei Plätze weiter links"). Eine Beziehung heißt eine Reihe,
wenn sie irreflexiv und transitiv (daher asymmetrisch) und zusammenhängend ist
(z.B. „kleiner als" für relle Zahlen). Eine Beziehung heißt eine „Ahnlichkeit", wenn
sie symmetrisch und reflexiv ist; eine „Gleichheit", wenn sie außerdem transitiv
ist (vgl. § 71, 73).
Andere formale Eigenschaften von Beziehungen sind: Einmehrdeutigkeit, Mehreindeutigkeit,
Eineindeutigkeit, bestimmte Anzahl der Glieder des Feldes, der Glieder
des Vorbereichs, der Glieder des Nachbereichs, der Anfangsglieder, der Endglieder u. a.
Um uns anschaulich zu machen, was unter der Struktur der Beziehungen
verstanden werden soll, denken wir uns für jede Beziehung
die „Pfeilfigur" gezeichnet: alle Beziehungsglieder werden durch [>14]
Punkte dargestellt, von jedem Punkt geht ein Pfeil zu denjenigen anderen
Punkten, zu denen der erste in der darzustellenden Beziehung
steht. Ein Doppelpfeil bezeichnet ein Gliederpaar, für das die Beziehung
in beiden Richtungen gilt; ein Rückkehrpfeil bezeichnet ein
Glied, das die darzustellende Beziehung zu sich selbst hat Haben
zwei Beziehungen nun dieselbe Pfeilfigur, so heißen sie „von gleicher
Struktur` oder „isomorph". Die Pfeilfigur ist gewissermaßen die
symbolische Darstellung der Struktur. Die Pfeilfiguren zweier isomorpher
Beziehungen brauchen natürlich nicht kongruent zu sein. Wir
nennen zwei Pfeilfiguren auch gleich, wenn die eine von ihnen durch
Verzerrung (ohne Zusammenhangsstörung) in die andere übergeführt
werden kann (topologische Äquivalenz)."
__
Strukturaussagen
"16. Alle wissenschaftlichen Aussagen sind
Strukturaussagen
16 Aus den angestellten Untersuchungen über die strukturelle Keimzeichnung
geht hervor, daß jeder Gegenstandsname, der in einer wissenschaftlichen
Aussage vorkommt, grundsätzlich (d. h. wenn die erforderlichen
Kenntnisse vorliegen) ersetzt werden kann durch eine strukturelle
Kennzeichnung des Gegenstandes, verbunden mit der Angabe des
Gegenstandsgebietes, auf das die Kennzeichnung sich bezieht. Das gilt
nicht nur für individuelle Gegenstandsnamen, sondern auch für
allgemeine,
also für Namen von Begriffen, Klassen, Relationen (wie wir
es im Beispiel des § 14 für die Relationen der Straßenverbindungen
und dergl. gesehen haben). Somit kann jede wissenschaftliche Aussage
grundsätzlich umgeformt werden in eine Aussage, die nur Struktureigenschaften
und die Angabe eines oder mehrerer Gegenstandsgebiete
enthält. Nun besagt eine Grundthese der Konstitutionstheorie (vgl.
§ 4), deren Nachweis in den folgenden Untersuchungen erbracht
werden
soll, daß es im Grunde nur ein Gegenstandsgebiet gibt, von dessen
Gegenständen
jede wissenschaftliche Aussage handelt. Damit fällt die
Notwendigkeit der Angabe des Gegenstandsgebietes in jeder Aussage
fort, und wir erhalten das Ergebnis, daß jede wissenschaftliche
Aussage
grundsätzlich so umgeformt werden kann, daß sie nur
noch eine Strukturaussage ist. Diese Umformung ist aber nicht
nur möglich, sondern gefordert. Denn die Wissenschaft will vom
Objektiven
sprechen; alles jedoch, was nicht zur Struktur, sondern zum
Materialen gehört, alles, was konkret aufgewiesen wird, ist letzten
Endes subjektiv. In der Physik bemerken wir leicht diese Entsubjektivierung,
die schon fast alle physikalischen Begriffe in reine Strukturbegriffe
übergeführt hat.
Zunächst sind alle mathematischen Begriffe
auf relationstheoretische zurückführbar;
vierdimensionales Tensor- oder Vektorfeld sind Strukturschemata; das
Weltliniengeflecht
mit den Beziehungen der Koinzidenz und der Eigenzeit ist ein Struktur-[>21]
schema, bei dem nur noch eine oder zwei Beziehungen mit Namen genannt
werden, die 16
aber auch schon durch die Art des Schemas eindeutig bestimmt sind.
In der Betrachtungsweise der Konstitutionstheorie ist der Sachverhalt
in folgender Weise auszudrücken. Die Reihe der Erlebnisse
ist
für jedes Subjekt verschieden. Soll trotzdem Übereinstimmung
in der
Namengebung erzielt werden für die Gebilde, die auf Grund der
Erlebnisse
konstituiert werden, so kann das nicht durch Bezugnahme auf
das gänzlich divergierende Materiale geschehen, sondern nur durch
formale
Kennzeichnung der Gebildestrukturen. Freilich bleibt es noch
ein Problem, wie aus den so ungeheuer verschiedenen Erlebnisreihen
sich bei Anwendung übereinstimmender formaler Konstitutionsregeln
Gebilde von einer für alle Subjekte übereinstimmenden Struktur
ergeben:
das Problem der intersubjektiven Wirklichkeit. Das wird später
noch zu erörtern sein. Zunächst halten wir fest, daß
es für die Wiss enschaft
möglich und zugleich notwendig ist, sich auf Strukturaussagen
nu beschränken. Das war die Behauptung unserer These.
Daß trotzdem die wissenschaftlichen Aussagen die sprachliche
Form
einer materialen Beziehungsbeschreibung oder sogar einer Eigenschaftsbeschreibung
haben können, geht aus den früheren Überlegungen hervor
(§
LITERATUR. Aus ähnlichen Überlegungen wie den hier angestellten
heraus ist
zuweilen die Auffassung vertreten worden, daß nicht das Gegebene
selbst, etwa die
Empfindungen, sondern ,,allein die Beziehungen zwischen den Empfindungen
einen
objektiven Wert haben können" (P oin c ari [Wert] 198). Diese
Auffassung geht
offenbar in die richtige Richtung, bleibt aber einen Schritt zu früh
stehen: von den
Beziehungen müssen wir weitergehen zu den Beziehungsstrukturen,
wenn wir zu völlig
formalisierten Gebilden kommen wollen; die Beziehungen selbst in ihrer
qualitativen
Eigenart sind noch nicht intersubjektiv übertragbar. Erst Russell
([Math. Phil.] 62f.)
hat Hinweise auf die Wichtigkeit der Struktur für die Gewinnung
der Objektivität
gegeben."
__
Formale Beziehungen und Strukturaussagen
Schlick in Erleben, erkennen, Metaphasik, S.6:
- FN6.1) Man vgl. die scharfsinnigen
und unwiderleglichen Ausführungen von R. Carnap
in seinem Werk „Der logische Aufbau der Welt", in dem er dartut, daß alle wissen-
schaftlichen Urteile sich auf reine Strukturaussagen — dieser Begriff entspricht
unseren „Formalen Beziehungen" — beschränken müssen. Wir fügen hinzu, daß
dies von allen sinnvollen Urteilen überhaupt gilt, denn die Argumente bleiben für alle,
auch die nichtwissenschaftlichen Aussagen gültig. Vgl. ferner Ludwig Wittgenstein,
„Tractatus logico-philosophicus", deutsch und englisch, London 1922. [>7]
Carnap in Der Logische Aufbau der Welt, 1928, RNr 16, S. 20:
"Alle wissenschaftlichen Aussagen sind Strukturaussagen
... Nun besagt eine Grundthese der Konstitutionstheorie (vgl.
§ 4), deren Nachweis in den folgenden Untersuchungen erbracht werden
soll, daß es im Grunde nur ein Gegenstandsgebiet gibt, von dessen Gegenständen
jede wissenschaftliche Aussage handelt. Damit fällt die
Notwendigkeit der Angabe des Gegenstandsgebietes in jeder Aussage
fort, und wir erhalten das Ergebnis, daß jede wissenschaftliche Aussage
grundsätzlich so umgeformt werden kann, daß sie nur
noch eine Strukturaussage ist. Diese Umformung ist aber nicht
nur möglich, sondern gefordert. Denn die Wissenschaft will vom Objektiven
sprechen; alles jedoch, was nicht zur Struktur, sondern zum
Materialen gehört, alles, was konkret aufgewiesen wird, ist letzten
Endes subjektiv."
Andererseits finde ich in Carnap Aufbau, z.B. unter Rnr 76, S. 108:
- "... So heißen also zwei Farbempfindungen übereinstimmend,
wenn
sie in Farbton, Sättigung, Helligkeit und im Lokalzeichen, also damit
auch in der Stelle des Sehfeldes, übereinstimmen; ..."
Präsentation und Analyse von Erleben und Erlebnis bei Rudolf Carnap
in Der logische Aufbau der Welt angehen werde.
Schlick in Carnaps Literaturverzeichnis 1928:
- SCHLICK 25, 65, 67, 130, 136, 163, 176, 182
[Raum u. Zeit] Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. Berlin (1917), 4. Auflage 1922
[Erkenntnl.]. Allgemeine Erkenntnislehre. Berlin (1918), 2. A. 1925. E 1
[Metaphysik] Erleben, Erkennen, Metaphysik. Kantstud. XXXI, 146-158, 1926.
__
Strukturauassagen Carnaps heißen bei Schlick formale Beziehungen.
__
zerlegbar (geteilte innere Wahrnehmung)
Ein Erlebnis ist definiert als Ausschnitt aus dem Erleben. Es kann die Verarbeitung von äußeren oder/und inneren Wahrnehmungsquellen enthalten. Nach der theoretischen Analyse gibt es eine Vielzahl von Dimensionen des Erlebens. Die Frage ist hier, ob ein Erlebnis schon bei der inneren Wahrnehmung zerlegt/geteilt erlebt werden kann, also während des Aktes des Erlebens und nicht erst durch nachträgliche Analyse. Hierzu habe ich oben Beispiele gebracht: visuell: Blau-Gelb, Rechtecke 1-9, akustisch: Stimmengewirr.
__
Standort: Erleben, Erlebnis und Elementar-Erlebnis bei Rudolf Carnap.
*
Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse
Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Zusammenfassung Hauptseite *
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Erleben, Erlebnis und Elementar-Erlebnis bei Rudolf Carnap. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/Carnap.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert:
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
01.02.23 Weitere Beispiele (Rechtsecke) zur Zerlegtheitswahrnehmung. Überarbeitung Blau-Gelb.
31.01.23 Vorläufiger Abschluss der Zusammenfassung.
30.01.23 Auswertungen, Kommentare, Zusammenfassung
29.01.23 Auswertungen.
28.01.23 Angelegt