(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=26.09.2023angelegt Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 29.05.24
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Beweis und beweisen bei Kurt Lewin_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Allgemeines Beweisregister Psychologie
besonders zu Erleben und Erlebnis
Beweis und beweisen bei Kurt
Lewin (1890-1947)
mit einer Untersuchung zu seinem
Verständnis der Definition
Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen
Methoder der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Checkliste-Beweisen. Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht Beweisseiten * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Definition und definieren * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhöfe * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse * Hauptbedeutungen Erleben * »«
_
Editorial.
Lewin 1917.
Zusammenfassung Lewin-1917.
beweisrelevante-Fundstellen im Textkontext.
Lewin-1922e.
"beweis" Fundstellen im Textkontext.
Beweisthema bei Lewin.
Ach-Lewin-Kontroverse in den Fachmedien / Internet:
DORSCH Lexikon der Psychologie.
Spektrum-Lexikon-Psychologie.
Psychologie48-Lexikon.
ChatGPT: Ach-Lewin-Kontroverse: Auskunft vollkommen daneben.
Ach (1935) zu Lewins Befunden und Argumenten.
Lewin, Kurt (1931) Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Biologie und Psychologie.
Zitierstil Lewin 1931.
Ein erstes frühes Beispiel für den Hochstaplerzitierstil.
Definitionslehre, Definition und definieren bei Kurt Lewin).
Beweislinks.
Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen
Editorial
Das Thema Beweis und beweisen spielt bei Kurt Lewin sowohl theoretisch (erste zwei Bde. der Werkausgabe über Wissenschaftstheorie) als auch praktisch eine große Rolle. Berühmt wurde hierbei die sog. Ach-Lewin-Kontroverse, in der er das von Ach vertretene "Assoziationsgesetz" - "Wenn zwei a und b häufig hintereinander aufgetreten sind, und dann a (b) erlebt wird, so hat b (a) die Tendenz aufzutauchen." - meinte, widerlegt zu haben, was auf dieser Seite ausgiebig untersucht und dargestellt werden soll. Im "Assoziationsgesetz", wie es Lewin formuliert hat, gibt es keinen Willen oder Absicht (z.B. zum Einprägen), keine Determination, Bahnung oder Hemmung, kein Lernen, keine Stärke der Assoziation. Auch der wichtige Begriff der Tendenz wird nicht erklärt. Das ist eine äußert dürftig, unzulänglich, ja schlampig formulierte Hypothese, die Lewins Niveau als Wissenschaftler nicht angemessen ist. Seine angebliche Widerlegung des "Assoziationsgesetzes" ist eine wissenschaftstheoretische Fehlleistung, die mein Lewinbild ziemlich erschüttert hat.
Assoziation ist ein grundlegender Begriff der Geistesgeschichte und besonders der Psychologie. Das Wort Assoziation kommt aus dem Lateinischen: associare bedeutet verbinden, vereinigen, verknüpfen (mehr zu den Wortbedeutungen: Wikipedia).
Obwohl bereits Aristoteles einige grundlegenden Prinzipien für Assoziationsbildungen für den Erinnerungsprozess formulierte (Ähnlichkeit, Kontrast, räumliche oder zeitliche Nähe) wurde in den letzten 2500 Jahren keine Assoziationstheorie ausgearbeitet, die den Namen Theorie wirklich verdient. Ein merkwürdiges Phänonomen für das ich noch keine Erklärung gefunden habe. Um diesem Phänomen auf die Spur zu kommen, werte ich die Arbeiten von DenkerInnen und ForscherInnen aus, die als VertreterInnen der Assoziationslehre gelten oder sich sonst mit der Assoziation auseinandergesetzt haben. Hierzu gehört auch Kurt Lewin (1890-1947) mit seiner kritischen Analyse der ACHschen Versuche. Am Ende dieser Reise, die noch eine Weile dauern wird, auch wenn ich mich auf wenige repräsentative Stichproben von Denker- und ForscherInnen beschränke, habe ich dann hoffentlich herausgefunden, warum das so ist. Nachdem von Philosophen echte, d.h. empirische Wissenschaft nicht zu erwarten ist - sie meinen überwiegend was andere meinen - ist vor allem die Zeit ab 1770 interessant, wo die empirische Psychologie mit den ersten Messungen von Tetens begann. Aus den 2500 Jahren werden somit rund 250 Jahre. Mit Ach und Lewin sind wir im Zeitraum 1905-1935 angekommen.
Doch hier geht es in erster Linie um Beweis und beweisen, Assoziation und Assoziationsgesetz liefern nur den thematischen Rahmen und Anlass.
Lewin, Kurt (1917) Die psychische Tätigkeit bei der Hemmung von Willensvorgängen und das Grundgesetz der Assoziation. In: Zeitschrift für Psychologie. (1917), 77, S. 212–247. Kürzel L1917.
G e s p e r r t bei Lewin hier fett.
Zusammenfassung-Lewin-1917
L1917-Fazit: Lewin widerlegt nicht das "Assoziationsgesetz",
sondern bestenfalls Achs Hypothesen, wenn seine Versuchsabänderungen
keinen Einfluss haben, was Ach (1935, S.213f
) nicht glaubt und ich auch nicht. In der Arbeit kommt das Hauptsuchwort
"beweis" zwar nicht vor, aber doch einige beweisrelevante Begriffe wie
z.B. widerlegen 1, falsch 5, richtig 10, zeig 18.
Lewin will zeigen, dass das "Assoziationsgesetz"
in der Formulierung "Wenn zwei a und b häufig hintereinander aufgetreten
sind, und dann a (b) erlebt wird, so hat b (a) die Tendenz aufzutauchen"
(S.213) so nicht zutrifft und zusätzlicher Bedingungen bedarf. Im
"Assoziationsgesetz", wie es Lewin formuliert hat, gibt es keinen Willen
oder Absicht (z.B. zum Einprägen), keine Determination, Bahnung oder
Hemmung, kein Lernen, keine Stärke der Assoziation. Auch der wichtige
Begriff der Tendenz wird nicht erklärt. Das ist eine äußert
dürftig, unzulänglich, ja schlampig formulierte Hypothese, die
Lewins Niveau als Wissenschaftler nicht angemessen ist. Lewin bezieht sich
auf Versuche von N. ACH (1910), insbesondere an das S. 43 formulierte
assoziative
Äquivalent der Determination. Eine Beweisidee teilt Lewin nicht
mit. Sie scheint aber darin zu bestehen, dass er Ableitungen aus dem "Assoziatationsgesetz"
trifft - die so nicht von ihm im "Assoziationsgesetz" formuliert wurden
- derart, dass Assoziationen, die bei der Bildung gestört werden,
schwächer sein und damit längere Reaktionszeiten bewirken müssten,
was er nach seinen Mittelwerten nicht bestätigen kann (von Simoneit
im Labor Ach wiederholt und bestätigt). Auf die Idee, dass seine Operationalisierungen
unangemessen sein könnten, kommt er nicht. Er schließt falsch,
weil die Assoziationszeiten der Mittelwerte bei seinen Versuchen allesamt
in der gleichen Größenordnung liegen, könne das "Assoziationsgesetz"
so nicht stimmen. Lewin erkennt nicht, dass er nur einen ins "Assoziationsgesetz"
hineinprojizierten Pappkameraden widerlegt, so widerlegt er also etwas,
was gar nicht behauptet wurde. Tatsächlich belegen alle ja alle Versuchsreihen
Lewins die Gültigkeit des "Assoziationsgesetzes", wie er es formuliert
hat, er sieht das aber nicht, weil er fixiert darauf ist, dass sich Unterschiede
bei den Assoziationszeiten ergeben sollten, die etwas widerlegen, was nie
behauptet wurde. Lewin widerlegt also bestenfalls Ach, aber nicht das "Assoziationsgesetz",
das man auch gar nicht widerlegen kann, weil es seit Beginn der empirischen
Psychologie um 1770,
also seit über 250 Jahren nie wissenschaftlich richtig ausformuliert
wurde, was einiges über das Wissenschaftsverständnis der PsychologInnen
und der AssoziationswissenschaftlerInnen aussagt.
Fundstellen anderer beweisrelevanter Worte und Begriffe
Auch wenn der Hauptsuchtext "beweis" nicht vorkommt, enthält der Text Lewin 1917 doch einige beweisrelevante Worte (Begriffe). Ich gebe eine kleine Auswahl wieder: falsch, richtig, widerleg, zeig.
Fundstellen falsch: 2 beweisrelevante
L1917-219.1 "Daraus folgt, daß entweder das Grundgesetz der Assoziation
in der angegebenen Fassung falsch
ist, oder daß Versuchs-
fehler vorliegen, die das Resultat verdecken."
L1917-219.2 "Es fragt sich nun, was im einzelnen an diesem Gesetze falsch
ist ...."
- 229: falsche Silbe
234: Vp auf falschem Weg
238: Falschhandlungen im Leben infolge Gewohnheit
Fundstellen richtig 10 (11
aber 1 Pseudo: aufrichtigsten), zwei ausgewählt.
L1917-214: "Auch die Achschen Versuche erkennen die Richtigkeit
dieses Gesetzes dadurch, daß sie es der Messung zugrunde legen ,
ausdrücklich an "
L1917-228: "Ist diese Erklärung der Vorgänge richtig,
so müssen die gleichen Silben nach der gleichen Anzahl von
Wiederholungen eine intendierte Fehlreaktion liefern oder nicht liefern,
je nachdem, ob bei den Reihen, in die sie als Reizsilben für intendierte
Fehlreaktionen eingeführt werden, eine Rpt oder eine andersartige
Tätigkeit angeführt wird. In der Tat läßt sich eine
derartige Anordnung treffen."
Fundstelle widerlegen 1
L1917-219: "Auf diese in Betracht kommenden Einwände die ich teils
durch eine genauere Diskussion des Einwandes selbst, teils durch besondere
Experimentalreihen widerlegen zu können
glaube, einzugehen, erübrigt sich an dieser Stelle, da die weiteren
Versuche den Faktor bestimmen, der unter Konstanz aller übrigen Bedingungen,
je nach seinem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein das Auftreten oder
Ausbleiben der Reproduktionstendenz nach sich zieht."
Fundstellen zeig
18 Fundstellen, zwei ausgewählt.
L1917-217: "Ist nun das Grundgesetz der Assoziation in der angeführten
Fassung richtig, so müßten
sich bei unserer Anordnung folgende Wirkungen notwendig zeigen"
L1917-219: "Damit wäre gezeigt,
daß das Grundgesetz der Assoziation in der oben angeführten
Fassung zu weit geht, insofern es Anordnungen gibt, bei denen trotz
Vorliegen der geforderten Bedingungen die behaupteten Wirkungen nicht eintreten,
auch wenn keine verdeckten Faktoren vorhanden sind."
Lewin, K. (1922e) Das Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der Assoziation. Psychologische Forschung, 1 (1921), 191–302 und 2 (1922), 65–140. Kürzel L1922e
Zusammenfassung-Lewin1921/22
Beweis/Nachweis werden von Lewin 23 gebraucht, davon 9 "beweis"/Nachweis
im ersten Teil (1921), 14 im zweiten Teil (1922). Ich habe die ersten 9
Erwähnungen auf den über 100 Seiten des Ersten Teils erfasst.
Aber Beweis oder Nachweis werden an keiner Stelle, wie man es nach den
Regeln
für wichtigere Grundbegriffe erwarten könnte,
erklärt, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder
Literaturhinweis. Ich habe daher auf die Dokumentation des Zweiten Teils
verzichtet. Die Verwendung "deutlich" in (L1922e225) legt eine quantitative
Auffassung von Beweis nahe, was aber auch nicht erläutert wird. Lewin
äußert nur eine vage Beweisidee, liefert keine Beweisskizze
und führt die Beweise auch nicht durch (Checkliste-Beweisen).
Im wesentlichen bleibt es bei Erwähnungen und Behauptungen. Meine
Kritik
und Argumente gegen die 1917 vorgelegte Arbeit Lewin gelten auch
für die Arbeit 1921/22.
"beweis"-Fundstellen
im Textkontext im Ersten Teil (191-302)
23 Treffer, davon 9 "beweis"/Nachweis im ersten Teil, 14 im zweiten
Teil.
Abkürzungen
- Idt = Identifizierungsprozeß
g-Silben = Silben, die in einer Reihe auswendig gelernt sind,
n-Silben = neutrale Silben, die in der Regel gelesen waren.
U = Umstellen
u-Silben = neue Silben zum Einüben des U.
L1922e217: "... Nimmt man an, daß das innere Umstellen
und der Idt-Prozeß in Wirklichkeit nie gleichzeitig
neben einander laufen
können, ohne sich zu stören und zu verlangsamen — eine Annahme,
die
allerdings noch durchaus eines 1BeweisesBEnbedürfte
—, so wäre zu er-
warten, daß die größere Geläufigkeit der g-Silbentrotz
der bestehenden [>218]
Assoziationen sogar eine kürzere U-Zeit dieser
Silben als der n-Silben
nach sich ziehen müßte. In der Tat geht der Unterschied
der Reaktions-
zeit der n- und g-Silben
der 1. U-Hemnmngsreihe, wenn man ihn überhaupt
beachten will, in dieser der Annahme der Assoziationstheorie
entgegengesetzten Richtung."
- RS-LWPW217: Beweis wird erwähnt, aber nicht erklärt, auch
nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literatur-
hinweis.
L1922e225: "In den Ergebnissen des 19. Versuchstages seien zunächst die
Selbstbeobachtungsangaben beim U der 12 u-Silben, das wie am Vortage
nach dem 10maligen Lesen der Reihen der Gruppe a vor dem
Darbieten der U-Hemmungsreihen stattfand, mitgeteilt, da sie einen
deutlichen 2Beweis dafür liefern, daß die Idt-Prozesse nicht als Folge
der durch das Lernen gestifteten Assoziationen der einzelnen 280mal
wiederholten g-Silben anzusehen sind. ..."
- L1922e225: Beweis wird erwähnt, aber nicht erklärt,
auch
nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literatur-
hinweis. Die Verwendung "deutlich" legt eine quantitative Auf-
fassung von Beweis nahe.
L1922e236: ".... Die Gleichartigkeit des Wiederauftauchens früherer
Vorstellungen einerseits mit dem Wiederausführen vorhergegangener
Tätigkeiten andererseits ist jedoch nicht 3erwiesen; d. h. es ist noch
nicht der 4Beweis dafür erbracht, daß beide Vorgänge den gleichen
Gesetzen unterstehen. ..."
- RS-LWPW226: Beweis wird erwähnt, aber nicht erklärt, auch
nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literatur-
hinweis.
L1922e257.1: "2) Die Versuchsergebnisse und das Grundgesetz der Assoziation,
a) Das Ausbleiben der „reproduktiv-determinierenden" Verzögerung.
Wider Erwarten waren die durch die einzelnen Assoziationen der
dargebotenen Silbe bedingten Zeitverlängerungen ausgeblieben, d. h.
jene Erscheinung, die Ach als ,,reproduktiv-determinierende Hemmung"
bezeichnet und deren Untersuchung vor allem die Arbeit Glässners
(1912) gewidmet ist. Daß es sich bei diesem Ausbleiben nicht um eine
zufällige Erscheinung handelt, 5beweist die sehr gute Übereinstimmung
aller drei Vpnen.
- RS-LWPW257.1: Beweis wird erwähnt, aber nicht erklärt, auch
nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literatur-
hinweis.
L1922e257.2: "Zunächst sei betreffend der Termini folgendes bemerkt: Es scheint
mir notwendig zu sein, den Begriff der „Hemmung'' von dem der „Ver-
zögerung'' im Sinne einer relativen Zeitverlängerung zu trennen. Denn
es kommen ganz beträchtliche relative Zeitverlängerungen vor, ohne daß
ein subjektives Hemmungserlebnis auftritt, und es wäre durchaus noch
zu 6beweisen, daß die Hemmungserlebnisse lediglich auf dieselben
Ursachen zurückzuführen sind wie die Verzögerungen, und für sie
nicht etwa besondere Bedingungen erfüllt sein müssen. Um unnötige
Hypothesen bei der Beschreibung zu vermeiden, sei das subjektive
Hemmungserlebnis von der objektiven Zeitverlängerung unterschieden
und der Terminus ,,Hemmung" für das Erlebnis reserviert, während
als Bezeichnung der objektiven Zeitverlängerung der Terminus ,,Verzögerung"
benutzt werde, so daß z. B. von der ,,reproduktiv-determinierenden
Verzögerung" zu sprechen sein wird."
- RS-LWPW257.2: Beweis wird erwähnt, aber nicht erklärt, auch
nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literatur-
hinweis.
L1922e258: "Den Umstand, daß eine Vp eine Reihe von Silben frei aufzusagen vermag,
pflegt man bereits als 7Beweis einer recht beträchtlichen Assoziation
zwischen den einzelnen Silben dieser Reihe anzusehen, da man das
Nennen der nächsten Silben auf die durch die Assoziationen verursachte
Tendenz zurückführt. ..."
- RS-LWPW258: Beweis wird erwähnt, aber nicht erklärt, auch
nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literatur-
hinweis.
"Sofern sich die Tendenz der Assoziation gegen die durch eine Absicht
hervorgerufene Tendenz zu einer bestimmten Tätigkeit (heterogene
Tätigkeit) richtet, sind mit dem Auffassen der Reizsilbe also die Bedingungen
für das Eintreten einer reproduktiv-determinierenden Verzögerung
gegeben. Das tatsächliche Bestehen einer derartigen Verzögerung,
wie sie Ach und Glässner 8nachzuweisen versucht haben,
war also mit dem Begriff der Assoziation als sehr wahrscheinlich
nahegelegt. Denn das Ausbleiben einer derartigen Verzögerung
würde zu der auffallenden Konsequenz führen, daß die von der
Assoziation ausgehende Tendenz zur Reproduktion durch die Absicht
zu heterogenen Tätigkeiten ganz ausgeschaltet wird resp. sich heterogenen
Tätigkeiten gegenüber nicht als Verzögerung bemerkbar macht.
Trotzdem sind bereits von anderer Seite1) Einwände gegen die eindeutige
9Beweiskraft der Versuche Achs für das Bestehen einer reproduktiv-
determinierenden Verzögerung erhoben worden, und wenn
auch Glässner einen Teil der diese Einwände begründenden Versuchs-
umstände bei seinen Versuchsreihen ausgeschaltet hat, so zeigt doch
gerade die hier vorliegende Versuchsreihe, wie wenig man ohne genügende
Selbstbeobachtung das Nichtbestehen von Nebentendenzen, die vom
Vleiter nicht beabsichtigt sind, sicherstellen kann. Das Ausbleiben der
Verzögerung bei der Vp A kann man überdies nicht als einen Zufall
ansprechen, da es ja auch bei den beiden anderen Vpen auftritt, und die [>259]"
- RS-LWPW259: Nachweis/Beweis wird erwähnt, aber nicht erklärt,
auch
nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis.
| Nachdem im Ersten Teil auf über 100 Seiten bei den 9 Erwähnungen zu Beweis/Nachweis von Lewin nicht erklärt wird, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis, was er unter Beweis versteht, gehe ich nicht davon aus, dass Lewin das im Zweiten Teil leistet. Daher verzichte ich auf weitere Dokumentation der Erwähnungen. |
Beweisthema bei Lewin
KLW2, S.361: Erfahrung und Experimente begründen empirische Beweise
"Die Richtigkeit dieser obersten, inhaltlichen Sätze wird jedoch
nicht anders bewiesen als die Richtigkeit
irgendwelcher abgeleiteter Sätze: nämlich durch Erfahrung, insbesonders
durch Experimente. Jeder empirische Beweis
der Richtigkeit eines abgeleiteten Satzes ist zugleich ein Baustein zum
Beweis
der Richtigkeit des obersten Gesetzes. ..."
Kurt Lewin (1933) Eine dynamische Theorie des Schwachsinnigen*
S.7: "Sowohl die experimentellen Ergebnisse wie die Beobachtungen des
täglichen Lebens scheinen
also gleich eindringlich durchaus Widersprechendes
zu beweisen: einerseits zeigt der Schwachsin-
nige eine besondere Starrheit und Fixiertheit, die es nur sehr schwer
zu Ersatzhandlungen im funk-
tionellen Sinne kommen läßt, andrerseits ergibt sich eine
ausgeprägte Tendenz zu Ersatzhandlun-
gen und ein extrem leichtes Sichzufriedengeben mit ihnen. Dabei handelt
es sich nicht etwa um ver-
schiedene Gruppen von Kindern, sondern beide Extreme sind für
ein und dasselbe Kind kennzeich-
nend."
https://th-hoffmann.eu/archiv/lewin/lewin.1933.pdf
Digitalisierte Fassung von Thomas Hoffmann (2001). Quelle (Seitenabgaben
in eckigen Klammern): Kurt Lewin,
1982: Werkausgabe. Bd. 6: Psychologie der Entwicklung und Erziehung.
Hrsg. von Franz E. Weinert/Horst Gund-
lach. Bern/Stuttgart (Huber/Klett-Cotta), S. 225-266.
_
Ach-Lewin-Kontroverse in den Fachmedien und im Internet
_
DORSCH Lexikon der Psychologie (Abruf 14.09.2023)
"Suchresultate für "ach-lewin-kontroverse"
0 Ergebnisse "
_
Spektrum-Lexikon-Psychologie (Abruf 14.09.2023)
"Ach-Lewin-Kontroverse, Bezeichnung für die unterschiedliche Interpretation von Ergebnissen mit der Methode des Paar-Assoziations-Lernens. Kurt Lewin bezweifelte die Interpretation der Ergebnisse von Narziß Ach, daß es bei heterogener Tätigkeit notwendigerweise zum Konflikt zwischen determinierender Tendenz, d.h. der neuen Aufgabenstellung und einer assoziativen Reproduktionstendenz komme, die auf der gelernten Silbenassoziation beruht."
_
Psychologie48-Lexikon (Abruf 14.09.2023)
(http://psychology48.com/deu/d/ach-lewin-kontroverse/ach-lewin-kontroverse.htm)
"Ach-Lewin-Kontroverse, Bezeichnung für die unterschiedliche Interpretation von Ergebnissen mit der Methode des Paar-Assoziations-Lernens. Kurt Lewin bezweifelte die Interpretation der Ergebnisse von Narziß Ach, daß es bei heterogener Tätigkeit notwendigerweise zum Konflikt zwischen determinierender Tendenz, d.h. der neuen Aufgabenstellung und einer assoziativen Reproduktionstendenz komme, die auf der gelernten Silbenassoziation beruht."
_
ChatGPT: Ach-Lewin-Kontroverse: Auskunft vollkommen daneben
https://chat.openai.com/c/ab172fb7-14d1-4210-8f3d-6b27b5633aa0 3.5 Abruf 14.09.2023
"Die Ach-Lewin-Kontroverse bezieht sich auf einen wichtigen wissenschaftlichen
Disput in der Psychologie des frühen 20. Jahrhunderts zwischen Wolfgang
Köhler und Edward C. Tolman auf der einen Seite sowie John B. Watson
und Ivan Pavlov auf der anderen Seite. Der Konflikt drehte sich um die
Interpretation von Lernprozessen bei Tieren und die Rolle von inneren mentalen
Prozessen in der Psychologie.
Hier sind die wichtigsten Aspekte dieser Kontroverse:
- Behaviorismus vs. Gestalt-Psychologie: Auf der einen Seite standen Wolfgang Köhler und Edward C. Tolman, die der Gestalt-Psychologie nahestanden. Sie argumentierten, dass das Verhalten von Tieren nicht nur durch äußere Reize und Reflexe erklärt werden könne, sondern dass auch innere mentale Prozesse wie Einsicht und kognitive Karten eine wichtige Rolle spielten.
- S-R-Theorie: John B. Watson und Ivan Pavlov vertraten die S-R-Theorie (Stimulus-Reaktion-Theorie), die besagte, dass das Verhalten von Tieren ausschließlich durch Reiz-Reaktions-Verbindungen erklärt werden könne. Sie betonten, dass innere mentale Prozesse in der Psychologie keine Rolle spielen sollten.
- Das Rattenlabyrinth-Experiment: Ein entscheidender Punkt in dieser Kontroverse war das Rattenlabyrinth-Experiment von Tolman. Er fand heraus, dass Ratten, die wiederholt in ein Labyrinth gesetzt wurden, eine "kognitive Karte" des Labyrinths entwickelten und nach einer gewissen Zeit den kürzesten Weg zur Belohnung finden konnten, selbst wenn sie zuvor nicht belohnt worden waren. Dies deutete darauf hin, dass die Ratten mentale Prozesse nutzten, um ihr Verhalten anzupassen.
- Widerlegung des reinen Behaviorismus: Die Ergebnisse von Tolman und Köhler, sowie spätere Forschung, trugen dazu bei, den strikten Behaviorismus von Watson und Pavlov zu widerlegen und die Anerkennung der Rolle von kognitiven Prozessen in der Psychologie zu fördern.
Letztendlich führte die Ach-Lewin-Kontroverse dazu, dass die
Psychologie einen breiteren Ansatz zur Erforschung des Verhaltens und der
mentalen Prozesse von Menschen und Tieren entwickelte. Die Idee, dass kognitive
Prozesse eine wichtige Rolle bei der Erklärung von Verhalten spielen,
wurde in der Kognitiven Psychologie weiter erforscht und anerkannt."
_
Ach
- Ach, Narziß (1935) Analyse des Willens. Berlin: Urban & Schwarzenberg.
Vorbemerkung: Der Arzt und Psychologe Narziß war überzeugter Nazi , aber doch auch ein guter Psychologe, worauf es hier ankommt. In seiner Erwiderung auf Lewins Kritik habe ich nichts Ideologisches gefunden. Es ist eine sachlich-psychologische Auseinandersetzung sogar mit anerkennenden Zügen wie z.B. A1935-336 "K. Lewin gebührt das Verdienst, ..."
_
Suchwort "Lewin" in Ach 1935:
Im Inhaltsverzeichnis
- IV. Die noch nicht realisierte Determination (unvollendete Handlung,
unter¬
brochene Handlung), Ersatzhandlung (Lewin, Zeigarnik, Schlote,
Sandvoß, Ovsiankina, Lissner, Mahler, Brown). 169
§ 13. Abänderungen des kombinierten Verfahrens (Selz, Lüderitz, Gläßner, Rux,
Bournau, E. Müller, Lewin, Simoneit, Lindworsky). 203
§ 23. Über Sättigung und Übersättigung (K. Lewin, A. Karsten). 336
Im Sach- und Namensverzeichnis:
- Lewin K. 169,174,176,179, 184, 213,
215 f., 237, 336, 410.
Im Text gibt es zu "Lewin" 28 Treffer:
Kurzüberblick
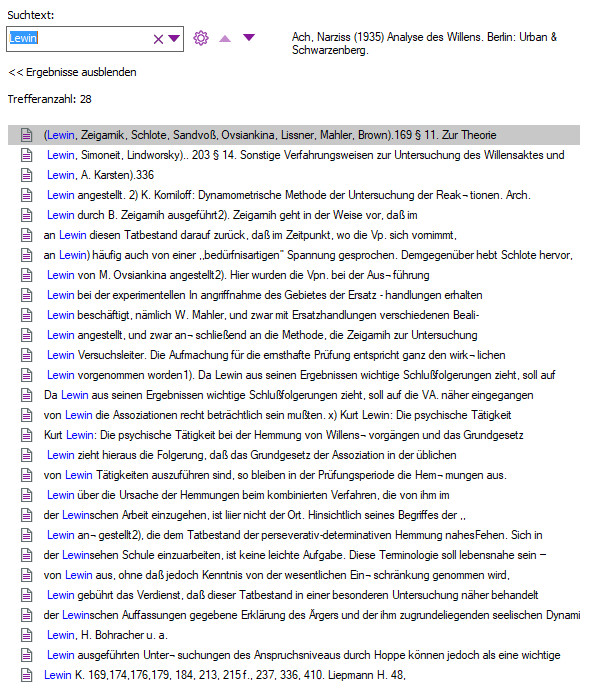
Anmerkung zur Markierung; Nachdem Ach gesperrt und fett nebst kursiv setzt, ist die Sperrung hier beibehalten worden.
_
A1935-139-Fußnote
1) Günter Voigt: Über die Richtungspräzision einer Fernhandlung. Psychology. Forschung. ff. 70 ff. (1932). Die Versuche wurden unter Leitung von K. Lewin angestellt.
_
A1935-169: "Es sind Methoden ausgebildet worden, welche den Zweck haben, den Tatbestand der noch nicht realisierten Determination einer näheren Untersuchung zu unterziehen. Die ersten derartigen Untersuchungen wurden unter der Leitung von K. Lewin durch B. Zeigarnik ausgeführt2). "
_
A1935-174: "Zeigarnik führt im Anschluß an Lewin diesen Tatbestand darauf zurück, daß im Zeitpunkt, wo die Vp. sich vornimmt, auf Grund der Instruktion die Aufgabe auszuführen, ein ,,Quasibedürfnis” entsteht, das von sich aus zur Erledigung der Sache drängt."
_
A1935-175: "So wird von Zeigarnik (anschließend an Lewin) häufig auch von einer ,,bedürfnisartigen” Spannung gesprochen."
_
A1935-176: "Untersuchungen über die Wiederaufnahme unterbrochener Handlungen wurden ferner unter Leitung von K. Lewin von M. Ovsiankina angestellt2)."
_
A1935-179: "Von diesem Standpunkte der Determinationspsychologie aus müssen demgemäß auch die Ergebnisse von weiteren Untersuchungen betrachtet werden, die unter Leitung von K. Lewin bei der experimentellen Inangriffnahme des Gebietes der Ersatzhandlungen erhalten wurden. So zunächst die Untersuchungen von K. Lissner2). Hier sollte die Frage des Ersatzwertes der Ersatzhandlung in den Mittelpunkt der Untersuchung gerückt werden."
_
A1935-180: "Mit der Untersuchung der Ersatzhandlung hat sich gleichzeitig eine weitere Schülerin von K. Lewin beschäftigt, ..."
_
A1935-184.1: "... Die Versuche wurden ebenfalls unter Leitung von K. Lewin angestellt, und zwar anschließend an die Methode, die Zeigarnik zur Untersuchung des Behaltens von erledigten und unerledigten Handlungen verwendet hat. ..."
_
A1935-184.2 "Um die Ernsthaftigkeit der Prüfung zu erhöhen, war Prof. Lewin Versuchsleiter."
_
A1935-213: "Eine bemerkenswerte Abänderung des kombinierten Verfahrens ist von K. Lewin vorgenommen worden1). Da Lewin aus seinen Ergebnissen wichtige Schlußfolgerungen zieht, soll auf die VA. näher eingegangen werden. Der wichtigste Unterschied liegt in der Einübungsperiode (1. Abschnitt), bei der die Silbenreihen nicht gelesen und eingeprägt, sondern T ä t i g k e i t e n an ihnen vorgenommen werden. Dieser scheinbar geringfügige Umstand hat zu einer wesentlichen Änderung des Ablaufes des seelischen Vorganges geführt, wie gleich hier bemerkt werden soll. Die Anordnung ist folgende:
,,Die Silben werden in Reihen zu zwölf Silben visuell sukzessiv durch einen Apparat mit ruckweiser Vorwärtsbewegung dargeboten in einem Tempo, das der Vp. ein bequemes Mitkommen gestattet. Vor jeder Reihe erhält die Vp. die Instruktion R (Reimen) oder U (Umstellen). Dargeboten werden im ganzen 24 verschiedene Silben. Sechs von diesen Silben kommen nur in Reihen vor, bei denen die Instruktion R erteilt wird (konstante Reimsilben = cr- Silben), sechs andere Silben (cu-Silben) nur in Reihen, bei denen umgestellt wird. Von den übrigen zwölf Silben kommt jede abwechselnd einmal beim Reimen, das andere Mal in einer Umstellungsreihe vor, so daß auf jede Silbe abwechselnd gereimt und umgestellt wird (variierende Silben = v-Silben). Es gibt also 6 cr- Silben, 6 cu-Silben und 12 v-Silben” (a. a. O. S. 216). Als Anfangs konsonanten der dreibuchstabigen Silben (pal) wurden lediglich b, p, g, k, d," t verwandt. Von den Vokalen wurde i nicht verwandt. Das Reimen war eindeutig bestimmt, da an Stelle eines harten Konsonanten immer der entsprechende weiche zu treten hatte und umgekehrt. Beim Mittelreimen (MiR), das bei einzelnen Anordnungen außerdem noch benutzt wurde, war der Vokal bzw. Diphthong durch ein i zu ersetzen.
Die cr-Silben und die cu-Silben werden je 250mal gereimt bzw. umgestellt. Jede v-Silbe 125mal gereimt und 125mal umgestellt. Die Wiederholungen erstreckten sich über 20 Versuchstage innerhalb von sechs Wochen, so daß infolge der Verteilung der Wiederholungen nach der Auffassung von Lewin die Assoziationen recht beträchtlich sein mußten.
_
1) Kurt Lewin: Die psychische Tätigkeit bei der Hemmung von Willensvorgängen und das Grundgesetz der Assoziation. Zeitschr. Psychol. 77. 212 ff. (1917) Das Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der Assoziation I. Psychol. Forsch. 1. 191 ff. (1922); Das Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der Assoziation II. Psychol. Forsch. 2. 75 (1922)."
_
[>214]
_
Bei der P r ü f u n g wurden die Silben nicht einzeln (wie beim kombinierten Verfahren), sondern in Reihen geboten z. B.:
er v cu er v cu er v cu er v cu.
Vor solchen Prüfungsreihen wurde abwechselnd die Instruktion R oder die Instruktion U gegeben (mit Messung der Reaktionszeiten).
E r g e b n i s: Entgegen der Erwartung sind in allen drei Gruppen von Silben die Reaktionszeiten die gleichen geblieben. Es ist also weder zu Hemmungen noch zu Bahnungen gekommen.
M. Simoneit hat diese Versuche nachgeprüft und das gleiche Resultat erhalten1), d. h. also unter den vorliegenden Bedingungen kommt es trotz angeblicher Assoziationsbildung zu keinen Hemmungserscheinungen. Lewin zieht hieraus die Folgerung, daß das Grundgesetz der Assoziation in der üblichen Fassung nicht richtig sein kann. In der Zwischenzeit haben andersartige Untersuchungen ergeben, daß, wenn Tätigkeiten ausgeführt werden, wie im vor liegenden Falle in der Einübungsperiode in der Tat keine merkbaren Assoziationen zwischen konkreter Bezugsvorstellung (Reizsilbe) und determinierter Vorstellung (Reaktionssilbe) gestiftet werden2). Nur wenn die vorherige Absicht darauf gerichtet ist, solche Assoziationen zu stiften, was beim Lernen oder Einprägen der Fall ist, werden auch bei Tätigkeiten Assoziationen gestiftet. Eine derartige Ganzheitsbindung, wie sie z. B. beim Lernen in Gestalt der Komplexbildung die Regel ist, bildet demnach die notwendige Bedingung für die Stiftung von Assoziationen. Insofern bedarf also das ursprüngliche Assoziationsgesetz in der Tat einer Einschränkung.
In Rücksicht auf das kombinierte Verfahren ist die Folgerung zu ziehen, daß jede Abänderung, mag sie zunächst auch unbedeutend erscheinen, die Anwendung des Verfahrens sachlich unmöglich macht, sofern sie die notwendige Voraussetzung, nämlich die Stiftung von hinreichend starken Assoziationen, zunichte macht.
M. Simoneit hat in seiner Anordnung I durch die Zusatzinstruktion „es kann eine Prüfung Ihres Lesens erfolgen”, die durch gelegentliche Prüfungen kontrolliert wurde, die Stiftung entsprechend starker Assoziationen erreicht, so daß in der Prüfungsperiode bei heterogenen Tätigkeiten s t a r k e H e m m u n g e n.
_
1) M. Simoneit: Willenshemmung und Assoziation. Zeitschr. Psychol. 100. 161 ff. (1926).
2) Vgl. z. B. II. Gerdessen: Die Einwirkung der Willensbetätigung auf die Eigenschaften der Bezugsvorstellungen. Arcli. ges. Psychol. Erg.-Bd. 2. 41 f., 94 (1930). Die Befunde von Gerdessen sind durch weitere, im Göttinger Institut mit anderen Anordnungen ausgeführte Versuche wiederholt bestätigt worden.
_
[>A1935-215]
_
zur Beobachtung kamen. Wird die erwähnte Zusatzinstruktion dagegen gegeben, wenn in der Einübungsperiode nicht wie bei diesen Versuchen nur Darbietungsreihen, also zum Lesen, geboten werden, sondern wenn im Sinne von Lewin T ä t i g k e i t e n auszuführen sind, so bleiben in der Prüfungsperiode die Hemmungen aus. Die Instruktion wird nicht in dem Sinne aufgefaßt, daß die Silben eines Paares als zusammengehörig zu behalten sind, sondern die Aufmerksamkeit wird auf die einzelnen Silben als solche gelenkt. Das geht auch aus den Angaben der Vpn. hervor, welche beim Reimen vor allem den Anfangskonsonanten, beim Umstellen zunächst den Endkonsonanten beachten. Außerdem werden die ersten und letzten Silben jeder Reihe in der Regel besonders bevorzugt. Merkbare Assoziationen werden also auch in diesen Fällen nicht gestiftet.
Dagegen gelang es Simoneit mit Hilfe von permutierten Tätigkeitsreihen in der Einübungsperiode wieder starke Asso¬ ziationen zu stiften und infolgedessen in der Prüfungsperiode starke Hemmungen bei den heterogenen Tätigkeiten hervorzurufen. Diese Anordnung III von Simoneit bildet infolgedessen eine wichtige Modifikation des kombinierten Verfahrens. Die Tatsache, daß auch durch die Ausübung von Tätigkeiten starke Assoziationen gestiftet werden, scheint zu unseren obigen Darlegungen zunächst in einem Widerspruch zu stehen. Simoneit hebt hervor, daß durch die neue Anordnung eine Reihe von verschleiernden Einflüssen beseitigt wird, die der Lewinschen Anordnung anhaften, so die Einstellung auf den Anfangs- bzw. Endkonsonanten bei den Tätigkeiten der Einübungsperiode, die Zurückdrängung assoziierter Eindrücke durch eine latente Determination auf die Tätigkeit schlechthin in der Hauptperiode, die geringe Aufmerksamkeitsinanspruchnahme in der E i n ü b u n g s p e r i o d e bei der Lewinschen Anordnung gegenüber der per mutierten Anordnung von Simoneit, wo die Vpn., wie schon der äußere Eindruck zeigt, s i c h a u ß e r o r d e n t l i c h a n s t r e n g e n m ü s s e n. Denn hier wechseln die Tätigkeiten am Serienapparat in ununterbrochener Folge, ebenso die verschiedenen Arten der Silben. Die drei Tätigkeiten wurden dabei durch ihre Symbole KR, U und AR bezeichnet1). Diese waren über jeder einzelnen Reizsilbe angegeben. Außerdem wurde noch die Zusatzinstruktion gegeben: ,,Es wird eine Kontrolle der Ausführung Ihrer Tätigkeit erfolgen.” Daß bei dieser permutierten Ausführung der Tätigkeiten starke Assoziationen gestiftet werden, zeigte sich unter anderem auch bei E r g ä n z u n g s v e r s u c h e n, bei denen z. B. am vierten Versuchstage die Tätigkeitsreihe ohne die Symbole der jeweiligen Tätigkeiten dargeboten wurde, so daß
- 1) Vgl. Simoneit: a. a. 0. S. 209 ff.
[>A1935-216]
_
also die Reihe nur aus Reizsilben in den bisherigen Permutationen bestand.
Die Vp. erhielt die Instruktion: ,,Führen Sie an den erscheinenden
Silben dieselben Tätigkeiten durch, die in den bisherigen Wiederholungen
an diesen Silben durchgeführt wurden!”, eine Aufgabe, die von den
Vpn. sofort fehlerlos gelöst wurde. Die Vpn. erklärten, ,,daß
die bisher durch die Tätigkeiten geschaffenen Silben ihnen von selbst
kämen.”
Die Ursache, warum es hier
trotz der Verwendung von Tätigkeiten zu so starken Assoziationen kommt,
liegt vor allem darin, daß die Stiftung von Assoziationen eine wesentliche
Hilfe für die schwierige Tätigkeit der Einübungsperiode
mit ihrer starken und dauernden Inanspruchnahme der Aufmerksamkeit bildet.
Die Vp. sucht sich diese Tätigkeiten selbstverständlich anzueignen,
und das einfachste Mittel dies zu erreichen, liegt in dem Einprägen
der Reizsilbe und der zugehörigen, durch die Tätigkeit geschaffenen
Reaktionssilbe. Denn jede Permutationsgruppe mit den 15 Reizsilben wird
für die gleiche Tätigkeit täglich zehnmal wiederholt, so
daß die gedächtnismäßige Zuordnung zwischen der Reiz-
silbe und der zugehörigen Reaktionssilbe zugleich eine wesentliche
Hilfe für die rasche und gute Ausführung der Tätigkeiten
in der Einübungsperiode bildet. So wird durch das permutierte Verfahren
indirekt zugleich das Einprägen der Silbenpaare bewirkt, so daß
es, trotzdem Tätigkeiten ausgeführt werden, zur Stiftung starker
Assoziationen kommt, die dann dem Sinne des kombinierten Verfahrens entsprechend
bei den heterogenen Tätigkeiten der Prüfungsperiode in gesetzmäßiger
Weise zu starken Hemmungen Veranlassung geben.
Mit diesen Feststellungen
entfallen auch die Ausführungen von K. Lewin
über die Ursache der Hemmungen beim kombinierten Verfahren, die von
ihm im wesentlichen auf die Identifikation der Reizsilbe zurückgeführt
werden, d. h. auf die Feststellung, welcher Art die betreffende Silbe angehört,
ob sie zu den cr-Silben, den cu-Silben oder den v-Silben gehört. Eine
derartige Identifikation hat bei der besonderen Anordnung von Lewin
nahegelegen und sie konnte als Mittel zur sicheren Ausführung der
Tätigkeiten der Prüfungsperiode dienen. Bei den Versuchen nach
dem echten kombinierten Verfahren kommt sie jedoch kaum zur Beobachtung.
Das gleiche gilt für die von Selz herangezogene Vergewisserung vonseiten
der Vp., z. B. ob die erscheinende Silbe eine für die Aufgabelösung
passende Silbe ist oder nicht1). All das sind Nebenerscheinungen, welche
bei einzelnen Vpn. gelegentlich als Hilfen auftreten können, die aber
mit dem Wesen der Hemmung
_
- 1) O. Selz: Die experimentelle Untersuchung des Willensaktes,
a. a. 0. S. 256.
[>A1935-217]
_
selbst nichts zu tun haben, sondern im Gegenteil determinierte Mittel sind, diesen Hemmungsvorgang zu umgehen1).
Auch derartige Erlebnisse der Prüfungsperiode lassen sich ausschalten, und zwar auf einem ähnlichen Wege, wie ihn Simoneit bei der permutierten Anordnung für die Tätigkeiten der Einübungsperiode eingeschlagen hat, nämlich dadurch, daß die Versuche der Prüfperiode ebenfalls unter dauernder und starker Anspannung der Vpn. vor sich gehen. Derartige Versuche sind an Hand des Serienapparates zu besonderen Zwecken unter meiner Leitung von TT. Möller durchgeführt worden. Sie zeigten den Hemmungsvorgang in ausgeprägter und reiner Weise (siehe auch VII. Kapitel).
Aus den Darlegungen geht hervor, daß das kombinierte Verfahren nicht bloß zur Hervorrufung des Willensaktes und der vollständigen Willenshandlung einschließlich der interessanten Hemmungs- und Bahnungsphänomene Anwendung finden kann, sondern auch zur Untersuchung der Frage, ob unter bestimmten Bedingungen A s s o z i a t i o n e n von merkbarer Stärke gestiftet werden oder nicht, als Index mit herangezogen werden kann.
Bei der lebhaften Diskussion, welche das kombinierte Verfahren auslöste, hat endlich noch ein Umstand eine Rolle gespielt, nämlich die Art, wie die F e h l h a n d l u n g e n (FR.), insbesondere die intendierten Fehlreaktionen (i.FB.) zu erklären seien, eine Frage, die den Autoren besonders am Herzen liegt, denen eine ,,natürliche” Erklärung der i.FB. verschlossen ist, da sie den Sinn des kombinierten Verfahrens nicht erfaßt haben bzw. die eigenartige Wirksamkeit der Determination nicht anerkennen. E. Müller2) hat in der obenerwähnten Arbeit 134 intendierte Fehlreaktionen, die er bei 1874 Reaktionen erhielt, einer näheren Analyse unterzogen, um die Ursache ihrer Entstehung festzustellen. 79 oder 62% derselben hatten ihre Ursache in der Wirkung von entgegenstehenden Reproduktionstendenzen, 15 (12%) in der Wirkung von Perseverationstendenzen, .5 (4%) in einem schwachen Entschluß, 7 oder 6% in Nebengedanken, 13 (10%) in Ablenkung der Aufmerksamkeit und 9 (7%) in Eilfertigkeit. Gelegentlich können auch mehrere dieser Faktoren Zusammenwirken, so Ab lenkung der Aufmerksamkeit und assoziative Reproduktionstendenz. Nachweisbar rein ist die Reproduktionstendenz in 51 der 79 Fälle die Ursache der FBn. gewesen. Demgegenüber sucht Lindworsky den eigentlichen Grund der FBn. n i c h t in der Wirkung der Assoziation zwischen einer Reizsilbe und der dazu gelernten bzw.
_
1) Auf sonstige Darlegungen der Lewinschen Arbeit einzugehen, ist hier nicht der Ort. Hinsichtlich seines Begriffes der ,,Tätigkeitsbereitschaft” und insbesondere der Möglichkeit einer „automatischen Reproduktion“ sei auf die eingehende Untersuchung von F. Scola hingewiesen. Untersuchungen zur Frage <der automatischen Reproduktion. Arch. ges. Psychol. 75. 23 ff. (1930).
2) E. Müller: a. a. 0. S. 77 ff.
_
[>A1935-218]
_
ausgesprochenen Silbe, sondern er macht für ihr Zustandekommen im wesentlichen das ,,Hineingleiten in die Situation des Lernkomplexes” verantwortlich1). Dieser Tatbestand ist als eine Perseveration der homogenen Tätigkeiten, also der in der Einübungsperiode an den Silben schon ausgeführten Tätigkeiten einschließlich der Reproduktion aufzufassen. Wenn aber diese Perseveration (Hineingleiten) der wesentliche Grund für das Entstehen der i.FBn. wäre, dann dürften in einer VA., die diese Tätigkeiten nicht ausführen läßt, wo also homogene Tätigkeiten ausgeschaltet sind, keine FBn. mehr Vorkommen. Von diesem Gedankengang ausgehend, hat E. Müller eine besondere Versuchsanordnung auf- gebaut (mit fünfbuchstabigen Silben). Auch bei einer solchen Anordnung des kombinierten Verfahrens kamen i.FB., und zwar in einem relativ hohen Prozentsatz zur Beobachtung. Daraus folgt, daß eine Perseveration des Komplexes der Lernsituation nicht die eigentliche Ursache der i.FBn. sein kann. Das Experiment hat also gegen Lindworsky entschieden. Es sind in erster Linie die gestifteten Assoziationen gewesen, welche zu den Fehlhandlungen führten. Selbstverständlich können aber andere Faktoren, wie Ablenkung, affektive Erregung, große Eile u. dgl., bei der Entstehung von falschen Handlungen mitwirken. Auch dieser Fall zeigt wieder, daß nur das Experiment es ist, dem die Entscheidung über strittige Fragen zukommt, daß es mit einem Male viele Seiten voll von unfruchtbaren Erläuterungen, wie wir sie gerade in der erwähnten Schrift von Lindworsky finden, über den Haufen wirft.
Als wesentliche Momente für das v e r s c h i e d e n a r t i g e V e r h a l t e n d e r P e r s o n e n bei Anwendung des kombinierten Verfahrens hebt E. Müller hervor: die s e n s o r i e l l e V e r a n l a g u n g, welche für das Einprägen wichtig ist, die i n t e l l e k t u e l l e S t e l l u n g n a h m e, welche bei der Aufgabelösung, z. B. durch Finden einer anderen, bequemeren oder auch eleganteren Lösungsform, in Betracht kommt, und drittens gewisse C h a r a k t e r- b z w. W i l l e n s e i g e n s c h a f t e n, worauf wir früher schon hingewiesen haben, so z. B. Ehrgeiz, Vorsicht, Gewissenhaftigkeit, Ausdauer.
_
[Es folgt §14]
_
A1935-237: Unter dem Gesichtspunkte der Analyse des Wollens wurden Untersuchungen über R ü c k f ä l l i g k e i t bei U m g e w ö h n u n g von G. Schwarz unter der Leitung von K. Lewin angestellt2), die dem Tatbestand der perseverativ-determinativen Hemmung nahestehen. Sich in die eigenartige Terminologie der Lewinschen Schule einzuarbeiten, ist keine leichte Aufgabe. Diese Terminologie soll lebensnahe sein — wenigstens im Ausdruck —, verliert aber durch die Vieldeutigkeit der sprachlichen Bezeichnungen leider viel an wissenschaftlicher Klarheit. In der Einleitung geht Schwarz von den oben bereits behandelten Versuchen von Lewin aus, ohne daß jedoch Kenntnis von der wesentlichen Einschränkung genommen wird, welche diese Versuchsergebnisse insbesondere an Hand der Versuche von Simoneit erfahren haben (vgl. § 13). Seine Untersuchungen beschränken sich auf die „A u s f ü h r u n g s g e wo h n h e i t e n”. Gegenüber der Umstellung, wo ganz verschiedene Tätigkeiten einander folgen (so Schreiben und Rechnen), spricht Schwarz von U m g e w ö h n u n g nur dann, wenn die zweite Tätigkeit lediglich eine U m f o r m u n g der
_
1) Vgl. N. Ach: Beiträge zur Lehre von der Perseveration. Erg.-Bd. 12 der Zeitschr. Psychol. § 12 (1926).
2) Georg Schwarz: Über Bückfälligkeit bei Umgewöhnung. 1. Teil. Rückfalltendenz und Verwechslungsgefahr. Psychol. Forsch. J). 86 ff. (1927).
_
[>238] ersten ist. Mit dieser Umgewöhnung haben sich bereits die Amerikaner Bergström,, Bair, Culler und Brown in besonderen Untersuchungen beschäftigt, ohne aber auf die q u a l i t a t i v e Analyse der Handlungen, die für die Feststellung der Natur der Gewöhnung besonders wichtig ist, näher eingegangen zu sein.
_
A1935-336: § 23.
Über Sättigung und Übersättigung.
Die in diesem Kapitel behandelten Willenserscheinungen, welche die Änderung derselben durch Übung bzw. Wiederholung betreffen, können nicht abgeschlossen werden, ohne noch auf einen psychologisch interessanten Tatbestand hingewiesen zu haben, der zu dem Monotonieproblem (§ 20) in Beziehung steht, nämlich die p s y c h i s c h e S ä t t i g u n g bzw. Ü b e r s ä t t i g u n g , die nicht selten im Anschluß an Handlungen auftritt, die immer und immer wieder ausgeführt werden. Die Tätigkeiten werden einem zum Überdruß. Es stellt sich Abneigung gegen dieselben mit starker Unlust ein. K. Lewin gebührt das Verdienst, daß dieser Tatbestand in einer besonderen Untersuchung näher behandelt wurde1), ohne daß allerdings, wie die Verfasserin der Arbeit am Schlüsse bemerkt, die Grundfrage der Sättigung, warum nämlich die Wiederholung eine zunächst angenehme oder gleichgültige Handlung unangenehm macht, einer Lösung zugeführt wenden konnte. ...
_
369: Auf Grund seiner Versuche konnte Sondergeld auch eine Würdigung der von ihm nachgeprüften Versuche von T. Dembo1) vornehmen und feststellen, daß die von Dembo im Sinne der Lewinschen Auffassungen gegebene Erklärung des Ärgers und der ihm zugrundeliegenden seelischen Dynamik den tatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht wird, insbesondere auch weil die grundsätzlich verschiedenen Verhaltungsweisen der konstitutionellen Typen keine Berücksichtigung gefunden haben.
_
A1935-388 Fußnote: 1) Diese Ausführungen gelten auch für andere Autoren, so z. B. für K. Lewin, H. Rohracher u. a.
_
A1935-410: Die unter der Leitung von K. Lewin ausgeführten Untersuchungen des Anspruchsniveaus durch H o p p e können jedoch als eine wichtige Bereicherung der Willenslehre bezeichnet werden, im besonderen auch der Motivation, da ja das Anspruchsniveau unter gewissen Bedingungen für das Willensverhalten des Menschen von ausschlaggebender Bedeutung ist.
_
A1935-457: Im Sach- und Namensverzeichnis: Lewin K. 169,174,176,179, 184, 213, 215 f., 237, 336, 410.
_
Ende der Stellungnahme Achs 1935
1931-Lewin (1890-1947) Lewin, Kurt (1931) Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Biologie und Psychologie. Erkenntnis Bd.1, 421-466.
Nach einem Vortrag am 4. Februar 1930 in der Gesellschaft für empirische Psychologie in Berlin. Die englische Übersetzung erschien 1931 im Journal of Genetic Psychology, Bd. 5, S. 141-177; ein Nachdruck erfolgte in A Dynamic Theory of Personality, Kap. 1 (New York/ London, McGraw-Hill, 1935); die französische Übersetzung erschien als Kap. 1 von Psychologie dynamique. Les relations humaines (Paris, Presses Universitaires de France 1959). Ein fotomechanischer Nachdruck erschien 1971 als Band 308 der Reihe Libelli in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt. Zuletzt Werkausgabe Bd. 1 Wissenschaftstheorie 1981, 233-271, im Anschluss Anmerkungen des Herausgebers.
ZL1931 Zusammenfassung-Lewins-wissenschaftstheoretische-Paradoxie
Kürzel
L1931]
ZL1931.1 Die 29-Seiten Arbeit aus dem
Jahre 1931 enthält folgende Fundstellen "begriff" 223, "dynam"
66 (70, erste 4 im Inhaltsverzeichnis), "beweis" 10,
"wissenschaftstheor"
5, "gesetz" 131.
ZL1931.2 Obwohl Lewin den Zustand der
Begriffsbildung in der Psychologie in seiner Einleitung ausdrücklich
- und zu Recht - beklagt und dies besonders am Begriff der Dynamik festmacht,
erklärt er diesen - für ihn persönlich wichtigen - Begriff
gar nicht, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder
Literaturhinweis. Das nenne ich paradox: nämlich genau das, was kritisiert
wird, selbst zu betreiben. Anscheinend kennt Lewin die Grundregel
für Begriffe - und auch Aristoteles
nicht - wichtigere Begriffe bei den ersten Erwähnungen zu definieren
oder zu erklären.
ZL1931.3 Das gilt auch für Wissenschaftstheorie,
Begriff und Beweis (die ich noch ausgewertet habe). In
allen 10 Fundstellen
wird Beweis nicht erklärt, auch nicht durch Querverweis, Fußnote,
Anmerkung oder Literaturhinweis.
ZL1931.4 Die Behauptung, "daß die
Frage der 2Dynamik gegenwärtig
unbestritten als der eigentliche Kern und die wichtigste Aufgabe der Psychologie
und Biologie angesehen wird, ..." wird nicht belegt wie er überhaupt
kaum belegt.
ZL1931.5 Lewins Zitierstil
ist ziemlich mangelhaft. Oft fehlen Seitenfundstellen. Aufgefallen
ist mir ein frühes Beispiel (1931!) für den Hochstaplerzitierstil.
ZL1931.Fazit Die grundsätzlich
wissenschaftstheoretisch interessante Arbeit wird in ihrer paradoxen Ausführung
ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht, und allgemein gesehen erst recht
nicht, was zum wissenschaftlich hochgebildeten Lewin nicht passt, aber
auch nicht zur ERKENNTNIS,
der Hauszeitschrift des Wiener Kreises. Insgesamt ein großangelegter
abstrakt-allgemeiner Entwurf zu wichtigen wissenschaftstheoretischen Themen,
der auf der Skizzenebene und beim Meinen
stehen bleibt, dem operationale Belege und Begründungen fehlen. Teilweise
verkennt Lewin Aristoteles und mehr Beachtung Zum
Geleit hätte dieser Arbeit sicher gut getan.
_
Fundstellen "begriff" 223, "dynam" 70,"beweis"
11, "wissenschaftstheor" 5.
Nach der Grundregel
für Begriffe, wonach wichtigere Begriffe einer wissenschaftlichen
Arbeit bei den ersten Erwähnungen definiert oder erklärt werden
sollten, werte ich nur die ersten drei Seiten und ein paar spätere
Kontrollen aus.
"Die 1Begriffsbildung der Biologie und Psychologie hat in den letzten beiden Jahrzehnten eine sehr tiefgreifende, zum Teil krisenhafte Wandlung durchgemacht. Die Diskussion stößt überall auf philosophische Fragen erkenntnistheoretischer, logischer und vor allem wissenschaftstheoretischer Natur. Die sich dabei ergebenden Schwierigkeiten sind nicht zuletzt deshalb so groß, weil Erkenntnistheorie und Wissenschaftslehre ihrem gegenwärtigen Entwicklungsstande gemäß bei der Beantwortung dieser konkreten Fragen notwendigerweise vielfach versagen. Denn diese Fragen lassen sich weder durch allgemeine, "philosophische" Gedankengänge beantworten, die keinen Kontakt mit der Sondernatur der verschiedenen Wissenschaften haben, noch dadurch, daß man die Unterschiede der Wissenschaften zwar berücksichtigt, sie aber zu einer "Heterogenität in jeder Hinsicht" übersteigert. Solche philosophischen Allgemeinheiten pflegen mehr zu schaden als zu nützen; denn sie verstärken nur die vielfachen philosophischen Vorurteile und Fesseln, die den Fortgang der betreffenden Wissenschaft einengen und die es gerade zu sprengen gilt.
Erst eine observative, vergleichende Untersuchung, die es ermöglicht, Parallelen oder Unterschiede von Wissenschaften aufzusuchen, ohne daß sogleich auf Identität oder auf vollkommene Verschiedenheit in jeder Hinsicht geschlossen wird, kann entscheidende Fragen der Wissenschaftslehre und die Fundamentalfragen der Einzelwissenschaften einer Erklärung näher führen. Eine solche Untersuchung im Sinne der vergleichenden Wissenschaftslehre hat die Wissenschaften nicht als logisch fixe, sondern als sich entwickelnde Gebilde aufzufassen, und sie wird sich vor allem hüten müssen, Verschiedenheiten der Entwicklungsstadien als Grundverschiedenheiten der betreffenden Wissenschaften anzusehen oder umgekehrt aus der Verwandtschaft wissenschaftstheoretisch äquivalenter Entwicklungsstadien verschiedener Wissenschaften auf eine Identität dieser Wissenschaften zu schließen.
Die folgende Untersuchung, die sich gleichermaßen an den Psychologen und Biologen wie an den Wissenschaftstheoretiker wendet, unternimmt eine solche vergleichende Gegenüberstellung der gegenwärtigen 2Begriffswandlung in Biologie und Psychologie mit gewissen Wandlungen der Physik, nämlich mit, dem Übergang von der aristotelischen zur galileischen 3Begriffsbildung. Im Mittelpunkt dieser Gedanken, die mir aus der konkreten psychologischen Forschungsarbeit im letzten Jahrzehnt erwachsen sind, stehen Fragen der 1Dynamik und zwar so, wie der Forscher diese Fragen sieht. Ihm kommt es ja nicht auf formalphilosophische Probleme in sich, sondern auf inhaltliche Erkenntnis einer Gegenstandswelt an. Philosophische Thesen haben für ihn letzten Endes nur insofern Interesse, als sie inhaltliche Thesen über die Welt dieser Untersuchungsobjekte mitenthalten oder sich in bestimmten praktischen Folgerungen für die Methode der Forschung, für die Art des 1Beweisganges oder für die konkrete Fragestellung äußern. Auch die Wissenschaftslehre wird, sofern sie als "empirische", nicht spekulative Wissenschaft auftreten will, gut daran tun, sich mehr an den in der tatsächlichen Forschungspraxis der Einzelwissenschaften implizit enthaltenen philosophischen Thesen zu orientieren, als an ihrer philosophischen "Ideologie."
Der Umstand, daß die Frage der 2Dynamik gegenwärtig unbestritten als der eigentliche Kern und die wichtigste Aufgabe der Psychologie und Biologie angesehen wird, daß insbesondere in der Psychologie der Terminus 3Dynamik fast schon zum Schlagwort zu werden droht, ist ein vielleicht primitives, aber handgreifliches Zeichen für die Art der Wandlung dieser Disziplinen, die noch vor nicht allzu langer Zeit als wesentlich beschreibende Wissenschaften galten.
Die Entwicklung der 4dynamischen Probleme scheint gegenwärtig wenn wir von der "Physik am Lebenden" absehen, in der Psychologie etwas weiter fortgeschritten zu sein, als in den übrigen Disziplinen der allgemeinen Biologie. Ich werde mich daher im folgenden der Kürze halber im wesentlichen auf die Psychologie beschränken, obschon sich die gleichen Entwicklungstendenzen auch sonst in der Biologie aufweisen lassen. [>3]
Ich habe nicht die Absicht, aus der Geschichte der Physik deduktiv zu schließen, was die Biologie tun "soll". Denn ich bin nicht der Meinung, daß es letzten Endes nur eine einzige empirische Wissenschaft, die Physik, gibt, auf die alle übrigen zurückgehen. Hier kann es offen bleiben, ob die Biologie und mit ihr die Psychologie auf Physik "zurückführbar" ist oder ob sie eine selbständige Wissenschaft ist.
Bei der Gegenüberstellung der aristotelischen und galileischen 4Begriffsbildung in der Physik kommt es uns naturgemäß weniger auf die persönlichen Nuancen der Theorie bei GALILEI und ARISTOTELES an als auf einige ziemlich massive Unterschiede der Denkweise, die für die tatsächliche Forschung der aristotelisch-mittelalterlichen und der nachgalileischen Physik maßgebend waren. Ob in einzelnen Punkten einzelne Forscher bereits spätere Gedankengänge vorweggenommen haben, ist in unserem Zusammenhang ohne Belang.
Ich betrachte zunächst einige wichtige allgemeine, Eigentümlichkeiten der aristotelischen und der galileischen 5Begriffsbildung in Physik und Psychologie, um dann speziell auf die 5dynamischen Grundvorstellungen einzugehen."
__
Ergebnis "dynam" : auf den ersten
drei Seiten gibt es fünf Erwähnungen "dynam". An keiner Stelle
wird erklärt, was darunter zu verstehen ist, auch nicht mit Querverweis,
Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweise. Sicherheitshalber und
aus Respekt gegenüber Lewin habe ich noch die Textkontexte aller Fundstellen
erfasst, um zu sehen, ob die eine oder Textstelle womöglich nähere
Erklärung verspricht:

__
Fundstellen
"beweis" im Textkontext
G e s p e r r t bei Lewin hier fett.
L1931B-Zusammenfassung-Beweis:
In allen 10 Fundstellen wird Beweis nicht erklärt, auch nicht durch
Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis. Teilweise
für mich unverständliche Argumentation, wahrscheinlich durch
die abstrakt-allgemeine Argumentation, ohne operationale Ausführungen,
Belegen und Begründungen.
_
L1931-422: "... Philosophische Thesen haben für
ihn letzten Endes nur
insofern Interesse, als sie inhaltliche Thesen
über die Welt dieser
Untersuchungsobjekte mitenthalten oder sich in
bestimmten
praktischen Folgerungen für die Methode
der Forschung, für die
Art des Beweisganges
oder für die konkrete Fragestellung äußern. ..."
- RS-L1931-422: Beweisgang unerläutert.
L1931-426: "Für die nachgalileische Physik erfüllt mit der Unter-
scheidung gesetzlicher und ungesetzlicher Vorgänge die Notwendig-
keit, jeweils besondere Beweise der Gesetzlichkeit des betreffenden
Vorganges zu geben. "
- RS-L1931-425: Beweise unerläutert. Begründung
fehlt.
L1931-429: "... Das heißt: die historische Zeitstrecke, für die die Kon-
stanz angenommen wird, wird zur Ewigkeit erweitert. Allgemein-
gültigkeit des Gesetzes und Ewigkeit des Prozesses stehen
noch in engster Beziehung. Die Dauer bzw. die häufige Wieder-
holung allein ist Beweis für mehr als momentane Gewichtigkeit."
- RS-L1931-429: Beweis unerläutert, Behauptung
-
"zur Ewigkeit erweitert" - unverständlich und nicht be-
gründet; Behauptung - "allein ist Beweis" nicht begründet
oder gar gezeigt.
L1931-442: "Auch in der Stellung zum Begriff der Gesetzlichkeit zeigt sich
also klar und eindringlich der aristotelische Charakter dieser psycho-
logischen Begriffsbildung. Er beruht auf einem geringen Zutrauen
zur Gesetzlichkeit des Psychischen, hat für den Forscher aber zu-
gleich die Annehmlichkeit, nicht allzu hohe Anforderungen an die
Geltung und an den Beweis der psychologischen Sätze zu stellen."
- RS-L1931-442: Der psychologische Begriff der
Gesetzlichkeit
wurde nicht definiert oder näher erläutert; "zeigt" wird behauptet,
aber nicht gezeigt. Behauptung "nicht allzu hohe Anforderungen"
bleibt unbegründet. In dem Abschnitt schwingt eine mehr oder
weniger Beweiskraft mit. Die nächste Fundstelle geht in die
Gegenrichtung. Das alles, insbesondere der Begriff Beweis
wird nicht erklärt.
L1931-448: "Auch methodisch ist die These von der ausnahmslosen
Gültigkeit der psychischen Gesetze von weittragender Bedeutung.
Sie führt zu einem außerordentlichen Steigen des Anspruchs-
niveaus an den Beweis. Es ist nicht mehr möglich, ,,Ausnahmen"
leicht zu nehmen. Sie ,,bestätigen" keineswegs mehr die ,,Regel",
sondern sind als vollgültige Gcgenbeweise anzusehen und zwar
auch dann; wenn sie selten vorkommen, ja wenn nur eine einzige
Ausnahme nachweisbar ist. ..."
- RS-L1931-448: Lewin postuliert unterschiedliche
An-
spruchsniveau an Beweise, was wohl richtig ist, aber er
lässt seinen Beweisbegriff im Dunkeln. Auch, wenn
er Ausnahmen bei Annahme ausnahmloser Gesetzlichkeit als
Gegenbeweis wertet. Erläutert und im Detail belegt oder
gar durchgeführt wird das alle nicht, so dass die ganze
Argumentation Lewins bloßen meinen ist, was nicht
zum anspruchsvollen Titel, Thema und in die Hauszeitschrift
ERKENNTNIS des Wiener Kreises passt.
L1931-450: "... Auch ein ,,Einzelfall" also ist dann ohne weiteres als
gesetzlich aufzufassen. Historische Seltenheit ist kein Gegenargu-
ment, historische Regelmäßigkeit kein Beweis für Gesetzlichkeit,
weil der Begriff der Gesetzlichkeit streng von dem der Regel-
mäßigkeit, der Begriff der Ausnahmslosigkeit des Gesetzes
streng von dem Begriff der historischen Konstanz (des ,,Immer")
getrennt wird. 1"
- RS-L1931-450: Das ist eine interessante allgemeine
Behauptung für die Lewin die Belege und ein Beispiel
schuldig bleibt. Beweis wird nicht erklärt.
L1931-458: "Die bekannte Eigentümlichkeit der meisten physikalischen
Gesetze, Differentialgesetze zu sein, scheint mir nicht, wie man das
häufig annimmt, ein Beweis dafür zu sein, daß die Physik das
Bestreben hat, alls in kleinste ,,Elemente" aufzulösen und
diese Elemente in möglichster ,,Isolierung" zu betrachten. ..."
- RS-L1931-458: Beweis wird nicht erklärt.
L1931-459: "Auf die weiteren logischen und methodischen Konsequenzen
dieser Begriffsbildung näher einzugehen, erübrigt sich. Sind Ge-
setz und Individuum keine Gegensätze, so steht nichts mehr im
Wege, sich im Beweis auch auf (historisch betrachtet) ungewöhn-
liche, selten und flüchtige Ereignisse, wie sie die physikalischen
Experimente meist darstellen, zu stützen. Ja es wird verständlich,
warum es systematisch betrachtet angebracht sein kann, solche
seltenen Fälle -- wenn auch nicht wegen ihrer Ungewöhnlichkeit
an sich -- herzustellen."
- RS-L1931-459: Beweis bleibt unerklärt wie
Lewins
Argumentation unverständlich.
L1931-466: "Aber nicht durch Weglassen der wechselnden Situationen
lassen sich die Zufälligkeiten des geschichtlichen Geschehens in der
Systematik überwinden, sondern nur durch eine bis ins Extrem
durchgeführte Berücksichtigung der Eigennatur des konkreten
Falles. Es gilt zur Einsicht zu bringen, daß Allgemein-
gültigkeit des Gesetzes und Konkretheit des indivi-[>466]
duellen Falles keine Gegensäitze sind, und daß an Stelle
der Bezugnahme auf einen historisch möglichst aus-
gedehnten Bereich häufiger Wiederholungen die Bezug-
nahme auf die Totalität einer konkreten Gesamtsitua-
tion treten muss. Das bedeutet methodisch, daß die Wichtig-
keit eines Falles und seine Beweiskraft nicht nach der Häufigkeit
seines Vorkommens gewertet werden darf. ..."
- RS-L1931-446: Für mich unverständliche
Argumentation
("... Extrem durchgeführte Berücksichtigung der Eigennatur
des konkreten Falles. ..."); Beweiskraft deutet eine quntitative
Auffassung von Beweisen an, was Lewin aber auch nicht näher
erklärt.
Zitierstil Lewin 1931
Zusammenfassung-Zitierstil
Lewin-1931 (Seitenzahlen Zitierquelle Erkenntnis)
1. Es finden sich in Lewin 1931 einige korrekte Zitierweisen
2. Unvollständige Zitierweise durch fehlenden Seitenzahlen, z.B.:
- 423: 1) Schaxel, Grundzüge der Theorienbildung in der Biologie. 2. Aufl. Jena 1922
- 425: 1) Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Berlin 1910.
- 428: 1) Levy-Brühl, Das Denken der Naturvölker. Wien 1929.
- 428-2) Zum Begriff des Vorkommens vergleiche Roux, Prinzipielle Sonderung von Naturgesetz und Regel, von Wirken und Vorkommen, Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Berlin 1920, ferner Przibram, Zoonomie, Leipzig I929, und Biologia Generalis, 1930. )
- 429: "(vgl. später)."
- 454: 1) Über die Bedeutung, die der Begriff des Vakuums in diesem Zusammenhang hatte, vgl. Dingler, Das Experiment, Miinchen 1928. Hier fehlt die Seitenzahl.
- 436: Jennings, Driesch,
- 437: Löb, Alverde, Üxküll
- 438: "z) Experimente kannten an sich schon die Griechen."
Bei Lewin 1931, S.17 fand ich: "Ich möchte an dieser Stelle nicht auf die gegenwärtig häufig erörterte Frage eingehen, ob es nicht auch eine spezifisch teleologische Erklärung in der Physik gibt. Man pflegt dabei auf das Prinzip der kleinsten Wirkung (vgl. PLANCK 1922, 103) hinzuweisen. Der dabei vorkommende Begriff der Gerichtetheit und die Frage, ob diese Gerichtetheit, den die Verfechter der Teleologie in der Biologie verwenden (vgl. BERTALANFFY 1929), soll hier nicht erörtert werden, sonder es soll darauf hingewiesen werden, daß auch bei der im engeren Sinne kausalen Erklärung der Physik Richtungsbegriffe eine grundlegende Rolle spielen."
RS: Die Arbeit BERTALANFFY (1901-1972), Biologe, Systemtheoretiker, wird nicht nachgewiesen:
- Von Bertalanffy, L. (1929). Kritische Theorie der Formbildung
(Translated by J. H. Woodger as Modern Theories of Development: An Introduction
to Theoretical Biology. Oxford: Clarendon Press, 1933). Berlin: Gebruder
Borntraeger.
Ende Zitierstil Lewin 1931
Definition und Definieren bei Lewin (ausgelagert auf eine eigene Seite im Definitions-Register)
Beweislinks
_
Checkliste-Beweisen
_
Methodik-Beweissuche in der Psychologie
Viele positive oder bejahende Feststellungen oder Aussagen haben kein Suchtextkriterium, so dass Fundstellen nur durch lesen, Zeile für Zeile, erfassbar sind. Negative Feststellungen oder Aussagen sind hingegen oft durch ein "nicht" zu finden.
_
Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen [Stand 27.03.2023, 18:21 Uhr]
Beweissuchwortkürzel.
Hauptunterscheidungskriterien mit Kürzeln (In Entwicklung und Erprobung) siehe bitte Beweissignierungssystem.
_
Literatur (Auswahl)
- Lewin, Kurt (1916) Die psychische Tätigkeit bei der Hemmung von Willensvorgängen und das Grundgesetz der Assoziation. J.A. Barth.
- Lewin, Kurt (1917) Die psychische Tätigkeit bei der Hemmung von Willensvorgängen und das Grundgesetz der Assoziation. In: Zeitschrift für Psychologie. (1917), 77, S. 212–247.
- Lewin, K. (1920d). [Rezension] G. F. Lipps: Das Problem der Wissensfreiheit Volkshochschulvorträge. Zeitschrift für angewandte Psychologie, 17, 354.
- Lewin, K. (1921). Das Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der Assoziation, I. Psychologische Forschung 1, 191–302, II. Psychologische Forschung, 2, 65–140.
- Lewin, K. (1922a). Der Begriff der Genese in Physik, Biologie und Entwicklungsgeschichte. Berlin: Julius Springer. (KLW 2, S. 47–318).
- Lewin, K. (1922b). Über einen Apparat zur Messung von Tonintensitäten. Psychologische Forschung, 2, 317–326. (KLW 2, S. 473–483)
- Lewin, K. (1922c). Über den Einfluß von Interferenzröhren auf die Intensität obertonfreier Töne. Psychologische Forschung, 2, 327–335. Lewin, K. (1922d). Eine experimentelle Methode zur Erzeugung von Affekten. In: Bühler, K. (Hrsg.), Bericht über den VII. Kongreß für experimentelle Psychologie in Marburg vom 22.–23. April 1921 (S. 146–148). Jena: Gustav Fischer.
- Lewin, K. (1922e). Das Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der Assoziation. Psychologische Forschung, 1 (1921), 191–302 und 2 (1922), 65–140.
- Lewin, K. (1922f). [Rezension] Walter Blumenfeld: Zur kritischen Grundlegung der Psychologie. Zeitschrift für Psychologie, 89, 179–181. (KLW 1; S. 367–369).
- Lewin, K. (1923a). Über die Umkehrung der Raumlage auf dem Kopf stehender Worte und Figuren in der Wahrnehmung. Psychologische Forschung, 4, 210–261.
- Lewin, K. (1923b). Die zeitliche Geneseordnung. Zeitschrift für Physik, 13 (1/2), 62–81. (KLW 1; S. 213–232).
- Lewin, K. & Sakuma, Kanae (1925). Die Sehrichtung monokularer und binokularer Objekte bei Bewegung und das Zustandekommen des Tiefeneffektes. Psychologische Forschung, 6, 298–357.
- Lewin, K. (1926a). Untersuchungen zur Handlungs- und Affekt-Psychologie. I. Vorbemerkung über die psychischen Kräfte und Energien und über die Struktur der Seele. Psychologische Forschung, 7, S. 294–329.
- Lewin, Kurt (1926b) Idee und Aufgabe der vergleichenden Wissenschaftslehre. Weltkreis, Erlangen 1926.
- Lewin, Kurt (1926c) Vorsatz, Wille und Bedürfnis: mit Vorbemerkungen über die psychischen Kräfte und Energien und die Struktur der Seele. Springer, Berlin 1926 (Digitalisat).
- Lewin, K. (1926d). Filmaufnahmen über Trieb- und Affektäußerungen psychopathischer Kinder (verglichen mit Normalen und Schwachsinnigen). Zeitschrift für Kinderforschung, 32, 414–447. (KLW 6, S. 41–75).
- Lewin, K. (1927a). Gesetz und Experiment in der Psychologie. Symposion, 1, 375–421. Auch separat erschienen. Berlin-Schlachtensee: Weltkreis-Verlag, 1927. (KLW 1, S. 279–320).
- Lewin, K. (1927b). Kindlicher Ausdruck. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, experimentelle Pädagogik und jugendkundliche Forschung, 28, 510–526. (KLW 6, S.77–99).
- Lewin, K. (1927d). Die Erinnerung an beendete und unbeendete Handlungen, In: VIII. Int. Kongreß für Psychologie, Groningen, 1926. (2 n.n. Seiten), Groningen: Noordhoff.Lewin, K. (1927e). Filmvortrag über Trieb- und Affektäußerungen psychopathischer Kinder (verglichen mit Normalen und Schwachsinnigen). Kurzer Bericht. In: Deutscher Verein zur Fürsorge für jugendliche Psychopathen e.V. (Hrsg.) Bericht über die vierte Tagung für Psychopathenfürsorge Düsseldorf, 24.–26. September 1926. Berlin: Springer. 1–6
- Lewin, K. (1928a). Die Entwicklung der experimentellen Willens- und Affektpsychologie und die Psychotherapie. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten: Offzielles Organ der Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater, 85, 515–534. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer. (entspricht in großen Teilen Lewin, 1929e).
- Lewin, K. (1928b). Die Entwicklung der experimentellen Willens- und Affektpsychologie und die Psychotherapie. Allgemeine Ärztliche Zeitschrift für Psychiatrie und psychische Hygiene, 1, 214–217.
- Lewin, K. (1928c). Die Bedeutung der „Psychischen Sättigung“ für einige Probleme der Psychotechnik. Psychotechnische Zeitschrift, 3, 182–188.
- Lewin, K. (1928d). Kindlicher Ausdruck. Filmvortrag. In Erich Becher (Hrsg.) Bericht über den X. Kongreß für experimentelle Psychologie in Bonn vom 20. – 23. April 1927. (S. 145–148). Jena: Fischer. (Dieser Text ist eine Zusammenfassung von 1927b).
- Kurt Lewin (1929) Die Entwicklung der experimentellen Wilenspsychologie und der Psychotherapie. In: Archiv für Psychiatrie. Band 85,
- Lewin, Kurt (1931) Die psychologische Situation bei Lohn und Strafe. Leipzig 1931.
- Lewin, Kurt (1931) Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Biologie und Psychologie. 1931, (PDF; 175 kB)
- Lewin, Kurt (1933) Eine dynamische Theorie des Schwachsinnigen. 1933, (PDF; 393 kB)
- Lewin, Kurt (1934) Der Richtungsbegriff in der Psychologie. Der spezielle und allgemeine Hodologische Raum. Psychologische Forschung volume 19, 249–299 (1934)
- Lewin, Kurt (1936) Principles of topological psychology. New York 1936. Deutsch: Grundzüge der topologischen psychologie. Bern 1969.
- Lewin, Kurt (1938) The conceptual representation and the measurement of psychological Forces. Durham, 1938.
- Lewin, Kurt (1948) Resolving social conflicts: selected papers on group dynamics. Harper, New York 1948.
- deutsch: Die Lösung sozialer Konflikte. Ausgewählte Abhandlungen über Gruppendynamik. Christian, Bad Nauheim 1953, 1968. (mit Gertrud Weiss Lewin und Herbert Alfred Frenzel, Vorwort von Max Horkheimer). Im Kapitel Der Sonderfall Deutschland befasste sich Lewin mit der Frage, wie das Deutschland der Nachkriegszeit durch Reeducation demokratisiert werden könnte.[17]
- Lewin, Kurt (1963) Feldtheorie in den Sozialwissenschaften. Ausgewählte theoretische Schriften. Hans Huber, Bern 1963; 2., unveränd. Aufl. 2012,
- Lewin, Kurt (1967 Nachdruck 1927) Gesetz und Experiment in der Psychologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1967.
- Kurt Lewin Werkausgabe (KLW). Hrsg. Karl Friedrich Graumann, Klett, Stuttgart ab 1980; 4 Bände sind erschienen, weitere geplante Bände werden nicht erscheinen, einige dafür bereits vorbereitete Beiträge erschienen jedoch im nachfolgend genannten Sammelband „Angewandte Psychologie“.
- Lewin, Kurt (2009) Schriften zur angewandten Psychologie. Aufsätze, Vorträge, Rezensionen, hrsg. und eingeleitet von Helmut E. Lück, Verlag Wolfgang Krammer, Wien 2009,
Lewin, K. (1926e). Ein verbesserter Zeitsinnapparat. Psychologische Forschung, 7, 273–275. (KLW 2, S. 485–487).
Lewin, K. (1926f). Ein zählender Chronograph. Psychologische Forschung, 7, 276–281. (KLW 2; S. 489–494).
Lewin, K. (1927c). Kindliche Ausdrucksbewegungen. Erläuterungen zu Filmaufnahmen. In: William Stern, Psychologie der frühen Kindheit bis zum sechsten Lebensjahr. Leipzig: Quelle & Meyer, 4. Aufl. S. 503–511; 5. Aufl. 1928, S. 501–510; 6. Aufl. 1930, S. 501–510. (Dieser Text ist ein Auszug aus Lewin, 1927b).
- Ach, N. (1905). Über die Willenstätigkeit und das Denken. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht.
- Ach, N. (1910). Über den Willen. Leipzig: Verlag von Quelle & Meyer. (in German)
- Ach, N. (1910/2006). On Volition (Über den Willen). Leipzig: Verlag von Quelle & Meyer. (in English and German)
- Ach, N. (1910). Über den Willensakt und das Temperament. Leipzig: Verlag von Quelle & Meyer.
- Ach, N. (1933) Über die Determinationspsychologie und ihre Bedeutung für das Führerproblem. In (111-112) Klemm (1934, Hrsg.) Bericht über den XIII. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Leipzig vom 16.-19. Oktober 1933. Jena: G. Fischer.
- Ach, Narziß (1935) Analyse des Willens. Berlin: Urban & Schwarzenberg.
Heckhausen, Heinz (1969) Die Ach-Lewin-Kontroverse in (134-147) Allgemeine Psychologie in Experimenten. Göttingen: Hogrefe.
Links(Auswahl: beachte)
Ach-Lewin-Kontroverse:
- Spektrum Lexikon der Psychologie: https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/ach-lewin-kontroverse/140
- Reader Assoziation von Peter R. Hofstätter aus: Das Fischer Lexikon Psychologie, erste (1957) und letzte Auflage (1974, 552.-566. Tausend)
- Literaturliste Assoziation.
- Reader Eisler Assoziation.
- Die C. G. Jung’sche Assoziationsmethode zur Diagnostik der Komplexe.
- Der Assoziationsversuch nach C. G. Jung mit Kristina in der 16. Sitzung.
_
Glossar, Anmerkungen und Endnoten: Eigener wissenschaftlicherund weltanschaulicher Standort.
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
assoziationsfrei Es gibt kein assoziationsfreies Material, bestenfalls ein assoziationsarme.
__
assoziatives Äquivalent der Determination nach ACH (1910), S. 43:
- "Diejenige Zahl von Wiederholungen einer Silbenreihe,
welche eben überschritten werden muß, damit die gestiftete
Assoziation und nicht die Determination den Ablauf des Ge-
schehens bestimmt, bezeichnen wir kurz als das assoziative
Äquivalent der Determination. Ist die Assoziation schwächer,
d. h. die Zahl der Wiederholungen geringer, so bestimmt der
Willensakt den Ablauf. Doch macht sich hier dann die Asso-
ziation ebenfalls noch geltend, und zwar bewirkt sie, wie
wir gesehen haben, infolge der reproduktiv-determinierenden
Hemmung eine Verlängerung der Dauer der Willenshandlung."
Determination bzw. Determinierung
Bei ACH (1904) im Kongreßbericht Experimentelle Psychologie, S. 81f:
- " Aus den Reaktionen ohne Zuordnung geht
hervor, daß von [>82]
der Zielvorstellung determinierende Tendenzen ausgehen , welche
eine Realisierung der Absicht im Sinne der Zielvorstellung bewirken.
Dies gilt auch für den in tiefer Hypnose gegebenen Suggestions-
befehl , für den gewöhnlichen Reaktionsbefehl und überhaupt für
die Wirkung der Instruktion oder des Auftrages, eine Erscheinung ,
die auch durch sonstige psychologische Erfahrung und vor allem
durch pathologische Tatbestände nahegelegt wird. Durch die Wir-
kung dieser determinierenden Tendenzen werden auch neue Asso-
ziationen gestiftet. Sie bilden so die Grundbedingung des kombi-
nierenden Denkens, indem sie die Bildung neuer Vorstellungsver-
bindungen ermöglichen, welche einer gegebenen Absicht oder einem
gegebenen Auftrage entsprechen"
Bei ACH (1905) im Vorwort:
- "Von den zwei Seiten des Willensproblems wird bei den vorliegenden
Ausführungen nur die zweite Seite behandelt, nämlich
die im Anschluß an eine Absicht oder einen Entschluß sich
vollziehende Determinierung, während dagegen die erste Seite,
das Zustandekommen der Absicht, keine eingebende Behandlung
erfahren hat, nur gelegentlich finden sich Andeutungen, welche
diese Seite des Willensproblems betreffen. "
Bei ACH (1910) 288 Fundstellen. Im Vorwort: "Determination als Nachwirkung
des Willensaktes." Der Begriff taucht im Inhaltverzeichnis sehr oft auf.
S.4f:
- "Wie die dynamische Seite des Wollens eine unerläßliche
Vorbedingung für das Verständnis der Motivation bildet, so ist
die vorliegende Untersuchung der dynamischen Funktionen erst
möglich geworden durch die Kenntnis der D e t e r m i n a t i o n ,
d. h. jener eigentümlichen Nachwirkung des Wollens, welche
eine Realisierung des geistigen Geschehens im Sinne der Ab-
sicht, des Vorsatzes und dergleichen nach sich zieht. Sie
bewirkt den geordneten Vorstellungsablauf beim Denken
und beim Handeln1. Es läßt sich nun an dem Erfolge der
Willenshandlung , d. h. daran, ob das erreicht wurde, was im [>5]
- 1 Vgl. hierzu: N. Ach , Über die Willenstätigkeit
und das Denken.
Göttingen 1905. Im folgenden abgekiirzt durch W. U. D.
Vorsatz behufs Verwirklichung antizipiert wurde, die Stärke
der Determination, der determinierenden
Tendenzen erkennen,
und zwar dadurch, daß der wirkliche Erfolg einer Willenshand-
lung, auch der einer sogenannten inneren, intellektuellen Willens-
handlung, sich unmittelbar objektivieren läßt, z. B. indem
man
bestimmte Aufgaben stellt, welche von der Versuchsperson
(Vp) übernommen und ausgeführt werden. Da ferner innere
Widerstande gegen die Verwirklichung der Absicht der Vp
künstlich gesetzt werden können, z. B. durch andersartige
Ge-
wohnheiten im Vorstellungsablauf, so sind wir in der Lage, den
Bereich der Willensmacht festlegen zu können. Es ist demnach die
Grenze der dynamischen Unabhängkeit im Können des Menschen
dadurch bestimmbar, daß von der Kraft des Wollens eine Nach-
wirkung ausgeht, die das realisiert, was gewollt wird. Stellen
sich dieser Determination zu starke
Widerstände entgegen, so
versagt die Macht des Willens. Es stützt sich demnach die
Untersuchung der dynamischen Seite des Willens auf den Tat-
bestand jener für den willkürlichen Verlauf des Geschehens
charakteristischen Erscheinung der Determination.
Die Verwirklichung dessen, was wir wollen, zeigt sich im
Erfolg, in der Leistung. Das Verhältnis der Leistung, welche
durch einen Willensakt verwirklicht wird, zum Wollen soll als
Wirkungsgrad des Wollens bezeichnet werden. Dieser
Wirkungsgrad kann bei gleicher Starke der durch den Willens-
akt gesetzten Determination ein
sehr verschiedener sein, näm-
lich je nach den Widerständen, welche sich der Determination
entgegenstellen. Die Determination
sucht zwar eine Verwirk-
lichung der im Vorsatz, in der Absicht oder überhaupt im
Willensakt vorliegenden Zielvorstellung zu erreichen. Aber
durchaus nicht immer wird das beabsichtigte Ziel auch erreicht.
Der Erfolg kann ausbleiben, er kann in einer veränderten
Form sich realisieren, er kann eine zeitliche Verzögerung er-
leiden und dergleichen. ... "
Erkenntnis
Wikipedia (Abruf 04.10.2023): "Erkenntnis. An International Journal for Analytical Philosophy ist eine philosophische Fachzeitschrift, die 1930 von Hans Reichenbach und Rudolf Carnap als Fortführung der Annalen der Philosophie (1919–1929, ab 1924 Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik) gegründet wurde. 1939 wurde die Publikation eingestellt, 1975 wurde die Zeitschrift von Wilhelm K. Essler, Carl Hempel und Wolfgang Stegmüller wieder gegründet. Der gegenwärtige Herausgeber ist Hannes Leitgeb."
Die ERKENNTNIS kann als Hauszeitschrift des Wiener Kreises angesehen werden.
__
Mittlere Variation
Wundt 1880, Bd. 1, S.223
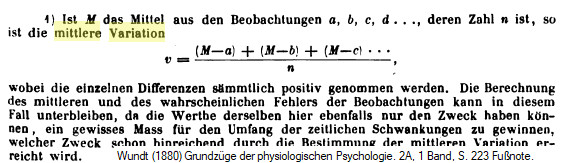
__
Nazi
Armin Stock (2015) in Wolfradt et. al. (S.8): "... Narziß Ach gehörte zu den wenigen Psychologen, die sich bereits 1933 zum NS-Staat und Adolf Hitler bekannten und zum Teil „völkische“ Ansichten in der Psychologie propagierten (z.B. im Vortrag „Über die Determinationspsychologie und ihre Bedeutung für das Führerproblem“ auf dem DGPs-Kongress in Leipzig, 1933, oder in „Verantwortung und Charakter“ auf dem DGPs-Kongress in Bayreuth, 1938).
Werk: Narziß Ach war einer der herausragenden Experimentalpsychologen seiner Zeit. ... "
Ach hielt 1933 einen Vortrag [PDF] "Über die Determinationspsychologie und ihre Bedeutung für das Führerproblem" auf dem XIII. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Leipzig vom 16.-19. Oktober 1933. Die Wertung Wikipedias (Abruf 24.09.2023) "Eine pathetische Huldigung Adolf Hitlers und seiner Ideen" kann ich in dem 1 1/4 Seiten Papier nicht nachvollziehen. Ich kann in dem Vortrag auch nichts Völkisches entdecken. Ach formuliert hier Grundthesen zu einer Psychologie von Führern, aufbauend auf seinen beiden Grundprinzipien der Determinationspsychologie mit denen sein Vortrag beginnt: "Die Verwirklichung im Sinne der Zielvorstellung und die Schaffung von Mitteln zur Erreichung des Zieles, also Zielgerichtetheit und sinnvoll-schöpferische Gestaltung, bilden die beiden Grundprinzipien der Determinationspsychologie."
__
sorgfältig nach welchen Kriterien?
__
Zentralwert
Nicht im Brockhaus 1908, 14.A., weder unter Z noch unter C.
__
Standort: Beweis und beweisen bei Kurt Lewin.
*
Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * natcode Register *
Übersicht Beweisseiten * Wissenschaftliches Arbeiten * Aristoteles Zum Geleit * Definition und definieren
* Begriffscontainer (Containerbegriff)
Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse * Hauptbedeutungen Erleben *
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Beweis und beweisen bei Kurt Lewin. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/BeweisRegister/LewinK.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jedem in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert:
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
06.10.2023 Auzsgelagert auf eigene Seite. Definition und definieren bei Lewin. Lit: 1934 Richtungsbegriff nachgetragen.
03.10.2023 Lewin, Kurt (1931) Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Biologie. * Zitierstil Lewin 1931. * Ein erstes frühes Beispiel für den Hochstaplerzitierstil.
26.09.2023 1. Version Ins Netz.
00.09.2023 Ausgearbeitet.
00.03.2023 angelegt.
»« ¶