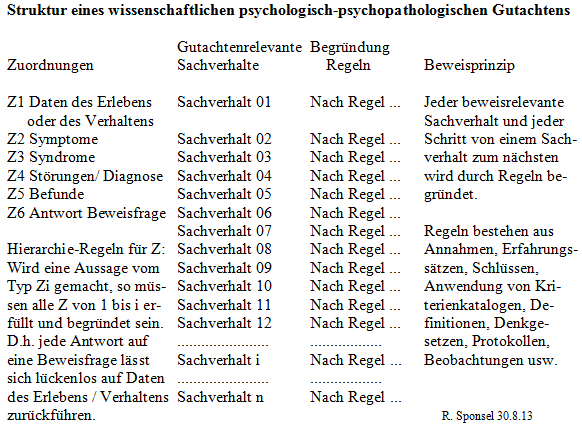(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=08.12.2014 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 28.07.15
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail: sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_Teil 4: Beweismethodik Kritische Urteilsanalyse Mollath Wiederaufnahme_ Überblick_ Rel. Aktuelles_ Rel. Beständiges _ Titelblatt_ Konzeption_ Archiv_ Region_ Service_iec-verlag _ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Methodenkritische Untersuchung der schriftlichen Urteilsbegründung im Mollath Wiederaufnahmeverfahren
Teil 4: Beweismethodik in der schriftlichen Urteilsbegründung des LG
Originalarbeit von Rudolf
Sponsel, Erlangen
_
_
Vorbemerkung
Beweismethodik > Zu
den allgemeinen Vorbemerkungen der Urteilsanalyse.
Die Beweismethodik ist das Herzstück jeder juristischen Entscheidung.
Mit ihrer Güte steht und fällt jede Entscheidung. Was ist nun
ganz allgemein und aus wissenschaftlicher Sicht ein Beweis?
| Allgemeine
wissenschaftliche Beweisstruktur und beweisartige Begründungsregel
Sie ist einfach - wenn auch nicht einfach durchzuführen - und lautet: Wähle einen Anfang und begründe Schritt für Schritt, wie man vom Anfang (Ende) zur nächsten Stelle bis zum Ende (Anfang) gelangt. Ein Beweis oder eine beweisartige Begründung ist eine Folge von Schritten: A0 => A1 => A2 => .... => Ai .... => An, Zwischen Vorgänger und Nachfolger darf es keine Lücken geben. Es kommt nicht auf die Formalisierung an, sie ist nur eine Erleichterung für die Prüfung. Entscheidend ist, dass jeder Schritt prüfbar nachvollzogen werden kann und dass es keine Lücken gibt. [Quelle] |
Ein spezielles Wort
an JuristInnen
Es geht mir hier nicht um das juristische Verständnis
von beweisen und begründen, sondern um eine allgemeine Sicht,
die Perspektive des gesunden Menschenverstandes, viel mehr aber noch aus
allgemein
wissenschaftlicher, wissenschaftstheoretischer und methodologischer Sicht.
Urteilsanalyse darf nicht den JustizjuristInnen überlassen bleiben,
die sich mittlerweile immer mehr zu einer Art voraufklärerischer Kaste
zurückentwickeln (demutieren). Ich fühle mich Sapere
aude! verpflichtet. Wer Im Namen des Volkes urteilt,
muss sich der Kritik aus dem Volk stellen, noch dazu wenn es in §
184 GVG heißt: Die Gerichtssprache ist deutsch. Im Teil 5 der Urteilsanalyse
werde ich beweisen (nicht nur meinen), dass das nicht
stimmt. Denn die Gerichtssprache ist faktisch nicht deutsch, sondern Kauderwelsch
(Scheindeutsch), wozu übrigens die Sachverständigen einen von
schwachen RichterInnen geduldeten erheblichen Beitrag leisten.
Methodik Beweis und Beweiswürdigung aus allgemin-wissenschaftlicher Sicht im wohlverstandenen Recht
Sachverhalte können erfasst und beachtet werden oder auch nicht. Sofern sie erfasst und beachtet wurden, kann ihnen ein Beweiswert (wahr, falsch, teilweise, nicht feststellbar) für ... zuerkannt werden, wobei die Zuerkennung natürlich zu begründen ist. Die Begründung kann mehr oder minder gut, lücken- oder mangelhaft sein. Hierzu folgende graphische Übersicht:
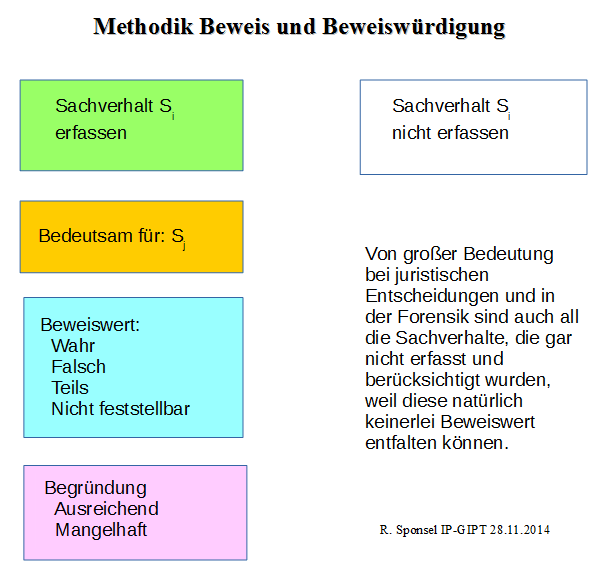
Ein Hinweis zur Hypothesenprüfung
Anmerkung: Grundbausteine für eine idiographische Wisenschaftstheorie
habe ich 1994 entwickelt und erstmals in Sponsel
(1995) Handbuch, S. 337 veröffentlicht, seit 3.10.2000
auch im Internet, hier nur die Übersichtsgraphik:
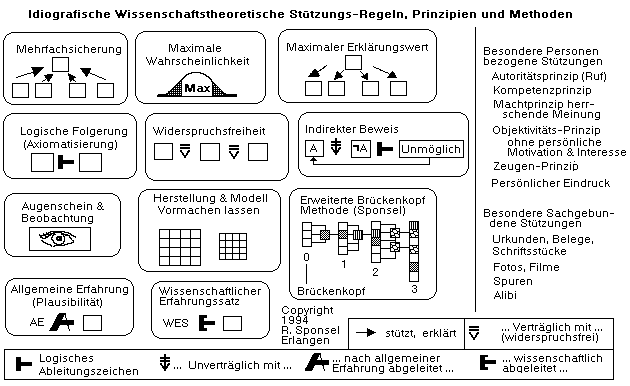
Für den vorliegenden Fall erscheint besonders die erweiterte Brückenkopf-Methode angezeigt. Das Thema Hypothesenprüfung wird in einem eigenen Abschnitt noch ausführlich behandelt.
Zur Beweismethodik in Forensisch-psycho-pathologischen Gutachten
Aus dem Handbuch der Beweiswürdigung von Geipel
- Geipel, Andreas
J. (Hrsg. 2013) Handbuch der Beweiswürdigung, 2. Auflage. Münster:
ZAP. [Web]
Kapitel 1 Einleitung
Rn1 In allen veröffentlichten Kommentar- und Literaturmeinungen,
die jeweils wieder Rechtsprechung zitieren, herrscht Einigkeit, dass die
Beweiswürdigung vollständig und geschlossen,1 sowie widerspruchsfrei
sein müsse,2 keine Lücken aufweisen dürfe,3 ferner nicht
gegen gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse,4 Regeln der Logik5 und
Erfahrungssätze6 verstoßen dürfe.7
Rn2 Anhand dieser Parameter müsste die Erfolgsaussicht eines revisionsrechtlichen Angriffs gegen die Beweiswürdigung relativ sicher beurteilt werden können. Die praktische Rechtswirklichkeit sieht jedoch anders aus: „Für den Revisionsführer ist es in den meisten Fällen völlig ungewiss, ob das Revisionsgericht sein die Feststellungen betreffendes Gravamen formelmäßig erledigen oder als Beschreibung eines Rechtsfehlers ansehen wird, die, wenn sie zutrifft, nur an der Hürde des Beruhens scheitern kann.“8 Der in der Praxis geäußerte Befund, dass Angriffe gegen die Beweiswürdigung nahezu aussichtslos sind,9 wird statistisch bestätigt. Selbst eine Auswertung von 658 elaborierten Rügen eines Revisionsrechtsspezialisten ergibt, dass die Erfolgsquote je 0 % beträgt, sofern Denkverstöße (42-mal gerügt mit 0 % Erfolg), Verstöße gegen Erfahrungssätze (8-mal gerügt mit 0 % Erfolg) und Bewertungswidersprüche (46-mal gerügt mit 0 % Erfolg) gerügt werden und lediglich 13 % beträgt, sofern lückenhafte Feststellungen (48-mal gerügt, 6-mal erfolgreich) gerügt werden.10 Ist der Angriff auf die Beweiswürdigung aber nahezu aussichtslos, so haben Verteidiger zwischenzeitlich versucht, das Beweisergebnis wenigstens vor bewussten und unbewussten Verfälschungen zu sichern und der Willkür des erkennenden Gerichts zu entziehen. Gleichwohl war auch dieses Unterfangen aussichtslos. Insbes. soll folgende Fallgestaltung keine Verletzung des § 265 StPO und des Fair-Trial-Grundsatzes darstellen: „Nach der Vernehmung einer Zeugin gaben sie [die Verteidiger] eine umfangreiche, schriftlich fixierte Erklärung ab, in der sie niederlegten, was die Zeugin nach ihrer Auffassung bekundet hatte, verbunden mit der Aufforderung an das Gericht, ihnen Hinweis zu erteilen, wenn sie nach dessen Ansicht irren sollten. Das Gericht gab keinen Hinweis. Es verurteilte. Und stützte sein Urteil auf angebliche Bekundungen der Zeugin, die denen, die sie nach Auffassung der Verteidigung gemacht hatte, in wesentlichen Punkten widersprachen.“11 In dem Bemühen, ein Beweisergebnis festzuschreiben und vor Verfälschung zu schützen soll es ferner unzulässig sein, einen Beweisantrag dergestalt zu stellen, dass zum Beweis, dass Zeuge A dies und Zeuge B jenes bekundet hatte, die Tonbandmitschnitte der jeweiligen Aussagen in Augenschein zu nehmen sind.12 D.h. „die Herrschaft des Tatrichters über die Tatsachen ist für den Verteidiger nach derzeit geltendem Recht unbezwingbar“.13
K1EN-1 Vgl. z.B. BGHSt 35, S. 316.
K1EN-2 Vgl. z.B.. BGH, StraFO 1997, S. 140.
K1EN-3 Vgl. z.?B. BGH, NStZ 1985, S. 184.
K1EN-4 Vgl. KK zur StPO, 5. Aufl., Schoreit, § 261 Rn. 46.
K1EN-5 Vgl. KK zur StPO, 5. Aufl., Schoreit, § 261 Rn. 47.
K1EN-6 Vgl. KK zur StPO, 5. Aufl., Schoreit, § 261 Rn. 48.
K1EN-7 Vgl. für den Bereich des Strafrechts z.?B. Dahs/Dahs, Die
Revision im Strafprozess, 6. Aufl., Rn. 410?ff. u. für den Bereich
des Zivilrechts Thomas/Putzo, Kommentar zur ZPO, 24. Aufl., § 546
Rn. 11.
K1EN-8 Herdegen, Die Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen
durch das Revisionsgericht auf Grund der Sachrüge, S. 140, in Beweisantragsrecht,
Beweiswürdigung, strafprozessuale Revision.
K1EN-9 Vgl. Nack, Verteidigung bei der Glaubwürdigkeitsbeurteilung
von Aussagen, StV 1994, S. 555? ff. (Angriffe gegen die Beweiswürdigung
im Allgemeinen u. gegen die Glaubwürdigkeit eines Belastungszeugen
im Besonderen) u. ders., Aufhebungspraxis der Strafsenate des BGH, NStZ
1997, S. 153?ff.
K1EN-10 Vgl. Barton, Die Revisionsrechtsprechung des BGH in Strafsachen,
S. 145.
K1EN-11 König, Die Verteidigung in der Hauptverhandlung, in Ziegert
(Hrsg.), Grundlagen der Strafverteidigung, S. 155, 212.
K1EN-12 Vgl. BGHR StPO § 244 Abs. 3 Satz 1 Unzulässigkeit
7 u. 12.
K1EN-13 König, Die Verteidigung in der Hauptverhandlung, in Ziegert
(Hrsg.), Grundlagen der Strafverteidigung, S. 155, 213.
Fehlersignierung
Nachdem das meine erste Urteils-Analyse ist, an der ich eine Methodik
der Urteils-Analyse entwickle, kann sich das Fehlersignatursystem im Verlauf
ändern durch Erweiterungen und Ergänzungen, weil natürlich
nicht alle Fehler und Mängel, die auftauchen, vorweggenommen werden
können. Ich übergehe in dieser Arbeit die RichterInnen-Fehler
bezüglich forensischer Gutachten, die im Teil 2 zur Anwendung
gelangen, und die Rechtsfehler
im engeren Sinne (Revisionsgründe) für die ich als Nichtjurist
nicht kompetent bin. Hingegen sind natürlich alle Menschen mit einem
IQ > 90 grundsätzlich in der Lage, allgemeine Beweismethodik-Fehler
zu erkennen.
Das Einzelfallprinzip gebietet sicherheitshalber nur von
potentiellen Fehlern zu sprechen. Der Rubriken enthalten also überwiegend
nur potentielle Fehler. Ob ein
potentieller Fehler im spezifischen
Einzelfall wirklich ein Beweismethodik-Fehler ist, sollte nicht absolut-allgemein,
sondern im Realitätsrahmen und Situationskontext des Einzelfalles
untersucht und entschieden werden. Wichtig ist vielleicht auch, dass man
sich eingesteht: fehlerlose Entscheidungen gibt es nicht oder nur selten
in einfachen Fällen. Aber: die Problemlösung beginnt bekanntlich
mit der Problemwahrnehmung. Deshalb ist es sinnvoll, sich seinen möglichen
Fehlern grundsätzlich zu öffnen. Manche Fehler mögen auch
keine ernste Bedeutung haben, andere aber im jeweiligen Einzelfall vielleicht
schon. Und es gibt fatale Fehler, die eine Entscheidung nicht akzeptabel
machen.
Entscheidungsphraseologie: Worthülsen und Leerformeln.
Zur Einstimmung eine Mahnung vor 2350 Jahren auch und gerade für
JustizJuristInnen (Entlehnt
von.)
|
|
welche ihre Gedanken untereinander austauschen wollen, etwas voneinander verstehen; denn wie könnte denn, wenn dies nicht stattfindet, ein gegenseitiger Gedankenaustausch möglich sein? Es muß also jedes Wort bekannt sein und etwas, und zwar eins und nicht mehreres, bezeichnen; hat es mehrere Bedeutungen, so muß man erklären, in welcher von diesen man das Wort gebraucht." Aus: Aristoteles (384-322) Metaphysik. 11. Buch, 5 Kap., S. 244 (Rowohlts Klassiker 1966). |
Worte, im Allgemeinen die Kleider der Begriffe, suggerieren Inhalte.
Doch bei genauerer Betrachtung oder Nachfrage, stellt sich bei gerichtlichen
Entscheidungen oft heraus, dass weder die Worte und Begriffe erklärt
noch die Belege für die jeweils konkrete Bedeutung angegeben werden,
nicht einmal in Verweisen, was ja ziemlich einfach zu bewältigen wäre,
wenn man die Belege einfach durchnumeriert.
Entscheidungen strotzen zuweilen von Selbstbekräftigungsformulierungen
- keine Zweifel, zur vollen Überzeugung gelangt, umfassend geprüft
... - die sich bei näherem Hinsehen als bloße Leerformeln
erweisen. Das Gericht bestätigt sich selbst und bekundet, dass es
etwas glaubt, für wahr oder falsch hält, aber es begründet
nicht, so dass man nicht konkret prüfen kann, auf welche Belege sich
der Glaube des Gerichts stützt. So erweist sich manche Begründung
nicht nur als Lücke oder Loch, sondern als regelrechter Krater.
Allgemeine Beweismethodikfehler der RichterInnen
- RiABMF01 Inhalt einer Worthülse oder Leerformel nicht erklärt (Lücke), z.B. kann man unter "glaubwürdig" viel verstehen. Hier wird also nicht gesagt, was dazugehört, was die Merkmale sind.
- RiABMF02 Inhalt einer Worthülse oder Leerformel nicht konkret belegt (Lücke). Hier wird nicht angegeben, wo man welche konkreten Merkmale findet.
- RiABMF03 Inhalt einer Worthülse oder Leerformel nur teilweise konkret belegt (Lücke). Hier werden nur einzelne konkrete Merkmale (mindestens eins) angegeben.
- RiABMF04 Inhalt einer Worthülse oder Leerformel falsch erklärt, z.B. was unter Wahn verstanden wird.
- RiABMF05 Inhalt einer Worthülse oder Leerformel teilweise falsch erklärt, z.B. Wahn müsse immer ein falsches Wirklichkeitsmodell beinhalten (es kann auch richtig, aber auf einem falschen Erkenntnisweg gewonnen worden sein).
- RiABMF06 Inhalt einer Worthülse oder Leerformel falsch angewendet, wenn z.B. glaubhaft aus glaubwürdig abgeleitet wird (glaubwürdig, also glaubhaft ist falsch).
- RiABMF07 Sachverhaltsauswahl nicht begründet. Dazu gehören sowohl solche, die man als Argumentationsbasis auswählt als auch diejenigen, die man außen vor lässt, nicht auswählt und dadurch - implizit - als unbeachtlich bewertet.
- RiABMF08 Sachverhalt gar nicht einbezogen / erörtert, z.B. die Rechtschreib- / Grammatikfehler im ärztlichen Attest.
- RiABMF09 Sachverhalt zwar genannt, aber nicht angemessen erörtert oder bewertet, z.B. werden Abweichungen in den Aussagen zwar genannt, aber sogleich (Lücke, Sprung) ohne nähere Begründung für unwichtig erklärt.
- RiABMF10 Unmögliches wird behauptet oder vertreten, z.B. alle Umstände berücksichtigt.
- RiABMF11 Wortbedeutungs- oder Begriffsunklarheiten, z.B. Gesamtwürdigung und Gesamtschau.
- RiABMF12 Es wird nicht an der ersten Stelle, wo ein Schlüsselbegriff gebraucht wird, direkt oder durch Verweis seine Bedeutung erklärt.
- RiABMF-X Sonstiger bislang nicht erfasster Beweismethodikfehler.
Beweismethodik
in der schriftlichen Urteilsbegründung des LG
Die Beweismethodik wird an verschiedenen Themen studiert, bislang:
- Alle Umstände berücksichtigt.
- Konstanz.
- Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit in der Urteilsbegründung.
- Hypothesenprüfungen und ihre Voraussetzungen.
- Fett-kursive Hervorhebungen im Text der schriftlichen Urteilsbegründung
von RS. Die Identifizierungs-Abkürzungen bedeuten z.B. in "01-UB4-AU"
mit 01 die erste Textstelle mit Fundwort(teilen), U = Urteilsanalyse, B=Beweismethodik,
4= Teil 4, AU = Alle Umstände, es folgt die Seite in der schriftlichen
Urteilsbegründung, wo man die Textstelle findet. Mit diesen Kürzeln
sollen Zielmarken- und Linkkonfusionen vermieden werden.
| 05-UB4-AU
S.
69: "Die Kammer schließt sich in der Ge- samtschau des Ergebnisses
der Beweisaufnahme aufgrund eigener kritischer Prüfung den Ausführungen
des Prof. Dr. Ne an
und hat dabei auch alle Umstände berücksichtigt, welche die Bewertung des Sachverständigen in Frage stellen könnten (vgl. BGH NJW 1997, 3101 ff.)." [Jurion] |
05-UB4-AU-RS Signierung Sponsel
RiABMF02 "alle Umstände berücksichtigt" welche konkret? RiABMF10 "alle Umstände berücksichtigt" Unmöglich. _ _ |
Ergebnisse der Analyse Alle Umstände berücksichtigt
Insgesamt habe ich 26 RichterInnen-Fehler gefunden, die jeder für sich überprüfen kann:
| RiABMF01 Inhalt einer Worthülse oder Leerformel nicht erklärt
(Lücke)
Ergebnis: 10 Signierungen. |
01: "nachvollziehbare", "glaubhafte", "keine Zweifel", 02: "Gesamtwürdigung", "umfassend geprüft", 03: "Gesamt- schau", "Gesamtwürdigung", "alle Umstände", 04: "Glaubwürdigkeit", "Gesamtschau", 05: - |
| RiABMF02 Inhalt einer Worthülse oder Leerformel nicht konkret
belegt (Lücke).
Ergebnis: 12 Signierungen. |
01: "Entstehungsgeschichte", "Abweichungen", "mögliche Motive". 02: "Gesamtwürdigung", "umfassend geprüft", "Abweichungen", 03: "Gesamtschau", "Gesamtwürdi- gung", "alle Umstände", 04: "Angaben", "berücksichtigten Umstände", 05: "alle Umstände berücksichtigt" |
| RiABMF10 Unmögliches behauptet oder vertreten
Ergebnis: 2 Signierungen |
01: 02: 03: "Gesamtwürdigung", 04: 05: "alle Umstände berücksichtigt" |
| RiABMF11 Wortbedeutungs- oder Begriffsunklarheiten
Ergebnis: 2 Signierungen. |
01: 02: 03: "Gesamtschau / Gesamtwürdigung", 04: "durchgreifenden
Zweifeln", 05: -
_ |
Zusammenfassung Analyse
Alle Umstände berücksichtigt
"Alle Umstände berücksichtigt" wird nicht erklärt, nicht
belegt und ist zudem falsch und unrealistisch. Bei den fünf Textstellen
habe ich 26 Fehler-Signaturen als erfüllt gesehen.
Selbst wenn man sich auf die bekannten Umstände beschränken
würde, blieben einige Sachverhalte übrig, die auch diese Beschränkung
widerlegen würden. Ich führe hier nur zwei Beispiele an: Die
Rechtschreib- / Grammatikfehler im ärztlichen Attest werden weder
erwähnt noch kritisch erörtert und daher auch gar nicht gewürdigt.
Auch die Sachverhalte, die die Komplotthypothese stützen, werden vom
Gericht so gut wie nicht ernsthaft erörtert.
Konstanz > [externer Link: siehe bitte Teil 1, hier]
Konstanz wurde aus traditionellen Gründen im aussagepsychologischen Teil abgehandelt, obwohl sie, systematisch gesehen, besser hier aufgehoben wäre, weil Konstanz ein Merkmal von wiederholten Aussagen zum gleichen Sachverhalt ist. Ich werde Konstanz aber auch noch im Teil 3 bei den Rechtsbegriffen und im Teil 5 Verständlichkeit, Klarheit, Nachvollziehbarkeit berücksichtigen.
Glaubhaftigkeit
und Glaubwürdigkeit in der Urteilsbegründung
Ein Sonderfall ist die Verwendung von "überzeugend" oder "nicht
überzeugend" bei Aussagen.
Vorbemerkung Wichtig ist die Unterscheidung
zwischen Aussagemethodologie und Aussagepsychologie, wie
hier
erläutert.
Die beiden Begriffe Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit
sind im Urteil von grundlegender und besonders für die Beweismethodik
von zentraler Bedeutung. Zusätzlich verwendet das Gericht im Zusammenhang
auch noch die Vokabel "überzeugend" (36x) und "kein(e) Zweifel (21x)
sowie kein(e) durchgreifenden Zweifel (10x). Aber diese grundlegenden und
folgenreiche Begriffe werden nicht erklärt, weder direkt noch durch
Verweis. Das scheint wohl der "Standard" in der deutschen Rechtsprechung
zu sein, allerdings völlig unwissenschaftlich und eine nicht nachvollziehbare
Ignoranz gegenüber der europäischen Geistesgeschichte, Wissenschaftstheorie
und Methodologie (> Aristoteles
Zitat). Es bleibt daher nichts anderes übrig, um die Bedeutung,
die das LG diesen Begriffen sozusagen implizit beimisst, durch Aufsuchen
aller Textstellen, in denen sie vorkommen, zu erschließen. Diese
Methode ist erfolreich, wenn auch sehr mühsam, wovon Sie sich im Folgenden
überzeugen können.
In der aussagepsychologischen
Bedeutung ist Glaubwürdigkeit ein Persönlichkeitsmerkmal,
Glaubhaftigkeit
ist
ein Aussagemerkmal. Die "moderne" Aussagepsychologie untersucht in erster
Linie Glaubhaftigkeit und weniger Glaubwürdigkeit, obwohl auch diese
eine Rolle spielen kann (z.B. bei Zeugenaussagen von Bandenmitgliedern,
Netzwerken, Komplotten, Aussagekompetenzen; > Die
verwickelte Beziehung zwischen Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit).
Im Allgemeinen gelten Personen mit "gutem Ruf (Leumund)", z.B. Adelige,
Höher Gebildete, Reiche, Mächtige, RichterInnen, Staats-/AnwältInnen,
PolizistInnen, ÄrztInnen, PsychologInnen, GutachterInnen, PfarrerInnen,
BeamtInnen, Geschäftsleute, ProfessorInnen und DoktorInnen, als glaubwürdig,
Personen aus Milieus mit weniger gutem Ruf, Kriminelle, Rotlichtmilieuangehörige,
Unterschichtsangehörige, Prekariatsangehörige, Außenseiter,
"Spinner", psychisch Kranke, Minderbemittelte und Minderbegabte, als weniger
glaubwürdig. Diese Unterschiede und Vorurteile kennt die moderne Aussagepsychologie
nicht. Für sie ist klar, dass Adelige, Höher Gebildete, Reiche,
Mächtige, RichterInnen, Staats-/AnwältInnen, PolizistInnen, ÄrztInnen,
PsychologInnen, GutachterInnen, PfarrerInnen, BeamtInnen, Geschäftsleute,
ProfessorInnen und DoktorInnen ebenso lügen oder verleugnen können,
wie Kriminelle, Rotlichtmilieuangehörige, Unterschichtsangehörige,
Prekariatsangehörige, Obdachlose, Außenseiter, "Spinner", psychisch
Kranke, Minderbemittelte und Minderbegabte die Wahrheit sagen können.
[Nach]
Das Gericht kennt den wichtigen begrifflichen Unterschied,
der in der neueren Aussagepsychologie gemacht wird, wie die folgenden Fundstellen
belegen:
- S. 45: "In der Gesamtwürdigung der feststellbaren Abweichungen jeweils für sich gesehen und auch in ihrer Gesamtschau haben sich im Ergebnis keine durchgreifenden Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Nebenklägerin und der Glaubhaftigkeit ihrer Angaben ergeben: "
- S. 49: "In der Gesamtschau der Abweichungen in den Angaben ergeben sich keine durchgreifenden Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Angaben der Nebenklägerin und ihrer Glaubwürdigkeit: "
- S. 57: "Die an den vorgenannten Maßstäben orientierte Gesamtwürdigung führt zu dem Ergebnis, dass die Kammer vom festgestellten Sachverhalt überzeugt ist.
Es haben sich nämlich auch unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte der Beschuldigung, die Abweichungen in den Aussagen der Nebenklägerin und die von der Kammer ebenfalls in Betracht gezogenen Möglichkeit von Motiven für eine Falschbeschuldigung keine durchgreifenden Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Nebenklägerin und der Glaubhaftigkeit ihrer Angaben ergeben: ..."
Es gibt noch andere Fundstellen, die hier
- nachdem die Bedeutung klar gesichert ist - nicht weiter belegt werden.
Wichtig
ist hier, dass das Gericht nirgendwo erklärt, was seine Kriterien
für Glaubwürdigkeit sind und mit welchen Methoden das Gericht
die Glaubwürdigkeit prüft.
Anmerkungen:
(1) Das Jahrhunderturteil
des BGH zur Aussagepsychologie 1999 wird in der schriftlichen Urteilsbegründung
des LG nicht erwähnt. Mit diesem Jahrhunderturteil wurden einige neue
und zwingende Orientierungen gesetzt. Ein wichtiges Ergebnis war, dass
das jahrhundertealte Vorurteil glaubwürdig, also glaubhaft
aufgegeben wurde. Zentral war die Forderung, hypothesenorientiert vorzugehen.
Das Vorhandensein von genügend Realkennzeichen genügt nicht,
weil auch (auto-) suggestive Einflüsse die Merkmale einer Erlebnisfundierung
erzeugen können.
(2) Der
vom LG genutzte Kommentar von Fischer hat im Sachregister (hier 60. A.)
keine Einträge bei folgenden Worten: Glaubhaft, Glaubhaftigkeit, Glaubwürdig,
Glaubwürdigkeit.
Wie kann man herausfinden,
was das LG unter Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit versteht?
Das allgemeine, normale und insbesondere das wissenschaftliche Vorgehen
besteht darin, einen wichtigen Begriff beim ersten Gebrauch in der verwendeten
Bedeutung anzugeben, direkt erklärt oder durch einen
angemessenen und klaren Verweis mit genauer Fundstelle, also
kein Hochstaplerzitat, wie es
bei den PsychologInnen leider verbreitet ist. Ein solches übliches
Vorgehen pflegt die schriftliche Urteilsbegründung des LG Regensburg
nicht. Was kann man, ich, also tun, um dennoch den Bedeutungen näherzukommen?
Eine gute Methode ist: man schaut sich die Textstellen an und gewinnt aus
den Texten selbst Bedeutungsinformation. So kann man z.B. der Textstelle
S. 62 entnehmen, dass das Gericht folgende Aussage-Merkmale als Glaubwürdigkeitsindizien
verwendet: (keine) Übertreibungen, (kein) Belastungseifer, Einräumen
von Erinnerungslücken (eine der 19 vom BGH anerkannten Kriterien für
eine realerlebnisfundierte Merkmalsanalyse), Bemühen um eine zutreffende
- nicht übertriebene - Darstellung. Daher ist es sinnvoll, die Textstellen
mit entsprechenden Suchworten zu finden, um sozusagen durch den impliziten
Gebrauch, die Bedeutung zu erschließen.
Vorprüfung ausführliches und detailliertes Auswertungsbeispiel für die ersten 10 Textfundstellen bei Texten, die "glaubhaft" u.a. enthalten
In der Vorprüfung wurde untersucht, ob der Ansatz praktisch anwendbar
ist und auf alle 173 Textfundstellen ausgedehnt werden kann.
| Fundst | Aussag | Thema | Gh | Gw | Ue | kZ | Egh | Egw | Eue | EkZ | KritGh | KritGw | KritÜb | KritkZ |
| [Gh01] | M.Mas | Bezieh | J | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | gh0 | - | - | - |
| [Gh02] | Nebkl, Böh | Gewalt | J | - | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 | gh0 | - | ue0 | - |
| [Gh03] | Böh | Verletz | J | J | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | gh1 | gw1,gw2,
gw3 |
- | - |
| [Gh04] | Nebkl | 12.08.01 | J | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | gh0 | - | - | - |
| [Gh05] | Zeugen | Tatgesch | J | - | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 | gh2 | - | ue0 | - |
| [Gh06] | Nebkl | Tatgesch | J | - | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 | gh3 | - | ue1 | - |
| [Gh07] | Nebkl | 12.08.01 | J | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | gh4,gh5 | - | - | - |
| [Gh08] | Nebkl | Beschuld | J | J | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | gh6 | gw4,gw5 | - | kz1,kz2,
kz3, |
| [Gh09]
_ |
Nebkl, Sim,
Rei,Kr-Ol |
Tatgesch
_ |
J
_ |
J
_ |
-
_ |
-
_ |
0
_ |
0
_ |
0
_ |
0 | gh3,gh7,
gh8,gh9 _ |
-
_ |
-
_ |
- |
| [Gh10] | Sim | Tatgesch | J | J | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 | gh1, | gw1,gw5 | - | - |
Erklärungen der Abkürzungen
Fundstelle, Aussagende(r), Thema, Gh=Glaubhaftig/keit, Gw=Glaubwürdig/keit
Ue=überzeugend, kZ=kein(e) Zweifel
E=direkte Erklärung oder Verweis: Egh= direkte Erklärung
oder Verweis zu glaubhaft, Egw= direkte Erklärung oder
Verweis zu glaubwürdig, , Eue= direkte Erklärung
oder Verweis zu überzeugend, direkte Erklärung
oder Verweis zu keine(e) Zweifel.
KritGh=implizite Kriterien des LG für Glaubhaftigkeit
an der Fundstelle [Ghzz], KritGw=implizite Kriterien des LG für Glaubwürdig/keit
an
der Fundstelle [Ghzz], KritÜb=implizite Kriterien des LG für
überzeugend
an
der Fundstelle [Ghzz], KritkZ= implizite Kriterien des LG für
keine(e)
Zweifel an der Fundstelle [Ghzz].
Kriterien Glaubhaftig/keit, Glaubwürdig/keit, Überzeugend,
kein(e) Zweifel: J=Ja, N=Nein, - keine Bewertung, Ziffern gh, gw, ue, kz
verweisen auf implizit erwähnte Kriterien, so wie sie der Reihe nach
gefunden wurden, hier von [Gh01], [Gh02], ... [Gh10].
Hierbei gefundene
implizite Kriterien für Glaubhaftigkeit, Glaubwürdigkeit, Überzeugend,
kein(e) Zweifel
[...] := Fundstelle auf der Hilfsseite, kleine Buchstaben gh, gw, ue,
kz verweisen auf gefundene (implizite) Kriterien
| Kriterien Glaubhaftig/keit: J=Ja, N=Nein, - keine
Bewertung
gh0 =Keine Kriterien genannt gh1 =Erinnerungslücken eingeräumt [Gh03] gh2 =Bestätigung durch andere Zeugen [Gh05, Gh09] gh3 =zeitnahe Tatschilderungen [Gh06] gh4 =Einlassung Angeklagter HV [Gh07] gh5 =Schreiben Angeklagter [Gh07] gh6 =Nachvollziehbar [Gh08] gh7= in sich stimmig [Gh09] gh8= übereinstimmend [Gh09] gh9= vereinbare Äußerungen [Gh09] _ Kriterien überzeugend J=Ja, N=Nein, - keine Bewertung ue0 = Keine Kriterien genannt ue1 = keinerlei überzeugendes [zirkulär?] Motiv für Falschbeschuldigung [Gh06] |
Kriterien Glaubwürdig/keit: J=Ja, N=Nein, -
keine Bewertung
gw0 =Keine Kriterien genannt gw1 =kein Belastungseifer [Gh03] gw2 =kein Motiv für eine Falschbezichtigung [Gh03] gw3 =keine persönlichen Kontakte [Gh03] gw4 =Entstehungsgeschichte der Beschuldigung [Gh08] gw5 =Abweichungen in den Aussagen [Gh08, Gh10] gw6 =um zutreffende Aussagen bemüht [Gh10] _ Kriterien kein(e) Zweifel J=Ja, N=Nein, - keine Bewertung kz0= Keine Kriterien genannt kz1= Entstehungsgeschichte [Gh08] kz2= Abweichungen (Aussagen) [Gh08] kz3= Mögliche Motive für Falschbeschuldigung [Gh08] _ Die Differenzieung "durchgreifend" beim Zweifel ist hier noch nicht berücksichtigt, wohl unten, in der Gesamtauswertung. |
Gesamtauswertung der Textfundstellen
Erfassungen nach Suchwortteilen
Vorbemerkung: Suchen von glaubhaft oder glaubwürdig findet auch
unglaubhaft/igkeit oder unglaubwürdig/keit, was genauso informativ
ist:
- a un/Glaubhaft
in welchen Textstellen kommt glaubhaft vor? [83 Fundstellen]
b un/Glaubhaft in welchen Textstellen kommt nur glaubhaft und nicht glaubwürdig vor? [56 Fundstellen]
c un/Glaubwürdig in welchen Stellen kommt glaubwürdig vor? [33 Fundstellen]
d un/Glaubwürdig in welchen Stellen kommt nur glaubwürdig und nicht glaubhaft vor? [6 Fundstellen]
e un/Glaubhaft und un/glaubwürdig - in welchen Textstellen kommen beide vor? [27 Fundstellen]
f Überzeugend oder "nicht überzeugend" bei Aussagen. [36 Fundstellen]
g Kein(e) Zweifel in welchen Stellen kommt kein(e) Zweifel vor? [21 Fundstellen]
h kein(e) durchgreifenden Zweifel in welchen Stellen kommt kein(e) durchgreifenden Zeifel vor? [10 Fundstellen]
- Querverweis: Zusätzliche
Erfassungen für ergänzende Studien.
Systematische Methodik Prüfung der Glaubhaftigkeit, Glaubwürdigkeit, Überzeugend, kein(e) Zweifel, kein(e) durchgreifenden Zweifel
| Allgemeiner
Diagnosenbegriff [Quelle]
(1a) Ein Sachverhalt liegt (nicht) vor. (1b) Ein Sachverhalt liegt (nicht) in dieser oder jener Ausprägung vor. |
Hier liegt ein allgemeines "Diagnose"-Problem vor, d.h. es sind Daten des Erlebens, Verhaltens, Körpers oder von Spuren gesucht, die (Un-) Glaubhaftigkeit, Glaubwürdigkeit, Überzeugendes, kein(e) Zweifel anzeigen können. Ähnlich wie in den psychopathologischen Diagnosesystemen stellen sich dann zwei z.T. schwierig zu beantwortende Fragen:
- wie viele Kriterien gibt es jeweils und wie viele müssen mindestens erfüllt sein, damit es zur Bewertung "glaubhaft", "glaubwürdig" oder "überzeugend" kommt?
- welche Methoden stehen zur Verfügung, um das Vorhandensein, Nichtvorhandensein oder so oder so ausgeprägtes Vorhandensein der jeweiligen Kriterien festzustellen?
Vorbemerkung
zu glaubwürdig und glaubhaft
Manche Methoden und Kriterien können sowohl bei der Glaubhaftigkeits-
als auch bei der Glaubwürdigkeitsbeurteilung eine Rolle spielen, so
z.B. die Entstehungsgeschichte der Aussage oder das Aufkommen der Anzeige.
Alle Beurteilungen und Bewertungen beruhen natürlich auf dem - letztlich
gruppensubjektiven
- Dafürhalten der RichterInnen, allerdings auf dem höheren Niveau
einer Delphimethode, wenn
es mehrere RichterInnen sind. Wenn Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit
eine zentrale Rolle spielen, so ist zu verlangen, dass diese beiden Begriffe
klar und richtig gehandhabt werden.
- Exkurs: Subjektiv
und objektiv glaubhaft - Aussagepsychologischer Sachverständiger und
Gericht
Ob Aussagen objektiv glaubhaft, also als Tatsachen zu werten sind oder nicht, entscheidet das Gericht in seiner Beweiswürdigung und ist nicht die Aufgabe z.B. einer aussagepsychologischen Sachverständigen. Ihre Aufgabe ist es, die subjektive Glaubhaftigkeit (Realerlebnisfundierung) zu erforschen. Ob und wie ihre Ergebnisse zur subjektiven Glaubhaftigkeit (Realerlebnisfundierung) durch das Gericht Berücksichtigung finden, ist der Sachverständigen selbst entzogen. Sie hat hier die Rolle als Diener, Helfer oder Berater.
Exkurs: Metasprache
und "Metamerkmale"
Es gibt sprachliche Äußerungen in einer Sprache
(Objektsprache) und es gibt Äußerungen über
die Äußerungen (Metasprache). Sagt jemand: "Es regnet", so ist
das eine Äußerung in einer Sprache. Sagt jemand über die
Äußerung: Es ist wahr, dass es regnet, so liegt eine metasprachliche
Äußerung vor.
Glaubhaft und glaubwürdig sind
nun metasprachliche Ausdrucke ähnlich wie z.B. wahr und falsch.
Die objektsprachlichen Grundlagen sind Aussagen und ihr Ausdruck. Glaubhaft
bezieht sich auf Aussagen, glaubwürdig auf die Person (zur
Bedeutung).
Glaubhaftigkeitsmerkmale sollten sich in Aussagen,
Glaubwürdigkeitsmerkmale in Personen finden. Wenn glaubhaft ein Metamerkmal
von Aussagen ist, dann müssen die Kriterien ausschließlich in
den Aussagen selbst zu finden sein. Alles, was sich in Aussagen nicht
finden lässt, aber dennoch zur Beurteilung für die Glaubhaftigkeit
von Angaben herangezogen wird, gehört daher zur Glaubwürdigkeit
und zur Person. Dazu gehören z.B. die Interessenlage und die Beziehung
zu Betroffenen von der Aussage, aber auch die Aussagenkompetenz, die Lebenserfahrung,
die Gedächtnisleistung und Erinnerungsfähigkeiten, die Beobachtungsgabe,
Wahrnehmung und Aufmerksamkeit.
| Praktische Prüfregel: Lässt sich eine Beurteilung oder Bewertung nicht aus den Aussagen gewinnen, gehören Beurteilung oder Bewertung zur Glaubwürdigkeit oder zu einem anderen Thema. |
Vorgehen in der
Aussagepsychologie In Aussagen finden sich nun eine Reihe von Merkmalen
M1, M2, M3, ... z.B. ein gewisser Detailreichtum, eine gewisse Folge der
Handlungsschilderungen, gewisse Erinnerungsunsicherheiten u.a.m. Diese
Merkmale M1, M2, M3, ... und ihre Verbindungen können nun in einem
ersten Schritt einer Glaubhaftigkeitsanalyse unterzogen werden (Merkmalsanalyse
nach Realkennzeichen). Man erhält in diesem ersten Schritt so eine
ganze Reihe von Indizien für subjektiv glaubhafte Merkmale
in den Aussagen. Diese können aber auf unterschiedliche Wirkfaktoren
zurückzuführen sein, z.B. auf autosuggestive oder suggestive
Einflüsse, auf bestimmte Motive (z.B. Belastungs- oder Entlastungsmotive)
oder Interessen, Verpflichtungen, Phantasietätigkeit, andere Erfahrungen,
die sich hier hinein- und vermischen können u.a.m. In einem zweiten
Schritt ist daher dann hypothesenorientiert zu untersuchen, welche der
Aussageteile wie zu beurteilen sind. Im Prinzip stehen hier vier Grundwertungen
zur Verfügung: (1) Indiz für subjektiv glaubhaft (erlebnisfundiert),
(2) Indiz für nicht subjektiv glaubhaft (erlebnisfundiert), (3) keinerlei
Indiz=neutral für subjektiv glaubhaft (weder-noch), (4) unklar ob
subjektiv-glaubhaft (erlebnisfundiert). Nun ist hypothesenorientiert so
lange zu erörtern bis für die Gesamtaussage oder bestimmte Teile
nur noch die Glaubhaftigkeitshypothese übrig bleibt oder abgebrochen
werden muss, weil sich andere Hypothesen nicht - hinreichend sicher - widerlegen
lassen: dann konnte die Glaubhaftigkeitshypothese nicht bestätigt
werden.
| Noch wichtig die Unterscheidung > Aussagemethodologie und Aussagepsychologie. |
Systematische
Überlegungen
_
Die allgemeine systematische Methodik lässt sich für die
fünf
Begriffe glaubhaft, glaubwürdig, überzeugend, kein(e) Zweifel,
kein(e) durchgreifenden Zweifel, wie folgt beschreiben:
Glaubhaftigkeit, glaubhaft Bewertung
- Def-gh Voraussetzungen: Es muss eine klare Definition vorliegen und hierzu ausreichend Sachverhalte, Spuren oder Aussagen korrekter Vernehmungen (Exploration; >Fehler) vorliegen. Anmerkung: Wird von der forensischen Psychiatrie oft ignoriert oder nicht erfüllt und mit okkultenMeinungs- und Aktenachten überbrückt.
- Krit-gh Methoden der Glaubhaftigkeitsprüfung: Realkennzeichen-Analyse der Aussagen, Hypothesen-Prüfung der Aussagen; Kognitive Kompetenzanalyse, Gedächtnis- und allgemeine Aussageanalyse, Vernehmung (Exploration), Vergleiche extern (Zeugen) und intern (Konstanz), Spuren. Entstehungsgeschichte der Aussage, Aufkommen der Anzeige, ....
- fKrit-gh Formale Darstellung der Kriterien der Glaubhaftigkeit: KGh1, KGh2, KGh3, ...
- Krit-gh-Bsp Beispiele Kriterien der Glaubhaftigkeit: KGh1= Einräumen von Erinnerungslücken; KGh2 = Spontane oder freie Berichterstattung auf offene Fragen; KGh3=sprunghafte (ungeordnete) Darstellung; KGh4= berichten von Komplikationen, ... ... und hier z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... aus MK. Minimal sollte wenigstens eine Methode der Prüfung angegeben werden. Die einfachste, wenn auch methodologisch nicht vertretbare ist das meinen, bloße glauben oder Dafürhalten.
- Erf-gh Formale Darstellung der Methoden der Prüfung ob oder wie sehr ein Kriterium von glaubhaft gegeben ist: MKGh1, MKGh2, MKGh3, ...
- Meth-gh Methoden der Prüfung: MKGh1= Eindruck vom Ausdrucksverhalten (z.B. "normales" Verhalten für die betrachtete Situation, also keine bemerkten Störungen und Abweichungen), ...
Glaubwürdigkeit,
glaubwürdig Bewertung
- Def-gw Voraussetzungen: Es muss eine klare Definition vorliegen und hierzu ausreichend Sachverhalte, Spuren oder Aussagen korrekter Vernehmungen (Exploration; >Fehler) vorliegen. Anmerkung: Wird von der forensischen Psychiatrie oft ignoriert oder nicht erfüllt und mit okkultenMeinungs- und Aktenachten überbrückt.
- Krit-gw Methoden der Glaubwürdigkeitsprüfung: Ruf; Entwicklungsstand; Kompetenz; Motivations-, Interessen- und Beziehungsanalyse. Entstehungsgeschichte der Aussage, Aufkommen der Anzeige, ....
- fKrit-gw Formale Darstellung der Kriterien der Glaubwürdigkeit: KGw1, KGw2, KGw3, ...
- Krit-gw-Bsp Beispiele Kriterien der Glaubwürdigkeit: KGw1 =kein Belastungseifer, KGw2 =unbefangen und neutral gegenüber den Parteien (Zeugen), KGw3 =Rufanalyse (Charakter, Persönlichkeit, Biographie) ....
- Erf-gw Formale Darstellung der Methoden der Prüfung ob oder wie sehr ein Kriterium von glaubwürdig gegeben ist:: MKGw1, MKGw2, MKGw3, ... und hier z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... aus MK. Minimal sollte wenigstens eine Methode der Prüfung angegeben werden. Die einfachste, wenn auch methodologisch nicht vertretbare ist das meinen, bloße glauben oder Dafürhalten.
- Meth-gw Beispiele Methoden der Prüfung: MKGw1= Vernehmung; MKGw2 = Eindruck vom Ausdrucksverhalten (z.B. "normales" Verhalten für die betrachtete Situation, also keine bemerkten Störungen und Abweichungen); MKGw3 =Motivations- und Interessenanalyse, MKGw4 =Vergleichen (mit Lebenssituationen), ....
Vorbemerkung
zu "überzeugend" und "kein(e) Zweifel" oder kein(e) durchgreifenden
Zweifel
In der juristischen Literatur habe ich bislang keine Ausführungen
gefunden, die Begriff, Operationalisierung, Kriterien und Methoden der
Feststellung von "überzeugend" oder "kein(e) Zweifel Bewertungen darlegen,
so dass ich hier eigene heuristische
und intuitive Ideen
einbringe, die an dieser Stelle natürlich nur hypothetischen Vorschlagscharakter
haben können (weil Neuland). Außerdem können sich hier,
wenn man "überzeugend" (auch) als Rechtsbegriff auffasst, Unterschiede
zu anderen Begriffen ergeben. Rein sprachlich haben wir es immer mit mindestens
vier Begriffssprachen bzw. Sprachtypen zu tun, nämlich Alltagssprache
(die sich regional auch sehr unterscheiden kann), Bildungssprache, Fachsprache
1,2,3, ..., Rechtsbegriff (mehr hierzu in Teil 3 und 5). Deshalb sind Rechtstexte
nicht selten, auch wenn sie äußerlich ganz vernünftig
und harmlos aussehen, ein Kauderwelsch aus diesen vier Sprachen
oder Sprachtypen. Das macht Rechtsdiskussionen oft so schwierig, insbesondere
zwischen Rechtskundigen und Rechtsunkundigen. Es ist auch unklar, wie so
vieles in der Rechtssprache (> Justizias
Loreley), ob sich die Bewertung "überzeugend" auf Glaubhaftigkeit,
Glaubwürdigkeit oder beides bezieht oder beziehen kann. Sofern sich
"überzeugend" auf Glaubwürdigkeit bezieht, ist große Vorsicht
angesagt, weil z.B. manche Lügner oder Soziopathen, Hochstapler, Histrioniker
(>Normalform),
Schauspielbegabte, Maniforme oder Paranoide sehr, sehr überzeugend
wirken können.
- Def-ue Voraussetzungen: Es muss eine klare Definition vorliegen und hierzu ausreichend Sachverhalte, Spuren oder Aussagen korrekter Vernehmungen (Exploration; >Fehler) vorliegen.
- Krit-ue Methoden der überzeugend Bewertung: Kann auch synonym mit der Bedeutung von glaubhaft oder glaubwürdig gebraucht werden, was dann aber ausgewiesen werden sollte. Zusammenpassen ("stimmig", "homogen") mit anderen Sachverhalten, keine Widersprüche, im Einklang mit der Erfahrung oder der Wissenschaft.
- fKrit-ue Formale Darstellung der Kriterien des Überzeugenden: KU1, KU2, KU3, ...
- Krit-ue-Bsp Beispiele Kriterien des Überzeugenden: KU1 =im Einklang mit allgemeiner Erfahrung; KU2 =situationsangemessen, KU3 = nachvollziehbar, KU4 =verständlich, KU5 =vereinbar mit anderen festgestellten Sachverhalten, ...
- Erf-ue Formale Darstellung der Methoden der Prüfung ob oder wie sehr ein Kriterium von Überzeugendem gegeben ist: : MKU1, MKU2, MKU3 ... und hier z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... aus MK. Minimal sollte wenigstens eine Methode der Prüfung angegeben werden. Die einfachste, wenn auch methodologisch nicht vertretbare ist das meinen, bloße glauben oder Dafürhalten.
- Meth-ue Beispiele Methoden der Prüfung: MKU1= Zusammenpassen ("stimmig", "homogen"): MKU1.1= Zeuge berichtet von Zug, wenn die Tür und das Fenster auf sind, zieht es, es wird festgestellt, dass eine Tür und ein Fenster auf war [aber: es herrschte Windstille]. MKU1= Zusammenpassen ("stimmig", "homogen"): MKU1.2= Zeuge berichtet ungenau, in der Dämmerung werden die Wahrnehmungen unschärfer und ungenauer, es wird festgestellt, dass die Wahrnehmungen in der Dämmerung stattfanden etwa durch Einholen eines Wettergutachtens.
- Def-kz Voraussetzungen: Es muss eine klare Definition vorliegen und hierzu ausreichend Sachverhalte, Spuren oder Aussagen korrekter Vernehmungen (Exploration; >Fehler) vorliegen.
- Krit-kz Methoden der kein(e) Zweifel Bewertung: Kann auch synonym mit der Bedeutung von glaubhaft oder glaubwürdig gebraucht werden, was dann aber ausgewiesen werden sollte. Zusammenpassen ("stimmig", "homogen") mit anderen Sachverhalten, keine Widersprüche, im Einklang mit der Erfahrung oder der Wissenschaft.
- fKrit-kz Formale Darstellung der Kriterien kein(e) Zweifel: KZ1, KZ2, KZ3, ...
- Krit-kz-Bsp Beispiel Kriterien kein(e) Zweifel:: wie überzeugend: KZ1 =im Einklang mit allgemeiner Erfahrung; KZ2 =situationsangemessen, KZ3 =nachvollziehbar, KZ4 =verständlich, KZ5 =vereinbar mit anderen festgestellten Sachverhalten, ...
- Erf-kz Formale Darstellung der Methoden der Prüfung ob oder wie sehr ein Kriterium kein(e) Zweifel gegeben ist: : MKZ1, MKZ2, MKZ3, ... und hier z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... aus MK. Minimal sollte wenigstens eine Methode der Prüfung angegeben werden. Die einfachste, wenn auch methodologisch nicht vertretbare ist das meinen, bloße glauben oder Dafürhalten.
- Meth-kz Beispiele Methoden der Prüfung: MKZ1 = Zusammenpassen ("stimmig", "homogen"): Zeuge berichtet, er habe sich eingenässt vor Angst, durch Spuren gesichert, passt zur Schilderung der Gewalterfahrung. MKZ2 = glaubhafte Schilderung: Zeuge berichtet Geschichte mit stimmigen Handlungsfolgen mit vorher, Handlung, nachher, auch nachvollziehbaren Nebensächlichkeiten, frei, etwas ungeordnet, mit Erinnerungslücken und spontanen Verbesserungen, im Kerngeschehen bei Wiederholung weitgehend konstant.
keine durchgreifenden
Zweifel Bewertung
Obwohl der Begriff dem Sinn nach insoweit klar ist, dass zwar Zweifel
vorliegen, aber diese sind nicht so stark, dass sie griffen. Aber wie oder
wodurch kommt das? Wann werden Zweifel zu durchgreifenden, wann nicht?
Mit der Einführung der (nicht) durchgreifenden Zweifel werden mindestens
drei Ausprägungen auf der Dimension Zweifel konstituiert: keine Zweifel,
keine durchgreifenden Zweifel und Zweifel. Fügt man als vierte
Ausprägung noch erhebliche Zweifel hinzu, so liegt eine theoretische
Zweifelsskala mit vier Ausprägungen vor.
Die Standard-Zweifel-Skala in juristischen Entscheidungen in Fuzzy-Darstellung

- Def-dz Voraussetzungen: Es muss eine klare Definition vorliegen und hierzu ausreichend Sachverhalte, Spuren oder Aussagen korrekter Vernehmungen (Exploration; >Fehler) vorliegen.
- Krit-dz Methoden der keine durchgreifenden Zweifel Bewertung: Kann auch synonym mit der Bedeutung von überwiegend glaubhaft oder überwiegend glaubwürdig gebraucht werden, was dann aber ausgewiesen werden sollte. Zusammenpassen ("stimmig", "homogen") mit anderen Sachverhalten, keine Widersprüche, im Einklang mit der Erfahrung oder der Wissenschaft.
- fKrit-dz Formale Darstellung der Kriterien kein(e) Zweifel: KZ1, KZ2, KZ3, ...
- Krit-dz-Bsp Beispiel Kriterien kein(e) Zweifel:: wie überzeugend: KZ1 =im Einklang mit allgemeiner Erfahrung; KZ2 =situationsangemessen, KZ3 =nachvollziehbar, KZ4 =verständlich, KZ5 =vereinbar mit anderen festgestellten Sachverhalten, ...
- Erf-dz Formale Darstellung der Methoden der Prüfung ob oder wie sehr ein Kriterium kein(e) Zweifel gegeben ist: : MKZ1, MKZ2, MKZ3, ... und hier z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... aus MK. Minimal sollte wenigstens eine Methode der Prüfung angegeben werden. Die einfachste, wenn auch methodologisch nicht vertretbare ist das meinen, bloße glauben oder Dafürhalten.
- Meth-dz Beispiele Methoden der Prüfung: MKZ1 = Zusammenpassen ("stimmig", "homogen"): Zeuge berichtet, er habe sich eingenässt vor Angst, durch Spuren gesichert, passt zur Schilderung der Gewalterfahrung. MKZ2 = glaubhafte Schilderung: Zeuge berichtet Geschichte mit stimmigen Handlungsfolgen mit vorher, Handlung, nachher, auch nachvollziehbaren Nebensächlichkeiten, frei, etwas ungeordnet, mit Erinnerungslücken und spontanen Verbesserungen, im Kerngeschehen bei Wiederholung weitgehend konstant.
Das Problem der Operationalisierung und der Mindest-Erfüllung des operationalen Begriffsumfanges (Anzahl der Kriterien).
Seelisch-Geistiges kann man derzeit noch nicht ausreichend gut direkt beobachten. Es wird daher notgedrungen erschlossen. Dieses Erschließen ist mit mannigfachen Schwierigkeiten und Problemen verbunden. Die Grundlage aller menschlichen Beurteilung und Bewertung sind Daten und Informationen des Erlebens, Verhaltens und des Körpers, sowie die Spuren, die Erleben, Verhalten und der Körper hinterlassen. Mit der Güte und Sicherheit dieser Grundlage steht und fällt jede höhere Beurteilung und Bewertung, z.B.: Symptom-Zuordnung, Syndrom-Zuordnung, Befund, Diagnose, Auswirkung bei der strafbaren Handlung. Die meisten seelisch-geistigen Begriffe sind Konstruktionen unseres Geistes, gewonnen aus unserer Selbst-, Fremd- und Lebenserfahrung, eingebettet in reale Lebenszusammenhänge, also durch Interaktion und Sozialisation erworben. Die geringsten Probleme gibt es daher, wenn es gelingt, die Konstruktionen unseres Geistes mit Konkretem, Praktischem auf der Handlungsebene zu verknüpfen.
Die Begriffskonstruktionen glaubhaft, glaubwürdig, überzeugend, kein(e) Zweifel kann man nicht direkt beobachten. Man erschließt ihr mehr oder minder ausgeprägtes Vorhandensein aus verschiedenen Aussagen, Beobachtungen und Spuren. Damit sind wir beim Problem der Operationalisierung angelangt, das in den Sozialwissenschaft und in der Wissenschaftstheorie seit bald 100 Jahren intensiv erörtert und beforscht wird. Die Rechtswissenschaft und die Rechtsprechung scheint davon allerdings wenig berührt zu sein.
Vieles, was wir Seele und Geist zurechnen, ist nicht direkt beobachtbar.
Die Merkmale von Seele und Geist
sind Konstruktionen. Daher sind Aussagen über Seele und Geist (befinden,
fühlen, denken, wünschen, wollen, eingestellt sein, ...) besonders
anfällig für Fehler. Damit man sich nicht in rein geistigen Sphären
bewegt, ist es daher in vielen Fällen sinnvoll, ja notwendig, unsere
Konstruktionen seelischer Merkmale und Funktionsbereiche an Konkretes,
Sinnlich-Wahrnehmbares,
Zählbares
zu knüpfen. Damit haben wir die wichtigsten praktischen Kriterien
für Operationalisiertes benannt (in Anlehnung an das test-theoretische
Paradigma; Stichwort Operationalisierung
bei Einsicht und Einsichtsfähigkeit)
Ein Begriff kann demnach als operationalisiert gelten,
wenn sein Inhalt durch wahrnehm- oder zählbare
Merkmale bestimmt werden kann. Viele Begriffe in der Psychologie, Psychopathologie,
in Gesetzen und in der Rechtswissenschaft sind nicht direkt beobachtbare
Konstruktionen des menschliches Geistes und bedürften daher der Operationalisierung.
Welcher ontologische
Status oder welche Form der Existenz ihnen zukommt, ist meist unklar.
In der Psychopathologie und Psychotherapie hat man, um aus dem unerträglichen Chaos in der Psychodiagnostik herauszukommen, Kriterienlisten entwickelt, in denen die Bedingungen formuliert werden, die erfüllt sein müssen, um eine Diagnose zu vergeben (Beispiel für Persönlichkeitsstörung und Prof. Dr. Nedopils Fehlleistung hier). Das kann für einige Fälle, aber natürlich nicht für alle, verallgemeinert werden. Die schwächste Formulierung, die man verlangen muss, lautet: es sind die Kriterien anzugeben, die man angewandt hat, um einen Begriff zu operationalisieren, so dass man kontrollieren und nachprüfen kann - ein allgemeines Kriterium für Wissenschaftlichkeit - , wie man zu seiner Beurteilung und Bewertung gelangt ist. Hierbei kann man ganz allgemein für Sachverhalte und ihr Vorliegen oder Nichtvorliegen folgende Fallunterscheidungen treffen:
Sachverhalts-Qualitäts-
und Bewertung-Tabelle
| Sachverhalt / Qualität |
|
|
|
|
| liegt (so ausgeprägt) vor |
|
|
|
|
| liegt (so ausgeprägt) nicht vor |
|
|
|
|
Anmerkung: Bei der Sachverhaltsformulierung kann manchmal das sog. Problem der "Polung" Verwirrung stiften (Beispiele hier).
Die Bewertung vorliegender
Sachverhalte / Kriterien
Gibt es n formulierte Kriterien für das Vorliegen, so können
daraus m <= n vorliegen. Im ICD-10 oder DSM-5 verlangt man z.B., dass
6 aus 9 - neben anderen Bedingungen - Kriterien erfüllt sein müssen
(Beispiel Borderlinestörung
im DSM III und IV). Im Recht sind mir solche Regelorientierungen unbekannt,
was meist mit der Dicken Berta der freien Beweiswürdigung gerechtfertigt
wird. Hier fragt sich: welche und wie viele
Kriterien ("Gesamtschau" der Kriterien) in welcher Ausprägung
müssen für glaubhaft, glaubwürdig, überzeugend, kein(e)
Zweifel gegeben sein, um eine entsprechende Beurteilung und Bewertung begründet
abgeben zu können?
Die Bewertung fehlender Sachverhalte
/ Kriterien
Beurteilungen und Bewertungen können sich auch aus dem Fehlen
positiver Kriterien ergeben, wenn z.B. in einer komplizierten und komplexen
Handlungsschilderung keine Komplikationen erwähnt werden, was zu den
Umständen nicht passt. Das würde dann nicht für Glaubhaftigkeit
gewertet werden. Fehlt hingegen ein Belastungsmotiv, so würde das
für spezielle Glaubwürdigkeit, also Glaubhaftigkeit
in diesem Kontext sprechen.
Die Bewertung in der
Gesamtschau
Vernünftigerweise wird man alle für relevant
befundenen Daten und Informationen in einer Gesamtbetrachtung zusammenfassend
und abschließend beurteilen und bewerten. Hier ist natürlich
zu fordern, dass die Daten- und Informationsbasis aller beurteilten und
bewerteten Daten und Informationen ausgewiesen und ihre Auswahl zur Menge
der für relevant befundenen Daten und Informationen begründet
wird. Für die Beurteilung und Bewertung in der Gesamtschau sind
dann folgende Ergebnisse möglich:
|
|
chend erfüllt |
|
teilweise nein |
feststellbar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Probleme der Prüfung und Feststellung ob Glaubhaftigkeit, Glaubwürdigkeit, Überzeugendes oder kein(e) Zweifel vorliegen.
Welche Anforderungen sind an die
Begründung zu stellen?
Genügt die bloße Nennung? Genügt die bloße Behauptung?
Oder sind inhaltliche Begründungen zu fordern, die zur jeweiligen
Bewertung führen, damit nennen und behaupten nicht bloße Entscheidungsphrasen
sind.
Anerkennung der Grenzen
Jede Methode hat ihre Grenzen, insbesondere die der Begründung,
will man nicht in einem praktisch unvertretbaren unendlichen Regress nicht
endender Begründungsfragen landen. Praktisches Begründen ist
natürlich endlich und muss es auch sein. Die Gretchenfrage ist natürlich:
wo fängt diese Grenze jeweils an und wo endet sie im Einzelfall? Im
Urteil argumentiert das LG z.B. mit seinem "persönlichen Eindruck"
in der Zeugenbeurteilung [Gh24, S.
39]. Darf, soll man es damit bewenden lassen? Soll der Verweis nach persönlichem
Eindruck" genügen oder muss man da mehr verlangen? Das ist schon deshalb
kritisch zu hinterfragen, weil Prozesse theatralische Elemente enthalten,
wo oft Oberfläche, Schein und Spiel mehr Gewicht erhalten als der
Rechtsidee dient.
Gerichte, Justiz und Polizei sind überlastet und
müssen von daher auf Ökonomie achten, wenn Prozesse sich nicht
viele Jahre und über die Verjährung hinaus hinziehen sollen.
Das führt zu folgenden Problemkreisen mit den folgenden Fragen:
- Jede Methode und jeder Begründungsweg hat Grenzen
- Wie kann und soll mit methodischen Problemen umgegangen werden?
- Wo darf man aufhören?
- Welche Lücken darf man hinnehmen?
- Welche Sicherheit kann verlangt werden?
Als Orientierungsregel kann gelten: so viel Aufwand wie möglich,
aber nicht mehr als nötig oder vertretbar. Man muss auch erkennen
lernen, wann man aufhören muss, weil die Mittel und Möglichkeiten
erschöpft oder zu aufwändig sind und es dann auch tun. Auch hier
stellen sich in der konkreten Praxis dann die operationalen Fragen: was
bedeutet möglich, nötig, vertretbar? Aber dieses
Fass mache ich jetzt nicht auch noch auf.
Zusammenfassung Glaubhaftigkeit, Glaubwürdigkeit und des Überzeugenden, kein(e) Zweifel
Befangenheitskontrolle
Zur Bewertungs- und Begründungs-Sprache des LG und seiner impliziten
Kriterien. Nachdem das LG seine grundlegenden Begriff nicht direkt erklärt
und auch Verweise mit klar definierten Fundstellen nicht für nötig
erachtet, musste ich interpretieren. Das ist immer gefährlich und
mit einigen Fehlermöglichkeiten behaftet. In meinem Falle besonders,
weil ich als Mitglied des erweiterten Unterstützerkreises von Gustl
Mollath natürlich befangen bin. Schon deshalb musste ich gegen motivierte
Interpretationsfehler meinerseits besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:
- Ich habe meine Analyse Methode vollständig transparent und in jedem Schritt für andere kontrollierbar konzipiert, so dass es bei diesem Vorgehen schwierig ist, einseitig oder manipulativ zu sein, ohne dass es bemerkt wird. Das bewirkt schon einige Selbstkontrolle und Disziplinierung.
- Ich habe bei den Fundstellen keine Auswahl getroffen, sondern alle signiert, um Selektionsfehler auszuschließen.
- Ich habe konservativ gegen ein Motiv, dem LG unbedingt Fehler nachweisen zu wollen, interpretiert und deshalb eher Aufnahmen und Redundanzen bei den Kriterien in Kauf genommen, um diesen Fehler möglichst auszuschließen. Das Prinzip heißt also: im Zweifel für das LG.
- Ich habe meine Frau dafür gewonnen, kritisch Korrektur zu lesen. Sie ist meist meine erste und auch beste Kritikerin.
Das schließt Interpretationsfehler und halbbewusste Manipulationen
natürlich nicht aus, aber die Kontrollmaßnahmen sollten minimierend
wirken. Dennoch meine Bitte an LeserInnen, sich mit Kritik nicht zurückzuhalten,
Fehler, Mängel oder Irrtümer mitzuteilen (danke), die ich natürlich
nicht
ausschließena,b,wis kann.
Ergebnis-Fazit: Die schriftliche
Urteilsbegründung zeigt aus allgemeiner wissenschafts-methodologischer
Sicht mehr Fehler, Mängel, Schwächen, Ungereimtheiten und schwere
Unklarheiten als ein Mensch Knochen hat (also >200).
Diese Wertung beruht auf einer vollständigen
Untersuchung der ausgewiesenen Textstellen, und nicht auf einer selektiven
Auswahl, wie es in Gerichtsentscheidungen und in forensisch-psychiatrischen
"Gutachten" nicht selten üblich ist. Alle Textstellen,
das ist hier keine Worthülse, werden ganz konkret im einzeln
belegt, analysiert und bewertet und jeder mit einem IQ >= 90, der der deutschen
Sprache mächtig ist, über etwas Lebenserfahrung verfügt
und gesunden Menschenverstand hat, kann dies - getreu Sapere
aude! - selber kontrollieren und kritisch überprüfen.
Erläuterung
der Methode am Beispiel glaubhaft
Betrachte die Textstelle, in der das Wort "glaubhaft" vorkommt
und suche darin nach Begründungen für glaubhaft. Beispiel: S.
13.1:
- "Die Angaben der Zeugin Böh erweisen sich als glaubhaft
und die Zeugin selbst als glaubwürdig, zumal sie unumwunden Erinnerungslücken
[=gh1] eingeräumt und keinerlei Belastungseifer hat erkennen lassen.
So hat die Zeugin erklärt, dass sie nicht wisse, ob die Nebenklägerin
Verletzungen oder blaue Flecken gehabt habe. Ein Motiv für eine Falschbezichtigung
ist auch nicht erkennbar, da die Zeugin nach eigenem Bekunden seit dem
geschilderten Vorfall weder zum Angeklagten noch zur Nebenklägerin
persönliche Kontakte hatte."
- 003: 0100 [Gh03] gh1;
Zeugin Böh glaubhaft und glaubwürdig. Doppelzuordnung. In der
Aussagepsychologie gehört dieses Kriterium (Erinnerungslücken)
zur Glaubhaftigkeit. Aussagepsychologische Glaubhaftigkeitskriterien sollten
sich ausschließlich aus den Aussagen selbst ergeben.
Solche Unklarheiten durchziehen das ganze Urteil.
Das Einräumen von Erinnerungslücken wird vom BGH-Urteil zur Aussagepsychologie
1999 als Kriterium Nr. 15 für Glaubhaftigkeit angeführt. Aber
natürlich meint man da nicht, dass Erinnerungslücken nach über
10 Jahren als aussagepsychologisches Glaubhaftigkeitskriterium zu feiern
sind, wie das das LG absurderweise z.B. bei den Zeugen Feld, Hei,
West, Dr. Leip und Mas [Gh24], Böh
[Gh03] oder Sim [Gh10]
tut.
Die schriftliche Urteilsbegründung wurde nach folgenden Worten durchsucht:
- a un/Glaubhaft
in welchen Textstellen kommt glaubhaft vor? [83 Fundstellen]
b un/Glaubhaft in welchen Textstellen kommt nur glaubhaft und nicht glaubwürdig vor? [56 Fundstellen]
c un/Glaubwürdig in welchen Stellen kommt glaubwürdig vor? [33 Fundstellen]
d un/Glaubwürdig in welchen Stellen kommt nur glaubwürdig und nicht glaubhaft vor? [6 Fundstellen]
e un/Glaubhaft und un/glaubwürdig - in welchen Textstellen kommen beide vor? [27 Fundstellen]
f Überzeugend oder "nicht überzeugend" bei Aussagen. [36 Fundstellen]
g Kein(e) Zweifel in welchen Stellen kommt kein(e) Zweifel vor? [21 Fundstellen]
h kein(e) durchgreifenden Zweifel in welchen Stellen kommt kein(e) durchgreifenden Zweifel vor? [10 Fundstellen]
Anmerkung: Zusätzliche
Erfassungen für ergänzende Studien mit einstweiligen Fundstellenbelegen.
Die Ziffern zzz vor dem Doppelpunkt kennzeichen die Textstelle: glaubhaft 1-83, glaubwürdig 84-116, überzeugend 117-152, kein(e) Zweifel 153-173. Nach dem Doppelpunkt bedeutet
- Def: die erste Stelle in Zzzz Begriff erklärt=1 oder nicht=0;
- Krit: die zweite Stelle in zZzz Kriterium/en weist aus, ob und wie viele mutmaßliche impliziten Kriterien gefunden wurden oder nicht =0;
- Erf: die dritte Stelle in zzZz gibt an, ob und wie viele Ausprägungskriterien zur Erfüllung der Kriterien genannt werden =z oder nicht=0;
- Meth: die vierte Stelle in zzzZ ob und wie viele Methoden der Erfassung oder Wertung angegeben werden =z oder nicht=0;
Alle aus den 173 Textstellen
erschlossenen impliziten Kriterien
001-083 Ausw. glaubhaft. 084-116 Ausw. glaubwürdig. 117-152 Ausw.
überzeugend. 153-173 Ausw. kein(e) Zweifel.
| Erläuterungen
zur Fundstellenbearbeitung
Die impliziten LG-Kriterien wurden Textstelle für Textstelle von 1-173 nacheinander erfasst. Hierdurch kam es zu Überschnei- dungen und Mehrfacherfassungen, die manchmal widersprüchlich sind. So taucht z.B. kein Motiv für Falschbeschuldigung bei glaubhaft (gh18), glaubwürdig (gw2), überzeugend (ue10) und beim Zweifel (kz12) auf. Motive zeigen sich meist nicht in Aussagen, gehören daher zur Glaubwürdigkeit und nicht zur Glaubhaftigkeit. Und Abweichun- gen von Angaben gehören zur Glaubhaftigkeit und nicht zur Glaub- würdigkeit. In den Text- Fundstellen wurde zunächst nach Kriterien für glaubhaft (1-83), dann für glaubwürdig (84-116), sodann für überzeugend (117-152) und letztlich für kein(e) Zweifel (153-173) gesucht. Auch wenn in Textstellen von 1-83 die Worte glaubwürdig, überzeugend oder kein(e) Zweifel vorkommen, so werden doch nur Kriterien für glaubhaft erfasst usw. In eckigen Klammern wird eine Fundstelle angegeben. Implizite LG Kriterien Glaubhaft/igkeit:
gw0 = Keine Kriterien genannt
|
Implizite LG Kriterien überzeugend
ue+Ziffern verweisen auf implizit erwähnte Kriterien. ue0 = Keine Kriterien genannt ue? = unklare Bedeutungszuordnung [U02, U03, U04] ue1 = keinerlei überzeugendes Motiv für Falschbeschuldigung [Gh06] ue2 = nachdrücklich [U04] ue3 = offenkundig [U04] ue4 = vereinbar mit [U05] ue5 = bestätigt von [U05] ue6 = kein Motiv für unzutreffende Angaben [U07] ue7 = tragfähige Motive und überzeugende Möglichkeiten für eine Falschbeschuldigung [U08] ue8 = andere bestätigen, was X gesagt hat [U12] ue9 = plausibel [U20] ue10 = Zeitraum zu kurz für Falschbeschuldigungsmotiv [U21] Implizite LG Kriterien kein(e) Zweifel
Themenbezüge Zusatz-Kennzeichnung "b" nach Ziffer.
Implizite LG Kriterien kein(e) durchgreifenden Zweifel
|
Gesamtsignierungstabelle
der 173 Textstellen
001-083 Ausw. glaubhaft. 084-116 Ausw. glaubwürdig. 117-152 Ausw.
überzeugend. 153-173 Ausw. kein(e) Zweifel.
Erklärung der vier
Signaturen
Lesebeispiele für die Einträge: Die Ziffern zzz vor dem Doppelpunkt
kennzeichnen die Textstelle: glaubhaft 001-083, glaubwürdig 084-116,
überzeugend 117-152, kein(e) Zweifel 153-173. Nach dem Doppelpunkt
bedeutet:
- Def die erste Stelle in Zzzz Begriff erklärt=1 oder nicht=0;
- Krit die zweite Stelle in zZzz Kriterium/en weist aus, ob und wie viele Kriterien gefunden wurden oder nicht =0 (keins);
- Erf die dritte Stelle in zzZz gibt an, ob und wie viele Ausprägungskriterien zur Erfüllung der Kriterien genannt werden =z oder nicht=0;
- Meth die vierte Stelle in zzzZ ob und wie viele Methoden der Erfassung oder Wertung angegeben werden =z oder nicht=0;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnisse
un/glaubhaft,
Un/Glaubhaftigkeit Def=0% - Krit=50.6% - Erf=0% - Meth=6%.
Textstellen
(1-83).
Nachdem bei glaubhaft die Kriterien am differenziertesten entwickelt
vorliegen, war es hier nicht so schwierig. Hier konnte ich aus der Argumentation
des LGs zahlreiche implizite Kriterien extrahieren, die aber, mangels fehlender
Erklärung der Begriffe, Interpretationsfehler enthalten können.
Der Ausdruck un/glaubhaft wurde in 83 Textstellen
gefunden. Der Begriff wurde an keiner Stelle direkt erklärt oder auf
eine Erklärung verwiesen. Das sind 0 von 83, also 0% . In 42 Textstellen
konnte mindestens 1 Kriterium des LG interpretiert werden, das sind 50.6%.
Angaben zu Erfüllungskriterien konnten in keiner Textstelle gefunden
werden: 0% von 83. In 5 Textstellen von 83, das sind 6%, fanden sich Textstücke,
die man als Hinweise interpretieren kann, mit welchen Methoden die Erfassung
oder Bewertung vorgenommen wurde. Die Durchsicht der Fragezeichensignaturen
ergab: 4 von 83 Textstellen, 4.8%, waren unklar hinsichtlich der Zuordnung
oder ob überhaupt ein Kriterium vorliegt.
Sortierung der vom LG
implizit verwendeten Kriterien bei Textstellen mit glaubhaft
Das Gericht hat weit mehr Möglichkeiten zur Glaubhaftigkeits-
und Glaubwürdigkeitsbeurteilung als die AussagepsychologIn, nämlich
Spuren, Urkunden, andere Aussagen, Sachverständigen-GA. Aussagepsychologische
GA oder Anwendungen sind so gesehen lediglich ein Beweismittel unter
vielen. Man sollte Gaubhaftigkeits- und Glaubwürdigkeitsbeurteilungen
und Vorgehensweisen des LG von der Aussagepsychologie mit einem eigenen
Ausdruck abgrenzen. In dieser Arbeit möchte ich den Ausdruck juristische
Aussagemethodologie verwenden, die die Aussagepsychologie nicht
nur umfasst, sondern weit über sie hinausgeht. Nach Analyse der Textstellen
stellt sich nun aber heraus, dass hier ein ziemliches Durcheinandervorliegt.
Doppel- und Mehrfachzuordnungen, unklare bis fragliche und falsche Zuordnungen,
wovon Sie sich durch diese Dokumentation selbst überzeugen können,
sind keineswegs die Ausnahme, sondern eher die Regel.
| A Zuordnung Glaubhaftigkeitskriterien | B Zuordnung Glaubwürdigkeitskriterien | C Zuordnung juristische Aussagemethodologie |
_ Aus forensisch-psychologischer Perspek- tive ist das BGH-Urteil zur Aussagepsy- chologie der Wegweiser, u.a. die 19 Realkennzeichen, wovon das LG rund 1/3 erwähnt und die Hypothesenprüfung. _
|
gh28 = Entstehungsgeschichte [Gh41] _ _ _ Aus forensisch-psychologischer Per- spektive sind bei Erwachsenen am wich- tigsten die Motivations-, Interessen- und Beziehungsanalyse, die Entstehungsge- schichte der Aussage und das Aufkom- men der Anzeige._ _
|
gh21 = Gesamtschau [Gh08, Gh28] macht nichts [Gh37] Das betrifft juristische Beweismethodik,
|
Anmerkung: Die Nummerierung der Kriterien hat keinerlei Bedeutung, außer dass sie anzeigt, in welcher Reihenfolge ich fündig wurde. Ich wollte mich nicht in systematischen Problemen verfangen, sondern einfach erfassen, was als Kandidat für ein Kriterium in den Textstellen des LGs für glaubhaft als tauglich schien.
Ergebnisse un/glaubwürdig, Un/Glaubwürdigkeit Def=0% - Krit=78.8% - Erf=0% - Meth=12,1%. Textstellen (84-116).
Hier war es schon etwas schwieriger, z.T. deshalb, weil manche Kriterien sowohl der Glaubhaftigkeit als auch der Glaubwürdigkeit zugeordnet werden können, z.B. Entstehungsgeschichte der Beschuldigung [Gh10] mehr noch aber durch die unklaren, teils falschen Zuordnungen.
Der Ausdruck un/glaubwürdig wurde in 33 Textstellen gefunden. Der Begriff wurde an keiner Stelle direkt erklärt oder auf eine Erklärung verwiesen. Das sind 0 von 33, also 0% . In 26 von 33 Textstellen konnte mindestens 1 Kriterium interpretiert werden, das sind 78.8%. Angaben zu Erfüllungskriterien konnten in keiner Textstelle gefunden werden: 0% von 33. In 4 Textstellen von 33, das sind 12.1% fanden sich Textstücke, die man als Hinweise interpretieren kann, mit welchen Methoden die Erfassung oder Bewertung vorgenommen wurde. Die Durchsicht der Fragezeichensignaturen ergab: 3 von 33 Textstellen, 9.1%, waren unklar hinsichtlich der Zuordnung oder ob überhaupt ein Kriterium vorliegt.
| Implizite LG Kriterien Glaubwürdigkeit:
gw Ziffern verweisen auf implizit erwähnte Kriterien. |
Erörterung und Bemerkungen |
| gw0 = Keine Kriterien genannt
gw1 = kein Belastungseifer [Gh03] gw2 = kein Motiv für eine Falschbezichtigung [Gh03] gw3 = keine persönlichen Kontakte [Gh03] gw4 = Entstehungsgeschichte der Beschuldigung [Gh08] gw5 = Abweichungen in den Aussagen [Gh08, Gh10] gw6 = um zutreffende Aussagen bemüht [Gh10] gw7 = persönlicher Eindruck [Gh24] gw8 = Genauigkeit/ fachliche Kompetenz [Gw08] gw9 = (~gh26) einleuchtende Erklärung gegeben [Gw08] gw10 = kein solches Näheverhältnis [Gw09] gw11 = Falschaussagen [Gw11] gw12 = Widersprüche [Gw14], gehört bei Aussagen zu glaubhaft. gw13 = Gesamtwürdigung, umfassende Würdigung [Gw29] gw14 = keine/ Übertreibung(en) [Gw30] gw15 = Geistheilerin (keine Bedenken) [Gw31] gw16 = Zuverlässigkeit der Angaben [Gw33 >116] gw17 = Kontinuität der Angaben [Gw14] _ _ _ _ _ |
gw1, gw2, gw3, gw4, gw8, gw9, gw10, gw11, sind als
Kriterien nicht zu beanstanden, was natürlich nicht heißt, dass
den Zuordnungen des LGs zu den jeweiligen ZeugInnen und insbesondere den
Begründungen gefolgt
werden kann. gw6, gw16 sind gute Kandidaten für Zirkelschlüsse. gw7 erscheint ausgesprochen problematisch und müsste differenziert operationalisiert werden. gw17 ist unklar, sofern damit aber die Konstanz gemeint ist, wäre die bessere Zuordnung zu glaubhaft. Aber, die Konstanz gehört zu einer höheren Ebene (Metaaussagemerkmal), sie ist kein Merkmal wie die Realkennzeichen in Aussagen, sondern ein Vergleich, welche Merkmale z.B. der Realkennzeichen bei verschiedenen Aussagen derselben Person zum gleichen Sachverhalt, vor allem beim sog. Kerngeschehen, konstant = gleich vorkommen. In der Aussage- psychologie wird bei der Konstanzanalyse allerdings vorausgesetzt, dass die Aussagen durch offene und nicht durch Suggestivfragen, sozusagen korrekt und damit verwertbar gewonnen wurden. Das ist sehr oft bei der Kripo, StAen und RichterInnen aber nicht der Fall. So gesehen ist es sehr störend, wenn in juristischen Entscheidungen Worte gebraucht werden, die mit ihrer Bedeutung in der Aussagepsychologie nicht übereinstimmen, ohne dies kenntlich zu machen. Obwohl der fehlende Belastungseifer eine große Rolle spielt, wird nirgendwo ausgeführt, wie er denn festgestellt wird. Das ist auch bei den anderen Kriterien so und daran krankt das ganze Urteil. gw15 Bei GeistheilerInnen ist grundsätzlich Vorsicht geboten und eine besondere Prüfung angezeigt. _ |
Die verwickelte Beziehung
zwischen Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit bedarf dringend einer
gründlichen Klärung
Ich glaube nicht, dass die Glaubwürdigkeit wie es meist in aussagepsychologischen
Abhandlungen dargestellt wird, ausgedient hat oder ausgedient haben sollte.
Die völlige Ablehnung der Glaubwürdigkeit geht m.E. zum großen
Teil auf Begriffswirren zurück.
Welche Merkmale der Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit
können jeweils die andere Kategorie bestätigen - und warum? Beispiele:
(1) Jemand ist in einer Zeugenaussage neutral gegenüber beiden Parteien,
das ist ein Glaubwürdigkeitsmerkmal. Kann, soll, darf das auch bedeuten,
dass seine Aussagen glaubhaft(er) sind? (2) Jemand verfüge über
eine gute Erinnerungsfähigkeit und gute kognitive Fähigkeiten,
das gehört zu den Glaubwürdigkeitsmerkmalen. Kann, soll, darf
das auch bedeuten, dass seine Aussagen glaubhaft(er) sind? Nun, im letzteren
oder 2. Beispiel sollte sich dies z.B. im Detailreichtum oder in raum-zeitlichen
Verknüpfungen, Einzelheiten u.a., also in einer differenzierten Aussage
niederschlagen. So gesehen würden sich gute Erinnerungen und kognitive
Fähigkeiten auch in der Aussage (indirekt) zeigen.
Ergebnisse überzeugend Def=0% - Krit=19,4% - Erf=0% - Meth=5,6%. Textstellen (117-152).
Der Ausdruck überzeugend wurde in 36 Textstellen gefunden. Der Begriff wurde an keiner Stelle direkt erklärt oder auf eine Erklärung verwiesen. Das sind 0 von 36, also 0% . In 7 von 36 Textstellen konnte mindestens 1 Kriterium interpretiert werden, das sind 19.4%. Angaben zu Erfüllungskriterien konnten in keiner Textstelle gefunden werden: 0% von 36. In 2 Textstellen von 36, das sind 5,6% fanden sich Textstücke, die man als Hinweise interpretieren kann, mit welchen Methoden die Erfassung oder Bewertung vorgenommen wurde. Viele Textstellen, 72.2% waren unklar in der Weise, dass ich sie nicht positiv berücksichtigt habe. Beispiel S. 12f: "Diese glaubhaften Angaben der Nebenklägerin werden durch die überzeugende Aussage der Zeugin BH bestätigt. ..."
| Begriffsprobleme Überzeugend (> Vorbemerkung) | Implizite LG Kriterien überzeugend (> Vorbemerkung) |
Ein sehr schwieriger Ausdruck, weil er sich erstens auf die geistigen
Vorgänge (Überzeugungsbildung) der RichterInnen beziehen kann
(reflexive Bedeutung), zweitens auch auf die Wirkung eines Aussagenden
(personale Bedeutung) auf die RichterInnen und drittens auf den Sachverhalt
selbst (sachliche Bedeutung). Für definitive Klarheit müsste
das Wörtchen in juristischen Entscheidungen daher wenigstens dreifach
indiziert werden:
Das LG sagt nicht, welches "überzeugend" es jeweils verwendet und erst recht nicht, welche Kriterien und welche Ausprägungen diese Zuordnung erzeugt. |
ue+Ziffern verweisen auf implizit erwähnte Kriterien. In eckigen
Klam- mern jeweils eine Fundstelle.
ue0 = Keine Kriterien genannt [U01]
Ich habe diese Kriterien ue1-ue10 zwar aus den Textstellen gewonnen, aber nicht herausfinden können, was denn nun mit "überzeugend" gemeint ist und wie diese Beurteilung und Bewertung zustande kommt. |
Anmerkung: Intuitiv und heuristisch sind mir hierzu folgende potentiellen Kriterien eingefallen: plausibel, zusammenpassend, stimmig, im Einklang mit dem Situationskontext, vielleicht auch mit der Lebenserfahrung, im Einklang mit der Wissenschaft, im Einklang mit der Naturwissenschaft, keine inneren (Inkonstanzen) oder äußeren Widersprüche (Nichtübereinstimmungen) oder bedeutsamere Abweichungen u. a. m.
Ergebnisse kein(e) Zweifel Def=0% - Krit=28,6% - Erf=0% - Meth=33,3%. Textstellen (153-173).
Der Ausdruck kein(e) Zweifel wurde in 21 Textstellen gefunden. Der Begriff wurde an keiner Stelle direkt erklärt oder auf eine Erklärung verwiesen. Das sind 0 von 21, also 0% . In 6 von 21 Textstellen konnte mindestens 1 Kriterium interpretiert werden, das sind 28,6%. Anga-ben zu Erfüllungskriterien konnten in keiner Textstelle gefunden werden: 0% von 21. In 7 Textstellen von 21, das sind 33,3% fanden sich Textstücke, die man als Hinweise interpretieren kann, mit welchen Methoden die Erfassung oder Bewertung vorgenommen wurde. Bei 14 von 21 Textstellen, 66,7%, war unklar, ob oder welche Kriterien zur Qualifizierung keine Zweifel führen. Beispiel S. 14.2:
- "2. ) e.)).
In der Gesamtschau (nachfolgend Ziffer 2.) f.)) liegen nachvollziehbare und glaubhafte Angaben der Nebenklägerin vor, an deren Glaubwürdigkeit sich für die Kammer auch unter Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte der Beschuldigung, der Abweichungen in den Aussagen der Nebenklägerin und der von der Kammer ebenfalls berücksichtigten möglichen Motive für eine Falschbeschuldigung keine Zweifel ergeben haben."
| Implizite LG Kriterien kein(e) Zweifel | Erörterung und Bemerkungen (> Vorbemerkung) |
| Hier sind leider viele Themenbezüge und weniger Kriterien dokumentiert,
diese zunächst:
kz0 = Keine Kriterien genannt kz? = unklare Bedeutungszuordnung. kz1= nachvollziehbare Angaben [Z01] kz2= glaubhafte Angaben [Z01] kz3= um zutreffende Aussagen bemüht [Z03] [Z05] kz4= zutreffende Schilderungen, hier nicht [Z04] kz5= persönlicher Eindruck [Z05] kz6= Aussage 15.1.3 durch Polizei hervorgerufen (kein Belastungseifer) [Z16] kz7= vom festgestellten Sachverhalt überzeugt [Z15] kz8= Zuverlässigkeit der Angaben [Z19] kz9= Gesamtschau (aller maßgebl. Umstände) [Z01] kz10 = Abweichungen in den Angaben [Z01] kz11 = Entstehungsgeschichte [Z01] kz12 = Kein Falschbeschuldigungsmotiv [Z01] kz13 = anschaulich erläutert [Z13] Themenbezüge Zusatz-Kennzeichnung "b" nach Ziffer.
|
Das LG spricht 21x von kein(e) Zweifel oder auch 10x von kein(e) durchgreifenden
Zweifel (siehe bitte hier),
es sagt aber nicht klar, wie es zu dieser Bewertung kommt und welche Sachverhalte
oder Kriterien dieser Bewertung zugrundeliegen. Wie oben ausgeführt,
können beim Zweifel im Umfeld juristischer Entscheidungen vier
Ausprägungen unterschieden werden, die für den praktischen
Gebrauch ausreichen. Das Problem ist nicht, den allgemeinen oder bildungssprachlichen
Sprachgebrauch von Zweifela,b zu verstehen, sondern den juristischen,
insbesondere wie das Urteil oder die Bewertung kein(e) Zweifel§
zustande kommt, was die RichterIn tut, um kein(e) Zweifel§
zu haben. Durch die Indizierung Zweifel§ wird Zweifela,b
zu
einem Rechtsbegriff. Wir wollen hier methodisch "nur" nachvollziehen und
verstehen, wie das funktioniert. Aber darüber erfahren wir in diesem
Urteil nichts. Doch das LG wird sich sicher bei der Verwendung dieser Vokabel
jeweils etwas gedacht haben. So sollte die implizite Bedeutung durch Textanalyse
erschlossen werden können, hier fand ich 13 Kandidaten (kz1-kz13).
Öfter erfahren wir einen thematischen Bezug, z.B. Entstehungsgeschichte
[Gh08], die Abweichungen in den Aussagen
[Gh08] oder keine möglichen Motive
für eine Falschbeschuldigung gefunden [Gh08].
Hier ergaben sich 16 Themenbezüge (kz1b-kz16b).
Um die Argumentationsfunktion verstehend zu erschließen, kann
man nun die folgenden Weil-Verknüpfungen bilden und
anschließend kritisch prüfen:
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, werte LeserIn, aber bei mir würde das jeweilige Kriterium nicht reichen, aber wenn mehrere zusammenkommen, wie man es bei ICD/DSM macht, könnte man vielleicht sagen, wenn mindestens X aus diesen 13 (z.B. 7 nach der über 50% Regel) in Bezug auf einen Sachverhalt oder eine Aussage erfüllt sind UND man innerlich, kognitiv-mental keine Zweifel mehr spürt, dann ist die sehr starke Bewertung kein(e) Zweifel akzeptabel.. Hinweis: In der Kommentierung 153: 0?00 zur Auswertung von [Z01] ist vielleicht die Problematik am deutlichsten zu erkennen. Hier kann man das LG so verstehen, dass die Gesamtschau all der erwähnten Kriterien in ihrem Zusammenwirken zu der Beurteilung und Bewertung kein(e) Zweifel geführt hat. |
Ergebnisse
keine
durchgreifenden Zweifel
Def=0% - Krit=40% - Erf=0% - Meth=50%. Textstellen
(aus 153-173).
Der Ausdruck kein(e) durchgreifenden Zweifel wurde in 10 Textstellen
gefunden. Der Begriff wurde an keiner Stelle direkt erklärt oder auf
eine Erklärung verwiesen. Das sind 0 von 10, also 0% . In 4 von 10
Textstellen konnte mindestens 1 Kriterium interpretiert werden, das sind
40%. Angaben zu Erfüllungskriterien konnten in keiner Textstelle gefunden
werden: 0% von 10. In 5 Textstellen von 10, das sind 50% fanden sich Textstücke,
die man als Hinweise interpretieren kann, mit welchen Methoden die Erfassung
oder Bewertung vorgenommen wurde. Bei 6 von 10 Textstellen (154, 158, 159,
164, 166, 170), das sind 60%, war unklar, ob oder welche Kriterien zur
Qualifizierung keine Zweifel führen.
Die Durchsicht der Fragezeichensignaturen ergab: 4 von 83 Textstellen, 4.8%, waren unklar hinsichtlich der Zuordnung oder ob überhaupt ein Kriterium vorliegt.
Nun ist die Formulierung keine durchgreifenden Zweifela,b zwar von seinem Sinn her klar - zumindest in seiner alltäglichen oder bildungssprachlichen Bedeutung - und besagt nichts anderes, als dass es Zweifela,b gab, die aber nicht so stark waren, dass sie "durchgreifen" würden, so gesehen eine sehr schöne Wortschöpfung. Genauere Bestimmungen werden aber benötigt, wenn es darum geht, nachzuvollziehen, wie RichterInnen dazu kommen, zwischen keinen Zweifeln§, keinen durchgreifenden Zweifeln§, Zweifeln§ oder gar erheblichen Zweifeln§ zu unterscheiden. Wie geschieht das? Welche Erfassungs- und Bewertungsmethoden werden hier angewandt? Das sind die Gretchenfragen beim keine durchgreifenden Zweifel§ und sollte durch die Analyse der Textstellen näher ergründet werden.
Auch durch die Analyse der Textstellen konnte
ich nicht herausfinden, wann ein Zweifel ein "durchgreifender" ist oder
nicht. Denn aussagemethodologisch ist es natürlich wichtig,
zu erfahren, was den nicht durchgreifenden Zweifel hervorruft oder begründet.
Welche Kriterien sollen für nicht durchgreifenden Zweifel gelten?
Am simpelsten wäre natürlich das subjektive Moment in der RichterIn:
sie schaut in sich hinein und fragt sich: sind meine Zweifel entscheidungserheblich,
rumort es, gärt es, treibt es mich geistig um?
| Implizite LG Kriterien kein(e) durchgreifenden Zweifel | Durchgreifende Zweifel (> Vorbemerkung) |
| dz0 = keine Kriterien genannt
dz? = Unklar, wie es zu kein(e) Zweifel kommt. dz(kz..) = Spezifikation nach kz. dz1= keine durchgreifenden Zweifel bei Abweichung von vereidigter Aussage (Zeugin Sim) [Z02] _ dz2 = durchgreifende Zweifel wegen Eingeständnis unzutreffender Angaben, Zeu Bra [Z04] dz3 = Abweichungen jeweils für sich und Gesamtschau [Z06] dz4 = Abweichungen bei den Schlägen [Z07] dz5 = keine durchgreifenden Zweifel einzeln und in der Gesamtschau _ _ _ |
Völlig absurd erscheint die Bewertung des LG, bei der Abweichung
der Zeugin Sim von ihrer vereidigten Aussage in der HV, S. 19:
"Diese Angabe weicht insoweit von der Aussage der Zeugin in der Hauptverhandlung ab, als protokolliert wurde, die Zeugin wisse zu dem Vorfall im August nichts und habe die Nebenklägerin nur in der Praxis gesehen. Auch wenn die Zeugin durch das Amtsgericht Nürnberg auf diese Aussage hin vereidigt wurde, begründet diese Abweichung weder durchgreifende Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugin Sim noch an der Glaubhaftigkeit ihrer Angaben." Auswertung und Kommentar: 154: 0?00 [Z02] dz?, dz1: keine durchgreifenden Zweifel bei Abweichung von vereidigter Aussage an der Glaubwürdigkeit der Zeugin Sim oder der Glaubhaftigkeit ihrer Angaben, wobei nicht erklärt wird, warum das so ist. |
Einzelergebnisse und spezielle Hypothesen
Die
Meinungs-Regel in richterlichen Entscheidungen
In vielen Textstellen fehlt jegliche inhaltliche Begründung für
Bewertungen von glaubhaft, glaubwürdig, überzeugend, kein(e)
Zweifel. D.h., etwas ist glaubhaft, glaubwürdig, überzeugend
oder hinterlässt kein(e) Zweifel, weil die Kammer das meint.
Praktisch ausgedrückt macht die Kammer einen Sachverhalt zu einem
glaubhaften,
glaubwürdigen, überzeugenden oder kein(e) Zweifel hinterlassenden,
indem sie ihm einfach das entsprechende Wort anheftet. Freie Beweiswürdigung
entgleist dann in freies Meinen. Damit bleiben viele Bekundungen von
glaubhaft,
glaubwürdig, überzeugend oder hinterlässt kein(e)
Zweifel unbegründete, bloße Behauptungen. Das erinnert mich
fatal an meine Ergebnisse zu forensischen-psychiatrischen Gutachten, in
denen sehr, sehr oft die Zuordnung von Symptomen, Syndromen, Befunden,
Diagnosen und deren Wirkungen auf die Tathandlungen auf bloßem
Meinen beruhen. Das liefert eine Erklärungs-Hypothese, weshalb sich
forensische Psychiatrie und Gerichte so gut verstehen: da haben sich zwei
Meinungskulturen gefunden. Mit wissenschaftlicher Methodologie
hat das allerdings gar nichts zu tun.
Die Nieder-
und Glattbügelungs-Technik in richterlichen Entscheidungen
In der Mollath Urteilsbegründung ist mir aufgefallen, dass a)
Mollath selbst und alle seine Zeugen hinsichtlich der Tatvorwürfe
am 11./12.8.2001 meist unglaubhaft oder unglaubwürdig sind und b)
für ihn sprechende nicht geladen wurden, z.B. Gerhard Dörner
(Gründer des Unterstützerkreises), während die Nebenklägerin
selbst und alle ihre ZeugInnen als glaubhaft und glaubwürdig gelten.
Für dieses Phänomen, das mir vor einiger Zeit schon bei einem
Urteil des LG Stuttgarts auffiel, habe ich einen Namen gesucht.
Zirkelschluss
beim A und O der Beweisfrage
Das A und O ist dieses Urteils ist die Frage: sind die Aussagen zum
Tatgeschehen 11.8./12.8.2001 mit genügender Sicherheit glaubhaft oder
nicht. Dabei begründet das LG die Glaubhaftigkeit mit zwei Hauptargumenten,
nämlich damit, dass (1) die Nebenklägerin diese Ereignisse den
ZeugInnen Rei, Sim und Mas erzählt habe und (2) mit den Praxisdokumenten
der ärztlichen Untersuchung. Insbesondere wird das Fehlen eines Falschbezichtigungsmotiv
für die Nebenklägerin durch die Zeugenaussagen begründet,
die allerdings wiederum auf Aussagen der Nebenklägerin beruhen, was
die Zirkelschlussfrage aufwirft.
Allgemein lautet dieses Zirkelschlussmodell: X erzählt
A, B, C, dass ihm W wiederfahren ist. A, B, C erzählen sodann,
dass X ihnen erzählt habe, dass X W widerfahren sei. Daraus folgt
ja bestenfalls nur, dass X davon erzählt hat, dass ihm W widerfahren
sei, aber nicht, dass W stattgefunden hat. Hier liegt also eine Lücke
zwischen sagen und tatsächlich erlebt haben vor. Die empirische Voraussetzung
für diesen Schluss müsste lauten: Wenn jemand ein Erleben erzählt,
dann hat es umso eher stattgefunden, je zeitnäher anderen von diesem
Erleben berichtet wird. Eine solche Voraussetzungsbehauptung müsste
allerdings empirisch belegt werden.
Was bleibt (Ausblick) ?
Schön wäre, wenn die Strafrechtswissenschaft sich endlich
anschickte eine zu werden, wie Dr. Gerhard Strate in seinem Buch,
S. 21, ebenso fachkritisch wie trefflich formulierte: "... so ist hierfür
eine Wissenschaft verantwortlich, die fern davon ist, eine zu sein, jedoch
große Leistungen darin vollbringt, die Suggestion von Wissenschaftlichkeit
zu verbreiten: die Strafrechtswissenschaft. ..." Das wäre, 2350 Jahre
nach Aristoteles,
kein übereilter Schritt, also wenigstens die Entscheidungsphraseologie
durch Methodologie zu ersetzen, die der abendländischen
Geisteskultur angemessen ist..
Die Justiz hat sich zu einer Kaste entwickelt, die den wohlverstandenen
Rechtsstaat mindestens so gefährdet wie sie ihn pflegt. Das muss anders
werden, grundlegend anders. Und dazu bedarf es endlich wirksamer Außenkontrollen
und Korrektive. Schaut man sich an, was die großen Medien (DIE ZEIT,
DER SPIEGEL) mit Ausnahme einiger weniger wie z.B. die SZ an überangepassten
Fehlleistungen in ihrer Justizikritik hervorbringen, muss man sagen: auch
die Medien versagen in einer Weise, wie es nur mit einem Nietzsche-Wort
kommentiert werden kann: ....
Und wenn wir schon dabei sind: vielleicht sollte man auch anfangen,
den Rechtsstaat, Demokratie und die Gewaltenteilung praktisch ernster zu
nehmen und weiter zu entwickeln; und als ersten Schritt vielleicht das
Bruderschaftskorps RichterInnen und StaatsanwältInnen trennen, das
sich täuschend hinter der Vokabel "Richterverein" versteckt. Und auch
das Justizpsychiatriesystem taugt, wie der Fall Mollath, die Spitze des
Eisbergs, ebenso empörend wie erschütternd zeigt, weitgehend
keinen Schuss Pulver. Hier triumphieren zum Schaden aller entgleiste, weil
beliebige bis willkürliche Meinungskulturen.
Als nächstes werde ich wahrscheinlich Teil 3, Rechtsbegriffe, und hier grundlegend das Kauderwelsch der juristischen Entscheidungssprache, die Schuldunfähigkeit§ (Einsichtsfähigkeit§, Steuerungsfähigkeit§) und die Gemeinheit des in dubio pro reo§ Freispruchs wegen "nicht ausschließbarer§" Schuldunfähigkeit§ unter die allgemein-wissenschaftliche und methodologische Lupe nehmen.
Hypothesenprüfungen und ihre Voraussetzungen
Der Hypothesengedanke in der Wissenschaft.
Der Hypothesengedanke in der Rechtswissenschaft.
Denkmöglichkeiten.
Das Jahrhunderturteil zur Aussagepsychologie.
Nach Oliver Garcia im beck-blog (5.1.15, #14)
- "Die Nullhypothese bezieht sich auf die Glaubhaftigkeitswürdigung
gerade in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen. Das war auch das Thema
in BGHSt 45, 164 (https://dejure.org/1999,28). Hier ein zusammenfassendes
Zitat aus OLG Stuttgart, https://dejure.org/2005,6849:
Zitat:
Da vorliegend Aussage gegen Aussage steht, ist von dem (methodischen)
Grundprinzip auszugehen, die Glaubhaftigkeit der Aussage solange zu negieren,
bis diese Negation mit den gesammelten Fakten nicht mehr vereinbar ist.
Dabei nimmt man zunächst an, die Aussage sei unwahr (so genannte "Nullhypothese"
- BGHSt 45, 164, 167 f.). Diese Annahme überprüft man dann anhand
verschiedener Hypothesen (vgl. dazu BGH aaO S. 168 ff.). Ergibt sich, dass
die Unwahrhypothese mit den erhobenen Fakten nicht mehr in Übereinstimmung
stehen kann, so wird sie verworfen, und es gilt die Alternativenhypothese,
dass es sich um eine wahre Aussage handelt (BGHSt aaO, 168).
Die Nullhypothese ist übrigens im Standardwerk von Bender/Nack, Tatsachenfeststellung vor Gericht (2. Auflage im Zeitpunkt der BGH-Entscheidung) entwickelt worden. Nack war der nachmalige Vorsitzende des für Bayern zuständigen 1. Strafsenat des BGH. Am Fall Mollath war Nack aber (leider?) nicht beteiligt."
Der Hypothesengedanke spielt im schriftlichen Urteil so gut wie keine Rolle, wenn man das Wort sucht. Es zitiert lediglich Prof. Dr. Ne, S. 81:
- "... Der Sachverständige hat nachvollziehbar und überzeugend
ausgeführt, dass sich der Angeklagte zum Zeitpunkt der vorgeworfenen
Taten nicht ausschließbar aufgrund der ehelichen Konflikte in einer
Ausnahmesituation befunden habe, die psychodynamisch zu einer Änderung
der Persönlichkeit geführt haben könne. Im Zusammenhang
mit den Persönlichkeitsauffälligkeiten erscheine die Hypotheseeiner
psychischen Störung in Form einer wahnhaften Störung zum Zeitpunkt
der Tat durchaus plausibel und nicht abwegig." [H01]
Wichtige Hypothesen im einzelnen:
Komplotthypothesen.
Brainstorming
Materialien ("Anknüpfungstatsachen") zur Komplotthypothese
> Der
Hypothesengedanke im schriftlichen Urteil.
- KHM01 Grundsätzlich spricht die Zeit, in der die HypoVereinsbank von der UniCredit übernommen werden soll, ja dafür, dass man keine negativen Schlagzeilen gebrauchen konnte. Warum sollte man Einflussnahmen der Bank also vorab ausschließen? Warum blieb der Revisionsbericht so lange im Dunkeln?
- KHM02 Ein Motiv der Ex, dass ihre Geschäfte nicht ans Licht kommen sollen, ist sicher nicht an den Haaren herbeigezogen. Mit Zuspitzung der Krise und Auseinandersetzung ist die Entwicklung eines Motivs naheliegend, Vorkehrungen zu treffen, gewappnet zu sein, um für den Ernstfall etwas gegen GM in der Hand zu haben, womit er diszipliniert oder zur Räson gebracht werden könnte.
- KHM03 Völlig ungewöhnlich ist, dass Dr. Leip von sich aus am 04.05.2005 bei der Justiz nachfragt, ob nicht noch was vorliegt, womit er überdeutlich zum Ausdruck bringt, so reicht es nicht für § 63 StGB. Zeigt er damit nicht ungewöhnlichen Belastungseifer und damit Befangenheit?
- KHM04 Seltsamerweise beginnen um die Zeit von Dr. Leips Nachfrage nach eventuellen weiteren Straftaten in GM Gegend gehäuft Reifenstechereien, bei denen die Polizei nach Recherchen (URL verändert) von Erwin Bixler, eine sehr hilfreiche Figur für GMs Gegner abgibt. Dr. Leip kann mit Polizeimaterial bedient werden, das gemeingefährlichkeitstauglich ist. Und jetzt kann das "Gutachten" auch abgewickelt werden.
- KHM05 Gutachten werden ohne Exploration und persönliche Untersuchung geschrieben und Diagnosen zusammenphantasiert sogar noch mit Befundfälschung (Vergiftungswahn-Textmontage) und abenteuerlichen Konstruktionen angereichert. Warum diese Intensität und forensisch-psychiatrische Energie?
- KHM06 Es wird ein Video vom Reifenstecher vorgeführt, das an einem Tag aufgenommen wurde, zu dem gar kein Tatvorwurf bestand.
- KHM07 Warum geht die Ex nicht in ihre Hausarztpraxis, wo sie immer war? Wieso geht sie in die Praxis, in der ein junger unerfahrener Arzt, aber eine Freundin und Partnerin ihres Bruders sitzt?
- KHM08 Warum verschwindet das Attest? Und zu welchem Zeitpunkt wird es (welches?) "plötzlich" wieder gefunden? Eine Version scheint unter ungeklärten Umständen verschwunden.
- KHM09 Warum enthält das Attest Rechtschreib- und Grammatikfehler, die nicht zum angeblichen Verfasser passen? Texte in Dateien können verändert werden. Wer hatte Zugang zur Praxis-EDV?
- KHM10 Warum wird der Geschäftsplan am LG so "hingepasst", dass der "scharfe Hund" Richter Brix den Fall bekommt?
- KHM11 Warum wurden die Verfahren so einseitig geführt?
- KHM12 Warum kennt die bayerische Justiz das BVerfG Urteil aus 2001 nicht, das verlangt, dass für Einweisungen nach § 81 StPO die Mítwirkung des Betroffenen sichergestellt sein muss? Warum kennen es die Dres. Lip, Wörth, Leip nicht? Kannten sie es wirklich nicht, obwohl es in der Hauszeitschrift der forensischen Gerichtspsychiatrie abgedruckt wurde, oder wollten sie es nicht kennen oder nicht verstehen und, falls, warum nicht?
- KHM13 Wieso gibt es Verbindungen zum Finanzamt (Eintrag "Spinner"), Richter Brix und ein Beamter dort kannten sich. Wie kommt es zu diesem Eintrag?
- KHM14 Der Geliebte und spätere Ehemann der Nebenklägerin, Herr Mas und Richter Brix kannten sich vom Sportverein (Handballer), sollen auch bei der Verhandlung (Sitzungspause) beieinander gestanden haben. Wurden Telefonate der beiden überprüft?
- KHM15 Dr. Kra-Ol wird falsch und einseitig informiert bezüglich des Attestes, das sie ausstellen soll. Sie war damals seit vier Jahren Kundin der Ex, wie nun bei der WA herauskommt.
- KHM16 Obwohl Mollath erst 9, dann 8 Monate frei herumlief, also offensichtlich ungefährlich war, stempelte man ihn zum Gemeingefährlichen, was selbst Prof. Ne nicht verstand. Obwohl diese Lebenstatsachen gegen jede Gemeingefährlichkeit sprachen, wurde sie durchgesetzt. Warum gab es diese großen Zeiträume, warum wurden sie nicht aufgeklärt?
- KHM17 Warum zeigte Dr. Leip solch massive Interessen und forensisch-psychiatrische Energie, GM faktisch mit einer Betreuung zu entmündigen (Betreuung mit entsprechenden Einwilligungsvorbehalten) und versuchte das Gutachten Dr. Sim in seinem Sinne zu beeinflussen, wenn er unmissverständlich mitteilt, dass GM wegen seines Wahnes nicht geschäftsfähig sei?
- KHM18 Warum erhielt Prof. Krö in Punkt 5 der strafrechtlichen Beweisfragen ausdrücklich eine Aufforderung, zum zivilrechtlichen Betreuungsgutachten Stellung zu beziehen?
- KHM19 Warum ist die Justizpsychiatrie so organisiert, dass es keine faire Chance gibt, Fehleinweisungen zu entgehen? (systemisches Komplott).
- KHM20 Und weshalb deckte die bayerische Politik, namentlich die damalige Frau Justizministerin Dr. Merk, den zum Himmel schreienden Murks und Pfusch einer unmenschlichen Verräumung so lange? Wen galt es zu schützen? Seit wie lange ist der Fall im Ministerium bekannt?
Zu diesem "brain" eine präzisierende Anmerkung von Herrn Bixler: "Sämtliche 'ermittelten' Reifenstechereien ereigneten sich in dem Zeitraum 31.12.2004/1.1.2005 - 1.2.2005 (oder sollen sich in dieser Zeit ereignet haben). Was nach dem Anruf Dr. Ls. bei Eberl zunahm, war die Intensität der "Ermittlungsaktivitäten", außerdem wurden nachweislich Mas/Mül (s. Blatt 116f.) und Dr. Woe (s. Blatt 39 unten links) aktiv."
Die Sachbeschädigungskomplotthypothese
- Siehe bitte hierzu die ausgezeichneten Recherchen
und Dokumentation von Erwin Bixler: Fall Mollath; Darlegungen zum "Konstrukt"
Sachbeschädigungen. (URL verändert)
Behördenkomplott: Forensische Psychiatrie, Justiz, Polizei, Finanzbehörde, Politik.
Die Intrigenhypothese.
Hypothesen zu den Verletzungsmalen.
Hypothesen zum Attest.
Hilfsapparat Teil 4 Beweismethodik Fundstellen wichtiger Worte, deren Begriff leider nicht hinreichend klar ausgeführt wird, leider, denn die Worte sind die Kleider der Begriffe (> Homonyme)
- abwegig. * Fundstellen im Urteil.
- Alles berücksichtigt, alle Umstände berücksichtigt. * Fundstellen im Urteil.
- Alternative(n), Alternativhypothesen. * Fundstellen im Urteil.
- Ausgeschlossen. * Fundstellen im Urteil.
- Begründung, begründet. * Fundstellen im Urteil.
- Beweisaufnahme. * Fundstellen im Urteil.
- Beweisbasis * Fundstellen im Urteil.
- Beweiserhebung. * Fundstellen im Urteil.
- Beweis-Fehler. * Fundstellen im Urteil.
- Beweismittel. * Fundstellen im Urteil.
- Beweiswert. * Fundstellen im Urteil.
- Anmerkung: Das Wort findet Verwendung z.B. in dem BGH-Beschluss 1 StR 493/06 vom 29. November 2006: Rn18 "Davon, ob die unterbliebene konfrontative Befragung eines Zeugen der Justiz zuzurechnen ist, ist nach der Rechtsprechung des EGMR der Beweiswert der Angaben dieses Zeugen abhängig. ..."
- Beweiswürdigung. * Fundstellen im Urteil.
- Denkbar. * Fundstellen im Urteil.
- Zum Begriff. Nach U. Klug (1982), S, 155 stets eine Verletzung der Gesetze der Logik. Anmerkung: Da es viele Logiken gibt, ist diese Bestimmung zu ungenau. In der Rechtspraxis reichen zwei Wahrhheitswerte (wahr, falsch) oft nicht. Es sind meist noch teils und nicht feststellbar (non liquet) notwendig.
- Denkgesetze. * Fundstellen im Urteil.
- fernliegen, absolut fernliegend. * Fundstellen im Urteil.
- Gesamtschau. * Fundstellen im Urteil.
- Glaubhaft, Glaubhaftigkeit * Fundstellen im Urteil.
- Glaubwürddig, Glaubwürdigkeit * Fundstellen im Urteil.
- Hypothesen, hypothesenorientiertes Vorgehen. * Fundstellen im Urteil.
- Indiz für ... * Fundstellen im Urteil.
- Könnte, hätte, würde, wäre * Fundstellen im Urteil.
- Lücken. * Fundstellen im Urteil.
- Möglich, Möglichkeit, möglicherweise; als Leerformel. * Fundstellen im Urteil.
- Naheliegend * Fundstellen im Urteil.
- Nicht ausschließbar Leerformel. * Fundstellen im Urteil.
- Plausibel * Fundstellen im Urteil.
- Sprünge. * Fundstellen im Urteil.
- Zwar-Aber, als Leerformel. * Fundstellen im Urteil.
- Überzeugung, überzeugt, überzeugend, als Leerformel. * Fundstellen im Urteil.
- Unwahrscheinlich * Fundstellen im Urteil.
- Vereinbar, Vereinbarkeit als Beweisindiz * Fundstellen im Urteil.
- S. 50: "Schließlich erachtet die Kammer die Angaben der Nebenklägerin auch deshalb als glaubhaft, da sie konstant geschilderten Verletzungshandlungen mit dem festgestellten Verletzungsbild aus rechtsmedizinischer Sicht vereinbar sind:"
- Wahrscheinlich * Fundstellen im Urteil.
- Widerspruch. * Fundstellen im Urteil.
- Zirkel, zirkulär. * Fundstellen im Urteil.
- Zeugenbeweis. * Fundstellen im Urteil.
- Zwanglos * Fundstellen im Urteil.
- Zweifel, zweifeln, als Leerformel * Fundstellen im Urteil.
- Zweifel, durchgreifende * Fundstellen im Urteil.