(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=28.07.2002 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 31.03.15
Impressum: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel
Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen * Mail: sekretariat@sgipt.org
Anfang_Kunstfehler-2_Überblick_Rel. Aktuelles _Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region__Service_iec-verlag__ Zitierung & Copyright__ _Wichtige Hinweise Links u. Empfehlungen_
Kunstfehler - Schimpfwort oder Tabu ?
Erste Fachtagung des IVS am Samstag den 27. Juli 2002
Festsaal, Klinikum am Europakanal
An die TeilnehmerInnen
Über potentielle Kunst- oder Behandlungsfehler
in der
Psychotherapie aus allgemeiner und integrativer Sicht
von Rudolf Sponsel,
Erlangen
Internet-Erstausgabe 28.7.2002, Letztes update 29.07.2002
Überblick zum Thema Behandlungsfehler in
der IP-GIPT.
|
|
|
|
Motto: "Wenn behauptet wird, daß eine Substanz
keine Nebenwirkungen zeigt, so besteht der dringende Verdacht, daß
sie auch keine Hauptwirkung hat."
Der Pharmakologe G. Kuchinsky
Werte Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die
Einladung zu diesem interessanten und heißen Thema. Für alle
Interessierten ist dieser Vortrag ab Sonntag, den 28.7.2002, 18.00 Uhr
im Internet einseh- und herunterladbar. Er darf auch beliebig weitergegeben
werden. Zunächst ein Überblick:
- Einführung: Was bedeutet Psychotherapie rechtlich und was folgt daraus?
- Kunstfehler im engeren Sinne
- Erstes Zwischenergebnis: Definition Kunstfehler
- Therapieschulsystem bedingte Kunstfehler
- Bedingte Kunstfehler, die aus einer Vorgabe resultieren
- Kunstfehler-Paradoxien und Kuriosa
- Liste potentieller Kunstfehler-Quellen
- Potentielle Kunstfehler zu Beginn einer Behandlung
- Potentielle Kunstfehler mangelhafter Diagnostik, Therapieplanung, therapiebegleitender Evaluation und Dokumentation
- Potentielle Kunstfehler mangelnder Abklärung oder Kooperation
- Potentielle Kunstfehler gegen die therapeutische Beziehung
- Potentielle Kunstfehler mangelnder Reflexion, Supervision und Fortbildung
- Potentielle Kunstfehler gegen Ergebnisse allgemeiner Psychotherapieforschung
- Potentielle Kunstfehler gegen das Persönlichkeitsrecht (Abstinenzgebot)
- Potentielle Kunstfehler gegen Effizienz und Wirtschaftlichkeit
- Sonstige potentielle Kunst-/ Fehler: Rest- und Auffangkategorie
- Zusammenfassung der schlimmsten potentiellen Fehlermöglichkeiten
- Abstract - Zusammenfassung
- Nachtrag aus der Diskussion: Was tun?
- Ausblick
- Literaturhinweise
- Querverweise
Vorbemerkung: Seit Herbst 1977 bin ich frei niedergelassen.
Setzt man die Fehlermöglichkeit pro 50-Min- Sitzung mit 10 an,
ergibt das bei 25 Sitzungen pro Woche 250 und in einem Arbeitsjahr mit
44 Wochen 11.000, in den letzten 25 Arbeitsjahren macht das rund 275.000
Fehlermöglichkeiten.
Einführung: Was bedeutet Psychotherapie?
Da es um Kunstfehler in der Psychotherapie geht, ist es
zunächst wichtig, noch einmal klar zu machen, was Psychotherapie eigentlich
rechtlich bedeutet. Nach Pulverich
(1996, 479; 2000, 644:) ist Psychotherapie ein Eingriff in die körperliche
Integrität und einwilligungspflichtig, ich zitiere:
| „Auch die Psychotherapie gilt als Eingriff in die körperliche Integrität, da auf den seelischen Zustand eines Menschen eingewirkt wird. Die Einwilligung des Patienten muß daher vor jeder psychotherapeutischen Behandlung vorliegen." |
Aus dieser Bestimmung ergeben sich sofort die ersten großen und groben allgemeinen Kunstfehlermöglichkeiten. Denn:
Ein Mensch kann in einen Eingriff seiner persönlichen Integrität nur dann einwilligen, wenn er die möglichen Folgen und Risiken wirklich einsehen und realistisch einschätzen kann. Therapeutische Eingriffe, die solche Risiken und Folgen verbergen, nicht einsehbar machen können oder verharmlosen, sind m.E. von vorneherein unzulässig (wie z.B. u.U. Psychoanalyse, Primärtherapie oder esoterische Heilweisen).
Ich erwähne die Psychoanalyse deshalb, weil sie nach ihrem Selbstverständnis nicht unbedingt symptombezogene Veränderungen anstrebt, sondern strukturelle und damit tiefgreifende Eingriffe in die Struktur der Persönlichkeit beansprucht und offenbar auch für legitim hält [EN01]. Besonders kritisch ist dies, wenn diese Eingriffe und ihre Folgen für die PatientInnen nicht vor Aufnahme der Behandlung wirklich einsichtig, realistisch einschätzbar und transparent vermittelt werden.
Stuart Sutherland, Professor für experimentelle Psychologie,
erlitt eine sehr schwere und langanhaltende endogene Depression. Er beschreibt
in seinem Therapiebericht [EN02]
"Die seelische Krise" aus seiner Psychoanalyse und von seinem Psychoanalytiker:
| "Obwohl er versuchte, ein
wenig von der Schuld , die ich mit mir herumtrug, von mir zu nehmen, machte
er eine Reihe von Bemerkungen, die ich ziemlich bedrohlich fand. Er erklärte:
»Es scheint, als hätten Sie die besten Dinge im Leben versäumt«
[EN03] Einmal diagnostizierte
er bei mir verdrängte Homosexualität
und während ich ihm von einem Kindheitserlebnis erzählte, beugte
er sich vor und sagte etwas zutiefst Schockierendes. Ich bitte den Leser
um Verzeihung, aber um die Art meiner Reaktionen zu verstehen, ist es notwendig,
den Wortlaut wiederzugeben, nämlich:
»Hatten
Sie damals nicht den Wunsch, Ihr Vater
Wenn ich jemals einen solchen Wunsch gehabt haben sollte, so habe ich ihn seither lang vergessen, jedenfalls aber fand ich diese Idee höchst bestürzend." |
Halten wir fest:
Ein grober und schwerwiegender System-Kunstfehler liegt
vor, wenn PatientInnen zu Beginn einer Behandlung - praktisch also in der
probatorischen Phase - nicht übersehen können, auf was sie sich
da im wesentlichen und im einzelnen einlassen und mit welchen zugrundeliegenden
Störungsmodellen gearbeitet wird (Verstoß gegen die Aufklärungspflicht).
Doch was sind nun Kunstfehler im engeren Sinne? Ist der
Begriff überhaupt sinnvoll? Pulverich
(1996, 477; 2000, 642/43) hält den Kunstfehlerbegriff nicht für
sinnvoll:
| „Der im Zusammenhang mit der Fahrlässigkeit oft gebrauchte Begriff des »Kunstfehlers« gibt in aller Regel für die Annahme der Verletzung der Sorgfaltspflicht nichts her, da er von allgemein anerkannten Regeln der Behandlung ausgeht. Weil sich aber gerade in der Heilkunde auch konträre Auffassungen und Methoden herausgebildet haben, bleibt die Umschreibung der »allgemein anerkannten Regeln« oftmals leer." |
Stattdessen bevorzugt Pulverich
(1996, 477; 2000, 642) den Begriff des Behandlungsfehlers:
| „In der Medizin wird als Behandlungsfehler jede Maßnahme definiert, »... die nach dem Standard der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung die gebotene Sorgfalt vermissen läßt und darum unsachgemäß erscheint« (Laufs & Uhlenbruck, 1992, § 99 Rdn. 5)." [EN04] |
Die Bezugnahme auf Behandlungsfehler erhellt den Sachverhalt aber auch nicht weiter.
Nun, Behandlungsfehler begleiten unseren psychotherapeutischen
Alltag und sind unvermeidlich. Aber es kommt natürlich darauf an:
welche, wie bedeutsam sind sie, wie können sie konstruktiv-positiv
verwertet werden und wie geht man mit dem Fehlerproblem im allgemeinen
und im besonderen um, wie korrigiert man sie und wie lernt man aus ihnen?
Diskussion, Problematik und Ahndung der heilkundlichen Kunstfehler sind
fast so alt wie die Heilkunde selbst. Bereits das babylonische Recht -
rund 1700 Jahre vor Christus - sah im Codex Hammurabi drastische Strafen
vor [EN05]. So ist die Kunstfehler-Diskussion
in der medizinischen Heilkunde hoch entwickelt. Juristisch ist dort klar:
| "Übersieht der Arzt veröffentlichte neue Behandlungsmethoden und hält er an Überholtem fest, so handelt er pflichtwidrig." [EN06] |
Ersetzt man in dem Text das Wort "Arzt" durch "PsychotherapeutIn", wird klar, daß sich eine solche Auffassung nicht mit "Therapieschulen" verträgt. Eine wissenschaftliche Psychotherapie kann es sich daher nicht mehr leisten, dieses Thema als Nebenschauplatz am Rande zu behandeln.Tatsächlich ist es mit der Idee einer allgemeinen und wissenschaftlichen Psychotherapie unvereinbar, die Definition der Kunstfehler den Psychotherapieschulen zu überlassen, da die strenge Beschränkung auf eine "Schule" schon als grundsätzlicher allgemeiner Kunstfehler bewertet werden kann, es sei denn, eine SchulentherapeutIn nimmt eine relativ enge Indikationsbeschränkung an.
Die Terminologie zum Fehlerproblem ist - seit es die Diskussion um das Problem gibt - umstritten. Das Thema ist aber viel zu wichtig, als daß wir es uns leisten sollten, zu warten, bis terminologische Einigungen erzielt sind. Ich habe mich daher für die pragmatische Lösung entschieden, es jeweils offen zu lassen, ob ein Fehler ein "bloßer" Fehler, Behandlungsfehler oder ein Kunstfehler genannt werden soll, zumal möglicherweise auch erst der genaue Kontext und Situationsrahmen eine solche Differenzierung gestattet. In der Medizin und entsprechenden Rechtsprechung hat sich inzwischen der Terminus "Behandlungsfehler" etabliert. Ich bevorzuge den Terminus "Kunstfehler" in folgender definitorischer Interpretation: Ausübung der Heilkunde ist die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse, Regeln, Methoden und Erfahrungen auf einen Einzelfall zum Zwecke der Vorbeugung, Linderung, Besserung, Heilung oder Bewältigung von Störungen mit Krankheitswert. Ein solcher Einzelfall ist immer individuell und einmalig, kurz: ein idiographisches Geschehen (Maslow 1977). Die richtige Anwendung - "wer heilt hat recht" - der Erkenntnisse, Regeln, Methoden und Erfahrungen auf den individuellen Einzelfall ist daher mit Recht als Kunst zu kennzeichnen in des Wortes etymologischer Bedeutung und des geflügelten Wortes: Kunst kommt von Können, käme sie von wünschen oder wollen, hieße sie Wunst. D. h., der Kunst liegt ein solides Handwerk, eine Ausbildung zugrunde, sie entwickelt sich mit entsprechender Erfahrung und wird natürlich auch durch die Begabung beeinflußt. Pulverich (1996, 477f; 2000, 643) führt in diesem Zusammenhang aus:
„Unter Fahrlässigkeit fällt auch die Anwendung einer Behandlungsmethode, ohne das dazu erforderliche Fachwissen erworben zu haben (BGH-Urteil vom 27.9.1983, in NJW 1984, S. 655). Der Psychotherapeut muß sich in jedem Einzelfall fragen und selbstkritisch prüfen, ob seine Fähigkeiten und Kenntnisse ausreichen, um die richtige Diagnose zu stellen und eine sachgemäße Behandlung einzuleiten und dabei alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen beachten zu können."
In der Einzelfallanwendung sind Psychotherapien - wie schon Heinroth 1818 [EN07] formulierte - heuristische, kreative und schöpferische Problemlösungen und Prozesse und auch so gesehen gut mit der Analogie "Kunst" vergleichbar. Es gibt daher auch keine mechanische oder schablonenhafte Fehler-Diagnostik. Ob ein potentieller Fehler im spezifischen Einzelfall wirklich ein Kunstfehler ist, kann nicht allgemein, sondern muß im Realitätsrahmen und Situationskontext des Einzelfalles untersucht und entschieden werden. Und natürlich hängt die Fehler-Diagnose und das Gewicht, das ihr zukommt, auch sehr davon ab, wie hoch der Schaden ist, aber auch davon, welcher Therapieschule die Fehler- DiagnostikerIn nahesteht. Dieser Zustand wird aber hoffentlich zunehmend an Bedeutung verlieren.
Erstes
Zwischenergebnis: Definition Kunstfehler
- Ein Kunstfehler liegt vor, wenn bei zumutbarer und kundiger Analyse der Einzelfall-Sachlage, ein nach den allgemeinen [EN08] oder zulässig individuell vereinbarten wichtigen Zielen und Zwecken der Behandlung gebotenes Tun oder Lassen nicht erfolgte.
- Der Kunstfehler heißt bedeutsam, wenn der unerwünschte Zustand oder Schaden beträchtlich, d.h. operationalisierbar und quantifizierbar ist.
- Ob ein potentieller Fehler im spezifischen Einzelfall wirklich ein Kunstfehler ist, kann meist nicht allgemein, sondern muß im Realitätsrahmen und Situationskontext des Einzelfalles untersucht und entschieden werden.
Therapieschulsystem
bedingte Kunstfehler
Die Einzel- und einsichtsorientierten Therapien vernachlässigen nicht selten die ökologische Dimension und beziehen das Umfeld mit den beiden wichtigsten Komponenten Arbeits- und Beziehungsraum nicht genügend ein. Sie berücksichtigen zu wenig, daß der Mensch Teil eines ökosozialen Systems und Ganzen ist. Hier liegt der Schwerpunkt der systemischen Therapie. Das kann und darf man nun aber keiner einzelnen Therapieschule überlassen, sondern es ist die Pflicht jedes Therapiesystems, den sozialen Lebensraum der PatientIn einzubeziehen und hierfür geeignete Arbeitsmodelle und Konstrukte zu entwickeln. Wenn im Zuge von individuenzentrierten Therapien Partnerschaften, Ehen und Familien auseinanderbrechen, so wird hier mitunter ein großer und unwiderruflicher Schaden angerichtet.
Betrachten wir uns die Therapieschulen, so fällt auf, daß die wichtigsten Schulen ganz unterschiedliche Schwerpunkte und damit auch Einseitigkeiten und Bedürftigkeiten aufweisen, die mit einem wissenschaftlichen Psychotherapiekonzept nicht in Einklang zu bringen sind. Betrachten wir die verschiedenen Therapieschulen unter dem Gesichtspunkt psychischer Hauptfunktionen, die zugleich als psychische Heilmittelklassen angesehen werden können, so zeigt sich z.B. folgendes:
Die Heilmittelklasse [J]Empfinden_Fühlen_Spüren spielt z. B. eine wichtige Rolle in der Gesprächspsychotherapie, beim Focusing, in der Körpertherapie, in Gestalt und in allen Entspannungstherapien. Das Heilmittel [J] Entspannen ist daher eine ganz wichtige Spezies dieser Heilmittelklasse. [t] Alexithymien, [t] Orientierungslosigkeit, [t] psychosomatische Symptommasken, [t] Streß und Überforderungssyndrome haben oft mit gestörtem [J] Empfinden_Fühlen_Spüren zu tun. Die Heilmittelklasse [J] Empfinden_Fühlen_Spüren ist schwer zu überschätzen; sie liefert im übrigen auch die psychologische Grundlage für die wichtige Heilmittelklasse des [J] Wertens.
[J] Einsicht, [J] Bewußtheit und [J] Katharsis sind die Kernheilmittel der Psychoanalyse, aber auch von Gestalt und Gesprächspsychotherapie.
[J] Lernen und [J] Verhalten sind die Grundklassen der verhaltenstherapeutischen Heilmittel.
[J] Denken, [J] Einstellungen und [J] Kognitive Schemata sind wichtige Heilmittel in der kognitiven Therapie.
[J] Durcharbeiten und [J] Klären sind wichtige Spezies der Heilmittelklasse [J] Kommunikation, die in allen Psychotherapien eine zentrale Rolle spielt.
[J] Regeln - die Beziehungen [J] lenken, [J] gestalten und verändern - sind wichtige Heilmittel der interpersonellen Therapien, der Transaktionsanalyse, der Systemischen, Strategischen und Kommunikationstherapie, speziell auch in der Anwendung Gruppen- und Familientherapie.
[J] Konfrontieren als Stellen sind Spezies mehrerer Heilmittelklassen, besonders aber des [J] Tuns, das eine zentrale Rolle in der Verhaltens- und Systemischen Therapie spielt.
[J] Lenken ist wahrscheinlich das wichtigste allgemeine Heilmittel überhaupt. Eine offensichtliche Rolle spielt es bei [t] Zwängen, [t] Impulsneurosen, bei den [t] Süchten und [t] Abhängigkeiten, beim [t] Vermeidungsverhalten und allen Störungen vom Typ Beherrschung einerseits und Überwindung von [t] Passivität, [t] Desinteresse und [t] Trägheit andererseits.
Eine wissenschaftliche Psychotherapie sollte den ganzen
Menschen, alle wichtigen psychischen Funktionen und auch - wenigstens konzeptionell
- den sozialen Lebensraum mit einbeziehen. Dies läßt sich gut
mit der Metapher folgenden Psychotherapiebaums verstehen.

Stellt sich in einer Psychotherapie z.B. heraus, daß
zur Erreichung eines Therapieziels erhebliche Informationsdefizite beseitigt
werden müssen, so ist natürlich klar, daß man dieses Problem
nicht dadurch beheben kann, daß man etwa fragt: Was fällt Ihnen
dazu ein? oder Wie geht es Ihnen damit? Hier muß informiert werden.
Stellt sich heraus, daß jemand eine Fähigkeit nicht richtig
beherrscht, die zur Erreichung eines Therapieziels notwendig ist, so steht
Lernen und entsprechende Unterstützung an. Jede Vermeidungsproblematik
muß letztlich die Konfrontation anstreben. Das wußte Plutarch
bereits vor 1900 Jahren, der geniale Goethe
als er 1777 in die Kuppel des Straßburger Münsters stieg,
um seine Höhenphobie zu kurieren, und auch Freud
und Ferenczi um 1916. Konfrontationstherapie muß daher Bestandteil
jedes Therapiesystems sein, das Vermeidungsverhalten behandeln will, ebenso
wie die Einbeziehung und Handhabung unbewußter
Prozesse kein Reservat der Tiefenpsychologie
sein darf, weil unbewußte Prozesse bei allen Menschen und natürlich
z.B. auch in Verhaltenstherapien eine wichtige Rolle spielen.
Bedingte Kunstfehler, die aus einer Vorgabe resultieren
Von einem bedingten Kunstfehler spreche ich, wenn er aus
einer Vorgabe resultiert. Beispiel: Gibt man in der Therapie eine Aufgabe,
so ist es sicher ein kleiner Kunstfehler, Erledigung und Ergebnis dieser
Aufgabe nicht nachzufragen. Läßt jemand eine suizidale Problematik
erkennen, so muß das aufgegriffen werden. Wird ein Informations-,
Lern oder Verhaltensdefizit beklagt und die Überwindung zum Therapieziel
gemacht, muß sich die PsychotherapeutIn aktiv darum
kümmern (das betrifft in besonderem Maße alle - meist einsichtsorientierte
- Therapieschulen, die sich als non-direktiv
verstehen und aktive Information, Beratung und Anleitung ablehnen).
Kunstfehler-Paradoxien und Kuriosa
Auch wenn uns das gar nicht gefällt: Laien, Esoteriker
und Scharlatane können sehr erfolgreich sein. Statt sich darüber
aufzuregen, wäre gründliche Forschung hierzu sinnvoller und wichtiger.
Der Sektenspezialist Hemminger
führt aus: "Die Zufriedenheit der Klienten esoterischer Therapien
ist hoch, bei einer repräsentativen Befragung wurden kaum Negativeffekte
genannt." . Die Konsumenten- Studie von Hartmann
& Zepf in der Zeitschrift test 2002, 02, 91-95, zeigt, daß
auch die Selbsthilfegruppen fast genauso gut abgeschnitten haben wie die
Therapiegruppen. Die von PsychoanalytikerInnen durchgeführte Studie
ergab überdies, daß die Psychoanalyse bei der Symptomreduktion
am besten abschnitt und daß Therapien umso erfolgreicher sind, je
länger sie dauern, also Ergebnisse ganz nach den Wunschträumen
der Psychoanalyse, die sehr stark nach wissenschaftlichen Kunstfehlern
riechen. Nun, selbst kriminelles, egozentrisches, mißbrauchendes
und unethisches Verhalten kann im Einzelfall sehr erfolgreich sein. Das
scheint sogar den inzwischen auch in Deutschland strafrechtlich verbotenen
sexuellen Mißbrauch zu betreffen, wie die Übersichtsarbeit „Als
hätte ich mit einem Gott geschlafen" von Pope & Bouhoutsos
(dt. 1991,1994; engl. 1986) zeigt. Ja, aus Kunstfehlern können sogar
neue Therapieschulen entstehen, wie uns folgender Fall [EN09]
lehrt:
| „Aaron war der sehr intelligente,
11jährige Sohn einer kühlen, überintellektuellen und geschiedenen
Frau, die als Mathematikerin in einem der Los Angeles Raketen- Weltraum-
Laboratorien arbeitete. ... Als er mir vorgestellt wurde, war er bereits
2 Jahre lang bei zwei anderen Therapeuten in Behandlung gewesen, ... Die
anderen Therapeuten hatten ihn konventionell mit Spieltherapie behandelt.
Der größere Teil ihrer Zeit wurde damit zugebracht, ihm die
Bedeutung seines Spiels zu erklären. Schlug er z. B. wiederholt eine
weibliche Puppe, fragte ihn der Therapeut, ob er nicht gerne seine Mutter
schlüge, und er hoffte, Aaron würde ihm die Richtigkeit seiner
Vermutung bestätigen. ...
Eine Möglichkeit, Aaron zu beschreiben, ist die Feststellung, daß er - obwohl angenehm in seiner äußeren Erscheinung - das abscheulichste Kind war, dem ich jemals begegnet war. Ganz gleich, wie er sich auch benahm: nie hatte jemand versucht, ein Werturteil über sein Verhalten abzugeben. Niemand hatte ihm je erzählt, daß das, was er tat, falsch war. Alles was er tat, wurde als etwas angenommen, was erklärt oder - wie der Fachmann sagt - interpretiert werden mußte. ... Obwohl ich damals die Methode der RT noch nicht konzipiert hatte, entdeckte ich in der Arbeit mit Aaron erstmals die außerordentliche Bedeutung der Konfrontation des Kindes mit seinem Verhalten. Diese Konfrontation, die glücklicherweise erst stattfand, nachdem eine Beziehung aufgenommen worden war, begründete die therapeutische Bindung, die Aaron sehr half. Mir war in etwa deutlich geworden, daß ich durch die Anwendung der Prinzipien der orthodoxen Therapie nur noch mehr zu Aaron's Hoffnungslosigkeit beitrug, anstatt sie zu erleichtern, und so entschloß ich mich, meine Taktik abzuändern. Gegen all meine Ausbildung und alle einschlägigen Bücher und ohne jemandem davon etwas zu erzählen, begann ich eine Art Realitätstherapie. Mit Erklärungen und Interpretationen war es nun vorbei. Von nun an würden wir Nachdruck auf die Realität und das gegenwärtige Verhalten legen. Als Aaron am nächsten Morgen kam, nahm ich ihn in mein Büro, stupste ihn sanft an dem Spielraum vorbei, wo er - wie immer - anzuhalten versuchte. Ich sagte ihm, er solle sich setzen und zuhören, und erklärte, ich sei nicht daran interessiert, was er zu sagen habe, sondern nur daran, daß er mir zuhören möge. Er jammerte und versuchte davonzukommen, aber ich hielt ihn fest und hielt sein Gesicht dem meinen zugewandt. Ich sagte ihm, er solle seinen Mund halten und nur einmal in seinem Leben zuhören, was andere zu sagen hätten. Ich erklärte ihm, die Zeit des Spiels sei vorüber; nun würden wir sitzen und wie Erwachsene reden; wenn wir spazieren gingen, würden wir wie Erwachsene gehen. Ich sagte ihm ganz klar, daß ich weder ein Davonlaufen noch ein unhöfliches Benehmen tolerieren würde, wenn wir gingen; er habe höflich zu sein und zu versuchen, sich mit mir zu unterhalten. Er habe mir alles zu erzählen, was er täte, und ich würde ihm entscheiden helfen, ob es richtig oder falsch wäre. Als er gehen wollte, hielt ich ihn mit Gewalt zurück. Als er versuchte, mich zu schlagen, sagte ich ihm, ich würde zurückschlagen. Nach 2 Jahren ohne jede Einschränkung war es wahrscheinlich die Plötzlichkeit der neuen Haltung, die ihn dazu brachte, mit mir zu reden. .... Als ich ihm offen sagte, er sei das abscheulichste Kind, das ich je getroffen hätte, war er sehr überrascht. Er hatte geglaubt, alle Therapeuten müßten ihre Patienten automatisch lieben. Ich teilte ihm mit, daß er sich ändern müsse, wollte er bei mir in Behandlung bleiben. Denn weder ich noch irgendjemand anders sei in der Lage, ihn so, wie er jetzt sei, gern zu haben. Was dann geschah, kam ganz unerwartet. Zunächst wurde er liebenswürdig und sprach höflich mit mir. Er schien gerne bei mir zu sein, und erstaunlicherweise begann ich, mich auf ihn zu freuen. ... Die Beziehung zwischen Aaron und mir gedieh schnell. Ich kritisierte ihn für alle seine alten Schwächen, aber ich lobte ihn auch, wenn er es gut machte. Nach etwa 6 Wochen hatte er sich sehr verändert. Von der Schule hörte ich, seine Leistungen seien plötzlich sehr gut geworden, sein Verhalten ausgezeichnet. Die Lehrer verstanden nicht, was passiert war. Ich bat sie, streng mit ihm zu sein, ihn im übrigen aber so freundlich wie möglich zu behandeln und keinen Kommentar über sein verändertes Verhalten abzugeben. Zu Hause merkte seine Mutter die Veränderungen, und obwohl sie sich über sein neues Verhalten freute, fühlte sie sich unwohl, weil er "anders" war. Da sie ihn immer als eine Art unglücklicher kleiner Kreatur gesehen hatte, fand sie es nun schwierig, zu ihm als einem verantwortlichen Jungen Beziehung aufzunehmen. Grund dafür war ihre gestörte Beziehung zu Männern und zu Menschen allgemein." |
So entstand also 1965 die von dem Psychoanalytiker Glasser
begründete sog. Realitätstherapie, deutsche Veröffentlichung
1972. Ich komme nun zur Systematik und Klassifikation.
Liste Potentieller Kunstfehler-Quellen
Methodik: Wie bin ich damals 1996 bei der ersten Version
vorgangen? (1) Im wesentlichen habe ich die Literatur, meine FachteamkollegInnen
(inzwischen Qualitätszirkel) [EN10],
die Regionalgruppe integrativer PsychotherapeutInnen Mittelfranken und
meine eigene Erfahrung (vor allem auch im Umgang mit Fehlern) exploriert
und zu sortieren versucht. (2) Die Klassenbildung erfolgt nach den Regeln
der Definitionslehre, Logik und Methodologie [EN11],
d. h.: differenzieren nach Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten und Unterschieden
und Zusammenfassen nach gemeinsamen und ähnlichen Merkmalen des therapeutischen
Prozesses. Neu hinzugekommen sind - gegenüber der Erstveröffentlichung
1997 - 2.7, 2.8, 4.0 und 4.4.
(1)
Potentielle Kunstfehler zu Beginn einer Behandlung
- 1.1 Wenn keine Aufklärung über Dauer, Erfolgsaussichten und Risiken erfolgt.
- 1.2 Wenn eine PatientIn angenommen wird, ohne sich dem Fall ausreichend gewachsen zu fühlen.
- 1.3 Wenn eine PatientIn angenommen wird, und bezüglich der Problematik keinerlei Erfahrungen vorliegen, ohne dies in den probatorischen Sitzungen anzusprechen und abzuklären.
(2)
Potentielle Kunstfehler mangelhafter Diagnostik, Therapieplanung, therapiebegleitender
Evaluation und Dokumentation
- 2.1 Wenn der Realitätsrahmen des Einzelfalles nicht angemessen berücksichtigt wird (Zeit, Geld, Randbedingungen).
- 2.2 Wenn angebotene Symptome und SymptomträgerInnen (IndexpatientInnen in der systemischen Therapie) nicht kritisch hinterfragt oder permanent kritisch überfragt werden (Relativität der Bedeutung von Symptom und SymptomträgerInnen).
- 2.3 Wenn versäumt wird, ein evaluierbares Behandlungskonzept zu entwickeln (hypothesengeleitetes Vorgehen), wie die Störungen beeinflußt werden sollen.
- 2.4 Mangelhafte oder gar fehlende therapiebegleitende Evaluation und Dokumentation, damit rechtzeitig erkannt werden kann, wie die Erfolgs- und Mißerfolgsaussichten sind.
- 2.5 Wenn Entwicklung, Bereitschaft, Fähigkeit und Einsicht der PatientInnen nicht angemessen berücksichtigt werden (Überforderung, Widerstand, Abneigung).
- 2.6 Qualitätätssicherung und Erfolgskontrolle (wenn nicht wenigstens stichprobenhaft z. B. 10 : 1 Katamnesen zur Evaluierung von Behandlungserfolgen durchgeführt werden).
- 2.7 Unzulängliche, geschönte Diagnostik, um PatientInnen nicht zu labeln, z.B. das Vermeiden der Diagnosen Persönlichkeitsstörungen oder Schizophrenie.
- 2.8 Suggestive Explorationsmethoden in der Diagnostik [Anmerkung aus der Diskussion EN12].
Anmerkung: Die enorme Bedeutung dieser Fehlerquelle ist mir erst in den letzten Jahren so richtig klar geworden, vor allem auch durch meine Neben-Tätigkeit als Aussagepsychologe. Während Psychotherapie vielfach suggestiv ist und positiv suggestiv sein darf [EN13], sind Suggestivmethoden in allen diagnostischen Situationen fatal. Da jede Therapie auch fortwährende Diagnostik und Evaluation betreiben muß, entsteht hier für die PsychotherapeutIn eine schwierige Situation, weil sich diagnostischer und therapeutischer Interventionsstil grundlegend unterscheiden. Suggestive Aussagen sind praktisch solche, die mit Ja oder Nein beantwortet werden könnten oder sogar noch eine implizite Aussage enthalten. Beispiele für suggestiv falsche Fragen mit richtigem Alternativvorschlag:
- Suggestiv und falsch: Sind Sie orgasmusfähig? Richtig:
Können Sie Ihre sexuellen Reaktionen beschreiben?
Suggestiv und falsch: Sind Sie sexuell mißbraucht
worden?
Richtig: Was haben Sie sexuell erlebt?
Suggestiv und falsch: Haben Sie seit der Vergewaltigung Panikattacken? Richtig: Können Sie sich noch daran erinnern, wann ungefähr Ihre Panikattacken aufgetreten sind?
(3)
Potentielle Kunstfehler mangelnder Abklärung oder Kooperation
- 3.1 Wenn mit anderen beteiligten TherapeutInnen (z. B. ÄrztInnen, SozialpädagogInnen, PädagogInnen, HeilpraktikerInnen, SeelsorgerInnen, PflegerInnen) nicht angemessen zusammengearbeitet wird, wenn erforderlich.
- 3.2 Besonders mangelnde medizinische Abklärung im Bereich Psychosomatik und Psychopathologie.0
(4)
Potentielle Kunstfehler gegen die therapeutische Beziehung
- 4.0 Grundlage ist eine wohlwollende, interessierte und aufmerksame Haltung.
- 4.1 Mangelnder Aufbau einer tragfähigen therapeutischen Beziehung.
- 4.2 Wenn Kritik, negative Rückmeldungen oder verstärktes negatives Befinden von PatientInnen nicht zu verstärkter Reflexion und Supervision führen und nicht erwogen wird, ob eine Veränderung der Therapierahmenmethode oder ein TherapeutInnenwechsel der PatientIn besser dient.
- 4.3 Unnötig starke Bindung aufbauen (abhängig machen), dadurch unnötige Ablösungsschwierigkeiten und Therapieverlängerung.
- 4.4 Unreflektiertes Riskieren von Komplikationen und Loyalitätskonflikten durch - evtl. auch gleichzeitige - Behandlung Nahestehender oder Interessenverbundener.
(5)
Potentielle Kunstfehler mangelnder Reflexion, Supervision und Fortbildung
- 5.1 Wenn besonders in problematischen und unklaren Therapiesituationen keine entsprechende Reflexion, Auto-Supervision oder Supervision erfolgt.
- 5.2 Wenn keine ständige, auch schulenübergreifende Fortbildung erfolgt. [Hierzu Pulverich]
(6)
Potentielle Kunstfehler gegen Ergebnisse allgemeiner Psychotherapieforschung
- 6.1 Wenn nicht alle therapierelevanten Dimensionen (Beziehung, Klärung, Ressourcenaktivierung, Bewältigung) angemessen berücksichtigt werden.
- 6.2 Wenn dem individuellen und spezifischen Einzelfall nicht angemessen Rechnung getragen wird.
- 6.3 Wenn das soziale Umfeld und die konkrete Lebenssituation der einzelnen PatientIn nicht angemessen einbezogen und berücksichtigt wird.
- 6.4 Wenn bewährte Standardmethoden ("kriterienvalide Heilmittel") nicht zur Lösung der ihnen zugeordneten Störungen angewendet werden (z. B. Stellen bzw. Konfrontieren in der Behandlung der Phobien).
(7)
Potentielle Kunstfehler gegen das Persönlichkeitsrecht (Abstinenzgebot)
- 7.1 Wenn Behandlungsziele gegen den Willen von PatientInnen verfolgt werden. Die PatientIn hat ein Grundrecht auf persönliche Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung.
- 7.2 Wenn zu sehr in die Persönlichkeit der PatientIn eingedrungen wird, ohne daß dies nach den Therapiezielen erforderlich wäre.
- 7.3 Wenn das Abwehrsystem der PatientIn mit Brachialmethoden zum Wanken gebracht wird.
- 7.4 Besondere Merkmale, Fähigkeiten oder Dienste einer PatientIn für sich auszunutzen, etwa der narzißtische Mißbrauch und ganz extrem der sexuelle Mißbrauch von PatientInnen.
(8)
Potentielle Kunstfehler gegen Effizienz und Wirtschaftlichkeit
- 8.1 Wenn nicht versucht wird, so kurz bzw. schnell und so schonend im Sinne der Lebenswerte der PatientIn wie sicher (bewährte Methoden) und ökonomisch wie möglich zu behandeln.
- 8.2 Wenn Therapiemethoden angewendet werden, von denen bekannt ist, daß sie für ein gegebenes Problem nicht so gut geeignet sind wie andere.
- 8.3 Wenn Therapiemethoden oder Techniken nicht angewendet werden, obwohl allgemein bekannt ist, daß sie für ein umschriebenes Problem sehr wirkungsvoll sind.
- Hierbei muß aber berücksichtigt werden, daß nicht jede PsychotherapeutIn alles können kann und daß jede TherapeutIn im Einklang mit ihrer Persönlichkeit, Erfahrung und Kompetenz handeln, also kongruent sein muß.
(9)
Sonstige potentielle Kunstfehler: Rest- und Auffangkategorie
Rest- und Auffangkategorie für bislang nicht berücksichtigte
potentielle Kunstfehlerquellen.
Zusammenfassung der schlimmsten potentiellen Fehlermöglichkeiten
Ich möchte mich zum Schluß auf die Nennung einiger grober und schwerer Kunstfehlermöglichkeiten beschränken als da meiner gegenwärtigen Auffassung nach sind: (1) Verkennen einer Selbstmordgefahr. (2) Fehlende Notfallprophylaxe, (3) Psychotische Dekompensation, (4) Zerstörung von Partnerschaften, Familie und Beziehungen, (5) anhaltende Nichtbesserung oder gar Verschlimmerung und (6) Falsche Indikation und Falschbehandlung.
Pulverich
(1996, 479; 2000, 644) führt zur Selbstmordgefahr aus:
| „Bei endogenen Depressionen
oder anderen psychischen Erkrankungen, bei denen mit einer Selbstmordgefahr
des Patienten gerechnet werden muß, kann eine Garantenstellung des
behandelnden psychologischen Psychotherapeuten bestehen, die ihn verpflichtet,
eine Unterbringung oder freiwillige Einweisung in eine stationäre
Einrichtung zu veranlassen.
Verletzt er diese Verpflichtung, macht er sich nicht nur wegen fahrlässiger Tötung strafbar (BayOLG Urteil vom 21.11.1972, in NJW 1973, S. 56s), er ist ggf. auch schadensersatzpflichtig gegenüber den Hinterbliebenen. Die Offenbarung der Suizidgefahr zum Zwecke des Lebensschutzes ist hinsichtlich der Schweigepflicht gerechtfertigt (s. unten). Eine Garantenpflicht mit den vorbeschriebenen Folgen besteht aber nicht, wenn ein Patient Selbstmordabsichten äußert, jedoch die Freiheit und Möglichkeit seiner Willensbestimmung in keiner Weise eingeschränkt ist." |
In diesem von Pulverich zuletzt unterschiedenen Fall sollte man besser nicht von Selbstmordabsicht, sondern Freitodabsicht sprechen.
Nun, inzwischen sind psychotherapeutische Behandlungsklemmen und potentielle Kunstfehler attraktiv für das Fernsehen geworden:
Therapie
und Praxis, 10.7.2 ARD 20.15-21.45

Quelle: Aus der Fernsehprogrammeinlage der Nürnberger (Erlanger) Nachrichten vom 10.7.2002
Immerhin, wenn schon das Fernsehen zur besten Sendezeit, Kunstfehlerfilme bringt, dann ist es sicher auch an der Zeit, daß wir uns dem Problem mehr stellen. Fehler sind normal und unvermeidbar. Vermeidbar sind aber Wegschauen, Ausblenden und damit Nichtbefassen. Wer bei sich die Fehlermöglichkeiten mehr wahrzunehmen bereit ist, wird sicher eine bessere Therapie machen können. So gesehen ist die Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit potentiellen Kunstfehlern weder Schimpfwort noch Tabu, nicht nur eine Pflicht sondern eine ganz normale professionelle Selbstverständlichkeit.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Abstract - Zusammenfassung:
(I) Es wurde das Kunst- oder Behandlungsfehlerproblem in der Psychotherapie aus allgemeiner und multi-modal-integrativer Perspektive erörtert. Die Notwendigkeit einer schulenübergreifenden Perspektive wurde dargelegt und begründet.
(II) Überblick:
- Einführung: Was bedeutet Psychotherapie rechtlich und was folgt daraus?
- Kunstfehler im engeren Sinne
- Erstes Zwischenergebnis: Definition Kunstfehler
- Therapieschulsystem bedingte Kunstfehler
- Kunstfehler-Paradoxien und Kuriosa
- Liste potentieller Kunstfehler-Quellen
(III) Die Liste potentieller Kunstfehlerquellen wird an einigen Beispielen aus Praxis erprobt. Abschließend werden die schlimmsten Kunstfehlerquellen erörtert.
Nachtrag
aus der Diskussion: Was tun?
Die Kunstfehlerproblematik kann im weiteren Sinne einerseits
der Berufsethik und andererseits der Qualitätssicherung und dem Qualitätsmanagement
zugeordnet werden. Obwohl die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie
die Debatte bereits 1988
auf den Weg brachte, ist die kontinuierliche Beschäftigung und Auseinandersetzung
mit dem Thema keineswegs eine ganz normale professionelle Selbstverständlichkeit,
wie es zu wünschen und zu fordern ist. Leider ist zu befürchten,
daß das Gesundheitssystem - wie meist - den falschen Weg über
formalisierte Bürokratisierung, Gängelung und Verordnung gehen
wird. Eine Fachtagung wie diese, aus der heraus die Auseinandersetzung
in die Fachteams, Supervisionsgruppen, Qualitätszirkel und Praxen
getragen wird, ist sicher ein guter Weg. Die Kunstfehlerdebatte muß
von der PsychotherapeutInnen innerlich angenommen und akzeptiert werden,
sonst bleibt sie aufgesetzt, hohl und entgleitet zu einer formalisierten
Pflichtübung. Sinnvoll erscheint eine Kombination aus positiven Anreizen
etwa über Punktwerte und Boni - da in unserer Gesellschaft fast alles
über Geld und in der
Heilkunde über Punktwerte reguliert wird - und eine kollegiale Kontrolle.
Hier werden die Psychotherapeuten-Kammern eine ganz wichtige Aufgabe erhalten.
Eine wirkliche Kontrolle des realen Geschehens könnte aber nur dadurch
eintreten, daß jede Sitzung tonbandprotokolliert werden muß,
nur dann wären etwa die negativ suggestiven Kunstfehler in der Psychoanalyse
prüfbar.
Ausblick
Wie geht es weiter? Ich werde das Thema weiter verfolgen,
Material, Literatur und Quellen zum Thema sammeln. Hinweise,
Information und Kritik sind willkommen.
Literatur- und Linkhinweise
Literatur zur Methodologie und Klassifikation:
_
Neuere Literatur zum Behandlungs- und Kunstfehlerproblem (nach 1996)
_
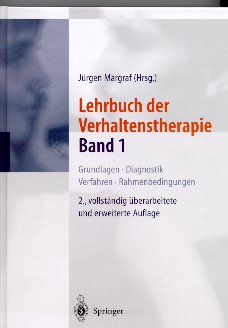 |
Rechtliche Rahmenbedingungen
633-654
GERD PULVERICH Verhaltenstherapie im Sozialrecht
|
_
Linkhinweise
Viagra
Dr. Steffen Fliegel zu VIAGRA: „Bei psychischen Ursachen von Erektionsstörungen ist VIAGRA kontraindiziert, die Verschreibung wäre ein Kunstfehler. Denn: Es gibt gute Alternativen in der Sexualberatung und in der Sexualtherapie, die frei von Nebenwirkungen sind und auch die Ursachen der sexuellen Störungen behandeln."
Aus dem Internet: Thema am 08.06.98 in: "VORNAME GENÜGT"
In Arzthaftungsprozess grundsätzlich Gutachten nötig - Behandlungsfehler
müssen im Prozess gerügt werden
Saarbrücken (12.10.2000; Az.: 1 U 819/99-203): https://www.psychotherapie.de/report/2000/10/00101201.htm
https://www.psychotherapie.de/report/2000/02/00022301.htm
Berufsbiographisches: Rudolf Sponsel (Jahrgang 1944) studierte in Erlangen Psychologie (Toman, Werbik), Psychopathologie (Wieck, Baer), Philosophie (Lehrstuhl Lorenzen) und Soziologie (Matthes). Seit 1978 freie Praxis, ab 1985 allgemeine und integrative psychologisch-psychotherapeutische Gemeinschaftspraxis mit der Ehegattin. Gemeinsam über 1000 Fälle und rund 1500 h Supervisionserfahrung. Forensischer Sachverständiger (Familienrecht, Aussagepsychologie); verkehrpsychologische Beratung. Arbeiten: "CST-System" (1982-84), Promotion über Psychotherapieerfolgskontrolle (Toman, Egg), "Numerisch instabile Matrizen und Kollinearität in der Psychologie" (1994) und "Handbuch Integrativer Psychologischer Psychotherapie" (1995). In Vorbereitung: (Herbst 2002): Handbuch der AD-H-D Diagnostik bei Erwachsenen. Über 20 Jahre Mitglied im BDP, neben der Praxis mit dem Aufbau der Gesellschaft für Allgemeine und Integrative Psychotherapie beschäftigt mit dem Schwerpunkt der Internetzeitschrift IP-GIPT. Anschrift: Dipl.-Psych. Dr. phil. R. Sponsel. Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen. Fax 09131-27115 Email: irs@sgipt.org. Tel. 09131-27111.
IVS: Institut für Verhaltenstherapie, Verhaltensmedizin und Sexuologie. Nettelbeckstr. 14 D-90491 Nürnberg.
___
An die TeilnehmerInnen: Herzlichen Dank für die angenehme, interessierte Atmosphäre, die gute Aufnahme und Diskussion.
___
Kuchinsky-Zitatquelle: Mutschler, Ernst (1975 f). Arzneimittelwirkungen. Ein Lehrbuch der Pharmakologie für Pharmazeuten, Chemiker und Biologen. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. S. 46
___
EN01 So schon Freud (1909, GW 7, S. 284) in der „Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben": „Es ist aber nicht der therapeutische Erfolg, den wir an erster Stelle anstreben, sondern wir wollen den Patienten in den Stand setzen, seine unbewußten Wunschregungen bewußt zu erfassen."
___
EN02 Sutherland, Stuart (dt. 1980, engl. 1976). Die seelische Krise. Frankfurt: Fischer. S. 35f
___
EN03 Man beachte, daß diese Deutung neben ihrer negativen Labelung sehr negativ suggestiv und somit ein diagnostischer bzw. therapeutischer Kunstfehler ist.
___
EN04 Auch diese Deutung ist neben ihrem schockierenden Inhalt ebenfalls sehr negativ suggestiv und daher ein schwerer diagnostischer bzw. therapeutischer Kunstfehler.
___
EN05 ausführlich zur Geschichte der [ärztlichen] Kunstfehler: Mallach et al. 1993, S. 2 ff
___
EN06 BGH NJW 1978 587, OLG Bamberg VerR 1977 436". In: (S. 10): Mallach, H. J.; Schlenker, G.; Weiser, A. (1993). Ärztliche Kunstfehler. Eine Falldarstellung aus Praxis und Klinik sowie ihre rechtliche Wertung. Stuttgart: G. Fischer.
___
EN07 J. A. C. Heinroth (1773-1843), der 1811 in Leipzig den ersten Lehrstuhl für psychische Therapie bekam, hat bereits 1818 in seinem Lehrbuch der psychischen Störungen die große Bedeutung der Heuristik im heilkundlichen Handeln erkannt. Behandeln ist nach Heinroth ein heuristisches „Geschäft".
___
EN08 Hier sind die rechtlichen, berufsrechtlichen und berufsethischen Rahmenbestimmungen gemeint, die unabhängig von individuellen Vereinbarungen gelten, z.B. sind sexuelle Kontakte verboten, gelten nach dem Gesetz als schädlich und sind verboten, was auch durch eine individuelle Vereinbarung nicht aufgehoben werden kann.
___
EN09 Glasser, W. (dt. 1972, orig. 1965) Realitätstherapie. Neue Wege der Psychotherapie. Weinheim und Basel: Beltz. Aus den Seiten 122 - 125.
___
EN10 Naturgemäß beschäftigen wir uns in unserer Fachteam-Supervision ständig mit unseren tatsächlichen, vermeintlichen und möglichen Fehlern einerseits und der Realisierung einer bestmöglichen Therapie für unsere PatientInnen andererseits. Besonders danke ich hier meinem integrativen Fachteamkollegen Gert Meixner aus der Tagesklinik Nürnberg, den SchulpsychologInnen Mona und Hermann Meidinger, Augsburg und meiner Frau und integrativen Fachteamkollegin Irmgard Rathsmann-Sponsel, die mit vielen - und kritischen - Ideen zu der vorliegenden Fassung beitrugen.
___
EN11 Kamlah, W. & Lorenzen, P. 1967; Menne 31992; Savigny, E. v. 1970.
___
EN12 In der Diskussion wurde von einer Kollegin kritisch angemerkt, daß sie die direkte, auch suggestive Frage bei suzizidaler Problematik, für richtig hält, was im Einzelfall richtig sein kann. Ein einfache Möglichkeit, auch direkt, aber nicht suggestiv zu fragen, ist immer möglich durch „Ver-Oderung" und In-Kaufnahme von „schlechtem" oder umständlicherem Deutsch" : Haben Sie Selbstmorgedanken oder haben Sie gegenwärtig keine?" Zur gesamten Suggestivproblematik siehe bitte: Suggestion und Suggestivfragen. Aussagepsychologische und vernehmungstechnische Kunstfehler. https://www.sgipt.org/forpsy/sugg/sfragen.htm. Praktische Beispiele auch hier: Kinder und ZeugInnen richtig befragen bei sexuellem Mißbrauch / Vergewaltigung: https://www.sgipt.org/forpsy/zeubef0.htm
___
EN13 Hierzu gehören wie oben schon ausgeführt solche negativ labelnden Suggestiv-Deutungen ganz sicher nicht »Es scheine, als hätten Sie die besten Dinge im Leben versäumt.« Und gar: »Hatten Sie damals nicht den Wunsch, Ihr Vater sollte Sie ficken, bis die Scheiße herausrinnt?« Das sind ganz sicher klare Kunstfehler - wie sie aber in Psychoanalysen sehr verbreitet sein dürften. Das ergibt sich u.a. daraus, daß selbst neuere Standardwerke psychoanalytischer Therapie ein diesbezügliches Problembewußtsein auch nicht im Ansatz erkennen lassen.
___
EN14 Kunstfehlerdebatte in der VT: "Die Vermeidung von Schädigungen der Klienten durch Psychotherapie und andere Formen psycho-sozialer Praxis sollte oberstes Ziel des praktischen Handelns aller klinischen Psychologen, Psychotherapeuten und Angehörigen anderer helfenden Berufe sein. So selbstverständlich eine solche Forderung auch sein mag, wird sie dennoch in keinem Bereich der medizinischen und psychosozialen Versorgung wirklich eingelöst." Aus dem Vorwort der Herausgeber
Kleiber, Dieter & Kuhr, Armin (1988, Hrsg.). Handlungsfehler und Mißerfolge in der Psychotherapie. Beiträge zur psychosozialen Praxis. Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie, {103 Seiten}. Tübinger Reihe, Nr. 8.
___
Pulverich (1996, 478; 2000, 643) zur Fortbildungsverpflichtung: „Darüber hinaus besteht die Verpflichtung zur Fortbildung, zumindest zum regelmäßigen Lesen der einschlägigen Fachzeitschriften, die ihn über Fortschritte in der Psychotherapie und über anderweitig gewonnene Erkenntnisse von Nutzen und Risiken der von ihm angewendeten Heilverfahren unterrichtet (BGH-Urteil vom 29.1.1991, aaO.). Der Maßstab, welche Sorgfaltspflichten für einen psychologischen Psychotherapeuten gelten, richtet sich nach dem Aus- und Fortbildungsstand der Gruppe der Psychotherapeuten (Taupitz, 199l)."
___
Nondirektive Therapieschul-Systeme sind in sich konzeptionell widersprüchlich, weil jede Psychotherapie durch Lenken Einfluß nehmen will und muß. Dies nicht angemessen wahrzunehmen, stellt ihre Eignung grundsätzlich in Frage und es bleibt letztlich unklar, was und wie diese Therapien wirken und wirken wollen.
___
Terminologie: Mit dem griechischen Buchstaben Theta J (nach Jerapeia (therapeia): Heilung) kennzeichnen wir Psychische Funktionen, wenn sie Heilmittel oder Heilwirkfaktoren Qualität (Funktion) annehmen, z. B. J einsehen, J zulassen unterdrückter Erinnerungen, J stellen (konfrontieren), J sich überwindenundJ mutig sein, J differenzieren, J entspannen, J lernen, J loslassen, J beherrschen ... Und um deutlich zu machen, daß wir ein Wort nicht alltagssprachlich, sondern im Rahmen einer psychologisch-psychotherapeutischen Fachsprache verwenden, kennzeichnen wir das Wort mit dem griechischen Buchstaben y (Psi, mit dem das griechische Wort für Seele = yuch, sprich: psyche, beginnt). Viel Verwirrung gibt es in und um die Psychologie, weil viele ihrer Begriffe zugleich Begriffe des Alltags und anderer Wissenschaften sind. Um diese babylonische Sprachverwirrung, die unökonomisch, unkommunikativ und entwicklungsfeindlich ist, zu überwinden, ist u. a. das Programm der Erlanger Konstruktivistischen Philosophie und Wissenschaftstheorie entwickelt worden: Kamlah & Lorenzen (1967). Zu einigen psychologischen Grundfunktionen siehe bitte: vorstellen. Ausführlich zur Terminolgie.
Störungs Funktor. Begriffe, die eine Störung repräsentieren sollen, kennzeichnen wir mit dem Anfangsbuchstaben Tau (t) des griechischen Wortes für Störung tarach (tarach).
Querverweise (Links) zum Terminologie-Problem in der Psychologie, Psychopathologie, Psychodiagnostik und Psychotherapie:
Introspektion, Bewußtseins- und Bewußtheitsmodell in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie
Beispiel Nur_empfinden_fühlen_spüren
Über den Aufbau einer präzisen Wissenschaftssprache in Psychologie, Psychopathologie, Psychodiagnostik und Psychotherapie
Überblick der Signaturen: Dokumentations- und Evaluationssystem Allgemeine und Integrative Psychotherapie
Testtheorie der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie.
Probleme der Differentialdiagnose und Komorbidität aus Sicht der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie
Standort: Über potentielle Kunst- oder Behandlungsfehler in der Psychotherapie.
*
- Überblick zum Thema Behandlungsfehler in der IP-GIPT.
- Sponsel, Rudolf (1997). Potentielle Kunst-/ Fehler aus der Sicht der Allgemeinen und Integrativen Psychologischen Psychotherapie. Materialien zur Qualitätssicherung mit einer Literaturübersicht
- Notfallwissen für PsychotherapeutInnen: Dick, Gunther & Dick-Ramsauer, Ursula (1996). Erste Hilfe in der Psychotherapie. Berlin: Springer.
- Iatrogenie - Krank durch Behandlung. Fehler, Behandlungsfehler, Kunstfehler. Ein kritischer Beitrag zur Epidemiologie des Gesundheitssystems, das selbst ein wichtiger Faktor für Krankheit und Tod ist.
- Sponsel, Rudolf (2002). «10 Gebote» für den richtigen Umgang mit Psychopharmaka. Buchhinweise, Literaturliste, Links: Arzneimittel und Psychopharmaka.
- Sponsel, R. (2002). Literatur und Linkliste (LiLi): Irrtum, Betrug, Tricks, Täuschung, Fälschung, Risiko, Versagen und anderes Fehlverhalten in Forschung, Wissenschaft und Technik.
- TOP-10. Theoretische Organisations-Prinzipien des Therapieprozesses in der GIPT.
- Die Handlungsprinzipien in der GIPT: Intuition * Heuristik * Flexibilität * Kontrolle.
- Literaturliste: Analogie, Erfinden, Heuristik, Intuition, Irrtum, Kreativmethoden, Problemlösung, Prod. Denken, Schöpferische Prozesse.
- Literaturliste: Evaluation, Evaluation Funktionen, Störungen u. a., Evaluation Psychotherapieprozeß
- Allgemeines und Integratives Psychologisch-Psychotherapeutisches Manifest.
- Außendarstellung der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie.
- Nachuntersuchung/ Qualitätssicherung
- Weitere Hinweise hier.