Internet Publikation für
Allgemeine und Integrative Psychotherapie
(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=18.03.2002
Internet-Erstausgabe, letzte Änderung 31.01.22
Impressum:
Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel
Stubenlohstr.
20 D-91052 Erlangen Mail:
Sekretariat@sgipt.org_Zitierung
& Copyright
«10 Gebote» für den richtigen Umgang mit Psychopharmaka
Buchhinweise und Literaturliste Arzneimittel und Psychopharmaka
von Rudolf Sponsel,
Erlangen
Erstausgabe 18.3.2002, Letztes Update
20.03.2002
Wichtige
Hinweise zu Empfehlungen
Und nicht vergessen: "Wenn behauptet wird, daß eine Substanz keine Nebenwirkungen zeigt, so besteht der dringende Verdacht, daß sie auch keine Hauptwirkung hat." (G. Kuchinsky; aus S. 46)
Arznei
Telegramm: https://www.arznei-telegramm.de/
Suchtgefahr
* Weitere Links *
Literaturauswahl
* Querverweise IP-GIPT
_
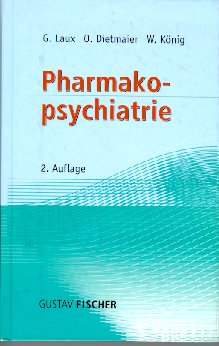 |
Laux, G.; Dietmaier, O. & König, W. (1997). Pharmakopsychiatrie. Stuttgart: Gustav Fischer. |
"«10 Gebote»
für den richtigen Umgang mit Psychopharmaka
- Psychopharmaka nur dann, wenn eine gezielte Indikation besteht (Erkrankung). Zuerst sorgfältige Untersuchung und Diagnosestellung (zugrundeliegende Ursachen).
- Medikamentöse Vorbehandlungen eruieren, Suchtanamnese abklären.
- Adäquate Wahl des Psychopharmakons nach Wirkprofil unter Berücksichtigung möglicher Interaktionen und Nebenwirkungen sowie Kontraindikationen.
- Dosierung in der Regel einschleichend und individuell. Keine Verschreibung größerer Mengen während der Akuterkrankung. Dosisanpassung bei Alterspatienten.
- Bei Tranquilizern und Hypnotika Dosierung möglichst niedrig aber ausreichend; frühestmögliche, langsame Dosisreduktion mit Übergang auf diskontinuierliche Gabe (Bedarfsmedikation).
- Exakte Aufklärung und Information des Patienten über Wirkung und mögliche Nebenwirkungen sowie Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, insbesondere mit Alkohol (möglichst meiden).
- Längerfristige Kombination mehrerer Psychopharmaka möglichst vermeiden.
- Persönliche Verordnung mit Verlaufskontrollen (Dosisanpassung). Aufbau einer tragfähigen Arzt-Patient-Beziehung (compliance).
- Gesamtbehandlungsplan erstellen, der auch andere Therapieformen umfaßt (ärztl. Gespräch, Psychotherapie, physikal. Maßnahmen).
- Bei Langzeit-Medikation Kooperation mit Facharzt (Indikationsstellung, Dosierung, Behandlungsdauer). Gesonderte Aufklärung über mögliche Nebenwirkungen bei Langzeitmedikation (Spätdyskinesien). «Paß» für Lithium- und Depot-Neuroleptika führen. Beendigung der Behandlung grundsätzlich durch langsam ausschleichende Dosisreduktion."
Das Buch
informiert weiter kurz und bündig orientierend über:
"1 Psychische Störungen durch Arzneimittel
Obwohl in der Regel für jedes
Arzneimittel ein mehr oder weniger breites Spektrum unerwünschter
Wirkungen bekannt ist, werden psychische Nebenwirkungen häufig übersehen
oder fehlbeurteilt. Dabei ist - insbesondere bei psychiatrischen Patienten
- die Unterscheidung, ob die psychischen Symptome krankheitsimmanent oder
pharmakogen bedingt sind, nicht immer einfach.
Psychische Störungen
werden in nicht unerheblichem Maße durch Psychophannaka selbst ausgelöst.
So können z. B. Neuroleptika zur Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit,
Affektverarmung und zu Depressionen führen. Antidepressiva können,
wenn auch selten, bei inadäquater Dosierung Verwirrtheitszustände,
Delirien oder produktiv psychotische Symptome hervorrufen. Bei Langzeiteinnahme
von Benzodiazepinen werden Persönlichkeitswandel (Gleichgültigkeit,
Adynamie) und dysphorisch-depressive Verstimmungen diskutiert. Gerade bei
älteren Patienten treten auch paradoxe Reaktionen wie z. B. Erregungsund
Unruhezustände auf. Besonders ausgeprägt können die psychischen
Nebenwirkungen bei plötzlichem Absetzen nach chronischem Gebrauch
sein: Hier kann es zu Delirien, zerebralen Krampfanfällen und Funktionspsychosen
kommen. Typische Folgen eines Psychostimulantien-Mißbrauchs sind
Depressionen sowie die Auslösung psychotischer Episoden."
_
| Suchtgefahr besteht gewöhnlich weder bei Neuroleptika noch bei Anti-Depressiva, stark jedoch bei den Tranquilizern, den "Happy- und Glückspillen", wenn sie über einen längeren Zeitraum genommen werden. Aus psychologisch- psychotherapeutischer Sicht empfiehlt sich hier Vorsicht, wenngleich kurzfristige Gaben bei kürzeren außergewöhnlichen Belastungen vertretbar erscheinen. |
Links
(Wichtiger Hinweis)
- Arznei Telegramm: https://www.arznei-telegramm.de/
- Arbeitskreis Sucht: https://www.verwaltung.uni-karlsruhe.de/~bad/aksucht/kap02.html
- Interessante und wichtige Statistiken zum Thema MPU, Alkohol, Verkehr: https://www.mpu-test.de/psychopharmaka1.htm
- Wie Frauen ihren Umgang mit Psychopharmaka überprüfen können: https://www.frauennetz.schleswig-holstein.de/servlet/is/2060/
- Zur Geschichte der Psychopharmaka: https://www.psychiatrie.de/therapie/gesch.htm
- Stille Nacht mit Valium: https://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,42694,00.html
Literatur zu Arzneimitteln und Nebenwirkungen
Auch ältere Werke
können hier sehr interessant sein, speziell für die Geschichte
der Medikamente, die wieder schnell in ihrer Anwendung verändert (z.B.
Reserpin) oder gar wegen gravierender Nebenwirkungen ganz vom Markt genommen
werden mußten (so manches Produkt scheint wie in der EDV erst durch
die Anwendung richtig getestet zu werden). Die meisten allgemeinen Werke
enthalten spezielle Kapitel zu den Psychopharmaka, Nebenwirkungen und zum
nicht unwichtigen Placeboeffekt. Eine Standwerke haben fortgesetzte und
aktualisierte Auflagen, was hier durch ein "f" angezeigt wird. Es wurden
auch ein paar kritische Werke aufgenommen.
- Adler, E. (1988). Kranke Rezepte. Sucht durch verordnete Medikamente / Betrügerische Kassenabrechnungen / Fallstudien aus der Praxis. Nördlingen: Greno.
- Barondes, Samuel H. (dt. 1995, engl. 1993). Moleküle und Psychosen. Der biologische Ansatz in der Psychiatrie. Heidelberg: Spectrum.
- Benkert, Otto (1995). Psychopharmaka. Medikamente. Wirkung. Risiken. München: Beck'sche Reihe.
- Benkert, Otto & Hippius, Hanns (1977 f). Psychiatrische Pharmakotherapie. Berlin: Springer.
 |
Wohlfeil, kurz und verständlich, z.B.: |
- Bettschart, Roland; Glaeske, Gerd; Langbein, Kurt; Saller, Reinhard & Skalnik, Christian (1995). Bittere Naturmedizin. Wirkung und Bewertung der alternativen Behandlungsmethoden, Diagnoseverfahren und Arzneimittel. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Dukes, Graham M.N. & Kimbel, Karl H. (1985 f). Arzneirisiken in der Praxis. München: Urban & Schwarzenberg.
- Elstner, Peter & Stephan, Ursula (1990, 3. A. Hrsg.). BI-Lexikon Toxikologie. Leipzig: VEB BI.
- Elsesser, Karin (1996). Verhaltenstherapeutische Unterstützung des Benzodiazepin-Entzugs. Wirksamkeit vom Symptomkrontroll- und Angstbewältigungstraining. Weinheim: Psychologie VerlagsUnion.
- Estler, C. J. (1994, Hrsg.). Pharmakologie und Toxikologie. Stuttgart: Schattauer.
- Funcke, Michael (1982). Medikamente unter der Lupe. Erklärungen der Substanzen, Wirkungen - Nebenwirkungen von Arzneimitteln. Landsberg: mvg.
- Gross, Werner (1990, Hrsg.). Psychotherapie statt Pillen. Bonn: Deutscher Psychologenverlag.
- Habermann, E. & Löffler, H. (1979). Spezielle Pharmakologie und Arzneitherapie. Heidelberg: Springer.
- Hehn, Adam; Lang, Paul-Helmut & Hansen, Eike (1980). Mögliche Nebenwirkung Tod. Zeugnis aus dem Inneren der Pharmaindustrie. "Die große Vergiftung" - Folge 2. Reinbek: Rowohlt.
- Hippius, H.; Engel, R.R. & Laakmann, G. (1986). Benzodiazepine. Rückblick und Ausblick. Berlin: Springer.
- Hoch, Rolf-Eckart & König, Benno (1999). Lexikon der rezeptpflichtigen und rezeptfreien Arzneimittel. Medikamente, Wirkstoffe, Vitamine, Mineralien, Lebensmittel-Zusatzstoffe. Eltville: Bechtermünz.
- Hoffmann, Christof & Faust, Volker (1983). Psychische Störungen durch Arzneimittel. Stuttgart: Thieme.
- Kähler, H. J. (1967). Störwirkungen von Psychopharmaka und Amalgetika. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- Kähler, H. J. (1970). Rauwolfia Alkaloide. Eine historische pharmakologische und klinische Studie unter Mitarbeit von Karl Dietmann, Alfred Popelak und Günther Steinorth. Mannheim: Boeringer.
- Langbein, Kurt; Martin, Hans-Peter & Weiss, Hans (1999). Bittere Pillen. Nutzen und Risiken der Arzneimittel. Über 3000 Medikamente, Naturheilmittel und Homöopathika seriös bewertet. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Laux, G.; Dietmaier, O. & König, W. (1997). Pharmakopsychiatrie. Stuttgart: Gustav Fischer.
- Linden, Michael & Manns, Marianne (1977). Psychopharmokologie für Psychologen. Beiträge zur klinischen Psychologie. Salzburg: Müller.
- Mutschler, Ernst (1975 f). Arzneimittelwirkungen. Ein Lehrbuch der Pharmakologie für Pharmazeuten, Chemiker und Biologen. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- Pöldinger, Walter (1971). Kompendium der Psychopharmakotherapie. Grenzach/ Baden: Hoffmann- La Roche.
- Rathscheck, Reinhold (1974). Konfliktstoff Arzneimittel. Frankfurt: Suhrkamp.
- Rote Liste Service GmbH (alljährlich). Aulendorf: Editio Cantor.
- Rudolf, Gerhard A.E. (1996). Die Therapie mit Lithiumsalzen: ein Kompendium für die Praxis. Wiesbaden: Dt. Univ. Verl.
- Schou, M. (1980). Lithium-Behandlung der manisch-depressiven Krankheit. Information für Arzt und Patienten. Stuttgart: Thieme.
- Snyder, Solomon H. (1989). Chemie der Psyche. Drogenwirkungen im Gehirn. Heidelberg: Spektrum.
- Stössel, Jürgen (1973). Psychopharmaka - die verordnete Anpassung. München: Piper.
- Wellhöner, Hans-Herbert (1990 f). Pharmakologie und Toxikologie. Berlin: Springer.
- Willek, Karin (1999). Alternative Medizin im Test. Berlin: Springer.
- Speziell zum Metyhlphenidat und Ritalin-Streit
- Die psychologisch- psychotherapeutische allgemeine und integrative Heilmittellehre
- Vergleichende Psychotherapieforschung
- Die Grundlegenden Probleme und die Aporie jeglicher Einzelfall- und damit Therapieforschung
- Bayes Theorem
Sponsel, Rudolf (DAS). «10 Gebote» für den richtigen Umgang mit Psychopharmaka. Buchhinweise, Literaturliste, Links: Arzneimittel und Psychopharmaka von Rudolf Sponsel, Erlangen. Aus unserer Abteilung Medizinische Psychosomatik, Psychopathologie und Psychiatrie. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/medppp/medik/10gebote.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erfragen. In Streitfällen gilt der Gerichtsstand Erlangen als akzeptiert.