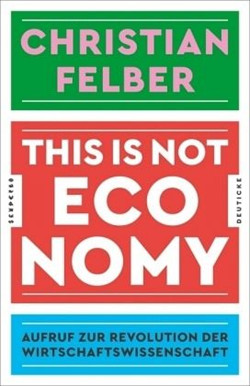Inhalt
Einleitung 7 [7 Anmerkungen]
TEIL I - PANOPTIKUM DER KRITIK [392 Anmerkungen]
1. Geschichts- und Kontextlosigkeit
13
2. Mathematisierung 25
3. Physikneid - die eingebildete Naturwissenschaft
35
4. Fetisch Modell 46
5. Gleichgewichtsmärchen
54
6. Positivismus 65
7. Wertfreiheit versus Normativität
77
8. Theoretischer Monismus 89
9. Interdisziplinaritätsresistenz
97
10. Lehrbücher oder Parteiprogramme?
105
11. Bildung von Egoisten 115
12. Hierarchisierung-Machtbildung
123
13. Königsdisziplin 130
TEIL II - RADIKALE AMNESIE [47 Anmerkungen]
Vergessen und verdrängt I - die Herkunft
139
Vergessen und verdrängt II - der Name
146
Vergessen und verdrängt III - das Ziel
155
TEIL III - POLITISCHE ÖKONOMIE [80 Anmerkungen]
1. Wirtschaftsnobelpreis?
165
2. Econocracy - die Herrschaft der Ökonomen
176
3. Lehrbuchposse 186
4. Ideologisches Glaubenssystem 194
TEIL IV - ZENTRALE GLAUBENSINHALTE [80 Anmerkungen]
1. Wachstum 199
2. Menschenbild 207
3. Wettbewerb statt Kooperation -
der zentrale Theorie- und Empirie-Fehler 216
4. Staat & Markt: das beste Ehepaar
der Welt 224
5. Eigentum 233
TEIL V - ALTERNATIVEN [39 Anmerkungen]
1. »Plural«: die Ökumene
der Ökonomik 243
2. Heilige Wirtschaftswissenschaft
255
Dank 269
Anmerkungen 271
Literatur 285
Interviews 303
Ausfuehrliche
Darlegung
Eigene Kommentare zu den Präsentationen habe ich kursiv gesetzt
und vorab mit "RS" markiert. Zwischenüberschriften von mir, werden
mit Index "RS" und sind kurs gesetzt gekennzeichnet.
0 Einleitung 7
Die Einleitung beginnt mit einem Paukenschlag Zitat von Paul Krugman
(2009): "Moderne Makroökonomie ist bestenfalls spektakulär nutzlos
und schlimmstenfalls klar schädlich." Der schroffe Gegenwind,
der von der Mainstream-Ökonomie auf die Entwicklung der Gemeinwohl-Ökonomie
erfolgte, überraschte in seiner Intensität und Totalität.
RS: Das wundert mich nicht, zeigt aber,
wie wichtig und richtig Felbers Fundamentalkritik ist. Und er ist ja, Voltaire
sei Dank, nicht einzige (z.B. Brodbeck
1998, 2. A. 2000).
0.1 Sonderbare Argumente
S. 8
Die Gemeinwohlökonomie sei keine Wissenschaft, berufe sich grundlegend
auf Ethik, sei also nicht wertfrei, was Felber als "mächtige Selbst-
und Publikumstäuschung" zurückgibt.
RS: In der Tat, es kann nicht den geringsten
Zweifel geben, dass die grundlegende Basis der Wirtschaftswissenschaft
ethischer Natur ist: Was soll, warum, wie, zu welchen Zielen und
Zwecken wirtschaftswissenschaftlich erforscht werden?Die WirtschaftswissenschaftlerIn
trifft immer Wertentscheidungen (>
Werturteilsstreit),
ob sie will oder nicht. So, wie man nicht nicht-entscheiden kann, so kann
man auch den grundlegenden Wertentscheidungen nicht entgehen. Und das muss
explizit gemacht und gesamtgesellschaftlich diskutiert werden.
0.2 Ideologie S. 8
Merkwürdigerweise gäbe es aber sogar eine breite und grundlegende
Kritik innerhalb der Wirtschaftswissenschaften selbst, S. 8f: "Die Breitband-Kritik
existiert seit vielen Jahren und in vielen Punkten sogar seit Jahrzehnten
- doch sie prallt am orthodoxen Theoriegebäude und am Wissenschaftsbetrieb
wie an der Chinesischen Mauer ab. »Neoklassische Ökonomen bewältigen
Kritik, indem sie sie ignorieren«, schreibt der Renegat-Ökonom
Steve Keen.2" Kritikresistenz und -Immunisierung seien Erkennungsmerkmale
von Ideologien.
0.3 Vertrauen im Abgrund
S. 9
Die Mainstream-Ökonomie sei unfähig gewesen, die Finanzkrise
vorherzusehen. In der Bevölkerung gäbe es wenig Vertrauen in
die Wirtschaftsexperten, laut einer FORSA-Umfage nur ein Viertel der unter
34-jährigen.
0.4 Studierendenproteste
S. 10f
Felber weist auf weltweite Gegenbewegungen hin: in Frankreich seit
2000 auf das Netzwerk "... für »postautistische Ökonomik«,
"in Großbritannien ging »Rethinking Economics« an den
Start, in Deutschland und Österreich entstanden die Netzwerke für
Plurale Ökonomik, die sich 2014 international mit anderen Initiativen
zur International Student Initiative for Plural Economics (ISIPE) zusammenschlossen.
In einem öffentlichen Brief schreiben die Nachwuchs-Ökonom*innen:
»Die
Weltwirtschaft befindet sich in einer Krise. In der Krise steckt aber auch
die Art, wie Ökonomie an den Hochschulen gelehrt wird (...) Wir beobachten
eine besorgniserregende Einseitigkeit der Lehre, die sich in den vergangenen
Jahrzehnten dramatisch verschärft hat.« Das Netzwerk fordert,
»die Ökonomie wieder in den Dienst der Gesellschaft zu stellen«.7"
TEIL I - PANOPTIKUM
DER KRITIK
1. Geschichts- und Kontextlosigkeit
13 [11 Themen]
1.1 Wirtschaftsgeschichte
15
Felber beklagt mit Recht, dass in den Standard-Ökonomiebüchern
die Wirtschaftsgeschichte weitgehend fehlt, S. 16: "Vielleicht reichen
zwanzig bis dreißig Seiten Wirtschaftsgeschichte in den Lehrbüchern
(zwei bis drei Prozent), aber ganz ohne sollte es nicht abgehen. An den
deutschen Universitäten kamen 2016 gerade einmal 0,5 Prozent Wirtschaftsgeschichte
in den Curricula vor.12"
1.2 Geschichte der Disziplin
17
Auch die Geschichte der Disziplin werde ausgeklammert.
1.3 Definition
und Ziel der Ökonomik 18
Es fehle eine Definition der Wirtschaftswissenschaft und ihrer Ziele.
1.4 Wissenschaftstheorie
19
Die Wissenschaftstheorie werde nicht offen gelegt.
1.5 Kontexte 20
Ausblendung der Umfelder Politik, Ethik, Ökologie, Gender und
Machtthemen.
1.5.1 Gender 20f
Ausblendung der genuinen Haushalte und die Rolle der Mütter.
1.5.2 Umwelt 21f
Ausblendung der Umweltprobleme, Ökosysteme, Planet Erde.
1.5.3 Ethik S. 22
Ausblendung der Grundwerte unserer Gesellschaft und Kultur. Pflege
der Illusion der Wertfreiheit, S. 22: "... Das neoklassische Standardmodell
strotzt vor Werten: Effizienz, Wachstum, Wettbewerb, Nutzenmaximierung,
Rationalität: alles Werte! ..."
1.5.4 Demokratische
Institutionen 23
Die wichtigen demokratischen Institutionen - wie Handelsregister, Grundbuch,
Finanzamt, Umweltbehörden, Emissionszertifikate-Ausgabestelle, Arbeitsinspektorat,
Finanzaufsicht, Zentralbank, Staatsanwaltschaften, Gerichtshöfe -
kämen in den ökonomischen Standardmodellen nicht vor.
Keine Anmerkungsbelege.
1.5.5 Geld- und
Finanzsystem 23
Das Geld- und Finanzsystem spiele in den ökonomischen Standardmodelle
keine Rolle, sei die längste Zeit gar nicht vorgekommen: "... »Wir
haben sehr ausdifferenzierte makroökonomische Modelle, meint das damalige
Mitglied des Sachverständigenrates Peter Bofinger, »sie haben
nur einen Nachteil: Es gibt keinen Finanzsektor. Das finde ich bemerkenswert,
insbesondere in der Europäischen Zentralbank: Auch deren kompliziertes
Modell kennt keinen Finanzsektor. ... "
1.5.6 Macht 24
Ausblendung der Machtverhältnisse und Ungleichgewichte.
2. Mathematisierung
25 [6 Themen]
2.1 Neufaust 25
| NEUFAUST
Habe nun, ach o weh, fünf Jahre lang
Mathematik, Statistik und Wirtschaft studiert
habe dabei Herz und Seele riskiert
habe selbst meinen Geist brüskiert
bin zwar in Ziffern und Zahlen belesen
doch fremd blieb mir der Materie Wesen
Das hat zu dem knappen Ergebnis geführt:
ich bin als Spezialist arriviert
bin also nach strengster Regel Gebot
ein ausgebildeter Fachidiot.
Original-Quelle: Felber (1999)
Von Fischen und Pfeilen, S. 94. |
Die Lehrbücher sind voller Formeln,
Gleichungen, Diagramme, S. 25: "... Das »Herz« der neoklassischen
Wirtschaftswissenschaft ist ein Formelfriedhof. ..."
Gegen Mathematik in der Wissenschaft gibt es zwar
grundsätzlich nichts einzuwenden, aber die Ausschließlichkeit
und absolute Dominanz der auch noch fragwürdigen mathematischen Verfahren
wirft viele Fragen auf, die nicht einmal gestellt und erst recht
nicht beantwortet werden.
|
2.2 Historische Erklärung
26
Das Streben jeder Wissenschaft ist Exaktheit und Wahrheit. Beides fand
man in Mathematik und in den Naturwissenschaften, vor allem in der Physik.
Mathematisierung verheißt Wissenschaftlichkeit: S. 26: "... Claus
Peter Ortlieb bestätigt: »Die bloße Verwendung von Mathematik
wird als ein Garant für Wissenschaftlichkeit und >Ideologiefreiheit<
genommen.«35"
2.3 Prinzipielle Kritik
29
Das wissenschaftliche Ideal der Mathematik sei Objektivität. Mankiw
meine, auch Volkswirte bemühten sich um naturwissenschaftliche Objektivität,
versuchten, Physik und Biologie nachzuahmen. Felber behauptet und bezieht
sich dabei auf Silja Graupe (2017a, 12), S. 29: "... Wissenschaftstheoretiker*innen
zufolge geht es in der wissenschaftlichen Objektivität nicht darum,
die Dinge zu sehen, wie sie (wirklich) sind, sondern um ein Erkennen logischer
Zusammenhänge jenseits von subjektiver Wahrnehmung und Erfahrung.49
Diese Definition ist wichtig, weil wissenschaftliche Objektivität
in einem grundlegenden Gegensatz zu Empirie und Realität steht. Das
mag bei vielen auf Unverständnis stoßen, doch wie Silja Graupe
schön herausgearbeitet hat, ist »im Erkennen eine größtmögliche
Distanz zu jeglicher Form der menschlichen Erfahrung aufzubauen«
ausdrückliches Ziel objektiver Wissenschaft und somit eine »epistemische
Tugend«.50 ..."
RS: Felber spricht hier von "Wissenschaftstheoretiker*innen",
er belegt aber nicht welche damit genau gemeint sind und macht damit genau
den Fehler, den er den Standardökonomen vorwirft: einseitige Betrachtungsweise
und Ausblendung anderer Lehren. Natürlich ist Objektivität
ein Kriterium jeder Wissenschaft mit Ausnahme der dialektischen Materialisten,
die in ihren Dialektikpostulaten sogar ausdrücklich die Parteilichkeit
der Wissenschaft fordern (Esser
1977,
225). In der angegebenen Zitierstelle
bei Graupe 2017a, 12, findet sich auch die Behauptung oder Interpretation
Felbers nicht "... jenseits von subjektiver Wahrnehmung und Erfahrung.49
Diese Definition ist wichtig, weil wissenschaftliche Objektivität
in einem grundlegenden Gegensatz zu Empirie und Realität steht." Auch
diese Behauptung ist nicht belegt und nach meinen Wissenschaftstheoriekenntnissen
auch falsch. Zwar ist richtig, dass die ForscherInnen und ihr Forschen
im gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Bereich selber einen mehr
oder minder großen Einfluss auf die Forschungsergebnisse ausüben,
das heißt aber natürlich nicht, dass es keine Objektivität
mehr gibt (> Werturteile
in den Wissenschaften).
2.4 Schein und Entschwinden
31ff
Die Realität, die nach Felber grundsätzlich nicht objektiv
erforschbar ist, verschwindet in mathematischer Verkleidung. Die Sprache
der Wirtschaftswissenschaft sei unverständlich.
2.5 Methodische Kritik
33
Der wahre Wert der Mathematik für die Wirtschaftswissenschaft
werde breit angezweifelt (Colander, Lawson, Komlos, sogar Walras)
2.6 Finale 34
Selbst Krugmann - neben anderen - äußert sich in der New
York Times kritisch-skeptisch, S. 34: "... »Die ökonomische
Disziplin hat sich verrannt, da Ökonomen im Kollektiv die Schönheit
und die Präzision eindrucksvoller Mathematik mit der Wahrheit verwechselt
haben.«60 ..."
3. Physikneid - die eingebildete
Naturwissenschaft 35 [6 Themen]
3.1 Sozialphysik 36ff
Neid
auf die Physik und ihre wissenschaftlichen Erfolge machten die Ökonomen
glauben, wenn sie nur die Methoden der Physik nachahmten, würden
sie zu ebenso guten und harten wissenschaftlichen Ergebnissen gelangen.
Dahinter muss kein "Minderwertigkeitskomplex" stehen. Die These Felbers,
S. 37: "Eine Eigenschaft von Naturgesetzen ist, dass sie nicht dauerhaft
feststehen. ..." ist ein Druckfehler
und das "nicht" gehört herausgenommen.
3.2 Geschichte 38f
Mechanik und Thermodynamik seien hier die - unangemessenen - Vorbilder.
3.3 Etikettenschwindel 39f
Felber wiederholt seine These, dass die Ökonomie eine Sozialwissenschaft
sei und sich daher "prinzipiell nicht für die »Erklärung«
mit mathematischen Modellen" eigne. Ökonomische Grundkategorien wie
Geld, Eigentum, Märkte, Börse und Unternehmen seien keine Kreationen
der Natur, sondern Erfindungen der Kultur.
3.4 Ökologie spielt keine Rolle 40ff
Der Titel erklärt sich selbst.
3.5 Drei Stabilisierungen 42ff
Hier stellt Felber die Thesen Freier Markt und negative Rückkoppelung
als Krisenmanagementregulatorien in Frage und macht auf einige Ungereimtheiten
aufmerksam, z.B. dass die Ungleichgewichte in der Vermögensverteilung
steigen. Sodann berichtet er Alternativen: Progressive Besteuerung, Obergrenzen
für Einkommen und Vermögen, Ausgleich der Handels- und Leistungsbilanzen,
strenge Regulierung der Finanzmärkte und Gemeinwohlevaluierung bei
den Krediten, Begrenzung der Größe von Banken, Derivateverbot
und Vollgeldsystem. Kritikimmunisierung und immerwährend Exhaustion
("Ausreden").
3.6 Doppelparadox: "Auf einem toten Planeten gibt es keine Arbeitsplätze"
45
Einerseits Ausblendung, dass Gesellschaft nicht mit Natur gleichzusetzen
sei, andererseits Ausblendung der Kosten der Ressourcenplünderung
der Natur ohne Sinn und Verstand.
4. Fetisch Modell 46 [6
Themen]
Felber kritisiert die Hauptmethode, Modelle zu bilden, die allesamt
vom Himmel zu fallen scheinen. Keine Geschichte, keine Kontexte, keine
Ziele, keine Definitionen.
4.1 Was sind Modelle? 47f
Es bleibt offen bleibt, was Modelle eigentlich genau sein sollen, wie
sie zu begründen, zu evaluieren, zu entwickeln, zu falsifizieren oder
zu bestätigen sind.
4.2 Prognosefunktion 48f
Hier stellt Felber zunächst fest, dass die etablierten Ökonomen
unfähig waren, die große Finanzkrise 2007ff
vorherzusagen. (S. 49 "totales kollektives Modellversagen."). Hingegen
sei 12 heterodoxen Ökonom*innen eine Krisenprognose gelungen, wie
Tabelle 1, S. 49, übersichtlich zusammen fasst:

4.3 Verteidigung der Modelle 50f
Diese Verteidigung zeigt erhebliche blinde Flecke, Verantwortungslosigkeit
und Lernresistenz (S. 51 "Meinungskartell").
4.4 Hoffnungslos unterkomplex 51
Klimawandel und Artenschutz ignoriert und nicht vorhergesagt.
4.5 Verbesserung der Modelle? 52
Hier sollte nach Felber eine möglichst vollständige Abbildung
der Realität angestrebt werden.
4.6 Was spricht für die Modelle? 52f
Nichts.
5. Gleichgewichtsmärchen
54ff [5 Themen]
Leitzitat von Maurice Allais (1988, S. 43): "Eine Theorie, die nicht
durch empirische Belege verifiziert ist, hat keinen wissenschaftlichen
Wert."
Zu Recht grundlegend kritisiert Felber Walras' "anthropomorphes
Wunderwesen" namens "Auktionator"Taut.
Das
Streben des MarktesTaut
nach Gleichgewicht, als handele der Markt, zeigt ebenfalls eine hochgradig
unwissenschaftliche und metaphysische Grundeinstellung bei vielen Ökonomen.
Und hier darf natürlich die "unsichtbare Hand"Taut
Adam Smith' nicht fehlen.
5.1 Schwellenkonzept 56ff
Ökonomen seien so sehr in ihren Modellbildungen (Marktwirtschaft,
Gleichgewicht, Freier Wettbewerb, Effizienz, Selbstregulation der Märkte
als Optimum) verfangen, dass sie gar nicht merken, dass die komplexe Realität
eine ganz andere ist - mit Kontexten, die ignoriert werden, obwohl sie
wesentlich sind.
RS: Die Zwischenüberschrift "Schwellenkonzept"
wird nicht erklärt.
5.2 Anti-Realismus 58
Die Grundannahmen der Ökonomen seien unrealistisch und in ihrer
einfältigen Einseitigkeit auch unbegreiflich: S. 58f
-
Immer bewusste Präferenzabwägungen.
-
Immer rationales Handeln.
-
Eigennutzorientierung.
-
Unbegrenztheit der menschlichen Bedürfnisse.
-
Mehr sei immer besser.
-
Alle Handelnden gleich.
-
Keine Hierarchien.
-
Perfekte Information aller.
-
Preise enthalten alle relevanten Informationen.
-
Vollkommener Wettbewerb in Märkten.
-
Annahmen von Systemakteuren.
-
Angebot und Nachfrage bei Ausgleich ergäben den Gleichgewichtspreis.
-
Alle Märkte kämen gleichzeitig zum Ruhepunkt.
-
Handel zu Preisen im Ungleichgewicht (false trading) ausgeschlossen.
-
Märkte regulierten sich am besten selbst.
-
Kein Machtgefälle, Märkte seien verteilungsneutral.
-
Mit steigendem BIP nehme die Ungleichheit und die Umweltbelastung ab.
-
Unsicherheit existiere nicht.
-
Finanz-, Human- und Naturkapital seien jederzeit ersetzbar.
-
Als gäbe es keine rechtsstaatlichen Institutionen.
-
Als gäbe es keine Zeit und Geschichte.
-
Als gäbe es kein Geld- und Finanzsystem.
-
Als gäbe es keine Hausarbeit, Fürsorge-Arbeit oder Gender-Themen.
-
Als gäbe es keine Natur.
Diese Annahmen würden vielfach gar nicht mehr als Annahmen
erkannt, sondern quasi unbewusst (Capra) für die Realität gehalten.
5.3 Dekonstruktion
60f
"Alle Elemente des Märchens" (obige 24 Punkte) seien
unter Berufung auf die Arbeiten von Steve Keen (Australien) und Walter
Ötsch (Österreich) widerlegt.
5.4 Endlose Kritik 62f
Der Zwischen-Titel erklärt sich selbst. Zitiert werden: Ariel
Rubinstein (unrealistisch); Hermann Bruns ("mathematische Sonderwelt");
Koblitz & Rieter (imaginäre Gedankenkunstwelt); Wassily Leontief
(vollkommen willkürliche Annahmen); Paul Romer (post-reale Modelle);
Robert Clover ("walrasianische Theorie" ... "reine Science Fiction").
5.5 Falsifizierungen ignoriert 63f
Auch hier erklärt sich der Zwischentitel selbst. Die Neoklassik
werde einen organischen Tod sterben und dann nur noch eine kuriose Episode
der Wirtschaftswissenschaftsgeschichte sein.
6. Positivismus 65 [12 Themen]
6.1RS Beschreibt nicht die Realität, was aber
wichtig wäre 65
RS: Felbers Kritik der Realitätsferne ist zwar richtig,
beschreibt aber gerade keine positivistische HaltungKpism.
6.2RS Positivistische Ökonomen glauben an unverrückbare
Wahrheiten wie Naturgesetze 66
Dieses Verständnis, wie es sich im Standardwerk von Samuelson
und Nordhaus darstellt ( »Das Verständnis der dauerhaften
Wahrheiten, welche die Ökonomie bereithält, ist für das
Leben des Einzelnen und ganzer Nationen wichtiger denn je (...) Wir haben
daher beschlossen, uns auf die Kernthesen der Volkswirtschaftslehre zu
konzentrieren - auf jene dauerhaften Wahrheiten, die im neuen Jahrhundert
dieselbe Bedeutung haben werden wie im alten.«160
6.3RS Wertfreie Wissenschaft existiere nicht165
67
Der Zwischentitel erklärt sich selbst. Dazu passt das Eingangszitat
zum 6. Kapitel von Brodbeck: "Der Buddhismus lehnt eine Trennung von Fakten
und Werten ab". Felber beruft sich auf Putnam und Walsh, dass die Trennung
von Fakten und Werten in Trümmern läge.
RS: Das stimmt so nicht ganz. Die Definition
von "arm" ist kein Werturteil, allenfalls die Grenzziehung, wo sie beginnt
und natürlich auch die Entscheidung, Armut und ihre Gründe zu
erforschen und erst Recht etwa das Ziel, Armut zu minimieren. Querverweis:
Werturteilsstreit.
6.4RS Acht Gründe gegen den Positivismus: Fakten
und Werte ineinander verschlungen 68
-
In den Sozialwissenschaften gäbe es keine gesicherten Wahrheiten.
68
-
Es gäbe keine wertfreien Fragestellungen. 69
-
Wissenschaftliche Paradigmen sorgten für Ausblendung, Ausgrenzung,
Ächtung und Sanktionierung wichtiger Fragen und Themen. 70
-
Akzeptanz oder Verwerfung von Hypothesen seien Werturteile. 71
-
Das persönliche Wertesystem beeinflusse die Forschung und müsse
daher offen gelegt werden. 72
-
Die Subjektivität der Wissenschaftler*in beeinflusse die Interpretation
der Fakten. (man findet, was man finden möchte). 72
-
Unsichere Kausalitäten, viele Annahmen oder Prognosen falsch, z.B.
habe Mexiko 10 Jahre nach NAFTA 1,8% Wachstum verloren. 1960-1980 sei in
116 Staaten das Pro-Kopf Wachstum um 3.1% gestiegen, zwischen 1981 und
2000, in der Zeit der großen Globalisierung nur noch um 1.4%.
Felber S. 74: "Das formuliert auch ein Bericht der Weltkommission für
die soziale Dimension der Globalisierung im Auftrag der ILO: »Dieses
Ergebnis entspricht zumindest nicht den optimistischeren Vorhersagen in
Bezug auf die wachstumsfördernde Wirkung der Globalisierung.«190".
Die Fehlannahmen werden durch weitere Beispiele von Felber belegt. 74
-
Nichtakzeptanz von Falsifikation. 75f
Felber resümiert: Das seien 8 Gründe, die gegen den "Positivismus"
als wissenschaftliche Grundlage sprächen.
RS: Dieser Abschnitt ist insofern problematisch,
als die Fehler der neoklassischen Ökonomen ihrem vermeintlichen PositivismusKpism
zugeschrieben werden. Tatsächlich fehlt den neoklassischen Ökonomen
gerade eine positivistische GrundhaltungKpism
, nämlich wissenschaftliche Aussagen auf nachprüfbare
Befunde zu gründen. Im Grunde eine selbstverständliche wissenschaftliche
Einstellung und Haltung, in der Beobachtung, Daten, Experimente und Kontrolle
eine zentrale Rolle spielen.
7. Wertfreiheit versus Normativität
77 [7 Themen]
Das Kapitel beginnt furios mit einem machtvollen Eingangszitat von John
Maynard Keynes: "Economics is essentially a moral science."195 Damit
erklärt sich das Kapitel im Kern von selbst. Felber geht zunächst
auf die Geschichte der Problematik ein (Werturteilsstreit)
und zitiert Smith, Weber, Robbins, Keynes im Lichte Milton Friedmans (dessen
Keynes Zitat im Widerspruch zum Eingangszitat steht, was nicht aufgeklärt
wird), Komlos, (S. 78) Peukert und Capra, die letzten drei Belege für
die Wertgebundenheit der Ökonomie.
7.1 Wertesystem der Neoklassik 78
Sich um keine anderen ökonomischen Schulen zu kümmern sei
die erste normative Wertentscheidung der Neoklassiker. Weitere die Abkoppelung
von der Geschichte und der Realität. Man trifft, auch in der Wissenschaft,
quasi immer Entscheidungen, ob man will oder nicht, und so auch die Neoklassiker,
was sie aber nicht wahrhaben wollen und ausblenden. Ihre Wertentscheidungen
werden nicht kommuniziert und diskutiert, sondern durch Handeln, Machen
und Tun sozusagen konkludent, wie die JuristInnen zu sagen pflegen, hergestellt
und ausgedrückt.
| S. 79: "Die vielleicht größtmögliche
aller Wertentscheidungen ist jene, dass Ethik in der Wirtschaftswissenschaft
keine Rolle spielen soll." |
RS: Die Wertblindheit neoklassischer ökonomischer
"Wissenschaft" durchzieht das ganze Buch wie ein roter Faden. Im Kern zwar
richtig, wenn er auch ein wenig das Kind mit dem Badewasser ausschüttet.
Das komplizierte Geflecht zwischen Wert und Wertfreiheit wird von Felber
nicht aufgedröselt. (>Werturteile
in den Wissenschaften, Wert-Fakten-Analyse)
Wenn z.B. der Umsatz einer Branche festzustellen ist, oder die Anzahl derer,
die Mindestlohn erhalten, dann liegt ein Werturteil darin, die Ermittlung
für würdig zu erachten, aber nicht darin, wie die Feststellung
erfolgt. Eine wissenschaftliche Wertung geht dann aber wieder in die Ergebnisbeurteilung
ein. Die Ergebnisfeststellungen sollen objektiv (andere Untersucher gelangen
zum gleichen Ergebnis), reliabel (Festellungen genau genug) und valide
(es wird festgestellt, was festgestellt werden soll, also Umsatz oder Anzahl
und nicht Auftragseingänge oder die Anzahl der Niedriglöhner)
sein. (>Beobachtungsvaribale).
7.2 Wertesystem des Kapitalismus 79
Felber arbeitet fünf Kernwerte heraus:
-
Eigennutzenmaximierung
-
Streben nach finanziellem Erfolg
-
Wettbewerb
-
Konsum
-
grenzenloses Wachstum
_
| S. 80: "Vielleicht steht die Neoklassik auch deshalb
nicht offen zu ihrem Wertesystem, weil kapitalistisch-materialistische
Werte im Konflikt zu zeitlosen Grundwerten stehen, die menschliche Beziehungen
und Gemeinschaften gelingen lassen.208" |
7.3 Dichotomie Markt-Staat 81
Felber hält der Neoklassik hier ihren "nächsten Trick" vor,
nämlich die Aufteilung der Wertfreiheit, der "freie" Markt, zugeordnet
der Ökonomie und der normativen Wertungen, zugeordnet dem Staat. Felber
brandmarkt diesen Taschenspielertrick als hochgradig ideologisch und manipulativ.
Und Felber geißelt die Polemik, mit der Neoklassiker die Interventionen
des Staates ablehnt, wovon man allerdings bei den Freihandelsabkommen nichts
merkt. Gäbe es den Staat nicht, würde das nackte Faustrecht gelten
und allerschlimmste Zustände herrschen. Thatcher und Reagan seien
die Verkünder der verderblichen und falschen Botschaft gewesen, "Hayek,
Friedman und von Mises ihre Generatoren".
7.4 Märkte nicht verstanden 83
Die Verkehrung des Vorwurfs, man verstünde die Märkte nicht,
ist geradezu grotesk. Die konfus-irrationale Idee, dass es gut sei, die
Märkte am besten sich selbst zu überlassen, ist naturlich ein
grundsätzliches Werturteil, weil hier immer gefragt werden muss: für
wen
und was am besten?
7.5 Wertfreie versus normative Aussagen 84
Hier setzt Felber die Kritik - vorangehend Gabriel Felbermeyer - des
neoklassichen Establishment an seinem Ansatz fort und setzt sich mit René
Schmidpeter (Cologne Business School), der das Grundproblem wie die meisten
KollegenInnen nicht begriffen hat: ja, es geht grundlegend um Werte, die
aller Ökonomie zugrundeliegen. Das ist kein Spezifikum von Felber,
er ist nur transparent und realistisch.
7.6 Die Medien spielen mit 85
Die Zwischenüberschrift erklärt sich selbst.
RS: Tatsächlich kommt den Medien eine große
Mitschuld am Zustand der Weltwirtschaft und dem Zustand dieser Erde zu.
Das liegt wesentlich daran, dass die Medien privat-kapitalistische Unternehmen
sind (>Medienkritik, Oligarchie),
die in dieser Form abzuschaffen sind, wenn eine humane und gerechte Welt
durch echte, transparente und verantwortliche Wissenschaft gefördert
werden soll.
7.7 Beispiel Luks: keine Theorie 86
Hier setzt sich Felber mit einem weiteren seiner Kritiker, Fred Luks
in Wien, auseinander. "So wenig Felber die Gemeinwohlökonomie erfunden
hat, so wenig hat er eine Wirtschaftstheorie ..."
| S. 86f "... die Gemeinwohl-Ökonomie hat
nicht den Anspruch, ökonomische Wahrheiten oder Gesetze zu entdecken,
weil sie dieses Theorieverständnis nicht teilt. Sie ist auch keine
»konstruktivistische« Theorie, die als idealistische Vorstellung
geboren wird, sich jedoch nicht an der Realität bewähren muss.
Die Bewährung an der Realität ist unser ausdrücklicher Anspruch:
Nur wenn Unternehmen, Gemeinden, Städte, Landkreise und Bildungseinrichtungen
von der Schule bis zur Universität die Gemeinwohl-Ökonomie »annehmen«,
indem sie sie lehren, beforschen, weiterentwickeln und - vor allem - anwenden,
ist sie eine - pragmatistische - Theorie. So wie die Fürsorge-Ökonomie,
die Soziale und Solidarische Ökonomie, die Commons, der Faire Handel
oder Ethische Banken. Sie alle existieren. Mehr als fünfhundert
Organi-[>87] sationen haben bereits eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt, Universitäten
haben sie in das Lehrprogramm aufgenommen, es gibt einen Lehrgang Angewandte
Gemeinwohl-Ökonomie«, einen Lehrstuhl Gemeinwohlökonomie
an der Universität Valencia, und kurz nach Erscheinen dieses Buches
findet an der FH Bremen die erste zweitägige wissenschaftliche Konferenz
zur Gemeinwohl-Ökonomie statt. Sie ist somit praktizierte Realität
und in dieser Form - ganz positiv - nachweisbar. ..." |
8. Theoretischer Monismus
89 [6 Themen]
Hier prangert Felber die Einheitslehre in der mainstream-Ökonomie
an.
8.1 Nur eine Schule 89
wird unterrichtet.
8.2 Gründe für die Einheitslehre 90
Die Gründe erfährt man im nächsten Abschnitt 8.3.
8.3 Kanonisierung der Lehre 91
drückt gesellschaftliche Machtverhältnisse aus.
RS: Es fehlt der schon erörterte "Physikneid"
(Teil I 3.).
8.4 Auswirkungen 92
Extreme Einseitigkeit, Realitätsferne, Unzufriedenheit der Studierenden,
Unangemessenheit der ganzen Lehre.
8.5 Positivismus führt zu Monismus 94
Falsches Selbstverständnis als Naturwissenschaft (exakt, messbar,
wissenschaftlich, objektiv, Wahrheit).
RS: Fragliche Titelthese. Wenn einheitlich wissenschaftliche
Methoden angewandt würden, wäre solch ein Monismus zu begrüßen.
8.6 Vergleichs-Tabelle 2 96
Es werden nach 5 Kriterien (Ziel, Wissenschaftstheorie, Analysebrille,
Erkenntnisziel, Metaphorik) die neoklassische Orthodoxie (naturwissenschaftliche
Orientierung) mit 25 heterodoxen Schulen (sozialwissenschaftliche
Orientierung) verglichen.
9. Interdisziplinaritätsresistenz
97 [17 Themen]
Die Kapitelüberschrift erklärt sich selbst. Systematische
Unterdrückung von Forschungsergebnissen aus anderen Diszilinen
9.1 Verhaltensökonomik 98
Zur Verteidigung und Abweisung der Einseitigkeitsthese wird von mainstream-Ökonomen
auf die Verhaltensökonomik und auf Kahnemann verwiesen.
9.2 Kahnemann 98
Menschen handeln überwiegend nicht rational (Reichsbankpreis für
die Widerlegung des homo oeconomicus). So betrachtet ist die Berufung auf
Kahnemann durch die mainstream-Ökonomen unverständlich. Wenn
die "Behaviorial Economics" 1-2 Kapitel in den hinteren Rängen der
Lehrbücher "dazu geklebt" erhalten, dann ist das nicht mehr als nur
"Alibi".
9.3 Rational-Choice-Theory problematisch 98
"Behaviorial Economics" noch zu sehr im Rahmen der Rational-Choice-Theory
gesehen.
9.4 Beispiele: Missachtete Einsichten ganzheitlicher Wirtschaftswissenschaft
99
9.4.1 Neue Wissenschaftstheorie erforderlich 99
9.4.2 Menschenbild des homo oeconomicus überwunden 99
9.4.3 Eigennutzmaximierung im Widerspruch zu grundlegenden Werten 99
9.4.4 Wahn immerwährendes Wachstum 100
9.4.5 Kern-Ideologem der Neo-Klassik 100
9.4.6 Die Natur kennt kein unendliches Wachstum 100
9.4.7 Systemtheorie: Das Ganze ist mehr als Summe seiner Teile 101
9.4.8 Systemtheorie: Falscher Verzicht auf negative Rückkoppelungen
101
9.4.9 Missachtung der Kooperation 102
9.4.10 Falsches Gerechtigkeitsverständnis durch die Pareto-Effizienz
102
9.4.11 Ganzheitliche Betrachtung erforderlich (Capra) 103
9.4.12 Abschottung gegen interdisziplinäre Befruchtung 103
9.4.13 Mehr Integration statt Spezialisierung nötig 104
10. Lehrbücher oder Parteiprogramme?
105 [29 Themen]
Eingangszitat von Uwe Schneidewind: "Die gesamte ökonomische
Ausbildung ist eine Bankrotterklärung für das,
was gesellschaftlich gebraucht wird."273
10.1 Standardisierte ökonomische Bildung 105
Die Zwischenüberschrift erklärt sich selbst.
10.2 Nötigender Lehrbuchmarkt 106
Ein Riesenschäft für die Marktführer (Vormals Samuelson,
dann Mankiw, Chefberater von Bush; Varian Chefökonom bei Google; Pindyk
& Rubinfeld), weil von den Studenten erwartet wird, die neuesten Auflagen
zu erwerben.
10.3 Kritik an den Lehrbüchern aufbauend auf Peukert 2018 a, b
und erweiternd 107
10.3.1 Radikale Kontextlosigkeit 107
10.3.2 Keine klare wissenschaftliche Einbettung 107
10.3.3 Falsche Ausgabe als Naturwissenschaft 107
10.3.4 Unklare Definitionen und Ziele 107
10.3.5 Nur die neoklassische Schule dargestellt, keine anderen
108
10.3.6 Kritik unterschlagen oder nicht transparent und fair wiedergegeben
108
10.3.7 Wissen als final dargestellt, als dauerhafte Wahrheit
Quasi-Naturgesetze 108
10.3.8 Mathematische Methoden Monokultur 108
10.3.9 Realitätsferne Aussagen ohne empirische Belege 108f
10.3.10 Studierende von der Wirtschaftsrealität ferngehalten
109
10.3.11 Mächtige, fachfremde Metaphorik nicht realistisch erklärt
109
10.3.12 Quasireligiöse Schlüsselmetaphern wie unsichtbare
Hand (Smith), Auktionatur (Walras) 109
10.3.13 Wenig Raum für kritische Reflexion 109f
10.3.14 Antiaufklärung 110
10.3.15 Indoktrinierung 110
10.3.16 Manipulation 110f
10.3.17 Beschämung ethischer Gefühle 111
10.3.18 Marktprozesse erfolgen im institutionellen Vakuum 111
10.3.19 Partei für den Markt gegen den Staat 111
10.3.20 Lehrbücher enthalten mehrere Demokratie-Unmöglichkeitstheoreme
111f
10.3.21 System-Legitimation 112
10.3.22 Aktuelle Wirtschaftspolitik oft als alternativlos dargestellt
112
10.3.23 Finanzmarktkrise an den Lehrbüchern spurlos vorübergegangen
112
10.3.24 Aktuelle ökologische oder soziale Fragestellungen
ignoriert 113
10.3.25 Falsche Lehren wie z.B. Geldschöpfungsmultiplikator
oder Geldschöpfung durch die Zentralbanken nicht korrigiert 113
10.4 Schlussfolgerungen 113f
10.4.1 Fünf fachdidaktische Prinzipien nicht erfüllt
113
1. Multiperspektivität, 2. Kontroversität, 3. Wissenschaftsorientierung,
4. Handlungs- und Lernenden-Orientierung, 5. Aktualitätsbezug. Anhand
der bisherigen Analysen werde klar, führende wirtschaftswissenschaftliche
Lehrbücher genügten den Kriterien nicht.
10.4.2 Peukerts Fazit 113f
"»Die die Lehrbücher durchziehenden Manipulationsstrategien
widersprechen den ethischen Grundsätzen der Wissenschaft. Die Lehrbücher
verdienen insgesamt die Note ungenügend.«316"
11. Bildung von Egoisten 115
[16 Themen]
11.1 Unrealistisches Menschenbild 115
Die Zwischenüberschrift erklärt sich selbst.
11.2 Falsches und schädliches Menschenbild der neoklassischen Ökonomie
115
Eigennutzmaximierung, Materialismus, Konkurrenz untergrabe Gemeinschaften
und Beziehungen, hieve Egositen und Psychopathen in Führungspositionen.
11.3 Margaret Thatchers Leugnung der Gesellschaft 116
»So etwas wie eine Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt individuelle
Männer und Frauen und Familien (...) [aber] so etwas wie eine Gesellschaft
gibt es nicht.«325 Unter Thatcher und Reagan habe sich die Realität
an die neoklassischen Fiktionen angeglichen.
RS: "Gesellschaft" kann man nicht anfassen oder
sehen. Sie ist daher eine Konstruktion des menschliches Geistes, ein theoretischer
Begriff, aber daraus kann und darf man natürlich nicht den Schluss
ziehen, dass es keine "Gesellschaft" gibt.
11.4 Verwechslung von Modell und Realität 116
Das resultiere aus der Gewöhnung mit dem ständigen Hantieren
und Leben in und mit Modellen. Zur Stützung wird Karl Marx berufen:
"Das Sein bestimmt das Bewußtsein"326.
11.5 Erste Beispiele 117
11.5.1 Experiment Privates/Öffentliches Konto (Marwell & Ames
1981) 117
Ökonomen schnitten drastisch schlechter (20%) ab als der
Durchschnitt (49%).
11.5.2 Ultimatum-Spiel (1982/1991) 117
Die Teilnehmer verhalten sich fairer und vernünftiger als die
Eigenutzmaximierungsannahme vorhersagt, sie ist also widerlegt.
11.5.3 Spenden-Experiment 118
Auch hier schnitten die Ökonomen am schlechtesten ab (höchste
Egoismusrate).
Neuere Beispiele
11.5.4 Diktator-Spiel 118
Hier schnitten die Ökonomen schlechter ab als die anderen TeilnehmerInnen.
11.5.5 Gier Wirtschaftswissenschaftsstudent*innen 119
ÖkonomiestudentInnen beschreiben sich gieriger, bewerten dies
positiver und interessieren sich wenig für die Auswirkungen auf die
Gesellschaft.
11.5.6 Einfluss der Vorgaben auf die Gierbewertung bei Nichtökonomen
119
Vorgaben mit positiver oder negativer Bewertung beinflussen die danach
erfragte Einstellung, was die Formbarkeit zum Thema Gier belegt.
11.5.7 Korrumpierbarkeit 119
ÖkonomiestudentInnen zeigten sich in diesem Experiment signifikant
korrupter.
11.5.8 Kooperation 120
In einer Variante des Gefangenendilemmas kooperierten ÖkonomiestudentInnen
nicht zu 60,4% gegenüber NichtökonomInnen mit 38,8%.
11.6 Schlussfolgerungen: Das Studium der Wirtschaftswissenschaft muss
neu eingerichtet werden 121
11.6.1 Thesen von Precht und Grant 121
Precht: " »Strenges und hartes Nutzenkalkül, Rücksichtslosigkeit
und Gier sind nicht die Haupttriebkräfte des Menschen, sondern das
Ergebnis einer gezielten Züchtung."
11.6.3 Demokratischer Kanon steht über der Freiheit der Wissenschaft
121f
"Die Freiheit der universitären Forschung und Lehre ist wichtig,
aber ist selbst nicht unbegrenzt, sie dient dem demokratischen Wertekanon,
der über der Freiheit der Wissenschaft steht."
12. Hierarchisierung-Machtbildung
123 [7 Themen]
12.1 Selbstverstärkende Rückkoppelungen im neoklassischen
Wirtschaftssystem 123
Die Zwischenüberschrift erklärt sich selbst.
12.2 Gender-Imbalance 123f
Wissen und Universitäten seien männerdominiert (ordentliche
Professuren: Deutschland, Österreich, USA ca. 87%, Schweiz 93%).
12.3 Mathematik als Mittel der Hierarchie 124
Die Zwischenüberschrift erklärt sich selbst.
12.4 Journals reproduzieren Mainstream 125
Die Zwischenüberschrift erklärt sich selbst.
12.5 »A Journalism« 126
Zeitschriften der ersten Liga (»A Journalism«)
seien entscheidend für die Reputation.
12.6 Berufungssystem 127
Sie hängen weitgehend von Veröffentlichungen in Top Zzeitschriften
(»A Journalism«) ab, was nur funktioniert, wenn
man die Regeln des mainstreams einhält.
12.7 Gremien und Jurys 128f
Diese seien streng systemerhaltend organisiert.
RS: Das ist ein ziemlich perfekt organisiertes
elitäres Inzuchtsystem, wehalb ja auch wenig bis nichts dabei herauskommt.
13. Königsdisziplin
130 [8 Themen]
13.1 Kuhns kritische Beobachtung 130
Kuhn fiel auf, dass die Ökonomen vergleichsweise wenig die Frage
der Wissenschaftlichkeit diskutieren. An Selbstbewusstsein bzw. Hybris
mangele es ihnen nicht.
13.2 Martin Leschkes Beobachtung 130
»Die mathematischen und ökonometrischen Methoden sowie die
Orientierung am Homo oeconomicus-Modell machten die Ökonomik
zur »Königsdisziplin« unter den Sozialwissenschaften.«375
Offenbar ganz nach dem Vorbild der »Königsdisziplin« aller
Wissenschaften, der Physik."
13.3 Ökonomen werden öfter zitiert 131
Die Zwischenüberschrift erklärt sich selbst.
13.4 Ökonomen werden besser bezahlt 131
Abgänger erhalten die zweithöchsten Eingangsgehälter
(nach Medizin).
13.5 Ökonomen sind gefragtere Berater*innen 132
Vor allem von der Politik.
13.6 Hybris der Neoklassik-Kaste 133
Sie und Arroganz zeigten sich allerorts, z.B. bei Samuelson, Pindyk/Rubinfeld,
Hayek, Eichenberger, Bachmann, Hamburger Apell (2005), Eine Besonderheit
der Ökonomen sei auch ihre Gepflogenheit, sich über Nicht-Ökonomen
zu erheben und zu belustigen.
RS: Wahrscheinlich leidet eine große Zahl
an Verhältnisblödsinn
- zum Schaden aller außer ihnen.
13.7 Kritikresistenz 135
Die Zwischenüberschrift erklärt sich selbst und unterstreicht
den oben attestierten Verhältnisblödsinn.
13.8 Psychogramm der Wirtschaftswissenschaft 136
In der Zusammenschau ergeben sich ein "fortgeschrittener pathologischer
Narzissmus". Das Krankheitsbild beginne mit mangelnder Selbstkenntnis,
der schwachen oder fehlenden wissenschaftstheoretischen Grundlage und Epistemologie
einschließlich der akuten Geschichtsvergessenheit. Daraus resultiere
ein schwaches Selbstwertgefühl. Daher versuche man eine mathematische
Naturwissenschaft zu sein, um sich mit deren Federn zu schmücken,
was in der Erschleichung des Reichsbankpreises ("Nobelpreises") zum Ausdruck
komme. Man dünke sich als etwas Besseres ("Königsdisziplin")
besonders gegenüber den Sozialwissenschaften, gehe auffallend aggressiv
gegen Andersmeinende vor.
TEIL II - RADIKALE AMNESIE
[21
Themen]
14. Vergessen und verdrängt I - die Herkunft
139 [3 Themen]
14.1 Abspaltung der Ethik 141 Querverweis 1.5.3:
Die Herkunft von Adam Smith,
dem Moralphilosophen aus Glasgow, wird von den Neoklassikern verdrängt.
Sie verkennen und verleugnen, dass die Grundlage jeder Ökonomie die
Ethik ist. Dieser Grundlage ist natürlich mit Mathematik und Marktmodellen
nicht beizukommen.
14.2 Liebe zur Weisheit? 143
Sie sei aus neoklassischen Lehrbüchern völlig verschwunden,
wohingegen sie bei Adam Smith noch eine große Rolle gespielt habe.
14.3 Mindestanforderung Wiedervereinigung Ökonomik und Ethik 144
Diese Zwischenüberschrift erklärt sich selbst. Felber zitiert
den Vorschlag vom Raworth, die analog zum hippokratischen Eid bei den Medizinern,
einen Eid für ÖkonomInnen vorschlägt:
| S. 145: "»1. Handle im Dienst der menschlichen
Entwicklung in einem gedeihenden Netz des Lebens, in der Anerkennung, dass
alles davon abhängt. 2. Respektiere die Autonomie der Ge- meinschaften,
denen Du dienst, indem Du ihre Mitwirkung und Zustimmung einholst, während
Du Dir der Ungleichheiten und Unterschiede in ihnen bewusst bist. 3. Sei
weise in der Gesetzgebung, versuche das Schadensrisiko zu minimieren, im
Speziellen gegenüber den Verwundbarsten, im Angesicht von Unsicherheit.
Schließlich, 4. Arbeite mit Demut, indem Du die Annahmen und Grenzen
Deiner Modelle trnsparent machst, und indem Du alternative ökonomische
Perspektiven und Instrumente anerkennst.«12" |
15 Vergessen und verdrängt II - derName
146 [10 Themen]
15.1 Von der Ökonomik ... 146
Hier erläutert Felber die Wort- und Begriffsgeschichte (oikos
- die Lehre vom Haus[halt], was von NeoklassikerInnen verdrängt und
ausgeblendet wird. Als Werte galten im griechischen oikos: Fürsorge,
Zusammenarbeit, Eintracht, Mäßigung, Klugheit.
15.2 ... über Agoranomie und Agoralogie der Lehre vom Markt...
148
Agora komme aus dem Altgriechischen und bedeute Markt. Von daher wäre
die treffendere Bezeichnung Agoranomie für die Wissenschaft vom Markt,
Angebot, Nachfrage und Gleichgewicht. Auch Agoralogie als Ausdruck für
die Wissenschaft vom Markt könnte gewählt werden.
15.3 ... zur Chrematistik der Kunst des Gelderwerbens 150
Heute heißt es Kapitalismus. Kapital sei der höchste Wert
im Kapitalismus und seine Mehrung das höchste Ziel (S. 151).
| S. 152: "... Ökonomie hat per definitionem ein
ethisches Ziel und ist »Gute-Leben» oder Gemeinwohl-Ökonomie
- im Unterschied zur chrematistikè. Bloß haben die
Chrematisten den Ökonomie-Begriff okkupiert, seine ursprüngliche
Bedeutung verdrängt und ihn mit der entgegengesetzten Bedeutung aufgeladen.
Deshalb müssen wir von sozialer Marktwirtschaft, solidarischer
Ökonomie oder Gemeinwohl-Ökonomie sprechen. Wären
die Ur-Begriffe bekannt, würden wir schlicht von »Ökonomie«
sprechen - und gemeint wäre Gemeinwohl-Ökonomie. Und nie im Leben
Kapitalismus! Ökonomie ist schon vom Begriff her antikapitalistisch.
Und Kapitalismus ist per definitionem antiökonomisch. ..." |
15.4 ... zurück zu einer echten Ökonomik (Politischen Ökonomie)
153
15.4.1 Häusliche Fürsorgewirtschaft einbeziehen 153
15.4.2 Ziel Wohl aller Haushaltsmitglieder 153
15.4.3 Geld und Kapital als dienende Mittel sehen 153
15.4.4 Grundhaltung der Fülle statt Knappheit 153
15.4.5 Mäßigung und Sättigung statt Maximierung und
Wachstum 153
15.5RS Tabelle Name, Entstehung, Genre, Gegenstand
154

16 Vergessen und verdrängt III - das Ziel
155 [8 Themen]
16.1RS Ziele der Ökonomie im historischen Verlauf
155
Das Eingangszitat von Jacob Viner (1933) "Economics is what economists
do" impliziert: Ziele spielen offensichtlich keine Rolle.
16.2RS Tabelle 4 Zehn Definitionen für Ökonomik
von Smith (1776) bis Pindyck & Rubinfeld (2018) 156
16.3 Konfusion 156f
"Die American Association of Economics ist ein weiteres Anschauungsbeispiel
für die Verwirrung, worum es in der Ökonomik nun eigentlich geht:
»Wirtschaftswissenschaft kann auf unterschiedliche Weise definiert
werden: Sie ist das Studium von Knappheit, das Studium, wie Menschen Ressourcen
verwenden und auf Anreize reagieren, oder das Studium der Entscheidungsfindung.«34
"
16.4 Dekonstruktion
158
Hier zeigt Felber, dass die Definitionen grundlegende Mängel enthalten
und daher wissenschaftlich nicht tragfähig sind.
16.4.1 a) Knappheit welcher Mittel? 158
Der Zwischentitel erklärt sich selbst.
16.4.2 b) Effizienter Einsatz knapper Mittel wofür? 158
Der Zwischentitel erklärt sich selbst.
16.4.3 c) Klärung des Ziels hat Vorrang! 160ff
Der Zwischentitel erklärt sich selbst, wobei Felber das Gemeinwohl
als oberstes Ziel erkennt und mit 9 Unterzielen spezifiziert:
-
Deckung der materiellen Grundbedürfnisse (Nahrung, Kleidung, Wohnraum,
Mobilität...)
-
Gesundheit und Bildung
-
Soziale Sicherheit und Zusammenhalt
-
Vertrauen und Beziehungsqualität
-
Transparenz und partizipative Demokratie
-
Subjektive Lebenszufriedenheit/Glück
-
Stabiles Klima und intakte Umwelt (hohe Artenvielfalt, saubere Meere, trinkbare
Flüsse)
-
Frieden und abnehmende Gewalt
-
rückläufige unfreiwillige Migration.
| S. 161: "... Der St. Gallener Wirtschaftsethiker
Timo Meynhardt kommt zum Schluss: »Offenkundig besitzt jede Sprache
rund um den Globus ein Wort für Gemeinwohl. Zudem nenne jemand eine
Gesellschaftsheorie, die ohne Gemeinwohlbezug auskommt. Es gibt sie schlicht
nicht!«43" |
16.4.4 d) Hilfswissenschaft statt Königsdisziplin 162
| S. 162f: "... Die Mittel haben immer den Zielen zu
dienen". Die Wirtschaftswissenschaft kann per definitionem - solange sich
»nur« mit den Mitteln befasst - gar keine eigenständige
Wissenschaft sein. ... Sie muss verinnerlicht haben, dass die finanziellen
Ressourcen wertvolle Mittel sind, aber weder höchste Ziele noch Grundwerte.
..." |
16.4.5 PS: "Effizientes Management knapper Ressourcen" oder:
das Theorem der komparativen Kaufkraftvorteile 163
Ökologie und die Ressourcen des Planeten Erde sind bei den Neoklassikern
nicht vorgesehen. Das bringt Felber auf die Idee "ökologischer
Menschenrechte" und er schlägt ein Pro-Kopf-Verbrauchsbudget vor.
| S. 164: "Diese Idee von ökologischen Menschenrechten
könnte Mainstream-Ökonom*innen auch als »Theorie der komparativen
Kaufkraftvorteile« schmackhaft gemacht werden: Jede »Partei«
tauscht diejenige Kaufkraft, die sie im Überfluss hat (komparativer
Kaufkraftvorteil), gegen jene ein, an der es ihr mangelt (komparativer
Kaufkraftnachteil). Wenn beide Parteien ihren Vorteil ausspielen, können
beide gewinnen." |
TEIL III - POLITISCHE
ÖKONOMIE [53 Themen]
17. [1] Wirtschaftsnobelpreis?
165 [8 Themen]
Eingangszitat von Peter Nobel,1
"Der Preis für die Wirtschaftswissenschaften ist ein PR-Coup von
Ökonomen, um ihren Ruf zu verbessern."1
17.1 Reichsbank-Rache-Preis 166
Felber schildert hier die spannende und kaum bekannte Geschichte (auch
nicht in Wikipedia, Kontrollabruf 07.12.2019).
17.2 Erben gegen Namensverwendung 167f
Eindeutiger und klarer geht es nicht.
17.3 Strategie der Verwechslung 169
Die Reichsbank war bestrebt, ihren Reichsbankpreis mit genau denselben
Insignien auszustatten wie den Nobelpreis. Das gelang ihr bislang und deshalb
wird der Reichsbankpreis auch dem Nobelpreis völlig ungerechtfertigt
gleichgesetzt.
17.4 Unstatthafte Annahme des Preises 169f
Nur einer, Myrdal, habe die Größe gehabt, seinen Wirtschafts"nobelpreis"
zumindest im Nachhinein abzulehnen:
| S. 170: "... Myrdal sprach sich offen für die
Abschaffung des »Nobelpreises« aus, zum einen, weil die Ökonomik
eine »weiche« Wissenschaft sei, das bedeutet eine nicht exakte,
mit politischen und gesellschaftlichen Werten aufgeladene Wissenschaft,
im Unterschied zu den »harten« Wissenschaften wie Physik und
Chemie, wo sich niemand Sorgen über die politische Einstellung der
Empfänger*in machen müsse.18 ..." |
17.5 Vergabe-Kritik 171
Neoklassiker, Weiße, Männer und US-Ökonomen seien extrem
überproportional vertreten.
17.6 Leer ausgegangen 171f
Felber listet hier viele auf, die den Reichsbankpreis verdient hätten,
aber nicht bekamen, z.B. Joan Robinson, Donella Meadows, Hazel Henderson,
Kate Raworth, Genevieve Vaughan, Riane Eisler, Martha Nussbaum, Adelheid
Bieseker und viele andere.
17.7 Rolle der MPS [Mont Pèlerin Society] 173
Allein 8 Reichsbankrpreise seien in kurzer Zeit an dieses Netzwerk,
1946 von Hayek gegründet, gegangen.
17.8 Andere Preise 174
Felber informiert, dass der Vorschlag Jakob Uexkülls, einen Nobelpreis
für Ökologie und Menschenrechte einzurichten, ohne Begündung
abgelehnt worden sei. Daraufhin habe Uexküll den Right Livelyhood
Award gestiftet, der auch als "Alternativer
Nobelpreis" bekannt ist.
18. [2] Econocracy - die Herrschaft
der Ökonomen 176 [6 Themen]
S. 179: "Econocracy« bedeutet, dass die Regierung wissentlich
die Ziele der Wirtschaftspolitik anders definiert, als die Bevölkerung
dies wünscht, weil einflussreiche Ökonomen es ihr einflüstern.
..."
18.1RS Ökonomie betrifft alle - was wäre
also die Rolle der Expert*innen? 176
| S. 176: "... Die angemessene Rolle der Expert*innen
bestünde darin, ein Spektrum unterschiedlicher Alternativen auszuarbeiten
und aufzubereiten, damit die Bevölkerung dann informiert und frei
wählen kann." |
18.2RS Darauf werden die Student*innen nicht vorbereitet
176ff
| S. 177: "... Sie werden »entführt«
in dichte Nebel der Mathematik und die surreale Welt der Modelle, über
die sie die Verbindung zur Realität, zu den Menschen und zur Demokratie
verlieren. ..." |
Die Entfremdung sei groß. In Großbritannien vertraue nach
einer Umfrage nur 2% der Bevölkerung den Ökonom*innen »in
hohem Maße« und nur ein Drittel »in gewissem Maße«.
18.3 NAIRU, QE und BIP 178
Die Expertensprache werde vielfach nicht verstanden. Beispiele: »Non
accelerating inflation rate of unemployment» (NAIRU); Quantitative
Easing (QE) nach Felber "Quantitative Easing, so nobel es klingt, könnte
man auch mit Ramschpapieraufkaufprogramm durch Notenbanken übersetzen.
..."; Bruttoinlandsprodukt (BIP).
18.4 Aus neoklassisch wird neoliberal: TINA! [There is no alternative]
180
Felber informiert hier über die politische Umsetzung der neoklassichen
und neoliberalen Ideen durch Margaret Thatcher und Ronald Reagan. Zu Thatchers
Leugnung der Gesellschaft siehe bitte 11.3.
18.5 Neoliberales Denkkollektiv: Die Mont Pèlerin Society
(Hayek 1946) 181ff
Siehe bitte auch 17.7 Felber zeigt sich hier als subtiler Kenner der
Neoklassikgeschichte.
| S. 182: "Die geschlossene Gesellschaft - Mitglied
werden konnte man nur auf Einladung Hayeks - setzte sich aus drei Schulen
zusammen: den Austrians, der Chicago School (US) und den deutschen Ordoliberalen.
Entsprechend gingen die Meinungen auseinander. »Doch der gemeinsame
Kampf gegen Keynesianismus, Wohlfahrtsstaat, Gewerkschaften und Sozialisten
aller Art schuf eine Solidarität, die stärker war als die wechselseitige
Geringschätzung wissenschaftlicher Positionen.«54"
S. 183: "Aufgabe der Thinktanks ist und war es, die Theorie der »Vordenker«
wie Hayek, Friedman und Co. in leicht lesbaren Broschüren zusammenzufassen,
aktuelle wirtschaftliche oder politische Entwicklungen zu kommentieren,
Lehrstühle zu finanzieren, Veranstaltungen zu organisieren und Kontakte
zu Medien und Politik zu pflegen. Wichtig auch die Nachwuchsförderung
durch Stipendien und Preise, z. B. den Hayek Essay Contest«.63 Heute
werden 475 »free market organizations« in 93 Staaten
vom Atlas Network koordiniert - das könnte man als die »Kapitalistische
Internationale« bezeichnen." |
18.6RS Tabelle 5: Marktliberale Thinktanks 184
In der Tabelle werden 16 marktliberale Thinktanks gelistet nach Gründung,
Budget und Merkmalen.
19. [3.] Lehrbuchposse
186 [12 Themen]
Felber informiert in diesem Kapitel ausführlich und gründlich,
was es mit der Lehrbuchposse auf sich hat:
19.1RS Felber in einer Reihe mit Smith, Marx, Keynes
und Hayek 186
19.2RS Aufstand der Mainstream-Ökonomen
186
19.3RS Reaktion der Medien 187
19.4RS Reaktion des Ministeriums 188
19.5RS Debattenanalyse 188
19.6RS Stellungnahme Germ (einer der Autoren des
Schulbuches) 189f
19.7RS Entscheidendes didaktisches Kriterium: Multiperspektivität
190
19.8RS Zensur des Establishments 191
19.9RS Qualitätskontrolle der Mainstream-Ökonomie-Lehrbücher
wäre wichtiger 191f
19.10RS PS: Ministerium gegen eigenen Grunderlass
gehandelt 192
19.11RS PPS: 10jähriger Lehrauftrag an der
Uni Wien trotz vieler anderer Berufungen nicht verlängert 193
19.12 PPPS: Alarm: Felber 2019 erneut im Schulbuch 193
Die Überschrift erklärt sich von selbst.
20. [4] Ideologisches Glaubenssystem
194 [27 Themen]
20.1RS Was ist die neoklassische Ökonomik?
194
Felber fragt: "Ist die neoklassische Ökonomik nun:
- eine Wissenschaft
- eine reine Wissenschaft
- eine »Königsdisziplin«
- eine (Quasi-)Natur- oder eine Sozialwissenschaft
- eine Pseudowissenschaft
- »pure science ficition«
- eine Noch-nicht-(fertig gereifte) Wissenschaft
- ein Glaubenssystem oder
- eine Ideologie?"
Und er antwortet, dass der neoklassische mainstream
eher ein "Bollwer" und keine "selbstreflexive, offene, organische und flexible
Wissenschaft sei." Und er erklärt auch gleich warum:
20.2 Die 25 Todsünden der neoklassischen Ökonomik 195
20.2.1 Geriert sich als Naturwissenschaft, obwohl reine Sozialwissenschaft
("Physikneid") 195
20.2.2 Verbreitet Illusion der Wertfreiheit, obwohl selbst ein
radikales Wertsystem 195
20.2.3 Epistemische Intransparenz (Wissenschaftstheorie nicht
offen) 195
20.2.4 Mathematische Erkenntnisweise nicht angemessen 195
20.2.5 Positivistisches Konzept nicht auf dem Stand, falsche
Verkündungen angeblich dauerhafter Wahrheiten über ausgeforschte
Märkte 195
20.2.6 Ausschließlich auf Märkte fokussiert 195
20.2.7 Historische Wurzeln der Ethik vergessen und abgetrennt
195
20.2.8 Bedeutung des eigenen Namens verdrängt, fokussiert
auf Finanzkennzahlen, das ist Chrematistik, nicht Ökonomie 195
20.2.9 Keine Klarheit über die Ziele und Pseudoerklärungen
"Ecnomics is what economists do" 195
20.2.10 Tritt uniform dogmatisch auf und verdrängt und ignoriert
andere Theorieschulen 195
20.2.11 Mathematischer Ballast nicht sinnvoll 196
20.2.12 Arbeitet schwerpunktmäßig mit unterkomplexen
Modellen, klammert wesentliche Realitäten aus 196
20.2.13 Arbeitet mit irreführenden, nicht verständlich
erklärten Metaphern 196
20.2.14 Märkte quasireligiös interpretiert (unsichtbare
Hand [Smith], Auktionator [Walras]) 196
20.2.15 Lehrbücher antiaufklärerisch 196
20.2.16 Systematische Ignorierung von Kritik 196
20.2.17 Interdisziplinaritätsresistenz 196
20.2.18 Aggressive Abgrenzung von "non economists" 196
20.2.19 Pathologisch-irreales Menschenbild 196
20.2.20 Gefährdet ökologische Grundlagen 196
20.2.21 Demokratiefeindliche Rhetorik gegen den Staat (Staatsineffektivitätshypothese)
196
20.2.22 Verschleiert Machtverhältnisse durch falsche Darstellung
von Märkten als "frei" und "verteilungsneutral" 196
20.2.23 Männerfokussiert, blendet weibliche Fürsorge
und Beziehungsarbeit aus 196
20.2.24 Ungerechtfertigter Nobelpreis 197
20.2.25 Legitimiert unethische kapitalistische Ordnung 197
TEIL IV - ZENTRALE
GLAUBENSINHALTE [34 Themen]
21.1 [1.] Wachstum 199
[4 Themen]
Ständiges Wachstum sei der heilige Gral der Wirtschaftswissenschaft
und -politik. Das Eingangszitat von Kenneth Bouldung1 bringt es auf den
Punkt:
S. 199: "Anyone who believes exponential growth
can go on forever in a finite world is either a madman or an economist."
Jedermann, der glaubt, man könne exponentielles Wachstum in
einer endlichen Welt immer so weiter erzeugen, ist entweder ein Verrückter
oder ein Ökonom. |
Damit ist fast alles gesagt.
21.1 1 Ziel unklar 201
Damit ist echte Ökonomie als Wissenschaft nicht möglich.
S. 201: "... Die Gemeinwohl-Ökonomie misst den
Erfolg - auf Basis von Verfassungswerten - mit einer Gemeinwohl-Bilanz
für Unternehmen, einer Gemeinwohl-Evaluierung für Investitionen
und einem Gemeinwohl-Produkt für Volkswirtschaften.11
Das BIP macht etwas komplett anderes. Es misst den
monetären
Tauschwert von marktvermittelten Gütern und Dienstleistungen (Agoranomie)." |
21.1 2 Die etwas andere Entkoppelung 203
Das BIP sei eine wichtige Größe, aber ungeeignet zur ökonomischen
Erfolgsmessung und müsse daher entkoppelt werden.
21.1 3 Demokratie 204
| S. 204 "Neben den Verfassungen sind auch Bevölkerungsmehrheiten
gegen das BIP als Wohlstandsmaß. Zwei Umfragen in Deutschland und
Großbritannien haben ergeben, dass die Bevölkerung - im Unterschied
zu den chrematistischen Wirtschaftswissenschaftler*innen - gar nicht hint
dem BIP steht. Wie berichtet, stimmten in Deutschland nur achtzehn Prozent
für das BIP, hingegen waren 67 Prozent für seine Ablöse
für ein »Bruttosozialglück«.15" |
Die Gemeinwohlökonomie leiste hingegen, dass die Bevölkerung
das Gemeinwohlprodukt selbst komponieren könne.
21.2 [2.] Menschenbild
207 [8 Themen]
| S. 207: "Die Abwehr jedes normativen Menschenbilds
durch Ökonom*innen ist zum einen eine glatte Projektion: Sie lenkt
davon ab, dass der Homo oeconomicus, sosehr sie es auch bestreiten, selbst
ein normatives Menschenbild ist. Die Welt soll sich ihrer
Vorstellung und Vision anpassen, nämlich: Das Ausleben der Egoismen
ist positiv, weil die »unsichtbare Hand« des Marktes die Egoismen
der Einzelnen ja ohnehin zum Gemeinwohl füge." |
Ein großes Problem sei, dass die neoklassischen mainstream Ökonom*innen
ihre eigene Wertgebundenheit nicht wahrnähmen oder mit Killerphrasen
abwehrten.
21.2.1 Historie 209
Mit oikonomia habe der Homo oeconomicus gar nichts zu tun, er
sei erst im 20. Jhd. geboren worden.
| S. 209: " ... Die Tatsache, dass es den Homo oeconomicus
über zweitausend Jahre lang nicht gab - im Unterschied zum Begriff
der Ökonomie ist ein Hinweis darauf, dass es sich nicht um einen griechischen
Homo
oeconomicus handelt, sondern um den neoklassischen Homo chrematisticus." |
21.2.2 Dekonstruktion
209
Mit Hilfe der kritischen Begriffsanalyse (Dekonstruktion) und alternativen
Befunden, zeigt Felber, dass die Grundannahme des Homo oeconomicus, die
persönliche Eigennutzenmaximierung, nicht richtig ist.
21.2.3 Alternative Menschenbilder 211
Sie werden ignoriert und damit auch, dass man mit anderen Menschenbildern
zu ganz anderen Ergebnissen gelangen würde. Die folgenden Überschriften
erklären sich selbst:
21.2.4 a) Empathie und Mitgefühl 212
21.2.5 b) Hilfsbereitschaft und Solidarität 212
21.2.6 c) Schenken und Teilen 213
21.2.7 d) Gerechtigkeitsempfinden 213f
21.2.8 e) Gelingende Beziehungen und Glück 214f
21.3 [3.] Wettbewerb statt
Kooperation - der zentrale Theorie- und Empirie-Fehler 216
[6 Themen]
Die Überschrift erklärt sich selbst.
21.3.1 Definitionen 218
Die Gretenchenfrage dieses Abschnitts lautet: Was heißt und bedeutet
Wettbewerb gegenüber Kooperation. Vernünftige Überlegungen
und die empirischen Befunde sprechen klar für Kooperation.
21.3.2 Effizienteste Strategie für Motivation 219
Aus 369 empirischen Studien 1898-1989 habe sich klar ergeben, dass
87% der Ergebnisse dafür sprechen, dass Kooperation stärker motiviere
als Konkurrenz. Dies wird noch einmal in der folgenden Tabelle gegenübergestellt:
21.3.3RS Tabelle 6 Wettbewerbs und Kooperationsmodus
im Vergleich 220
Hier werden 11 Merkmale verglichen.
21.3.4 Ist Konkurrenz natürlich? 221
Felber sagt Nein und argumentiert, dass Kooperation als Anpassungsstrategie
der Konkurrenz haushoch überlegen sei.
21.3.5 Umsetzung in der Marktwirtschaft 222
Felber hält ein Zusammendenken von Marktwirtschaft und Kooperation
für möglich und wünschenswert.
21.3.6 PS: Effizientes Management knapper Ressourcen 223
Seien 10 Kuchenstücke für 5 Personen verfügbar, so sei
die beste Lösung, wenn jeder ein halbes erhielte und nicht wenige
viel und die andern nichts.
21.4 [4.] Staat & Markt:
das beste Ehepaar der Welt 224 [9 Themen]
Der Titel erklärt sich selbst.
21.4.1 Ehe statt Dichotomie 224ff
| S.224: "Staat und Markt sind vielleicht das wichtigste
Ehepaar der Welt: Sie spielen zusammen und erzeugen Synergien, sie sorgen
für Effizienz und Gerechtigkeit, für Demokratie und Freiheit.
..." |
21.4.1.1. Negative Rückkoppelungen bei Einkommen und Vermögen
227
| S. 227: "Das Extrem der Laissez-fair-Marktwirtschaft
lautet: grenzenlose Ungleichheit. Das Extrem der sozialistischen Planwirtschaft:
»Gleichmacherei«. Der sinnvolle Mittelweg besteht darin, Ungleichheit
zwar zuzulassen, um Unterschiede in Ausbildung, Engagement, Verantwortung
oder Risiko zu würdigen (Meritokratie, Leistungsgerechtigkeit), diese
Ungleichheit aber in vertretbaren und maßvollen Grenzen zu halten.
..." |
21.4.1.2. Sozialstaat 228
Der Titel erklärt sich selbst. Hauptfunktion: Schutz vor der Gefahr,
dass der Kapitalismus die Gesellschaft und die Demokratie zerstört.
21.4.1.3. Öffentliche Güter 228f
Hier ist die Daseinsvorsorge als dritte Kernaufgabe angesprochen.
21.4.1.4. Arbeitsmarkt 229
Eine weiteres Synergiefeld zwischen Staat und Markt. Das Recht auf
Privateigentum wird von Hayek un den Neoklassikern rabiat vertreten, während
das Recht auf Arbeit völlig hinten runter fällt.
21.4.1 5. Konjunkturpuffer 229
Hier denkt Felber an antizyklische Konjunkturpolitik (Keynes),
die in der Finanzkrise 2008 auf einmal ganz schnell von den Neoklassikern
gefordert wurde.
21.4.1.6. Ausgleich der Handelsbilanzen 230f
| S.230 "... Da die Summe aller Leistungsbilanzen
immer null ist, geht der Überschuss eines Landes zwingend auf Kosten
eines anderen Landes. Das Defizitland leidet unter steigender Arbeitslosigkeit
und Verschuldung und würde früher oder später in den Staatsbankrott
gehen. Keynes hatte auch den politischen Frieden im Sinn, als er 1944 in
Bretton Woods seinen Vorschlag zur Stabilisierung der Handelsordnung unterbreitete.
Die USA blockten den Vorschlag ab - heute wären sie dessen größter
Profiteur: Keynes’ Vorschlag wird in den Lehrbüchern totgeschwiegen,
weil er nicht aus dem Geist der Gleichgewichtstheorie geboren ist. ...
" |
RS: Gleichgewichtstheorie der mainstream Ökonomie.
21.4.1.7. Ökologische Grenzen 231
Der freie Markt sei auf dem ökologischen Auge gleich blind wie
auf dem sozialen.
21.4.1.8 Abbildung 5: Spektrum der Wirtschaftsordnungen
232

21.5 [5.] Eigentum
233 [7 Themen]
Felber empfiehlt zunächst, die verschiedenen Formen und Varianten
des Eigentums zu differenzen, um eine sachgerechte Diskussion zu fördern.
21.5.1 Tabelle 7: Eigentumsformen 234
Die 6 Unterscheidungen und Formen werden in den folgenden Abschnitten
dargelegt.
21.5.1.1 Öffentliches Eigentum 234ff
| S.234: "Daseinsvorsorge und Infrastruktur: Straßen,
Eisenbahnen, Schulen, Spitäler, Stadtwerke, Energieversorger, Sozialdienste
bilden das Fundament der Wirtschaft und des demokratischen Gemeinwesens
und sozialen Zusammenlebens gleichermaßen. Diese Güter sollen
allen Menschen zur Verfügung stehen (Universalprinzip), zu erschwinglichen
Preisen und barrierefrei. Dafür eignen sich gemeinnützige Unternehmensformen
wie z. B. Körperschaften des öffentlichen Rechts." |
21.5.1.2 Privates Eigentum 236ff
So heißt das Sankrosanktum der Neoklassiker. Die verfassungsmäßigen
Beschränkungen (Gemeinwohl)
griffen nicht und das Privateigentum sei derzeit die expansivste Eigentumsform,
was Felber wie folgt erklärt:
| S. 237: "... Wichtige historische Etappenschritte
waren die Einführung privater Kapitalgesellschaften, die Haftungsbeschränkung,
die Erlaubnis, Eigentum an anderen juristischen Personen zu erwerben, die
Erlaubnis des Landkaufs im Ausland, Schutz von geistigem Eigentum, einschließlich
Lebewesen, freier Kapitalverkehr, und aktuell: Bail-out mit Steuergeldern
sowie direkte Klagerechte von juristischen Personen gegen Staaten im Rahmen
von Investitions- und Handelsabkommen. Die Pflichtenseite sieht im Vergleich
äußerst mager aus: Weder gibt es eine globale Fusionskontrolle
noch eine Größengrenze, weder eine internationale Steuerkoordination
noch eine globale Finanzaufsicht; weder ein verpflichtendes Lobby-Register
noch eine verbindliche Gemeinwohl-Bilanz; die Nutzung von Steueroasen ist
ebenso erlaubt wie Landgrabbing, Parteienfinanzierung und feindliche Übernahmen.
Die Rechte und Pflichten juristischer Personen klaffen immer weiter auseinander
- hier ist eine historische Korrektur angebracht, über deren Möglichkeiten
die Lehrbücher Bewusstsein schaffen könnten." |
21.5.1.3 Abbildung 6: The rise, fall and equilibrium of corporate
power 238
Die Glockenkurve mit Wendepunkt um 2030 zeigt Entwicklungsmerkmale
von 1800 bis ca. 2010. Es ist ein sehr hoffungsvolles Schaubild, was die
Zukunft der nächsten 100 Jahre betrifft
| S.237: "Abbildung 6 ist in dieser Hinsicht wichtiger
als alle Angebots- und Nachfragekurven der Mikroökonomie-Lehrbücher.
Sie stellt die progressive Machtkonzentration und nötige Dekonzentration
der Macht transnationaler Unternehmen dar. ..." |
21.5.1.4 Gemeingüter - Allmenden 239
Gemeingüter, Allmenden oder Commons seien eine vollständige
Alternative zu Kapitalismus und Marktwirtschaft. Sie beruhten auf den Werten
Kooperation, Nachhaltigkeit und Gemeinwohl und kämen ohne das Prinzip
der Tauschäquivalenz und oft sogar ohne Geld aus.
21.5.1.5 Nutzungsrechte 240
Diese Alternative zum Privateigentum werde von den neoklassischen Lehrbüchern
weitgehend ausgeblendet.
21.5.1.6 Kein Eigentum - im Gegenteil: Aneignungsschutz durch
Rechtssubjektstatus! 240f
Zum Beispiel die Natur.
| S. 241: "Fazit: Um aus politischen Gebetsbüchern
wissenschaftliche Lehrbücher zu machen, müssten alle Eigentumsformen
neutral mit Vor- und Nachteilen präsentiert und diskutiert werden." |
TEIL V - ALTERNATIVEN [20 Themen]
22.1 [1.] »Plural«:
die Ökumene der Ökonomik 243 [5 Themen]
Im Juni 2000 protestierten an der Sorbonne (Paris) WirtschaftsstudentInnen
gegen die "autistische Wirtschaftswissenschaft". Im Juni 2001 meldeten
sich in Cambridge 27 DoktorantInnen kritisch gegen die Monopolisierung
in der Wirtschaftswissenschaft zu Wort und forderten eine offene Debatte.
Im gleichen Monat trafen sich in den USA 75 Studierende, Forscher- und
ProfessorInnen auf der zweiten Sommerakademie der Evolutionären Ökonomik
und veröffentlichten das "Kansas City Proposal" zur Unterstützung
der Proteste in Frankreich und Großbritannien. Auch in Deutschland
formierte sich eine studentische Alternative, die am 16.11.2003 den Arbeitskreis
"Post-Autistische Ökonomie"gründeten, woraus 2007 ein kleiner
Verein mit mehreren Regionalgruppen entstand. Nach der Finanzkrise 2008
(RS genauer 8.2.2007)
sei die Aufmerksamkeit sprunghaft angestiegen. 2012 und 2014 Umbenennung,
zuletzt in »Netzwerk
Plurale Ökonomik«.8
| S. 245: " ... Dieses schloss sich 2014 mit weiteren
65 Initiativen aus dreißig Staaten zur International Student Initiative
for Plural Economics (ISIPE) zusammen, die am 5. Mai einen internationalen
Aufruf für eine plularere Ökonomik weltweit in Zeitungen veröffentlichte:
»Wir beobachten eine besorgniserregende Einseitigkeit der Lehre,
die sich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verschärft hat.
Diese fehlende intellektuelle Vielfalt beschränkt nicht nur Lehre
und Forschung, sie behindert uns im Umgang mit den Herausforderungen des
21. Jahrhunderts - von Finanzmarktstabilität über Ernährungssicherheit
bis hin zum Klimawandel.« Die drei Kernforderungen des Aufrufs: »Theoretischer
Pluralismus, methodischer Pluralismus und Interdisziplinarität«.9
Der Aufruf wurde auch von dreitausend Personen unterzeichnet.10" |
22.1.1 Reaktion des Establishments 246ff
Die Reaktionen (Solow 2001, Frankreich; Burda 2012, Wambach 2018
für den Verein für Socialpolitik, Deutschland; Becker Uni Münster;
Wirtschaftsuniversität Wien) waren gegenkritisch, abwehrend, weiterhin
die Grundprobleme verleugnend. Immerhin: es fand und findet eine Auseinandersetzung
statt.
22.1.2 Pluralismus versus Neues Paradigma 250
Der neue Pluralismus formiert sich, z.B. auf der Website exploring-economics.org.
22.1.3 Alternative Lehrbücher 251f
Das Netzwerk
Plurale Ökonomik gibt Informationen über alternative
Lehrbücher. Es gibt auch einen Masterlehrgang von Peukert an der Uni
Siegen (https://www.plurale-oekonomik.de/materialien/einfuehrung/). Viele
Themen sind auch unter dem Stichwort "Microeconomics in Context" zu finden.
Hier ist allerhand auf den Weg gebracht worden.
22.1.4 Alternative Studien 253
Hier nennt Felber die Uni Siegen; die Cusanus Hochschule; Alanus Hochschule;
Institute for Ecological Economics der Wirtschaftsuniversität Wien
(bietet ein Masterstudium for Socio-Ecological Economics and Policy (SEEP)
an); Institut für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen;
Universität Kassel (Nachhaltiges Wirtschaften), der Leuphana-Universität
Lüneburg; Universität Witten-Herdecke; Hochschule für Nachhaltige
Entwicklung in Eberswalde. Felber S. 253: " ... Der aus der Sicht des Autors
innovativste Master-Lehrgang ist Economics for Transition am Schumacher
College in Tottnes/Großbritannien, das sich als »University
for Holistic Science« versteht. Eine breitere Übersicht bieten
sowohl das Netzwerk Plurale Ökonomik25 als auch die Gemeinwohl-Ökonomie26
an."
22.1.5 Alternative Institutionen 253f > siehe bitte auch
oben 22.1.4.
Auch hier berichtet Felber erfreuliche Entwicklungen: Forschungsinstitut
für gesellschaftliche Weiterentwicklung (FGW); »Institut für
zukunftsfähige Ökonomien« ("Thinktank ZOE"); Gesellschaft
für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft (GSÖBW); »Netzwerk
ökonomische Bildung und Beratung e. V.«28.
| S. 254: "»Grundsatz 3 lautet: Es gibt keine
universellen ökonomischen Gesetze oder Kausalitäten im Sinne
von Naturgesetzlichkeiten!« Grundsatz 8: »Es gibt keine wertfreie
Volkswirtschaftslehre«, Grundsatz 12: »Es gibt nicht nur eine
Definition der Volkswirtschaftslehre.«" |
22.2 [2.] Heilige Wirtschaftswissenschaft
255 [15 Themen]
Vorab S. 257: "»Heilig« meint hier nicht, dass die Wissenschaft
zur Religion wird, sondern dass sie - im Sinne der Systemtheorie und des
Holismus - ganzheitlich wird." Die gute Nachricht: die Wirtschaftswissenschaft
kann gerettet werden. Was hierzu getan werden muss, wird in diesem Kapitel
noch einmal zusammengefasst.
22.2.1 Tabelle 8: Neoklassik versus ganzheitliche Wirtschaftswissenschaft
256
Hier werden Neoklassik und Ganzheitliche Wirtschaftswissenschaft in
14 Stichwortenbereichen einander gegenübergestellt.
22.2.2RS Es folgen 12 Bausteine einer ganzheitlichen
Wirtschaftswissenschaft 257
22.2.2.1 Definition von Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft
257
| S. 257: "Viele Ökonomen stimmen im Gespräch
zu, dass die Ökonomie letztlich dazu diene, menschliche Bedürfnisse
zu befriedigen. Dieser Ansatz spiegelt sich auch in zahlreichen Verfassungstexten
wider: »Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohle des
ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs zu dienen«, steht
in der Verfassung Hessens (Art.
38.). Die bayerische Verfassung gibt »die Befriedigung der Bedürfnisse
aller Bewohner« vor (Art.
157). ..." |
22.2.2.2 Klärung des Ziels 258f
| S. 258: "... Was Ziel des Wirtschaftens ist, steht
in Demokratischen Verfassungen - oder ist über demokratische Prozesse
zu klären. Die bayerische Verfassung definiert es kristallklar: »Die
gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.« (Art.
151) Also müßte ein »Gemeinwohl-Produkt« das Bruttoinlandsprodukt
als Messgröße für volkswirtschaftlichen Erfolg ablösen.
..." |
22.2.2.3 Universalwissenschaft 259ff
| S. 259: "... Angesichts brennender globaler Probleme
braucht es die interdisziplinäre und ganzheitliche Zusammenschau aller
Teile des Ganzen. Wie Keynes sagt, muss eine gute Ökonom*in viele
richtige Rollen und Perspektiven in sich vereinigen. ... " |
22.2.2.4 Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie 262
| S. 262: "Die strikte Trennung zwischen positiven
und normativen Aussagen kann durch die transparente Reflexion und Offenlegung
aller Annahmen, Präferenzen und Wertentscheidungen aufgegeben werden,
»Ojektivität« im mathematischen und walrasianischen Sinn
wird ausgemustert, sie hat sich durch Einsichten der Neurolinguistik und
Kognitionsforschung erübrigt. Stattdessen geht es um die Anerkennung,
dass sich der Großteil menschlicher Wahrnehmung jenseits rationaler
Überlegung vollzieht. Dieses »wissenschaftliche Unbewusste«
gilt es zu schulen und gleichzeitig kritisch zu reflektieren.33 Selbstreflexion,
spielerische Skepsis, Bescheidenheit und Transparenz lösen Ojektivität,
Deduktion, Positivismus und Wahrheitssuche als »epistemische Tugenden«
ab." |
RS: Ich halte es für keine gute Idee, den
grundlegenden Unterschied zwischen Sachaussage und Werurteil zu verwischen.
(> Wert-Fakten-Analyse).
22.2.2.5 Plurales Paradigma 262f
Felber erörtert die paradigmatische Frage und einen vielleicht
möglichen Mittelweg.
RS: Ich meine, die Frage ist mit den ersten drei
Themen bereits beantwortet. Man kann alles machen, aber in der Wissenschaft
muss es eben wissenschaftlich
sein, qanz egal mit welchem Paradigma gearbeitet wird.
22.2.2.6 Methoden 263f
| S. 263: "Hier gilt es das breite Menü an vorhandenen
Forschungsansätzen voll auszuschöpfen: Fallstudien, historische
Vergleiche, Tiefeninterviews, einfache Statistik ohne hochraffinierte Ökonometrie,
narrativ-hermeutische oder normative Ansätze (Wirtschaftsethik), Archivarbeit,
Begriffsdekonstruktionen
oder Diskursanalysen. Die Ausrede, es gebe keine Alternativen zu Modellen,
gilt nicht. Modelle haben ihren Platz, aber der ist nicht im Zentrum, schon
gar nicht dürfen sie ein Methodenmonopol begründen. There are
many games in town. " |
22.2.2.7 Vollkontakt mit der Realität: praktische Wissenschaft
264
Der Zwischentitel erklärt sich selbst. Als Beispiel nennt Felber
die Arbeit von Silja Graupe und ihrem Team, deren Vorbild der Studienansatz
von John Stuart Mill zur Hungersnot in Irland ist (Feldstudie).
22.2.2.8 Aristotelischer Eid für Ökonom*innen
264f
| S. 264f: "... Das bringt mich auf eine Idee: ein
»aristotelischer Eid«. Dieser könnte dazu dienen, dass
Absolventen von Wirtschaftsstudien Aristoteles’ Unterscheidung von oikonomia
und chrematistike kennen müssen - und mindestens zehn verschiedene
ökonomische Theorieschulen." |
22.2.2.9 Diskursethik: Gewaltfreie Kommunikation 265
| S. 265: "Was weiters einer ethischen Verfeinerung
bedarf, ist die Aufhebung des Widerspruchs, dass Wissenschaftler*innen
in ihren Texten strenge formale Regeln befolgen müssen, hingegen im
öffentlichen Diskurs so tief unter die Gürtellinie greifen dürfen,
wie sie wollen - ohne irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen.
Die Untergriffe erfolgen dabei mit der Autorität, die sie sich über
öffentliche Forschungs- oder Lehraufträge erworben haben. Mit
dem bewussten Brechen der Regeln des respektvollen Kommunizierens wird
diese Autorität missbraucht. Deshalb sollten Wissenschaftler*innen,
die andere Wissenschaftler*innen als »Verbalschwurbler«, »Internet-Trolle«,
»politische Aktivisten« oder »Gemeinwohl-Diktatoren«
bezeichnen, mit irgendeiner Form disziplinärer oder professioneller
Konsequenz rechnen müssen. Alles, was »nichts zur Sache tut«,
hat im öffentlichen Diskurs über Wissenschaft nichts verloren.
..." |
22.2.2.10 Zurücklegung des Nobelpreises 266
| S. 266: "Den testamentarischen Willen von Alfred
Nobel anerkennend und dem Vorschlag von Nobels Erben folgend, sollte der
Anerkennungspreis der Schwedischen Reichsbank für die Wirtschaftswissenschaften
lm »Reichsbankpreis« umbenannt werden (mit Spitznamen Wirtschafts-
modellpreis). ..." |
22.2.2.11 Demokratiepolitische Einbettung in die Gesellschaft
266f
| S. 266: "Ein letzter wesentlicher Reformschritt ist
die Wiedereinbettung der ökonomischen Wissenschaft und wirtschaftspolitischer
Entscheidungen in demokratische Prozesse. Wirtschaftswissenschaft muss
verständlich sein, darf nicht zu intuitiver Abstoßung führen
und muss von den betroffenen Menschen mitentschieden werden können.
... " |
22.2.2.12 Neues attraktives Narrativ 267
| S. 267: "... Außerdem sollen die Werte als
Grundlage dienen, aufgehängt am höchsten Individualwert: Menschenwürde,
und dem höchsten Kollektivwert: Gemeinwohl. ... " |
22.2.3 Wirtschaften zum Wohl aller oder Ein gutes Leben für
alle 267
| S. 267: "Alles ist mit allem verbunden. Wirtschaftliche
Tätigkeiten sind in die Kontexte Demokratie, Gesellschaft, Kultur
und Ökologie eingebettet und dienen der Befriedigung der Grundbedürfnisse
und der Erfüllung aller Grundwerte: dem Gemeinwohl. Die rechtlichen
Spielregeln schützen diese Ziele und benachteiligen ihre Schädigung.
Es gibt vielfältige Wirtschaftsformen wie Haushalte, Gemeingüter,
(globale) öffentliche Güter und Märkte. Ebenso vielfältig
sind die Eigentumsformen - alle sind erlaubt, aber alle sind auch begrenzt
und bedingt: Eigentum ist nicht Zweck, sondern Mittel. Auch Geld (Zahlungsmittel)
und Kapital (Produktionsmittel) sind Mittel, die alle der Erreichung
der übergeordneten Ziele dienen. Die Ungleichheit ist begrenzt, das
Wirtschaften findet innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten
statt. Ethischer Welthandel ist nicht verdrängend und vernichtend,
sondern stimulierend und ergänzend. Die Handelsbilanzen werden in
der Balance gehalten. Das Gemeinwohl-Produkt, mit dem wirtschaftlicher
Erfolg gemessen wird, wird souverän-demokratisch definiert. Das Leben
ist heilig!" |
Ende der Präsentation
Literatur
(Auswahl)
-
Baker, Dean (2006) Zitiert S. 49 (Tab 1) nach Bezemer, Dirk (2009), in
der Lit-Liste nicht eigens aufgeführt.
-
Bezemer, Dirk (2009): No One Saw This Coming. Understanding Financial Crisis
Through Accounting Models, Research Report 9002, Universität Groningen.
-
Bofinger, Peter (2009) Große Staaten haben breite Schultern, Interview,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. Mai 2009.
-
Brochner / Jens / Sorenson (2005) Zitiert S. 49 (Tab 1) nach Bezemer, Dirk
(2009), in der Lit-Liste nicht eigens aufgeführt.
-
Brodbeck, Karl-Heinz (1998, 2. A. 2000). Die fragwürdigen Grundlagen
der Ökonomie [>Inhaltsverzeichnis].
Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft. Homepage: https://khbrodbeck.homepage.t-online.de/
-
Colander, David et al. (2009): The Financial Crisis and the Systemic Failure
of the Economics Profession, Critical Review, Vol. 21, Nr. 1-2, 249-267.
-
Davis, John B. (1991): Keynes’s View of Economics as a Moral Science. In
(89-103) Bateman, Bradley W./ Davis, John B. (Hg.) (1991): Keynes and Philosophy:
Essays on the Origins of Keynes’s Thought. Cheltenham.: Edward Elgar Publishing.
-
Esser, Hartmut; Klenovits, Klaus; Zehnpfennig, Helmut (1977) Wissenschaftstheorie
2 Funktionalanalyse und hermeneutisch-dialektische Ansätze. Stuttgart:
Teubner Studienskripten.
-
Felber, Christian (2019) This is not economy. Aufruf zur Revolution
der Wirtschaftswissenschaft. Verlag: Deuticke
-
Godley, Wynne (2006) Zitiert S. 49 (Tab 1) nach Bezemer, Dirk (2009), in
der Lit-Liste nicht eigens aufgeführt.
-
Graupe, Silja (2016): Der erstarrte Blick. Eine erkenntnistheoretische
Kritik der Standardlehrbücher der Volkswirtschaftslehre, S. 18-20,
VAN TREECK/URBAN (Hg.) (2016).
-
Graupe, Silja (2017a) Beeinflussung und Manipulation in der ökonomischen
Bildung – Hintergründe und Beispiele. FGW-Studie Neues ökonomisches
Denken 05 [PDF]
Düsseldorf, Mai 2017.
-
Graupe, Silja (2017b): Wie konnte es passieren? Ökonomische Bildung
als Boden einer geistigen Monokultur, S. 847-850, Wirtschaftsdienst des
ZBW - Leibniz- Informationszentrums Wirtschaft, 12/2017.
-
Harrison, Fred (2005) Zitiert S. 49 (Tab 1) nach Bezemer, Dirk (2009),
in der Lit-Liste nicht eigens aufgeführt.
-
Hudson, Michael (2006) Zitiert S. 49 (Tab 1) nach Bezemer, Dirk (2009),
in der Lit-Liste nicht eigens aufgeführt.
-
Janszen, Eric (2006) Zitiert S. 49 (Tab 1) nach Bezemer, Dirk (2009), in
der Lit-Liste nicht eigens aufgeführt.
-
Keen, Steve (2011): Debunking Economics. The Naked Emperor Dethroned?,
aktualisierte und erweiterte Ausgabe, Zed Books, London/New York.
-
Komlos, John (2015): Ökonomisches Denken nach dem Crash. Einführung
in eine realitätsbasierte Volkswirtschaftslehre, Houghton Mifflin
Company, Boston/New York.
-
Krugman, Paul R. (1987): Is Free Trade Passe?, S. 131-144, The Journal
of Economic Perspectives, Volume 1, Issue 2 (Herbst 1987).
-
Lawson, Tony (2017): What Is Wrong With Modern Economics, and Why Does
It Stay Wrong?, Journal of Australian Political Economy No. 80, S. 26-42.
-
Mankiw, N. Gregory (2001): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 2.
Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart.
-
Mankiw, N. Gregory (2009): That Freshman Course Won’t Be Quite the Same,
New York Times, 23. Mai 2009.
-
Mankiw, N. Gregory (2017): Makroökonomie, 7., überarbeitete Auflage,
Schäffer-Poeschel, Stuttgart.
-
Mankiw, N. Gregory/Taylor, Mark P. (2012): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre,
5. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart.
-
Mankiw, N. Gregory/Taylor, Mark P. (2016): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre,
6. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart.
-
Ortlieb, Claus Peter (2006): Zur »ideologiefreien Methodik«
der neoklassischen Lehre, S.55-62, Dürmeier / Von Egan-Krieger / Peukert
(2006).
-
Ostrom, Elinor (2011): Was mehr wird, wenn wir teilen. Vom gesellschaftlichen
Wert der Gemeingüter, oekom, München.
-
Ötsch, Walter Otto (2009): Mythos Markt. Marktradikale Propaganda
und ökonomische Theorie, Metropolis, Marburg.
-
Ötsch, Walter Otto (2018): Mythos Markt. Mythos Neoklassik. Das Elend
des Marktfundamentalismus, Metropolis, Marburg.
-
Putnam, Hilary & Walsh, Vivian (2012) The End of Value-Free Economics.
New York: Routledge.
-
Raworth, Kate (2017): Doughnut Economics. Seven Ways to Think Like a 2ist-Century-Economist.
London: Random House Business Books.
-
Richebächer, Kurt (2001) Zitiert S. 49 (Tab 1) nach Bezemer, Dirk
(2009), in der Lit-Liste nicht eigens aufgeführt.
-
Roubini, Nouriel () Zitiert S. 49 (Tab 1) nach Bezemer, Dirk (2009), in
der Lit-Liste nicht eigens aufgeführt.
-
Schiff, Peter (2007) Zitiert S. 49 (Tab 1) nach Bezemer, Dirk (2009), in
der Lit-Liste nicht eigens aufgeführt.
-
Shiller, Robert (2005) Zitiert S. 49 (Tab 1) nach Bezemer, Dirk (2009),
in der Lit-Liste nicht eigens aufgeführt.
-
Walsh, Vivian (2012): Sen after Putnam, Kapitel 3, Putnam / Walsh (2012).
-
Walras, Leon (1954): Elements of Pure Economics: Or, The Theory of Social
Wealth, herausgegeben von Allen and Urwin für die American Economic
Association und die Royal Economic Society, London.
Links (Auswahl: beachte)
-
Homepage: https://christian-felber.at/
-
Homepage zum Buch: https://christian-felber.at/buecher/this-is-not-economy/
-
Über Christian Felber: https://christian-felber.at/christian-felber/
-
Rethinking Economics
-
Student Initiative for Plural Economics (ISIPE)
-
Netzwerk
Plurale Ökonomik.
-
exploring-economics.org
_
Glossar,
Anmerkungen und Endnoten: Eigener
wissenschaftlicher Standort * Eigener
weltanschaulicher Standort.
GIPT= General and Integrative
Psychotherapy,
internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Anmerkungen Felber
-
Anmerkung-165-Teil1 Walsh 2012, 44.
-
Anmerkung-195-Teil1 Keynes Zitat. "195
Zitiert in Davis (1991), 89"
-
Anmerkung-273-Teil1: "Präsident
des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie, auf der Veranstaltung
»Transformative Wirtschaftswissenschaft. Welche Wirtschaftswissenschaft
brauchen Politik und Gesellschaft?« am 31. Januar 2018 in der Heinrich-Böll-
Stiftung, Berlin."
-
Anmerkung-12-Teil2: Raworth (2017), 160-162.
-
Anmerkung-1-Teil3: "Zitiert in Pruett (2016)"
Peter Nobel ist der Urenkel des Bruders Ludwig von Alfred Nobel.
__
Brodbeck 1998/2000 INHALTSVERZEICHNIS
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage VII
Vorwort zur Taschenbuchausgabe 1
1 Wissenschaftstheoretische Voraussetzungen 5
1.1 Denkmodelle 5
1.2 Das Ungedachte in den Wissenschaften 7
1.3 »Theorie und Realität« 8
1.4 Entscheidung und Wahrscheinlichkeit 11
1.5 Subjektive Wahrscheinlichkeit 14
1.6 Logik des Scheins 17
1.7 Ausblick 20
2 Soziale Physik 22
2.1 Erklärungsüberschuß 22
2.2 Ökonomie oder Physik? 28
2.3 Klassische Mechanik 33
2.4 Variable Konstanten der Wirtschaft 40
2.5 Soziale Naturgesetze? 47
2.6 Freiheit als Physik 53
2.7 Die Flucht in den Durchschnitt 58
2.8 Ein thermodynamischer Ausweg? 64
3 Zeit 74
3.1 Modell-Zeit 74
3.2 Synchronisiertes Handeln? 81
3.3 Produktion und Nutzen ohne Zeit 84
3.4 Zeitpräferenz 90
3.5 Erwartungen 96
3.6 Die situative Zeit der Geschichte 103
3.7 Freiheit und Sterblichkeit 111
3.8 Die Utopie des Stationären Zustands 116 |
4 Natur 125
4.1 Der Krieg gegen die Natur 126
4.2 Widerstand und Gegenstand des rationalen Ego 130
4.3 Tier, Maschine, Arbeit 133
4.4 Der ökonomische Naturbegriff 137
4.5 Produktionsfunktionen 142
4.6 Naturgesetz, Experiment, Produktion 146
4.7 Die Bedeutung von Produktion und die Produktion
von Bedeutung 152
4.8 Der Sinn von Kausalität 156
4.9 Das »geistige Kapital« 164
4.10 Das Ganze der produktiven Situation 169
4.11 Ökologische Mechanik 174
4.12 Ökologischer Rest 179
5 Rationalität 188
5.1 Die berechnende Rationalität 189
5.2 Das traditionelle Handlungsmodell 197
5.3 Freiheit des Willens im Handeln 203
5.4 Der unendliche Wille und das maximale Ziel 209
5.5 Exkurs: Handwerker, Kaufmann und Maschine
als Denkmodelle 214
5.5.1 Das Denkmodell des Handwerkers 215
5.5.2 Das Denkmodell des Kaufmanns 220
5.5.3 Das Denkmodell der Maschine 223
5.6 Gestaltungsfreiheit und maximaler Nutzen 228
5.7 Motiv und Kreativität als Kausalverhältnis? 237
5.8 Die Schattenseite des rationalen Lichts 247
Literaturverzeichnis 258
Index 278 |
__
Dekonstruktion: Gemeint ist kritische
Begriffsanalyse, die die Unangemessenheit und Unzulänglichkeit der
Begriffe offenlegt, z.B. von Grundbegriffen "freier Markt", "Knappheit
der Mittel", "Marktgesetze", "Marktmechanismus" oder "Ökonomie".
> Dekonstruktion S. 60f (Gleichgewichtsmärchen), S. 158 (Knappheit
der Mittel) und S. 209 (Homo oeconomicus).
RS Querverweis: Elementarkriterium
für Definitionen: Zweckangemessenheit.
__
Druckfehler-S. 37. Auf Nachfrage
am 29.11.2019 bestätigt.
__
Gefangenendilemma > https://de.wikipedia.org/wiki/Gefangenendilemma#Beschreibung_der_Situation.
__
DIE ZEIT 10.05.2017
Volkswirtschaftslehre: Denken können wir selbst! Wie frustrierte Studenten
der Volkswirtschaftslehre sich international vernetzen und für mehr
Vielfalt kämpfen. https://www.zeit.de/2017/20/volkswirtschaftslehre-studenten-plurale-oekonomik/komplettansicht
__
und hier gehts gleich zur Gemeinwohl-Ökonomie
- Dem Wirtschaftsmodell der Zukunft [PDF]
Und hier zu Felber als Vorbild.
Querverweise
Standort: Buchpräsentation Felber This
is not Economy
*
Wirtschaftliche
Werte - Grundlagen und Systematik für eine vernünftige, gerechte,
humane und stabile Weltwirtschaft.
Gemeinwohl-Ökonomie
* Neue Werte für die Wirtschaft
* Vorbilder * Vorschläge/Alternativen
* Manager-Gagen * "Deutschland
AG" * Hartz4 * Niedriglöhne
& Sklavenarbeit * Projekt ZeitzeugInnen
Wirtschaftskrisen in Erlangen * Steueroasenausstellung
* Gemeinwohl * Staatslehre
des Aristoteles * Politikaxiome
* Oligarchie * Globalplayer
* Elite & etilE * Kapitalrecht:
Unrecht im Namen des Rechts *
Doku
Finanzkrise,
Medienkritik
2006-aktuell:
*
Arbeiterwohlfahrt * attac
* Ausländerbeirat
* Bündnis 90/ Die Grünen
* Caritas * DGB
* Diakonie * Die
Linke * DKP * Dritte
Welt Laden * Evang. Kirchlicher Dienst in der
Arbeitswelt (KDA) * Frauengruppentreff
Bildung evangelisch * GEW
[PDF]
* Initiative Gewerkschaftsgrün *
IGM
* Mieterverein * Sozialforum
* SPD * Tafel
* VdK *
verd.i
*
*
* FAQ:
Integration & Migration * Überblick
Wirtschaftsstatistik * Überblick
Staatsverschuldung *
* Schuldenporträt
Erlangen * Eindrücke vom
Theater * Eindrücke vom
Erlanger Poetenfest * 10 Jahre Offenes
Atelier Erlangen * Der Charakter
und sein Preis * Ausflug Staffelberg
* Sturmspuren im Schlossgarten
nach "Emma" * Regionales *
Psychologische u. sozialpädagog. Hilfe
(Beratung) in Nordbayern
* Google
Psychotherapie Mittelfranken. * Google
Psychologie Mittelfranken. * Psychologisches
Institut FAU Erlangen *
*
30 Jahre
Psychopraxis - 30 Jahre Partnerschaft.
*
*
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS). Buchpräsentation
Felber This is not Economy - Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft.
Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie
IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/regional/attac/FelberTionE.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_Revolution
Wirtschaftswissenschaft_Überblick_Rel.
Aktuelles_Relativ
Beständiges_ Titelblatt_
Konzept_
Archiv_Service_iec-verlag_
Kommunikation:
Mail: sekretariat@sgipt.org
korrigiert: irs 07./08. 12.2019
/ irs 03.12.2019 / irs 15.11.2019
Aenderungen wird
gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen
und Kritik willkommen
05-08.12.19 Vollständige Präsentation.
04.12.19 7. Wertfreiheit
versus Normativität.
03.12.19 6. Positivismus.
02.12.19 5.
Gleichgewichtsmärchen.
29.11.19 4.
Fetisch Modell.
25.11.19 3. Physikneid
- die eingebildete Naturwissenschaft.
16.11.19 Die ersten drei Kapitel 0, 1, 2
präsentiert.
15.11.19 Plazierung im Netz mit ersten
ausführlicheren Darlegungen.
13.11.19 Bibliographischer Rahmen.
12.11.19 angelegt.
» «