(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=20.11.2018 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 22.09.22
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_ Begriffsanalyse Dialektik, Haupt- und Verteilerseite_Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:
Einführungs-, Haupt- und
Verteilerseite
Begriffsanalysen und Untersuchungen
zur Dialektik
_
Zum Geleit-1
"Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung
des Verstandes durch die Mittel unserer Sprache."
Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, 109]

Originalarbeit von Rudolf
Sponsel, Erlangen
_Aufgrund gelegentlicher
Ergänzungen und Korrekturen mit F5-Taste updaten empfohlen
__
Zum Geleit-2
"Denn jeder, der Wert auf Reinheit im Denken legt, wird von jedem sprachlichen
Ausdruck, der mit dem Anspruch auftrifft, Allgemeingültiges zu verkünden,
als Mindestes verlangen dürfen, daß sich derselbe den elementarsten
Gesetzen des Verstehens fügt."
Gotthard Günther 1940/41 Logistik und Transzendentallogik,
S. 135
Zusammenfassung - Abstract
- Summary
Die Lehre von "der" Dialektik hat einige Hauptschwächen: (1) Es
gibt keine klaren Definitionen, die manche für unnötig bzw. für
nicht erbringbar halten. (2) Man unterscheidet die wichtigen ontologischen
Bereiche und Ebenen nicht oder nicht sorgfältig genug. (3) Es fehlt
an klaren Referenzierungen, detaillierten Beispielen und Operationalisierungen.
(4) es wird viel behauptet, gemeint, statt wirklich zu zeigen, wie es sich
wissenschaftlich gehört. (5) Bei den verschiedenen Theorien ist meist
unklar, was Postulate (Axiome), (prüfbare) Aussagen oder Hypothesen
sind. Das gilt von den Anfängen im Altertum bis heute. Und deshalb
kann man auch von einer wissenschaftlichen Dialektik bis heute kaum sprechen.
Die meisten Dialektiker verstehen nichts vom wissenschaftlichen Arbeiten.
Dialektik ist ein vieldeutiges Homonym,
das wissenschaftlich in dieser unklaren Vielfalt so weitgehend unbrauchbar
ist. Die grundlegenden und elementaren terminologischen und ontologischen
Probleme sind ungeklärt und werden in der Literatur zur Dialektik
bunt durcheinander gewürfelt. Dem versucht diese Seite abzuhelfen.
Man muss scharf zwischen den verschiedenen (ontologischen) Welten trennen:
Geht es z.B. um einen Gegensatz im Denken, in der Sprache oder in der Wirklichkeit
innerhalb
der jeweiligen Welt oder zwischen den (verschiedenen ontologischen)
Welten. Es ist daher sehr wichtig und nützlich, klare Referenzwelten
streng zu unterscheiden. Das ist nicht ganz einfach, weil in der sprachlichen
Kommunikation die Denk-, Wahrnehmungs-, Wirklichkeits-, Norm-, Wunsch-
und Phantasiewelten nebeneinander gebraucht oder ineinander vermengt werden.
Was in der Sprache z.B. als Gegensatz erscheint, z.B. schwarz und weiß,
oben und unten, stark und schwach muß in der objektiven Wirklichkeit,
in der Natur kein Gegensatz sein. Unterscheidet sich z.B. das Selbstbild
vom Selbstwunschbild, kann man von Unterschied, Gegensatz oder Widerspruch
sprechen. Das eben ist zu klären. Wer in der Dialektikforschung weiter
kommen will, braucht äußerste sprachkritische Disziplin und
scharfe Unterscheidungen bei den Grundbegriffen und ihren Referenzierungen
in den verschiedenen Welten (ontologischen Bereichen). Bei wichtigen Grundlagenfragen
sollte immer auch das dialektische Bezugssystem angegeben werden, Auch
hierzu soll diese Seite beitragen. Wie weit das dieser Seite gelingt, mag
die LeserIn selbst beurteilen. Viele Probleme werden lösbar, wenn
man konkret und operational wird und sich vom allgemein-abstrakten, meist
unklaren Reden verabschiedet (>sch^3-Syndrom).
Einstieg in das Begriffsfeld Dialektik
Die klassische Dialektik ohne metaphysisch idealistische Vorannahmen,
z.B. von Linehan
in der Psychotherapie vertreten, geht davon aus, dass jeder Sachverhalt
oder Vorgang (These) seinen Gegensatz (Antithese) enthält
und nach einer Aufhebung in der Synthese strebt. Die Auseinandersetzung
zwischen These und Antithese führt zu einer ständigen Bewegung,
Veränderung und Entwicklung. In der Synthese sollen Elemente der These
und Antithese enthalten sein und die Synthese soll ein "Höheres" (DialMathoe),
(DialMatEntw) hervorbringen. Das
setzt sich unendlich fort, findet überall und ständig statt.
Konstanz, Stabilität, Ruhe gibt es bei genauer Betrachtung nicht;
stattdessen gilt das alte Heraklitsche Wort: alles fließt.
Betrachtet man ein Phänomen aus der Chemie,
H2O, so hat die Verbindung, das Molekül H2O
andere Eigenschaften als H oder O. Aus der Verbindung der beiden Elemente
Wasserstoff und Sauerstoff ist etwas Neues hervorgegangen, was man ohne
Zweifel als Synthese sehen und bezeichnen kann. Aber das Phänomen
greift nicht als dialektisches Beispiel, weil H und O keine
Gegensätze sind und keinen Widerspruch bilden. H und O sind anders,
verschieden, aber keine Gegensätze. Daraus folgt, dass es neben der
dialektischen Synthese auch noch andere Synthesen gibt. Der dialektische
Widerspruch bedeutet in einer ersten Intuition das Konträre (Gegensätzliches),
nicht das Kontradiktorische (Andere). Der kontradiktorische Widerspruch
beruht aussagenlogisch auf einer Negation. Gegensatz hat in der Aussagenlogik
kein Modell, aber in der Prädikatenlogik mit dem Konträren.
Leben und Tod sind im Sprachgebrauch konträre
Gegensätze. Irgendwann geht das Leben in den Tod über. Leben
und Tod entsprechen der Polarität, sind Anfang und Ende eines Prozesses.
Das Leben bringt den Tod aus sich heraus hervor: lebenswichtige Prozesse
funktionieren nicht mehr. So hätten wir zwar einen echten, sogar polaren,
Gegensatz, aber nicht die Gleichzeitigkeit. Im Allgemeinen und unter Normalbedingungen
dauert der Tod Jahrzehnte. Allerdings sterben täglich viele Milliarden
Zellen in unserem Körper [Quelle Zellsterben].
Doch was wäre dann die Synthese nach dem Tod? These (Leben) und Antithese
(Tod) sollen ja etwas "Höheres" hervorbringen? Es ist zwar ziemlich
wahrscheinlich, dass aus dem Zerfall des Menschen wieder etwas Neues entsteht.
Falls, ist es aber doch sehr fraglich, ob es etwas "Höheres" sein
wird. Im Falle der absterbenden Zelle wird nichts "Höheres", sondern
ein Ersatz neuer Zellen gebildet. Diese einführenden Überlegungen
zu Dialektik bekräftigen das vordem kritisch Gesagte.
_
Dialektik in der Sprachlehre
- Dialektik Herkunft nach Seiffert (1983)
- (Rhetorik) Kunst der Gesprächsführung; Fähigkeit, den Diskussionspartner in Rede und Gegenrede zu überzeugen
- a.. (Philosophie) philosophische Methode, die die Position, von der sie ausgeht, durch gegensätzliche Behauptungen infrage stellt und in der Synthese beider Positionen eine Erkenntnis höherer Art zu gewinnen sucht
- (bildungssprachlich) (einer Sache innewohnende) Gegensätzlichkeit."
A. DIALEKTIK ALS „INTERPRETIERENDER DIALOG“
Wenn wir verstehen wollen, was „Dialektik“ ist, so gehen wir am besten
von der Grundbedeutung aus.
„Dialektik“ kommt vom griechischen dialegesthai = sich unterreden.
Mit demselben Wort hängt auch „Dialog“ zusammen: „Dialektik“ kann
man also geradezu erklären als „Kunst, einen Dialog zu führen“.
Hierdurch haben wir bereits eine wichtige Begriffsbestimmung gewonnen:
„Dialektik“ hat es mit der menschlichen Rede zu tun, sie scheint eine Erscheinung
der Sprache zu sein. In unserer Terminologie können wir also auch
sagen: „Dialektik“ hat es zunächst mit Aussagen zu tun, und - vorsichtig
ausgedrückt - nicht mit möglichen Gegenständen solcher Aussagen.
..."
Dialektik imDuden (Online)
Bedeutungsübersicht?
b. (Philosophie) (im dialektischen Materialismus) die innere Gesetzmäßigkeit der ökonomischen Entwicklung in realen Gegensätzen
Dialektik im Sprachbrockhaus
(1956,
7. A)
die Dia|lektik, 1) Kunst der (wissenschaftl.) Gesprächsführung
(nach Plato). 2) der Weg des Denkens in bedeutungsentgegengesetzten Begriffen
(nach Hegel). 3) die Entwicklung der Wirklichkeit in realen Gegensätzen
(dialektischer Materialismus, nach Karl Marx). 4) U Spitzfindigkeit. EIGW.
: dialektisch. [griech. 'Unterredungskunst']"
Anmerkung "U" := Umgangssprache.
- Dialektik im Schüler-Duden Das Wissen
von A-Z
"Dialektik [gr.] w, bei den alten griechischen Philosophen war D. die Kunst, im Gespräch durch Rede u. Gegenrede die Wahrheit zu finden. Seither versteht man darunter auch eine spitzfindige Art des Argumentierens. - Bei Hegel u. Marx ist D. ein grundlegendes Prinzip: Jede Entwicklung vollzieht sich in drei Schritten: in Satz (These), Gegensatz (Antithese) u. Zusammenfassung von Satz u. Gegensatz zu einer höheren Einheit (Synthese)." Quelle: Preuß (1980, Hrsg.).
Grundprobleme Ontologische Bereiche / Ebene und Referenzwelten
Ontologische Bereiche / Ebenen und Sachverhalts-Vergleichs-Logik
Es empfiehlt sich - obwohl es meist nicht gemacht wird - zu Beginn
der Untersuchungen der Begriffsbedeutungen von Dialektik Überlegungen
anzustellen, auf welcher ontologischen Ebene oder zwischen welchen ontologischen
Ebenen oder Referenzwelten die Untersuchungen und Vergleiche
durchgeführt und erfasst werden sollen. Hierzu müssen dann Festlegungen
getroffen werden, welche Begriffe zu welcher ontologischen Ebene gehören.
Die meisten Sachverhalte können sind in mehreren ontologischen Bereichen
repräsentiert: Der Sachverhalt Baum kann z.B. als ein konkreter,
realer Baum oder als allgemeiner Baum gedacht, wahrgenommen, phantasiert,
erwünscht, normativ bewertet oder sprachlich kommuniziert werden.
Denke ich, der Baum sollte verschwinden, weil er zu viel Licht wegnimmt,
so gibt es einen Widerspruch zwischen der realen Wirklichkeit (steht da
und nimmt Licht weg) und meiner normativen Welt (soll verschwinden). Untersucht
man Widersprüche, so ist es besonders wichtig die Referenzwelt anzugeben.
Schwarz und weiß sind im Denken und in der Sprache Gegensätze,
aber es ist sehr fraglich, ob sie das in der Natur, der realen Wirklichkeit
auch sind.
Außerdem muss scharf
zwischen Objekt- und Metasprache unterschieden werden. Sprechen wir über
die objektive Welt, z.B. in der Weise die Erde dreht sich um die Sonne,
so ist das eine objektsprachliche Behauptung über ein Geschehen der
in objektiven Welt. Sprechen wir über die Aussage "die Erde dreht
sich um die Sonne", so sprechen wir nicht über eine objektsprachliche
Behauptung der objektiven Welt, sondern über eine Aussage einer Behauptung
über die objektsprachliche Welt. Dieser Aussage können wir den
empirischen Wahrheitswert wahr oder falsch zuordnen.
Referenzwelten RWindex
Bringt man die ontologischen Ebenen oder Referenzwelten durcheinander,
kann man sich schnell verstricken und verheddern. Ich führe folgende
ontologische Ebenen ein, um eindeutig kennzeichnen zu können, in welchen
Referenzwelten wir uns befinden:
- Referenzwelten RWindex der
ontologischen Bereiche OB.
- RWO Objektive Welt (Natur, naturwissenschaftliche Welt) heiße die Referenz-Welt, die es auch gibt, wenn man sich die Menschen hinwegdenkt, wenn auch nicht für immer und ewig, sondern zeitlich begrenzt.
- RWM Welt der Menschen, Individuen, Gruppen, Gemeinschaften, Gesellschaften und Staaten. Auch der Mensch gehört mit zur Natur und kann naturwissenschaftlich betrachtet werden.
- RWME Erlebens-Welt heißt die Referenz-Welt, die der Mensch erlebt. RWME ist Teil der RWM. RWME und RWMW können sich überschneiden, wobei auch nichtbewusste Wahrnehmungen das Erleben beeinflussen können.
- RWMW Wahrnehmungs- oder Wirklichkeitswelt heißt die Referenz-Welt, die der Mensch mit seinem Wahrnehmungs- und Verarbeitungsapparat erfährt und konstruiert. RWMW ist Teil der RWM.
- RWMD Denk- und Begriffswelt, ein Teil der Erlebens-Welt, heißt die Referenz-Welt, die der Mensch mit seinen Begriffsbildungen und ihren Beziehungen konstruiert und erzeugt. Die Denk- Begriffswelt kann als die Sprache des Geistes angesehen werden kann. RWMD ist Teil der RWM. und RWME.
- RWMP Phantasiewelt.
- RWMN Normwelt, die Welt der Gebote, Verbote und des Erlaubten.
- RWMB Wunsch- und Bedürfniswelt, die Welt der Wünsche und Bedürfnisse
- RWMS Sprachliche Welt heißt die Referenz-Welt, die der Mensch in seiner Kommunikationssprache beschreiben kann. RWMS ist Teil der RWM.
- RWMV Verhalten, handeln, tun.
- RWm Möglichkeitswelt, Welt der Wahrscheinlichkeiten.
- RWonS Referenzwelt ohne nähere Spezifikation: keine Referenzwelt angegeben, Bezugnahme ohne nähere Spezifikation. Der Normalfall beim Sprechen oder schreiben.
Fragen wir also nach der Bedeutung von Dialektik, empfiehlt es sich,
kurz innezuhalten und sich zu vergegenwärtigen, für welche Referenz-Welt(en)
(O, M, ME, MW, MD, MP, MB, MN, MS, MV, m, onS) wir das wissen wollen? Das
setzt ein gewisses Abstraktionsvermögen und Denken in Modellen voraus.
Definitionsprobleme > Definieren und Definition.
Man kann beliebig definieren, nur sollte man sagen, auf welche ontologische Ebene sich die Definition bezieht und welches Bezugssystem man zugrunde legt. "Widerspruch" ist gewöhnlich ein Wortgebrauch der Denk-, Begriffs- und Sprachebene. Der dialektische Materialismus bezieht seine Theorie und seine Behauptungen auf die objektive Wirklichkeit. Dialektik (DialDMat) beherrscht die Naturvorgänge. Von daher ist die Formulierung "Widersprüche in der Natur" erklärungs- und belegungsbedürftig. Wohl ahnt man gewöhnlich, was gemeint ist, aber für die Wissenschaft genügen Ahnungen nicht. Hier muss man genau sein.
_
Definition Dialektik
Es empfiehlt sich bei den Bedeutungsanalysen, sofern möglich, die verschiedenen ontologischen Bereiche / Ebenen oder Referenzwelten zu unterscheiden, sonst gerät man u.U. in Teufels Küche.
Der Begriff Dialektik ist eine Schöpfung und Konstruktion des menschliches Geistes und wird in vielen Bedeutungen und Varianten (> Signierungen nach Auswertung der Materialien) seit tausenden von Jahren gebraucht. Es ist daher erforderlich, dass Nutzer dieses Wortes angeben, in welcher Bedeutung sie es jeweils verstanden wissen wollen. Die Auswertung ergab mehrere Hauptbedeutungsfelder:
- Dialektik als nicht näher spezifizierter Begriff (DialonS).
- Dialektik als nicht näher spezifizierter bildungssprachlicher Begriff (DialBild). Von verschiedenen Seiten sehen, sowohl als auch. Siehe bitte oben Duden, Sprachbrockhaus und unten methodische Grundhaltung.
- Dialektik als Entwicklungstheorie (DialEntwT), traditionell triadische Entwicklung aus These, Antithese zur Synthese verstanden (Aber > Winter in (DialHeg)), wobei "These", "Antithese" und "Synthese" keine (Entwicklungs-) Sachverhalte der Natur oder der Gesellschaft wiedergeben, sondern zunächst sprachliche Ausdrücke sind, die implizit auf entsprechende Sachverhalte verweisen und sie behaupten (was zu zeigen wäre, und zwar richtig, wie sich das in einer Wissenschaft gehört).
- Metaphysische Auffassung Hegels (DialHeg): zu jedem Sachverhalt gehört seine Negation und jeder Sachverhalt birgt seine Negativität. Die Wechselwirkungen zwischen Positivität und Negativität bringen in einem unendlichen Prozeß ständige Bewegung, Entwicklung und Veränderung hervor. Philosophisch idealistische Position: Identifikation von Sein und Geist, das Sein ist eine Schöpfung des Geistes.
- Philosophisch materialistische Position: Die Materie bringt den Geist hervor mit der spezifisch dialektisch materialistischen Variante (Marx, Engels, Lenin) (DialDMat).
- Empirisch-wissenschaftliche-Entwicklungs-Theorie (DialEWET): (1) Entwicklung als Folge der Wechselwirkungen von Kräften und Energien. (2) Entwicklung als Ausdruck von Reifung und Wachstum. (3) Entwicklung als Folge ständiger Auseinandersetzung zwischen Anlage, Umwelt und Entwicklungsstand. > Piaget, Flammer unterscheidet 7 Faktoren.
- Dialektik als methodische Grundhaltung (DialMeth) und Argumentationsmethode (DialArgL), als scharfsinnige ganzheitliche Betrachtung, die "alle" Aspekte eines Sachverhalts für und wider, pro und contra, zu berücksichtigen sucht, ohne die metaphysischen (Hegel) oder ideologischen (DialMat) Vorannahmen. So gesehen kann Dialektik als ein spezifisch ganzheitlich methodisches Denken angesehen werden, also als eine grundsätzlich wissenschaftlich zu begrüßende Haltung.
- Dialektische Logik im engeren formallogischen Sinne (DialFLog) > Definition Dialektische Logik. Bislang nicht entwickelt > Dialektische Logik im engeren logischen Sinne.
- Anderes, sonstiges dialektisches System (DialAnd)
Untersuchungsmethodik zur dialektischen Analyse von Sachverhalten
Bezugs- und Rahmenparameter: dialektisches Bezugssystem
und ontologische Bereiche
Zur Beurteilung ist das dialektische Bezugssystem DBS:
(DialonS), (DialBild),
(DialEntwT), (DialHeg),
(DialDMat), (DialEWET),
(DialMeth), (DialArgL),
(DialAnd) und der ontologische
Bereich OB: (O, M, ME, MW, MD, MP, MB, MN, MS, MV, m, onS)
wichtig, worüber aber oft keine oder keine hinreichend sicheren oder
genauen Informationen vorliegen. Für die praktische Analyse genügen
(zunächst) die sieben dialektischen Systeme:
- Dialektik als nicht näher spezifizierter Begriff (DialonS).
- Dialektik als nicht näher spezifizierter bildungssprachlicher Begriff (DialBild).
- Dialektik als Entwicklungstheorie(DialEntwT) ohne nähere Spezifikation.
- Metaphysische Auffassung Hegels (DialHeg).
- Philosophisch materialistische Position (DialDMat).
- Empirisch-wissenschaftliche-Entwicklungs-Theorie (DialEWET).
- Dialektik als methodische Grundhaltung (DialMeth) und Argumentationsmethode (DialArgL).
- Anderes, sonstiges dialektisches System (DialAnd)
Systematische Tabelle dialektischer
Kategorien und ontologischer Bereiche
Die systematische Tabelle soll bei den Differenzierungen helfen und
für Klarheit sorgen, über was nun genau Aussagen in welchem ontologischen
Bereich (OB) aufgrund welchen dialektischen Bezugssystems (DBS)
gemacht werden sollen.
Z.B. kann man ein Atom in der Wirklichkeit ("objektiven
Realität") als Antithese interpretieren und danach fragen, was die
zugehörige These sein soll und was sich für die Synthese ergibt.
Man kann fragen, wie sich ein Atom in der Wirklichkeit ("objektiven Realität")
entwickelt und verändert? Man kann fragen, wie ein Atom wahrgenommen
(MW), gedacht (MD) oder sprachlich (MS) ausgedrückt wird.
es fehlt: M
| Sachverhalt S
Kateg/Ontol |
Wirklichk. |
Mensch |
Erleben |
Wahrnehm. |
Denken. |
Phantasie. |
WuBedürf. |
Norm. |
Sprache. |
tun |
|
|
| AntitheseDBS |
|
|||||||||||
| BewegungDBS | ||||||||||||
| BewusstseinDBS | ||||||||||||
| DingDBS | ||||||||||||
| EigenschaftenDBS | ||||||||||||
| Einheit d.GDBS | ||||||||||||
| EntwicklungDBS | ||||||||||||
| GegensatzDBS | ||||||||||||
| GesellschaftDBS | ||||||||||||
| GesetzDBS | ||||||||||||
| IdentitätDBS | ||||||||||||
| KomplementaritätDBS | ||||||||||||
| MaterieDBS | ||||||||||||
| Mat.Einh.d.WeltDBS | ||||||||||||
| NegationDBS | ||||||||||||
| Neg. d.NegationDBS | ||||||||||||
| PolaritätDBS | ||||||||||||
| QualitätDBS | ||||||||||||
| QuantitätDBS | ||||||||||||
| Raum & ZeitDBS | ||||||||||||
| RelationDBS | ||||||||||||
| RuheDBS | ||||||||||||
| SachverhaltDBS | ||||||||||||
| SprungDBS | ||||||||||||
| SyntheseDBS | ||||||||||||
| TheseDBS | ||||||||||||
| UmschlagenDBS | ||||||||||||
| UnterschiedDBS | ||||||||||||
| VeränderungDBS | ||||||||||||
| WandelDBS | ||||||||||||
| WesenDBS | ||||||||||||
| WiderspiegelungDBS | ||||||||||||
| WiderspruchDBS | ||||||||||||
| WissenschaftDBS |
Freie Darstellung der zur Analyse dialektischer Kategorien nach dialektischen Bezugssystemen und ontologischen Bereichen
Nach dieser grundlegenden Vorarbeit können wir uns an die Klärung der dialektischen Kategorien der verschiedenen dialektischen Systeme begeben. Zur Beurteilung ist für jede dialektische Kategorie das Bezugssystem DBS: (DialonS), (DialBild), (DialEntwT), (DialHeg), (DialDMat), (DialEWET), (DialMeth), (DialArgL), (DialAnd) anzugeben, z.B.:
- Anders, Anderes: (ODBS, MDBS, MEDBS, MWDBS, MDDBS, MPDBS, MBDBS, MNDBS, MSDBS, MVDBS, mDBS, onSDBS)
- Unterschied: (ODBS, MDBS, MEDBS, MWDBS, MDDBS, MPDBS, MBDBS, MNDBS, MSDBS, MVDBS, mDBS, onS)
- Gegensatz, dialektischer: (ODBS, MDBS, MEDBS, MWDBS, MDDBS, MPDBS, MBDBS, MNDBS, MSDBS, MVDBS, mDBS, onSDBS)
- Gegenteil: (ODBS, MDBS, MEDBS, MWDBS, MDDBS, MPDBS, MBDBS, MNDBS, MSDBS, MVDBS, mDBS, onSDBS)
- Polarität: (ODBS, MDBS, MEDBS, MWDBS, MDDBS, MPDBS, MBDBS, MNDBS, MSDBS, MVDBS, mDBS, onSDBS)
- Negation, dialektische: (ODBS, MDBS, MEDBS, MWDBS, MDDBS, MPDBS, MBDBS, MNDBS, MSDBS, MVDBS, mDBS, onSDBS)
- Negation der Negation: (ODBS, MDBS, MEDBS, MWDBS, MDDBS, MPDBS, MBDBS, MNDBS, MSDBS, MVDBS, mDBS, onSDBS)
- Widerspruch, dialektischer: (ODBS, MDBS, MEDBS, MWDBS, MDDBS, MPDBS, MBDBS, MNDBS, MSDBS, MVDBS, mDBS, onSDBS)
- Widerspruch, konträrer (ODBS, MDBS, MEDBS, MWDBS, MDDBS, MPDBS, MBDBS, MNDBS, MSDBS, MVDBS, mDBS, onSDBS)
- Widerspruch, kontradiktorischer (ODBS, MDBS, MEDBS, MWDBS, MDDBS, MPDBS, MBDBS, MNDBS, MSDBS, MVDBS, mDBS, onSDBS)
- Ähnlichkeit und Unähnlichkeit: (ODBS, MDBS, MEDBS, MWDBS, MDDBS, MPDBS, MBDBS, MNDBS, MSDBS, MVDBS, mDBS, onSDBS)
- Entwicklung: (ODBS, MDBS, MEDBS, MWDBS, MDDBS, MPDBS, MBDBS, MNDBS, MSDBS, MVDBS, mDBS, onSDBS)
- Dialektische Entwicklung / Dialektischer Prozess: (ODBS, MDBS, MEDBS, MWDBS, MDDBS, MPDBS, MBDBS, MNDBS, MSDBS, MVDBS, mDBS, onSDBS)
Untersuchung zur Dialektischen Begriffsbildung
Bei den Klassikern einer reinen Dialektik, also bei Hegel und den dialektischen Materialisten (Marx, Engels, Lenin), entwickeln sich die Sachverhalte aus These und Antithese zur Synthese hin, wobei jede Synthese wiederum zu einer These höherer Stufe wird usw. Das kann man sich in einer Art dialektischen Begriffsbaum vorstellen. Nach dem Weltbild des DiaMat findet diese Entwicklung der Sachverhalte in der Wirklichkeit, der objektiven Realität statt, also im ontologischen Bereich O. Die begriffliche Seite im Bereich MD und in der Sprache MS "spiegelt" sich diese Entwicklung wider.
Z.B.: Man kann sagen: der Begriff der Ladung enthält die Gegensätze "positive" und "negative" Ladung. "Positive" und "negative" Ladung schließen sich aus und sind Gegensätze. Als konkretes Beispiel in der Natur, kann man als Synthese ein Atom ansehen. Es enthält das "positiv" geladene Proton (These) und die "negativ" geladenen Elektronen (Antithese). Nach der klassischen Dialektik müßte man aber auch das Proton als eine aus These und Antithese hervorgegangene Synthese auffassen. Das allgemeine dialektische Begriffsmodell wäre demnach ein Begriffsbaummodell etwa folgender Art:
Graph
dialektischer Begriffsbaum
Andere wichtige dialektische Hilfs- und Unterscheidungsbegriffe
Anders/ Anderes, Gegenteil, Gegensatz, Negation (Verneinung), Polarität, Unterschied, Widerspruch
Grundsätzlich ist hier der ontologische Bereich (Ebene) zu beachten. Was im Denken oder in der Sprache als Widerspruch erscheint, muss in der realen Wirklichkeit keiner sein. Andererseits gibt es auch Widersprüche zwischen verschiedenen Ebenen, wenn etwa die Verkündung von Normen nicht mit der Lebenspraxis der Verkünder übereinstimmt oder ihr direkt widerspricht, was ständig auf allen Ebenen vorkommt (viele Beispiele bei Mary 2009)
Die Verneinung / Negation und das Wörtchen nicht.
Die Seite lernort-mint (Abruf
17.11.19):
"... Im Prinzip gibt es im Deutschen fünf Möglichkeiten der
Verneinung:
1. Verneinung mit Negationswörtern wie "nein, nicht, kein, nichts,
nie, niemals, niemand, nirgends"
2. Durch Verwendung der Präfixe "un-, a-, an-, non-, miss-, ab-,
de-, in-, im-"
3. Durch Verwendung der Suffixe "-frei, -leer, -los"
4. Durch Verwendung von Verben mit negierender Bedeutung wie z.B. "unterlassen,
untersagen, verbieten, vermeiden"
5. Durch Konjunktionen mit negierender Bedeutung wie "ohne dass, anstatt
dass""
Verneinungen oder Negationen werden auch als Widerspruch bezeichnet.
Sprachgebrauch Widerspruch und Verneinung > Signierungen Widerspruch
Kontradiktorischer Widerspruch.
Wird eine Aussage A verneint, indem gesagt wird, A ist nicht der Fall
oder A ist falsch, spricht man in der Logik und Methodologie von einem
kontradiktorischen Widerspruch, der im allgemeinen keinen
Gegensatz darstellt.
Begriffe, kontradiktorische
[contradictoriae lat.]: unvereinbare Begriffe, die einander ausschließen,
zwischen denen es keinen mittleren, dritten Zwischenbegriff gibt.
Die Begriffe weiß und nicht weiß
negieren
einander z. B. völlig. Man kann sie nicht gleichzeitig in ein und
derselben Beziehung auf ein und denselben Gegenstand anwenden, auch die
konträren
Begriffe weiß und schwarz kann man nicht auf ein und denselben
Gegenstand gleichzeitig und in ein und derselben Beziehung anwenden (>
Begriffe, konträre). Aber von konträren Begriffen unterscheiden
sich k. B. dadurch, daß zwischen konträren Begriffen ein Mittelbegriff,
ein dritter, möglich ist, während es zwischen kontradiktorische
Begriffe keinen Mittelbegriff, keinen dritten gibt. Welche Farbe wir auch
in der Tat wählen z. B. Blau oder Gelb, keine kann zum Mittelbegriff
werden, weil sie in den Umfang des Begriffes
nichtweiß
eingeht
(Abb.).
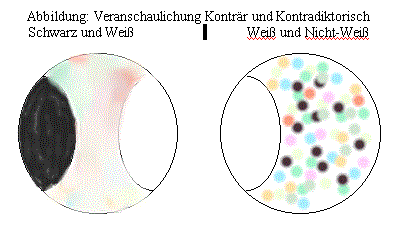 |
 |
Mit kontradiktorischen Begriffen hat man es in jeder
Wissenschaft zu tun: in der Mathematik z.B. sind solche Begriffspaare:
gleich
- nicht gleich, kommensurabel - nicht kommensurabel, spitz - nicht spitz,
gerade - nicht gerade, entsprechende Paare in der Chemie sind z. B.
organisch
- anorganisch, wäßrige Lösung - nicht wäßrige
Lösung, gesättigte Lösung - ungesättigte Lösung.
Quelle:
Aus dem Wörterbuch der Logik (Kondakow).
_
Kontraerer Widerspruch.
"Begriffe, konträre [contrariae
lat.]: unvereinbare Begriffe, zwischen denen ein Drittes, ein Mittleres
möglich ist, und die sich nicht nur gegenseitig negieren, sondern
auch etwa Positives für das im diskordanten [uneinigen] Begriff verneinte
enthalten, z. B. die Paare tapfer - feige, schwer - leicht, warm - kalt.
Jeder Begriff des Paares weiß - schwarz
geht in den Umfang des subordinierenden [= unterordnenden; RS] Begriffs
Farbe ein, füllt ihn aber nicht voll aus (Abb.).
Operationen mit k. B. werden in Übereinstimmung
mit den Forderungen des Satzes vom Widerspruch vorgenommen, aus dem sich
folgende Regeln ableiten lassen:
I. Nicht beide k. B. können, über
ein und dieselbe Klasse von Gegenständen genommen, in ein und derselben
Zeit und in ein und derselben Beziehung
gleichzeitig wahr sein.
Wurde z.B. festgestellt, daß das eine Metall leicht ist, muß
der k. B. schwer in bezug auf dieses Metall falsch sein.
II. Beide k.B. können sich, über
ein und dieselbe Klasse von Gegenständen genommen, zu ein und derselben
Zeit und in ein und derselben Beziehung als falsch erweisen. Dies
erklärt sich daraus, daß zwischen k. B. ein Drittes, Mittleres
möglich ist. Die Begriffe heller Stern und
schwacher
Stern sind z.B. k. B. Daraus folgt, daß zwischen ihnen ein Drittes
möglich ist, z. B. die Sonne, die die Astronomen als einen der Leuchtkraft
nach mittleren Stern klassifizieren, der nicht sehr hell, aber auch nicht
sehr schwach ist.
III. Aus der Wahrheit einer Aussage für
den einen von zwei k. B. folgt mit Notwendigkeit die Falschheit
der entsprechenden Aussage für den anderen. Wenn wahr ist,
daß durch eine Leitung Schwachstrom fließt, dann muß
die konträre Behauptung, daß durch sie Starkstrom fließt,
falsch sein.
IV. Aus der Falschheit einer Aussage über
den einen von zwei k. B. folgt logisch
weder die Wahrheit noch die
Falschheit der entsprechenden Aussage für den anderen.
Ist z. B. die Behauptung »dieses Dreieck ist spitzwinklig«
falsch, so kann man über die konträre Behauptung »dieses
Dreieck ist stumpfwinklig« nichts Bestimmtes sagen, weil es zwei
Möglichkeiten gibt: das Dreieck kann stumpfwinklig sein, es kann aber
auch rechtwinklig sein. Die angeführten Regeln gelten für beliebige
k. B., konträre Begriffe unabhängig von ihrem konkreten Inhalt.
Aus der Physik genommene k. B., z. B.
kalt - warm, weiß - schwarz,
aus der Mathematik gewählte wie groß - klein, gekrümmt
- gerade oder aus jedem beliebigen Wissensbereich herangezogene k.
B. sind in gleichem Maße dem Satz vom Widerspruch untergeordnet."
Quelle:
Aus dem Wörterbuch der Logik (Kondakow).
_
Scheinbarer oder unklarer Widerspruch.
Die meisten ergeben sich aus dem Sprachgebrauch. Sehr oft ergeben sich
bei genauerer Betrachtung und Analyse, dass, was im Sprachgebrauch als
Widerspruch erscheint und auch so erlebt wird, gar keiner ist, sondern
nur Anderes oder einen Unterschied bedeutet.
Sprachgebrauch zu Gegensaetzen / Gegenteilen - Kandidaten oder Beispiele
Ausführliche eigene Seite zum Gegensatz > Signierungen Gegensatz. > Querverweis Gegensatzsystem von Guardini.
Duden Gegensatz, der (Abruf
6.1.19)
"Bedeutungen (5)
- Verhältnis äußerster Verschiedenheit
- etwas (z. B. ein Begriff, eine Eigenschaft) oder jemand, das bzw. der etwas, jemand anderem völlig entgegengesetzt ist
- Widerspruch
- Meinungsverschiedenheiten, Differenzen
- (Musik) erster Kontrapunkt zum Thema einer Fuge
- Andersartigkeit, Gegeneinander, Gegensätzlichkeit, Kluft, Kontrast, Unterschied, Unterschiedlichkeit, Verschiedenartigkeit, Verschiedenheit, Widerstreit; (bildungssprachlich) Antagonismus, Divergenz, Heterogenität, Inhomogenität, Polarität; (Jargon) Schere; (veraltet) Kontrarietät; (Philosophie) Widerspruch; (Völkerkunde, Soziologie, Philosophie) Alienität
- Gegenbegriff, Gegenbehauptung, Gegensatzwort, Gegenstück, Gegenteil[wort], Gegenthese, Gegenwort; (bildungssprachlich) Antithese; (Sprachwissenschaft) Antonym, Oppositionswort
- Widerspruch, Widersprüchlichkeit, Zwiespalt; (bildungssprachlich) Diskrepanz; (Jargon) Schere; (Philosophie) Kontradiktion, Repugnanz"
Auch wenn unser Denken und Sprachgebrauch von Gegensätzen spricht, muss das nicht bedeuten, dass es sich auch "tatsächlich" um Gegensätze und nicht um bloße Unterschiede oder Andersheiten handelt. Hier ist also Vorsicht geboten. Anmerkung: Die Beziehung zwischen zwischen Gegensatz und Gegenteil ist bislang noch nicht ausreichend geklärt. Sie werden einstweilen im wesentlichen Inhalt überwiegend bedeutungsähnlich verwendet, wenn nicht auf klare Unterscheidungskriterien zurückgegriffen werden kann. Die Richtigkeit der Verwendung, der Gebrauch, hängt natürlich von der Definition oder Charakterisierung ab, was Gegensatz bedeuten soll. Der Begriff Gegensatz ist hauptsächlich eine Schöpfung des menschlichen Denkens und der Sprache. Im Ungefähren und im Alltag gibt es selten Probleme; da unterscheidet man gewöhnlich nicht zwischen Gegensatz und Gegenteil. Im Themenfeld der Dialektik stellt sich aber die Bedeutungsfrage sehr streng und scharf, wenn man untersuchen will, was an der Gegensatztheorie der DialektikerInnen dran ist.
Unterscheidungskriterien
Gegensatz und Gegenteil
Viele vermeintliche Gegensätze, die im Sprachgebrauch so genannt
werden, sind es bei genauerer Betrachtung nicht. Die begriffliche Abgrenzung
zwischen Gegensatz und Gegentel ist nicht einfach.
Betrachten wir einige Beispiele,
die nach den Metakriterien diskutiert werden:
GSac-re Gegensatz actio und reactio, Kraft
und Gegenkraft
GSan-un Gegensatz angenehm-unangenehm
GSgr-kl Gegensatz groß-klein.
Groß und klein werden von vielen Menschen im Sprachgebrauch als Gegensatz
erlebt.
GShe-du Gegensatz hell-dunkel. Hell und dunkel
werden von vielen Menschen im Sprachgebrauch als Gegensatz erlebt.
GSSei-Ni Gegensatz Sein-Nichts.
GSst-la "Gegensatzes von Stadt und
Land" (Engels, MEW Bd. 20, Vorwort, S. XI )
Metakriterien zur Diagnose von Gegensätzen
Wenn eine Definition (noch) nicht möglich sein sollte, so kann
man doch immer die Methode Beispiele und Gegenbeispiele für die Prädikationen
anwenden, um näherungsweise Klarheit zu schaffen.
GSKDud
Gegensatzkriterium des Dudens "Verhältnis äußerster Verschiedenheit."
Bei Eigenschaftspaaren prüfen, ob eine Steigerung darüber oder
darunter formulierbar ist. Äußerste Verschiedenheit kann es
nur zwischen den höchsten Steigerungsgraden geben.
GSKNkd
Verneint man A, entsteht nicht das Gegenteil von A, sondern alles andere,
Nicht-A. Beim Paar gut und böse ergibt die Verneinung von gut nicht
böse, sondern nicht gut (oder umgekehrt). Mit der Verneinung lässt
sich "böse" nicht gewinnen. Die Verneinungsprüfung spricht daher
für Gegensatz.
GSKanab
Gegensatzkriterium in der näheren Umgebung wirken bei beiden Objekten
Anziehungs- oder Abstossungskräfte
GSKkrw
Gegensatzkriterium es wirkt eine Kraft eines Objektes auf ein anderes.
GSKverb
Gegensatzkriterium verbunden sein, damit eine Kraft wirken kann. Aber was
heißt verbunden?
GSKebp Gegensatzkriterium
eindimensionale oder bipolare Dimension oder Skala. Farben sind in einem
Spektrum angeordnet.
GSKbf
Gegensatzkriterium Konträre Urteile können beide falsch sein,
kontradiktorische nicht.
GSKsprg Im Sprachgebrauch ist
Gegensatz dokumentiert.
GSKww Wechselwirkung.
GSKsilb Die Vorsilben
"a", "dis", "im", "in", "mis", "un" oder "a" stehen für eine Negation
und drücken daher meist das Gegenteil und keinen Gegensatz aus.
GSKerg Ersetzbarkeit durch
Gegenteil. Wenn bei einem Gegensatzpaar das Wort "Gegensatz" ohne Sinneinbuße
durch "Gegenteil" ersetzt werden kann, dann spricht das gegen den Gebrauch
von Gegensatz. Z.B. a) Kalt und warm als Gegensätze ersetzt durch
b) kalt und warm sind das Gegenteil. b) hört sich holpriger, nicht
so gut wie a) an.
Diskussion der Beispiele nach den Meta-Kriterien
GSac-re Gegensatz actio und reactio, Kraft und Gegenkraft. Das dritte Newton'sche Axiom, oft auch als Gesetz bezeichnet, postuliert, dass jede Kraft, die an einem Ort angreift, eine genauso große Gegenkraft antrifft. In diesem Modell wirken zwei Kräfte entgegengesetzt. Das Duden-Kriterium GSKDud kann als erfüllt angesehen werden. Bilden wir die Verneinung von Kraft, entsteht Nicht-Kraft, was hier falsch ist. Das Kriterium GSKkrw Kraftwirkung ist erfüllt wie auch das Verbundenheitskriterium GSKverb. Auch das Sprachgebrauchskriterium GSKsprg greift. Das Wechselwirkungskriterium GSKww ist erfüllt, das Silbenkriterium GSKsilb nicht.
GSan-un Gegensatz angenehm-unangenehm. Nach dem Silbenkriterium GSKsilb steht "un" immer für eine Verneinung, führt also zur Kontradiktion und zu keinem Gegensatz, obwohl sich das Sprachgefühl dagegen sträubt. Das Sprachgebrauchskriterium GSKsprg spricht also für einen Gegensatz. Das Duden-Kriterium GSKDud kann nicht als erfüllt angesehen werden: Die Worte angenehm und unangenehm bilden keine äußerste Verschiedenheit.
GSgr-kl Gegensatz groß-klein. Die Negation oder Verneinung von groß ist nicht-groß, das kann, muss aber nicht klein sein.
GShe-du Gegensatz hell-dunkel. Die Verneinung von hell ergibt nicht-hell. Es handelt sich also um keinen Gegensatz, obwohl es das Sprachgefühl nahelegt. Das Dudenkriterium GSKDud äußerste Verschiedenheit greift so wenig wie die Tatsache, dass beide falsch sein können, also GSKbf gilt.
GSst-la Die Formulierung von Engels (MEW Bd. 20) im Vorwort, XI des "Gegensatzes von Stadt und Land" wirft die Frage auf, was hier der Gegensatz sein soll. Auch der Gegenteilbegriff ist kaum zu begründen. Stadt und Land sind verschieden, anders. Richtig ist hier daher der Ausdruck "Unterschied" oder "anders".
Falscher Gebrauch von Gegensatz
"Allianz (franz. Alliance, spr. -...), Bündnis,
völkerrechtlicher Vertrag, zwischen zwei oder mehreren Mächten
zu einem bestimmten Zweck abgeschlossen. Im Gegensatz
() zu einer organisierten und auf die Dauer berechneten Staatenverbindung,
wie sie uns in einer Union oder Konföderation, im Staatenbund und
im Bundesstaat entgegentritt, hat die Allianz einen vorübergehenden
Charakter. Die verbündeten Mächte, welche zu gunsten des Bündnisses
von ihrer politischen Selbständigkeit nichts aufgeben, werden Alliierte
genannt."
Quelle: https://peter-hug.ch/01_0379?q=Gegensatz#I0376.
Definitionsprobleme
mit der Logik
Im Rahmen des Themas Dialektik ergaben sich zusätzliche Untersuchungen
zu verwandten Begriffen oder Begriffsfeldern.
Definition formale Logik (DialFlog)
Die (Logik) ist die Lehre von den wahren, falschen oder nicht entscheidbaren
(formalen) Schlussfolgerungen, wobei in der formalen Logik von den Inhalten
(den Intensionen) weitgehend abgesehen wird, was zu mancherlei Problemen
führt. Die Logik ist eine normative Wissenschaft und eine Lehre des
richtigen logischen Denkens, die Psychologie untersucht hingegen das tatsächliche
und auch das falsche Denken. In der Logik geht es um gültige Schlussformen
allein aufgrund der Form und der Logischen Wahrheitswerte (L-wahr, L-falsch),
die streng von Empirischen Wahrheitswerten (E-wahr, E-falsch) zu
unterscheiden sind. Die Beziehung zwischen logischer und empirischer Wahrheit
ist nicht gut geklärt (Aufgabe der Wissenschafts-, Erkenntnistheorie
und der Methodologie). In der Logik wird empirische Wahrheit ("Wahrheitsdefinitheit")
vorausgesetzt, aber nicht geklärt und fundiert.
Als Klassiker zur Veranschaulichung dient gewöhnlich:
Wenn jedes A ein B und jedes C ein A ist, dann gilt: C ist ein B (triviale
Schlussregel des modus ponens). Setzt man für A Büro, für
B Tulpe und für C Motorrad sein, dann gilt rein formal logisch, dass
jedes Motorrad eine Tulpe ist. Das zeigt, dass das mit der formalen Logik
so eine Sache ist. Das Standardbeispiel ist unmittelbar einsichtig: Wenn
alle Menschen (A) sterblich (B) sind und Sokrates (C) ein Mensch (A) ist,
dann ist Sokrates (C) sterblich (B). Für die aussagenlogische Beziehung
Wenn A, dann B, erhält man für die Gesamtaussage immer
den Wahrheitswert wahr, wenn A falsch ist (Implikationsparadox).
Wenn alle Türken (A) Menschen (B) und C ein Schweizer (S) ist, dann
folgt daraus nichts, solange nicht definiert ist, wie die logische Beziehung
zwischen Türken und Schweizern ist.
Definition Dialektische
Logik (DialDLog), (DialDMat).
Die dialektische Logik ist keine Logik im engeren Sinne (DialFDLog),
jedenfalls bislang nicht. Es ist eine wissenschaftstheoretische Grundeinstellung
und mehr eine Methode,
die auf dem theoretischen Polaritäts-Postulat basiert, dass jeder
Sachverhalt ("These") seinen Gegensatz ("Antithese") in sich trägt,
woraus sich aus den Wechselwirkungen höhere Entwicklungen ("Synthesen")
ergeben, die ihrerseits wieder zu neuen Ausgangssachverhalten ("Thesen")
werden usw. Das so verstandene Geschehen wird im dialektischen Materialismus
auch "Einheit und Kampf der Gegensätze" genannt, aber nicht systematisch,
empirisch oder experimentell belegt, sondern lautstark und nachhaltig,
geradezu propagandistisch behauptet, womit natürlich der wissenschaftliche
Anspruch nicht eingelöst wird.
Definition Formale
Dialektische
Logik (DialFDLog)
Die formale dialektische Logik ist die Lehre von den wahren, falschen
oder nicht entscheidbaren Schlussfolgerungen, die sich aus widersprüchlichen
Aussagen und ihrer Synthese ergeben.
Wie kann aus A und B, die sich widersprechen, ein
C formal dialektisch gefolgert werden? Ich liebe (A) und ich hasse (B)
dich, lebe aber mit Dir (D), wenn auch in einem ständigen Ambivalenzkonflikt
(C). Rein formal kann also der Satz vom Widerspruch in der formal dialektischen
Logik nicht gelten. Denn A und B (= ¬A) schließen sich - klassisch
formal logisch interpretiert - aus. Setzt man A und ¬A als zugleich
wahr voraus, so ist aus einem solchen System jede beliebige Aussage ableitbar
(>Popper). Ein solches System will man natürlich nicht. Allerdings
legt man bei dieser Argumentation klassisch formale logische Regeln an.
Nach Definition befinden wir uns aber im Gebiet der formal dialektischen
Logik, wo diese Regeln nicht gelten können oder sollten. Es müssen
also Regeln entwickelt werden, die verhindern, dass jeder beliebige Unsinn
abgeleitet werden kann. Wobei an dieser Stelle offen ist, ob das geht.
Man hat es meines Wissens nie versucht (Ausnahme Popper), weil man zu viel
Angst und Respekt vor dem Satz des Widerspruchs hatte, der für dialektische
Sachverhalte nicht gelten kann und darf. Es gibt vielleicht mehrere Möglichkeiten,
eine dialektische Logik einzuführen. So lange aber nicht geklärt
ist, ob es tatsächlich dialektische Sachverhalte gibt (These, Antithese,
Synthese), kämme dies gleich, den zweiten Schritt vor dem ersten tun
(> dialektischer Begriffsbaum).
_
Signierungen - Zur Methodik der Begriffsanalysen.
Die Signierungen erfolgen aufgrund empirisch-tatsächlicher Funde des Gebrauchs, wobei wenigstens ein Beispiel erfasst werden soll. Am Ende der Gebrauchsanalysen kann und soll dann überlegt werden, ob und wie die Definitionen überarbeitet und gruppiert werden können.
Signierungsstatus in den Quellen: [s] = signiert, [ts] := teilsigniert, [m] := markiert zum Signieren, [nnb] := noch nicht bearbeitet. [i] := informativ, keine Signierungen.
Signierungen Dialektik, dialektisch
Dialalltag Dialektisch,
Dialektik ist kein alltagssprachlicher, höchstens ein bildungssprachlicher
Begriff.
DialAnd Anderes, sonstiges
dialektisches System, das im Einzelfall näher zu spezifizieren ist.
DialAnti Antithese (Gegenbehauptung)
> Linehan Polarität.
DialArgL Dialektik als Argumentationslehre
und methodische Einstellung > Schwemmer
EdPuWT.
DialArist Eisler:
"ARISTOTELES nennt dialektikê das Beweisverfahren aus überlieferten
Sätzen"
Dialaufh Aufheben, dialektisch,
Hegel'scher Grundbegriff. In der Interpretation Winter (o.J.), S.
9: "Das Verb „aufheben“ hat dabei eine sehr treffende Mehrdeutigkeit: erstens
im Sinne von „emporheben“, zweitens „für ungültig (nichtig) erklären,
beenden“ und drittens im Sinne von „aufbewahren“. Für Hegel ist das
Aufheben „einer der wichtigsten Begriffe der Philosophie, eine Grundbestimmung,
...“[Fn38] mit dem „gedoppelten Sinn, dass es soviel wie aufbewahren, erhalten
bedeutet und zugleich soviel wie aufhören lassen, ein Ende machen.[Fn39]
[Fn38] Hegel, Werke, Band 5, S. 113; [Fn39] ebenda, S. 114]"
DialAuto Hier wird Dialektik
als autonom selbständiges Subjekt, das dies oder jenes tut bzw. unterlässt,
fehlinterpretiert. > Blasche: "Sie
[die Dialektik] überspringt dabei nicht naiv realistisch den sprachgebundenen
Artikulationshorizont, sondern versichert sich einer prinzipiell systemtranszendierenden
unbegrifflichen Realität als Korrektiv durch sprachliche Mittel allein."
DialBez Dialektische Beziehung
ohne nähere Spezifikation. Formulierung von Levins und Lewontin (1985)
zitiert nach Linehan.
DialBild Dialektik als
bildungssprachlicher Begriff. > Duden (3).
DialBsp Beispiele für einen
dialektischen Sachverhalt > Reich.
DBT nach Linehan
DialDBT Ein dialektischer kognitiv-verhaltenstherapeutischer
Ansatz, DBT nach Linehan.
DialDBTaKSD Andauernde
Konflikte stellen nach Linehan ein
Scheitern der Dialektik dar.
DialDBTbal Balance,
Gleichgewichtszustand nach Kegan, zitiert von Linehan.
DialDBTETB Dialektische Entwicklungstheorie
der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach Linehan
(DBT)
DialDBThm Dialektik als psychologisches
Heilmittel, so Linehan: "Die von
Borderline-Patientinnen gezeigten Verhaltensweisen lassen sich auch als
Scheitern an der Dialektik interpretieren."
DialDBTnd Dialektik von Nähe
und Distanz, Interpretation Linehans
(DBT)
DialDBTpers Linehan
(DBT): "Im Gegensatz zum analytischen Denken ist der dialektische Ansatz
persönlich; er berücksichtigt und betrifft die gesamte Person."
DialDBTpv Der traditionelle
und der DBT-Ansatz zur Praxis der Veränderung nach Linehan.
Der traditionelle Ansatz: "Dementsprechend besteht das Ziel der Therapie
darin, die Pathologie aufzuspüren und Möglichkeiten zur Veränderung
zu schaffen."
Der Ansatz der DBT hingegen: "Eine dialektische
Perspektive legt dagegen einen anderen Ansatz nahe: Jede Dysfunktionalität
enthält auch Funktionalität; jede Verzerrung enthält Wahrheit;
und in jeder Zerstörung findet sich ein Aufbau. Durch die Umkehrung
der Vorstellung „Widersprüche in der Wahrheit“ zu „Wahrheit im Widerspruch“
gelangte ich zu einer Reihe von Entscheidungen bezüglich der Form
von DBT"
DialDBTpww Dialektischer
Prozess des Wachstums und Wandels, Formulierung von Linehan
(DBT).
DialDBTspan Linehan:
"Innerhalb der Therapie selbst besteht demnach eine ständige dialektische
Spannung zwischen dem Vorgang der Veränderung und deren Folgen."
DialDBT-SQ Störungsquelle
mangelnde dialektische Fähigkeiten im Erleben und Verhalten bei Borderline
Patientinnen nach Linehan.
DialDBT-S Dialektische Strategien
nach Linehan. [Kap
7]
- DialDBT-Spar Dialektische Strategie paradoxes Vorgehen nach Linehan. [Kap 7]
- DialDBT-Smet Dialektische Strategie Metaphern nach Linehan. [Kap 7]
- DialDBT-Sadv Dialektische Strategie Advocatus-Diaboli-Technik nach Linehan. [Kap 7]
- DialDBT-Saus Dialektische Strategie Ausdehnen ("Extending") nach Linehan. [Kap 7]
- DialDBT-Sawz Dialektische Strategie Aktivierung des wissenden Zustandes nach Linehan. [Kap 7]
- DialDBT-Szli Dialektische Strategie aus Zitronen Limonade machen nach Linehan. [Kap 7]
- DialDBT-Snat Dialektische Strategie natürliche Veränderungen zulassen nach Linehan. [Kap 7]
- DialDBT-Sansp Dialektische Strategie anspornen nach Linehan. Ist bei Linehan unter Validierungsstrategien [Kap 8] gelistet, gehört systematisch aber zu den Behandlungsstrategien, daher unter DialDBT-S eingeordnet.
- DialDBT-SPL Dialektische Strategien des Problemlösen nach Linehan. [Kap 9]
- DialDBT-Skon Dialektische Strategie Kontingenzverfahren nach Linehan. [Kap 10]
- DialDBT-SFT Dialektische Strategie Fertigkeitstraining nach Linehan. [Kap 11]
- DialDBT-Sexp Dialektische Strategie der Expositionsbehandlung nach Linehan. [Kap 11]
- DialDBT-SKU Dialektische Strategien der kognitiven Umstrukturierung nach Linehan. [Kap 11]
- DialDBT-SAK Dialektische stilistische Strategie ausgewogener Kommunikation nach Linehan. [Kap 12]
- DialDBT-SAKg Dialektische stilistische Strategie gleichberechtigte Kommunikation nach Linehan. [Kap 12]
- DialDBT-SAKr Dialektische stilistische Strategie respektloser Kommunikation nach Linehan. [Kap 12]
- DialDBT-Sdiag Dialektische Diagnostik nach Linehan.
- DialDBT-SU Strategien zum Umgang mit dem sozialen Umfeld: Interaktion mit der Gemeinschaft nach Linehan [Kap 13]
- DialDBT-SUI Interventionen im Umfeld nach Linehan [Kap 13]
- DialDBT-SUB Beratung der Patientin nach Linehan [Kap 13]
- DialDBT-SUS Supervision des Therapeuten nach Linehan [Kap 13]
- DialDBT-SsP Strategien für spezifische Probleme nach Linehan [Kap 14]
- DialDBT-SsPV Vertrags-Strategien nach Linehan [Kap 14]
- DialDBT-SsPE Eröffnung der Sitzungen nach Linehan [Kap 14]
- DialDBT-SsPZ Zielstrategien nach Linehan [Kap 14]
- DialDBT-SsPB Beenden der Sitzungen nach Linehan [Kap 14]
- DialDBT-SsPA Strategien bei Abschluss der Therapie nach Linehan [Kap 14]
- DialDBT-SB Spezielle Behandlungsstrategien nach Linehan [Kap 15]
- DialDBT-SBK Krisen nach Linehan [Kap 15]
- DialDBT-SBS Suizidales Verhalten nach Linehan [Kap 15]
- DialDBT-SBG Therapiegefährdendes Verhalten nach Linehan [Kap 15]
- DialDBT-SBT Telefon-Strategien nach Linehan [Kap 15]
- DialDBT-SBZ Zusatz-Behandlung nach Linehan [Kap 15]
- DialDBT-SBB Beziehungs-Strategien nach Linehan [Kap 15]
- DialDBT-SV Dialektische Validierungs-Strategien nach Linehan.
DialDefiniendum Dasjenige, das definiert werden soll. Name, Wort, Symbol der zu definierenden Dialektikbedeutung. > Definition.
DialDefiniens Womit definiert wird, die Begriffsmerkmale oder der Begriffsinhalt des Wortes "Dialektik". Das Definiens kann in den Texten kürzer (Textteile) oder länger (der ganze Text) interpretiert werden. > Definition.
DialDLog Dialektische Logik von These, Antithese, Synthese, der Einheit und dem Kampf der Gegensätze im Sinne des dialektischen Materialismus (DiaMat).
DialDLonS Dialektische Logik ohne nähere Spezifikation.
DialDMat Dialektik im dialektischen Materialismus. > DiaMat.
Auswahl Dialektisch-materialistische Kategorien: (Kopnin unterscheidet 52 Kategorien, erklärt sie aber nicht). Im Prinzip gibt es so viele dialektische Kategorien wie es Kategorien gibt, also wahrscheinlich Hunderte oder Tausende, weil man jede Kategorie auch dialektisch betrachteten kann. Die folgende Auswahl bringt einige besonders wichtige:
- DialMatanti Antithese.
- DialMatbew Bewegung.
- DialMatbws Bewusstsein.
- DialMatDing Ding.
- DialMateig Eigenschaften.
- DialMatEuKdG Einheit und Kampf der Gegensätze.
- DialMatEntw Entwicklung.
- DialMatGeg Gegensatz.
- DialMatGes Gesellschaft.
- DialMatGwis Gesetz, wissenschaftliches.
- DialMathoe Höhere Entwicklung.
- DialMatident Identität.
- DialMatKat Kategorie.
- DialMatkompl Komplementarität.
- DialMatmat Materie.
- DialMatmew materielle Einheit der Welt.
- DialMatNeg Negation, dialektische.
- DialMatNegN Negation der Negation.
- DialMatpol Polarität.
- DialMatqual Qualität.
- DialMatQuQ Qualität und Quantität.
- DialMatRuZ Raum und Zeit.
- DialMatRel Relation.
- DialMatRuh Ruhe.
- DialMatsachv Sachverhalt.
- DialMatspr Sprung, dialektischer.
- DialMatsyn Synthese.
- DialMatthe These.
- DialMatums Umschlagen.
- DialMatunt Unterschied.
- DialMatver Veränderung.
- DialMatwes Wesen.
- DialMatwsp Widerspiegelung.
- DialMatwid Widerspruch, dialektischer.
- DialMatwis Wissenschaft.
DialEntwT Dialektik als Entwicklungstheorie > Schwemmer EdPuWT, ständiger Veränderungsprozess und Wandel > Linehan-Wandel.
DialErist Dialektik als Eristik. Eisler "... Bei den Megarikern artet die Dialektik in Eristik (s. d.) aus. ..."
DialErkKr Dialektik als Erkenntniskritik, eine Interpretation Wetters: "... Was das Vorhaben betrifft, die formale Logik durch die dialektische zu ergänzen, so haben wir schon darauf verwiesen, daß diese dialektische Logik keine eigentliche Logik darstellt, sondern vor allem das, was man als Erkenntniskritik bezeichnen könnte."
DialErkMeth Dialektische Erkenntnismethoden, Ausdruck bei Egger, hier ohne nähere Spezifikation, was das für Methoden sind.
DialEWET Dialektik als empirisch-wissenschaftliche Entwicklungstheorie.
DialFDLog Dialektische Logik im engeren, formallogischen Sinne.
DialFlog Formale, "traditionelle" oder gar "klassische" Logik (im Wesentlichen meist Prädikaten- oder Aussagenlogik) > Definition Logik. in Abgrenzung zur sog. > dialektischen Logik.
DialFSubj Falsches Subjekt > Adorno: "Das Buch möchte ...". Das Buch ist kein Subjekt mit eigenen Wünschen und Absichten. Adorno möchte mit dem Buch ... Wie Dialauto und BMautonS Autonomes Subjekt. Konstruierte Begriffe wie selbständig handelnde Subjekte (Geister einer Geisterwelt) darstellen ((hypostasisch-homunkulusartiger Gebrauch).
DialGanz Dialektische Betonung der Ganzheit und ganzheitlicher Betrachtung. Alles hängt mit allem zusammen. > Linehan, Piaget 1973.
DialGegB Gegensatzbegriff ohne nähere Spezifikation, Theorie und Praxis der Gegensätze.
DialGegD Dialektik der Gegensätze. Für und wider, pro und contra, sowohl als auch, das Ganze, die Vielfalt und besonders auch die Gegensätze sehen.
DialGes Gesetze der Dialektik. Ausdruck bei Kopnin: "Von einigen Wissenschaftlern wird angenommen, daß die Dialektik ihre eigene Logik der Ableitung von Folgerungen aus Prämissen schafft, d. h. ihren eigenen logischen Kalkül, der nicht auf den formallogischen Gesetzen (Identität, ausgeschlossener Widerspruch), sondern auf den Gesetzen der Dialektik aufbaut." Auch Zusammenfassung Linehan.
DialGesA Gesetze nach Auffassung "der" Dialektik nach Esser et al.
DialGidee Esser et al.: "Grundidee "der" Dialektik ist das Postulat von der Universalität der Bewegung aller Dinge, die sich aus einer den Dingen immanenten Widersprüchlichkeit ergibt und den historisch-materiellen Prozeß der Entfaltung aller Dinge zu immer neuen und qualitativ höheren Stufen einer sich in Sprüngen vollziehenden Entwicklung treibt."
Dialgipt Dialektik der Heilmittel im allgemeinen und integrativen Konzept > Zur Dialektik des GIPT-Symbols.
DialGPWWM Dialektisches Grundprinzip als Mehr-Faktoren oder Mehr-Komponenten Wechselwirkungsmodell, z.B. in der Entwicklungspsychologie > Soziale Lerntheorien: "Die heutigen sozialen Lerntheorien zeichnen sich durch ein dialektisches Grundprinzip aus, demzufolge sich ein Individuum in ständiger Interaktion mit der Umwelt entwickelt." Allgemeiner Sowohl-als-auch-Gedanke.
DialGesOnS Dialektische Gesetzmäßigkeit ohne nähere Spezifikation.
DialGPraem Grundprämissen "der" Dialektik nach Esser et al.: "Die Kritik der Grundprämissen umfaßt die drei wichtigsten Postulate: die These der Universalität der Bewegung, die dialektische Auffassung von Widersprüchen und die Forderung nach Parteilichkeit (vgl. Kap. 2.2.1)."
DialHeg Dialektik nach Hegel (EdpWiG, § 81): "Das Dialektische [...] ist [...] überhaupt das Prinzip aller Bewegung, alles Lebens und aller Betätigung in der Wirklichkeit. Ebenso ist das Dialektische auch die Seele alles wahrhaft wissenschaftlichen Erkennens.25"
Interpretation Winter (o.J.), S. 6: "Der weitreichenden Bedeutung des Wortes „Prinzip“26 zufolge begreift Hegel demnach das „Dialektische“ als ein Erstes, als Ursprung und Grund aller wirklichen Bewegung, Tätigkeit und Veränderung überhaupt. Die Dialektik ist demnach das, was jegliches Geschehen, Entwicklung und Leben in der Welt erst ermöglicht und bewirkt. Sie ist sozusagen der Motor für alle Vorgänge in der Wirklichkeit. Mit dieser grundlegenden und universalen Bedeutung umfasst der Dialektikbegriff auch die Formen der wahren, wissenschaftlichen Erkenntnis, wenn Hegel das Dialektische in metaphorischer Weise als „Seele“ versteht, d. h. hier etwa als die tragende, innere Kraft des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses. ..." > Fraglich bei Dorsch: "Er machte die D. zur Methode seines Philosophierens (Thesis – Antithesis – Synthesis > Dialtrias). Eine originelle Idee und wirre Phantastik > Darstellung und Kritik.
DialHist Dialektik als Geschichtslehre, Interpretation von Popper.
DialIAnUm Interaktion zwischen Anlage und Umwelt als treibender Faktor für Entwicklung, so in soziale Lerntheorien.
DialIdeal Idealistische Dialektik. Unterscheidung Adornos in der Besprechung Blasches: "In der »Negativen Dialektik« unterscheidet Adorno die idealistische Dialektik, die durch den »Vorrang des Sub[>188]jekts« definiert ist (a. a. O., 182 ff.), von der n.n. D., die materialistisch objektorientiert verfährt. ..."
DialInter Dialektische Interaktionen, unklare Formulierung bei Piaget 1973: "Wenn es sich andererseits darum handelt zu bestimmen, ob ein System A das System B nach sich zieht oder umgekehrt, wie bei den Beziehungen zwischen endlichen Ordinal- und Kardinalzahlen, zwischen dem Begriff und dem Urteil usw., kann man sicher sein, dass auf die linearen Prioritäten oder Reihen am Ende immer dialektische Interaktionen oder Zirkel folgen."
DialKant Dialektik als Pseudophilosophieren nach Kant " > Dorsch.
DialKantAL Dialektik als allgemeine Logik, ein nicht sehr klarer und wenig konsistenter Ausdruck Kants (S. 81,03). vor allem nach der näheren Spezifikation: "... daß die allgemeine Logik, als Organon [Zeile 13] betrachtet, jederzeit eine Logik des Scheins, d. i. dialektisch, sei" . Demnach gilt: DialKantAL = DialSchein.
DialKantPV Dialektik der praktischen Vernunft. Eine Konzeption Kants, nach Eisler: "Es gibt auch eine Dialektik der praktischen Vernunft, indem diese unter dem Namen des höchsten Gutes (s. d.) ein Unbedingtes sucht (Kr. d. pr. Vern. I. T., 2. B.). So auch in der Urteilskraft, nämlich betreffs der Antinomien des Geschmacks (s. d.) (Kr. d. Urt. § 55 ff.)."
DialKantTD Transzendentale Dialektik, Ausdruck Kants. Siehe auch > Eisler Transzendentale Dialektik: "Die transcendentale Dialektik besteht in der Untersuchung der Paralogismen (s. d.), Antinomien (s. d.) und Ideale (s. d.) der reinen Vernunft."
DialKern Begriffsrealistischer Kern "der" Dialektik (der Wesensbegriff), Interpretation von Esser et al.
DialKompl Dialektische Betonung der Komplexität von Zusammenhängen und Ganzheiten. > Linehan in Polarität.
DialKritik Kritik an der Dialektik (Definition, Gebrauch, Handhabung) > Kant, > Popper, > Wetter.
DialLenin Dialektik nach Lenin > Diamat.
DialLibera Dialektik der Freiheitsbewegungen > Cooper.
DialLineh Dialektik nach Linehan.
DialLoNeg Logik ohne Negation von Griss, zitiert von Piaget 1973.
DiallogW Wissenschaft der Logik ohne nähere Spezifikation > Dorsch.
DiallogFA Logik ferne oder fremde Aufgaben, denen sich die Dialektik in der Beurteilung Wetters widmet.
DialMarx Dialektik nach Marx > [Fundstelle nachtragen]
Dialmat Materialistische Dialektik (im Gegensatz zur idealistischen). Ausdruck bei Kopnin: "Deshalb ist es nur berechtigt, von der materialistischen Dialektik als von einer Logik zu sprechen, sofern sie einen solchen Apparat schafft — genauer, einen Organismus des Denkens, [>165[ den es in keinem anderen logischen System gibt." Auch von Holzkamp (1983b) verwendet.
DialMatLog Dialektisch-materialistische Logik > Fogarasi.
DialMatObj Materialistisch-objektorientierte Dialektik. Unterscheidung Adornos in der Besprechung Blasches: "In der »Negativen Dialektik« unterscheidet Adorno die idealistische Dialektik, die durch den »Vorrang des Sub[>188]jekts« definiert ist (a. a. O., 182 ff.), von der n.n. D., die materialistisch objektorientiert verfährt. ..."
Dialmerkm Merkmal des dialektischen Begriffs > Blasche negative Dialektik Adornos: "so könnte die Negative Dialektik, die von allen ästhetischen Themen sich fernhält, Antisystem heißen. ...".
DialMeth Dialektik als Methode, dialektische Methode. Auch Verfahren. > Eisler, Schwemmer.
DialNegat Negation in dialektischem Kontext. Piaget 1973.
DialNDaGK Negation der Negation Dialektik als Gesellschaftskritik, eine Deutung Blasches zu Adornos Negativer Dialektik.
DialNegD Negative Dialektik. Konzept Adornos (2007): "Es handelt sich um den Entwurf einer Philosophie, die nicht den Begriff der Identität von Sein und Denken voraussetzt und auch nicht in ihm terminiert, sondern die gerade das Gegenteil, also das Auseinanderweisen von Begriff und Sache, von Subjekt und Objekt, und ihre Unversöhntheit, artikulieren will."
DialonS Dialektik ohne nähere Spezifikation.
DialPAonS Dialektik im psychoanalytischen Gebrauch ohne nähere Spezifikation. Beispiel nach Reich: ""Versuchen wir es nun an einigen typischen Vorgängen im menschlichen Seelenleben, die die Analyse aufgezeigt hat, ihre Dialektik nachzuweisen, die unserer Behauptung nach ohne die psychoanalytische Methode nicht hätte zutage treten können."
DialPAsymp Symptombildung als Beispiel für dialektische Entwicklung. Interpretation von Wilhelm Reich: "Zunächst als Beispiel für die dialektische Entwicklung die Symptombildung in der Neurose, wie sie von Freud zuerst erfasst und beschrieben wurde. ..."
DialPAVerdr Dialektische Interpretation der Verdrängung durch Reich: "... Die Verdrängung ist also die Folge eines Widerspruches, der unter der Bedingung der Bewusstheit nicht zu lösen ist. Das Unbewusst werden des Triebes ist eine vorläufige, wenn auch pathologische Lösung des Konfliktes. ..."
DialPhAM Dialektik als philosophische Arbeitsmethode. Formulierung im Spektrum Lexikon der Psychologie.
DialPIWahn Philosophisch-idealistisches Wahnsystem > Fichte (in Klaus & Buhr).
DialPlato Dialektik im Verständnis Platons nach Eisler: "... PLATO versteht unter Dialektik (DialPlato) die Kunst des logischen, philosophischen Verfahrens, d.h. des Verfahrens, durch Analyse und Synthese der Begriffe, durch Fortgang des Denkens von niederen zu höheren, allgemeineren Begriffen zur Erkenntnis des Seienden, der Wirklichkeit, der Ideen (s. d.) zu gelangen ... ". Dialektik im Verständnis Platons nach Schwemmer: "Platon stellt dieser Eristik als der Kunst des argumentationslosen (politisch aber oft wirksamen) Wortstreits mit dem einzigen Ziel, den Beifall der (unkritischen) Menge zu erhalten, die D. als die Bemühung gegenüber, einen einsichtigen Gesprächspartner durch begriffliche Klärungen von den Erscheinungen der Sinnenwelt zu den Ideen zu führen (>Idee (historisch), >Ideenlehre, >Elenktik)."
DialPop Dialektik in den Augen Poppers.
DialPPTKB Dialektische Problematik der Therapeut-Klient-Beziehung in der Psychopathologie > Quensel S. 5.
DialPPPav Dialektische Problematik Anlage und Verantwortung > Quensel S.126. Spricht auch von "dialektischer Eiertanz."
Dialprobl Ausdruck von Dörner nach Öllinger: "Probleme mit unklar definiertem Anfangs- und Zielzustand werden bisweilen auch als dialektische Probleme bezeichnet (Dörner 1976)."
DialProz Dialektischer Prozess: These=Proposition (polarer Gegensatz) und Antithese=Opposition (polarer Gegensatz) im gleichen Sachverhalt, in dem sich eine Synthese=Aufhebung unter Spannungen entwickelt, die ihrerseits wieder zum Ausgangspunkt einer neuen These wird. Hierbei auch Ruhe- oder Latenzzeiten möglich wie auch Sprünge. > Klaus & Buhr oder plötzliche Veränderungen und dramatische Schübe > Linehan-Wandel.
Dialpsy Dialektik in der Psychologie. > Dorsch.
DialRiegel Dialektik nach Riegel ohne nähere Spezifikation.
DialSchein Wertung Kants, Dialektik als Logik des Scheins.
DialSoph Eisler: "Die Sophisten begründen eine Dialektik im schlechten Sinne, die darauf ausgeht, durch Scheinbeweise, Sophismen (s. d.) den Schein der Wahrheit zu erzeugen (vgl. ARISTOTELES, Rhet. II 24, 1402a 23)." Sophistische Dialektik nach Schwemmer, "der professionell ausgeübten Kunst und Lehre der Überredung zu beliebigen Meinungen"
DialSprung Dialektischer Sprung. Neuer Zustand mittels Sprung. > Klaus & Buhr.
DialSynth Synthese Überwindung von These und Antithese in der Synthese > Linhan Polarität.
DialThese These (Behauptung) > Linhan Polarität.
Dialtheo3A Theoretische Aspekte der Dialektik, Formulierung von Esser et al.: "Die methodologische Kritik (vgl. HELBERGER 1974, EBERLEIN 1972) soll sich auf drei Aspekte der Dialektik beziehen: die Diskussion der Grundprämissen, die Theoriekonzeption und [>225] die dialektische Auffassung von Gesetzen. Die Kritik der Grundprämissen umfaßt die drei wichtigsten Postulate: die These der Universalität der Bewegung (), die dialektische Auffassung von Widersprüchen und die Forderung nach Parteilichkeit (vgl. Kap. 2.2.1)."
DialtheoK Theoriekonzeption "der" Dialektik nach Esser et al.: "In Bezug auf die Theoriekonzeption der Dialektik seien wiederum drei Teilbereiche behandelt. Die Wahrheitskriterien für Theorien, das Wertproblem und das Verhältnis von Theorie [>228] und Praxis."
Dialtrias Dialektische Trias: These, Antithese, Synthese > Popper, > Dorsch. Kritisch Winter: "... Weder Platon noch Heraklit noch Hegel und auch nicht Marx haben sich bei der Bestimmung der Dialektik der Begriffsreihe „These, Antithese und Synthese“ bedient."
Dialtrick Dialektischer Taschenspielertrick, Ausdruck von Holzkamp (1983b).
Dialumschl Dialektischer Umschlag von einer Qualität in die andere. > Klaus & Buhr in dialektischer Sprung.
Dialunklar Unklare, schwer oder gar nicht verständliche Ausführungen. > Blasche negative Dialektik (Adorno)
Dialursp Unterredungskunst Ursprüngliche Bedeutung im antiken Griechenland. > Eisler, Schwemmer.
Dialverd Dialektik als Verdeckung, Schönfärben, Überkleistern von blinden Flecken. Gebrauch bei Holzkamp (1983b).
DialVSartre Dialektische Vernunft nach Sartre, zitiert von Piaget (1973). "Die wichtigsten Komponenten des dialektischen Denkens, wie [>104] Sartre es praktiziert, sind der Konstruktivismus und seine Konsequenz, der Historizismus. ..."
Dialwand Dialektisches Konzept ständiger Wandlung, z.B. bei Linehan, teilweise widersprüchlich, weil einerseits allmählich und kontinuierlicher Wandel erfolgen soll, andererseits aber auch Sprünge möglich sind:
- DialwandA Allmählicher Wandel, z.B. bei Linehan.
- DialwandK Kontinuierlicher Wandel, z.B. bei Linehan.
- DialwandS Sprunghafter Wandel, z.B. bei Linehan.
Dialwidspr Widerspruch, widersprüchliche Ausführung > Blasche negative Dialektik Adornos.
DialWis Dialektik als Wissenschaft > Fogarasi.
DialZitH Hochstaplerzitierstil, nur Autor und Jahr, ohne Fundstelle oder gar Inhalt. > Öllinger.
_
_
Signierungen Widerspruch - Formen und Varianten des Widerspruchs, widersprüchlich
Das Wort "Widerspruch" wird in sehr vielen unterschiedlichen, oft unklaren und fragwürdigen Bedeutungen gebraucht.
Wantag antagonistischer Widerspruch, eine Konstruktion des DiaMat, bei dem die Gegensätze nicht miteinander versöhnt werden können und der nur durch einen Bruch der bestehenden Einheit gelöst werden kann.
WBS Widerspruch zwischen Begriffswelt und Sprache, z.B. für ein Wort gibt es keinen klaren Begriff. Das ist mit vielen Worten so, weil die meisten Worte mehrdeutige Homonyme sind.
WDial Dialektischer Widerspruch ohne nähere Spezifikation. Beispiel bei Wetter: "Wir sahen aber, daß die »dialektischen Widersprüche« nicht im Sinne logischer Widersprüche zu verstehen sind."
WBlog Logischer Widerspruch in der Begriffswelt.
WMBdial Dialektischer Widerspruch in der Begriffswelt.
WMbNK Widerspruch zwischen Mensch und belebter Natur.
WMbsk Ontologischer Bereich Mensch M. Widerspruch als Begriffs-Sprache-Konflikt: ich habe einen Begriff, kann ihn aber nicht ausdrücken, weil mir die Worte oder Symbole fehlen.
WMErl Widerspruch im Erleben, ich möchte und ich möchte nicht (Ambivalenzkonflikt), ich möchte, aber ich kann nicht (Wunsch-Fähigkeits-Konflikt); ich möchte beides, aber nur eines geht (Anziehungs-Anziehungs-Konflikt); ich möchte es, aber nichts dafür leisten (Preis-Leistungs-Verhältnis-Konflikt); ich möchte keines, aber eines wird mir aufgezwungen (Vermeidungs-Vermeidungs-Konflikt).
WMfrag Fragwürdiger oder falscher Gebrauch des Wortes "Widerspruch", z.B. "der Widerspruch zwischen zwischen grün und gelb". Das sind einfach zwei unterschiedliche oder andere Farben. Anderssein oder Unterschied hat mit der Kernidee des Widerspruchs, der Verneinung, nichts zu tun. Es handelt sich in dem Beispiel also um einen falschen Gebrauch.
WMinter Interpsychischer Widerspruch zwischen mindestens zwei Menschen, z.B. ein Interessenkonflikt.
WMintra Intrapsychischer Widerspruch, ich möchte und ich möchte nicht.
WMMK Widerspruch als zwischenmenschlicher Interessenkonflikt. Einer will Z, der andere nicht oder nicht so.
WMNK Widerspruch durch einen Mensch-Natur-Konflikt. Ein solcher wird im allgemeinen nicht wahrgenommen, weil auch gar kein Begriff gebildet wurde, weil der - zumindest unbelebten - Natur keine eigenen Interessen zugeordnet werden. Anders bei belebter Natur. Wird einer Pflanze das Licht genommen oder eingeschränkt, dann wird sie leiden, kränkeln und schließlich absterben. Das kann spezifiziert werden.
WMssk Widerspruch als Wahrnehmungs-Sprach-Konflikt, ich kann etwas, was ich wahrgenommen habe oder wahrnehme, nicht in Worte fassen.
WMuNK Widerspruch zwischen Mensch und unbelebter Natur.
WMunkl Unklarer Gebrauch des Wortes Widerspruch, man weiß nicht, was ausgesagt werden soll.
WMwbk Widerspruch als Wahrnehmungs-Begriffskonflikt. Ich nehme etwas wahr, will es aber nicht wahrhaben; ich nehme etwas wahr, habe aber keinen Begriff dafür.
Wnantag Nicht-antagonistischer Widerspruch, eine Konstruktion des DiaMat, durch den die Bewegung fortgesetzt wird und der durch seine Lösung zu seiner höher entwickelten Einheit führt.
WNegDik Kontradiktorischer Widerspruch durch Negation oder Verneinung
WNegKon Konträrer Widerspruch durch Behauptung des Gegenteils. Das Blatt ist weiß. Nein, das Blatt ist schwarz. Der Mensch ist von Haus aus gut. Nein, der Mensch ist von Haus aus böse.
WNegOns Widerspruch durch Negation oder Verneinung ohne nähere Spezifikation.
WOB Widerspruch zwischen objektiver Welt O und der Begriffswelt B, d.h. zwischen einem Sachverhalt der objektiven Welt und der Begriffswelt gibt es einen Widerspruch, z.B. der Begriff Gott hat in der objektiven Welt keine Referenz.
WObj Objektiver Widerspruch ohne nähere Spezifikation, Widerspruch in der realen Welt, in der Wirklichkeit, die unabhängig vom Menschen ist, also etwa Widersprüche in der Natur, actio et reactio, Ebbe und Flut, Anziehung und Abstoßung, Materie und Antimaterie, Welle und Korpuskel, ...
WOdial Dialektischer Widerspruch in der objektiven Welt.
WPASK Dialektische Verarbeitung von Widersprüche in seelischen Konflikten. Interpretation nach Reich: "... Es besteht also nicht etwa eine "Tendenz" zur Symptombildung, sondern die Entwicklung erfolgt, wie wir sehen konnten, aus den Widersprüchen des seelischen Konfliktes. ..."
_
_
Signierungen Gegensatz, gegensätzlich
Man kann auf verschiedenen ontologischen Ebenen Aussagen treffen: O, M, W, B, S, m, onS
GDBTonS Gegensatz ohne
nähere Spezifikation in der DBT Linehans.
GDBTtb
Gegensatz in der therapeutischen Beziehung nach Linehan.
GDBTthes Gegensatzelement These
nach Linehan, z.B. in der therapeutischen
Beziehung (ein Ende der Wippe)
GDBTanti Gegensatzelement
Antithese nach Linehan, z.B.
in der therapeutischen Beziehung (ein Ende der Wippe)
GDBTsyn Gegensatzelement
Synthese nach Linehan, z.B.
in der therapeutischen Beziehung (die Mitte der Wippe)
Gdial Dialektischer Gegensatz
> Wörterbuch der Logik: [Fundstelle nachtragen]
GEinh Einheit der Gegensätze
> DiaMat.
GEuKG Einheit und Kampf der Gegensätze
> DiaMat.
GFGunt Falscher Gebrauch
von Gegensatz statt Unterschied. Im Gegensatz ... Im Unterschied .... >
Allianz.
GFGwid
Falscher Gebrauch Gegensatz statt Widerspruch. Gegensätze können
zwischen Sachverhalten bestehen, Widerspruch ist ein Ausdruck der Logik
und Sprache.
Gfragl Fragliche oder falsche
Verwendung > Allianz "Im Gegensatz zu einer organisierten
und auf die Dauer berechneten Staatenverbindung, wie sie uns in einer Union
oder Konföderation, im Staatenbund und im Bundesstaat entgegentritt,
hat die Allianz einen vorübergehenden Charakter." Hier wäre "Unterschied"
angemessener.
GGGsinn
Sinnlinie, Begriff Guardinis in seinem Gegensatzsystem (S.41), Gesamtlinie
S. 45.
GGG1A-B Akt-Bau,
1. Gegensatzpaar aus Guardinis Gegensatzsystem, Überblick S.
89.
GGG2F-F
Fülle-Form, 2. Gegensatzpaar aus Guardinis Gegensatzsystem,
Überblick S. 89.
GGG3E-G
Einzelheit-Ganzheit, 3. Gegensatzpaar aus Guardinis Gegensatzsystem,
Überblick S. 89.
GGG4P-D
Produktion-Disposition, 4. Gegensatzpaar aus Guardinis Gegensatzsystem,
Überblick S. 89.
GGG5U-R
Ursprünglichkeit-Regel, 5. Gegensatzpaar aus Guardinis Gegensatzsystem,
Überblick S. 89.
GGG6I-T
Immanenz-Transzendenz, 6. Gegensatzpaar aus Guardinis Gegensatzsystem,
Überblick S. 89.
GGG7Ä-B Ähnlichkeit-Besonderung,
7. Gegensatzpaar aus Guardinis Gegensatzsystem, Überblick S. 89.
GGG8Z-G Zusammenhang-Gliederung,
8. Gegensatzpaar aus Guardinis Gegensatzsystem, Überblick S. 89.
Ginvers
Inverse als Gegensatz. Die Inverse eines Sachverhalts löscht den Sachverhalt
aus, was folgt formal veranschaulicht werden kann: S + Inv(S) = 0. Sponsel
(1995), S. 162. > Systemtheorie.
GKampf Kampf der Gegensätze
> DiaMat.
GL-Q
Gegensatz Dynamischer Längsschnitt gegenüber statischem Querschnitt
nach Piaget.
GNeg
Scheinbarer Gegensatz durch Negation.
Gneutr
Neutralisieren als Gegensatz: Kraft und Gegenkraft.
GonS Gegensatz ohne nähere
Spezifikation, z.B. undefinierter Grundbegriff.
Gpolar
Gegensatz als Pol eines Sachverhalts, polares Gegenteil.
Gpolak
Aktualisierter Pol eines Sachverhalts.
Gpolpot
Potentieller, derzeit nicht aktualisierter Pol eines Sachverhalts. Pol
als aktualisierbare Disposition.
GPolarit
Gegensatzsachverhalt einer Polarität.
Gunklar
Unklare Ausführungen zum Gegensatz > Guardini S. 45: "Die Gestalt
des Lebens baut sich von innen her auf; sein Akt geht aus eigenem Ursprung
hervor."
Gvergl
Gegensatz für einen Vergleich, vergleichsweise
Wissenschaftlicher Apparat
- Adorno, Theodor W. (1966) Negative Dialektik. Suhrkamp, Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Adorno, Theodor W. (1970) Gesammelte Schriften, Band 6: Negative Dialektik. Jargon der Eigentlichkeit. Suhrkamp. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Adorno, Theodor W. (2007) Vorlesung über Negative Dialektik. Fragmente zur Vorlesung 1965/66. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Albert, Hans (1987) Kritik der reinen Erkenntnislehre. Tübingen: Mohr.
- Angehrn, E.; Fink-Eitel, H.; Iber, Chr. & Lohmann, G. (1991, Hrsg.): Dialektischer Negativismus. M. Theunissen zum 60. Geburtstag. Frankfurt: Suhrkamp.
- Arruda, Ayda I. (1977) On the Imaginary Logic of N. A. Vasil'év. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics Volume 89, 1977, Pages 3-24.
- Barwinski, R.; Bering, R. & Eichenberg, Chr. (2010, Hrsg.): Dialektische Psychologie und die Zukunft der Psychotherapiewissenschaft (Festschrift für Gottfried Fischer). Kröning: Asanger.
- Bense, Max (1949/50) Theorie dialektischer Satzsysteme - Eine Untersuchung über die sogenannte dialektische Methode. In: Philosophische Studien, Bd. 1, 1949, S. 202 ff., Bd. 2, 1950, S. 153 ff.
- Bense, Max (1949) Moderne Dialektik - Neue Forschungen. In: Universitas, Stuttgart, Jg. 1, H. 4, April 1949, S. 493-495
- Blendinger, Heinrich (1947) Polarität als Weltgesetz. Stuttgart: Wunderlich.
- Bloch, Walter (1972) Polarität. Ihre Bedeutung Für Die Philosophie Der Modernen Physik, Biologie Und Psychologie.
- Bochenski, J. M. (1962) Der sowjetrussische dialektische Materialismus (DIAMAT). Dalp-Taschenbücher.
- Bochenski, J. M. (1973) Marxismus Leninismus. Wissenschaft oder Glaube. München; Bayerische Landeszentrale für Bildungsarbeit.
- Brieskorn E. (1974) Über die Dialektik in der Mathematik. In: Otte M. (1974, Hrsg.) Mathematiker über die Mathematik. Wissenschaft und Öffentlichkeit. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Cobben, Paul; Cruysberghs, Paul; Jonkers, Peter & De Vos, Lu (2006, Hrsg.) Hegel Lexikon. Darmstadt: WBG.
- Dahlke, Rüdiger (2009) Die Schicksalsgesetze. Speilregeln fürs Leben Resonanz, Polarität, Bewusstsein. 5.A. München: Goldman Arkana.
- eEisler, Rudolf (1904) Dialektik.
- Engels, Friedrich (1925) Dialektik der Natur. [Online] Zeno.org: Karl Marx, Friedrich Engels: Werke. Berlin 1962, Band 20, S. 307. Fragment. Entstanden 1873-1883, ergänzt 1885/86. Teildrucke: Der Abschnitt »Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen« erschien 1896 in der Zeitschrift »Die neue Zeit«, der Abschnitt »Die Naturforschung in der Geisterwelt« im »Illustrierten Neuen Welt-Kalender für das Jahr 1898«. Erstdruck des Manuskripts in: Marx-Engels-Archiv, Bd. 2, Moskau, Leningrad 1925.
- Erdei, Laszlo (1972) Gegensatz und Widerspruch in der Logik. Budapest: Akademiai Kiado.
- Esser, Helmut ; Klenovits, Klaus & Zehnpfennig, Helmut (1977) Wissenschaftstheorie 2 Funktionalanalyse und hermeneutisch-dialektische Ansätze. Stuttgart: Teubner.
- Fischer, Ernst Peter (1987) Sowohl als auch. Denkerfahrungen in den Naturwissenschaften. Hamburg: Rasch und Röhring.
- Flammer, August (2009). Entwicklung als dialektischer Prozess. In (127-243) Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung. Bern: Huber.
- Fogarasi, Bela (1953) Dialektische Logik. - mit einer Darstellung erkenntnistheoretischer Begriffe. Berlin: Aufbau. (auch Rotdruck 1971)
- Frischherz, Bruno (2013) Dialektische Textanalyse und Textentwicklung Teil I. und II. (Online: www.zeitschrift-schreiben.eu)
- Glasersfeld, Ernst von (1987) Wissen, Sprache und Wirklichkeit: Arbeiten zum radikalen Konstruktivismus. Braunschweig: Vieweg. [GB]
- Glockner, Hermann (1957, Hrsg.) Hegel-Lexikon. 2 Bde. A-Leibniz-Z. Bd. 23 und 24 der Jubiläumsausgabe. 2. verb. A. Stuttgart: Fromanns.
- Greiner. Josef (1986) Dialektik des Kraftbegriffs. Wien: VWGÖ.
- Guardini, Romano (1998) Der Gegensatz. Versuch einer Philosophie des Lebendig-Konkreten. 1. A. 1925. Mainz/Paderborn: Grünewald/Schöningh.
- Günther, Gotthard (1962) Das metaphysische Problem einer Formalisierung der transzendental dialektischen Logik In: Heidelberger Hegeltage 1962, Hegel Studien Beiheft 1, p. 65-123. Auch published in vordenker.de: Oct 10, 2004 (PDF).
- Günther, Gotthard (1976) Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik. Erster Band: Metakritik der Logik - Nicht-aristotelische Logik - Reflexion - Stellenwerttheorie - Dialektik - Cybernetic Ontology - Morphogrammatik - Transklassische Maschinentheorie. Hamburg: Meiner.
- Hegselmann, Rainer (1965) Formale Dialektik. Ein Beitrag zu einer Theorie des rationalen Argumentierens. Hamburg: Meiner.
- Heise, Steffen () Analyse der Morphogrammatik von Gotthard Günther. Klagenfurter Beiträge zur Technikdiskussion Heft 50
- Höhl, Gudrun & Kessler, Herbert (1974, Hrsg.) Polarität als Weltgesetz und Lebensprinzip. Mannheim: Verlag der Humboldtgesellschaft.
- Hörz, H. (1968). Der dialektische Determinismus in Natur und Gesellschaft. Berlin: VEB Verl. D. Wissenschaften. [PDF im Internet]
- Hoffmann, Dieter (1990, Hrsg.) Robert Havemann, Dialektik ohne Dogma. Aufsätze, Dokumente und die vollständige Vorlesungsreihe zu naturwissenschaftlichen Aspekten philosophischer Probleme. Berlin: DVdWis.
- Holz, Hans Heinz (1997) Einheit und Widerspruch. Problemgeschichte der Dialektik in der Neuzeit. 3 Bde. Bd. 3: Die Ausarbeitung der Dialektik. Stuttgart: Metzler.
- Holz, Hans Heinz & Losurdo, Domenico (1996, Hrsg.) Dialektik-Konzepte. Topos, Heft 7. Bonn. Pahl-Rugenstein Nachfolger.
- Hubig, Christoph (1978) Dialektik und Wissenschaftslogik: Eine sprachphilosophisch- handlungstheoretische Analyse. Berlin: de Gruyter.
- Jaeschke, Walter (2016) Hegel-Handbuch. Leben - Werk - Schule. 3. A. Stuttgart: Metzler.
- Jakowenko, Boris (1936) Zur Kritik der Logistik, der Dialektik und der Phänomenologie. Prag: Internationale Bibliothek für Philosophie. Periodische Sammelschrift Bd. II, Nr. 3/4, März-April,
- Jooß, Christian (2017) Selbstorganisation der Materie: Dialektische Entwicklungstheorie von Mikro- und Makrokosmos. Neuer Weg.
- Kopnin, P. V. (russ. 1969, dt. 1970) Dialektik - Logik - Erkenntnistheorie. Lenins philosophisches Denken - Erbe und Aktualität. Berlin: Akademie-Verlag.
- Kesselring, Thomas (1981) Entwicklung und Widerspruch. Ein Vergleich zwischen Piagets genetischer Erkenntnistheorie und Hegels Dialektik. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Kesselring, Thomas (1984) Die Produktivität der Antinomie. Hegels Dialektik im Lichte der genetischen Erkenntnistheorie und der formalen Logik. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Kesselring, Thomas (2013) Formallogischer Widerspruch, dialektischer Widerspruch, Antinomie. Reflexionen über den Widerspruch. In (15-38) Müller, Stefan (2013, Hrsg.)
- Kesselring, Thomas (1991) Rationale Rekonstruktion von Dialektik im Sinne Hegels. In (273-303) Angehrn, E.; Fink-Eitel, H.; Iber, Chr. & Lohmann, G. (1991, Hrsg.): Dialektischer Negativismus. M. Theunissen zum 60. Geburtstag. Frankfurt: Suhrkamp.
- Kesselring, Thomas (2010) Paradoxien und Widersprüche – ihre Rolle in der Psychotherapie. In (9-33) Barwinski, R. et al. (2010, Hrsg.)
- Kesselring, Thomas (2010) Widerspruch und Antinomie. Zwei unterschiedliche logische Phänomene mit Bedeutung für die Psychotherapie. In: Psychotherapie Forum. Wien/New York: Springer, 2010, Heft 2, pp.108-115.
- Klaus, Georg (1966) Moderne Logik. Berlin: VEB Wiss.
- Klaus, Georg & Buhr, Manfred (1969, Hrsg.) Philosophisches Wörterbuch. 2 Bde. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.
- Kobusch, Theo (1987) Sein Und Sprache: Historische Grundlegung Einer Ontologie Der Sprache. Leiden: Brill. [GB]
- Köhne, Otto (1993) Die Urheber Der Abendländischen Polaritätslehre Lehren Und Bedeutung Für Die Gegenwart.
- Köhne, Otto (1981) Polarität. Einführung in die Polaritätstheorie. Mannheim: Sokrates.
- Kondakow, N. I. (dt. 1978 russ. 1975). Wörterbuch der Logik. Berlin: Das europäische Buch.
- Kopnin, P. V. (russ. 1969, dt. 1970) Dialektik - Logik - Erkenntnistheorie. Lenins philosophisches Denken - Erbe und Aktualität. Berlin: Akademie-Verlag.
- Leinfellner, Elisabeth & Leinfellner, Werner (1978) Ontologie Systemtheorie und Semantik. Berlin: Duncker & Humblot. [GB]
- Lorenzen, Paul (1962) Das Problem einer Formalisierung der Hegelschen Logik. Koreferat zu einem Vortrag von G. Günther, in: Hegel-Studien Beiheft 1.
- Lorenzen, Paul (1962) Szientismus versus Dialektik. In: Hermeneutik und Dialektik, H. G. Gadamer zum 70. Geburtstag, hrsg. v. R. Bubner u. a., Tübingen 1970, Bd. 1, S.57ff.
- Marcuse, Herbert (1989) Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit. Frankfurt aM: Suhrkamp. [wenig ergiebig zur Frage der Ontologie]
- Markin, Vladimir & Zaitsev, Dmitry (2017,ed.) The Logical Legacy of Nikolai Vasiliev and Modern Logic.
- Maximov, Dmitry (2017) N. A. Vasil’ev’s Logic and the Problem of Future Random Events. Axiomathes April 2018, Volume 28, Issue 2, pp 201–217
- Mikirtumov, Ivan B. () The laws of reason and logic in Nikolai Vasiliev’s system.
- Mittelstraß, Jürgen (1980-1996, Hrsg.). Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. 4 Bde. Die ersten beiden Bände erschienen bei BI, Mannheim. Die letzten beiden Bände bei Metzler, Stuttgart. 2. Auflage 2005 ff.
- Müller, Stefan (2011) Logik, Widerspruch und Vermittlung. Aspekte der Dialektik in den Sozialwissenschaften. Wiesbaden: Springer.
- Müller, Stefan (2013, Hrsg.) Jenseits der Dichotomie Elemente einer sozialwissenschaftlichen Theorie des Widerspruchs. Wiesbaden: Springer.
- Piaget, Jean (fr 1968, dt. 1973) Strukturalismus und Dialektik. In (103-109) Der Strukturalismus. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Piaget, Jean (fr 1970, dt. 1974) Genetische Erkenntnistheorie. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Popper, Karl (1970) Was ist Dialektik. In (261-290) Topitsch, Ernst (1970, Hrsh.) Logik der Sozialwissenschaften. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Preuß, Gisela (1980, Hrsg) Schülder-Duden. Das Wissen von A-Z. Mannheim: BI.
- Puntel, Lorenz B. (1996) Läßt sich der Begriff der Dialektik klären? Journal for General Philosophy of Science – Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, Vol. 27, No.1, 131-165. [Online]
- Rauschenberger, Walther (1951) Das Weltgesetz der Polarität, Frankfurt aM: Selbstverlag.
- Ridder, Lothar (2002) Mereologie Ein Beitrag zur Ontologie und Erkenntnistheorie. Frankfurt aM: Klostermann.
- Reich, W. (1934). Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse. [PDF im Netz]
- Ritsert, Jürgen (2017) Summa Dialectica. Ein Lehrbuch zur Dialektik. Weinheim: Beltz.
- Schwemmer, Oswald (2005) Dialektik, In Mittelstraß (2005, Hrsg,).
- Seiffert, Helmut (1973) Einführung in die Wissenschaftstheorie Band 1 Sprachanalyse, Deduktion, Induktion in Natur- und Sozialwissenschaften. 6. A. München: Beck.
- Seiffert, Helmut (1983) Einführung in die Wissenschaftstheorie Band. 2 Geisteswissenschaftliche Methoden: Phänomenologie - Hermeneutik und historische Methode - Dialektik. 8. üe A. München: Beck.
- Simon-Schaefer, Roland (1973) Dialektik Kritik eines Wortgebrauchs. Stuttgart: Fromanns.
- Sinowjew, A. A. (dt. 1970, russ.1967). Komplexe Logik. Grundlagen einer logischen Theorie des Wissens. Berlin: VEB d.Wiss.
- Sinowjew, A. A. (dt. 1968, russ.1968). Über mehrwertige Logik. Ein Abriß. Braunschweig: Vieweg.
- Sinowjew, A. & Wessel, H. (1975). Logische Sprachregeln. München: Fink. [Biographie]
- Stöhr, Hans-Jürgen (1983) Dialektik und Physik 2. Philosophische Probleme in der physikalischen Forschung. Rostock: Wilhelm-Pieck-Universität.
- Stuckenschmidt, Heiner (2009) Ontologien: Konzepte, Technologien und Anwendungen. Heidelberg: Springer. [GB]
- Svilar, Maja & Zahler, Peter (1984. Hrsg.) Selbstorganisation der Materie? Bern: Lang.
- Topitsch, Ernst (1970, Hrsg.) Logik der Sozialwissenschaften. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Ulbricht, Heinz & Schmelzer, Jürn (1983. Hrsg.) Dialektik und Physik 1. Zur Dialektik der Entwicklung physikalischer Theorien. Rostock: Wilhelm-Pieck- Universität.
- Vasil'év, Nicolas A. (1993) Logic and metalogic Axiomathes December 1993, Volume 4, Issue 3, pp 329–351
- Vasil’ev, Nikolai Aleksandrovich. 2003. Imaginary (non-Aristotelian) Logic. Translated by Roger Vergauwen and Evgeny A. Zaytsev. Logique et Analyse 46(182): 127–163. Engl. transl. of “Voobrazhaemaia (nearistoteleva) logika”.
- Wandschneider, Dieter (1995) Grundzüge einer Theorie der Dialektik. Stuttgart:
- Wandschneider, Dieter (1997): Zur Struktur dialektischer Begriffsentwicklung. In (114-169): Wandschneider, Dieter (1997, Hrsg.) Das Problem der Dialektik. Bonn: S.114-169
- Wetter, Gustav A. (1963) Dialektischer und historischer Materialismus. Frankfurt aM: Fischer.
- Winter, Reiner (o.J.) Was ist Dialektik? PDFOnline.
- Wundt, Max (1949) Hegels Logik und die moderne Physik. Köln: Westdeutscher Verlag.
Specht, Ernst Konrad (1967) Sprache und Sein: Untersuchungen zur sprachanalytischen Grundlegung der Ontologie, Berlin: De Gruyter. [GB]
Links (Auswahl: beachte) > Quellen und Materialien.
Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort. > Eigener weltanschaulicher Standort.
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Coincidentia Oppositorum Aufhebung der irdischen Widersprüche im Unendlichen, im göttlichen All (bei Nikolaus von Kues und Giordano Bruno) [Quelle Duden]
__
dialektischer Materialismus nach Wirtschaftslexikon24 (Ausgabe 2018)
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/dialektischer-materialismus/dialektischer-materialismus.htm
__
Elenktik Kunst des Beweisens, Widerlegens, Überführens. Methode von Sokrates, wie Metzelers Lexikon der Philosophie darlegt. https://www.spektrum.de/lexikon/philosophie/elenktik/537
__
Engels' Hegel-Kritik
"Es ist also die Geschichte der Natur wie der menschlichen Gesellschaft, aus der die Gesetze der Dialektik abstrahiert werden. Sie sind eben nichts andres als die allgemeinsten Gesetze dieser beiden Phasen der geschichtlichen Entwicklung sowie des Denkens selbst. Und zwar reduzieren sie sich der Hauptsache nach auf drei:
- das Gesetz des Umschlagens von Quantität in Qualität und umgekehrt;
- das Gesetz von der Durchdringung der Gegensätze;
- das Gesetz von der Negation der Negation.
__
Flammer unterscheidet 7 Faktoren
Flammer, August (2009). Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung. 4. A. Bern: Huber, S. 18:
- "1.2 Entwicklung 18
1.2.1 Entwicklung = Abfolge alterstypischer Zustandsbilder? 18
1.2.2 Entwicklung = Veränderung? 18
1.2.3 Entwicklung = reifungsbedingte Veränderungen? 19
1.2.4 Entwicklung = Veränderungen zum Besseren oder Höheren? 19
1.2.5 Entwicklung = qualitative resp. strukturelle Veränderungen? 20
1.2.6 Entwicklung = universelle Veränderungen? 21
1.2.7 Entwicklung = Sozialisation? 22"
Internetseite
Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren, geben wir nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia, DER SPIEGEL)
__
Mary 2009
Mary bringt viele Beispiele von Werteverkündern und ihrer dazu widersprüchlichen Lebenspraxis:
- S. 61 "Nehmen wir als Beispiel die Kindererziehung.
Man schickt I seine Kinder auf eine Schule, damit sie dort zu Freiheit
und Selbstbestimmung herangezogen werden. Durch die autoritäre Weisung
»Du gehst zur Schule«, die notfalls mit Ordnungsamt und Polizeikraft
durchgesetzt wird, verstößt man jedoch automatisch gegen Freiheit
und Selbstbestimmung."
S. 62 "Der Rat der EU erlässt Gesetzte, die für alle Mitgliedsländer Geltung haben. Er tagt grundsätzlich nicht öffentlich: »Diese demokratische Perversität kommentiert der frühere Präsident des Europäischen Parlaments, Hänsch, so: »Das hat es in der westlichen Welt noch nie gegeben, jedenfalls unter den Demokratien nicht, dass ein Gesetzgebungsorgan hinter verschlossenen Türen tagt und seine Beschlüsse im Geheimen fasst.«1"
S. 63a "Wie man sieht, ist es schon in der Familie unmöglich, sein Verhalten auf bestimmte Werte festzulegen oder an diesen auszurichten. Nicht anders verhält es sich im gesellschaftlichen Bereich. Wenn die Gesellschaft sich beispielsweise auf Freiheit festlegt, gewinnen die Starken, und die Schwachen verlieren, was unsolidarisch ist. Jede gesetzliche Regelung, die dann zur Wahrung der Solidarität eingeführt wird, schränkt die Freiheit ein. Solchermaßen erzwungene Solidarität richtet sich nun gegen den Wert der Selbstverantwortung. Baut man dann mehr auf Selbstverantwortung, wird man automatisch ungerecht. Und so weiter und so fort."
S.63b "Mitgefühl Nach dem Besuch des Kinderhospizes »Sternenbrücke« zeigte sich Hamburgs Bürgermeister Ole von Beust emotional beeindruckt. Er appellierte an die Hamburger: »Bitte unterstützen Sie dieses Projekt mit Spenden.«3 Auf die Idee, das undichte Dach des Sterbehauses aus Mitteln der Stadt erneuern zu lassen, kam von Beust nicht. Stattdessen fördert er lieber prestigeträchtige Großprojekte im Hafengebiet."
Quelle. Mary, Michael (2009) Werte im Schafspelz. Bergisch-Gladbach: Lübbe.
- "Kommunikation strukturiert Abhängigkeit zwischen unabhängigen
Elementen auf eine Art und Weise, die beides, Abhängigkeit und Unabhängigkeit,
zugleich unterstreicht ... [Dafür ist der Wert sozusagen ideal; M.
Mary] weil er bindet und offenlässt zugleich. Der Wert des Wertes
besteht darin, ein hoch empfindliches Netzwerk wechselseitiger Bestimmung
zu schaffen, in der jeder Wert zugleich ein Freiheitsgrad ist. Man kann,
muss ihm aber nicht folgen, sondern kann auf andere Werte ausweichen. Dadurch
kommen nie einzelne Werte als Lösungen infrage, auf die die Gesellschaft
sich festlegen muss. Dieses gleichzeitige Binden und Offenlassen ist wohl
die wichtigste Aufgabe des Wertes.3"
Moeglichkeiten einer dialektischen Logik
1) A = A+ UND A-. Der Widerspruch ist dann in A "versteckt", kann also auch aussagelogisch nicht mehr stören. Dahinter stehen dann Vorstellungen etwa folgender Art: Ein Dialektischer Sachverhalt Sd besteht aus zwei Teilen: Sd = Sd+ und Sd-. Sd kann auch Einheit der Gegensätze oder das Ganze genannt werden. Sd+ und Sd- heißen auch die Gegensätze des dialektischen Sachverhalts Sd.
2) A UND -A := wd (dialektisch wahr). Man definiert dialektische Wahrheitstafeln.
__
stipulieren
Ausdruck bei Gotthard Günther. Duden: "1. vertraglich vereinbaren, übereinkommen 2. festlegen, festsetzen
Synonyme zu stipulieren abmachen, abschließen, aushandeln, ausmachen, sich einigen, festmachen, schließen, übereinkommen, vereinbaren, sich verständigen"
__
Zellsterben
- "Wie viele Zellen sterben jeden Tag in deinem Körper? Weit mehr als wir Haare auf dem Kopf haben! Und mit Sicherheit mehr als es Autos auf unseren Straßen gibt! Täglich sterben nämlich zwischen 50.000.000.000 und 70.000.000.000 Zellen in unserem Körper..." [science.lu 21.11.2013, Abruf 29.10.19]
- "Bei einem erwachsenen Menschen sterben in jeder Sekunde rund 50 Millionen Zellen ab – das hört sich viel an, entspricht aber aneinandergelegt allenfalls einer ein Kilometer langen Zellenkette. Zudem werden in jeder Sekunde auch beinahe genauso viele Zellen neu gebildet, so dass die Bilanz unterm Strich fast ausgeglichen ist. Aber eben nur fast, denn der erwachsene Mensch baut nach und nach ab." [Spektrum.de 27.07.2003 Abruf 29.10.19]. Das ergibt auf einen Tag hochgerechnet: 4.32*10^12, also rund 4 Billionen.
- RP online (ohne Datum; Abruf 29.10.19): "
- Augenzellen Diese Zellen halten ein Leben lang. Dies ist jedoch problematisch: Durch die Abnutzung der äußeren Netzhaut-Zellen kommt es im Alter zu Sehmängeln.
- Blutzellen legen eine Strecke von 1600 Kilometern zurück, bevor sie nach ungefähr 120 Tagen sterben. Ihr "Friedhof" befindet sich in der Milz.
- Darmzellen 1,4 Tage lang ist das Leben von Dünndarmzellen im Schnitt, im Dickdarm ist ihre Lebenserwartung etwas höher: zehn Tage.
- Schweißdrüsenzellen Diese halten ein Leben lang, werden also auch nicht erneuert.
- Nervenzellen Auch die Nervenzellen erneuern sich zeitlebens nicht.
- Hautepidermis Die Zellen der Oberhaut haben sich nach durchschnittlich 19,2 Tagen neu gebildet.
- Knochenzellen Sie haben eine "Haltbarkeitsdauer" von ca. 25-30 Jahren.
- Hirnzellen Die weitverbreitete Ansicht, dass sich Hirnzellen nicht mehr regenerieren würden, ist falsch. Auch wenn für 100 abgestorbene Zellen nur ein bis zwei Stück "nachwachsen".
- Lymphozyten (Zellen des Immunsystems) Die Lebenserwartung dieser Zellen ist unterschiedlich. So können sie 5 Tage oder sogar Jahre alt werden.
- Magenzellen Sie leben nicht lange. Nach 1,8 Tagen werden sie von Nachfolgezellen ersetzt.
- Zellen der Harnblase Sie existieren durchschnittlich 66 Tage.
Standort: Begriffsanalyse und Untersuchungen zur Dialektik.
*
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen.
Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Wissenschaft site: www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, R. (DAS). Begriffsanalysen und Untersuchungen zur Dialektik Haupt- und Verteilerseite. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Dialektik/BA_Dial0.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_ Begriffsanalyse Dialektik Haupt-/Verteilerseite__Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_
2. Teil inhaltliche Prüfung irs 02.12.2019 / 1. Teil inhaltliche Prüfung irs 1.12.2019 / Rechtschreibprüfung: irs 26.11.2019 / erst-korrigiert: irs 18.11.2018
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
21.11.20 LitErg.
02.12.19 Korrektur.
26.11.19 Rechtschreibprüfung und Rechtschreib-Korrektur.
20.11.19 Grundversion erstmals ins Netz gestellt.
18.11.19 Vorläufiger Abschluss noch nicht end-korrigiert.
22-23.10 Weitere Differenzierungen und Präzisierungen der Referenzwelten.
21.10.19 Stand vergegenwärtigt.
02.-10.19 Bis 21. Oktober unterbrochen für die Auswertung der ersten 10 rechtswissenschaftlichen Werke.
00.02.19 Analysen und Ausarbeitungen bis 21.2.2019 fortgesetzt.
03.12.18 Unterbrochen bis 5.1.19
10.11.18 Weil zu groß geworden, zerlegt und einige Bereiche ausgelagert.
07.11.18 Vorläufiger organisatorischer Abschluss
01.11.18 angelegt
Interne Notizen
« » » «
