(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=29.12.2024 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 19.05.25.
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Axiomregister Psychologie_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Axiomregister Psychologie
besonders zu Erleben und Erlebnis
Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen
Standort: Axiomregister Psychologie * Haupt- und Verteilerseite Axiome in der Psychologie * Checkliste Axiome. * ChatGPT zu Axiomen in der Psychologie.
Methoder der Textanalyse * Anfangsproblem * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Checkliste-Beweisen. Beweisregister Psychologie * Fundstelleninformationen * Beweis und beweisen in der Psychologie * natcode Register * Übersicht Beweisseiten * ist-Bedeutungen * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Definition und definieren: referenzieren * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhöfe * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse * Hauptbedeutungen Erleben * »«
Inhaltsverzeichnis
- Editorial.
- Z1-Traditionelle-Bedeutung.
- Z2-Gebrauch.
- Z3-Geschichte.
- Z4-Wissenschaftstheoretische-Praxis.
- Z5-Basis.
- Z-Fazit.
Zusammenfassung.
Chronologisches Axiomregister.
Alphabetisches Axiomeregister.
Sachliches, thematisches Axiomregister.
_
Zitierstil.
Definitionsregister Psychologie * Checkliste definieren.
Beweisregister Psychologie * Checkliste beweisen. *
Natcoderegister Psychologie * Checkliste natcode *
Erlebnisregister Psychologie.
Signierungen und Signierungssystem.
Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen
_
Editorial > Editorial Hauptseite.
Auf dieser Seite wird nach der Methode der Textanalyse der Gebrauch des Wortes Axiom und seiner Verwandten hauptsächlich in der Psychologie zusammengetragen, dokumentiert und belegt. Ausgrund der großen geistes- und wissenschaftsgeschichtlichen Bedeutung wurden auch andere aufgenommen wie z.B. Aristoteles, Euklid, Einstein & Infeld, Hilbert, Kant, Newton, Russell.
Hierzu werden nach dem Modell des BeweisRegisters drei Register gebildet: Chronologisches -, Alphabetisches nach AutorInnen und sachlich-thematisches Axiomregister und im Laufe der Zeit mehr und mehr ergänzt, so dass sich ein repräsentatives Bild für die Psychologie ergibt.
Zusammenfassung Axiome in der Geschichte der Psychologie
Z1-Traditionelle-Bedeutung. Axiome sollten nicht beweisbar, aber nützlich für Beweise; hinreichend allgemein; grundlegend; wichtig; klar und einsichtig sein. Der Axiombegriff drückt eine gewisse Erhöhung gegenüber Annahmen, Grundlagen oder Voraussetzungen aus.
Z2-Gebrauch. Der Wortgebrauch ist sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Der Wortgebrauch wird mit der Methode der Textanalyse erfasst (Suchtexte zum Thema Axiome in der Psychologie). Alphabetisch geordnete Bedeutungszuweisungen:
- Anfang
- Annahme: Axiom als Annahme, z.B. Vaihinger 1911, 58.1: "Es ist noch eine Frage, ob nicht auch manche als Axiome oder Postulate aufgestellten Annahmen zu Hypothesen und von da sogar zu Fiktionen herabsinken könnten; solche allmählichen Degradationen sind ja schon oft dagewesen. ..."
- Bestätigt: Axiom durch Erfahrung und die Natur bestätigkeit, z.B. Newton.
- Beziehungsregler (von Sachverhalten). Axiom als Beziehungsregler, Stumpf 1939, S. 14 unter Bezugnahme auf Hilbert (Grundlagen der Geometrie).
- Definition: Axiom als Definition Burt 1940, p. 47, Stumpf 1939, S. 131.2 interpretiert hier Axiome als verkleidete Definitionen.
- Erstes Axiom In der Logik nach Stumpf 1939, S. 131.3 der Satz der Identität, S. 205 "A ist A"
- Expliziter Gebrauch. Hier werden Axiome oder Synonyme ausdrücklich so benannt, z.B. G. E. Müller, Euklid.
- Fiktion: Axiom als Fiktion (Vaihinger 1911) und damit nützlich (pragmatische Begründung), S. 56: "Neumann nannte auch das Gesetz der Erhaltung der Kraft, sowie eine Reihe mathematischer Axiome und Postulate blosse fiktive Annahmen. ..."
- Folgerungsaxiome nach Stumpf 1939, S.154
- Grundsatz: Axiom als unmittelbar einsichtiger Grundsatz, der weder beweisbar ist noch bewiesen werden muss, z.B. bei Pascal "2. Zu Axiomen darf man nur völlig aus sich selbst evidente Dinge wählen." So auch Aristoteles, Bühler 1934, S. 22; Stegmüller 1958.
- Heimliche Axiome, Wertheimer (1945, dt.1957), S. 73, Selbstverständichkeiten bezeichnet Wertheimer auch als "heimliche Axiome", z.B. dass sich Form und Größe eines Dreiecks nicht verändern, wenn man es verschiebt. Das kommt meiner Idee von Axiomen im Alltag nahe, die wir gar nicht als solche bemerken.
- Idealisierung: Axiom als Idealisierung ähnlich wie bei Gesetzen, die empirisch nie so rein gegeben sind, wie es ihre Formulierung in Größengleichungen ausdrückt.
- Impliziter und nicht ausdrücklich als Axiom ausgewiesener Gebrauch, der vielfach, vor allem im Alltag, nicht bewusst ist. Hier wird ein Sachverhalt wie ein Axiom genutzt, z.B. dass es eine Außenwelt gibt, dass alles Gründe hat, dass man seiner inneren Wahrnehmung vertraut.
- Konvention: Axiom als Konvention, z.B. Hume, Poincaré., Stumpf 1939,
- Kriterien / Merkmale von Axiomen
- Einfach nach Stumpf 1939, S.68
- Einsichtig.
- Evidenz (in dt. Bedeutung), Wundt 1896, S.382; Piaget 1972,
- Folgenreich nach Stumpf 1939, S.68
- Gültigkeit (a priori, allgemein und überhaupt, spezifisch)
- Klar.
- Notwendigkeit nach Stumpf 1939, S. 127
- Selbstverständlich nach Stumpf 1939, S. 127 am Beispiel des Satzes vom Widerspruch. Auch Wertheimer (1945, dt. 1957), S. 73.
- Verständlich.
- Wichtig.
- Willkürlich nach Stumpf 1939, S.68: "... willkürlich angenommene Vordersätze ..."
- Modell: Axiom als Modellannahme. Der Axiombegriff wird in der Psychologie im Sinne von prüfbaren Modellannahmen vielfach falsch verwendet. Was prüfbar ist, sollte nach traditionellen Auffassungen kein Axiom sein, z.B. Entscheidungstheorie (z.B. Bröder, Luce; F.A. Müller; Gigerenzer);
- Postulat: Axiom als Postulat oder Forderung, die erfüllt sein muss, z.B. bei Hull., Vaihinger 1911, S. 58.1 "Es ist noch eine Frage, ob nicht auch manche als Axiome oder Postulate aufgestellten Annahmen zu Hypothesen und von da sogar zu Fiktionen herabsinken könnten; solche allmählichen Degradationen sind ja schon oft dagewesen. ..." Die APA (update 2018) setzt Axiom und Postulat gleich; auch Pospeschill 2013.
- Prinzip: Axiom als Prinzip, das grundlegend gelten soll, z.B. der Satz vom Widerspruch, es kann nicht etwas und zugleich sein Gegenteil gelten. F.A. Müller 1882), S. 3: "... des Fechner'schen Prinzips, des Axioms, ..."
- Regel: Axiom als Regel, z.B. der Modus ponens in der Logik; ChatGPT widerspricht.
- Richtig/Falsch: Axiom als richtig oder falsch, z.B. F.A. Müller (1882), S. 56: "... Das Fundament der Psychophysik ist ein verfehltes, weil das Axiom der Psychophysik, es bestehe funktionaler Zusammenhang zwischen Empfindung und Reiz, falsch ist. ..."
- Satz. Axiom als allgemeiner Satz. Stumpf 1939, S.7, auch Vordersatz nach Stumpf 1939, S.68; Bühler 1934, S. 21, 22, 23.
- Unmittelbare Vernunfterkenntnis nach Stumpf 1939, S. 128 mit Beispiel Satz vom Widerspruch, Stumpf 139.3, S. 150 "... Vor [>150] läufig, beim gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnis, wird der Satz
- Unvollständigkeit: Axiome unvollständig, z.B. Gödel.
- Voraussetzung: Axiom als Voraussetzung, z.B. Reusser 1984 "... drei Voraussetzungen oder Axiome ..." Nach Stumpf 1939, S. 97, setzten große Mathematiker sehr allgemeine Begriffe voraus
- Widerspruchsfrei. Axiome sollen in sich und gegenüber anderen Axiomen derselben Basis widerspruchsfrei sein.
- Willkürlichkeit, Sinn und Sinnlosigkeit von Axiomen. Einstein nach Wertheimer (1945, dt.1957), S. 207: "... Einsteins erste Erwiderung war, daß wir in der Wahl von Axiomen völlig frei seien. „Es gibt keinen solchen Unterschied, wie Sie ihn voraussetzen“, sagte er, „zwischen sinnvollen und willkürlichen Axiomen. Die einzige Tugend von Axiomen ist, daß sie grundlegende Voraussetzungen liefern, aus denen man Schlüsse ziehen kann, die mit den Tatsachen übereinstimmen. ... Aber dann ging Einstein lächelnd dazu über, mir ein besonders hübsches Beispiel eines sinnlosen Axioms zu geben: „Man könnte natürlich, sagen wir, die Schallgeschwindigkeit anstelle der Lichtgeschwindigkeit wählen. ..."
| Ein Hauptsatz der Wissenschaftstheorie zum Anfang lautet: Irgendwo muss man anfangen und diesen Anfang kann man nicht beweisen und muss ihn folglich als gültig und wahr annehmen. Solche Anfangsannahmen wurden als Axiome bezeichnet und kann man auch als Axiome bezeichnen. Axiome bedeuten in diesem Sinne nichts anderes als erste Sätze, die man unbewiesen als wahr und gültig annimmt, um einem unendlichen Zurückschreiten zu entgehen.. |
besser noch in der Reihe der Axiome mit aufgeführt."
Z4-Wissenschaftstheoretische-Praxis.
- Z4.1 In der Psychologie völlig unterentwickelt. Sie ist - wie schon bei den Beweisen - ausgesprochen dürftig mit Ausnahme mathematisch dominierter Bereiche wie z.B. Statistik, Mess- und Testtheorie.
- Z4.2 Aber gerade in Statistik, Mess- oder Testtheorie der Axiombegriff nicht selten falsch verwendet im Sinne von prüfbaren Modellannahmen.
- Z4.3 Wenn auch ein Axiom selbst meist als nicht beweisbar gilt, so gilt das keinewegs für seine Kriterien, die aber in der wissenschaftlichen Praxis so gut wie nie begründet werden. Ob ein Axiom z.B. einleuchtend, verständlich, klar, anerkannt oder nützlich ist, kann natürlich empirisch untersucht, bestätigt oder widerlegt werden.
- B01 Grundbegriffe und Begriffe.
- B02 Annahmen oder Voraussetzungen.
- B03 Methoden der Erkenntnisgewinnung und Sicherung.
- B04 Regeln, allgemeine und spezielle.
- B05 Basissätze, Sätze, Befunde.
- B06 Gültigkeitsbereich.
Methode der Textanalyse
Die Methode der Textanalyse gilt auch für das Thema Axiome.
Suchtexte zum Thema
Axiome in der Psychologie
Die wichtigsten Suchtexte sind "axiom", "Postulat",
"Prinzip", "Grundsatz", "Annahme", "annehm", "angenommen", "annimmt", "Grundvoraussetzung",
"Basis".
Chronologisches Axiomregister
- 360-330-v.Chr.-Aristoteles ChatGPT:
- „Analytica Posteriora“ (71b9-12): Axiome sind notwendige, unbeweisbare Prinzipien.
- „Metaphysik“ (1005b19-20): Satz vom Widerspruch als grundlegendes Axiom.
- „Metaphysik“ (1011b23-24): Prinzip des ausgeschlossenen Dritten.
- „Analytica Posteriora“ (100b5-18): Erkenntnis von Axiomen durch intuitive Vernunft (nous).
- „Topik“ (100a25-100b20): Abgrenzung von Axiomen und Postulaten.
- 300 v.Chr. Euklid verfasste vermutlich um diese Zeit seine Elemente. > Euklid 8.
- 1687-Newton (1643-1726) Hierzu ChatGPT:
- Euclid (Euklid): Newton orientiert sich an der geometrischen Struktur von Euklids Elemente, wo Axiome die Basis deduktiver Systeme bilden.
- Galileo Galilei: Die empirischen Beobachtungen Galileis zur Bewegung bildeten die Grundlage für Newtons Formulierung der Axiome.
- René Descartes: Newton reagiert auch auf Descartes, der ebenfalls universelle Prinzipien formulierte, aber stärker auf mechanistische Modelle setzte.
- 1755-1804 Kants Schaffenszeit (Lebenszeit (1724-1804) Fundstellen "axiom" 134 im Bonner Kant-Korpus (Abruf 24.12.2024).
- 1777-Tetens. Tetens, Johann Nikolaus (1777) Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung, Band 2. Leipzig: Weidmannns Erben und Reich. [GB] [DTA]
"Aristoteles definiert die Rolle der Axiome explizit in der „Analytica Posteriora“ (Erstes Buch, Kapitel 2, 71b9-12):
- „Denn es gibt gewisse Dinge, über
die wir mit Notwendigkeit Gewissheit haben müssen – und zwar nicht
durch Beweisführung, sondern an sich –, wenn wir etwas lernen sollen.
Denn es ist unmöglich, alles zu beweisen, da man so ins Unendliche
fortschreiten müsste; und so gibt es letztlich Prinzipien, die nicht
beweisbar sind. ...
Zusammenfassung mit Belegen
"Newton steht in einer Tradition von Wissenschaftlern, die den Begriff „Axiom“ aus der antiken Philosophie übernommen und an die Bedürfnisse der modernen Wissenschaft angepasst haben:
ChatGPT Eine Abfrage am 25.12.2024 "Was genau verstand Kant unter einem Axiom und gibt es dafür Belege? Hat sich sein Verständnis gewandelt?" führt zum "Fazit: Kant verstand Axiome als synthetische Urteile a priori, die unmittelbar einsichtig sind und auf der reinen Anschauung basieren. Diese Definition ist in der "Kritik der reinen Vernunft" grundlegend und bleibt in seinen späteren Werken stabil."
S. 131

- 1794-Fichte (1762-1814) Fichte, Johann Gottlieb (1994) Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. Leipzig: Gabler. Obwohl man gerade von einer Wissenschaftslehre erwarten sollte, dass der Begriff des Axioms gebraucht und erläutert wird, ist das bei Fichte hier merkwürdigerweise nicht der Fall. Fundstellen "Annahme" 4, "axiom" 0; "beweis" 3 (u.a. Die Beweise des gesunden Menschenverstandes S.55); "Grundsatz" 2; "Postulat" 0; "Prinzip" 0; "Voraussetz" 2;
- 1797-Fichte (1762-1814) 5,6,7 oben Faksimile "Inhaltsanzeige".
- 1835-Fichte (1762-1814) Nachgelassene Werke Bd. 3, System der Sittenlehre. 4 Fundstellen "axiom" ohne Erläuterung, was er unter Axiom versteht:
- 231.1: "... was dem Axiome, dem ich und alle meine Bekannten ..."
- 231.2: "... Was aber Ihr und Ihrer Bekannten Axiom anbelangt, dass die Welt im Ganzen sich stets gleich bleibe, ..."
- 239: "... Wir erklären nicht nur für eine Abgeschmacktheit, sondern zugleich auch für eine boshafte Unverschämtheit die Behauptung, daß es irgend eine feste und ausgemachte Wahrheit gebe ; wir erklären für unwidersprechliches Axiom, daß es unabänderliches Schicksal des ganzen Menschengeschlechtes sei , in derselben Planlosigkeit, Verworrenheit und denselben Widersprüchen umher geworfen zu werden, in denen auch wir uns befinden. ..."
- 248: "E. Ich konnte diese Antwort voraussehen. »Die Principien werden durch keine Zeit, und keiner Zeit Ereigniß geändert; nur die Anwendung derselben wird bestimmt durch den Stoff, den die Zeit darbietet.« — Wer kennt nicht diese Axiome? Sollte es aber wirklich nur eine Ausdehnung der Sphäre sein, und nicht vielmehr eine Umänderung des Princips selber, das sich Ihnen als unzulänglich bewährt hätte, was ich Ihnen zutrauen und an Ihnen zu bemerken glaube?"
- 1838-Krug Axiom in Krugs enzyklopädisch-philosophisches Lexikon, 5. Band, S. 133 GB:
- 1854-Grimm'sches Wörterbuch. Kein Eintrag "Axiom" [Online]
- 1866-Wundt (1832-1920) Wundt, Wilhelm (1866) Die physikalischen Axiome und ihre Beziehungen zum Causalprinzip. Erlangen: Enke.
- 1) Alle Ursachen in der Natur sind Bewegungsursachen.
- 2) Jede Bewegungsursache liegt ausserhalb des Bewegten.
- 3) Alle Bewegungsursachen wirken in der Richtung der geraden Verbindungslinie ihres Ausgangs- und Angriffspunktes.
- 4) Die Wirkung jeder Ursache verharrt.
- 5) Jeder Wirkung entspricht eine ihr gleiche Gegenwirkung.
- 6) Jede Wirkung ist aequivalent ihrer Ursache."
- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Wundt hat 1866 sechs physikalische Axiome aufgestellt. Wie wurde diese Arbeit von der Naturwissenschaft, insbesondere den Physikern aufgenommen und welche Geschichte hat diese Arbeit genommen?
- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Zu den 6 einzelnen Axiomern hat ChatGPT sich nicht geäußert.
- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Hm, ich habe auf S.6 folgende Axiome gefunden: "1) Alle Ursachen in der Natur sind Bewegungsursachen. 2) Jede Bewegungsursache liegt ausserhalb des Bewegten. 3) Alle Bewegungsursachen wirken in der Richtung der geraden Verbindungslinie ihres Ausgangs- und Angriffspunktes. 4) Die Wirkung jeder Ursache verharrt. 5) Jeder Wirkung entspricht eine ihr gleiche Gegenwirkung. 6) Jede Wirkung ist aequivalent ihrer Ursache."
- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne, beides: Axiome im Kontext der damaligen oder heutigen Physik tiefer zu analysieren.
- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne. "tiefer in Verbindung mit aktuellen physikalischen Konzepten wie Quantenverschränkung, Dunkler Materie oder der Relativitätstheorie analysieren"
- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne (Quantenmechanik oder die Feldtheorien)
- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne (Doppelspaltexperiment, Relativitätstheorie oder Higgs-Feld)
- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Ja, gerne, beides (Bellschen Ungleichungen oder die Entdeckung von Gravitationswellen)
- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: An den philosophischen und wissenschaftstheoretischen Implikationen bin ich interessiert.
- Frage an ChatGPT am 25.12.2024: Popper ja.
- 1874-Wundt (1832-1920) Wundt, Wilhelm (1902) Grundzüge der physiologischen Psychologie. 5. Auflage. Fundstellen: Annahm 99, annehm 47, Axiom 1, S. 551, Lit in Fußnote 4: "F. A. MÜLLER (Das Axiom der Psychophysik, 1882) "), Grundsatz 3, method 365, Postulat 0, Prinzip 0, Voraussetzung 64,
- 1879-MüllerGE (1850-1934) Müller, Georg Elias (1879) Zur Grundlegung der Psychophysik. Berlin: Hofmann. Annahme 254, Axiom 0, beweis 41, method 610, Postulat 0.
- 1882-MüllerFA (1858-1888). Müller, Ferdinand August (1882) Das Axiom der Psychophysik und die psychologische Bedeutung der Weber'schen Versuche. Marburg: Elwert'sche Verlagsbuchhandlung. 42 Fundstellen "axiom": 1 im Titel.
- 1888-Avenarius (1843-1896). Avenarius, Richard (1888) Kritik der einen Erfahrung. Erster Band. Leipzig Fues (Reisland). 3 Fundstellen "axiom", wenig verständlich:
- 1889b-Münsterberg (1856-1916) Münsterberg, Hugo (1889b) Der Ursprung der Sittlichkeit. Freiburg i.Br.: Mohr. 5 Fundstellen "axiom".
- 1891-Stumpf (1850-1936) Stumpf, Carl (1891) Psychologie und Erkenntnistheorie. In: Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Band 19 = Denkschriften. Band 64, Abt. 2, 1891, ZDB-ID 209997-4, S. 467–516. "Axiom" wird S. 43 zwei mal erwähnt, aber nicht weiter erläutert, auch nicht durch Querverweise, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis.
- 1896-MüllerGE (1850-1934) 5 Axiome. G. E. Müller, Zschr. Psychol. 10 (1896) .
- 1896-Wundt (1832-1920) Wundt, Wilhelm (1896) Ueber naiven und kritischen Realismus, Erster Artikel. Philosophische Studien 12: 307-408. Zusammenfassung: Wundt spricht S. 382 von zwei Prinzipien, denen "offenbar " axiomatische, evidente Bedeutung zugeschrieben wird. S.387 setzt er Axiom und Prinzip gleich. S.390 räumt dem Identiätsaxiom in der Mathematik überragende Bedeutung ein, aber mit kritischem Nachklang. Was genau ein Axiom zu einem Axiom macht, erfahren wir nicht. Wundt liefert an der ersten Funstelle nur den Hinweis "evidente Bedeutung." Wie Evidenz gezeigt werden kann, thematisiert er nicht. 5 Fundstellen "axiom" (fett markiert):
- 382: "... Diese Lehre lässt sich in zwei Principien sondern, denen offenbar eine axiomatische, d. h. unmittelbar evidente Geltung zugeschrieben wird. ... "
- 387: "... Jene beiden Sätze sind daher Principien, die zwar in unseren wirklichen Denkfunctionen eng verflochten sind, die aber gleichwohl verschiedene Seiten dieser Functionen zum Ausdruck bringen und daher bei einer abstracten Formulirung der logischen Axiome von einander gesondert werden müssen. ..."
- 390.1: "Die augenfälligsten Belege hierfür bietet die Mathematik dar. Sie ist es stets gewesen, die der, Anschauung, dass das exacte logische Denken in allen seinen Anwendungen allein vom Identitätsaxiom beherrscht sei, zur Stütze gedient 'hat. ..."
- 390.2: "... Ist doch die mathematische Gleichung, in der jede genau bestimmbare Größenrelation
- 390.3: "...Alle mathematischen Schlüsse beruhen aber auf Substitutionen und Transformationen,
- 1897-Schultz (1850–1936) Schultz, Julius (1897) Bemerkungen zur Psychologie der Axiome. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht. [30 Seiten] S.11: "... Die Behauptung, dafs im selben Augenblick und amselben Orte dasselbe A dasselbe A sei, wäre kein brauchbarer Grundsatz, sondern ein ganz sinnloses Wortgeklingel. A=A als Axiom ist damit zugleich — wie alle Axiome- ein Postulat. Es schlierst die Forderung ein, einmal Gesetztes als mit sich identisch festzuhalten: und darin liegt eben bereits, dafs der Salz bloß bei Variierung der Belationen logischen Sinn und Zweck hat. Diese stillschweigende Bedingung gilt nun bis in die tiefsten psychologischen Wurzeln des Axioms hinein. ..." [Internetarchiv]
- 1898-Wundt (1832-1920). Wundt, Wilhelm (1898) Über naiven und kritischen Realismus, Zweiter Artikel. Philosophische Studien 13: 1-105. 12 Fundstellen "axiom":
- 4.1: "... Was bedeutet das Wort empiorikritische Avenarius selbst hat es ursprünglich immer nur in attributiven Verbindungen, wie [>4] empiriokritische Vorraussetzung, empiriokritischer Standpunkt>, empiriokritische Axiome u. dergl. angewandt. ..."
- 4.2 "... Auch hat er keine lestinunte Rechenschaft darüber gegeben, warum er jene Standpunkte,
- 7.1: "In dem Vorwort zu seinem Hauptwerk bezeichnet nun Avenarius selbst sein ganzes Unternehmen als entsprangen aus einer Aufgabe und aus zwei als evident vorausgesetztem Axiomen. "
- 7.2-3: "... Von den zwei Axiomen aber statuirt das erste, das Axiom der Erkenntnissinhalte, dass jedes menschliche Individuum sich gegenüber eine Umgebung mit mannigfaltigen Bestandtheilen, andere menschliche Individuen mit mannigfachen Aussagen und das Ausgesagte in irgend welcher Abhängigkeit von der Umgebung. wahrnimmt. ..."
- 7.4 "... Nach dem zweiten, dem Axiom der Erkenntnissformen, sind »alle spezielleeu wissenschaftlichen Erkenntniss-Fonuen oder -Mittel Ausbildungen vorwissenschaft-[>8] lichen1).
- 8.1: ".... Von diesen beiden Axiomen ist offenbar das erste maßgebend für die Grundlegung des Systems, also für das was oben die empiriokritisehe Theorie genannt werde, das zweite für die Anwendungen dor Theorie oder die vom Standpunkte derselben unternommene Kritik der Begriffe."
- 8.2: "Demnach ist nun aber auch der Inhalt des ersten der beide» Axiome als diejenige <empiriokritische Voraumetzung> zu betrachten, die ist der zuvor formulirten Aufgabe als die ›einziger bezeichnet ist, am der <alles theoretische und praktische Verhaltenr>abgeleitet werden soll. ..."
- 45: "In der letzterswähnten Forderung besteht nun zweifellos die wichtigste Annahme des empirokritischen Systems. Sie besitzt aber freilich nicht wie die andern den Charakter einer als Axiom bebandelten Voraussetzung, sondern sie gibt sieh als ein aus den sonstigen Voraussetzungen bereits abgeleitetes Postulat ..."
- 53: "... Dass die empiriokritisehe Theorie dieses Postulat wie ein a priori gültiges Axiom behandelt, dies wird aber schließlich noch durch den von der gewählten »Standpunkt. der Betrachtung — nicht gerechtfertigt, aber begreiflich gemacht."
- 74 Fußnote Wundt: "Die physikalisischen Axiome, 1866".
- 90: "Alle diese Beispiele zeigen deutlich, welche Wirkungen das Prineip der .0ekonenfie des Denkens. äußern kann, sobald os zum metaphysischen Axiom erhoben wird. Ein als heuristische Maxime
- 1899-Hilbert (1862-1943) Grundlagen der Geometrie. ChatGPT:
- Formale Grundannahmen: Sie sind keine „selbstverständlichen Wahrheiten“, sondern willkürliche Ausgangspunkte eines deduktiven Systems.
- Konsistenz statt Wahrheit: Entscheidend ist nicht, ob Axiome „wahr“ sind, sondern ob sie widerspruchsfrei (konsistent) sind.
- Unabhängigkeit: Axiome sollten so formuliert sein, dass keines von ihnen aus den anderen abgeleitet werden kann.
- Vollständigkeit: Das Axiomensystem sollte ausreichen, um alle relevanten Aussagen innerhalb eines mathematischen Systems zu beweisen oder zu widerlegen.“
- 1899-LippsGF (1865-1931) Lipps, Gottlob Friedrich (1899) Grundriss der Psychophysik. 1. Auflage. > siehe bitte 1909.
- 1899-Schultz (1850–1936) Schultz, Julius (1899) Psychologie der Axiome. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht. [232 Seiten]. S. (bei Schultz gesperrt hier fett)1: "Axiome oder Prinzipien, zu Deutsch Grundsätze, heißen Urteile, die, keines Beweises bedürftig, ihre Gewißheit in sich selber tragen; soll es 'apodiktisches' Wissen geben, so sind solche als Anfangsglieder der deduktiven Schlußreihen unumgänglich, wie im einzelnen die Logik nachzuweißen hat. ..." [Internetarchiv]
- 1901-1905-Titchener (1867-1927) Titchener, Edward Bradford (1901-1905) Experimental Psychology in vier Halb-Bdn. > 1910.
- Bewusstsein ist analysierbar: Das Bewusstsein kann in elementare Bausteine (Empfindungen, Bilder, Gefühle) zerlegt werden. Dies ist eine grundlegende Annahme seines Strukturalismus.
- Introspektion als Methode: Titchener vertrat die Ansicht, dass introspektive Selbstbeobachtung eine valide Methode ist, um die Struktur des Bewusstseins zu erfassen.
- Elementarismus: Psychische Phänomene lassen sich vollständig durch die Analyse ihrer Bestandteile verstehen, ähnlich wie chemische Substanzen in Moleküle und Atome zerlegt werden können." Diese implizite Axiom steht in scharfem Widerspruch zur Lehre der Gestaltpsychologen. Hierzu ChatGPT am 28.12.2024: "Die Gestaltpsychologie weist keine expliziten Axiome im klassischen Sinne aus, sondern arbeitet mit empirisch fundierten Prinzipien der Wahrnehmungsorganisation. Diese Prinzipien sind heuristisch und beschreibend, können aber als informelle "Axiome" interpretiert werden, die die Grundlage für ihre Theorien bilden. Der Fokus liegt auf der phänomenologischen Erklärung von Wahrnehmungsphänomenen, nicht auf formaler Strenge."
- 1903-1913-Russell (1872-1970) und Whitehead (1861-1947). ChatGPT:
- Grundlegende Annahmen eines logischen Systems, die selbst nicht bewiesen werden, sondern die Basis für alle weiteren Ableitungen bilden.
- Kriterien der Konsistenz: Axiome müssen logisch widerspruchsfrei sein, damit das System kohärent ist.
- Willkürliche, aber pragmatische Festlegungen: Axiome müssen nicht „wahr“ im metaphysischen Sinn sein, sondern als Grundlage für deduktive Schlüsse funktionieren.
- 1904-MüllerGE (1850-1934) DIE GESICHTSPUNKTE UND DIE TATSACHEN DER PSYCHOPHYSISCHEN METHODIK. Wiesbaden: Bergmann. Fundstellen: beweis 19, axiom 0, postulat 0, annahme 59.
- 1904-Münsterberg (1863-1916). Münsterberg, Hugo (1904) Amerikaner. Berlin: Mittler. S.328: "... Seit die Amerikaner nach den Philippinen gegangen sind, kann es denn doch nicht mehr als ein Axiom gelten, daß jede Regierung in der Zustimmung der Regierten die Quelle ihres Rechts findet. ..."
- 1910-Titchener (1867–1927) Titchener, Edaward Bradford (1910) A Textboook of Psychology. >1901-105.
- 1911-Vaihinger. Vahinger, Hans (1911) Die Philosophie des Als Ob. Leipzig: Meiner. Hier zitiert nach der 7. und 8. Auflage 1922. "axiom" ergibt 27 Fundstellen im Text (ohne SR und Anzeigen). Zentral für Vahinger Als-Ob-Philosophie ist der Begriff der Fiktion. Im Sachregister hat "Axiom" keinen Eintrag, nur das Paralellenaxiom (11. Euklidisches Axiome) hat einen Eintrag mit Verweis auf S. 528. Alle Fundstellen im Text fortlaufend und ohne Lücke:
- Vorwort XIa 5-6.Auflage: "... Daß auch außerhalb des Kreises der Mitarbeiter dieser Zeitschrift in den verschiedensten Einzelwissenschaften von der Methodik der Fiktionen Kenntnis genommen und Förderung erwartet wird, bezeugen die verschiedensten Bemühungen, modernste einzelwissenschaftliche Probleme (wie die Einsteinsche Relativitätstheorie, die Freudsche Psychoanalyse, die moderne mathematische Axiomatik) unter Gesichtspunkten der Philosophie des Als Ob zu behandeln und so ihnen anhaftende Schwierigkeiten zu beheben"
- Inhaltsverzeichnis Die Fiktion des Unendlich-Kleinen (506-511) ... Das Parallelenaxiom ..."
- 11: "... Ähnliches sagt Wundt, Axiome etc. pag. 16 über Aristoteles udd ib. 75 über Leibniz."
- 30.1: "... Mit Hilfe dieser abstrakten Ursache nun gelang es Smith, die ganze Nationalökonomie in ein geordnetes System zu bringen. Aus diesem axiomartig aufgestellten Satze entwickelte er deduktiv alle Verhältnisse des Handels und Verkehrs, welche sich mit systematischer Notwendigkeit daraus ergebe ..."
- 30.2: U.a. Zitat eine Wundttitels: "Die mathematische Physik braucht zur Aufstellung der Gesetze der Statik und Mechanik statt wirklicher Wesen nur centra activitatis anzunehmen, die umgeben sind von einer sphaera activitatis. Vgl. Flügel, Probleme der Philos. 53, ib. 59. über eine solche mechanische Fiktion vgl. Wundt, Die physikal. Axiome, pag. 123: „Ober den Grund der Abstraktion von dem Zuschauer.•"
- 34: "... Galileische Trägheitsaxiom ..."
- 56: "Neumann nannte auch das Gesetz der Erhaltung der Kraft, sowie eine Reihe mathematischer Axiome und Postulate blosse fiktive Annahmen. ..."
- 58.1: "Es ist noch eine Frage, ob nicht auch manche als Axiome oder Postulate aufgestellten Annahmen zu Hypothesen und von da sogar zu Fiktionen herabsinken könnten; solche allmählichen Degradationen sind ja schon oft dagewesen. ..."
- 58.2: "... Selbst in der Mathematik und mathematischen Physik wird jetzt an diesen Pfeilern gerüttelt, und es ist nicht unmöglich, dass auch hier Elemente als fiktiv entdeckt werden, die bisher als axiomatisch gegolten haben."
- 127.1: "Die Deduktion hängt allerdings enge mit der Fiktion zusammen, aber nicht enger als die Induktion: und die Fiktion ist, besonders in einigen Beispielen, mit dem Axiom ebenso nahe verwandt als mit der Hypothese, unterscheidet sich aber doch himmelweit von beiden. ..."
- 127.2 "... Beide, Axiom und Hypothese, wollen Ausdruck einer Wirklichkeit sein. Das ist die Fiktion nicht und will es nicht sein."
- 133: "... Auf allen Gebieten ist das „Dass" und „Weil" (also die Hypothese und das Axiom und Dogma) erschüttert, und das "Als ob" tritt an ihre Stelle. (Vgl. Kap. XXI/ u. XXVIL) ..."
- 243: "Vgl. Sigwart, Beiträge zur Lehre vom hypothetischen Urteil, Tübingen 1871, pag. 1. Wo Aristoteles von Zn68 sag im logischen Sinne spricht, versteht er darunter in weiterer Bedeutung überhaupt einen Satz der einer Folgerung zu Grunde liegt; so die Prämissen eines Schlusses, so die Axiome. ..."
- 344 (Smith): "... Er stellt jenen fiktiven Satz — es ist, als ob alle wirtschaftlichen, geschäftlichen Handlungen nur vom Egoismus motiviert wären — als ein Axiom an die Spitze des Systems und entwickelt daraus deduktiv, mit systematischer Notwendigkeit, alle Verhältnisse und Gesetze des Handels und Verkehrs und aller Schwankungen in diesen komplizierten Gebieten...."
- 345: "„In der Lehre vom Nationalreichtum," sagt Lange (a. a. 0. 454) „wird das Axiom aufgestellt, dass Jeder, indem er seinem eigenen Vorteil nachgeht, zugleich den Vorteil des Ganzen befördert.
- 355.1: "... Um nun den Konstitutionalismus, den Parlamentarismus als notwendige Regierungsform darzustellen, macht Bentham aus jenem Axiom folgende Deduktion: Wenn die Handlungen der Menschen im Wesentlichen durch ihre selbstsüchtigen Interessen bestimmt werden, so sind die einzigen Herrscher, welche im Interesse der Beherrschten regieren, nur diejenigen, deren selbstsüchtige Interessen koinzidieren mit den Interessen des Volkes. ..."
- 355.2: "Mill, dem unsere Schilderung dieser Theorie entnommen ist,')
- 355.3: "... Eine Inkonsequenz muss es genannt werden, weil Mill selbst, wie wir sahen, in der Nationalökonomie dasselbe Axiom als fiktive Grundlage annimmt und die Methode dieser fiktiven Abstraktion ganz richtig schildert, [>356] ..."
- 357: "... Seine [Mills] Behauptung, dass diese Bentham'sche Methode eine „geometrische" sei, weil sie nicht die Kollision von Kräften, das Ineinanderspiel der Ursachen berücksichtige, sondern nur nach Art der Geometrie aus Einem Axiom deduziere, ohne Berücksichtigung kontrekarrierender Einflüsse, ist ganz richtig; nur ist diese Methode sehr nützlich, wenn sie mit Vorsicht angewandt wird. ..."
- 373: "Solche Isolierungen, wo ein Ding aus seinem natürlichen Zusammenhang herausgerissen und auf sich selbst gestellt wird, sehen wir auch sonst vorgenommen. Wir können hierher vielleicht selbst das Galilei'sche Trägheitsaxiom stellen, denn „es setzt dasselbe einen idealen Fall voraus, der an keiner einzigen materiellen Einheit, an keinem System von solchen in seiner Isolierung stattfindet". Es wird festgestellt, was ein bewegter Körper tun würde, wenn er unbeeinflusst von jeglicher Ursache bliebe — nur schliesst dieses Wenn eben einen unwirklichen Fall ein. ..."
- 468: "... . Wenn Liebmann sagt,1) dass der Verstand schon durch konkrete Tatsachen und weiterhin durch die Axiome der rationalen Theorie über diese Unbestimmtheit hinausgedrängt wird zur Antizipation eines uns unbekannten und unerreichbaren fundamentalen Raumsystems, auf welches sich alle mechanischen Prozesse im empirischen Weltall zurückbeziehen; ..."
- 568: "Wenn wir z. B., um zu beweisen, dass die Winkel des ebenen Dreiecks gleich zwei Rechten sind, durch einen beliebigen Winkelpunkt eine mit der gegenüberliegenden Seite parallele Linie ziehen, so ist dies eine Hilfslinie, vermittelst welcher jener Beweis möglich wird, u. z. durch Reduktion des vorliegenden Falles auf das sogen. Parallelenaxiom. Man schiebt hier diese Hilfslinie ein, welche aber nach vollendetem Beweise herausfällt.1)
- 685.1-2: "... Dieses Kantische recte agis, ergo credis — ist das Grundaxiom der praktischen Philosophie und als solches das Gegenstück zu dem richtig verstandenen Cartesianischen Grundaxiom der theoretischen Philosophie: cogito, ergo sum."
- 727 zu Kant: "... . Aber man beachte wohl: der 'Satz: es ist ein Gott, bedeutet nicht den Glauben an das Dasein einer Substanz...sondern es ist ein Axiom der reinen praktischen Vernunft, sich selbst als Prinzip der Handlungen zu setzen'. ..."
- 751: "... Für Forberg ist die moralische Weltordnung nur eine Fiktion, für Fichte ein philosophisches Axiom, ein Dogma. ..."
- 796.1-2: SR Parallelenaxiom.
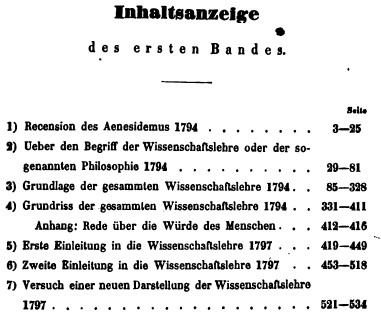
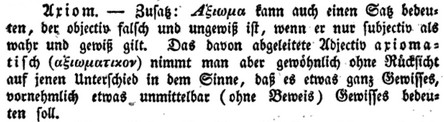
- Fundstellen "axiom" insgesamt 376
1 Titel
1 Vorwort
3 Inhaltsverzeichnis
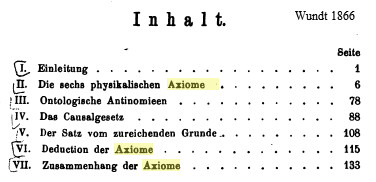
| S.1: "In jeder deductiven Wissenschaft giebt es eine Anzahl allgemeiner
Wahrheiten, die nicht mehr aus andern, derselben Wissenschaft angehörigen
Sätzen abgeleitet werden können, und man daher als oberste Sätze
oder Axiome bezeichnet."
S.6: Die 6 physikalischen Axiome nach Wundt |
ChatGPT zu Wundts Axiomen.
Zusammenfassung ChatGPT: "Die moderne Physik hat Wundts mechanistische
Weltanschauung durch folgende Konzepte ersetzt:
| Aspekt | Klassische Sicht (Wundt) | Moderne Physik |
| Kausalität | Deterministisch | Probabilistisch, Wahrscheinlichkeitskausalität |
| Realität | Objektiv und unabhängig | Beobachterabhängig, relational |
| Lokalität | Lokal und mechanisch | Nicht-lokal, holistisch |
| Raum und Zeit | Absolut und unveränderlich | Dynamisch und relational |
| Naturgesetze | Fest und universell | Kontextabhängig und dynamisch |
- S.6: "Das Axiom der Psychophysik behauptet , es bestehe
ein funktionaler Zusammenhang zwischen Empfindung einerseits, und Reiz
resp. psychophysischer Thätigkeit andrerseits, und es sei möglich,
auf Grund dieses funktionalen Zusammenhangs die Empfindungen zu messen.
Das Problem besteht dann darin, diese Funktion zu ermitteln. Wir werden
nun zunächst kurz darlegen , wie Fechner versucht hat das Problem
zu lösen. Indem wir dann von der speciellen Art der Lösung ganz
absehen, werden wir durch eine erkenntnisstheoretische Untersuchung das
Axiom selbst prüfen. Erweist es sich als falsch , so fällt auch
das Problem weg , dessen Lösung Fechner und andere versucht haben."
S.56: "Die Aufgabe , welche wir uns gestellt haben , ist damit in ihrem ersten Theil gelöst : Das Fundament der Psychophysik ist ein verfehltes, weil das Axiom der Psychophysik, es bestehe funktionaler Zusammenhang zwischen Empfindung und Reiz, falsch ist. Die Empfindung ist nicht Funktion des Reizes, sondern der Reiz Object der Empfindung , und die Empfindung kann somit nach dem Ergebniss der transscendentalen Erörterung
durch eine Zahl überhaupt nicht dargestellt werden , weil Erkenntniss nur von Objekten möglich ist."
- VII Vorwort: "Da ist es vielleicht nicht unzweckmäfsig,
sogleich zwei Voraussetzungen voranzuschicken , die ich, für den Augenblick
und ohne auf diese Bezeichnung Ge-[>VII]wicht zu legen, empiriokritische
Axiome benennen möchte: das erste das Axiom der Erkenn tnisInhalte,
das zweite das Axiom der Erkenntnis-Formen. Diese beiden Voraussetzungen
liefsen sich etwa so formulieren:
- 1) Jedes menschliche Individuum nimmt ursprünglich
sich gegenüber eine Umgebung mit mannigfaltigen
Bestandteilen, andere menschliche Individuen mit mannigfaltigen Aussagen und das Ausgesagte
in irgendwelcher Abhängigkeit von der Umgebung an: alle Erkenntnis-Inhalte der philosophischen
Weltanschauungen — kritischer oder nicht kritischer — sind Abänderungen jener ursprünglichen Annahme.
- 2) Das wissenschaftliche Erkennen hat keine wesentlich
anderen Formen oder Mittel als das
nicht-wissenschaftliche: alle specie1len wissenschaftlichen Erkenntnis -Formen oder -Mittel sind Ausbildungen vorwissenschaftlicher.
konnten — sie müssen sich in letztem Betracht auf einfache und allgemein menschliche Funktionen zurückführen lassen."
- S.36f "Weshalb beispielsweise auf eine von überwiegender
Unlust begleitete Wahrnehmung der Wille zur Abwehr des Reizes folgt, das
kann keiner psychologisch begründen, denn es lässt sich nicht
weiter auf einfachere Erlebnisse unseres Bewusstseins zurückführen;
das ist mithin genauso ein psychologisches Axiom, wie wir die einfachsten
anschaulichen Vorgänge physikalische Axiome nennen, und in derselben
Weise hat es Wert wie die [>37] physikalischen Axiome für die Naturerklärung."
S.98 "Alle physikalischen Gesetze führen in letzter Linie auf die physikalischen Axiome zurück, die, als Anwendungen der logischen Axiome auf den Begriff der Materie, für uns denknotwendig sind. Solche denk notwendigen Axiome in der Psychologie giebt es nicht, die Gesetze im Ablauf der Empfindungskomplexe sind nur empirisch zu begründen; weshalb auf die eine Empfindunf die andere folgt, auf die Innervationsempfindung die Bewegungsempfindung, ja selbst weshalb von zwei associiertcn Vorstellungen die eine mit der anderen auftritt, ist logisch zwingend nicht zu beweisen." RS: Viel zu allgemein.
ihren Ausdruck findet, anscheinend immer nur eine mehr oder minder verwickelte Anwendung des Identitätsaxioms. ..."
in denen immer und immer wieder von jenem Axiom Gebrauch gemacht wird. ..."
Voraussetzungen und Axiome empiriokritische nennt. ..."
nützliches methodologisches Hilfsmittel in den Händen dee wissenschaftlichen Forschers, der jeden Augenblick bereit ist sich durch die Erfahrung eines besseren belehren zu lassen, ist es für den speculirendon Philosophen nur noch ein Werkzeug zur Unterdrückung unbequemer Thatsachen."
"David Hilbert (1862–1943) prägte den modernen Axiombegriff entscheidend, insbesondere im Kontext der mathematischen Grundlagenforschung. Seine Auffassung von Axiomen unterscheidet sich grundlegend von der klassischen Tradition (z. B. Aristoteles oder Euklid), da er Axiome als rein formale Grundannahmen betrachtete, die unabhängig von ihrer intuitiven oder empirischen Evidenz sind.
1. Hilberts Verständnis von Axiomen
Für Hilbert sind Axiome:
ChatGPT (Frage am 28.12.2024): "Titchener war stark von der wissenschaftlichen Methodologie beeinflusst, insbesondere durch den Empirismus und die experimentelle Methode. Seine Forschung zielte darauf ab, psychologische Phänomene durch systematische Beobachtung und introspektive Analyse zu untersuchen. Dabei könnten gewisse methodische Annahmen als "axiomatisch" betrachtet werden, auch wenn er selbst diesen Begriff nicht explizit verwendete.
Mögliche implizite „Axiome“ bei Titchener:
"1. Definition des Axiombegriffs bei Russell. Russell sah Axiome als:
ChatGPT am 28.12.2024 zu Axiomen bei Titchener: "Titchener hat den Begriff „Axiom“ selbst nicht verwendet, weder in expliziter noch in prominenter Weise. Seine psychologische Methodologie basiert jedoch auf grundlegenden Annahmen, die in gewisser Weise als methodische "Axiome" interpretiert werden könnten, insbesondere im Hinblick auf die Analyse des Bewusstseins und die introspektive Methode. Diese Annahmen sind allerdings empirisch und pragmatisch geprägt und nicht formalisiert wie in der Mathematik oder Logik."
1909-LippsGF (1865-1931) Lipps, G. F. (1899). Grundriss der Psychophysik. Leipzig: Göschen. 2. neubearbeitete Auflage 1909 (Online). Zusammenfassung: Obwohl G.F. Lipps den Ausdruck "Axiom" nicht gebraucht, so kann man die Formulierung des psychophysische Grundgesetzes als solches interpretieren. Fundstellen: "axiom" 0; "Beobachtungsfehler" Eintrag im Inhaltsverzeichnis 34-36; "beweis" 4; "defin" 2
"fehler" 34; "gesetz" 95; "grundgesetz" 12; "postul" 0; "prinzip" 5; Psychophysisches Grundgesetz Eintrag im Inhaltsverzeichnis 44. Sachregister: kein Einträge Axiom, Postulat, Prinzip, Gesetz, Grundgesetz, aber "psychophysisches Grundgesetz".
Die Regierung hat weiter nichts zu tun, als diesem Kampf der Interessen möglichst Freiheit zu geben. ..."
scheint nun aber eine Inkonsequenz zu begehen, wenn er diese Art von Beweisführung für unwissenschaftlich erklärt, weil, wenn auch die Deduktion selbst nicht anzugreifen sei, doch das zu Grunde liegende Axiom der Wirklichkeit nicht entspreche; denn es werden die Menschen nicht in allen ihren Handlungen von ihren selbstsüchtigen Interessen geleitet. ..."
528: "... Und daraus folgt dann sogleich, dass das sog. 11. Axiom, nach dem die Summe der beiden inneren Gegenwinkel zweier parallelen geraden Linien, welche von einer dritten Geraden geschnitten werden, 180° betrage, als ein Spezialfall des Satzes zu betrachten ist, dass die Summe der drei Winkel in einem ebenen Dreiecke gleich zwei Rechten sei. ..."
- 1913-McDougall (1871-1938) McDougall, William (1913) Body and Mind. Second Edition. London: Methuen & Co. 11 Fundstellen "axiom".
- 1921-Külpe (1862-1915) Külpe, Oswald (1921) Ästhetik.Leipzig: Hirzel. Zwei Fundstellen zum Axiombegriff in Külpes Verständnis:
- 1928-Hilbert (1862-1943) Die Grundlagen der Mathematik. ChatGPT:
- Mathematik wird auf ein rein formales System zurückgeführt, das aus Symbolen und Regeln besteht.
- Die Axiome bilden die Ausgangsregeln, und der Beweis der Widerspruchsfreiheit ist zentral.
- Beispiel für diesen Ansatz: Hilberts Programm, das die Mathematik auf eine finite Anzahl von Axiomen und Beweisregeln stützen sollte.
- 1930-Carnap (1891-1970) Carnap, R. (1930) Bericht über untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik. Erkenntnis 1, 303–307 (1930). Sehr abstrakt, formal und dicht. Der Axiombegriff wird nicht erklärt. In der Fußnote teilt Carnap mit : "1) Da die Untersuchungen an anderer Stelle in ausführlicher Darstellung veröffentlicht werden sollen, seien hier nur die wichtigsten Definitionen und Ergebnisse ohne Angabe der Beweise zusammengestellt." Es kam zu seinen Lebezeiten aber zu keiner Veröffentlichung. Posthum wurde aus seinem Nachlass im Jahre 2000 Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik, edited by T. Bonk and J. Mosterin veröffentlicht.
- 1931-Gödel (1906-1978) Unvollständigkeitsssatz. ChatGPT (Frage 08.11.2024):
- 1931-Lewin (1890-1947) Lewin, Kurt (1931) Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Biologie und Psychologie. Erkenntnis Bd.1, 421-466.
- 1933-Bühler (1879-1963). Bühler, Karl (1933) „Über die Axiome der Sprachtheorie“. Kantstudien 38, 1933, S. 73–99. Fundstellen "axiom" 82 mit Titel und Kopfzeilenüberschriften. Die Ausführungen beginnen S.19: "1. Im logischen Aufbau, im Begründungsgefüge der Sätze einer empirischen Einzelwissenschaft oder einer homogenen Wissenschaftsgruppe gibt es stets zwei Grenzen, an deren einer Protokollsätze und an deren anderer Axiome stehen." Und die Regeln? In der Fußnote 1) S.20. "Die hier entwickelte Axiomatik ist das erste Kapitel meines Buches >Sprachtheorie<, das 1933 erscheinen soll." S.20f enthält Plauderei über Axiome mit Behauptungen und meist fehlenden Belegen oder Begründungen. Bezieht man im Vorgriff die Sprachtheorie von 1934 mit ein, könnte man die Überschriften S.24 "A. Der Schlüsselsatz von der Zeichennatur der Sprache", S.40 "B. Sprechhandlung und Sprachgebilde", S.60 "C. Das Strukturmodell der Sprache", S.74 "D. Das Schema der Sprachfunktionen" als die Axiome deuten. Klare Ausführungen, gar eine Definition der Axiome sucht man in dieser Arbeit vergeblich. So kann und sollte man das Thema Axiome und Axiomatisierung nicht behandeln.
- 1933-Kolmogoroff (1903-1987) Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (= Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. Band 3). Springer, Berlin 1933. [Internetarchiv] S.2:
- S.64: "... Man darf nicht vergessen,
daß Induktion und Deduktion SchJußweisen sind, und daß
sie die Sicherheit dessen, woraus geschlossen wird, voraussetzen. Die Axiome,
die Träger eines deduktiven Lehrgebäudes, können nicht selbst
wieder deduziert werden, und eine Gewinnung durch Induktion würde
ihnen die Gewißheit rauben, die sie besitzen müssen. Für
diese Axiome ist darum sehr früh eine
unmittelbare Einsicht, eine Intuition geltend gemacht worden. Aber auch
die Voraussetzungen der Induktion sind Wahrheiten, Tatsachenwahrheiten.
Die phänomenologische Methode wendet nun die Intuition auf solche
Tatsachenwahrheiten an, indem sie den qualitativen Bestand einer Erscheinung
genau festzusteHen sucht und sich dabei auf ihr Wesen beschränkt.
So abstrahiert sie von den individuellen Besonderheiten des zu erfassenden
Zustandes und Gegenstandes bei ästhetischem Verhalten und sucht nur
deren große bleibende Züge zu bestimmen. ..."
"Hier beschreibt Hilbert seine berühmte Formalismus-Philosophie:
„Aus den Axiomen soll sich durch rein logisches Schließen das gesamte Gebäude der Mathematik aufbauen lassen.“"
- "Gödel zeigte mit seinem Unvollständigkeitssatz,
dass in jedem ausreichend komplexen, widerspruchsfreien axiomatischen System
Aussagen existieren, die weder bewiesen noch widerlegt werden können.
Dies stellte Hilberts Programm in Frage und offenbarte die Grenzen der
Axiomatik. Gödel zeigte, dass Axiome notwendig und nützlich sind,
aber auch dass nicht alle Wahrheiten formal ableitbar sind."
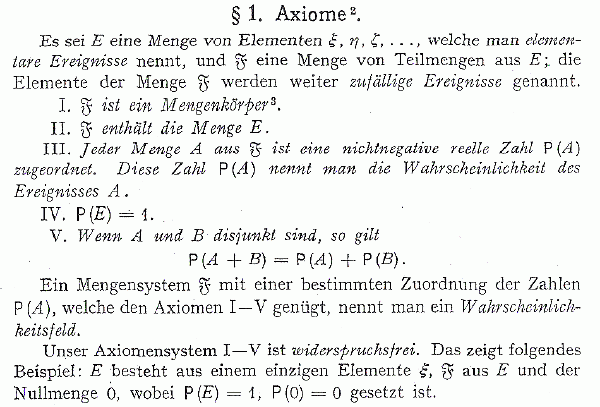
- 1934-Bühler (1879-1963). Bühler, Karl (1934) Sprachtheorie. Stuttgart: Gustav Fischer. Zusammenfassung: Fundstellen "axiom": Im Inhaltsverzeichnis zwei Einträge, § 1 ist Im Sachregister: "Axiomatik der Mathematik 20, 22. — der Sprachtheorie 3, 12-78, 21. Axiomatisches Denken 20ff.". Im Text (ohne Sachregister) 56 Erwähnungen (ohn Einleitung Herausgeber, Inhaltsverzeichnis und Sachregister). §1, S. 12-24, lautet: "Idee und Plan der Axiomatik". Nach dem Inhaltsverzeichnis sollten S. 19-21 un "3. Axiome der Sprachforschung" bzw. in "4. Die vier Prinzipien 21-24" zu finden sein. Bühler spricht dort auch von "vier Sätze" und vom Grundsätze:
- S.21: "4. Ein Vorblick auf das Folgende zeigt dem Leser, daß es vier Sätze sind, die wir formulieren, erläutern, empfehlen. Sollte ein Kritiker bemerken, sie seien (um ein Wort von KANT zu wiederholen) aufgerafft, es gäbe vermutlich noch mehr derartiger axiomatischer oder axiomnaher Sätze über die menschliche Sprache, dann findet er in diesem Punkte unseren vollen Beifall; die Sätze [>22] sind in der Tat nur aufgelesen aus dem Konzepte der erfolgreichen Sprachforschung und lassen, wie sie dastehen, Raum frei für andere. ..."
- S.22: "Zwei von den vier Grundsätzen gehören so eng zusammen, daß man sich fragen kann, ob ihr Inhalt nicht in einem einzigen Satze Platz hat: es. ist der erste und zweite. ..." Bühler bennet die ersten zwei Grundsätze nicht und gibt auch keinen Querverweis. Man kann an dieser Stelle nicht wissen, wovon Bühler spricht.
- S.23: "... Deren logische Rechtfertigung erfolgt in unserer Lehre vom Symbolfeld der Sprache und auch diese Lehre muß axiomatisch fundiert sein. Sie ist es wenn man B und D zusammen anerkennt." B und D bleiben an dieser Stelle unerklärt, es gibt auch keinen Querverweis.
- S.23: "....- Daß es der Psychologe der Sprache nicht weniger sein muß, daß die Gebildelehre des Grammatikers allem anderen logisch vorgeordnet sei und warum sie es sein kann, ist der Aufschluß, den das Axiom C bringt. Der Grundsatz D mag für sich selbst sprechen."
- (A) S.24: "§ 2. Das Organonmodell der Sprache (A)."
- (B) S.33: "§ 3. Die Zeichennatur der Sprache (B)."
- (C) S.48: "§ 4. Sprechhandlung und Sprachwerk; Sprechakt und Sprachgebilde (C)."
- (D) S.69: "§ 5. Wort und Satz. Das S.F•System vom Typus Sprache (D)."
- 1936-Lewin (1890-1947). Lewin, Kurt (1936) Principles of topological psychology. New York 1936. Deutsch: Grundzüge der topologischen psychologie. Bern 1969. Sowohl in der englischen Ausgabe als auch in der deutschen Übersetzung finden sich 9 Fundstellen "axiom", die Lewin ohne nähere Erklärungen erwähnt.
- 73.1-2: "Der metrische Raum. — Man kann fragen, ob über topologische Bestimmungen hinaus sich auch metrische Bestimmungen für die psychischen Bereiche treffen lassen. Ein metrischer Raum ist dadurch gekennzeichnet, daß je zwei Punkten x, y des Raumes eine Entfernung x7y 0 zuzuordnen ist, für die gewisse Entfernungsaxiome gelten, insbesondere das Dreiecksaxiom (HAUSDORFF 1914, S.211). ...".
- 74: "... Ob und wo das Dreiecksaxiom, dessen Gültigkeit die Voraussetzung aller Maßbestimmungen ist, auf quasiphysikalische Abstände anwendbar ist, wäre besonders zu untersuchen. ..."
- 216: Lit: "82. REICHENBACH, H.: Axiomatik der relativistischen Raum-Zeit-Lehre. Braunschweig: Vieweg und Sohn, 1924, 161 S."
- 221.1 Glossarium: "Raum, mathematischer. Bezieht sich nicht auf irgendwelche besonderen Seinsweisen, sondern ausschließlich auf Relationen. Für diese Relationen gelten bestimmte Axiome."
- 221.2-3 Glossarium: "Raum, metrischer: Beliebigen zwei Punkten eines solchen Raumes ist ein Abstand zugeordnet, für den bestimmte Axiome, insbesondere das Dreiecksaxiom, gelten."
- 221.4 Glossarium: "Raum. topologischer: Nichtmetrischer Raum, für den bestimmte Axiome gelten. Teil-Ganz-Beziehung und Zusammenhangsverhältnisse sind seine Grundbegriffe."
- 233 Sachregister: "Dreicksaxiom 221"
- 1938-EinsteinInfeld. Einstein, Albert & Infeld, Leropold (1938) The Evolution of Physics. Cambridge University Press. (Online). Fundstellen: "ayxiom" 0, "postulat" 0, "princip" 60, "assumption" 61, "bas" 24.
- 1939-Stumpf (1848-1936) Stumpf, Carl. (1939) Erkenntnislehre I. Leipzig: Barth.
- 1939-Jeversches-Wochenblatt vom 14.11.1939. "Wenn gewisse Axiome der Psychologie unumstößlich sind,, dann ist es u. a. das, daß sich der Verbrecher dadurch verrät , daß er die verbrecherische Tat gutheißt." Das ist keine wissenschaftlich, sondern ein unsinnig-propagandistischer Gebrauch.
- 1940-Burt (1883-1971) Burt, Cyril (1940) The Factor of the Mind. University of London Press.
- Axiom der Einheitlichkeit der Natur Burt 1940, p. 221
- Axiom oder Prinzip der Einfachheit Burt 1940, p.240
- Axiom universeller Kausalität Burt 1940, p. 31, 220
- Euklids erstes Axiom nach Burt 1940, p. 46
- Kardinalaxiom der empirischen Psychologie : alles, was messbar ist, hat notwendigerweise die Natur einer Relation 1940, p. 237.1
- Multiplikationsaxiom Burt 1940, p.51
- 1940-Stumpf (1848-1936) Stumpf, Carl. (1940). Erkenntnislehre II. Leipzig: Barth. Fundstellen: Annahme 85, Axiom 62, Hypothese 516, beweis 74, Ableitung 12, Kausaliät 510, Postulat 24, Prinzp 162, Gesetz 945, Regel 232, erleben.10 (SR-), erlebt 11, Erlebnis 14.
- 1943-Hull. Hull, Clark (1943) Principles of Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts, Inc. In dem Buch gibt es neben einem Sachregistereintrag 6 Fundstellen "axiom" (alle hier, übersetzt von DeepL).
- 1945-Wertheimer (1880-1943). Wertheimer, Max (1945, dt. 1957) Productive Thinking. Harper, New York. Im Sachregister der dt. Ausgabe wird ausgewiesen: "Axiome 41ff., 73f., 207, 211f., 212A
- 41ff: klärt nicht, was ein Axiom sein soll, bringt aber die Begriffsverschiebung ins Spiel.
- 73f: klärt nicht, was ein Axiom sein soll, bringt aber "heimliche Axiome" für Selbstverständlichkeiten auf.
- 207: klärt nicht, was ein Axiom sein soll, zitiert aber Einstein Auffassung: "Die einzige Tugend von Axiomen ist, daß sie grundlegende Voraussetzungen liefern, aus denen man Schlüsse ziehen kann, die mit den Tatsachen übereinstimmen.“
- 211f: Hier geht Wertheimer auf die Leistungsfähigkeit von Axiomen ein: "Die Technik der Axiome ist ein sehr brauchbares Werkzeug. Es ist eine der wirkungsvollsten Techniken, die bisher in der Logik und der Mathematik erfunden wurden; mit einigen wenigen allgemeinen Sätzen ist für alles gesorgt, was man braucht, um die Einzelheiten abzuleiten. Man kann mit riesenhaften Summen von Tatsachen umgehen, mit gewaltigen Mengen von Sätzen, indem man an ihre Stelle ein paar Sätze setzt, die in einem formalen Sinn mit allem diesem Wissen gleichbedeutend sind. Einige der großen Entdeckungen der modernen Mathematik wurden nur möglich, weil diese aufs äußerste [>] vereinfachende Technik zur Hand war. Auch Einstein benutzte dieses Werkzeug in seinen Darstellungen der Relativitätstheorie."
- 212A: Die Anmerkungen klären nicht, was Axiome sein sollen; aber es wird betont, dass die wirklichen produktiven Denkprozesse anders ablaufen, als sie später in Veröffentlichungen systematisch dargestellt werden. In Anmerkung 7 wird ausgeführt: "... „Die Art, wie in dem Buch von Einstein und Infeld die zwei Gruppen von je 3 Axiomen einander gegenüber gestellt werden, stellt ganz und gar nicht dar, wie die Dinge sich im tatsächlichen Denkprozeß abspielten. ..." Leider teilt Wertheimer die Fundstelle nicht mit. So sollte man Wissenschaft nicht betreiben. Die Rekonstruktion des Sachverhalts bei Einstein/Infeld, nur weil Wertheimer nicht ordentlich zitieren kann oder mag, hat mich fast zwei Stunden gekostet. Ich habe die englische Ausgabe von Einstein/Infeld 1938 nach "axiom" durchsucht, aber keinen Treffer erzielt. "princip" wird allerdings 62x gefunden. Was Wertheimer veranlasst von "3 Axiomen" zu phantasieren, bleibt sein Geheimnis.
- 1948-Schiller, Paul von (1908-1949) Schiller, Paul von (1948) Aufgabe der Psychologie. Eine Geschichte ihrer Probleme. Wien: Springer. 7 Fundstellen "axiom" von insgesamt 11 mit Überschriften. Schiller folgert S. 173.1-2 aus Axiomen Postulate, die er für empirisch beweisbar hält. Axiom wird nicht geklärt; schwer verständlich.
- Inhaltsverzeichnis Kap. IX Kritik Erlebnislehre: 2. Axiome und Gesetze der Zeichen 170
- 127: "Hull will den inneren Faktor mit einem, durch die Vorgänge des fraglichen Reizes ausgelösten antizipierenden Antwortfragment, bzw. mit dessen Reizwirkungsmodifikation gleichsetzen. Auf diesen Gedanken baut er eine Axiomatik des Lernens auf. ... "
- 171: "Aus diesen Eigenschaften läßt sich eine Axiomatik der Zeichen ausarbeiten, welche auch diejenige der Erlebnisse befriedigt.
- 172: "... Aus den Axiomen lassen sich unter anderen drei Annahmen folgern, die bekannten Feststellungen der Erlebnislehre entsprechen."
- 173.1-2: "Unsere drei Postulate gewinnen also ihre Verifizierung in den drei wichtigsten, bekannten Erlebnissätzen, was den zutreffenden Charakter [>173] unseres Axiomensystems vorläufig genügend zu sichern scheint. Somit ergJeben unsere Sätze ein wahres Axiomensystem, denn.die aus ihnen gefolgerten Postulate sind empirisch beweisbar, sie sind widerspruchfrei und keines ist Folge der anderen. ..."
- 183: "Das Erleben aus der Behinderung von Instinktverläufen zu derivieren, wurde wiederholt versucht und ist eigentlich auch ein Axiom der Tiefenpsychologie. Des g,enaueren können wir diesen Gedanken am Beispiele der Ausdrucksbewegungen verfolgen."
- 193: "... Darum versuchen wir jetzt die Grundzüge der Handlungslehre in knappe Sätze zu fasssen und wenn auch nicht axiomatisch, so doch so in strenger Weise, wie es bei ·dem zarten Stand unserer Kenntnisse heute schon möglich erscheint. ..."
- 1951-Stevens (1906-1973) Stevens, S.S. (1951, ed.) Handbook of Experimental Psychology. New York: Wiley. 1436 Seiten.Zusammenfassung: Im Index kein Eintrag "axiom", "postulat" (obwol das Thema Postulates mehrere Seiten einnimmt p.13-17" , "prinzip". Tatsächlich verwendet Stevens Postulat statt Axiom, wie man seinen Ausführungen p. 16 entnehmen kann:
- 1958-Stegmüller (1923-1991). Stegmüller, Wolfgang (1958) Die axiomatische Methode in (335-342) Wissenschaftstheorie. In (327-353) Das Fischer Lexikon Philosophie. S. 335 führt zu Beginn aus:
- 1959-Luce (1925-2012) Luce, Duncan R. (1959) Individual Choice Behavior. New York: Wiley. 322 Fundstellen "axiom", davin 1 Schutzumschlag, 8 Inhaltsverzeichnis, 2 Literaturverzeichnis, 9 Sachregister, also 302 im Text.
- 1967-Watzlawick (1921-2007), Beavin, Jackson. Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H. & Kackson Don D. Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes. W. W. Norton & Company, New York
- 1969-Watzlawick (1921-2007), Beavin, Jackson. Menschliche Kommunikation – Formen, Störungen, Paradoxien. Bern: Huber. "2. Kapitel : Pragmatische Axiome - ein Definitionsversuch
- 1. metakommunikatives Axiom: "Man kann nicht nicht kommuniziueren." (S. 53)
- 2. metakommunikatives Axiom: "Jede Kommunikations hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist." (S.56)
- 3. metakommunikatives Axiom: "Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bediungt." (S. 61)
- 4. metakommunikatives Axiom: "Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten. Digitale Kommunikationen haben eine komplexe und vielseitige logische Syntax, aber eine auf dem Gebiet der Beziehungen unzulängliche Semantik^Analoge Kommunikationen dagegen besitzen dieses semantische Potential, ermangeln aber die für eindeutige Kommunikationen erforderliche logische Syntax." (S.68)
- 5. metakommunikatives Axiom: "Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht." (S.70)
- 1972-Huber (1942-) Huber, Oswald.(1972) Axiomatische Präferenzlogik in der psychologischen Entscheidungsforschung. Ein Beitrag zur Theorie der sicheren mehrdimensionalen Wahlen. Salzburg: Universität, Philosophische Fakultät, 1972, 192 Seiten Schreibmaschinenfassung, 101 Literaturang.
- 1972-Piaget (1896-1980) Piaget, Jean (1972, dt. 1973) Erkenntnistheorie der Wissenschaften vom Menschen. Übersetzung: Erika Höhnisch. Frankfurt: Ullstein. Im Fremdwörterverzeichnis S.294: "Axiom, Satz der keines Beweis bedarf, da er in sich selbst einsichtig (evident) ist."
- 1973-Kamlah (1905-1976) & Lorenzen (1915-1994). Kamlah & Lorenzen (1973) § 2 Das Problem des Anfangs (der "Fundamentalphilosophie") in (15-22) Logische Propädaeutik. Axiomatik und das Anfangsproblem hängen eng miteinander zusammen.
- 1973-Westmeyer (1946-2020), Westmeyer, Hans (1973) Kritik der psychologischen Unvernunft. Probleme der Psychologie als Wissenschaft. Stuttgart: Kohlhammer. Im Sachregister wird "Beweis" nicht angeführt, auch nicht "Wahrheit". Demnach scheint Beweis und Wahrheit in Westmeyers Wissenschaftstheorie von 1973 keine Rolle zu spielen. Das ist aber falsch, weil Westmeyer S. 25f angibt "Analog Stegmüller (1969, 672) [>26] führen wir den Beweis durch reductio ad absurdum." Mit Hilfe von Hempels Regel Maximaler Bestätigung (RMB), dem Ansatz Stegmüllers mit einer Reinterpretation von objektiven Wahrscheinlichkeitswendungen als abgeschwächte induktive, soll eine widerspruchs- und mehrdeutigkeitsfreie Variante des statistischen Syllogismus möglich sein. Komplizierter, schwieriger Beweisgang. Fundstellen: axiom 1, beweis 13, bewies 0, zeig 55, postulat 8, prinzip 11, folgerung 11; erleben 5, erlebt 0, Erlebnis 0.
- 1974-Orth (1946-2012) Orth, Bernhard (1974) Einführung in die Theorie des Messens. Kohlhammer Standards Psychologie. Sturrgart: Kohlhammer. Obwohl der Begriff des Axioms in der Messtheorie eine überragende Rolle spielt, konnte ich bei Orth (1974) keine befrieigende Definition von Axiom finden außer "Meßtheoretische Axiome sind Eigenschaften undefinierter Begriffe". Nach dem Sachregister Orth (1974), S. 34:
- 1976-AEM. Lexikon der Psychologie Bd.1, A-Gyrus: "Axiom, axiomatisches System, im Gegensatz zu einem Theorem stellt ein A. eine nicht bewiesene Aussage dar. ..." Axiome der Psychologie werden nicht genannt.
- 1977-ToebeHarnattSchwemmerWerbik. Toebe, Peter; Harnatt, Jochen; Schwemmer, Oswald & Werbik, Hans (1977) Beiträge der Konstruktiven Philosophie zur Klärung der begrifflichen und methodischen Grundlagen der Psychologie. In (93-115) Schneewind, K.A. (1977, Hrsg.) Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie. München: Reinhardt (UTB). Zusammenfassung: Die Arbeit stellt das Begründungsproblem in den Mittelpunkt und alternativ zum Empirismus und der analytischen Philosophie den konstruktiven Ansatz der Erlanger Schule um Paul Lorenzen. Der Axiombegriff wird nicht näher erörtert und das "Anfangsproblem" im Sachregister nicht ausgewiesen. Im Sachregister wird Axiom S. 93 und 94 zugewiesen; "axiomatisches Vorgehen" S. 93ff. S.93-94 acht Fundstellen "axiom", u.a. S.93:
- 1978-Block. Block, Ned (1978) TROUBLES WITH FUNCTIONALISM. In (261-326) Savage, C. Wade (1978, ed.). Erwähnt zwei mal "axiom" ohne nähere Erläuterung.
- p.311.1-2: "... Inferences can be accomplished by systems which use a few axioms and many rules
- 1978-Fodor. Fodor, J. A. (1978) COMPUTATION AND REDUCTION. In (229-260) Savage, C. Wade (1978, ed.). Spricht p. 258 von einem "nichtlogischen Axiom", ohne dies näher zu erläutern.
- 1978-Schwartz. Schwartz, Robert (1978) INFINITE SETS, UNBOUND COMPETENCES, AND MODELS OF MIND. In (183-200) Savage, C. Wade (1978, ed.). Eine Fundstelle, in der Axiomatisierung nur gebraucht, aber nicht näher erläutert wird:
- p.190: "... Are these rules merely descriptions of certain regularities in the speaker's competence, in the way that one or another axiomatization of logic may be seen as a representation of the ideal logician's reasoning competence; or is there some stronger sense in which the speaker can be said actually to employ or follow the rules? ..."
- 1978-Simon. Simon, Herbert A. (1978) On the Forms of Mental Representation. In (3-18) Savage, C. Wade (1978, ed.). Zwei Fundstellen "axiom"; bloßer Gebrauch, keine Erläuterung, was ein Axiom sein oder heißen soll:
- p.4: "... There is informational equivalence, also, between ap prop riately axiomatized formulations of Euclidean geometry and analytic geometry, respectively."
- p.6: "The information about the rectangle and the processes for answering questions about it might be represented in a variety of ways. (1) They might be represented as a set of propositions (more or less isomorphic with the verbal statement), together with an appropriate axiomatization of plane geometry. ..."
- 1978-Savage. Savage, C. Wade (1978, ed.) Perception and Cognition Issues in the Foundations of Psychology Minnesota Studies in the PHILOSOPHY OF SCIENCE HERBERT FEIGL AND GROVER MAXWELL, GENERAL EDITORS VOLUME IX. University of Minnesota Press. In dem Buch wird "aciom" bei vier Autoren 14x erwähnt, aber nicht näher erläutert.
- 1979-Drösler. Drösler, Jan (1979) Grundlegung einer mehrdimensionalen metrischen Skalierung. Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie, 1979, 26 (1), 1-36, 31 Literaturang.
- 1979-Wottawa (1948-) Wottawa, Heinricht (1979) Grundlagen und Probleme von Dimensionen in der Psychologie. Meisenheim am Glan: Hain. 14 Fundstellen "axiom", alle bezüglich des Choise-Axioms. Die Axiomatibegriff selbst wird nicht thematisiert und das ist eine Schwäche.
- S.59 Lithinweis auf das Choice Axiom von Luce und Galanter 1959
- S.61: "... Die Bedingung, daß der Vergleich zweier Reize unabhängig von der Obermenge der Reize ist, nennt man auch "choice-axiom" (Luce, :959). ..."
- S.64.1: "... Der entscheidende Vorteil bei der Anwendung des BTL-Verfahrens besteht nicht in der Bestimmung der Modellparameter, sondern in der Möglichkeit, durch Oberprüfung der Güte des
- S.64.2: "Das choice-axiom wurde nicht nur als Grundlage zur Analyse von Paarvergleichsdaten angewandt. Dieses Modell kann u. a. auch Wahrnehmungsexperimenten und Lernvorgängen zugrunde gelegt werden (vgl. Luce 1963). ..."
- S.65.1: "... So einleuchtend und zweckmäßig der Ansatz des Wahlaxioms als Grundlage von Meßvorgängen erscheint, so pro:lematisch scheint es, die Erfüllung dieser Annahme etwa bei komplexe-en Lernvorgängen anzusetzen ..."
- S.65.2: "... Bei diesen Erweiterungen tritt die inhaltliche Bedeutung des choice-Axiom hinter der einfachen mathematischen Darstellung zurück (vgl. etwa Sternberg, 1963; Albert, 1976)."
- S.66.1: "Parameterfreie Ansätze kann man entweder auf den Forderungen des choice-axiom direkt aufbauen (wenn Objekt a vor b bevorzugt wird, dann sollte für jedes Objekt die Bevorzugungshäufigkeit von a gegenüber c größer sein als von b gegenüber c; ..."
- S.66.2: "... Bei einem Ansatz des auf dem Wahlaxiom basierenden Modells für inhaltliche Forschungsprobleme zeigt sich deutlich die schwierige Frage, ob für inhaltliche Probleme einfache, auf der Forderung nach Vergleichen oder anderen wünschenswerten Meßeigenschaften basierende Modelle eingesetzt werden sollen. ..."
- Auch die weiteren der 14 Fundstellen beziehen sich auf das Choice-Axiom.
- 1980-Duden Leikon Redaktion (1980, Hrsg.) Schüler-Duden Das Wissen von A-Z. Mannheim: BI. "Axiom [gr.] s, in der Philosophie und Mathematik ein Grundsatz, der unmittelbar einleuchtct und nicht weiter zu begründen ist; Satz, der weder beweisbar ist, noch eines Beweises bedarf." >2024.
- 1980-Hübner (1941-) Einführung in die Methodenlehre der Psychologie. Darmstadt: WBG. Einträge im Sachregister: "axiomata (Descartes) 11, Axiomatik, Axiomatisierung 130. 141, — der Wahrscheinlichkeitstheorie nach Kolmogorov 153-154 f., Axiomensysteme 130. 214, Basissätze (Popper) 181." S. 130f setzt sich Hübner mit dem Axiombegriff auseinander:
- 1980-Westermann Westermann, R.. (1980) Die empirische Überprüfung des Niveaus psychologischer Skalen. Zeitschrift für Psychologie, 1980, 188 (4), 450-468, 30 Literaturang., ISSN: 0044-3409. URL(Zeitschrift).
- 1981-Gigerenzer (1947-) Gigerenzer, Gerd (1981) Messung und Modellbildung in der Psychologie. München: Reinhhardt (UTB). Zusammenfassung: S.46: "Gegenstand der Meßtheorie sind die Gesetzmäßigkeiten, welche notwendig und hinreichend für eine homomorphe Abbildung eines empirischen Systems auf ein bestimmtes numerisches System sind. Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen sind Eigenschaften der empirischen Relationen. Sie heißen Axiome. Aus diesen logisch abgeleitete Sätze heißen Theoreme". Der Axiombegriff wird nicht ausdrücklich und begriffskritisch erörtert.
- "2.1.4 Meßtheorie und Axiomatisierung 46
- 3.3.2 Die axiomatische Methode 82
- 4.5 Axiomatische Meßmodelle und Skalierungsmodelle 125"
- 1981-Krantz (). Helger T. Krantz (1981, 2. A.) Einführung in die klassische Testtheorie. Frankfurt: Fachbuchhandlung für Psychologie, beschreibt im Kapitel 5.2, S. 69-75 „Die Axiome“, 5 Axiome:
- A1 Ein Meßwert besteht aus wahrem Wert und Fehler (Datenmodell, S. 66)
- A2 Der Mittelwert der Meßfehler ist 0 (S. 69)
- A3 Die Korrelation zwischen wahren Werten und Fehlern ist 0 (S.72)
- A4 Die Fehler zweier beliebiger Tests korrelieren mit 0 (S. 73)
- A5 Die wahren Werte eines Tests korrelieren mit den Fehlern eines anderen Test mit 0 (S: 73).
- 1982-Sixtl (1935-2000) Sixtl, Friedrich (1982) Meßmethosen der Psychologie. Theoretische Grundlagen und Probleme. 2. überarbeitete und erw. Auflage. Weinheim: Beltz. Im Sachregister gibt es keine Einträge "Axiom, Postulat, Prinzip, Annahme, Voraussetzung, Erleben".
- 1982/83-Rührig (1953-1990) Beweis. Sind die zwei kleinsten Items einer Reihe größer als das größte Item dieser Reihe, gibt es eine Basis für die SummenScore-Funktion. Man kann diese Bedingunge als Axiom interpretieren, wonach sich dann die Summen-Score-Funktion begründen lässt.
- 1983-Messen und Testen (EdP B,I,3). Feger, Hubert (1983, Hrsg.) Messen und Testen. Enzyklopädie der Psychologie B. I, 3. Göttingen u.a. Verl. für Psychologie, Hogrefe. Umfang: XXI, 814 S. Zusammenfassung: Der allgemeine Axiombegriff und seine Bedeutung für die Psychologie wird nicht erörtert. Das Sachregister enthält keinen Eintrag "Axiom", erwähnt aber spezifische wie z.B. "Auswahlaxiom", "Archimedisches Axiom" (S,162: "Jede streng beschränkt Standardfolge ist endlich"), , "Lösbarkeits.Axiom", "Wesentlichkeits-Axiom bei Meßstrukruen".
- 1983-Stegmüller (1923-1991) Stegmüller, Wolfgang (1969) Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie. Bd. 1 Erklärung, Begründung, Kausalität. Zweite verbesserte und erweiterte Auflage. Berlin: Springer. Sachregistereinträge: Axiom 73 f; axiomatische Methode 73; axiomatischer Aufbaue der Aussagenlogik 86 ff; Axiomenschema 86 f.
- 1984-Graumann (1923-2007) &-Herrmann (1923-2013) Graumann, Carl. F. & Herrmann, Theo (1984, Hrsg) Karl Bühlers Axiomatik: fünfzig Jahre Axiomatik der Sprachwissenschaften. Würzburg: Klostermann. Fundstellen 8 "axiom" (2 im Titel, 5 S. 123, 1 S. 140. Über die Axiome Bühlers erfährt man nur wenig, u.a. (nicht zu gebrauchen):
- Klein, Wolfgang (1984) Bühler Ellipse [Sonderdruck im Netz] Hier S.123 unter "3. Bühlers Theorie5 In der „Sprachtheorie" finden sich einige durchgängige Annahmen, die Bühler nicht als „Axiome" - in seinem Sinne - bezeichnet, wohl aber als solche behandelt. Dazu zählt die Vorstellung, daß Sprachzeichen, wie alle andern „Sinnendinge", in Form und Funktion nur zu verstehen sind, wenn man sie nicht isoliert, sondern in ihrem Verhältnis zum jeweiligen „Umfeld" betrachtet.6 Der Grund dafür, daß Bühler dieses „Axiom" nicht der „Axiomatik der Sprachwissenschaften" zuschlägt, ist vielleicht, daß es nicht speziell für die Sprache gilt. Es ist ein gestaltpsychologisches Axiom, das für alles Wahrnehmbare und als Sonderfall auch für Sprachzeichen zutrifft."
- 1984-Pongratz. (1948-) Pongratz, Ludwig J. (1984) V. Erleben In (245-297) Pongratz, Ludwig J. (1984). Pongratz, Ludwig J. (1967, 1984, 2. A.) Problemgeschichte der Psychologie. Bern: Francke.Im dritten Kapitel "Erleben und Verhalten", 245-299, zwei Fundstellen "axiom". S. 282:
- 1984-Reusser (1950-) Reusser, Kurt (1984) PROBLEMLÖSEN IN WISSENSTHEORETISCHER SICHT. Dissertation Bern. Fundstellen "axiom" 10. S.3f: "Ich möchte drei Voraussetzungen oder Axiome der Psychologie des ausgehenden 19. Jahrhunderts kurz umreissen: (1) Das Bewusstsein als Gegenstand der Psychologie ... (2) Der assoziationistische Atomismus als nichtstrukturelle Aufbauund Wissenstheorie. ... (3) Subjektivismus ohne Subjektbegriff als anthropologische Haltung."
- 1984-Westmeyer (1946-2020). Westmeyer, Hans (1984) Kernkurs: Psychologie eine Wissenschaft? Version C/ Novembver 1984. Studienmaterialien FIM Psychologie Erlangen.
- 1985-Irtel. Irtel, Hans (1985) Die Prüfung der Additivität binokularer Farbenmischungen. Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie, 1985, 32 (4), 588-602, 18 Literaturang.
- 1988-Diederich-Orth. Diederich, Adele; Orth, Bernhard (1988) Produktsummenmodelle: Axiome und ihre empirische Überprüfung Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie, 1988, 35 (4), 546-558, 6 Literaturang.
- 1990-LuceKrantzSuppesTversky Luce, R. D., Krantz, D. H., Suppes, P., & Tversky, A. (1990). Foundations of measurement, Vol. 3. Representation, axiomatization, and invariance. Academic Press.
- 1991-Breuer. Breuer, F. (1991). Wissenschaftstheorie für Psychologen: eine Einführung. (Arbeiten zur sozialwissenschaftlichen Psychologie, Beih. 1). Münster: Aschendorff. [Online] Fundstellen Axiom: 9, aber keine Erklärung, was nun ein Axiom genau sein soll und wozu es nötig ist. Postulat 21 Fundstellen, aber keine Erklärung. Beweis 8. Prinzip 114.
- 1991-Groeben & Westmeyer. Groeben, Norbert & Westmeyer, Hans (1991, 2.A.) Kriterien psychologischer Forschung. München: Juventa. Fundstellen: Axiom 57, beweis, Postulat, Prinzip, S.68: "
- 1995-Sponsel (1944-) Die vorläufigen Axiome der IPPT. In (128-145) Sponsel, R. (1995). Auch im Internet.
- 1996-Sixtl (1935-2000) Sixtl, Friedrich (1996) Einführung in die exakte Psychologie. München: Oldenbourg. Im Sachregister keine Einträge "Axiom", "Postulat", "Prinzip".
- 2000-Carnap (1891-1970) Carnap, Rudolf (2000) Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik, edited by T. Bonk and J. Mosterin. Dannstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Zusammenfassung: In dem Buch, reiner Carnap Text, S. 59-166, findet keine inhaltliche Erörterung zum Axiombegriff statt, wie schon aus den Ausführungen 1930 zu befürchten war, obwohl Carnap S.61 schreibt (fett markiert RS): "... Diese verschiednen Forderungen stimmen darin überein, daß jede Axiomatik eine Grunddisziplin voraussetzt, und zwar als eine inhaltliche Disziplin, d.h. als eine, deren Begriffe eine bestimmte Bedeutung haben.' ...". Schon vorher, S. 59, fordert Carnap "scharfe Begriffsbestimmungen". Die gibt es aber zum Axiombegriff nicht. Überhaupt ist mir unklar geblieben, was Carnap mit seiner allgemeinen Axiomatik eigentlich will und was eine allgemeine Axiomatik leisten kann und soll.
- 2000-LexNeuro. Hanser, Ludwig (2000, PL). Lexikon der Neurowissenschaft. 4 Bde. incl. 1 Erg. Bd. m. Register. Heidelberg: Spektrum. "Axiom s [von griech. axioma =], Postulat, E axiom, eine ohne Beweis als wahr angenommene logische Formel. Eine Menge von Axiomen wird häufig zur formal-logischen Beschreibung der Theorie eines Sachgebiets aufgestellt und zur Deduktion weiterer Formeln verwendet. Ein bekanntes Beispiel aus der Arithmetik sind die Peano-Axiome zur Charakterisierung der natürlichen Zahlen." Die Verkürzung auf "logische Formel" ist viel zu eng und falsch, Aussage wäre besser.
- 2001-Hilgard. Atkinson, Rita L.; Atkinson, Richard C.; Smith, E.; Bem, Daryl J. & Nolen-Hoeksema, Susan, herausgegeben von Grabowski, Joachim und van der Meer, Elke (2001) Hilgards Einführung in die Psychologie. Heidelberg [u.a.] Spektrum. Im Sachregister keine Einträge Axiom, Prinzip, Postulat, Assumption.
- 2008-GerrigZimbardo. Gerrig, Richard J. & Zimbardo Philip, G. (2008) Psychologie. 18. aktualisierte Auflage. München: Pearson Studium. Zusammenfassung: 860 Seiten. "Axiom" kommt in diesem Werk nicht vor. Eine Erörterung über den Axiombegriff im Allgemeinen und besondere in der Psychologie erfolgt daher nicht. "postul" erzielt 22 Treffer, aber wie man sieht, erfolgt keine Erörterung zum Postulatbegriff, d.h. Postulat und postuliert werden nur erwähnt, gebraucht, aber nicht erläutert:
- 2012-APA APA handbook of research methods in psychology.
- 2012-Herzog (1949-). Herzog, Walter (2012) Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie. Wiesbaden: Springer VS. 2 Fundstellen "axiom" ohne nähere Erläuterung:
- S.75.1-2: "Axiomatische Voraussetzungen Dabei handelt es sich um ontologische Überzeugungen hinsichtlich der Beschaffenheit der Welt. Sie entsprechen den Idealen der Naturordnung bei Toulmin. Axiomatisch ist auch die Annahme, dass die Welt eine Ordnung aufweist, die dem menschlichen Erkenntnisvermögen zugänglich ist."
- 2013-Fahrenberg (1937-) Fahrenberg, Jochen (2013) Zur Kategorienlehre der Psychologie
- 87-110: 9 Erwähnungen im Zusammenhang mit Wundt 1866 Die physikalischen Axiome ...
- 165: Bühler.
- 184: Stumpf.
- 216: Valsiner.
- 435 Überschrift: "Fragwürdige Übertragung messtheoretischer Axiome auf Selbstbeurteilungen"
- 439: "... Axiome der Klassischen Testtheorie ..."
- 5 Erwähnungen in der Literaturliste.
- 2013-Pospeschill Pospeschill, Markus (2013) Empirische Methoden in der Psychologie. München: Reinhardt (UTB). (Buchpräsentation). Drei Sachregistereinträge "Axiom" S. 27, 43, 57. Seite 27 setzt Axiom und Postulat gleich. :
- 2014-Myers () Myers, David G. (2014) Psychologie. Berlin: Springer. Zusammenfassung. Der Axiombegriff kann nicht erörtert werden, weil das Wort schon gar nicht vorkommt, auch nicht Postulat. Eine Erörterung über den Axiombegriff im Allgemeinen und besondere in der Psychologie erfolgt nicht. Die Fundstellen im einzelnen: "annahme" 121, annehm 31, angenom 11, Vorannahme 8; "axiom" 0; basis 112; "begriff" 145, grundbegriff 1 (Lit); "beweis" 33, bewies 3; "Gesetz" 315; angesetzt 2, ausgesetzt 79, umgesetzt 6, vorgesetzt 37; "method" 220; "postul" 5, postulat 0, postuliert 5; "Prinzip" 218; "Regel" 271; "Satz" 385, ansatz 152, aufsatz 9, Datensatz 1, einsatz 46, ersatz 10, gegensatz 70, Grundsatz 4; "theor" 826, theorie 562, theorem 0, theoretisch 43; voraus 99, vorausgesetzt 4, voraussetzen 7, Voraussetzung 16; "wissen" 1201, wissenschaft 589, wissenschaftlich 206, unwissen 8;
- 2015-Bröder. Bröder, Arndt (2015) Entscheidungstheorien. In (Ebook PDF-Seiten 108-112) Galliker & Wolfradt (2015, Hrsg.). 7 Fundstellen "axiom".
- 108: "Der Mathematiker Daniel Bernoulli formulierte die Theorie des erwarteten Nutzens (EU-Theorie, für expected utility), die 1944 von John von Neumann und dem Ökonomen skar Morgenstern axiomatisiert wurde; das heißt, sie formulierten die genauen Bedingungen, aus denen Präferenzen folgen, die der Maximierung des erwarteten Nutzens bei Entscheidungen entsprechen. ..."
- 109.1: "Als formalisierte Theorie übte die EU-Theorie eine große Anziehungskraft auf psychologische Forscher aus, da ihre Axiome klare Verhaltenskonsequenzen implizieren, neben anderen zB die Forderung nach Transitivität von Präferenzen oder deren Unabhängigkeit von Konsequenzen, die allen ptionen gemeinsam sind (surething-principle) ..."
- 109.2: "... Viele empirische Tests der EU-Theorie verwendeten Wahlen zwischenabstrakten Lotterien, um die Axiome direkt zu testen, und fanden zahlreiche empirische Verletzungen. ..."
- 109.3: "... Amos Tversky demonstrierte intransitive Präferenzen, der Ökonom Maurice Allais wies auf Verletzungen des Unabhängigkeitsaxioms hin. ..."
- 109.4: "Wenngleich der rational handelnde homo oeconomicus für die Wirtschaftswissenschaften weiterhin eine »nützliche Fiktion« zur Erklärung wirtschaftlicher Vorgänge ist, zeigten die vielfältigen empirischen Verletzungen der EU-Axiome jedoch, dass er als psychologisches Modell zur Erklärung individuellen Verhaltens zu kurz greift."
- 2015-Fahrenberg (1937-). Fahrenberg, Jochen (2015) Theoretische Psychologie. Eine Systematik der Kontroversen. Lengerich: Pabst Science. Zusammenfassung: Kein Eintrag im Inhaltsverzeichnis und Sachregister. 48 Fundstellen "axiom" im Text, aber keine Erörterung des Axiomebegriff bei den ersten 10 Erwähnungen der Seiten 106-377:
- 106: "... Die übliche Forschungspraxis verzichtet auf eine empirische Überprüfung der jeweiligen Ska-lenaxiomatik. ..."
- 107: "... Darüber hinaus kann die Skepsis vielleicht ausgedrückt werden, indem eine Formulierung Fegers (1991, S. 83) aus dem Zusammenhang genommen und verallgemeinert wird: „Die Hauptvertreter des axiomati-schen Ansatzes scheinen bereits das Opfer ihrer Auswahl ‚interessanter Messsituationen‘ geworden zu sein ...“"
- 121: "... Das radikale Beharren auf der Theorieabhängigkeit jeder Definition von Prädikaten, ohne dass überhaupt eine axiomatisierte Theorie gegeben und akzeptiert ist, würde die wissenschaftliche Kom-munikation und kreative Entwicklung nicht erleichtern. ..."
- 255: Zitat Wundts.
- 261: Literaturhinweis zu Wundt (1866) Die physikalischen Axiome ...
- 273: Zitat Tiefensees zu Brentanos Axiomen (analytische Urteile a priori)
- 281: Bezug auf Brentano.
- 345: Bezugnahme Stumpfs Axiome. [1939, 1940]
- 360: "... Abgesehen von seinen Axiomen des psychophysischen Parallelismus verzichtet Köhler weitgehend auf definitorische Zusammenfassungen und er gibt auch keine Systematik der Kategorien und Relationsbegriffe. ..."
- 377: Bezugnahme Avenarius.
- 2015-Galliker & Wolfradt. Galliker, Mark & Wolfradt, Uwe (2015, Hrsg.) Kompendium psychologischer Theorien. Frankfurt: Suhrkamp. Im ganzen Buch 11 Fundstellen "axiom", die sich auf zwei Autoren verteilen: Bröder (Entscheidungstheorien) und Herzog (Psychologik). Beide erwähnen "axiom", aber geben keine Erläuterung zum Axiombegriff. Auch dass der Werk keinen eigenen Eintrag "Axiomatik" hat, ist ein klarer Mangel. Im Stichwort Wissenschaftstheorie taucht das Wort gar nicht auf.
- 2015-Herzog. Herzog, Walter (2015) Psychologik. In (Ebook PD-Seiten 415-418) Galliker & Wolfradt (2015, Hrsg.).
- 415.1: "Die Psychologik wurde von Jan Smedslund begründet, der bisher ihr einziger namhafter Vertreter istElemente seiner Kritik am psychologischen Mainstream finden sich jedoch auch bei anderen Repräsentanten der Disziplin wie Fritz Heider, Uwe aucken, Jochen Brandtstädter, André Kukla oder Peter GssorioBeziehungen bestehen sowohl zur analytischen Philosophie (udwig Wittgenstein, Gilbert Ryle, John Searle, Daniel Dennett ua), deren Methode der Sprachanalyse mit Smedslunds axiomatischem Ansatz weitgehend übereinstimmt, wie auch zur
- 415.2: "... Vergleichbar der euklidischen Geometrie, gewinnt sie dadurch den Charakter eines axiomatischen Systems, indem sie den psychologischen Alltagsverstand in unbestrittene Grundsätze, definierbare Begriffe und daraus abgeleitete Theoreme zerlegt ... "
- 416: "... Da Bedeutungen in analytischer Beziehung zueinander stehen, lassen sich die Axiome der Psychologik nicht mit den gängigen Verfahren der psychologischen Forschung aufdecken ..."
- 418: "... Das wird von Smedslund insofern anerkannt, als er den Axiomen der Psychologik zwar universellen Charakter zuschreibt, trotzdem aber mit der Möglichkeit rechnet, dass sie unter anderen ebensbedingungen anders sein könnten. ..."
- 2016-Galliker () . Galliker, Mark (2016) Ist die Psychologie eine Wissenschaft? Wiesbaden: Springer.
- S.93: "... Als allenfalls „dogmatisch“ kann Dilthey dort verstanden werden, wo es um die „Axiome“ seines Ansatzes geht ..."
- S.98: "... Diese Antwort war für Fries allenfalls hinsichtlich geometrischer Axiome zutreffend, doch in Bezug auf andere wissenschaftliche Bereiche oder auch bezüglich des Gebietes der Metaphysik betrachtete er sie als fragwürdig."
- S.100.1-2: "Mill zufolge sind selbst die Axiome der Mathematik Generalisierungen von Erfahrungen. Mit anderen Worten: Die Evidenz wissenschaftlicher Axiome ist eine erfahrungsmäßige und nach dem Autor letztlich auch immer eine „experimentale“. ..."
- 2021-Wandelt () Wandelt, Alina (2021) Algorithmische Gouvernementalität am Beispiel von OKCupid. S.23: "Dabei bildet sich eine neue Vorstellung von Natur heraus: Im unterstützenden Regieren der Bevölkerung ‚in der Realität‘ wie in der Forderung des therapeutischen .1: ""Ethos nach dem Herausschälen des ‚wahren‘ Selbst: Wie Illouz schreibt, ist die Idee des wahren Selbst eines der zentralen Axiome der Psychologie; dieses zu offenbaren bedarf ‚enormer Geschicklichkeit und größter Vorsicht‘ ([2008] 2011: 220) und deshalb der Unterstützung und Technik von Experten (ebd.)"
- 2021-2023-Psychologie-Welt ohne Datum Copyright 2021-2023 "Der Fall für die Gerechtigkeit über die Barmherzigkeit .... Eine der wenigen vereinbarten Axiome der Psychologie ist, dass Sie mehr von dem bekommen, was Sie belohnen, weniger von dem, was Sie bestrafen. Wenn also ein Professor "großzügig" in der Bewertung ist, bestraft diese Gnade die verdienstvollen Studenten, deren legitimes A nun weniger ausweist und diejenigen belohnt, die weniger getan haben, um A zu bekommen. "
- 2024-APA Dictionary (Updated on 04/19/2018). "axiom n. in logic and philosophy, a universally accepted proposition that is not capable of proof or disproof. An axiom can be used as the starting point for a chain of deductive reasoning. Also called postulate. [from Greek axioma, “worthy thing”] —axiomatic adj." Die APA setzt Axiom und Postulat gleich.
- 2024-bing-Suche- (Abruf 19.12.2024) "Axiome der Psychologie". 2 Treffer von 9 mit 7 Anzeigen.
- 2024-Cottbus-Nachrichten vom 21.10.2024 "Was bedeutet ‚Sichi‘? Die Bedeutung und Herkunft des Begriffs erläutert ... Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle in der zwischenmenschlichen Verständigung, und die Bedeutung des Begriffs ’sichi‘ kann zahlreiche Kommunikationsarten beeinflussen. Axiome der Psychologie zeigen, dass sowohl einseitige als auch zweiseitige Kommunikation Formen des Informationsaustauschs darstellen, wobei die Sprache und die Verwendung von Zeichen und Bewegungen entscheidend sind."
- 2024-Dorsch-Lex (Abruf 19.12.2024) "Axiom [engl. axiom; gr. ... (axioma) Wertschätzung, Forderung], [PHI], Postulat, Grundannahme einer (formal- oder erfahrungswiss.) Theorie, die i. R. dieser Theorie selbst nicht deduktiv ableitbar ist. Axiome dienen dazu, andere Aussagen (Theoreme) aus ihnen abzuleiten. Axiome innerhalb erfahrungswiss. Theorien werden anhand der empirischen Konsequenzen dieser Theorien geprüft. Die frühere Auffassung, dass Axiome «evident» und einer Begründung weder fähig noch bedürftig seien, ist heute kaum mehr von Bedeutung."
- 2024-Duden (Abruf 28.12.2024)
- als absolut richtig erkannter Grundsatz; gültige Wahrheit, die keines Beweises bedarf
- nicht abgeleitete Aussage eines Wissenschaftsbereichs, aus der andere Aussagen deduziert werden
- 2024-Spektrum-LexPsy (Abruf 19.12.2024): "Axiom, als absolut richtig bzw. wahr anerkannter Grundsatz, der seinen Wahrheitsgehalt und Einsichtigkeit in sich selbst trägt und keines Beweise bedarf. Grundannahme einer wissenschaftlichen Theorie, die dazu dient, andere Aussagen (Theoreme) aus ihnen abzuleiten."
Zusammenfassung: Fundstellen: Annahme 7, Axiom 75, beweis 30, Ableitung 0, Kausalität 13, Postulat 2, Prinzp 21, Gesetz 107, Regel 25, erleben 12, erlebt 4, Erlebnis 5. Band II > 1940. Ich habe die ersten 15 Fundstellen bis Seite 154 gesichtet und dokumentiert. Eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Begriff des Axioms (> Checkliste Axiome) findet bei den ersten 15 Erwähnungen der ersten 154 Seiten nicht statt:Ich habe die ersten 15 Fundstellen bis Seite 154 gesichtet und dokumentiert. Eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Begriff des Axioms (> Checkliste Axiome) findet bei den ersten 15 Erwähnung der ersten 154 Seiten nicht statt:
- [1] RS-SEL1-7: Stumpf setzt an der ersten Fundstelle S. 7 Axiome
mit "allgemeinen Sätzen" gleich, ohne den Begriff des Axioms ausdrücklich
zu erläutern.
[2] RS-SEL1-14: In der zweiten Erwähnung S. 14, sagt Stumpf, Axiome regeln die Beziehungen der Dinge untereinander.
[3] RS-SEL1-68: In der 3. Erwähnung S. 68 kennzeichnet Stumpf Axiom nach der modernen Konventionslehre als willkürlich angenommene Vordersätze, weiter spezifiziert als die einfachsten und folgenreichsten.
[4] RS-SEL1-97: In der 4. Erwähnung S. 97, sagt Stumpf, dass die großen Mathematiker in ihren Axiomen sehr allgemeine Begriffe als gegeben voraussetzten.
[5] RS-SEL1-127: Der Begriff der Selbstverständlichkeit und Notwendigkeit wird in der 5. Erwähnung S. 127 mit Axiomen am Beispiel des Satzes vom Widerspruch oder Ähnlichem in Verbindung gebracht.
[6] RS-SEL1-128: RS-SEL1-128: Axiome werden in der 6. Erwähnung mit Beispiel Satz vom Widerspruch als unmittelbare Vernunfterkenntnis angesehen, wobei Stumpf fragt, welche andere dieser Art es wohl noch geben mag.
[7] RS-SEL1-130: 7. Erwähnung Überschriften "Universalaxiome" und "Kategorische Axiome". "a. Satz des Einschlusses „Was in einem Begriffsganzen als Teil enthalten ist, muß von dem ganzen ausgesagt werden, ... Dies ist der Grundsatz der sog. analytischen Urteile."
[8] RS-SEL1-131.1: 8. Erwähnung Bezugnahme Descartes.
[9] RS-SEL1-131.2: In der 9. Erwähnung werden Axiome als verkleidete Definitionen interpretiert.
[10] RS-SEL1-131.3: In der 10. Erwähnung sagt Stumpf, dass man in der Logik den Satz der Identität als erstes aller Axiome hinstelle.
[11] RS-SEL1-136: In der 11. Erwähnung behauptet Stumpf, ohne dies durch entsprechende Zitate zu belegen, dass die neuere Mathematik und Physik misstrauisch und umstürzlerisch gegen die Axiome vorgehe.
[12] RS-SEL1-150: Die 12. Erwähnung empfiehlt einen Satz besser als Axiom einzuführen.
[13] RS-SEL1-152: Überschrift "2. Folgerungsaxiome". "Wir verstehen darunter Sätze, die den Zusammenhang zwischen den Vordersätzen und dem Schlußsatz eines formel gültiges Schlusses aussprechen."
[14] RS-SEL1-153 Die 14. Erwähnung macht einen technischen Einwand gegen ein durch Umformung erhaltenes Axiom.
[15] RS-SEL1-154: In der 14. Erwähnung äußert sich Stumpf zur Vielzahl der "Folgerungsaxiome", die nach einer Fußnote des Herausgebers in § 20 eingefügt worden sind.
Burt gebraucht den Ausdruck "axiom" in seinem Buch The Factors of the Mind (1940) insgesamt 11 mal, 1 mal davon im Index (Sachregister). Sämtliche Fundstellen wurden erfasst und dokumentiert, in englisch und in deutsch durch Google Übersetzer. Der Axiombegriff wird hierbei von Burt nicht definiert oder näher erläutert, so dass die inhaltlichen Bestimmungen auf Behauptungsniveau bleiben..
Sachlich-thematisch habe ich im Register erfasst:
- p. 2: "Der Begriff „Theorie“ hat in den Verhaltens- oder
„Sozial“-Wissenschaften eine Vielzahl von Bedeutungen. Im Sinne der vorliegenden
Arbeit ist eine Theorie eine systematische deduktive Ableitung der sekundären
Prinzipien beobachtbarer Phänomene aus einer relativ kleinen Anzahl
von primären Prinzipien oder Postulaten, ähnlich wie die sekundären
Prinzipien oder Theoreme der Geometrie letztlich als logische Hierarchie
aus einigen ursprünglichen Definitionen und primären Prinzipien,
den Axiomen, abgeleitet werden. In der Wissenschaft gilt ein beobachtetes
Ereignis als erklärt, wenn der Satz, der es ausdrückt, logisch
aus [>2] einer Reihe von Definitionen und Postulaten in Verbindung mit
bestimmten beobachteten Bedingungen, die dem Ereignis vorausgehen, abgeleitet
wurde. Dies ist, kurz gesagt, das Wesen der wissenschaftlichen Theorie
und Erklärung, wie sie in den physikalischen Wissenschaften nach Jahrhunderten
erfolgreicher Entwicklung allgemein verstanden und akzeptiert wird (i,
S. 495-496)."
— sinnvolle und sinnlose 73f., 207". Falsches Einstein/Infeld-Zitat ohne Seitenzahl und Wortchaos Annahme, Axiom, Postulat, (Anmerkung S. 212): In der englischen Ausgabe Einstein/Infeld ist p. 186 von "new assumption" (zwei) die Rede, in der deutschen Ausgabe von Einstein/Infeld S. 120 wird von "beiden Postulaten" gesprochen und Wertheimer spricht vom Vergleich von drei Axiomen, obwohl es in der Relativitätstheorie, im neuen Konzept nur zwei gibt.
| Einstein/Infeld Englische
Ausgabe (1938) p.185
(1) The velocity of light in empty space always has its standard value, independent ofthe motion of the source or receiver of light. (2) In two c.s. moving uniformly, relative to each other, alllaws of nature are exactly identical and there is no way of distinguishing absolute uniform motion. (3) Positions and velocities are transformed from one inertialsystem to another according to the classical transformation. The contradiction is then evident. We cannot combine (1), (2), and (3). |
p. 186 Our new assumptions are:
(1) Thevelocity oflight in vacuois the samein all c.s. movinguniformly, relative to eachother. (2) All laws of nature are the samein all c.s. moving uniformly, relative to each other. The relativity theory begins with these two
|
| Deutsche Ausgabe S.119: Einstein, Albert & Infeld,
Leopold (1956ff) Die Evolution der Physik. Reinbek: Rowohlt (rde).
1. Im leeren Raum ist die Lichtgeschwindigkeit stets konstant. Sie hängt weder von der Bewegung der Lichtquelle noch von der des Beobachters ab. [>120] 2. In zwei gleichförmig gegeneinander bewegten Systemen herrschen genau dieselben Naturgesetze. Es gibt keine Möglichkeit, eine absolut gleichförmige Bewegung zu konstatieren. 3. Positionen und Geschwindigkeiten werden gemäß der klassischl Transformation von einem Inertialsystem in ein anderes übertragen - dann liegt der Widerspruch klar zutage. Wir können die Punkte 1,2 und 3 nicht auf einen Nenner bringen. |
S.120 "Unsere neuen Annahmen lauten:
1. Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist für alle gleichförmig, gegeneinander bewegten Systeme gleich groß. 2. In allen gleichförmig gegeneinander bewegten Systemen gelten durchweg die gleichen Naturgesetze. Von diesen beiden Postulaten geht die Relativitätstheorie
aus. Die klassischen Transformation wollen wir uns von nun an nicht mehr
be[>121]dienen, da wir wissen, daß sie sich mit unseren Annahmen
nicht vereinbaren läßt."
|
1. Es gibt Bedeutungsbereiche (Aussagegebiete), die von dem objektiven eindeutigen Aussagebereich verschieden sind.
2. Es gibt unzählige solche sonderdeutigen Bedeutungs,bereiche, die auch voneinander verschieden sind. ...3....4."
| p.16: "It is helpful to distinguish among definitions, postulates, and theorems. In a formal system like algebra these distinctions are clear enough. By means of definitions we introduce new signs into the system, and the definitions relate the new signs to the older signs already explicated. Thus an = a X a X a X . . . (for n factors) is a definition used to introduce the exponential sign into the system. Postulates, then, are the statements we make, without proof, about the signs and operators and their relations. And theorems are the statements arrived at by combining the signs in a manner consistent with the postulates and definitions." | GÜ: "Es ist hilfreich, zwischen Definitionen, Postulaten und Theoremen zu unterscheiden. In einem formalen System wie der Algebra sind diese Unterscheidungen klar genug. Mittels Definitionen führen wir neue Zeichen in das System ein, und die Definitionen setzen die neuen Zeichen mit den bereits erläuterten älteren Zeichen in Beziehung. Daher ist an = a X a X a X . . . (für n Faktoren) eine Definition, die verwendet wird, um das Exponentialzeichen in das System einzuführen. Postulate sind also die Aussagen, die wir ohne Beweis über die Zeichen und Operatoren und ihre Beziehungen machen. Und Theoreme sind die Aussagen, zu denen wir gelangen, wenn wir die Zeichen in einer Weise kombinieren, die mit den Postulaten und Definitionen vereinbar ist." |
- "2. Die axiomatische Methode. So wie man die Begriffe
einer Wissenschaft in der Weise ordnen kann, daß man die Undefinierten
Begriffe an den Anfang stellt und die übrigen Begriffe auf dem Wege
der Definition auf sie zurückführt, so lassen sich auch die Aussagen
eines wissenschaftlichen Gebietes, von denen die Wissenschaftler annehmen
oder wissen, daß sie wahr sind, in der Weise ordnen, daß man
gewisse Aussagen, die Grundsätze oder Axiome genannt werden, an den
Anfang stellt, aus denen sich dann die übrigen logisch ablciten lassen.
..." Zur modernen Auffassung siehe Zitat Hübner 1980.
- p.6 "a. Interpretation. Part ii
of the axiom simply states that if y is invariably chosen over x then x
may be deleted from T when considering choices from T. This seems reasonable.
If one never selects liver in preferenee to roast beef, then in choosing
among liver, roast beef, and chicken one can immediately reduce the problem
to consideration of roast beef and chicken."
[GÜ] "a. Interpretation. Teil ii des Axioms besagt einfach, dass, wenn y ausnahmslos vor x gewählt wird, x bei der Erwägung von Entscheidungen aus T gestrichen werden kann. Das erscheint vernünftig. Wenn man nie Leber vor Roastbeef auswählt, dann kann man bei der Wahl zwischen Leber, Roastbeef und Huhn das Problem sofort auf die Erwägung von Roastbeef und Huhn reduzieren.."
Der Begriff Axiom und pramatisches Axiom wird nicht geklärt. Zu einer früheren Kritik der Axiome von mir siehe bitte hier.
Anmerkung: Watzlawick, Paul; Weakland, John H. & Fisch, Richard (1974) Lösungen. Zur Theorie und Praxis menschlichen Wandels. Bern: Huber. Im Sachregister kein Eintrag "Axiom(e)"
1970-Piaget (1896-1980) Piaget, Jean (1970, dt. 1974) Abriss der genetischen Epistemologie. Übersetzung: Fritz Kubli. Olten und Freiburg: Walter. Zusammenfassung: Die meisten Erwähnungen erfolgen im Abschnitt Epistemiologie der Logik (101-108). Den Ausführungen kann man entnehmen, dass Piaget Axiome und Prinzip synonym verwendet. Während bei Euklid die Axiome noch anschaulich und evident sein mussten, verlange die moderne Lehre nur noch Widerspruchsfreiheit, Vollständigkeit und Unabhängigkeit. Eine ausdrückliche Erörterung des Axiombegriffs selbst findet nicht statt.
102.1-4: "Wenn die Axiomatisierung tatsächlich auf gewissen Prozessen der reflektierenden Abstraktion beruht, erlangt sie mit zunehmender Verfeinerung eine immer größere Bewegungsfreiheit. Die fragliche Abstraktion tritt klar zutage, wenn der Logiker auf sein eigenes Denken zurückgeht und daraus gewisse elementare Prinzipien entnimmt - wie das Identitätsprinzip, das Widerspruchsprinzip und das Prinzip des ausgeschlossenen Dritten. Die Geschichte der Axiomatisierungen zeigt indessen, daß, obschon auf einer gewissen Entwicklungsstufe, etwa bei Euklid, die Axiome noch anschaulich und evident sein mußten (und somit Anleihen beim natürlichen Denken waren), die retroaktive Abstraktion schließlich zu einer differenzierten Aktivität wurde, die ihre Ziele, je mehr diese bewußt waren, verallgemeinerte und dadurch immer weniger intuitive Theorien zu begründen vermochte (die nicht-euklidischen Geometrien sind in dieser Hinsicht ein bedeutsamer Markstein). Die Formalisation durfte sich von nun an ihre Axiome völlig frei - je nach Bedürfnis - vorgeben, ohne sich auf die vom natürlichen Denken gelieferten Elemente zu beschränken. "
103.1-3: "... Welchen Inhalt axiomatisiert die formale Logik? In der Geschichte der Mathematik geht der formalisierten Theorie zumeist eine intuitive oder «naive» Theorie voran. In der Logik läßt sich hingegen nur schwer eine ähnliche Unterscheidung treffen, und trotzdem dürfte ein axiomatisches System kaum aus dem Nichts geboren werden, da die unbewiesenen und unbeweisbaren Aussagen, die als Axiome gewählt werden, und die nicht-definierbaren Begriffe, welche zur Abgrenzung aller definierten Begriffe unerläßlich sind, eine ganze Welt von implizierten Verbindungen umlassen. ..."
105: "... Jedes formale System beruht auf Axiomen, die den drei Bedingungen unterworfen sind: Vollständigkeit, Verträglichkeit und Unabhängigkeit (die letztere besagt, daß zwei Axiome sich nicht durch Tautologie aufeinander reduzieren dürfen)."
ChatGPT am 0801.2025 zur Wissenschaftstheorie Piagets: "Ein prägnanter „Hauptsatz“ der epistemischen Erkenntnistheorie von Piaget könnte in etwa so lauten:
- „Wissen ist das Ergebnis eines dynamischen Prozesses
der aktiven Konstruktion durch die Wechselwirkung zwischen Subjekt und
Umwelt, wobei Assimilation, Akkommodation und Äquilibration als zentrale
Mechanismen wirken.“
| Ein Hauptsatz der Wissenschaftstheorie zum Anfang lautet: Irgendwo muss man anfangen und diesen Anfang kann man nicht beweisen und muss ihn folglich als gültig und wahr annehmen (ein Axiom?). Solche Anfangsannahmen wurden als Axiome bezeichnet und kann man auch als Axiome bezeichnen. Axiome bedeuten in diesem Sinne nichts anderes als erste Sätze, die man unbewiesen als wahr und gültig annimmt, um einem unendlichen Zurückschreiten zu entgehen. |
- „Unter einer Axiomatisierung wollen wir die Bildung eines
Axiomensystems verstehen. Jede Axiomatisierung hat von einer Anzahl undefinierter
oder primitiver Ausdrücke (oder: Grundbegriffen) auszugehen, wie z.
B. dem Begriff »Menge«. Aus undefinierten lassen sich definierte
Ausdrücke ableiten, wie z. B. die Begriffe »Relation«
und »Operation« in der Mengenlehre. In der Meßtheorie
werden diese Begriffe jedoch undefiniert gelassen; die Mengenlehre wird
insofern vorausgesetzt. Meßtheoretische Axiome sind Eigenschaften
undefinierter Begriffe: die undefinierten Begriffe bilden das Relativ.
Im allgemeinen sind bei einer Axiomatisierung Ableitungsregeln anzugeben,
die festlegen, mit welchen Mitteln definierte Ausdrücke aus undefinierten
und Theoreme aus Axiomen abgeleitet werden dürfen. In der Meßtheorie
sind dieses alle logischen und mathematischen Regeln, die nicht gesondert
angegeben werden. Ein Axiomensystem ist ein formales System und bedarf
einer (inhaltlichen) Interpretation: in der Meßtheorie muß
es empirisch und numerisch interpretiert werden können.“
- "(1) In Logik und Mathematik ist es üblich geworden,
mit einem System von Axiomen und Regeln zu beginnen; diese Axiome und Regeln
brauchen dabei nicht begründet zu werden. Die analytischen Wissenschaften
haben nun dieses axiomatische Vorgehen der Formal Wissenschaften zu dem
wissenschaftlichen Vorgehen bei der Bildung von Theorien überhaupt
erhoben. Die Begründungsfrage für die Grundbegriffe und Grundsätze
(Axiome) einer Wissenschaft ist jedoch durch die normative Setzung (eines
faktischen Vorgehens) eliminiert."
Modells festzustellen, ob die Forderungen des choice-axiom erfüllt sind. ..."
- "Axiome gelten nicht mehr, wie in der klassischen Formulierung,
als letzte Evidenzen, sondern als postulierte Kemsätze allgemeiner
Art, die mit speziellen Aussagen in einer komplexen Wenn-Dann-Relation
stehen. Stegmüller gibt diese moderne Deutung der Axiome für
die Mathematik in folgender Weise:
- 'Was behauptet also der Mathematiker, der einen Lehrsatz
innerhalb eines axiomatischen Systems entdeckt hat? Die Antwort muß
lauten: Vom Mathematiker wird nicht der Lehrsatz in Isolierung als eine
assertorische Behauptung aufgestellt, sondern eine komplexe Wenn-Dann-Aussage.
In der Wenn-Komponente dieser Behauptung ist das gesamte Axiomen-System
enthalten (d. h. also die einzelnen durch ‘und’ verbundenen Axiome), in
der Dann-Komponente der betreffende Lehrsatz. Eine mathematische Aussage
hat also nicht die Gestalt „das und das gilt", sondern vielmehr „wenn die
und die Axiome gelten, dann gilt auch das und das“ (Stegmüller, 1958,
S. 337).'"
| Axiome und Axiomatisierung nehmen einen breiten Raum ein und werden
oft erwähnt, so im Inhaltsverzeichnis
_ |
Axiom 46ff, 79, 82, 124
— Archimedisches 234, 284 — Assoziativität 286 — Aufhebung 250ff distributive 246 dual-distributive 246 — Bisymmetrie 284f — Doppelaufhebung 232f, 236, 239, 243, 264 — existentielles 237 — hinreichende Axiome 118 — Kommutativität 252ff, 286 — Konnexität, s. Vollständigkeit — Lösbarkeit 234f, 262, 284 — Minimalität 260,267, 325,414f — Monotonität 284 — nicht-notwendiges 236 — notwendiges 118, 236 — Positivität 266 _ |
— Reflexivität 46, 134f, 286— schwache Monotonie
265
— segmentäre Additivität 267,414 — Symmetrie 134f, 260, 266, 325, 394,414 — technisches 237 — Thomsen-Bedingung 232 — Transitivität 48, 52, 80, 134f, 182, 184ff, 192ff, 200ff, 229, 382, 389 — Unabhängigkeit 229ff, 239 einfache 24Iff, 261 gemeinsame 24Iff, 263 — universelle 237 — Vollständigkeit 48, 52, 80, 182, 200, 229, 382 — Vorzeichen-Abhängigkeit einfache 242ff gemeinsame 243ff — Wesentlichkeit 235f axiomatische Methode 82ff, 416 |
Anmerkung aus Orth (1974), S. 41: „Das über Skalierungsverfahren Gesagte gilt sinngemäß auch für psychologische Tests. Diese sind auch »Meßverfahren per fiat« genannt worden (Torgerson, 1958; Pfanzagl, 1968; Fischer, 1970), da sie auf dem Glauben beruhen, daß die jeweilige Eigenschaft meßbar sei, und daß Tests zur Messung auf Intervallskalenniveau führten. Ein weiterer Unterschied zwischen Meßstrukturen und Tests besteht darin, daß bei letzteren nicht ein empirisches Relativ in ein numerisches, sondern ein numerisches [Buch 288] Relativ in ein anderes numerisches Relativ abgebildet wird. Es werden (numerische) Testrohwerte in numerische Testwerte abgebildet bzw. transformiert. Für eine Messung mit Hilfe von Tests auf Intervallskalenniveau sind die meßtheoretischen Grundlagen noch zu entwickeln. Dennoch sind Tests keinesfalls wertlos; sie sind wichtige Instrumente zur Diagnostik und Vorhersage.“
- "a) Wundt war noch im Denken der sogenannten «Bewußtseinspsychologie»
befangen. Er glaubte, alle seelischen Vorgänge enthielten sensuelle,
anschauliche Elemente. Dieses «sensualistische Axiom»
[RS: Beleg?] haben die Forschungen der sogenannten «Würzburger
Schule» nicht bestätigt. Unter Führung von OSWALD KÜLPE
(1862-1915) nahmen NARZISS ACH (1871-1946), KARL BÜHLER (1879 bis
1963), KARL MARBE (1869-1953), AUGUST MESSER (1867-1937), OTTO SELZ (1881-1944)
und andere die Analyse von Denkakten (Urteilen, Schlüssen) in Angriff.
Sie fanden, daß das Denken nicht durch Vorstellungsverbindungen zu
erklären sei; gerade die sogenannten unanschaulichen Anteile seien
beim Denken das Entscheidende. Sie nannten diese Bestandteile «Bewußtheiten»
(Ach) oder «Gedanken» (Bühler) und «determinierende
Tendenzen» (Ach)."
- "... Denn es wurde ja eine ganzheitliche Bewegungsgestalt,
nicht ein Aggregat von Empfindungselementen wahrgenommnen (Wertheimer,
1912). Damit war in den Augen dieser Forscher die Unhaltbarkeit des «atomistischen»
Axioms
experimentell erwiesen und der gestalthcorctische Ansatz notwendig geworden."
Die Postulate der Hullschen Theorie entsprechen den Axiomen des theoretischen Teils seiner Theorie. Einige Axiome der allgemeinen Verhaltenstheorie hat Westmeyer (1973) formuliert. Krause (1972) hat eine Formalisierung der Festingerschen Dissonanztheorie vorgelegt. Andere Beispiele für explizit axiomatisch aufgebaute Theorien findet man unter den mathematischen Lern- und Entscheidungstheorien. Wie wir gesehen haben, können aber auch beliebige andere hinreichend klar formulierte Theorien in axiomatische Theorien verwandelt werden."
_
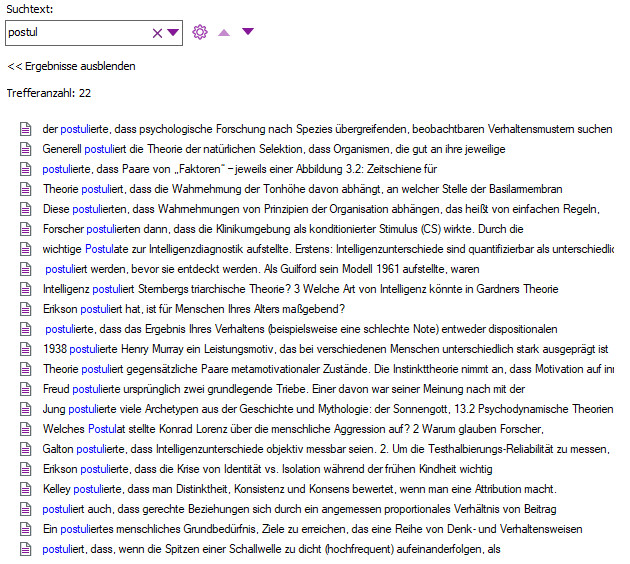
"prinzip" wird sogar 143 mal erwähnt. Im Sachregister
taucht nicht eigens aud, nur das Prinzip der Erhaltung wir dort erwähnt.
Die ersten 13 Erwähnungen kommen im Inhaltsverzeichnis vor. Der Prinzipbegriff
selbst wird bei den ersten 20 Erwähnungen im eigentlichen Text erörtert
und erläutert.
"annahm" 95, annehm 33, angenom 143 werden insgesamt
271 erwähnt, aber nicht die wissenschafttheoretische Bedeutung erörtert
oder erläutert, etwa warum man unter bestimmten Bedingungen diese
oder jene Annahme treffen kann und dies erläutern muss. .
Die Fundstellen der Suchkürzel im einzelnen::
"annahm" 95, annehm 33, angenom 143; "axiom" 0;
basis 112; "begriff" 145, grundbegriff 0; "beweis"
33, bewies 1; "Gesetz" 221; "method" 292; "postul"
22; "Prinzip" 143; "Regel" ; "Satz" 103, ansatz 71,
aufsatz 7, Datensatz 3, einsatz 58, ersatz 9, gegensatz 55, Grundsatz 0;
"theor" ; voraus ; "wissen" ;
Komplementaritätsprinzip. Perspektiven und Perspektiven-Wechsel. e-Buch, zweite Fassung. Zusammenfassung: Im Inhaltsverzeich und Sachregister kein Eintrag. 15 Erwähnungen im Text (die 5 im LitVerz nicht einbezogen), aber keine Erörterung zum Axiombegriff im Text:
- "... Idealerweise enthält
das Aussagensystem einer Theorie Axiome, d. h. grundlegende Postulate,
die nicht aus anderen Sätzen abgeleitet werden können, aus denen
unter Zuhilfenahme von logischen Transformations- und Ableitungsregeln
weitere Aussagen und Theoreme deduzierbar sind. In der Psychologie und
anderen Sozialwissenschaf [>28] ten sind derart ausgearbeitete und formalisierte
Theorien jedoch eher die Ausnahme.
Nichtsdestotrotz sollte eine gute Theorie die Befunde nicht nur beschreiben und erklären, sondern auch in einem erweiterten Geltungsbereich wertvoll sein, indem sie prognostisch über zukünftige Ereignisse und Entwicklungen Annahmen erlaubt."
phänomenologischen Soziologie (Alfred Schütz, Erving Goffman, Thomas uckmann, Aaron Cicourel ua), die in den Strukturen der ebenswelt einen ähnlichen Gegenstand bearbeitet wie Smedslund, dessen Anliegen in der Rekonstruktion des psychologischen Alltagswissens liegt."
4 Fundstellen "axiom", allerdings nur Erwähnungen bezüglich anderer Autoren (Dilthey, Fries, Mill) ohne begriffliche Klärung:
- "Axiom ...
Bedeutungen (2)
Erkenntnis, Grundprinzip, Grundsatz, Lehrsatz
Alphabetisches Axiomeregister
Hier werden Fundstellen nach Autoren alphabetisch geordnet dokumentiert: explizite und implizite, erlärte und unerklärte durch bloßen Gebrauch, gewichtige und weniger gewichtige bis hin zu kuriosen (Jeversches-Wochenblatt 1939).
APA 2024 * Aristoteles 360-330 v.Chr.* Atkinson, Rita L. 2001 * Atkinson, Richard C. 2001 * Bem, Daryl J. 2001 * bing 2024 * Block 1978 * Breuer 1991 * Bühler 1933, 1934 * Burt 1940 * Carnap 1930, 2000. * Cottbus Nachrichten 2024 * Diederich-Orth 1988 * Dorsch 2024 * Drösler 1979 * Duden 1980, 2024 * Einstein & Infeld 1938 - Euklid 300 v.Chr. * Fahrenberg 2013, 2015 * Fichte 1794, 1797, 1835 * Fodor 1978 * Galliker & Wolfradt 2015 * Galliker 2016 * Gerrig & Zimbardo 2008 * Gödel 1931 * Grimm 1854 * Groeben & Westmeyer 1991 * Harnatt 1977 * Herzog 2012 * Hilbert 1899, 1928 * Huber 1972 * Hübner 1980 * Hull 1943 * Infeld 1938 (mit Einstein) * Irtel 1985 * Jeversches-Wochenblatt 1939 * Kamlah & Lorenzen 1973 * Kant 1755-1804 (Schaffenszeit) * Kolmogoroff 1933 * Krantz, H.T. 1981 * Krug 1838 * Külpe 1921 * Lewin 1931, 1936 * LexNeuro 2000 * Lorenzen 1973 (mit Kamlah) * Luce 1959 * McDougall 1913 * Messen und Testen (EdP B,I,3) 1983 * Müller, G.E. 1879, 1896f., 1904 * Münsterberg 1989b, 1904 * Myers 2014 * Newton 1687 * Nolen-Hoeksema, Susan 2001 * Orth > Diederich. * Piaget 1970, 1972 * Pongratz 1984 * Pospeschill 2013 * Psychologie-Welt 2021-2023 * Reusser 1984 * Rührig 1982/83 * Russell 1903-1913 * Savage 1978 * Schiller, P. 1948 * Schultz, Julius 1897, 1899 * Schwartz 1978 * Schwemmer 1977 * Simon 1978 * Sixtl 1996 * Smith, E. 2001 * Spektrum LexPsy 2024 * Sponsel 1995 * Stegmüller 1958 * 1983* Stevens 1951 * Stumpf 1891, 1939, 1940 * Tetens 1777 * Titchener 1901-1905, 1910 * Toebe 1977 * Vaihinger 1911 * Wandelt 2021 * Watzlawick 1967, 1969, * Werbik 1977 * Wertheimer 1945 * Westermann 1980 * Westmeyer 1973, 1991 (mit Groeben) * Whitehead 1903-1913 (mit Russell) * Wundt 1866, 1874, 1896,1898, * Zimbardo > Gerrig.
_
Sachliches, thematisches Axiomregister
- Allgemeine Axiomatik > Carnap 1930, 2000.
- Anfangsproblem Kamlah & Lorenzen 1973.
- atomistisches Axiom Dessen Unhaltbarkeit nach Pongratz 1984.
- Axiom, mehrdeutiger Begriff.
- Axiom der Einheitlichkeit der Natur Burt 1940, p. 221
- Axiome in der Psychologie > Monographie von Schultz 1897, 1899.
- Axiom oder Prinzip der Einfachheit Burt 1940, p.240
- Axiom universeller Kausalität Burt 1940, p. 31, 220
- Entscheidungsforschuung Huber 1972.
- Choice axiom Luce 1959 nach Wottawa 1979, S. 61.
- Gemeinsamer Factor = gemeinsame Ursache nach dem Axiom universeller Kausalität Burt 1940, p. 31
- Euklids erstes Axiom nach Burt 1940, p. 46
- Kardinalaxiom der empirischen Psychologie : alles, was messbar ist, hat notwendigerweise die Natur einer Relation Burt 1940, p. 237.1
- Klassische Testtheorie > Krantz, Helger, T. 1981,
- Kommunikationsaxiome Watzlawick 1967, 1969,
- Messen Eine empirische Messung liegt nach neuerer messtheoretische Aufassung vor wenn es eine homomorphe Abbildung eines empirischen Relativs in ein numerisches Relativ gibt. Orth 1974, S. 18. Der Beweis hierfür wird dem Repräsentationsproblem zugeordnet. Ob man nicht besser von Definition oder einem Messmodell spricht, mag hier offen bleiben
- Multiplikationsaxiom Burt 1940, p.51
- Nationalökonomie, so Vahinger 1911, S. 344, 345, 355.1., 355.2 (Kritik durch Mill),
- Parallelenaxiom (Euklid); Durch einen Punkt außerhalb einer gegebenen Geraden gibt es genau eine Gerade, die parallel zu der gegebenen ist.
- Postulat, Gleichsetzung mit Axiom, z.B. von der APA (update 2018).
- Physik > Wundt 1866, Wertheimer 1945.
- Psychologie der Axiome > Julius Schultz 1897, 1899.
- Psychophysische Axiome, Psychophysik > G.E. Müller 1896f, F.A. Müller 1882,
- sensualistisches Axiom Von Pongratz 1984 Wundt zugeordnet.
- Summen-Score-Axiom: Sind die zwei kleinsten Items einer Reihe größer als das größte Item dieser Reihe, gibt es eine Basis für die SummenScore-Funktion. Rührig 1982/83.
- Trägheitsaxiom Vaihinger 1911, S.34 "Galileisches Trägheitsaxiom".
- Verhalten Hull 1943,
- Wahres Selbst Wandelt 2021: "Wie Illouz schreibt, ist die Idee des wahren Selbst eines der zentralen Axiome der Psychologie".
- Wahrscheinlichkeitsaxiome > Kolmogoroff 1933.
Zitierstile
Sie wurden nur gelegentlich näher untersucht, wenn Unklarheiten aufgetreten sind, z.B. bei Max Wertheimer.
Checkliste Axiome (allgemein) * Checkliste Axiome in der Psychologie *
Checkliste definieren * Definitionsregister Psychologie * Checkliste definieren in der Psychologie *
Checkliste-Beweisen * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen [Stand 27.03.2023, 18:21 Uhr] * Beweissuchwortkürzel. * Hauptunterscheidungskriterien mit Kürzeln (In Entwicklung und Erprobung) siehe bitte Beweissignierungssystem.
Signierungen und Signierungssystem.
_
Literatur (Auswahl) > Text; LiLi.
- Avenarius, Richard (1888) Kritik der einen Erfahrung. Erster Band. Leipzig Fues (Reisland).
- Block, Ned (1978) TROUBLES WITH FUNCTIONALISM. In (261-326) Savage, C. Wade (1978, ed.).
- Bröder, Arndt (2015) Entscheidungstheorien. In (Ebook PDF-Seiten 108-112) Galliker & Wolfradt (2015, Hrsg.). 7 Fundstellen "axiom".
- Breuer, F. (1991). Wissenschaftstheorie für Psychologen: eine Einführung. (Arbeiten zur sozialwissenschaftlichen Psychologie, Beih. 1). Münster: Aschendorff. [Link] .
- Bühler, Karl (1933) „Über die Axiome der Sprachtheorie“. Kantstudien 38, 1933, S. 73–99.
- Bühler, Karl (1934) Sprachtheorie. Stuttgart: Gustav Fischer.
- Carnap, R. (1930) Bericht über untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik. Erkenntnis 1, 303–307 (1930). https://doi.org/10.1007/BF00208622.
- Carnap, Rudolf (2000) Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik, edited by T. Bonk and J. Mosterin. Dannstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2000
- Diederich, Adele; Orth, Bernhard (1988) Produktsummenmodelle: Axiome und ihre empirische Überprüfung Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie, 1988, 35 (4), 546-558, 6 Literaturang.
- Drösler, Jan (1979) Grundlegung einer mehrdimensionalen metrischen Skalierung. Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie, 1979, 26 (1), 1-36, 31 Literaturang.
- Feger, Hubert (1983, Hrsg.) Messen und Testen. Enzyklopädie der Psychologie B. I, 3. Göttingen u.a. Verl. für Psychologie, Hogrefe. Umfang: XXI, 814 S.
- Fodor, J. A. (1978) COMPUTATION AND REDUCTION. In (229-260) Savage, C. Wade (1978, ed.).
- Galliker, Mark & Wolfradt, Uwe (2015, Hrsg.) Kompendium psychologischer Theorien. Frankfurt: Suhrkamp.
- Galliker, Mark (2016) Ist die Psychologie eine Wissenschaft? Wiesbaden: Springer. 4 Fundstellen "axiom" bezüglich Dilthey, Fries und Mill, aber keine Positionen der neueren Psychologie.
- Groeben, Norbert & Westmeyer, Hans (1991, 2.A.) Kriterien psychologischer Forschung. München: Juventa.
- Herzog, Walter (2012) Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie. Wiesbaden: Springer VS.
- Herzog, Walter (2015) Psychologik. In (Ebook PD-Seiten 415-418) Galliker & Wolfradt (2015, Hrsg.).
- Huber, Oswald.(1972) Axiomatische Präferenzlogik in der psychologischen Entscheidungsforschung. Ein Beitrag zur Theorie der sicheren mehrdimensionalen Wahlen. Salzburg: Universität, Philosophische Fakultät, 1972, 192 Seiten Schreibmaschinenfassung, 101 Literaturang.
- Hull, Clark L. (1943) Principles of Behavior. An Introduction of Behavior Theory. New York: Appleton-Century-Crofts, Inc.
- Irtel, Hans (1985) Die Prüfung der Additivität binokularer Farbenmischungen. Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie, 1985, 32 (4), 588-602, 18 Literaturang.
- Jeversches-Wochenblatt vom 14.11.1939.
- Leung, Kwok; Bond, Michael Harris; Reimel de Carrasquel, Sharon; Muños, Carlos; Hernández, Marisela; Murakami, Fumio; Yamaguchi, Susumu; Bierbrauer, Günter; Singelis, Theodore M. (2002) Social axioms. The search for universal dimensions of general beliefs about how the world functions. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2002, 33 (3), 286-302, 48 Literaturang.
- Külpe, Oswald (1921) Ästhetik.Leipzig: Hirzel.
- Lewin, Kurt (1931) Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Biologie und Psychologie. Erkenntnis Bd.1, 421-466.
- Lewin, Kurt (1936) Principles of topological psychology. New York 1936. Deutsch: Grundzüge der topologischen psychologie. Bern 1969.
- McDougall, William (1913) Body and Mind. Second Edition. London: Methuen & Co.
- Müller, G. E. (1904) DIE GESICHTSPUNKTE UND DIE TATSACHEN DER PSYCHOPHYSISCHEN METHODIK. Wiesbaden: Bergmann. Fundstellen: beweis 19, axiom 0, postulat 0, annahme 59.
- Münsterberg, Hugo (1904) Amerikaner. Berlin: Mittler
- Orth, Bernhard (1974) Einführung in die Theorie des Messens. Kohlhammer Standards Psychologie. Sturrgart: Kohlhammer.
- Reusser, Kurt (1984) PROBLEMLÖSEN IN WISSENSTHEORETISCHER SICHT. Dissertation Bern.
- Röhner, Jessica; Ed.: Schütz, Astrid.(2021, Hrsg.) Essenzen - Im Gespräch mit Paul Watzlawick. Bern: Hogrefe. [Link]
- Savage, C. Wade (1978, ed.) Perception and Cognition Issues in the Foundations of Psychology Minnesota Studies in the PHILOSOPHY OF SCIENCE HERBERT FEIGL AND GROVER MAXWELL, GENERAL EDITORS VOLUME IX. University of Minnesota Press.
- Schiller, Paul von (1948) Aufgabe der Psychologie. Eine Geschichte ihrer Probleme. Wien: Springer. 11 Fundstellen "axiom"
- Schultz, Julius (1899) Psychologie der Axiome. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht. [232 Seiten]
- Schultz, Julius (1897) Bemerkungen zur Psychologie der Axiome. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht. [30
- Stumpf, Carl; Ed.: Kaiser-el-Safti, Margret; Mitarb.: Wolfradt, Uwe (2011). Erkenntnislehre. Lengerich: Pabst,
- Schwartz, Robert (1978) INFINITE SETS, UNBOUND COMPETENCES, AND MODELS
- Simon, Herbert A. (1978) On the Forms of Mental Representation. In (3-18) Savage, C. Wade (1978, ed.). Zwei Fundstellen "axiom"; bloßer Gebrauch, keine Erläuterung, was ein Axiom sein oder heißen soll:
- Stumpf, Carl. (1939) Erkenntnislehre I. Leipzig: Barth. Fundstellen: Annahme 7, Axiom 75, beweis 30, Ableitung 0, Kausalität 13, Postulat 2, Prinzp 21, Gesetz 107, Regel 25, erleben 12, erlebt 4, Erlebnis 5.
- Stumpf, Carl. (1940). Erkenntnislehre II. Leipzig: Barth. Fundstellen: Annahme 85, Axiom 62, Hypothese 516, beweis 74, Ableitung 12, Kausaliät 510, Postulat 24, Prinzp 162, Gesetz 945, Regel 232, erleben.10 (SR-), erlebt 11, Erlebnis 14.
- Tack, Werner H. (1983) Psychophysische Methoden. In (346-426) Feger (1983, Hrsg.)
- Wandelt, Alina (2021) Algorithmische Gouvernementalität am Beispiel von OKCupid.
- Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H. & Kackson Don D. Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes. W. W. Norton & Company, New York
- Westermann, R.. (1980) Die empirische Überprüfung des Niveaus psychologischer Skalen. Zeitschrift für Psychologie, 1980, 188 (4), 450-468, 30 Literaturang., ISSN: 0044-3409. URL(Zeitschrift).
- Westmeyer, Hans (1973) Kritik der psychologischen Unvernunft. Probleme der Psychologie als Wissenschaft. Stuttgart: Kohlhammer.
- Westmeyer, Hans (1984) Kernkurs: Psychologie eine Wissenschaft? Version C/ Novembver 1984. Studienmaterialien FIM Psychologie Erlangen.
- Wottawa, Heinricht (1979) Grundlagen und Probleme von Dimensionen in der Psychologie. Meisenheim am Glan: Hain.
- Wundt, Wilhelm (1866) Die physikalischen Axiome und ihre Beziehungen zum Causalprinzip. Erlangen: Enke.
- Wundt, Wilhelm (1874) Grundzüge der physiologischen Psychologie. 1. Auflage.
- Wundt, Wilhelm (1896) Ueber naiven und kritischen Realismus, Erster Artikel. Philosophische Studien 12: 307-408.
- Wundt, Wilhelm (1898) Über naiven und kritischen Realismus, Zweiter Artikel.
OF MIND. In (183-200) Savage, C. Wade (1978, ed.). Eine Fundstelle, in der Axiomatisierung nur gebraucht, aber nicht näher erläutert wird:
_
Sachregister und Glossare
Bei Hilgard & Bower, Lerntheorien, kommt "Axiom" im Sachregister und Glossar nicht vor. Auch nicht Annahme, Postulat oder Beweis. Dafür ausführlich Gesetz. Prinzip hat 6 Einträge.
_
Aufgelesen zum Sichten:
"Die APXAI in der griechischen Mathematik 1.". Grundprobleme der Geschichte
der antiken Wissenschaft, Berlin, New York: De Gruyter, 1971, pp. 342-366.
https://doi.org/10.1515/9783110816778.342
Links(Auswahl: beachte)
ChatGPT > Zu Axiomen in der Psychologie.
- https://chat.openai.com/
- https://chatgpt.ch/
- https://talkai.info/de/chat/
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Archimedische Axiom Feger (1983, Hrsg.) EdP B,I,3, S. 158; beschränkt eine Menge auf endlich viele. ChatGPT 1, 2, 3.
__
Auswahlaxiom Feger (1983, Hrsg.) EdP B,I,3, S. 17, 26, 294 f, 370 f.; ChatGPT;
__
Bisymmetrie-Axiom Tack 1983, S.388-393, überschreibt seinen Abschnitt mit "Mittenbildung"; er verwendet den Ausdruck Axiom nicht, spricht stattdessen von einer "Bedingung".
__
Englische Ausgabe (1938)
Die Ausgabe im Internetarchive enthält keine Jahreszahl des Erscheinens, auch keine ISBN, woran man das ermitteln könnte. Auch in der deutschen Übersetzung findet sich keine Hinweis auf das Jahr der ersten Ausgabe. Ich fragte daher ChatGPT am 27.12.2024: Das Buch von Einstein/Infeld The Evolution of Physics enthält keine Angabe, wann es (zum ersten Mal) erschienen ist. Das ist sehr ungewöhnlich.
"Das Buch "The Evolution of Physics" von Albert Einstein und Leopold Infeld wurde zum ersten Mal 1938 veröffentlicht. Dass in manchen Ausgaben oder Nachdrucken das genaue Erscheinungsjahr fehlt, könnte daran liegen, dass Verlage oft ältere Bücher neu auflegen, ohne die ursprünglichen bibliografischen Details vollständig anzugeben.
Falls in Ihrer Ausgabe keine Jahresangabe zu finden ist, könnte dies auch mit einem besonderen Nachdruck oder einer speziellen Edition zusammenhängen. In solchen Fällen empfiehlt sich ein Blick in das Vorwort oder die ersten Seiten des Buches, da dort manchmal Hinweise auf die ursprüngliche Veröffentlichung versteckt sind.
Alternativ könnten Sie die genaue Ausgabe über die ISBN-Nummer oder andere Merkmale nachrecherchieren, um mehr über die Herkunft und das Veröffentlichungsjahr Ihrer Kopie herauszufinden."
__
Fraktionierung und Vervielfachung Tack 1983, S. 393-393.
__
Lösbarkeits-Axiom Feger (1983, Hrsg.) EdP B,I,3, S. 157 ff. Hierzu Orth S. 157: "Bei Meßstrukturen, die zu Intervallskalenniveau führen, reicht die Annahme der Endlichkeit jedoch nicht aus. Es müßte zusätzlich ein sehr strenges strukturelles Axiom eingeführt werden, das empirisch kaum erfüllt sein wird, wie z.B. die Bedingung, daß alle Reize (Elemente von A) eine gleichabständige Sequenz bilden. Deshalb wird meist die Annahme der Endlichkeit von A aufgegeben. Als strukturelle Bedingung wird dann häufig ein Lösbarkeitsaxiom verwendet; ein solches Axiom besagt, daß bestimmte „Gleichungen“ oder „Ungleichungen“ (im empirischen Bereich) lösbar sind. Für eine algebraische Differenzen-Struktur kann das folgende Lösbarkeitsaxiom benutzt werden: Wenn ab >= cd
>= aa, dann existieren Elemente d1, d2 e A, so daß ad1 ~ cd ~ d2b gilt (für alle a, b, c, d e A). Es wird also gefordert, daß die Menge A so „dicht“ ist, daß es in ihr Elemente d1 und d2 gibt, die Lösungen der „Gleichungen“ ad1 ~ cd und cd ~ d2b sind (sofern ab >= cd >= aa). Lösbarkeitsaxiome sind empirisch nicht direkt prüfbar, da empirisch nicht gezeigt werden kann, daß bestimmte Elemente nicht existieren (siehe hierzu auch Abschnitt 4)."
__
Wesentlichkeits-Axiom bei Meßstrukruen Feger (1983, Hrsg.) EdP B,I,3, S. 162f. Es besagt nach Orth: Komponenten müssen die abhängige Variable tatsächlich beeinflussen.
__
_
Standort: Axiomregister Psychologie.
*
Standort: Axiomregister Psychologie * Haupt- und Verteilerseite Axiome in der Psychologie * Checkliste Axiome. * ChatGPT zu Axiomen in der Psychologie. *
Methoder der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Checkliste-Beweisen. Beweisregister Psychologie * Fundstelleninformationen * Beweis und beweisen in der Psychologie * natcode Register * Übersicht Beweisseiten * ist-Bedeutungen * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Definition und definieren: referenzieren * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhöfe * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse * Hauptbedeutungen Erleben * »«
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Axiomregister Psychologie. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/AxiomRegister/AxiomRegister.htm
*
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeit et und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert:
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
19.05.2025 Münsterberg 1989b.
10.01.2025 Gigerenzer 1981; Stevens 1951; Stegmüller 1983, Sixtl 1996.
08.01.2025 Enzyklopädie der Psychologie Messen und Testen (1983) * Piaget 1980 *
07.01.2025 Gottlob Friedrich Lipps 1899, 1909 (Grundriß Psychophysik). * Carnap 2000 kritisch kommentiert.
03.01.2025 Auswertung Bühler 1933.
02.01.2025 Bühler, Piaget.
31.12.2024 Fahrenberg 2013, 2015.
28.12.2024 Grundversion abgeschlossen.
19.11.2024 angelegt. .
"annahme", annehm , angenom ; "axiom" 0; basis 112; "begriff" 145, grundbegriff ; "beweis" 33, bewies ; "Gesetz" angesetzt, umgesetzt, vorgesetzt, ; "method" ; "postul" postulat, postuliert, ; "Prinzip" ; "Regel" ; "Satz" , ansatz , aufsatz , Datensatz , einsatz , ersatz , gegensatz , Grundsatz ; "theor" ; voraus ; "wissen" ;