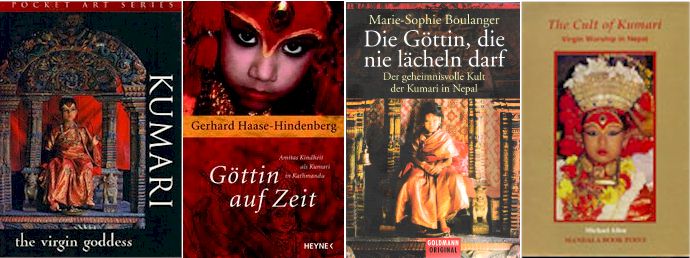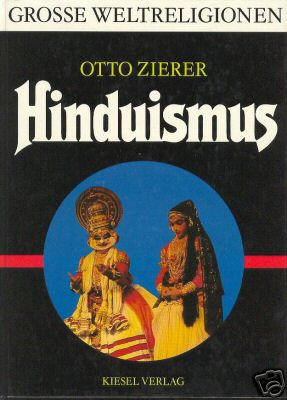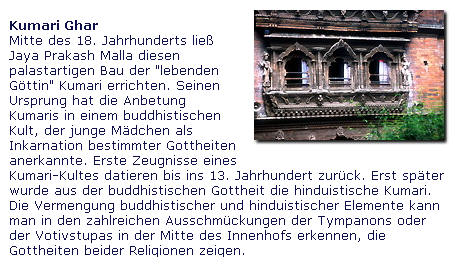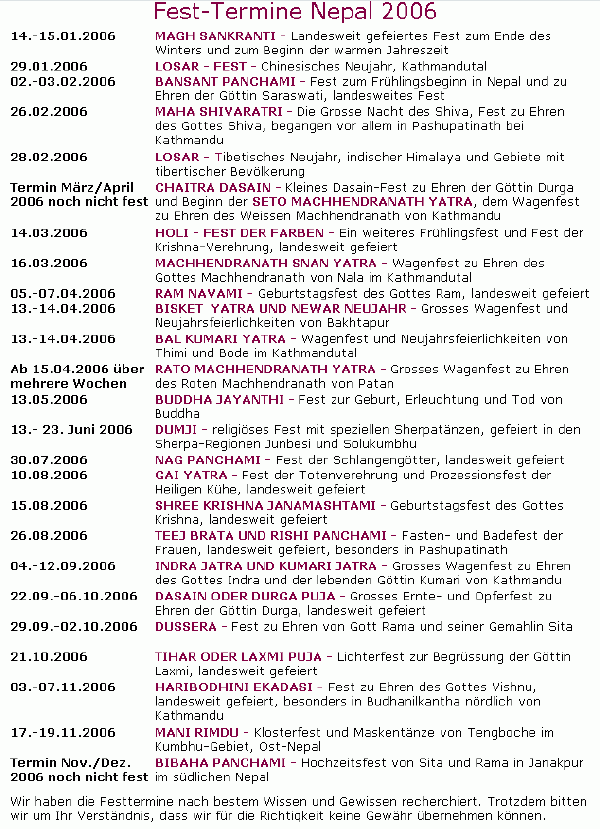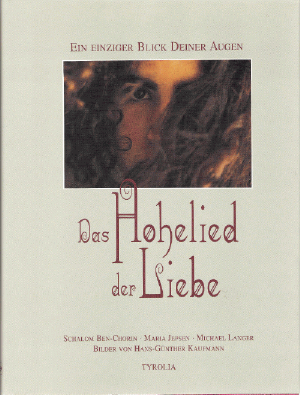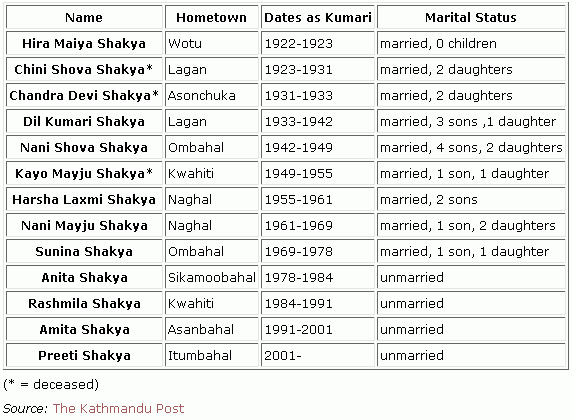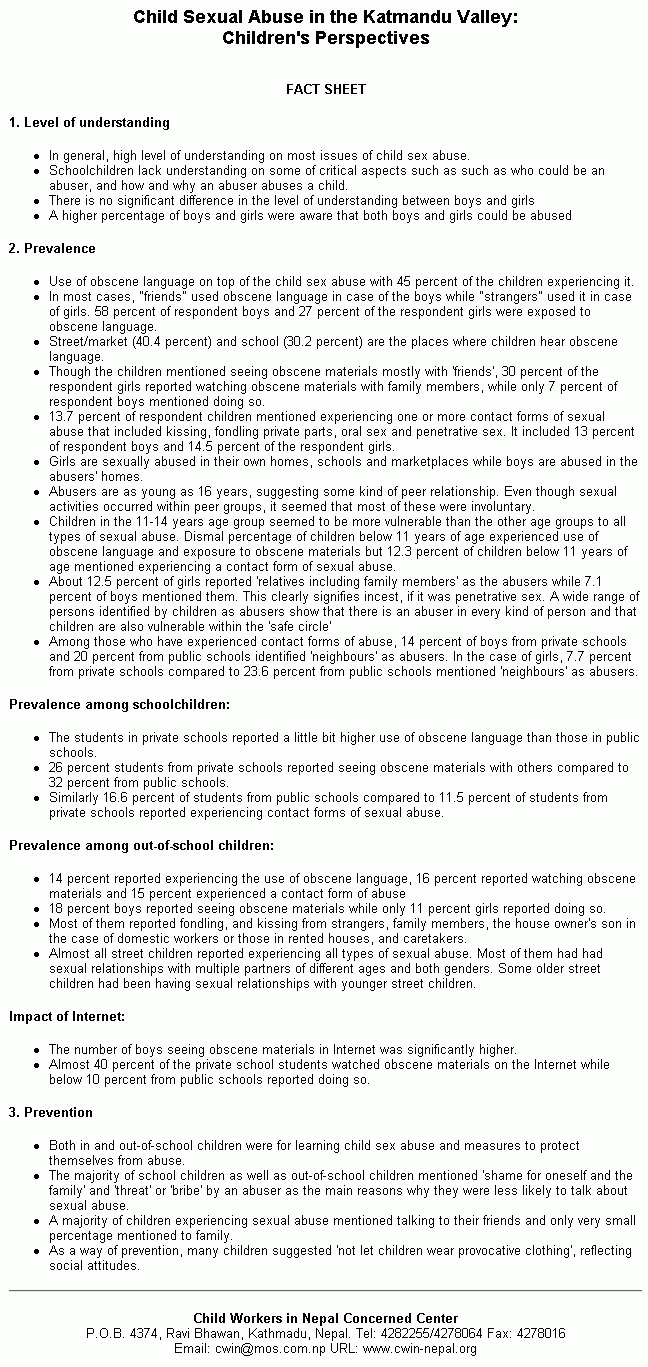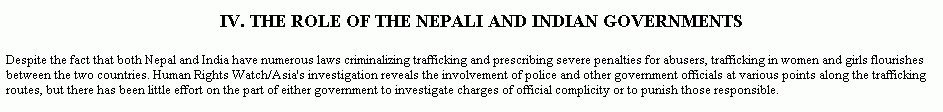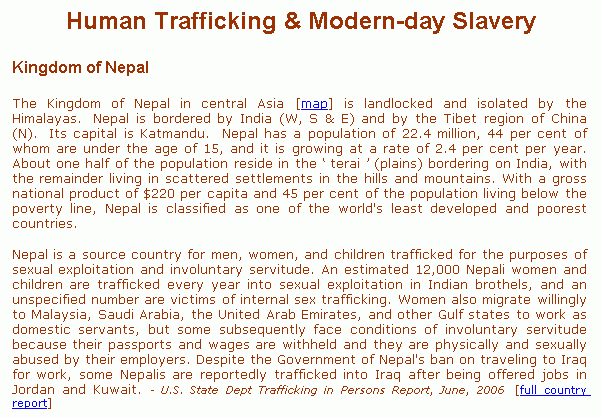Einführung:
Kindesmissbrauch
zu religiös-politischen Zwecken ?
Vorbemerkung: Die folgenden Ausführungen
beruhen im wesentlichen auf den Informationen durch die beiden Bücher
von Marie-Sophie Boulanger
(dt. 2004), mit B abgekürzt und Gerhard Haase-Hindenberg
(2006), im folgenden bei Zitaten mit HH abgekürzt. In geringem Umfang
wird die Dissertation Merz
herangezogen [siehe Zur
Auswahl], mehr noch einige Internetseiten. [besonders
Religionsgeschichte
Nepals * Kumari (en.Wikipedia)].
Alle mir bekannten und nützlich erscheinenden Quellen werden dokumentiert,
so dass sich jede ein eigenes Bild machen und selbst recherchieren kann.
Die Berichte sind in ihrer faktischen und psychologischen Bedeutung und
trotz ihres dokumentarischen Wertes mit einer gewissen Vorsicht zu lesen,
weil sie natürlich durch die subjektiven Filter der AutorInnen und
der mit ihnen verbundenen anderen Kulturen, aber auch durch die Filter
der Lektorate und Marketingabteilungen gegangen sind. Bei den Mitteilungen
der Details und ihrer Bedeutung und Stellung im Lebensverlauf sollte man
daher eine gewisse Vorsicht walten lassen. Und das gilt natürlich
auch für meine eigenen Ausführungen. Teilweise fehlen auch wichtige
Informationen, wie meist, wenn es um problematische und tabuisierte
Themen geht und religiöse-politische Interessen im Spiel sind [mehr
dazu hier].
Das Problem: Wenn ein dreijähriges
Kind aus seiner Familie herausgerissen und mir nichts dir nichts zur Kindgöttin
erklärt wird, dann muss die Frage gestellt werden, ob hier nicht ein
anachronistischer Kindesmissbrauch zu religiösen Zwecken betrieben
wird, der eigentlich die Sozialwissenschaftlichen
Fakultäten in Nepal und die Unicef/UN
auf den Plan rufen sollte. Das Phänomen der Göttin auf Zeit
in Nepal ist nicht nur ein äußerst fragwürdiges menschliches,
sondern auch ein extrem entwicklungspsychologisches Kulturexperiment mit
einer jahrhundertealten Tradition und damit eine Herausforderung für
das Konzept Kindeswohl und
Bindungstheorie,
wobei natürlich berücksichtigt werden muss, dass Nepal einem
anderen Kulturkreis angehört [Frauen,
Kinder und Religionen in Nepal; Unicef
zur Lage der Mädchen in Nepal; illegale
Kinderarbeit]. Die moderne ausschließlich im westlichen Kulturkreis
entwickelte Bindungstheorie
kann viele Phänomene der Realität nicht nur nicht erklären;
mit vielen steht sie in direktem Widerspruch [Bindungspathologie
kurz und bündig]. Diese Phänomene nenne ich Bindungsparadoxa.
In der Göttin auf Zeit steckt möglicherweise auch
ein solches paradoxes Phänomen, das mit der Bindungstheorie in Widerspruch
steht oder nicht durch sie erklärt werden kann (z.B.).
Durch die relativ einmalige Arbeit der AutorInnen zur Kumari, der Kindgöttin
auf Zeit, ist nun erstmals ein genauere Betrachtung dieses Phänomens
möglich. Wenn Nepal schon auf Kindgöttinnen aus kulturell religiöser
Tradition nicht verzichten kann und will - immerhin wurde die Kumari sogar
von
den
Kommunisten begrüßt, was ihre
starke Verwurzelung im Volk deutlich macht, so sollte doch zumindest für
eine kindangemessenere Einführung, Begleitung, Umgang mit den Angehörigen
und für eine entsprechende Rückführung gesorgt werden. Im
Falle Amita (1991-2001) scheint sich hier auch einiges durch den besonderen
Einsatz ihres Vaters in die wünschenswerte Richtung zu bewegen.
Gegenthese: In der englischsprachigen
Wikipedia wird eine Zusammenstellung
aus The Kathmandu Post zitiert, die einige negative Mythen widerlegen
soll, z.B. den populären Aberglauben, dass ein Mann, der eine Kumari
heiratet, verloren ist und innerhalb von sechs Monaten stirbt, indem er
Blut aushustet. In Wirklichkeit scheint es jedoch, dass die meisten Kumaris
schließlich keine Schwierigkeiten hatten, Männer zu finden.
Alle lebenden ehemaligen Kumaris mit der Ausnahme der jüngsten haben
sich verheiratet.
Ergänzende Anmerkung:
Die frühe Auswahl im Kleinkindalter zum religiösen Führer
scheint eine buddhistische Tradition zu sein, wie das Beispiel
Dalai
Lama nahelegt.
Inhaltsverzeichnisse
und Gliederungen:
Die beiden deutschen Bücher sind aus entwicklungspsychologischer
und bindungstheoretische Sicht nicht so ideal gegliedert, sondern wie folgt:
|
Inhalt Boulanger (Anita 1979-1986, Rashmila 1986-1991)
Prolog: Das Kind vom Kumari Chowk 11
Erster Teil: Die kleine Königsmacherin
Kathmandu 21
Der Festwagen der Kindgöttin 33
Die verbotene Tür 52
Zweiter Teil: Durgas Zeichen
Die hochnäsige Prinzessin von Patan 73
Die Lumpengöttin von Bungamati 85
Die kleine Fee von Bhaktapur 98
Dritter Teil: Die Schwarze Göttin
Die Besessenen von Patan 115
Dhana 128
Talejus Nacht 142
Vierter Teil: Die Kind-Shakti
Die abgesetzte Göttin 159
Rashmilas Schweigen 176
Diwali 195
Epilog 207
Schlussbemerkung zur deutschen Ausgabe 211
Danksagung 213
Anhang
Die 32 Schönheitsmerkmale
oder battislaksana 215
Glossar 217
Bibliographie 221
Bildnachweis 223 |
Inhalt Haase-Hindenberg (Amita 1991-2001):
PROLOG: RECHERCHE MIT ÜBERRASCHUNGEN 9
RASMILAS LETZTES FEST 17
DIE AUSWAHL 29
EXPERTEN DES KÖNIGS 35
VOM MÄDCHEN ZUR GÖTTIN 49
TRAUM UND WIRKLICHKEIT 75
EINE GÖTTIN IN DER LEHRE 91
DIE STUMME TOCHTER 105
KUMARI - SUPERSTAR 127
DIE KRANKE MÄDCHENGÖTTIN 161
KALA RATRI - DIE »SCHWARZE NACHT« 167
ANDERE WELTEN 175
DAS SCHWERT DES MANJU SHREE 183
BRIEF AN DEN KÖNIG 193
DIE LEHRERIN 209
DIE FREMDE 225
STREIT UMS GELD 255
MASSAKER IM KÖNIGSPALAST 265
DER UNGELIEBTE THRONFOLGER 287
EIN LANGER ABSCHIED 299
ERSTE SCHRITTE IN EIN NEUES LEBEN 325
RÜCKKEHR IN EINE FREMDE WELT 337
DIE BRAUT DES SURYA BHAGAWAN 351
DIE ZEIT DANACH 373
ANHANG
GLOSSAR 399
DANKSAGUNG 413
BILDNACHWEIS 415
|
Zu den Bilddokumentationen
Da es sich um eine fremde Kultur handelt, sind die Bilddokumentationen
[Boulanger, Haase-Hindenberg]
sehr hilfreich, um eine bessere Anschauung und Vorstellung zu erhalten.
Dies wird im Zeitalter des Internets aber auch sehr erleichtert, weil man
doch relativ schnell und einfach auch Bildinformationen erhalten kann (Links
Kumari).
Erste Näherungen
Basis-Information
[Verlags-Info HH]:
"Eine Kindheit hinter Tempelmauern: die wahre Geschichte
einer lebenden Göttin
"Seit Jahrhunderten wird in einem Palast in Kathmandu jeweils ein kleines
Mädchen als Jungfrauengöttin Kumari verehrt. Sie lebt getrennt
von ihrer Familie und der Außenwelt, ihr Tagesablauf ist bestimmt
von religiösen Ritualen. Doch mit dem Ende ihrer Kindheit endet auch
ihre göttliche Existenz, und die Kumari muss in ein Leben zurückkehren,
auf das sie niemand vorbereitet hat. – Amita Shakyas Geschichte erlaubt
erstmals den Blick in einen exotischen Kosmos, zu dem der Westen bislang
keinen Zugang hatte.
Am Tag vor ihrem dritten Geburtstag wird Amita auf
den Thron der Kumari gesetzt und in einem geheimen religiösen Ritual
zur einzigen lebenden Göttin der Welt geweiht. Denn der Hofastrologe
hat in ihr die Wiedergeburt Talejus, der Schutzgöttin Nepals, erkannt.
Für Amita beginnt ein Leben hinter Tempelmauern. Vom ganzen Volk verehrt,
wird sie an hohen Feiertagen in prunkvollen Prozessionen durch die Stadt
gefahren, sogar der König lässt sich von ihr segnen. Die Alltagserfahrungen
normaler Kinder aber bleiben Amita verwehrt. Niemand hatte ihr gesagt,
dass eine Kumari mit Eintreten der Pubertät abgelöst und zu ihrer
Familie zurückgeschickt wird. Und niemand wusste, dass am Ende von
Amitas Göttinnenexistenz eine Tragödie stehen würde – das
Massaker im Königspalast, bei dem der Regent und dessen gesamte Familie
ermordet werden. Hatte die Kumari ihnen den Schutz entzogen? Zum ersten
Mal erzählt eine ehemalige Mädchengöttin ihre Geschichte:
Der Publizist Gerhard Haase-Hindenberg hat mit Amita Shakya wochenlang
intensive Gespräche geführt und ihre Familie, die Priesterschaft
und andere ehemalige Kumaris befragt. Mit bemerkenswertem Einfühlungsvermögen
versetzt er die Leser in die Psyche eines kleinen nepalesischen Mädchens
und berichtet von geheimen religiösen Riten, einer außergewöhnlichen
Kindheit und dem schwierigen Weg zurück in die Realität."
Aus der ZDF-Präsentation
zu HH (2.3.6): "Offiziell ist Nepal zwar ein hinduistischer Staat, aber
die Kumari muss aus der buddhistischen Shakya-Kaste
kommen. Sie darf am ganzen Körper keine Narbe ausweisen. Ein religiöses
Komitee bestimmt die Kumari-Kandidatin im zarten Alter von vier Jahren.
Das auserwählte Mädchen wird dann aus der Familie geholt, um
den Rest seiner Kindheit im Kumari-Tempel verehrt zu werden. Gerhard Haase-Hindenberg
ermöglicht in seinem Buch einen Blick in die geheimnisvolle Welt der
Kumari."
Matriarchat.Net: "Pressebericht
vom 10.07.2001 22:18 MEZ .
Mädchen in Nepal zur Göttin Kumari erhoben. Gilt als Wiedergeburt
der Göttin der Stärke. [Bild: Die letzte Kumari (re.) mit
SpielgefährtIn], berichtet zur Inthronisation der Nachfolgerin von
Amita, über die HH's Buch hauptsächlich handelt.
"Kathmandu - In Nepal ist am Dienstag (10. Juli
2001) ein vierjähriges Mädchen zur lebenden Göttin Kumari
erhoben worden. Das Kind sei entsprechend der Tradition und mit vedischen
Riten als Göttin eingesetzt worden, sagte der oberste Priester am
nepalesischen Königspalast, Ramesh Prasad Pandey. Kumari gilt den
Gläubigen im hinduistischen Königreich Nepal als Wiedergeburt
der Göttin der Stärke, Taleju Bhavani. In der vergangenen Woche
war die bisherige Kumari aus dem Amt ausgeschieden, weil sie die Pubertät
erreicht hatte. Aufgabe der Kumari ist es, die vor ihrem Tempel in der
Hauptstadt Kathmandu versammelten Gläubigen mehrmals täglich
zu segnen. Bei unglücklicher Kumari wird Naturkatastrophe erwartet.
Bei dieser Gelegenheit trägt die lebende Göttin ein prächtiges
goldenes Gewand und ihre Stirn ziert ein aufgemaltes drittes Auge. An Festtagen
wird sie in einer Sänfte durch die Stadt getragen. "Viele erwarten
eine Naturkatastrophe, wenn die Kumari nicht glücklich ist", sagte
der Künstler Milan Shakya zur Bedeutung der Göttin. Die Kumari
wird traditionell in der Familie Shakya nach einer geheimen und strengen
Prozedur ausgewählt. Der Name der neuen Kumari ist Reshmila Shakya.
Auch nach ihrer Amtszeit erhalten die lebenden Göttinnen eine bescheidene
staatliche Rente. Ehemalige Göttinnen verbringen ihr Leben in aller
Regel ehelos. Gläubige Männer scheuen sich, sie zur Frau zu nehmen.
(Reuters) [Bild: Karte] Die Newar in Nepal haben es geschafft, ihren Frauen
das schreckliche Schicksal der Hindu-Ehefrauen zu ersparen. Denn diese
sind in Indien nur die untergeordneten Dienerinnen ihres Gatten, den sie
als Gott zu betrachten haben; sie sind die Sklavinnen ihrer Schwiegermutter,
für die sie alle schweren Arbeiten verrichten müssen, ihre Ehe
ist unauflösbar, und noch bis vor kurzem wurden sie beim Tod des Gatten
der Hexerei verdächtigt und mit seinem Leichnam verbrannt - nur so
konnten sie sich vom Verdacht des Übelwollens gegen ihn befreien.
In Nepal hingegen wurden alle Mädchen mit sechs Jahren symbolisch
mit einem Gott vermählt; dadurch blieben sie ihr Leben lang die Gattinnen
des Gottes und konnten nicht verbrannt werden, wenn ihr irdischer Mann
starb. Nepal kennt keine Witwen. Die irdische Ehe kann von beiden Seiten
gelöst werden."
Grundinformation Nepal: Siehe
bitte Nepal-Links.
Über die frühere Geschichte
vor 1768 scheint es wenig Material zu geben [1].
Überblick Geschichte [Quelle Auswärtiges
Amt]

Anmerkung: Leider hängt das Auswärtige Amt mit
ihren Informationen immer
zurück; zur neueren Entewicklung siehe bitte aktuelle
Presse und evtl. Wikipedia.
Umbruchzeit in Nepal
Die beiden Bücher behandeln hauptsächlich die beiden Kumaris
Rashmila (1986-1991) und Amita (1991-2001). Zum weltpolitischen Rahmen
und zum nationalen Hintergrund schreiben die beiden AutorInnen:
»Die KP Nepals
grüßt die Kumari.« (HH, S. 50f, fett RS)
"In diesem Jahr, welches nach dem nepalesischen Kalender das Jahr 2048,
nach dem newarischen 1111 und nach dem. gregorianischen 1991 ist, findet
Navami (am Ende des nepalesischen Monats Ashwin) Mitte Oktober statt. Seit
dem letzten Dashain-Fest hat es in der ganzen Welt große politische
Veränderungen gegeben. Im Osten Europas sind die kommunistischen Regime
zusammengebrochen, die beiden deutschen Staaten haben sich nach vier Jahrzehnten
der Trennung wieder vereinigt, in Südafrika geht die Apartheid ihrem
Ende entgegen, und in Israel denkt ein ehemaliger General laut über
Friedensverhandlungen mit den Palästinensern nach. Auch der kleine
Himalaja-Staat Nepal hat seither einige innenpolitische Veränderungen
erlebt. Noch im Frühjahr des letzten Jahres hatte die königstreue
Regierung die absolute Monarchie gegen friedliche Demonstranten mit Gewehrfeuer,
Tränengas und Massenverhaftungen verteidigt. Der Protest aber nahm
immer breitere Formen an, sodass sich der König schließlich
im April 1990 über den Rundfunk an sein Volk wandte, die Aufhebung
des Parteienverbots ankündigte und für das kommende Frühjahr
freie Wahlen versprach. Im Mai siegte dann die Kongresspartei landesweit
mit absoluter Mehrheit und stellt seither den Ministerpräsidenten.
[<50]
Dennoch schlagen die Uhren in diesem Jahr 1991 in
Nepal anders als in anderen Teilen der Welt, denn jeder dritte der frei
gewählten Abgeordneten gehört der Kommunistischen Partei an.
Wenngleich auch sie auf die religiösen Traditionen ihres Landes
Rücksicht nehmen müssen und am vergangenen Indra-Jatra-Fest ein
Transparent vor die Parteizentrale aufgehängt hatten, mit der Parole:
»Die
KP Nepals grüßt die Kumari.« Und so sitzt am Durbar-Platz
[1,2,],
allem politischen Wandel zum Trotz, ein kleines Mädchen auf dem Thron
der lebenden Göttin, auch wenn es in dieser Nacht selbst hier eine
personelle Veränderung geben wird."
»Und wie habt ihr
euren König getötet?« (B, S. 12f, fett von RS)
"Gleich bei der Ankunft löste Kathmandu einen unbeschreiblichen
Zauber in mir aus. Ich war hingerissen: Die Nepalesen waren freundlich
und fröhlich, die Landschaften atemberaubend, die mit Holzschnitzereien
verzierten Häuser glichen dem Theaterdekor eines mittelalterlichen
Stücks. Dies war das Paradies.
Dabei herrschte im April 1991 in Nepal eine wirkliche
Revolution, von der wir unserem Wunsch zum Trotz, an die tröstliche
Unveränderlichkeit dieses Landes aus einer anderen Zeit zu glauben,
durchaus etwas mitbekamen. Eine dumpfe Spannung schien an dem zerbrechlichen
und friedlichen Gefüge des kleinen Hindu-Königreichs im Himalaja
zu nagen. Innerhalb weniger Monate hatte Nepal mehreren Jahrhunderten absoluter
Monarchie den Rücken gekehrt und sich mit Inbrunst in den ersten Wahlkampf
seiner Geschichte gestürzt. Kaum war das Land aus seiner jahrhundertelangen
Isolation herausgetreten, war man sich schlagartig der fast mittelalterlichen
Strukturen bewusst geworden und wollte die verlorene Zeit aufholen. Zu
diesem Zweck pries die dortige kommunistische Partei eine radikale Methode:
die historische Kurzfassung des Modells der im Himalaja aus welchen Gründen
auch immer sehr berühmten Französischen Revolution. In ganz Kathmandu
waren riesige Karikaturen plakatiert, die einzig [<12] wirksame Propaganda
in einem Land mit einer der weltweit höchsten Analphabetenraten. Eine
davon sah einer Karikatur, über die sich ganz Paris während der
Generalstände 1789 amüsiert hatte, zum Verwechseln ähnlich.
Darauf war ein nepalesischer Bauer dargestellt, der gebückt unter
der dreifachen Last eines fetten Brahmanen, eines aus der hohen Kaste stammenden,
behäbigen Beamten und eines feisten, debil aussehenden Königs
ging. Stärker noch als der Eindruck, mich auf einem anderen Kontinent
zu befinden, war der, in eine andere Zeit zurückversetzt worden zu
sein: Abgesehen vom topi*, der traditionellen Kappe, anhand derer
man den nepalesischen Bauern von seinem Pendant des Ancien Régime
unterscheiden konnte, schien das Bild wie abgepaust aus einem liegen gebliebenen
Geschichtsbuch eines Touristen. Händler, die mitbekommen hatten, dass
wir Franzosen waren, nahmen uns beiseite und fragten: »Und wie
habt ihr euren König getötet?« Ich fiel aus allen Wolken:
War denn der König in Nepal nicht die unangefochtene Inkarnation des
Gottes Vishnu*? Und die braven angehenden Rebellen nickten allesamt mit
ihren Kappen: Natürlich war der König der allmächtige Gott
in Person - weswegen man trotzdem darüber nachdenken konnte ...
In jenen Tagen, glaube ich, erkannte ich zum ersten Mal, dass das,
was für den Westen ein offenkundiger Widerspruch, ein grundlegender
Fehler in der Logik war, für den Nepalesen nichts Unversöhnliches
hatte, ganz im Gegenteil."
Anmerkung: mit * gekennzeichnete Worte
werden im Glossar noch einmal besonders erklärt.
Diese Frage bekommt im Nachhinein eine makabre Bedeutung, weil sich
am 1.6.2001 ein Massaker an der könglichen Familie ereignete. Hierauf
wird weiter unten
noch näher eingegangen.
Religionsgeschichte
Nepals
Die Religionsgeschichte Nepals ist nicht einfach zu verstehen, weil
hier sowohl hinduistische als auch buddhistische
Lehren ineinander übergehen und in einer eigenen nepalesischen Form
verschmelzen [Überblick
über die Religionen Nepals]. Hervorzuheben ist, dass den Nepalesen
eine grosse Leistung in religiöser Toleranz gelungen ist. Es dürfte
in der Weltgeschichte der Religionen nicht oft vorkommen, dass ganz unterschiedliche
religiöse und lebensphilosophische Systeme wie hier z.B. Buddhismus
und Hinduismus über Jahrhunderte und Jahrtausende eine solch friedliche
Entwicklung nehmen und konstruktiv miteinander verschmelzen - undenkbar
im auserwählt-fundamentalistisch-militanten
Christentum oder Islam [Hinduismus und Islam].
frühere Geschichte Nepals.
Hier konnte ich in dem Band von Otto Zierer, Die grossen Weltreligionen,
Hinduismus, ein paar wenige, aber doch interessante Informationen finden:
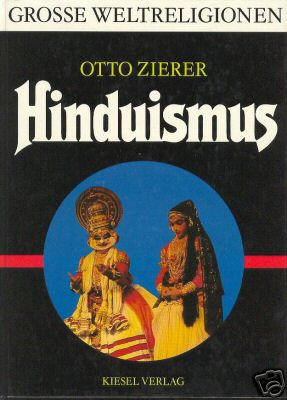 |
Hier wird S. 114f zur Religions-Geschichte
Nepals ausgeführt:
"Ein Beispiel für den ersteren Fall ist Nepal. In
diesem Gebirgsland, das so nahe an Buddhas Heimat und seinen späteren
Wirkungsstätten liegt, hatte sich der Buddhismus durchgesetzt. Noch
im 4. Jahrhundert n. Chr. war Nepal das klassische Land der buddhistischen
Mönche. Von den tibetischen Bergen herab drang seit dem 5. nachchristlichen
Jahrhundert der Lamaismus und die tantrische Form des Buddhismus in Nepal
ein, was dem von großen Göttern und Berggeistern beherrschten,
halbmongolischen Volk sehr entsprach. Trotzdem war die hinduistische Grundhaltung
der Menschen auf die Dauer nicht auszulöschen. Überall vermengten
sich hinduistische und buddhistische Formen, Riten und Anschauungen. Besonders
seit dem 14./15. Jahrhundert vollzog sich ein unablässiger Vorgang
der Einsickerung des Hinduismus in Nepal, so daß die drei Religionen
Buddhismus, Lamaismus und Hinduismus schließlich nebeneinander bestanden,
ohne sich gegenseitig zu beanstanden. Ja, die Kraft und Phantasie des Hinduismus
überflutete sowohl Buddhismus wie Lamaismus so sehr, daß schließlich
die religiösen Vorstellungen, die Riten, Prozessionsfeste, die Gottesdienste
und Tempelbauten überall den Charakter des Hinduismus annahmen. Hinduistische
Feste wurden von tibetischen Lamas ausgerich-[<115]tet; Hindupriester
des Kali-Tempels schmückten diesen mit buddhistischen Opfertischen;
Prozessionen zu Ehren Shivas fanden unter Mitwirkung buddhistischer Mönche
statt. Die Vermischung der Religionen war vollkommen und völlig friedlich."
Diese seit Jahrtausenden friedliche Koexististenz kann
als kulturhistorische Großtat gar nicht genug hervorgehoben werden.
Wie haben sie das gemacht, was können sie besser als die militanten
Christen und Moslems? |
___
Religiös-kultureller
Hintergrund der "Kumari"
| "Vor vierhundert Jahren, so erklärt der Volksglaube die Existenz
der Mädchengöttin, soll sich einer der Herrscher aus der längst
untergegangenen Malla-Dynastie der Göttin Taleju
beim Würfelspiel in eindeutiger Absicht genähert haben. Dieser
Legende nach sei sie darauf erzürnt aufgesprungen und habe beim Verlassen
des Palastes geschworen, künftig nur noch in Gestalt eines jungfräulichen
Wesens aus der Shakya-Kaste zu erscheinen. Jener Kaste, der einst auch
der historische Buddha entstammte. Fortan erscheint die Hausgöttin
des jeweiligen Hindu-Königs immer in der Gestalt eines kleinen buddhistischen
Mädchens. Da aber nach nepalesischer Definition mit dem Beginn der
Pubertät ein Mädchen aufhört, ein jungfräuliches Wesen
zu sein, ist dieses Indra-Jatra-Fest das letzte Fest jener Kumari, die
schon bald wieder ihren Geburtsnamen Rasmila tragen wird. Denn in der 'schwarzen
Nacht' des Dashain-Festes in einem Monat wird die lebende Göttin auf
jenem Thron dort eine andere sein." (HH, S. 19).
Anmerkung: Der Ursprung der Geschichte thematisiert Grenzüberschreitung
und sexuellen Missbrauch. |
Kathmandu
- Kumari Ghar.
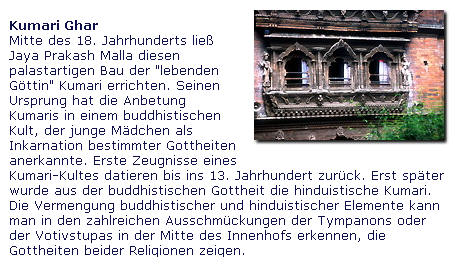
Wie bedeutsam der Kumari-Kult
in Nepal ist - etwa vergleichbar unserem Weih- nachten mit Christi Geburt
(Taleju schlüpft in die Kumari) - kann man u.a. daran ermessen, dass
selbst die Kommunistische Partei Nepals als drittstärkste Kraft zum
Indra-Jatra-Fest ein Transparent mit folgender Parole an der Parteizentrale
aufhängte: "Die KP Nepals grüßt die Kumari" (HH, S. 51) |
Blut und Opferkult in Nepal
| "... Sogar die Royal Air Nepal wird heute auf dem Flughafen
so viele Büffel opfern, wie zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit
ihrer beiden Maschinen, die ebenfalls mit Blut bestrichen werden, nötig
sind. ..." (B, S. 100f) |
Zur angemessenen Beurteilung des Blutkultes und der Blutopfer muss man
berücksichtigen, dass diese Riten sehr stark in den Festen (Pujas)
im Volk verwurzelt sind und sozusagen alle NepalesInnen damit aufwachsen.
Enthauptete Büffel, Ziegen, Widder, Hähne ... und das Begiessen
zu schützender Dinge mit ihrem Blut gehören zum "Alltag" der
Feste wie das Feuerwerk am Silvester bei uns. Die Schutzfunktion des mit
Tier-Blut-Bestreichens ist im Christentum mit den Ritualen des Segnens
(im Krieg natürlich auch der Waffen, damit möglichst viele Feinde
sterben), Weihwasser benetzen oder mit der Verwendung des Symbols des Kreuzes
vergleichbar.
B. S. 98f berichtet ihre Beobachtungen und Eindrücke:
"In einem warmen Strahl ist das Blut hervorgeschossen.
Der Mann besprengt Räder und Seitenteile seines Lasters, indem er
den Hals des Tieres wie einen Wasserschlauch hin und herbewegt. Nur mit
Mühe kann ich meinen Brechreiz unterdrücken. Ein paar Meter weiter
zieht eine andere Ziege, die begriffen hat, welches Schicksal ihr bevorsteht,
vergebens an ihrem Seil. Alle Arbeitsutensilien, von der einfachen Schraubenmutter
bis hin zum Reifen, werden ausgiebig begossen. Rund um das Fahrzeug, das
für den Anlass mit Gottesdarstellungen und Blumengirlanden geschmückt
wurde, werfen sich lachende Kinder bunte Luftballons zu. Ein echtes Fest!
Der Laster hat seine Opfergabe, seine Blutration erhalten: Er wird im kommenden
Jahr nicht das Leben seines Fahrers einfordern. In den Buden ringsum wiederholt
sich die Szenerie. Ein Handwerker bestreicht die Pfosten seiner Werkstatt
mit den Eingeweiden einer Gans, ein Geschäftsmann fährt mit seinem
girlandengeschmückten Motorrad ins Büro.
Seit heute Morgen ist Nepal in ein rotes Bad zu
Ehren von Durga getaucht. Es ist Navami, der neunte Tag des Dassain. Das
blutige Festmahl der Großen Göttin hat begonnen. Im Morgengrauen
habe ich Budhia zur großen Tieropferung im Hof des kot*, der
Kaserne im Palast von Kathmandu, geschleift. Er hat es mir übel genommen,
das weiß ich. »Diese Hindus sind Schlächter«, sagt
er in gedämpftem Ton. Er ist Buddhist, wenn auch kein allzu strenger,
wenn es um Geld, Frauen oder eine gute Flasche Tschang geht. Doch die Opferungen
im Rahmen von Dassain sind ein wiederkehrendes Streitthema unter meinen
hinduistischen Freunden, vor allem bei denen, die aus einer hohen Kaste
stammen und von sich behaupten, sie seien schockiert über diese »archaischen«
Praktiken,
Und doch ist Dassain hier mehr als ein hinduistisches
Volksfest. Ganz Nepal, der Staat selbst feiert den Sieg der Großen
Göttin über den Büffel-Dämon Mahisasura, die Personifikation
der Kräfte des Bösen. Aber Durgas Schutz hat seinen Preis. Davon
bekommt man schon eine Ahnung, wenn man an den provisorischen Altären
vorbeizieht, die ihr zu Ehren in allen Straßen aufgestellt sind:
Das mitleidlose Antlitz, der gebieterische Fuß, der den üblen
Dämonen zertritt, die wirbelnden Arme, die einen Kriegstanz vollführen
und Schwert und Lanze schwingen, wollen nichts als Blut, Blut und nochmals
Blut.
Damit die Massentötung stattfinden kann, werden
seit Tagen Ziegenböcke, Schafe und hunderte anderer Tiere herdenweise
in die Städte Nepals getrieben. ..."
Inthronisation
und die "Schwarze Nacht"
Taleju
reinkarniert in die Kumari
Die Göttin Taleju, die sowohl das Gute als auch das Böse
enthält - also nach christlicher Analogie Gott und den Teufel
in einem vereint - ist die Schutzgöttin der Könige von Nepal,
in der Staatsreligion selbst als Inkarnationen
des Gottes Vishnu angesehen, die in der Schwarzen
Nacht der Inthronisation in die Kumari "schlüpft" (Apotheose).
Bereits hier sieht man die extrem enge Verbindung von politischer Herrschaft,
Königtum und Religion. Die Göttin wird also zu Fleisch, im Christentum
spricht man von Inkarnation (Fleischwerdung - des Göttlichen; allgemeiner
kann man von Verkörperung sprechen) und ist deshalb aus christlicher
Tradition relativ einfach zu verstehen durch die Figur des Christus selbst
und vor allem durch die Kommunion (Abendmahl,
Eucharistie),
die ja ein extrem phantastisches und blutrünstiges Geschehen zum Inhalt
hat, so dass sich hinduistische und christliche Phantasmen grundsätzlich
sehr ähnlich sind - wie auch viele andere sonst in den Religionen
der Welt. Zu allen religiösen Kulten gehört, dass sie mit Geheimnis
und Tabu umgeben und angereichert sind. Dies dient der Macht, dem Nimbus
und Schutz der Priesterschaft. Viele Religionen haben im Laufe ihrer Geschichte
psychopathologische und kriminelle Riten entwickelt. Doch was einerseits
psychopathologisch und kriminell anmutet und strafrechtlich verfolgt wird,
wird zu einer sakralen (heiligen) Handlung, wenn sie von Propheten oder
Priestern im Rahmen eines religiösen Ritus ausgeübt wird. Marie-Sophie
Boulanger stellt daher die Frage,
ob hier nicht sogar sexueller Kindesmissbrauch vorliegt, was nicht völlig
aus der Luft gegriffen wirkt. |
|
Religiös-Metaphysische
Rituale
In fast allen Religionen gibt es das Phänomen, dass Götter
von Menschen Besitz ergreifen (psychopatho- logisch betrachtet einen Wahn
ausbilden, wenn sie es richtig glauben), Götter in Menschengestalt
auftreten oder Menschen zu Göttern werden. Das hatte und hat auch
oft eine politische Herrschaftsfunktion, die nicht selten sehr gefährliche
Formen für den Welt- und Landesfrieden annahm, besonders dann, wenn
ein Auserwählt-
Wahnsystem mit Missionierungsauftrag
zusammen traf, eine Spezialität der Christen und Moslems, nicht der
Buddhisten.
Religion - nach Marx trefflich als das Opium fürs Volk gekennzeichnet
- und Macht waren immer die engsten Verbündeten und es ist als eine
der größten emanzipatorischen Großtaten der westlichen
Kulturgeschichte anzusehen, dass dieser Irrsinn durch die Französische
Revolution im Zuge der Aufklärung
zumindest im Grundsatz überwunden wurde. Die Aufklärung hat aber
nicht erkannt, dass der Mensch metaphysische
Bedürfnisse hat. Daher sind die alten mit Psychopathologie durchsetzten
Religionen immer noch sehr mächtig. Man hat ebenso dümmlich wie
sträflich versäumt, den metaphysischen Bedürfnissen der
Menschen Rechnung zu tragen. Nur die wenigsten scheinen in der Lage, auf
metaphysisches "Bimbamborium" innerlich ganz zu verzichten, ohne
dadurch den Sinn [2,3]
des Lebens oder der Welt in Frage zu stellen und in Zynismus oder Nihilismus
abzudriften. Um dem Leben einen Sinn abzugewinnen braucht man keinen Gott
und keine Religion. |
Was
besagt die religiöse Symbolik der Beziehung Kumari und König
?
Diese Frage ist mit meinen geringen Kenntnissen der nepalesischen Religionslehre
nicht zu beantworten. In Nepal gibt es eine Staatsreligion. Der König
nimmt in Anspruch, die Inkarnation Vishnus zu sein
und die Kumari ist eine Inkarnation der Durga, beide
repräsentieren also höchste Gottheiten. Die offizielle Funktion
der Kumari ist der Schutz des Königs und seines Reiches und die alljährliche
Bestätigung seiner Herrschaft.
Die Internetseite Die
Religionsgeschichte Nepals führt aus: "Im Shaktismus wird
dem weiblichen Prinzip eine ausschlaggebende Bedeutung innerhalb des Weltprozesses
zugeschrieben. Entweder wird die höchste Gottheit als weibliches Wesen
verstanden (Durga, Kali etc.) oder die männliche Gottheit kann nur
mit Hilfe von weiblichen Energien (shakti) ihre Wirksamkeit entfalten.
Die Anhänger des Shaktismus lassen sich in zwei Gruppen unterscheiden,
von denen das Ritual der "right hand"-Shaktas allen offensteht, während
die Zeremonie der "left hand"-Shaktas geheim und nur Eingeweihten zugänglich
ist. In ihren Riten werden die "fünf Mukara" angewandt: Mada (Wein),
Matsja (Fisch), Mamsa (Fleisch), Mudra (geröstete Körner), Maithuna
(Geschlechtsverkehr). Damit übertreten die Shaktisten bewußt
eine dem orthodoxen Hindu gesetzte Tabugrenze, aber nicht um der Ausschweifung
willen, sondern auch nur zur Erreichung des höchsten göttlichen
Zieles."
Zum Verdacht
Boulanger: Ritueller sexueller Missbrauch zu "religiösen" Zwecken
?
Betrachtet man sich das Äußere, so fällt auf, dass
die kleinen Kindgöttinnen erotisch im Sinne verführerischer Früherwachsener
gestylt werden, was eigentlich - aus unserer Sicht - gar nicht zu einem
kleinen Mädchen passt - andererseits: die Göttin soll natürlich
schön sein und so wird sie ja auch ausgewählt.:

Quelle: Kumari aus dem Cover des Buches von Haase-Hindenberg.
Der Verdacht eines ritualisierten sexuellen Missbrauchs bei der Inthronisation
der Kumari
wurde von Boulanger in ihrem Buch (S. 185-194) durch Berufung
auf Literaturhinweise gegründet, ich zitiere S. 191f (fett hervorgehoben
RS):
"Ich versuche mir ins Gedächtnis zu rufen, was
ich über diese berühmte Nacht weiß, in der die künftige
Göttin in ihren Status erhoben wird. Nach der Prüfung der blutigen
Büffelköpfe wird das Kind zu den Priestern in den Tempel von
Taleju gebracht. Sämtliche Rituale müssen geheim bleiben, damit
die tantrische Magie nicht ihre Wirkung verliert. Dennoch habe ich die
Beschreibung eines Abschnitts dieser Initiation gelesen, wie er dem Ethnologen
und Nepal-Forscher Gérard Toffin von einem Priester anvertraut wurde.
Eine Reihe von magischen Vorgängen soll das Mädchen darauf vorbereiten,
von der Göttin beseelt zu werden. Zunächst wird das nackte Kind
vom Oberpriester gewaschen, um es von seinen bisherigen Erfahrungen zu
reinigen. »Auf diese destruktive Phase, eine Desindividuation gewissermaßen,
folgt eine Reihe weiterer Riten, die den Körper des Kindes in einen
göttlichen Körper verwandeln sollen. Zu diesem Zweck berührt
der Priester sechs Körperstellen des Mädchens, die so genannten
anga,
mit einem Büschel aus Eragrotis cynasuroides kusa, einem Gras,
das für religiöse Zwecke so weit verbreitet ist, dass man glauben
möchte, es könne alles reinigen. Die sechs Körperstellen
sind: Augen, Vulva, Vagina, Nabel, Brust [<191] und Hals. Je
weiter der göttliche Geist sich in ihr niederlässt, desto mehr
verfärbt sich der Körper des Kindes rot, was die Farbe der Kumari
ist.« [FN9: Gérard Toffin, »Le Palais et le Temple«.]
Damals hatte ich nicht wirklich begriffen, was dieses
eigenartige Ritual bedeutet. Jetzt bekomme ich langsam eine Ahnung von
den Zusammenhängen und mir wird klar, was dieses Mädchen, das
noch ein Kleinkind ist, durchmacht. Sie wird von Männern ausgezogen,
gewaschen und an den intimsten Stellen ihres Körpers, auch an den
inneren
Geschlechtsmerkmalen, berührt.
Für mich liegt es auf der Hand, dass allein
eine solche Zeremonie bereits ausreicht, um ein Kind in gleicher Weise
zu traumatisieren wie durch einen Geschlechtsakt. Und was ich über
den Tantrismus und seine Riten weiß, nimmt mir nicht meine Sorge
hinsichtlich der nachfolgenden geheimen Stufen der Zeremonie oder der übrigen
Rituale, an denen die Kumari im Laufe ihrer Herrschaft teilzunehmen hat.
... Ich hatte noch nicht die Zeit gehabt, den englischen
Text des Nepalesen Jagadish
zu lesen. Darin geht es um frühere tantrische Kulte mit jungfräulichen
kleinen Mädchen, Schnell überfliege ich die verschiedenen Gestalten
der Shakti, wie sie Mädchen (im Alter von einem bis sechzehn Jahren)
vor ihrer Pubertät verkörpern. [<192] Der Autor erwähnt
die von den Tantras vorgeschriebenen Voraussetzungen für eine spirituelle
Verwirklichung: Zu jeder Kaste gehöre ein ganz bestimmter Typus von
Kindern. Der Autor kommt zu folgendem Schluss: »Der letzte Zweck
der Verehrung einer kindlichen Jungfrau bleibt im Dunkeln, aber es hat
den Anschein, als hätten die Gläubigen im Anschluss an die Verehrung
sexuelle Beziehungen mit ihnen.« [FN10: C. Regmi Jagadish,
»The Kumari of Kathmandu«.]. Jagadish
beendet das kurze Kapitel mit dem Hinweis darauf, man könne aus den
Schriften darauf schließen, dass dieser Kult von den nepalesischen
Königen Pratap Malla und Pratap Singh Shah ausgeübt worden sei.
Der von den hohen Kasten mit kleinen Jungfrauen
aus niedrigen Kasten betriebene Kult mit dem Ziel, übernatürliche
Kräfte zu erlangen, ist ein Klassiker des Tantrismus. Aus dem gleichen
Grund standen in Indien auch die devadasi, die Tempelprostituierten,
im Ruf, den hohen Kasten, die ihre Dienste in Anspruch nahmen, die Gunst
der Götter zu sichern. Durch ein Paradox, wie es für den Tantrismus,
bei dem Grenzüberschreitung und die Umkehrung religiöser Regeln
gängige Praxis sind, typisch ist, war ihre Unberührbarkeit eine
Garantie für die Wirksamkeit magischer Rituale. Die Parallele zu den
Kumaris springt ins Auge: Sie, die bei orthodoxen Brahrnanen praktisch
als unberührbar gelten, werden dennoch, selbst von den Königen,
als Göttinnen verehrt.
Wie soll man in Erfahrung bringen, nach welcher
tantrischen Richtung die kleinen in Tempel und Palast eingeschlossenen
[<193] Göttinnen heute noch leben? Ich wage kaum, für mich
selbst die Vermutungen zu formulieren, die mich quälen: Sollten die
Kumaris Gegenstand tantrischer Riten sein, die gar nicht so symbolisch
sind, wie behauptet wird? Was ich über ihren Kult erfahren habe, ihr
Verhalten als offenkundig traumatisierte Kinder und das Wesen selbst ihrer
Funktion als Shakti, die das Königreich fruchtbar zu machen hat, scheint
mir eine Antwort zu geben, wie ich sie nicht haben will. Allmählich
begreife ich besser, warum man munkelt, ehemalige Kumaris würden ihr
Schicksal als Prostituierte in Indien besiegeln. Ob sie nun stimmen oder
nicht, diese Gerüchte sind jedenfalls Ausdruck eines Unbehagens bezüglich
der Sexualität der ehemaligen Göttinnen.
Ich bin sehr niedergeschlagen. War der starre, tote
Blick des kleinen Mädchens vom Kumari Chowk, der mich so beschäftigt
hatte, der einer kaputten Puppe? Was mir zu Beginn meines Aufenthalts als
erstaunliche Umkehrung der Machtverhältnisse erschien, ein Kind, das
Kräfte besaß, denen sich sogar Könige unterwarfen, kommt
mir heute vor wie eine entsetzliche Abscheulichkeit. Eine Umkehrung war
es schon, doch nicht der Art, wie ich es vermutet hatte. Diese Mädchen
stehen im Dienst des Kults, nichts anderes. Eine Allianz von Palast und
Tempel, deren Spielzeug, deren tantrische Instrumente sie sind.
Wenn dies das Ende meiner Suche sein sollte, so
machte mich meine Entdeckung nicht glücklich."
Zu berücksichtigen ist hier natürlich aber
auch, wie diese Rituale von der nepalesischen Gesellschaft beurteilt werden.
Das dürfte aber gar nicht richtig möglich sein, weil weitgehend
unbekannt sein dürfte, was im Kumari Bahal genau geschieht: die Priester
werden sich dort genau so wenig in die Karten schauen lassen, wie sonst
auf der Welt, wenn sie es nur irgendwie vermeiden können, weil sich
öffentliche Supervision und spirituelle priesterliche Macht ausschliessen
(Informationen). Möglicherweise
wollen Volk und Gesellschaft auch gar nicht so genau wissen, was da wirklich
vor sich geht, wie Boulanger mutmasst. Vielleicht finden aber auch die
intellektuelle und spirituelle nepalesische Elite einen Weg, die Kluft
zwischen traditionellem Ritus und wissenschaftlicher Bindungstheorie konstruktiv
zu überwinden. Gerade die asiatische Problemlösungs-Kultur des
Zen mit seinen Koans könnte dafür gut gerüstet
sein.
Das
Massaker im Königspalast am 1.6.2001 und seine Bedeutung für
die Stellung der Kumari (Amita).
Kurz vor der schon angekündigten Beendigung der Amtszeit der Kumari
Amita geschieht etwas Ungeheuerliches:

Quelle: Chronik 2001Tag für
Tag in Wort und Bild, S. 93, Chronik-Verlag.
Diese Familentragödie im Königshaus wirft natürlich die
zum Koan geeignete Frage auf: Wieso konnte die Kumari,
die Schutzgöttin des Königshaus, den König und seine Familie
nicht schützen? Weitergehend ergibt sich die Frage, was folgt für
den Kumari-Kult und die Funktion der Kumari, wenn sich zeigt, dass sie
diese Aufgabe nicht erfüllen kann? Und wie hat die noch amtierende
Kumari, Amita, dieses außergewöhnliche Ereignis verkraftet?
Hatte sie Schuldgefühle?
Anmerkung: Danach wurde Gyanendra König [, Wikipdia,
], dessen diktatorische Maßnahmen sehr kritisch bei HH, S. 385f beschrieben
werden.
Die Reaktion der Kumari auf die Ermordung der Königsfamilie
HH, S. 278, berichtet: "Nachdem die grausame Wahrheit bis in den Thronsaal
der Kumari gedrungen war, hat sich Durga schließlich mit der Mädchengöttin
zurückgezogen und mit ihr über das Ereignis gesprochen. Obgleich
sie ja selbst keine Hintergründe, geschweige denn Details, kennt.
Vor allem hat sie ihr verschwiegen, dass in den ausländischen Nachrichtensendungen
ein schrecklicher Verdacht gegenüber Dipendra ausgesprochen wird.
Denn die Kumari soll dem neuen König nicht voreingenommen begegnen,
falls er genesen und sie um die Tika bitten sollte.
»Lang lebe Dipendra!«, tönt es
zum Wohnzimmer der Kumari herauf. Grölende Gruppen meist junger Männer
ziehen durch die Stadi und skandieren immer wieder ihre Verbundenheit mit
dem neuen König. Durga, die hinter der Mädchengöttin steht
und mit ihr gemeinsam auf den Basantapur-Platz hinausblickt, erkennt hinter
dieser Sympathiebekundung für Dipendra die Ablehnung Gyanendras.
Durga spürt eine wachsende Unruhe in sich aufsteigen. Weiß
sie doch aus eigener Erfahrung, wie schnell eine scheinbar friedliche Demonstration
in nackte Gewalt umschlagen kann. Dafür hat es in den letzten Jahren
mehr als ein Beispiel gegeben - drüben in der New Road, auf dem Kantipath-Boulevard
und vor einigen Jahren selbst hier auf dem Basantapur-Platz. Sie ist den
Sicherheitsorganen dankbar, dass sie seither beim Ausbrechen von Unruhen
immer sofort den Platz neben dem Kumari Bahal abriegeln. Die Umgebung des
Wohnsitzes der Mädchengöttin war ebenso zur »Bannmeile«
erklärt worden wie die des Königspalastes und des Parlaments.
Durga zwingt sich zur Ruhe, um sich der Dyo Maiju
gegenüber nicht anmerken zu lassen, dass sie Angst hat. Nur zu gut
kann sie nachempfinden, welche enormen inneren Konflikte die Mädchengöttin
in diesem. Moment auszuhalten hat.
Noch einmal sieht sie Mousuf Sarkar ganz deutlich vor sich, wie
er unterhalb des goldenen Fensters steht und ihr zuwinkt. Damals hatte
sie Sorge, es könnte ein Abschiedswinken sein. Nun weiß sie,
dass es ein Abschiedswinken war! Sie sieht ihn neben der Königin auf
dem Balkon dort drüben stehen, am Indra-Jatra-Fest, und sie blickt
noch einmal in das Gesicht mit der großen Brille und dem sanften
Lächeln - er kommt ganz nah zu ihr herunter, damit sie ihm die Tika
geben kann.
Es ist nicht schön, dass sie Mousuf Sarkar
nie mehr sehen wird. Aber es freut sie, dass er jetzt als kleiner Tropfen
zurückkehrt ins große Meer, das Nirwana heißt. Dort ist
er für alle Zeiten unangreifbar. Seine Mörder haben ihr Ziel
nur hier auf dieser Erde erreicht ... im Nirwana aber haben sie keine Macht.
»Du musst nicht traurig sein. Sie haben ihr Ziel nicht erreicht!«,
sagt die Kumari und reißt Durga aus angstvollen Vorahnungen.
»Von wem sprichst du?«
»Von den Dämonen, die Mousuf Sarkar getötet haben.
Im Nirwana endet ihre Macht, und er wird nun wieder Teil des großen
Meeres!«
Einen Augenblick lang denkt Durga darüber nach, ob dieses buddhistische
Bild der positiven Leere auf einen hinduistischen König angewendet
werden kann, der immerhin als Inkarnation des Gottes Vishnu galt. Dann
aber huscht ein Lächeln über ihr Gesicht, denn sie ahnt, dass
die Mädchengöttin Recht hat."
Auswahl, Vorbereitung
und Zustimmung.
Psychologisch interessiert uns hier vor allem: wie wird das Kind vorbereitet?
Wie wird den Eltern geholfen, ihr Kind, aber auch die ganze Familie auf
die neue Rolle und Situation vorzubereiten? Wie werden Umgangsfragen
und andere wichtige Kindeswohlfragen
geregelt?
Auswahlprozedur:
die Chefastrologen am
Hof haben das Wort
"Schon seit Stunden brütet der Astrologe über den Horoskopen
von kleinen Mädchen aus der Shakya-Kaste. Eine von ihnen, daran glaubt
er fest, ist zur nächsten Kumari des Königs bestimmt. Dieser
unerschütterliche Glaube lässt für den Astrologen von vornherein
gar nicht erst die Möglichkeit zu, etwa alle Aspirantinnen für
ungeeignet zu halten.
Seine Aufgabe ist es, ehe er sich mit seinen Kollegen
im königlichen Palast endgültig beraten wird, eine astrologische
Analyse zu erarbeiten. Sein Wort wird bei der Auswahl Gewicht haben,
niemand wird ernsthaft an der Analyse des weisen Mannes zweifeln. Schon
gar nicht die drei anderen Hofastrologen, die einst allesamt seine Schüler
waren. Und so entscheidet sich in diesem Moment in einem dunklen Hinterhof
in Patan das Schicksal eines kleinen Mädchens, das zu diesem Zeitpunkt
noch irgendwo in Kathmandu im Kreise seiner Familie lebt.
In einem Flügel des geräumigen Königspalastes
hat der Chefastrologe seine Berechnungen entlang der Wand aufgehängt.
Keiner der drei anderen Astrologen weiß, wessen Horoskop sich hinter
den Ausarbeitungen ihres Meisters befindet. Deren Blicke nämlich sollen
sich ausschließlich auf die Konstellation der Gestirne richten. Doch
ehe [<30] der Chefastrologe seine Kollegen nach vorn bittet, um die
Ausarbeitungen vorzustellen, gefällt er sich noch einmal in der Rolle
des Lehrers. Auch wenn alle Anwesenden längst Meister ihres Fachs
sind, referiert Mangal Raj Joshi zunächst über die große
Weisheit des Universums. Er spricht über die Bedeutung der Sonne im
Verhältnis von hell und dunkel, heiß und kalt, gut und böse.
Schließlich ermahnt er seine Kollegen angesichts der bevorstehenden
Aufgabe, sich der großen Verantwortung bewusst zu sein. Dann tritt
er an die Ausrichtungen heran und erläutert insbesondere die unterschiedlichen
Konstellationen von Sonne, Mond und Jupiter, verweist auf die störenden
oder positiven Aspekte anderer Gestirne. Durch die Art und Weise aber,
wie er die einzelnen Konstellationen deutet, gibt es kaum Zweifel, welches
Horoskop wohl am ehesten jenen edlen Qualitäten entspricht, die sie
»Rajuk« nennen. Sie müssen höherwertiger als die
des Königs sein. Neben den körperlichen Voraussetzungen, die
andere zu beurteilen haben, sind die geistigen und charakterlichen Qualitäten,
die eben dem Horoskop zu entnehmen sind, für eine Kumari unerlässlich.
Genau dies herauszufinden ist die Aufgabe des hier versammelten Gremiums.
Jeder der Astrologen tritt einzeln zu den Berechnungen und betrachtet die
Ausarbeitungen aus nächster Nähe. Gelegentlich schreibt sich
einer etwas auf, bevor er die anderen Planetenkonstellationen betrachtet
und mit den Notizen vergleicht. Endlich notiert jeder die Nummer seines
favorisierten Horoskops auf einen Zettel und legt ihn gefaltet auf den
Tisch des Chefastrologen. Langsam und mit würdiger Miene öffnet
der alte Mann endlich einen Zettel nach dem anderen, betrachtet ihn jeweils
kurz und legt ihn zustimmend zur Seite. Schließlich stellt er befriedigt
Einstimmigkeit fest. Dabei hätte es genügt, wenn nur einer der
drei anderen Astrologen zum gleichen Ergebnis wie er gekommen wäre.
Die Bestimmung sagt nämlich, dass die einfache Mehrheit genügt,
im Fall eines Patts jedoch die Stimme des Chefastrologen den Ausschlag
gibt." (HH, S. 30f).
Die 32
Schönheitsmerkmale oder battislaksana [Sekundär-Quelle Anhang
Boulanger S. 215f]
Gemäß den Tantras, heiligen Schriften, die für die
Auswahl künftiger Kumaris herangezogen werden,
1. Wohlgestaltete Füße.
2. Ein Kreis unter der Fußsohle.
3. Eine wohlgeformte Ferse.
4. Lange Zehen.
5. Füße und Hände wie die einer Ente.
6. Zarte und geschmeidige Füße und Hände.
7. Ein Körper in der Form eines Saptacchata-Blattes.
8. Die Schenkel eines Rehs.
9. Tief im Becken sitzende Geschlechtsorgane.
10. Runde Schultern.
11. Die Brust eines Löwen.
12. Lange Arme.
13. Ein reiner Körper.
14. Ein Hals wie eine Muschel.
15. Wangen wie die eines Löwen.
16. Vierzig Zähne.
17. Wohlgestaltete Zähne.
18. Weiße Zähne.
19. Eine kleine Zunge.
20. Eine feuchte Zunge.
21. Die tiefe Stimme eines Spatzes.
22. Schwarzblaue Augen.
23. Die Wimpern einer Kuh.
24. Ein schöner Schatten.
25. Ein goldfarbener Schatten.
26. Eine schöne Hautfarbe.
27. Glattes, aber sich nach rechts drehendes Haar.
28. Schwarzblaues Haar.
29. Eine breite Stirn.
30. Ein runder Kopf.
31. Ein Körper wie ein Banyanbaum (Nyagrodha).
32. Ein kräftiger Körper.
(Aus »Kailash. A Journal
of Himalayan Studies«, 1974, Bd. II, Nr. 3)
Die weitere praktische Auswahl wird unter Das
Verhalten des Auswahl-Komitees ausgeführt.
Die Rolle
und Zustimmung der Eltern und die Vorbereitung auf das Göttin werden.
Kumari werden geht nicht ohne Zustimmung der Eltern. So gesehen tragen
die Eltern letztlich die Verantwortung. HH, führt hierzu u.a. S. 35
aus:
"EXPERTEN DES KÖNIGS
Wenn der Astrologe das beste Horoskop gefunden hat, sagt er Bescheid,
und es werden die zweiunddreißig erforderlichen körperlichen
Merkmale überprüft. Meine Frau untersucht das Mädchen nackt.
Wenn wir damit fertig sind, sagen wir dem König, dass wir das richtige
Mädchen gefunden haben.
RAMESH PRASAD PANDEY, Mul Purohit - königlicher Oberpriester
Wenn man seine Tochter nicht als Kumari hergeben will, so ist das möglich.
Aber dann darf man das Horoskop nicht aushändigen. Denn wenn die Horoskope
erst mal überprüft sind und die Wahl getroffen wurde, kann man
keinen Rückzieher mehr machen.
AMITAS VATER" |
Anmerkung: HH, S. 232, berichtet auch, dass zur Auswahl der Nachfolgerin
Amitas, sich viele Eltern von in Frage kommenden Töchtern weigerten,
das Horoskop ihrer Töchter auszuhändigen.
Eine angemessene Vorbereitung auf das Göttinnendasein scheint es
nicht zu geben. Es ist allerdings auch objektiv schwierig, wenn man bedenkt,
dass Amita 1 Tag vor ihrem dritten Geburtstag inthronisiert wurde. Und
was wollte man auch selbst einer aufgeweckten Dreijährigen wie im
Falle Amita erklären?
Amitas
Vorbereitung durch die Eltern auf die Auswahl zur Kumari. (HH,
S. 36f)
"Seit Tagen leben sie nebeneinander her, konfrontiert
mit der schicksalhaften Deutung des königlichen Astrologen, und ohne
ein Wort über deren Konsequenzen - nicht miteinander und schon gar
nicht mit den Mädchen. Nun würde es Amrits Aufgabe sein, Amita
den Zweck des gemeinsamen Besuchs im Narayanhiti Durbar, dem neuen Königspalast
im modernen Teil von Kathmandu, zu erläutern.
Amrit hat seine beiden Töchter in die Wohnstube gerufen und sich
dort mit ihnen auf den Fußboden gesetzt. Er hat angefangen, von der
Kumari zu erzählen. Er hat erläutert, wie wichtig es ist, dass
ein kleines Mädchen über das Land wacht, und wie schön es
für dieses Mädchen ist, von allen Menschen verehrt zu werden.
Die Töchter des Amrit Man Shakya hören ihm zu, und als er an
das letzte Indra-Jatra-Fest erinnert, teilen sie lebhaft ihre Erinnerungen
mit. Sie fallen sich gegenseitig ins Wort, sprechen von der riesigen Krone
der Kumari und deren goldenem Wagen, beklagen sich, dass der König
keine Krone getragen hat und sie schon so früh nach Hause mussten.
»Diese Kumari wird aber schon bald keine Kumari mehr sein«,
sagt Amrit, und seine Töchter sehen ihn an, als ob er den Weltuntergang
verkündet hätte.
Irgendwie hat er das Gespräch falsch angefangen,
geht es ihm durch den Kopf. Um eine positive Wendung hinzubekommen, ruft
er ihnen zu: »Bald wird ein anderes hübsches Mädchen unsere
neue Kumari!«
An den ratlosen Mienen seiner beiden Töchter
kann Amrit erkennen, dass sie ihn nicht verstehen. Woher sollten sie auch
wissen, dass [<36] eine Kumari nicht vom Himmel fällt, sondern
ein Mädchen aus einer ganz normalen Familie ist? Eine Göttin
auf Zeit.
»Die Kumari ist zwar eine Göttin.
Aber sie ist auch ein Mädchen, die eine Ma und einen Baa hat. So wie
ihr!«, versucht er eine Erklärung und er ist Anita dankbar,
als sie ihm mit ihrer Bemerkung fast ins Wort fällt: »Dann können
wir ja auch die Kumari sein ...!«
Amita springt begeistert auf, hüpft durch das
ganze Zimmer und ruft: »Jaaaa, ich will eine Kumari sein!«
Anita aber lässt sich aus der Hocke nach hinten
fallen und lacht.
»Du siehst ja gar nicht aus wie die
Kumari!«, ruft sie. Und nachdem sie sich wieder aufgerichtet hat:
»Wo ist denn überhaupt deine Krone?«
Amitas Antwort erfolgt prompt: »Ich gehe mit
Ma eine kaufen!«
Amrit ruft seine jüngere Tochter zu sich und
nimmt sie in den Arm.
»Du bekommst die Krone, die die Kumari am
Indra-Jatra-Fest getragen hat. Denn wenn sie keine Kumari mehr ist, dann
braucht sie sie ja nicht mehr.«
Die beiden Mädchen sehen ihren Baa überrascht
an. Auch wenn sie diese Bemerkung in ihrer ganzen Bedeutung nicht verstehen,
so spüren sie offensichtlich in diesem Moment, dass dahinter keine
Fantasterei steckt.
Amrit ist froh, dass es ihm fast spielerisch gelungen
ist, Amita ein wenig auf ihre künftige Rolle vorzubereiten. Auch wenn
es über eine verbale Ankündigung noch nicht hinausging. Während
des morgigen Besuchs im Kumari Bahal wird es sicher eine Gelegenheit geben,
ihr zu erklären, dass dieser Palast ihr künftiger Wohnsitz sein
wird. In den nächsten Tagen wird er dann auch Anita darauf vorbereiten
müssen, dass sie ihre weitere Kindheit ohne die kleine Schwester verbringen
wird. Im Augenblick aber will er das Thema nicht weiter vertiefen. Es wird
schließlich für alle Beteiligten noch schwer werden. Und Amrit
ist froh, in seiner Frau eine starke Partne-[<37] rin zu haben. Mit
ihrer bemerkenswerten Entschlossenheit, der Göttin Taleju die eigene
Tochter zur Verfügung zu stellen, hatte sie schnell seine anfänglichen,
unausgesprochenen Zweifel zerstreut."
| Nach der Darstellung von HH werden die
Eltern von den Verantwortlichen (Auswahl-Komitee, Priester, Palast, entwicklungspsychologisch
kundigen Sozialwissenschaftlern) völlig allein gelassen werden, ihrem
Kind zu erklären, was geschehen wird und soll. |
Amitas
Vorbereitung durch das Auswahl-Komitee. (HH, S. 40f ):
"Von seinem Stammplatz aus entdeckt der Chitaidar,
wie Amrit Man Shakya mit seiner kleinen Tochter über den Hof kommt.
Er ruft nach seiner Frau und eilt den beiden Besuchern entgegen, um zu
verhindern, dass sie die Treppe bis in den Thronsaal hinaufsteigen. Die
voraussichtlich neue Kumari soll der derzeitigen Mädchengöttin
nicht begegnen.
In dem lang gestreckten Raum eine Etage tiefer sitzen
sie sich schließlich gegenüber. Der Vater der künftigen
Kumari ist ein bescheidener Mensch, seit vielen Jahren Busfahrer - der
Chitaidar hatte Erkundigungen über ihn eingeholt. Dieser einfache,
freundliche Mann sorgt für seine Familie und begeht alle Feiertage
nach den strengen Regeln des von den Newar [RS: Volksgruppe] praktizierten
Vajrayana-Buddhismus.
Ein solcher Mann, so mag sich der Chitaidar überlegt haben, wird weder
übertriebene Ansprüche noch überflüssige Fragen stellen.
Und seine Frau, die eigentliche Chitaidar, scheint keine Zweifel zu haben,
dass die Gutachter des Palastes und auch der König selbst dieses
ausgesprochen hübsche Mädchen als Kumari bestätigen werden.
Sie mag es, dass die freundliche Frau dauernd
zu ihr sagt, wie hübsch sie ist. Es gefällt ihr auch, wenn sie
sagt, dass sie es hier ganz sicher schön finden wird, und alle, die
hier wohnen, sich schon auf sie freuen. Und als der Mann mit der großen
Brille erzählt, dass es im Haus auch noch andere Kinder gibt, sagt
sie, dass sie ihre Schwester Anita mitbringen will. Ihre Ma will sie auch
mitbringen, die kann sehr schön singen, und abends kommt Baa dann
von der Arbeit und bringt für alle Erdnüsse mit ...
Warum aber freuen sich denn die fremden Leute
nicht? Sie schaut zu ihrem Baa, aber auch der schaut ernst auf den Boden.
Dann sagt der fremde Mann, sie würden jetzt zusammen zum König
gehen, der möchte sie unbedingt kennen lernen. Und als sie fragt,
ob er heute die Krone auf dem Kopf hat, wie auf dem Bild zu Hause, da lachen
nun doch noch alle, und sie lacht auch.
Es ist schon fast eine halbe Stunde her, seit die
Frau des Mul Purohit die kleine Amita an die Hand genommen und den hohen
Gang entlanggeführt hat. Seitdem sitzt der Vater des Mädchens
neben dem Chitaidar auf dem Flur im Königspalast und wartet. Sein
Begleiter, das ist ihm schnell klar geworden, hat keine Ambitionen, sich
mit ihm zu unterhalten. Wann immer Amrit Man Shakya den Ansatz dazu machte,
antwortete der Chitaidar knapp und scheinbar unwillig. Warum das hier denn
so lange dauern würde, wollte Amitas Vater wissen,
»Der Astrologe stellt erst noch das Horoskop vor«, bekam
er zur Antwort." [<41]
Trennung
von der Familie, Übergang zur Göttin, Trennungsverarbeitung
HH beschreibt (S. 51f) : "Die künftige Mädchengöttin
steigt in ein klappriges Taxi, das ihr Vater an Straße angehalten
hat. Amitas Mutter folgt ihr, in der Hand eine kleine Reisetasche, in der
sie nur das Waschzeug und ein wenig Unterwäsche eingepackt hat. Schließlich
wird dem Mädchen künftig die Kleidung in der roten Farbe der
Kumari zur Verfügung gestellt - dort, wo es jetzt mit seinen Eltern
hinfährt und aller Voraussicht nach die nächsten Jahre leben
wird. Die Dimension dieser Trennung aber haben offenbar weder Amita noch
ihre größeren Schwester wirklich verstanden. Denn obgleich ihr
Baa es ihnen am Morgen noch einmal zu erklären versucht hatte, vollzog
sich der Abschied ohne Tränen.
Am Hanuman-Dhoka-Palast bezahlt Amrit Man Shakya
dem Fahrer 25 nepalesische Rupien. Amita drückt beim Aussteigen ihre
Puppe fest an sich, die die Mutter ihr kurz vor dem Verlassen des Hauses
noch schnell in den Arm gelegt hat. Dann gehen sie zum Kumari Bahal hinüber.
Vor dem schmalen Eingang steht eine ältere Frau und bietet Farbpostkarten
mit dem Bild der Mädchengöttin an. Da sie ihr Geschäft fast
ausschließlich mit Touristen macht, beachtet sie die Shakyas
gar nicht. Mimita Shakya aber betrachtet nachdenklich die unterschiedlichen
Porträtfotos, die die Frau aufgefächert in [<51] der Hand
halt. Mit ausdrucksloser Miene blickt darauf die kleine Kumari direkt in
die Kamera. Schon bald, so geht es Amitas Mutter durch den Kopf, wird diese
Frau den Touristen aus aller Welt das Foto ihrer Tochter anbieten.
Es fällt Mimita Shakya schwer, mit ihrer Tochter
die Schwelle des Kumari Bahal zu überschreiten. Sie muss an die heftigen
Albträume denken, von denen Amita in den letzten Tagen geplagt wurde.
In der Nacht, nachdem das Mädchen im Palast untersucht und anschließend
dem König vorgestellt worden war, fing es an. Anita hatte ihre Eltern
geweckt und teilte ihnen besorgt mit, dass ihre kleine Schwester weinen
und manchmal laut schreien würde. Dann haben sie Amita zu sich ins
Ehebett geholt. Hier sollte sie nun die letzten Tage bis zu ihrem Umzug
in den Kumari Bahal schlafen. In der nächsten Nacht ging es wieder
los. Mehrfach hatten die Eltern ihre Tochter geweckt. Doch kaum war sie
wieder eingeschlafen, fing sie erneut an zu wimmern und zu schreien. In
seiner Hilflosigkeit hat ihr der Vater schließlich eine Ohrfeige
verpasst. Aber schon im nächsten Moment tat es ihm entsetzlich Leid.
Am folgenden Morgen rief Amrit Man Shakya im Kumari
Banal an und berichtete von den nächtlichen Albträumen seiner
Tochter. Der Chitaidar aber erklärte, diese
Vorgänge seien »völlig normal«. Schließlich
würden sich bereits die gewaltigen Energien der Taleju und auch der
Durga ankündigen, und das sei für das Mädchen natürlich
ungewohnt. Dies wäre lediglich eine Übergangsphase, die ganz
sicher bald vorbei sei.
Auch Amitas Vater wirkt nicht gerade entschlossen,
den Kumari Bahal zu betreten. Auffällig lange betrachtet er die aufwändigen
Holzschnitzereien rund um das schmale Eingangstor. Oben thront die vielarmige
Durga, zu deren Füßen der Eingang zum Hof von unzähligen
kleinen Totenköpfen eingerahmt ist. In ihrer Zeit als Mädchengöttin
wird seine Tochter nie wieder dieses Tor durchschreiten. Für die wenigen
Male, die sie im Laufe der nächsten Jahre an Zere-[<52]monien außerhalb
dieses geräumigen Hauses teilnehmen wird, ist ein schmuckloser Weg
über einen dunklen Nachbarhof vorgesehen. Schon heute Nacht wird Amita
dort durch jene kleine Maueröffnung ins Freie gelangen, wo sie am
letzten Indra-Jatra-Fest ihre Vorgängerin gesehen hat. Hinter diesem
eigenwilligen Vorgang steht eine Tradition, deren Herkunft niemand mehr
zu benennen weiß."
Angelangt im Thronsaal schildert der Autor weiter
(S. 58): "Warum sehen sich denn alle so komisch an? Sie hat sich doch
nur auf Mas Schoß gesetzt und gefragt, wann sie wieder nach Hause
gehen. Ma sagt, dass hier ganz viele Menschen herkommen werden, um sie
zu besuchen. Deshalb muss sie auch immer hier sein ... Die Menschen werden
alle ganz lieb zu ihr sein und sie verehren, weil sie ganz, ganz wichtig
für diese Leute sein wird. Aber warum sie so wichtig für diese
Leute sein wird, das hat Ma nicht gesagt.
Noch hat Amita die junge hübsche Frau nicht
entdeckt, die sie aufmerksam von einer Ecke des Raumes aus beobachtet.
Sie ist die unverheiratete Tochter des Chitaidar-Paares, und nichts passt
weniger zu dieser freundlichen Person als ihr Name: Durga.
Sie ist fasziniert — von der Anmut des kleinen Mädchens, seinem
natürlichen Lachen und dem zierlichen schmächtigen Körper.
Die neue Kumari, so scheint es, ist ein verletzliches Wesen, das eines
ganz besonderen Schutzes bedarf.
Durga ist in einem Alter, in dem Nepalesinnen ihre
ersten Kinder gebären. Und noch bevor sie mit der neuen Kumari einen
Satz wechseln konnte, hat sie an sich ein heftig einsetzendes Gefühl
registriert, für das der Begriff »Zuneigung« zu wenig
wäre. Das sensible Kind dort, das spürt sie, wird sie brauchen,
um sich in diesem Palast zu Hause zu fühlen und seiner göttlichen
Aufgabe nachkommen zu können. Durga ist entschlossen, der Göttin
eine ergebene Dienerin und dem Mädchen eine schwesterliche Freundin
zu sein.
Die junge Frau in der Ecke dort kommt ihr bekannt
vor. [Déjà vu] Aber
sie weiß, dass sie sie noch nie gesehen hat. Sie lächelt die
fremde Frau an und die fremde Frau lächelt zurück.
Niemandem im Raum ist der kurze Blickwechsel zwischen
den beiden entgangen, jener emotional aufgeladene Augenblick, in dem sich
eine stumme Adoption vollzog. Dabei ist keineswegs sicher, ob Durga sich
darüber im Klaren ist, dass sie in diesem Moment auch für ihr
eigenes Schicksal eine entscheidende Weiche gestellt hat. Zumindest im
nächsten Jahrzehnt wird sie unverheiratet bleiben müssen — denn
kein Ehemann würde akzeptieren, dass seine Frau das Bett nicht mit
ihm, sondern mit der Kumari teilt. Aber auch keinem Mann zuliebe würde
Durga den Dienst für die lebende Göttin aufgeben. Eine Herausforderung,
die sie angesichts der kleinen Amita in ungewohnte Erregung versetzte.
[<59]
Sie freut sich, weil diese Frau auf sie zukommt.
Sie kennt diese Frau nicht, aber sie spürt, dass sie nett zu ihr sein
wird. Und als die Frau sie an die Hand nimmt, rutscht sie von Mas Schoß
und geht mit ihr mit.
Mimita Shakya spürt einen Schmerz, als ob ihr
das Herz von einem Ring zusammengeschnürt würde. Sollte sie nicht
froh sein, dass ihre Tochter jener Frau so vertrauensvoll folgt, die doch
in den nächsten Jahren eine wichtige Person im Leben von Amita sein
wird? Doch es setzt sich das mütterliche Gefühl der Trauer durch,
darüber, dass sich für Amita der Wechsel offenbar ohne jeden
Abschiedsschmerz vollzieht. Dann aber macht sich Mimita Shakya klar, dass
das Kind die Dimension des Ereignisses ja im Moment noch gar nicht begreifen
kann."
Das Leben als Kindgöttin
Eine gute allgemeine Zusammenfassung findet sich bei GEOlino.de: "Doch
das Leben, das sie von da an führen wird, ist eintönig. Getrennt
von der Außenwelt und der Familie verbringt die Kumari fast ihre
gesamte Kindheit im Palast von Kathmandu. Ihr Alltag ist geprägt von
religiösen Ritualen. Stundenlang muss sie bewegungslos auf ihrem Thron
ausharren, nicht einmal blinzeln soll sie. Täglich kommen fast ein
Dutzend Menschen zu ihr: Kranke, Pilger und Politiker wollen sich von ihr
segnen lassen. Blütenblätter streut sie über sie und drückt
ihnen einen roten Punkt auf die Stirn. Ihre Aufgabe ist es, Glück
zu bringen.
Dabei wird jede ihrer Regung als Zeichen gewertet.
Fängt die Kumari an zu weinen oder laut zu lachen, wird der Besucher
krank werden oder sogar sterben. Fängt sie an zu zittern, wird die
Person ins Gefängnis kommen; hebt sie das dargebotene Essen des Besuchers
vom Boden auf, so verliert er Geld. Bleibt die Kumari jedoch still, so
wird sein Wunsch in Erfüllung gehen. Sogar der König selbst erbittet
ihren Segen zum Indra Jantra-Fest am Ende der Regenzeit.
Nur 13 Mal im Jahr verlässt sie ihre heiligen
Mauern. An diesen religiösen Feiertagen versammeln sich tausende von
Menschen auf den Straßen Kathmandus, um die Schutzgöttin Nepals
zu sehen. Die Kumari-Helfer tragen sie durch die Menge, weil ihre Füße
nicht den Boden berühren dürfen. Dann und wann müssen sie
das Mädchen auch vor den fliegenden Glücks-Münzen schützen,
die die Leute werfen. Doch wer wünscht sich nicht, von Tausenden bejubelt
und verehrt zu werden?"
Ausführlich, was die Kumari Amita (1991-2001)
betrifft, informiert hierzu HH.
Vorbereitung
auf das Ende des Kindgöttinnendaseins
Wenn Haase-Hindenberg Recht hat, scheint es bislang in der Priesterschaft,
im Palast und in der gebildeten nepalesischen Gesellschaft niemanden besonders
interessiert zu haben, was mit den Mädchen passiert nachdem sie ziemlich
unvermittelt ihren Göttinnenstatus verlieren und zurück in ein
Leben geworfen werden, das ihnen fremd ist, das sie nicht kennen. Erfreulicherweise
scheint hier der Vater Amitas einiges auf den richtigen Weg gebracht zu
haben.
Vorzeitige
Beendigungen des Göttinnendaseins
Marie-Sophie Boulanger behauptet, dass die offiziellen Angaben für
Anita (1979-1986) und Rashmila (1986-1991) teilweise falsch und wiedersprüchlich
sind, weshalb sich dann die Frage stellte: warum werden falsche
Angaben gemacht, was bedeutet das? Im einzelnen argumentiert sie (S.
185f):
"Hinter der Verbotenen Tür verbergen sich in
der Tat etliche Mysterien. Unter anderem erscheinen mir die Umstände
der Absetzung immer obskurer. Was Anita mir im Vertrauen berichtet hat,
macht mich sprachlos. Der wirkliche Grund für ihre Absetzung war nicht
der offiziell genannte gewesen; ihre Menstruation
hatte nicht eingesetzt. Und bei Rashmila? Der Palast und die Familie versichern,
sie sei im Alter von zwölf Jahren abgesetzt worden. Das ist leicht
zu überprüfen. Zwar [<185] gibt es kein Register der Kumaris,
aber die Geburtsdaten, der Zeitpunkt der Wahl und der Absetzung der Göttinnen
der letzten Jahrzehnte sind bekannt. Ich wühle in meinem Rucksack,
in dem ich ständig alles mitführe, was ich für meine Interviews
zu benötigen glaube: Tonbandgerät, Notizblöcke, Fotokopien,
verschiedene Texte, Lexikon und andere wichtige und unwichtige Dinge mehr.
Ich sehe mehrmals nach. Rashmila ist 1982 geboren, sie ist heute also sechzehn.
Bei ihrer Absetzung 1991 war sie demnach neun Jahre alt und nicht etwa
zwölf, was ein gewaltiger Unterschied ist!
Ein paar Minuten denke ich darüber nach, was
diese offizielle Lüge im Einzelnen bedeutet. Neunjährige Mädchen,
deren Menstruation einsetzt, sind selten in einem Land, in dem das Durchschnittsalter
pubertierender Mädchen zwischen dreizehn und fünfzehn Jahren
liegt. Auch Anita hatte ihre Regel noch nicht, als sie mit elf Jahren nach
Hause geschickt wurde - und auch in ihrem Fall hatte man angegeben, sie
sei zwölf gewesen. All das kommt mir immer seltsamer vor. Aus anderen
Quellen wusste ich ja schon, dass an ehemaligen Kumaris das Ritual der
»Aussperrung« - die zwölf Tage ohne Sonnenlicht und ohne
Kontakt zu Menschen - und sogar die Ihi-Hochzeit vollzogen wird. Diese
Riten, die die Frau auf die Ehe vorbereiten sollen, dürfen in der
Regel nur praktiziert werden, bevor bei den Mädchen die Menstruation
einsetzt.
Warum wurden diese Mädchen schon vorher mit
dem Hinweis abgesetzt, die einsetzende Regel sei der Grund?"
Amitas (1991-2001)
Vorbereitung
Die ersten Hinweise erhielt Amita im Jahr 2000 zur Zeit des großen
Indra-Jatra-Festes (HH, S. 230) als Gaurav zu ihr sagte, es werde die Zeit
kommen, da dürfte sie auf dem goldenen Wagen mitfahren. Die nächste
Situation ergab sich anläßlich der alljährlichen Einladung
ehemaliger Kumaris (HH, S. 234) und dem Hinweis Durga-Didis auf die Bildgalerie
aller früheren Kumaris. Klar und deutlich sprach es dann, wenige Tage
später, eine ehemalige Kumari, inzwischen alte Dame, aus. Zwsichenzeitlich
wurde schon die neue Kumari ausgewählt, Preeti, aber alle meinen,
vor allem aber Durge-Didi, sie hätten noch Zeit, ein Irrtum, wie sich
herausstellen sollte.
Nach den Informationen von HH, S. 234 gibt es im
Kumari Bahal eine Bildergalerie mit allen bisherigen Kumaris und es gibt
auch die alljährliche Tradition, die ehemaligen Kumaris einzuladen,
die die meisten ehemaligen auch annehmen. Sie erhalten auch eine lebenslange
Rente, die, gemessen am Durchschnittseinkommen, auch nicht zu verachten
ist. HH, S. 234 berichtet von solch einem alljährlichen Treffen ehemaliger
Kumaris:
"Als die Mädchengöttin den Raum betritt,
verstummen die Frauen an der langen Tafel. Sie respektieren die derzeitige
Dyo
Maiju als die, was auch sie einst waren - als lebende Inkarnation der
Göttin Taleju (oder nach buddhistischer Lesart
die der Göttin Vajra Devi). Alljährlich
am zweiten Tag des Indra-Jatra-Festes
werden die ehemaligen Mädchengöttinnen Kathmandus in den Kumari
Bahal eingeladen, um in Anwesenheit der Mädchengöttin das
Abendessen einzunehmen. Sie wissen, dass die Kumari bereits gespeist hat,
denn bekanntlich ist es niemandem gestattet, die Mahlzeit mit ihr gemeinsam
einzunehmen. Schließlich hat eine jede von ihnen einst dort auf dem
roten Kissen an einem seperaten Tisch den jeweiligen Vorgängerinnen
stumme Gesellschaft geleistet. Zehn ehemalige Kumaris zwischen zwanzig
und zweiundachtzig Jahren sind auch in diesem Jahr der Einladung in das
Wohnhaus ihrer Kindheit gefolgt.
In der Vergangenheit hatte man die Mädchengöttin
im Unklaren darüber gelassen, um wen es sich bei diesen Frauen handelt.
Sie hat aber auch nicht nachgefragt - weder wer diese Besucherinnen sind
noch, weshalb sie sich nicht vor ihr verneigen. Vor wenigen Tagen aber
wurde sie von Durga darüber aufgeklärt, dass alle diese Frauen,
die, wie schon in den Jahren zuvor, hier speisen werden, einst als Kumari
im Bahal gelebt haben. Dann hatte Durga sie auf jene Bildergalerie im langen
Gang des oberen Stockwerks aufmerksam gemacht, an der die Mädchengöttin
in all den Jahren achtlos vorübergegangen war.
»Dies sind die Bilder von sämtlichen
Kumaris, die jemals in diesem Palast gelebt haben, seit er im Auftrag von
König Jaya Prakash Malla vor über zweihundert Jahren erbaut worden
war«, hat Durga zu ihr gesagt. Danach hat die Kumari sie der Reihe
nach betrachtet, Die [<234] meisten Porträts sind nur als Zeichnungen
vorhanden, doch die letzten zwölf Kumaris existieren bereits als Fotografie.
Seither konnte die Mädchengöttin nicht mehr an der Kumari-Galerie
vorbeigehen, ohne die auf gleiche Weise geschminkten Mienen ihrer zahlreichen
Vorgängerinnen zu mustern."
HH, S. 235, fühlt sich in Amitas damalige Gedanken
ein und projiziert (im Buch sind solche Passagen immer kursiv gesetzt und
in einem eigenen Absatz dargestellt) wie folgt:
"Die Kumaris auf den Bildern dort oben
sind alles Mädchen. Diese Frauen hier aber sind gar keine Mädchen.
Die junge Frau, die gleich rechts von ihr sitzt, erkennt sie sogar wieder.
Sie ist die, die auf dem letzten Foto abgebildet ist. Da war sie noch ein
kleines Mädchen ...
Sie blickt in die Gesichter der anderen. Aber
sie kann diese nicht gut erkennen, weil keine dieser Frauen zu ihr hersieht
... Warum aber sind diese Frauen denn keine Kumaris mehr? ... Sie sind
ja auch keine Mädchen mehr!? ... Kann man denn nur eine Kumari sein,
wenn man ein Mädchen ist? Natürlich, denn es heißt ja Dyo
Maiju - Mädchengöttin! Und wenn sie selbst kein Mädchen
mehr sein wird ...? Irgendwann hört sie ja auch mal auf, ein Mädchen
zu sein! Wird sie dann keine Kumari mehr sein? Was aber wird sie stattdessen
sein? Solange sie zurückdenken kann, ist sie die Kumari und wohnt
mit Durga-didi hier im Bahal, Wo aber soll sie dann wohnen? Wo wohnen denn
alle diese Frauen? Auf diese Fragen findet sie keine Antwort. Aber Durga-didi
wird niemals zulassen, dass sie woanders wohnt. Vielleicht aber wird sie
ja nie etwas anderes sein, als ein Mädchen — und deshalb kann sie
vielleicht auch immer die Kumari bleiben. Sie hält es für möglich,
dass bei ihr alles anders sein wird als bei diesen Frauen — auch wenn sie
nicht weiß, warum."
Obwohl die Nachfolgerin - Preeti - schon ausgewählt war,
weiß Amita immer noch nichts davon, dass ihre Tage im wahrsten Sinne
des Wortes gezählt sind. Durga-Didi, die
vertraute Tochter des Chitaidar, mit der sie in einem Bett schläft,
hatte es bislang nicht fertig gebracht, es ihr zu sagen. Aber sie erfährt
es von einer ehemaligen Kumari, die nach dem alljährlichen Jahrestreffen,
bei einer der üblichen morgendlichen Sitzungen in den Thronsaal kommt.
HH, S. 42 schildert:
"Endlich kniet die alte Frau vor der Kumari nieder,
verbeugt sich tief zu deren Füßen und spricht dann so leise,
dass sich die Mädchengöttin ihr ein wenig entgegenbeugen muss,
um sie zu verstehen.
»Ich war eine Kumari wie du. Das ist lange
her. Auch du wirst nicht mehr lange die Kumari sein. Deine Nachfolgerin
ist bereits ausgewählt, und schon bald wirst du den Bahal verlassen
müssen, Aber habe keine Angst, das Leben draußen ist schön,
es gibt viel zu entdecken.«
Dann erhebt sich die alte Dame und erst jetzt, als
sie in Richtung Ausgang läuft, wird sie von der Chitaidar erkannt.
Sie sieht der alten Ex-Kumari hinterher und schaut schließlich mit
irritiertem Blick zur Dyo Maiju.
[<242]. HH projiziert:
"Die wenigen Worte der fremden alten Frau haben
sie vollkommen verwirrt. Woher will diese Frau denn wissen, dass es schon
eine Nachfolgerin gibt? Sie glaubt es nicht, denn das hätte Durga-didi
ihr doch gesagt. Außerdem will sie ja gar nicht weg von hier. Will
lieber nichts anderes anziehen als die rote Kleidung der Kumari, will lieber
nichts sehen von dieser Welt da draußen, wenn sie danach nicht wieder
hierher zurückdarf.
Vielleicht ist diese alte Frau ja verrückt,
wie die Frau, die damals an Indra Jatra immer neben dem Wagen herlief und
»Talejuuuuu!« brüllte. Damals hat der Thuloba gesagt,
dass diese Frau verrückt sei, und Durga-didi
hat ihr dann erklärt, was das bedeuten würde. Eine Krankheit
im Kopf, wenn man alles anders sieht, als es wirklich ist. Und wenn man
Dinge erfindet, die es gar nicht gibt. Wahrscheinlich hat diese Frau eine
Nachfolgerin nur erfunden ...
Aber diese Frau hatte als Kumari ja irgendwann
auch mal eine Nachfolgerin, und diese Nachfolgerin auch wieder eine. Deshalb
sitzen ja an Indra Jatra so viele Frauen am Tisch, die alle mal eine Kumari
waren.
Warum schaut die Thuloma sie so merkwürdig
an? Hat sie vielleicht gehört, was die alte Frau zu ihr gesagt hat?
Und weiß die Thuloma etwas, was sie nicht weiß?
Zum ersten Mal in ihrem Leben spricht sie selbst
eine Fürbitte ... ganz leise, und sie bewegt dabei kaum die Lippen.
Und weil sie damit ja nicht zu einer Kumari gehen kann, wendet sie sich
direkt an Taleju. Sie bittet die Göttin, dass sie nie von hier fort
muss und immer bei Durga-didi bleiben kann und bei Garima und den Jungen.
Und auch bei der Thuloma und dem Thuloba
und dem kleinen Tinku.
Plötzlich fühlt sie sich ganz stark.
Sie spürt, wie die Taleju sie erhört und ihr verkündet,
schon in wenigen Tagen in der »Schwarzen Nacht« wieder als
die Göttin Durga bei ihr zu erscheinen — drüben in dem dunklen
Tempelraum Aadhyro Kotha. Und am Tag darauf werde unten — genau ein Stockwerk
unter diesem Thronsaal - wie in jedem Jahr ihr Geburtstag gefeiert werden,
und sie werde auch dann noch immer die Kumari sein. [<243]
Die Ablösung wurde dann nach dem Massaker im
Königshaus und drei Wochen nach der Krönung des neuen Königs
für alle überraschend zu einem Zeitpunkt verfügt, mit dem
niemand mehr gerechnet hatte. HH, S. 300 berichtet:
"Im Kumari Bahal war man von dem Anruf aus dem Narayanhiti
Durbar ziemlich überrascht. Am Krönungstag hatte man durchaus
noch mit einer Ablösung der Dyo Maiju gerechnet. Nicht nur wegen ihres
seltsamen Verhaltens am goldenen Fenster. Der Wechsel auf dem Thron bedeutet
schließlich generell eine Erneuerung für das Land. Weshalb also
sollte dem neuen König nicht auch eine neue Kumari zur Seite gestellt
werden? Das aber war nicht geschehen, und deshalb hatte in der Familie
der Chitaidars bald niemand mehr damit gerechnet, dass dies noch vor dem
nächsten Dashain-Fest passieren würde. Schon gar nicht in der
nun beginnenden Zeit der starken Regenfälle. Dann aber kam der Anruf
mit der nüchternen Mitteilung, dass in fünf Tagen drüben
im Mul Chowk eine außerordentliche Durga-Puja angesetzt sei, um die
kleine Preeti Shakya als neue Kumari zu inthronisieren.
Dem Chitaidar war nun die Aufgabe zugefallen, nacheinander
die Eltern der aktuellen wie der künftigen Mädchengöttin
in den Kumari Bahal zu bitten und sie davon in Kenntnis zu setzen. Seine
Tochter Durga sah sich außerstande, an diesen Gesprächen teilzunehmen.
Sie musste erst mal selbst damit zurechtkommen, dass sie sich nun derart
überraschend von dem geliebten Mädchen an ihrer Seite trennen
muss. Erst am Abend hatte sie ihre Emotionen so weit im Griff, dass sie
mit der Dyo Maiju über das sprechen konnte, was die Entscheidung des
Palastes nun für sie beide bedeuten würde.
Die Kumari hatte die Nachricht dann erstaunlich
ruhig aufgenommen und sogar die Größe gehabt, Durga zu trösten.
Sie zeigte auf Binas Globus, auf das kleine Land Nepal und erklärte:
»Sieh mal, auf dieser großen Welt ist unser Land so klein.
Da sind wir ja in der Nähe und wir können uns auch immer sehen.«
Durga nahm das Mädchen in den Arm und schwieg.
Wie hätte sie es auch bei so viel kindlichem Optimismus übers
Herz bringen sollen, der Kumari zu erklären, dass ihre beiden Familien
mittlerweile hoffnungslos zerstritten waren, was eine Fortführung
der Beziehung nahezu unmöglich machte?
Der unaufhörliche Besucherstrom der Gläubigen
hat nach dem Tod von König Birendra kaum nachgelassen. Trotz der beginnenden
sommerlichen Regenfälle finden sie Tag für Tag den Weg in den
Kumari Bahal. Die Mädchengöttin ist für viele zur Identifikationsfigur
in einer allgemeinen Orientierungslosigkeit geworden - zu einem Symbol
für die Kontinuität traditioneller Werte in einer sich verändernden
Gesellschaft, in der selbst ein Königsmord möglich ist.
Keiner von diesen Menschen hier weiß, dass
dies der letzte Tag ist, den sie auf diesem Thron verbringt. Aber alle
diese Menschen werden es morgen erfahren. Durga-didi hat gesagt, dass es
der Königspalast am Abend bekanntgeben wird. Solange sie zurückdenken
kann, ist sie die Kumari. Und nun wird schon morgen ein anderes Mädchen
hier sitzen. Sie aber wird dann fort sein, in einem fremden Haus mit fremden
Menschen. »Es gibt viel zu entdecken«, hatte die alte Frau
vor ein paar Monaten gesagt. Sie aber hat Angst davor, da draußen
etwas Neues zu entdecken. ..."
Die Rückkehr,
die Verarbeitung und das Leben danach
GEOlino.de
fasst in "Das Leben nach der Gottheit" verallgemeinernd zusammen: "Etwa
alle zehn Jahre besteigt ein neues Mädchen den Thron im Kathmandu-Palast.
Dann beginnt für die Ex-Kumari ein neues Leben außerhalb des
Palasts. Zurück bei ihren Eltern muss die Ex-Göttin ganz von
vorne anfangen. Von nun an wird sie zur Schule gehen und mit dem nepalesischen
Alltag zurechtkommen müssen. Mittlerweile hat man erkannt, dass es
ein großes Handicap für die Ex-Kumari ist, jahrelang isoliert
gelebt zu haben. So lehren die Priester sie bereits im Palast lesen und
schreiben. Auch ihre Eltern darf sie gelegentlich sehen.
Viele der jungen Frauen heiraten im späteren
Leben nicht [RS: siehe aber]. Denn viele
nepalesische Männer haben Angst vor einer Frau, der göttliche
Kräfte nachgesagt werden. Und selbst wer nicht an die Übernatürlichkeit
der Ex-Kumari glaubt: wie kann eine Frau, die jahrelang von tausenden Menschen
angehimmelt wurde, eine gute Ehefrau sein? So jedenfalls denken viele Nepalesen."
[RS: siehe aber].
Marie-Sophie Boulangers
Eindrücke
B, S. 185 (fett RS): "Ich sitze neben den steinernen Löwen, die
den Eingang zum Kumari House bewachen, und denke an all die ehemaligen
Göttinnen, die aus diesem Tempel in einem Zustand fortgeschickt wurden,
der nicht allein auf ein verändertes Leben zurückzuführen
ist, so radikal und schmerzlich es auch sein mochte. Das ist allerdings
die Erklärung, die in den wenigen Artikeln auftaucht, in denen von
der verheerenden Verfassung ehemaliger Kumaris die Rede ist: Es sei eine
verständliche »Ernüchterung«, verursacht durch die
Rückkehr in ein normales Leben, der Alltag einer Sterblichen nach
einem Leben als Göttin, die es gewöhnt war, dass sie angebetet
wurde und man ihren Befehlen stets Folge leistete. Mir scheint jedoch,
dass die Schwierigkeiten der früheren Kumaris anderer Natur sind.
Sie
verweisen auf ein sehr tief reichendes, seelisches Leiden, mit schweren
und sichtbaren Folgen für ihre Beziehung zu anderen Menschen. Eigenartigerweise
scheint das Problem in meinen Augen vor allem die ehemaligen Kumaris von
Kathmandu zu betreffen, die alle besonders ausgeprägte Symptome seelischer
Verkümmerung und allgemeiner Teilnahmslosigkeit zeigen."
An der unzulänglichen Vorbereitung und Ernüchterung
bei der Rückkehr ins "normale Leben", das die Kumaris nicht kennen,
gibt es aus meiner Sicht - NepalesInnen mögen das anders sehen - zwar
keinen Zweifel, aber die allgemein postulierte These eines tief reichenden,
seelischen Leidens wird von Boulanger unzulänglich belegt und
steht sogar im Widerspruch zur tatsächlichen Geschichte ehemaliger
Kumaris, wenn man sich vergegenwärtigt, dass unverheiratet sein und
keine Kinder haben erst bei den jüngeren Kumaris aufzutreten scheint
(wenn die Informationen stimmen),
also erst etwa ab 1990 [siehe].
Amitas
(1991-2001) Rückkehr, Verarbeitung und das Leben danach.
(HH, S. 313 ff)
Eine Kumari weint niemals, das hat sie gelernt. (HH, S. 239)
HH, S. 321f berichtet: "Am dritten Tag in Itumbahal
ist es Mimita Shakya erstmalig gelungen, mit ihrer Tochter allein zu sein.
Sie hatte sich mit diesem Wunsch an ihre Gastgeberin gewandt und damit
bei der einfachen Frau, die wie sie selbst aus der Shakya-Kaste stammt,
Verständnis gefunden. Nachdem der kleine Sougat von seiner Mutter
abgeholt worden war, hat die Frau des Hauses die Tür für Besucher
geschlossen und sich mit Bina und den anderen Familienmitgliedern in die
Küche zurückgezogen.
Seit fast einer Stunde sitzt nun die Kumari am letzten
Abend ihrer göttlichen Existenz mit ihrer leiblichen Mutter im selben
Raum und verweigert das Gespräch. Mimita weiß nicht einmal,
ob ihre Tochter überhaupt zugehört hat, als sie vorhin von dem
Haus erzählte, in dem sie ab morgen leben wird, und von der Familie,
die sie [<321] dort schon sehnsuchtsvoll erwartet. Die Fragen
jedenfalls, die sie ihrer Tochter gestellt hat, blieben allesamt unbeantwortet.
...
»Es sind nur wenige Wolken da, dann gibt es
morgen nicht so viel Regen ...«, versucht Mimita abermals mit ihrer
Tochter in Kontakt zu treten. »Dann können wir dein Abschlussfest
dort unten in dem großen Hof feiern!«
Das Abschlussfest?! Sie weiß selbst nicht,
warum sie sich darauf nicht freuen kann. Sie freut sich, dass Durga-didi
morgen kommen wird. Jedenfalls hat Durga-didi ihr das versprochen. Aber
sie hat auch Angst vor diesem Abschlussfest. Denn sie weiß ja, dass
damit dann endgültig alles aus ist, was bisher ihr Leben war. Die
Frau dort drüben, die ihre Ma ist, hat sie gefragt, ob sie neugierig
sei auf das Haus und auf das Zusammenleben mit ihrer Schwester ... Sollte
sie ihr sagen, dass sie vor allem traurig ist, weil sie ihren Khopi
verlassen musste und Durga-didi und Garima ... und auch den kleinen Tinku,
mit dem sie durch den großen Bahal toben konnte, ohne gleich an der
nächsten Wand anzustoßen?
Ihre Ma hat erzählt, dass man in diesem
anderen Haus immer die Terrassentür schließen muss, weil sonst
die Affen in die Wohnung kommen, und dann hat ihre Ma gesagt, dass die
Familie selbst die Tiere angelockt hätte, [<322] weil alle immer
den Affen vom Dach aus Bananen zugeworfen haben. Und dann hat ihre Ma gefragt,
ob sie die Affen auch mal füttern will? Aber sie hat ihr nicht geantwortet.
Sie weiß nicht, was sie sagen soll, und sie weiß nicht, wie
sie es sagen soll. Sie hat noch nie mit fremden Menschen gesprochen. Alle
Menschen, mit denen sie in ihrem ganzen Leben geredet hat, waren die Menschen,
mit denen sie zusammenwohnte und die sie jeden Tag sah. Diese Frau aber,
die ihre Ma ist, ist ihr ganz fremd. Obwohl diese Frau sie im Kumari Bahal
manchmal auf den Schoß genommen hat. Von nun an wird sie sie jeden
Tag sehen, und gerne würde sie mit ihr sprechen, denn ihre Ma ist
schön und fröhlich und auch sehr nett. Manches fällt ihr
ein, was sie ihr sagen könnte - aber sie weiß nicht, wie sie
mit dieser Frau dort sprechen soll ... "
Als sehr hilfreich erweist sich, dass ihre Tante
Bina, die sie die letzten drei Jahre im Kumari Bahal - dank des Einsatzes
ihres Vaters - unterrichtete, bei ihrer Rückkehr mit im Hause ist.
So sind nicht alle fremd. Doch sehr mühsam muss sie die einfachsten
Sachen des Alltags lernen. Diese Vorbereitung und Unterrichtung erleichterte
das Zurechtkommen in der Schule erheblich. HH, S. 379 berichtet:
"Für die meisten ihrer Mitschüler schwebte
Amita in den ersten Monaten schlichtweg in anderen Sphären. Dabei
spielten sich deren Gedanken durchaus im Diesseits ab: etwa acht Kilometer
südöstlich, um genau zu sein - in. einem newarischen Klosterbau
aus dem 18. Jahrhundert. Die pensionierte Mädchengöttin hatte
sich noch nicht von ihrer Kindheit verabschiedet - nicht vom Leben im Kumari
Bahal, nicht von Durga, ihrer Dienerin, und nicht von den Kindern, mit
denen sie aufgewachsen war. Ihre Gedanken waren ausschließlich rückwärts
gewandt. Schließlich hatte sie im Kumari Bahal, wo ein Tag gleich
dem anderen verlief, auch nicht gelernt, nach vorn zu blicken.
In ihrer Klasse fand sie lange keinen Kontakt zu
Mitschülern - suchte ihn aber auch nicht. Selbst ihrer Banknachbarin,
die als Klassenbeste immer wieder nachgefragt hatte, ob sie helfen könne,
war sie die Antwort regelmäßig schuldig geblieben. In den Pausen
stand Amita allein auf dem großen Hof herum, und für die von
der Schule angebotenen Freizeitaktivitäten hatte sie sich gar nicht
erst eingetragen.
Eines Tages war dann Ganga in die Klasse gekommen,
deren Familie kurz zuvor nach Swayambhu gezogen war. Sie wusste zu diesem
Zeitpunkt nicht, dass sie fortan die Schulbank mit einer ehemaligen Kumari
drücken würde. Doch das schüchterne Mädchen hatte schnell
erkannt, dass es innerhalb des Klassenverbandes scheinbar festgefügte
Freundschaften gab. Ganga traute sich nicht, jene Klassenkameradinnen anzusprechen,
die während der Pausen in Dreier- oder Viergruppen beieinander waren.
Daher suchte sie die Nähe zu dem Mädchen, das immer ganz allein
am Rand des Schulhofs stand. Und da Amita auf sie einen noch schüchterneren
Eindruck machte,
[<379] gewann Ganga ihr gegenüber schnell an Selbstvertrauen
und Eloquenz.
Der Banknachbarin von Amita war deren Annäherung
nicht verborgen geblieben, und sie bot an, ihren Platz mit dem von Ganga
zu tauschen. Langsam, aber konstant entwickelte sich eine zarte Freundschaft
zwischen den beiden Außenseiterinnen. Zunächst war sie nur auf
den schulischen Kontakt beschränkt, da Amita außerhalb der Schulstunden
noch immer nicht ohne ein Familienmitglied das Haus verließ. Ganga
zeigte großes Interesse an den Naturwissenschaften, und Amita interessierte
sich seit dem Tag, an dem Bina mit dem Globus aufgetaucht war, für
Geographie. Die Freundschaft erlebte schließlich auch die gegenseitige
Unterstützung beim Bewältigen des Schulstoffs. Zum ersten Mal
wurde Amita nicht als Kumari wahrgenommen, sondern als ein ganz normales
Mädchen. Sie genoss diesen Status. Aber Amita hatte eine heimliche
Sorge. Die Sorge nämlich, dass sich Ganga ihr gegenüber verändern
oder vielleicht sogar abwenden würde, wenn sie erführe, dass
ihre neue Freundin eine ehemalige Mädchengöttin ist. Auf gar
keinen Fall sollte Ganga sie deshalb zu Hause besuchen, wo all diese Kumari-Bilder
an den Wänden hängen und sie von der Familie als Dyo Maiju angesprochen
wird. Irgendwann aber hatte sich diese Sorge durch einen einzigen, kurz
hingeworfenen Satz der Freundin in Luft aufgelöst: »Das hätte
ich mir früher nicht denken können, dass ich einmal in der Schule
neben dem Mädchen sitze, das ich an Indra Jatra immer im Fernsehen
gesehen habe.«
Damit war klar, dass Ganga ihre Vergangenheit kannte.
Es war aber auch klar, dass ihr das nicht allzu viel bedeutete, und schon
gar nicht würde es etwas an ihrer Freundschaft ändern. An diesem
Nachmittag war Amita der Normalität ein Stück näher gekommen
- und das fand sie schön."
Als wichtige Integrationshilfe in die Familie erwies
sich wohl das Befolgen der Empfehlung der Chitaidar (HH, S. 308) als sich
der Vater fragte: "Wie kann man die Dyo Maiju in die Familie integrieren
und dennoch auf deren, noch immer vorhandene Göttlichkeit Rücksicht
nehmen? Vom Chitaidar war in dieser Hinsicht keine Hilfe zu erwarten. Doch
dessen Frau hatte sie vor vier Tagen im Kumari Bahal kurz zur Seite genommen
und gesagt: »Feiert mit eurer Tochter möglichst schnell hintereinander
die newarischen Hochzeiten, das wird ihr helfen,
sich zu Hause einzuleben.«" Hierdurch ist sie ihrer Schwester Anita
wieder nahegekommen.
Das Buch schliesst mit dem Kapitel "Die Zeit danach"
(S. 373-396) ab, hier einige Auszüge (S. 383): "Drei Jahre und neun
Monate nachdem Amita als Kumari abgelöst worden war, stellte sie sich
in der Ganesh-Boarding-Highschool den Examensfragen einer staatlichen Prüfungskommission
- und kehrte eine Woche später in den Kumari Bahal zurück.
Bereits einige Tage zuvor war Durga bei Mimita und
Amrit Man Shakya erschienen und hatte sie davon in Kenntnis gesetzt, dass
Ami-[<383]ta telefonisch mit Garima für die Zeit nach der Prüfung
einen Besuch verabredet habe. Sie bat um Verständnis, denn schließlich
hätten die beiden Mädchen sich eine Weile nicht gesehen und Amita
»nach den Anstrengungen der letzten Wochen einen Urlaub verdient«.
...
(S. 384): "Der Gang durch den Kumari Bahal wurde
für Amita zur Rückkehr an den Ort ihrer Kindheit. Sie kannte
jeden Winkel des geräumigen Gebäudes und dessen Bewohner begrüßten
sie wie ein heimgekehrtes Familienmitglied - auch wenn Garima mittlerweile
eine Brille trug, Sourav und Gaurav — und ein wenig auch schon Sougat —
zu hochgewachsenen jungen Männern, die Thuloma
und der Thuloba sichtbar älter und Tinku spürbar ruhiger geworden
waren. Amita war mittlerweile fast genauso groß wie Durga, doch als
sie einander in den Armen lagen, es kam ihr vor, als hätten die letzten
drei Jahre und neun Monate nicht stattgefunden.
Aber Amita bekam auch überall und ständig zu spüren,
dass sie nicht mehr die Hausherrin im Kumari Bahal war. Sie schlief bei
ihrer Freundin Garima und nicht bei Durga, die das Bett im Khopi
natürlich mit der jetzigen Kumari teilt. Von den Gläubigen, die
an ihr vorbei die Treppe nach oben stiegen, um von der Mädchengöttin
die Tika zu empfangen, wurde sie kaum wahrgenommen. Und der Thronsaal war
für sie natürlich tabu — zumindest solange die Kumari auf dem
Löwenthron saß und ihrer göttlichen Mission nachging."
Es kommt einer ungewöhnlichen Begegnung zwischen
der amtierenden Kumari und Amita, die sich als ehemalige zu erkennen gibt.
HH, S. 388f, schildert u.a.: "»Hier setze ich mich manchmal hin«,
beginnt sie zu erklären, »weil mich dann nämlich niemand
sehen kann, aber ich kann alle Leute da draußen ganz genau beobachten!«
»Ich weiß!«
Die fast achtjährige Mädchengöttin
blickt Amita erstaunt an: »Woher denn?«"
Der Autor projiziert Amitas Gedanken (S. 388f):
"In diesem Moment wird ihr schlagartig klar, dass Durga-didi der Dyo
Maiju gar nicht gesagt hat, dass sie auch mal eine Kumari war. Was sollte
sie denn jetzt antworten? Sie konnte doch nichts Unwahres sagen. Vielleicht
weiß ja die Kumari noch gar nicht, dass sie irgendwann einmal gar
keine Kumari mehr sein wird — so wie sie es damals auch nicht wusste, bevor
sie es von dieser alten Frau erfahren hat, die auch mal eine Kumari war?!
Trotzdem war sie dieser alten Frau später dankbar - und vielleicht
will Durga-didi ja auch, dass es sie der der Kumari sagt?!
»Woher weißt du das?«, fragt die
Kumari beharrlich nach.
Amita zögert einen kleinen Moment, ehe sie antwortet:
»Weil ich dort auch oft gesessen habe ...
als ich noch die Kumari war.«
Die Mädchengöttin wirft die Stirn in tiefe Falten, während
sie ihre Vorgängerin fixiert. Der Blick wird Amita unheimlich, aber
sie hält ihm stand. Erst der Chitaidar erlöst die beiden Dyo
Maijus aus dieser stummen Konfrontation, als er von der Tür aus in
den Raum ruft: »Unten im Hof warten Leute auf dich, Dyo Maiju. Darf
ich dich ans Fenster ...«
»Nein!«, unterbricht ihn die Kumari
barsch, dreht sich energisch zu dem vergitterten Fenster um und blickt
angestrengt hinaus.
Wortlos zieht sich der Chitaidar wieder zurück. Nach einer kleinen
Weile dreht sich die Mädchengöttin zu Amita um: »Komm her!«
Amita nimmt neben ihrer Nachfolgerin auf jener kleinen Bank hinter
dem vergitterten Fenster Platz, auf der sie viele Jahre meist allein gesessen
hatte.
Nun will die kleine Mädchengöttin alles
von ihr wissen. Wie lange Amita im Kumari Bahal gewohnt hat und auf welche
Schule sie dann später gegangen und ob das Examen schwer gewesen sei.
Und als sie ihre Vorgängerin fragt, was sie nun nach dem Examen vorhabe,
antwortet Amita zu ihrem eigenen Erstaunen: »Ich werde Wirtschaft
studieren und danach will ich in einem Hotel arbeiten.«
Kommentarlos nimmt die Kumari diese Aussage als bereits feststehenden
Plan zur Kenntnis. Sie weiß nicht, dass Amita diesen »Plan«
soeben erstmalig formuliert hat. Und sie weiß auch nicht, dass diese
Vision exakt den angestrebten beruflichen Perspektiven von deren Schwester
Anita entspricht."
Rashmilas
(1986-1991) Rückkehr, Verarbeitung und das Leben danach
Darstellung Boulanger (B,
S. 182f)
"Ermutigt stelle ich Rashmila jetzt ein paar Fragen über ihr »voriges«
Leben als Göttin, Ihre Stimme ist nicht sehr selbstsicher, sie klingt
wie die eines kleinen Mädchens. Sie spricht über die morgendliche
Puja, über die Gläubigen, die sie in der Stille des Kumari House
aufsuchten, um sie zu verehren, über die gerneinsamen Spiele mit den
Kindern der Wächter. Als Nachfolgerin von Anita konnte sie bereits
fernsehen, was sie von Zeit zu Zeit auch tat. Die Wächterin kümmerte
sich um sie, kleidete sie an und begleitete sie überallhin. Aber vom
wirklichen Leben, das sich draußen abspielte, vom Lärm der Rikschas,
der gedämpft zu ihr hinüber drang, vom Geschrei der Menschen
und deren Liebesgeschichten hatte sie nie etwas gehört. Bis sie brutal
hineingestoßen wurde, als man der Göttin das hochgesteckte Haar
gelöst, ihr den heiligen Schmuck abgenommen und die Gewänder
und alles Übrige an eine andere weitergegeben hatte, an ein Kleinkind
von zwei Jahren, das man unmittelbar zuvor als die neue Inkarnation Talejus
ausgemacht hatte. Das war 1991, und der Palast hatte dem Volk von Kathmandu
offiziell verkündet, dass seine Göttin zwölf Jahre alt und
aus ihr eine Frau geworden sei. Vier Tage lang hatte sie im Haus ihrer
Eltern, wohin man sie zurückgebracht hatte, die Huldigungen der Gläubigen
entgegengenommen - eine sehr kurze Übergangszeit, in der sie nicht
mehr wirklich Taleju und auch noch kein gewöhnliches Mädchen
war. Am letzten Tag dann kam es bei einer Privatzeremonie zur Machtübergabe
zu einer Begegnung zwischen den beiden Kumaris. [<182]
Es war vorbei. Auf sie wartete ein neues Zuhause,
Eltern, an die sie sich kaum erinnerte: Sie war erst vier Jahre alt gewesen,
als sie auserwählt worden war.
Die Beschreibung ihrer Rückkehr nach Hause
erinnert in jeder Hinsicht an das, was Anita mir berichtet hat. »Alles
war neu, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartete. Und ich hatte
Angst vor der Welt draußen, ich wusste nicht einmal, wie man über
die Straße geht!« Ihre Schwester Pramira, die noch immer neben
ihr sitzt, hört mit besorgtem Blick aufmerksam zu, wie sie von ihrem
früheren Leben erzählt, jederzeit bereit einzugreifen. Jeder
aus der Familie tritt wie ein liebevoller Beschützer auf, als gehe
es um ein krankes Kind oder einen Menschen, der gerade einen Schock erlitten
hat.
Nach langem Zögern stelle ich Rashmila schließlich
dieselbe Frage wie Anita: Hätte sie gern eine Tochter, die später
auch einmal Kumari werden sollte? Schlagartig schweigt Rashmila. Sie senkt
den Kopf und knetet ohne zu antworten ihre Hände. Die Stille wird
drückend. Pramira wechselt redselig zu einem anderen Thema, und alle
scheinen aufzuatmen.
Es ist das zweite Mal, dass diese Frage bei einer
ehemaligen Kumari diese Reaktion hervorruft. Warum? Von Rashmila erfahre
ich nichts mehr. Ist das Leben einer früheren Kumari so sehr von ihrer
Kindheit geprägt, dass sie für immer schweigen und das Geheimnis
wahren muss?"
Darstellung Haase-Hindenberg
(HH, S.377-379, fett von RS)
"Zwei Kumari-Generationen nach Nani war mit Rasmila Shakya ein sehr
schüchternes Mädchen auf den Löwenthron gekommen, wenngleich
die Chitaidar-Familie von Anfang an keine fremden Leute für sie gewesen
waren. Die Chitaidar ist die Schwester ihrer Mutter, und sie war Rasmila
damals durchaus bekannt. Nahezu unbekannt hingegen waren ihr acht Jahre
später die leiblichen Geschwister, mit denen sie nach der überraschenden
Ablösung zusammentraf. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb war
die Rückkehr in die Familie von ihr keineswegs als freudiges Ereignis
empfunden worden. Vielmehr hatte sie wochenlang in der elterlichen Wohnung
mit niemandem ein Wort gesprochen. Sowohl mental als auch gefühlsmäßig
war es ihr sehr lange unmöglich gewesen, das Ende ihrer göttlichen
Existenz zu akzeptieren. Das Mädchen hatte stumm vor sich hin
gestiert, hat seitdem immer schwitzende Hände und bald
war oberhalb ihrer Schläfen kreisrunder Haarausfall sichtbar
geworden. In der Familie hat man von »einer schweren Zeit«
gesprochen, »die vorübergehen« werde. Dennoch waren den
Eltern zeitweilig Zweifel gekommen, ob es richtig gewesen sei, der Anweisung
von Pramila - ihrer ältesten Tochter - zu folgen und Rasmila fortan
nicht mehr als Dyo Maiju, sondern mit jenem Namen anzusprechen, der ihrer
Tochter fremd sein musste. Für häusliche Arbeiten wurde die heimgekehrte
Rasmi-[<377]la jedoch nie herangezogen. Ihre Mutter hat sich beharrlich
geweigert, sie dafür einzuteilen. Denn sie vertrat die Auffassung,
wenn Rasmila sich daran beteiligen wolle, würde sie es schon sagen.
Davon aber war das Mädchen weit entfernt, und kaum jemand in ihrer
Umgebung nahm zur Kenntnis, dass es augenscheinlich an einer schweren
Depression litt - außer Pramila. Sie war als älteste von
vier Geschwistern schon früh zu einer Art Leitfigur für die anderen
geworden - mit Ausnahme ihrer fünf Jahre jüngeren Schwester Rasmila.
In der Zeit von deren Abwesenheit hatte Pramila als beste Absolventin ihrer
Highschool den Schulabschluss geschafft. Mittlerweile studierte sie mit
Hilfe eines staatlichen Stipendiums Mathematik und Physik. Pramila - traditioneller
Familienmensch und emanzipierte Intellektuelle in einer Person — hatte
damals mit ihrer kleinen Schwester gesprochen, auch wenn diese nicht antwortete.
Sie hatte ihr von einem lebenswerten Leben außerhalb des Kumari Bahal
berichtet, selbst wenn die Ex-Kumari gar nicht zuzuhören schien. Sie
hatte Rasmila vorgeführt, dass man mit Zahlen mehr machen konnte,
als sie zu addieren oder zu subtrahieren, und schließlich in den
Augen ihrer jüngeren Schwester so etwas wie interessierte Aufmerksamkeit
registriert. Dem waren bald Rasmilas erste Worte und Sätze gefolgt
und an Pramilas Seite die ersten zaghaften Schritte in die als feindliche
Welt empfundenen Straßen von Kathmandu.
Vor allem aber war Rasmila irgendwann bereit, sich
von der Schwester in Rechnen, Schreiben und der nepalischen Hochsprache
prüfen zu lassen. Das Ergebnis war katastrophal. Das zwölfjährige
Mädchen beherrschte kaum den Stoff der zweiten Klasse. In regelmäßigen
Unterrichtsstunden bereitete Pramila neben ihrem Studium die Schwester
darauf vor, ab dem nächsten Schuljahr die zweite Klasse zu besuchen.
Neun Schuljahre standen der ehemaligen königlichen Kumari von
Kathmandu in einem Klassenverband bevor, in dem sämtliche Mitschüler
mindestens vier Jahre jünger waren als sie selbst. Keine gute Voraussetzung
für soziale Kontakte, weshalb Rasmila sich immer enger an der älteren
Schwester orientierte, die ihr den Weg aus der Sinnkrise gezeigt hatte."
Da bleibt nur noch zu sagen: Ein dreifaches Hoch auf Pramila!
Das ist eine Schwester.
Anitas
(1979-1986) Rückkehr, Verarbeitung und das Leben danach (B, S.
168-175).
B. S. 169: "... Anita Shakya gibt an, zwanzig Jahre alt zu sein, aber
sie wirkt etwas älter. Unweigerlich vergleiche ich die lächelnde,
gepflegte junge Frau, die sie jetzt ist, mit dem heranwachsenden Mädchen
mit dem traurigen, verschlossenen Gesicht, das ich auf den Fotos gesehen
habe, die unmittelbar nach ihrer Absetzung entstanden. Damals, so heißt
es, sei sie ausgesprochen einsilbig gewesen und habe nie gelächelt.
Sumitra, die ihr damals begegnet war, bestätigt mir, dass sie sich
sehr verändert habe. Die ehemalige Kumari antwortet bereitwillig auf
meine Fragen, bewahrt aber weiterhin ihre Zurückhaltung und hat den
Blick meistens auf den Boden gerichtet. ...
B. S. 172: "Anita berichtet jetzt von ihrer Rückkehr
ins Elternhaus. Sie hatte kaum noch Erinnerungen an ihre Familie. Sie musste
sich daran gewöhnen, mit diesen Menschen zusammenzuleben, die sie
nicht kannte, sich neue Gewohnheiten aneignen und einer fremden Umgebung
anpassen. Die Wiedereingewöhnung fiel ihr sehr schwer.
Und wie hat ihre Familie die Rückkehr ihrer
einst göttlichen Tochter erlebt? Da sie als einziges Kind zur Kumari
auserwählt worden war, gesteht Anita, eine besondere Stellung genossen
zu haben: »Mein Vater sieht in mir immer noch ein bisschen die Göttin
und redet mit mir anders als mit den anderen.« Die Großmutter,
die das Gespräch, von Anfang an mitverfolgt hat, nickt energisch in
bestem Newari. Ihr kleiner Bruder, ein aufgeweckter Teenager, der sehr
gut Englisch spricht, bestätigt mir später, dass allen unwohl
war beim Gedanken an Anitas Rückkehr. Er selbst hatte sie außer
bei den öffentlichen Zeremonien noch nie gesehen. »Ich war beeindruckt«,
sagt er, »und ich wusste nicht so genau, wie ich mich verhalten sollte.
Jetzt bin ich nicht mehr so unsicher, aber sie wird für mich nie wie
eine normale Schwester sein.« [<172] ...
Heute verbringt Anita die meiste Zeit zu Hause.
Ihre gepflegten Händen, die in modischem Blau lackierten Fingernägel,
die hübschen, Kajal geschminkten Augen und die rot angemalten Lippen
zeugen von dem ruhigen und zurückgezogenen Leben einer ehemaligen
Kumari, die es nicht allzu sehr in die Welt hinauszieht. Eine etwas fragile,
bemalte kleine Puppe, die weiß, wie nutzlos sie ist. Unter ihren
acht Brüdern und Schwestern ist sie die Einzige, die nicht studiert
hat und kein Wort Englisch spricht. Sie erläutert, dass sie mit der
Schule aufgehört habe, bevor sie das hiesige Abitur geschafft hatte.
»Als ich Kumari war, konnte ich, wenn ich wollte, spielen anstatt
zu lernen. Und ich habe lieber gespielt. Jetzt finde ich das Leben schwierig,
man muss arbeiten. Vorher habe ich nichts gemacht, das war besser.«
...
Mit Fragen nach ihrer Zukunft halte ich mich zurück.
Was kann sie schon machen ohne jede Ausbildung und mit der Gewissheit,
nur schwer einen Mann zu finden? Ich prüfe ihr Geburtsdatum nach.
Anita ist nicht, wie sie sagt, zwanzig, sondern dreiundzwanzig Jahre alt,
was hier schon als etwas spät gilt, um zu heiraten. Verheimlichen
sie und ihre Familie deswegen ihr wirkliches Alter?
In Nepal ist die Verheiratung der Tochter ein vorrangiges
Ziel; eine unverheiratete Frau hat keinerlei Sozialstatus. Die Hindu-Gesellschaft
nimmt die Frau nur durch die Kuratel ihres Vaters und in der Folge ihres
Ehemannes hindurch wahr. [<173]
Die Furcht vor Ehelosigkeit ist so groß, dass
die Newar schon vor langer Zeit ein Mittel ersonnen haben, das es ihren
Töchtern ersparen soll, mittellos und gesellschaftlich gebannt zu
sein: die Ihi-Heirat.
...
Da ich Anita nicht allzu direkt fragen will, was
sie über ihre Hochzeit denkt, formuliere ich es anders. Würde
sie eines Tages gern Kinder haben, gar ein Mädchen, das dann Kuma-ri
wäre? Nein. Die entschlossene, ernste Antwort überrascht mich.
Schweigen. Anita fügt hinzu, sie wolle nicht heiraten. Sumitra und
ich sehen uns betroffen an. Für eine junge nepalesische Frau ist das
eine erstaunliche, fast ungehörige Ant-[<174] wort. Die Familie,
die das Gespräch bislang durch ihre Kommentare mitgeprägt hat,
bleibt jedoch eigenartig stumm. Es ist wohl nicht das erste Mal, dass Anita
ihre Entscheidung kundtut.
Erneut macht sich Unbehagen breit, wie vorhin schon
einmal, als ich mich nach den Gründen ihrer Absetzung erkundigt habe.
Sollte ich schon wieder ein Tabu angesprochen haben?
Anita ist jetzt sorgfältig geschminkt, die
hellen Henna-Reflexe spielen auf ihrem offenen Haar. Jetzt ist sie fertig
für die Fotosession. In der Zwischenzeit hat ihre Familie stolz posiert.
Das Mädchen ist immer noch sehr hübsch, aber sieht plötzlich
wieder dem sorgenvollen Teenager früherer Jahre ähnlich. Fotografiert
wird nicht auf dem Balkon, sondern nur im halbdunklen Haus, die ehemalige
Göttin hat Angst, »gesehen zu werden«. Aus der Kindgöttin,
die unter den bewundernden Blicken der Gläubigen lebte, ist eine Frau
geworden, die sich vor den Blicken anderer schützt. Hinter dem Lächeln
der hübschen bemalten Puppe verbirgt die Göttin Wunden, die noch
nicht verheilt sind."
Nanis
(1961-1969) Rückkehr, Verarbeitung und das Leben danach (HH, S.
373-377, fett RS).
"Der Wechsel in die nepalesische Alltagsrealität konnte kaum härter
sein, als Nani ihn nach dem Dashain-Fest von 1969 erlebt hatte. Es war
die Zeit, als die Kumari-Familien keinerlei finanzielle Unterstützung
vom Königspalast erhielten — weshalb sich Nanis Eltern so lange darüber
beschwerten, bis schließlich eine monatliche Apanage in Höhe
von zunächst 300 Rupien bewilligt worden war. Das hatte zwar kaum
für das Essen der heimgekehrten Tochter gereicht, war aber der Einstieg
in ein verändertes Bewusstsein, welches letztlich zur heutigen weitaus
großzügigeren Regelung geführt hat.
Für Nani jedenfalls hatte das privilegierte
Leben vier Tage nach der Rückkehr ins Elternhaus mit dem Tag geendet,
an dem sie die rote Kleidung der Kumari ablegte. Fortan musste sie sich
daran gewöhnen, dass man sie »Nani« und nicht mehr »Dyo
Maiju« rief. Ihre Mutter hatte sie umgehend mit den häuslichen
Arbeiten vertraut gemacht und sich auch nicht gescheut, das Mädchen
allein zum Einkaufen zu schicken. Natürlich war der Frau klar, dass
sich ihre solcherart unerfahrene Tochter schwer tun musste, sich draußen
unter all den fremden Menschen in dem verwirrenden Verlauf der Gassen zurechtzufinden.
Aber sie setzte auf jenes Prinzip, welches in ande-[<376]ren Ländern
»learning by doing« genannt wird, und glaubte letztlich, damit
Erfolg gehabt zu haben. Tatsächlich aber hatten die beiden Schwestern
von Nani vielerlei Hilfestellungen geleistet, waren mit ihr durch die Stadt
gelaufen und hatten sie mit den Gewohnheiten des Alltags vertraut gemacht.
Auch wenn die Ex-Kumari Nani Mayiu Shakya. nicht
verschweigt, dass sie diese radikale Umstellung ihres gesamten Lebens zeitweise
in tiefe seelische Krisen gestürzt hat, hält sie in der
Rückschau das Vorgehen ihrer Mutter für den einzig richtigen
Weg."
Psychologische Beurteilung
dieser Göttin-auf-Zeit-Erfahrung
Hier stellt sich natürlich als erstes die Frage, ob jemand aus
einem anderen Kulturkreis überhaupt in der Lage ist, einen solchen
religiös-kulturellen Brauch zu beurteilen? Auf den ersten entwicklungspsychologischen
Blick aus westlicher Sicht wird hier bei vielen entsetzte Ablehnung, wie
man Kindern so etwas antun kann, hervorgerufen. Aus medialer Sicht, die
gewöhnlich keine Skrupel kennt, ist
es eher ein Traum und eine willkommene Sensation, die sich - auch scheinheilig
gut getarnt - gut vermarkten lässt, weil die KonsumentInnen kurzfristig
starkes Interesse an solch außergewöhnlichen Schicksalen zeigen.
Die psychologischen
Gretchenfragen lauten:
Wie kann man Kind und Göttin gleichzeitig sein und sich entwickeln,
ohne Schaden zu nehmen?
Und wie ist der nepalesische Umgang der Verantwortlichen (Kumari-Komitee,
Königshaus) zu bewerten?
Was können wir für Bindung, Umgang und Kindeswohl daraus
lernen?
Bemerkenswerte
Sachverhalte im Widerspruch zur Bindungstheorie
"AmitasVater hat mir später erzählt, dass sie schon vier
Wochen, nachdem sie Kumari geworden war, während seiner Besuche nicht
mehr mit ihm sprach. Als ich Amita danach frage, erklärt sie knapp:
'Ich wusste nicht, worüber wir reden sollten.'" (HH, S. 13)
Zusammenfasssung.
Den Kumaris wird aus entwicklungspsychologischer und aus bindungstheoretischer
Sicht vielfach schwerer Schaden zugefügt:
Erstens,
dass man ihnen überhaupt eine solche Aufgabe aufbürdet. Zweitens,
wenn sie aus ihren Familien im Kleinkindalter zwischen 3 und 4 Jahren aus
ihren Familien herausgerissen werden. Hier ist längst
eine tiefe Bindung entstanden, die, aus der Perspektive der kleinen Mädchen
gesehen, mir nichts, dir nichts ziemlich drastisch und nachhaltig aufgehoben
wird. Drittens, wenn den Mädchen und Eltern ein "normaler"
Umgang verweigert und durch die Priesterschaft und die Chitaidars verunmöglicht
bzw. massiv behindert wird. Das hat natürlich auch mit dem Göttinnenstatus
der Kumaris zu tun, d.h. dieser Göttinnenstatus und das Kindeswohl
sind miteinander unvereinbar. Viertens, dass den Mädchen
eine angemessene Schulbildung während ihrer Kumari-Zeit verweigert
wird. Fünftens, dass ihnen die Kindheit geraubt wird.
Sechstens,
dass man sie nicht bei Zeiten auf die Endlichkeit ihrer Aufgabe vorbereitet.
Siebtens,
dass man sie ziemlich unvermittelt in ein Leben zurückwirft, mit dem
sie sich hinten und vorne nicht auskennen. Achtens, dass
sie keine angemessene Betreuung in der Zeit danach erhalten.
Bewertung.
Zwei in vielerlei Hinsicht interessante, ungewöhnliche und bemerkenswerte
Bücher für eine ganze Reihe psychologischer Disziplinen: Kulturpsychologie,
Religionspsychologie, Entwicklungs- und Sozialpsychologie, differentielle
Psychologie der Persönlichkeit, im besonderen für die Bindungstheorie
im Umfeld Kindeswohl und
Trennung
von primären Bezugspersonen, Fragen des Umgangs, Bedeutung von Kontinuität
und Stabilität.
Literatur (Auswahl)
Literatur zur Kumari
Allen,
Michael R. (1995) The Cult of Kumari: Virgin Worship in Nepal. Kathmandu:
Mandala Book Point.
Boulanger,
Marie-Sophie (2004). Die Göttin, die nie lächeln darf - Der geheimnisvolle
Kult der Kumari in Nepal. München: Goldmann. [ISBN 3-442-15269-0]
Bilddokumentation
Boulanger: (1) Rashmila Kumari von Kathmandu bis 1991. (2) Menschenmenge
auf den Tempelstufen des Durbar-Palastes, Männer von Frauen und Kindern
getrennt. (3) König und Königin grüßen 1998 vom Balkon
aus die lebende Göttin. (4) Während des Indra Jatra Festes wird
die amtierende Kumari streckenweise getragen. (5) Nur Männern ist
es gestattet, die Kumari zu begleiten, die reglos und in Gedanken versunken
auf ihrem Thron sitzt. (6) Seit Stunden fiebern die Kinder dem Durchzug
der kleinen Göttin entgegen. (7) Indra Jatra: Tantrische Pancha-Buddha-Priester
vor dem Haus der Kumari. Die fünf Farben stehen für die fünf
Urstoffe Wasser, Feuer, Luft, Erde und Äther. (8) Der Kumari Chowk
in Kathmandu, der Innenhof des Hauses, in dem die lebende Göttin wohnt.
(9) Die ehemalige Kumari Anita (1979 - 1986). (10) Die ehemalige Kumari
Rashmila (1986 - 1991). (11) Gemälde von David, einem nepalesischen
Maler, das die "kosmische Kumari" darstellt. (12) Chandra Shila, Kumari
von Patan, mit ihren "Insignien", dem Schlangenkollier und der Kette mit
den abgetrennten Köpfen. (13) Der Durbar-Platz in Patan. (14) Die
Göttin von Patan erteilt Marie-Sophie Boulanger die Tika, ein Gemisch
aus Reis und Zinnoberrot, das als Zeichen des Segens auf die Stirn aufgetragen
wird. (15) Jamuna, Kumari von Bungamati, bei einem Fest zu Ehren des Gottes
Bhairav. (16) Gonga, die Zwillingsschwester der Kumari Jamuna und selbst
ehemalige Kumari von Bungamati. (17) Die Göttin ist eingeschlafen....
(18) Die kleine Göttin ist bereit für die Zeremonie. (19) Anlässlich
des Dassain-Festes nimmt die Kumari von Bhaktapur die Opfergaben der Gläubigen
entgegen. Sie muss von allen Speisen, die ihr dargebracht werden, kosten.
(20) Prozession der Kumari von Bhaktapur, die von ihren Gana Kumaris umgeben
ist, den Kindern, die anlässlich von Dassain verschiedene Gottheiten
verkörpern. (21) Nachdenkliche Gesichter bei den Gana Kumaris, den
kleinen Göttinnen für einen Tag. (22) Drei Gana Kumaris warten
auf die Göttin von Bhaktapur, damit die Prozession beginnen kann,
Sie verkörpern Ganesh und zwei Muttergottheiten. (23) Überall
in der Stadt werden Altäre zu Ehren der großen Göttin errichtet.
Hier funkelt eine Schreckensmaske von Durga Kali im Licht der Fackeln.
(24) Ziegenopfer im Innenhof des kot
in Kathmandu am neunten Tag
von Dassain. (25) Dhana, genannt die "Old Kumari" von Patan, ist ein einzigartiger
Fall: Mit über 45 Jahren übt sie abseits des offiziellen Kults
noch immer ihre Funktion aus. (26) Die "Old Kumari" und ihre Mutter im
Kultraum ihres Hauses. (27) Die "Old Kumari". (28) Die zur Einäscherung
dienenden ghat in Pashupatinath, einer heiligen Hindu-Stadt in Nepal.
(29) Buddhistische Mönche in der untergehenden Sonne von Swayambhunath.
Haase-Hindenberg,
Gerhard (2006). Göttin auf Zeit. Amitas Kindheit als Kumari in Kathmandu.
München: Heyne. [ISBN-10: 3-453-12033-7, ISBN-13: 978-3-453-12033-4]
Bilddokumentation
Haase-Hindenberg: I. 128: (1) die eineinhalbjährige Amita mit
ihrer Schwester Anita. (2) Amitas Eltern zu Beginn von Amitas Kumari-Zeit.
(3) Kumari Bahal, der Wohnsitz der lebenden Göttin. (4) Der Haupteingang
zum Hof des Kumari Bahal, darüber das Bildnis der Göttin der
vielarmigen Göttin Durga. (5) Amita am Tag ihrer Inthronisation als
Kumari - noch muss die schwere Krone festgehalten werden [sehr ernst].
(6) Ramesh Prasad Pandey (Mul Purohit), hinduistischer Chefpriester des
nepalesischen Königs. (7) Uddav Karmachary (Mul Pujari), Hauptpriester
im Taleju-Tempel. (8) Mangal Raj Joshi, Chefastrologe des nepalesischen
Königs. (9) Puspa Ratna Bajracharya (Raj Guru), Oberhaupt der Pancha-Buddha-Priester.
(10) Die Panche-Buddha-Priester im festlichen Ornat mit den Symbolisierungen
der fünf Elemente: Erde, Himmel, Luft, Feuer und Wasser. (11 von außen
und 12 von innen gesehen) Eine mit Silber ausgeschlagene Hirnschale als
das Trinkgefäß, in dem der Kumari die alkoholischen "heiligen
Wasser" gereicht werden. (13) Am Indra-Jatra-Fest wird die Kumari zu ihrem
Prozessionswagen getragen, wobei ihre Füsse den Boden nicht berühren
sollen. Links unten: Bhairav, der Kindergott für einen Tag. (14) Amita
als Kumari auf dem Prozessionswagen, der Mann links mit der Brille der
Chitaidar [praktischer "Manager" der Kumari], am linken Bildrand Amitas
Vater. (15) Menschen auf den Stufen der Maju-Deval-Pagode, die die Vorbeifahrt
des Kumari Wagens verfolgen. (16) König Birendra am 4. Tag des
Indra-Jatra-Festes auf dem Weg zu seiner Kumari, um die Tika [farbiges,
meist rotes Zeichen auf der Stirn] und die Bestätigung für ein
weiteres Jahr als Regent zu erhalten. (17) Tempel der Göttin Taleju.
II. 288: (18) Vergittertes Fenster
durch das die Kumari in die Welt hinausblicken kann. (19) Schülerinnen
der benachbarten Nava-Adarsha-High-School auf dem Basantapur-Platz.
(20) Durga Shakya, Amitas Dienerin im Kumari-Palast, (21) Bina Bajracharya,
Amitas Cousine, die ihr im Kumari-Palast Unterricht erteilte. (22) Das
Schulzeugnis einer lebenden Göttin (mit Passfoto der Kumari). (23)
Januar 2001: Zur letzten Puja [hinduistisches Opfer- oder Kultritual] im
Machhindranath-Tempel mit den Enkeln des Chitaidar. (24) Zum Abschied erstmals
in privater Kleidung neben einem Taleju-Priester und dem Chitaidar. (25)
Amitas Nachfolgerin Preeti Shakya wird in der "Schwarzen Nacht" des Dasain-Festes
über weiße Tücher zur Durga-Puja in den Haupthof des Taleju-Tempels
geführt. (26) Die ehemalige Kumari Nani Maya Shakya (1961-1969), heute
Ehefrau und dreifache Mutter. (27) Die ehemalige Kumari Rasmila Shakya
(1983-1991), die Informatik studiert. (28) Amitas Eltern heute. (29) Amita
musste sich in Schuluniform an der Privatschule ihres Onkels erst an das
Lernen in der Gruppe gewöhnen. (30) Amita auf Entdeckungstour durch
Kathmandu. (31) Faksimile von Amitas Aufzeichnungen für die gemeinsame
Arbeit am Buch über ihre außergewöhnliche Kindheit. (32)
Amita wählt mit ihrer Schwester Fotos für das Buch aus. (33)
Während der Gufa, der 12 gemeinsamen Tage in der Dunkelheit, sind
sich die Ex-Kumari Amita und ihre Schwester Anita sehr viel näher
gekommen. (34) Vor dem Kumari Bahal erläutert die Ex-Kumari Gerhard
Haase-Hindenberg, wo und wie sich der Beginn der Indra-Jatra-Prozession
vollzog.
Merz, Brigitte
(2002). Bhakti und Shakti. Göttliche und menschliche agency im Kontext
des Heilkults der Göttin Hàratã in Nepal. Dissertation.
Vorgelegt an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaft
der Universität Heidelberg im Fach Ethnologie. [Volltext]
Fallbeispiel 2.1 Raj Kumari Shakya. URL: https://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/4599.
URN: urn:nbn:de:bsz:16-opus-45990.
Literatur
zum Religiös-Kulturellen Hintergrund
Literaturliste "Nepal
und Himalaya". Mehr Literatur in der Dissertation von Brigitte Merz.
Allgemeines
zur Gottes- und Religionsvielfalt:
Bellinger,
Gerhard J. (1999). Sexualität in den Religionen der Welt. Frechen:
Komet.
Lissner,
Ivar & Rauchwetter, Gerhard (1982). Der Mensch und seine Gottesbilder.
Freiburg: Olten.
Tworuschka,
Monika & Udo (1996, Hrsg.). Religionen der Welt. Grundlagen, Entwicklung
und Bedeutung in der Gegenwart. München: Orbis.
Fischer-Schreiber,
Ingrid; Ehrhard, Franz-Karl; Friedrichs, Kurt & Diener,
Michael S. (1995). Lexikon der östlichen Weisheitslehren: Buddhismus,
Hinduismus, Taoismus, Zen. München: Barth.
Majpuria,
T. C. & Gupta, S. P. (1981). Nepal, the Land of Festivals (Religious,
Cultural, Social and Historical Festivals). New Delhi: S. Chand.
Regmi, Jagadish,
C. (1991). The Kumari of Kathmandu. Kathmandu: .
Schumann,
Hans Wolfgang (1998 ). Buddhismus. Stifter, Schulen und Systeme. München:
Diederichs Gelbe Reihe
Toffin,
Gérard (1993). Le Palais et le Ternple. Paris:
Vaidya,
K. (1986). Buddhist Traditions and Culture of the Kathmandu Valley (Nepal).
Kathmandu: Sajha.
Zierer,
Otto (1985). Die grossen Weltreligionen. Hinduismus. Salzburg: Kiesel.
Links (Auswahl: beachte)
Buch Allen:
"About the book: Kathmandu, Newar Buddhist girls as young
as two years old are selected to become living incarnations of the Hindu
goddess Taleju. Called 'Kumaris', the children are worshiped daily by both
priests and laity and until some sign of imperfection appears, most commonly
with the onset of menstruation, they are required
to live in accordance with a rigorous code of purity maintenance. In this
book Dr. Allen provides a detailed ethnographic account of all of the principal
manifestations of this remarkable form of worship. The book is a substantially
revised and enlarged edition of a monograph first published in 1975 by
the Institute of Nepal and Asian Studies, Tribhuvan University, Kathmandu,
Nepal. The then Dean of the Institute, Dr. Prayag Raj Sharma, described
the book as "the most comprehensive study yet undertaken on the cult of
the Kumari. Dr. Allen has ... succeeded not only in compiling much data
on the subject for the first time, but has also tried to show the deep
significance of the cult for the socio-religious life of the people of
the Kathmandu Valley." The book has been out of print for many years and
Dr. Allen has in this new edition included much additional contemporary
material, including 46 beautiful plates. The Cult of Kumari provides material
of great interest to scholars of South Asian religion and society, to students
of gender and women's studies and to all those who have visited Nepal and
wondered greatly at the strange lives of these young girls worshiped as
living goddesses." [Q]
Buch Boulanger: Zur Autorin: "Marie-Sophie
Boulanger begegnete der Kumari von Katmandu 1991 zum ersten Mal. Von Indien
aus, wo sie für den Orden Mutter Theresas arbeitete, war sie zur Erholung
nach Nepal gereist. Der Kult der Kumari ließ die französische
Journalistin nicht wieder los. Mit dem Preis für »Junge Journalisten«
der Fondation Hachette in der Tasche, reiste sie 1998 erneut in den Himalayastaat,
um Tradition und Hintergründe des Kultes genau zu untersuchen.
Heute ist sie für den Fernsehsender Forum tätig."
Thali.at:
"Es ist die höchste Ehre, die einem kleinen Mädchen in Nepal
zuteil werden kann: als Inkarnation der Hindu-Göttin Durga-Kali erwählt
und angebetet zu werden. Doch um welchen Preis. Auf ein grausames Auswahlverfahren
folgt ein einsames Leben hinter Tempelmauern - ohne Eltern, nach strengen
Regeln. Marie-Sophie Boulanger "hat mutig eine verbotene Tür aufgestoßen"
(Marie-Claire) und berichtet über die einzigartige Tradition und Bestimmung
der Kindgöttinnen."
Nepalonline:
"Angelockt durch eine erste Begegnung mit der Kumari von Kathmandu, kommt
die Autorin Jahre später zurück ins Kathmandutal, um dem Kumarikult
auf die Spur zu kommen. Nachdem sie anfänglich vor geschlossene Türen
rennt, erschliessen sich ihr nach und nach die Hintergründe des Kultes.
Neben der Kumari von Kathmandu spielen auch die anderen Kumaris des Tales
eine Rolle in dem Buch. Auch das Leben danach wird von der Autorin beleuchtet.
Ein spannendes Buch, das hinter die Kulissen blickt."
Veränderte URLs ohne Weiterleitung entlinkt:
Buch Haase-Hindenberg: Inforadio (Interview
mit dem Autor) * Göttin auf Zeit * Video * ZDF-Buchpräsentation
* GEO: Kumari - MDR * Zum Autor: 1, 2, 3,
Kumari-Links Nepal: Religionsgeschichte
Nepals * Kumari (en.Wikipedia)
* Kumari — The Living
GoddessKumari. * Kumari
Devi - The Living Goddess * Nepal
Religion * Zum Hinduismus [,Wikipedia,]
* Hindu-Götter * Festtermine Nepal * Kumari [,Matriarchat.Net
(Zitat), 2,3,] * Sanskrit-Begriffe
* Bildreportagen Duerigen
*
Nepal: [Auswärtiges
Amt, Wikipedia,
destination-asien,
] * Geschichte Nepals [1,2,] * Hauptstadt Kathmandu [,Wikipedia,]
* Deutsch-Nepalische Gesellschaft
e.V. * Das
alte Zentrum von Kathmandu. Der Basantapurplatz und der Durbar Square,*
NGO-Forum
Nepal * Medien in Nepal * Massaker im Königspalast 2001: , AG
Friedensforschung Uni Kassel, Friedrich
Ebert Stiftung Nepal , Nepal-dia,
Tagesspiegel,
Worl
Scoialist Web Site,
Universitäten: Tribhuvan University
Kathmandu, hier gibt es auch eine sozialwissenschaftliche Fakultät,
die mit der internationalen Bindungsforschung (Bowlby,
Ainsworth, Main u.a.; Übersichten: Holmes,
Ahnert)
vertraut sein sollte.
UNICEF - UN: * Unicef.org
* Unicef.org
zu Nepal * Unicef
Deutschland * Unicef
Wikipedia *
1) GIPT= General and Integrative
Psychotherapy,
internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
Glossar,
Anmerkungen und Endnoten: [alphabetisiert; nach der Literatur]
___
Übersicht: Aadhyro
Kotha * Apotheose
* Bewertung
*Bindungspathologie
kurz und bündig * Bhara
Tayegu * Brahma
* Buddhismus
* Chitaidar * Dalai
Lama * Dashain-Fest
* Déjà vu*
Durga
* Durga Puja
* Dyo
Maju / Dya Maju * falsche
Angaben * Feste
in Nepal * Frauen,
Kinder und Religionen in Nepal *
Gott
* Gottesbilder
* Guthi Sanasthan *
Hinduismus
* Hindu-Trinität
* Hinduismus und Islam*
Hofastrologe
- Astrologie in Nepal * Hohes
Lied der Liebe * Horoskopverweigererung
* Ihi-Hochzeit*
Illegale
Kinderarbeit in Nepal * Indra-Jatra-Fest
*
Informationen
stimmen? * Inkarnation
* Jatra
* keine Skrupel (der Medien)
* Koan
* Kumari * Kumari
Bahal * Kumari
Chowk * Kumari
Chronologie * Mahayana-Buddhismus
* Narayan * Narayanhiti
Durbar * Nepalesische
Staatsreligion * pars
pro toto *
Parvati
* Religiöse
Erklärungen und Begründungen
* Religion
und Religionsgeschichte Nepals * Schwarze
Nacht * Sexueller
Missbrauch in der Religion * Sexueller
Missbrauch in Nepal und in den Hindugebieten
* Shakti
* Shakya-Kaste
*
Shiva, Shivaje * Taleju
* Tantra * Unicef
zur Lage der Mädchen in Nepal *
Vajrayana-Buddhismus
* Vishnu
* Wahn
* Wirklichkeitsbegriff
im Buddhismus * Yihee-Hochzeit
> Ihi-Hochzeit * Zen
* Zum ersten Mal *
Zur
Auswahl schreibt Brigitte Merz in ihrer Dissertation *
___
Aadhyro Kotha. HH, S. 399 (Glossar):
"ein sakraler (nahezu dunkler) Raum im Haupthof zwischen der alten Königsresidenz
Hanuman-Dhoka-Palast und dem Taleju-Tempel, in dem
während Kola Ratri - der »Schwarzen
Nacht« des Dashain-Festes - in Gegenwart
der Kumari die geheimnisvolle Durga-Puja abgehalten
wird."
___
Apotheose. Vergötterung oder Vergöttlichung
[, Wikipedia, ]. Durch
die Rituale in der Schwarzen Nacht, wird das Mädchen zur Göttin
Taleju, es findet also eine Apotheose statt. Allgemein eine psychopathologische
Auserwählt-Entgleisung, die sich durch alle Kulturen und die gesamte
Weltgeschichte zieht - zum Teil sogar heute noch gilt (z.B. der König
von Nepal oder der Tenno, der japanische Kaiser) - was die extreme
Verwandtschaft und Nähe von politischer Macht, Religion und Kirche
eindrucksvoll unterstreicht. In Rom wird diese Phase durch Cäsar
eingeleitet und bereits mit Augustus vollständig umgesetzt. Auch Alexander
d. Gr. konnte dieser Versuchung nicht widerstehen. In der deutschen
Geschichte zeigt sich die Sakralisierung politischer Macht in dem höchst
psychopathologisch anmutenden Namen "Heiliges Römisches Reich Deutscher
Nation" (dhm,
Wikipedia).
Apotheotische
Gemälde.
___
Bhara Tayegu > Ihi-Hochzeit.
___
Bewertung. Bewertungen sind immer subjektiv,
daher sind wir in unseren Buchpräsentationen bemüht, möglichst
viel durch die AutorInnen selbst sagen zu lassen. Die Kombination Inhaltsverzeichnis
und Zusammenfassungen sollte jede kundige oder auch interessierte LeserIn
in die Lage versetzen selbst festzustellen, ob sie dieses oder jenes genauer
wissen will. Die BuchpräsentatorIn steht gewöhnlich in keiner
Geschäftsbeziehung zu Verlag oder den AutorInnen; falls doch wird
dies ausdrücklich vermerkt. Die IP-GIPT ist nicht kommerziell ausgerichtet,
verlangt und erhält für Buchpräsentationen auch kein Honorar.
Meist dürften aber die BuchpräsentatorInnen ein kostenfreies
sog. Rezensionsexemplar erhalten. Die IP-GIPT gewinnt durch gute Buchpräsentationen
an inhaltlicher Bedeutung und Aufmerksamkeit und für die PräsentatorInnen
sind solche Präsentationen auch eine Art Fortbildung - so gesehen
haben natürlich alle etwas davon, am meisten, wie wir hoffen, InteressentInnen
und LeserInnen.
___
Bindungspathologie
kurz und bündig: Menschen gehen in ein Milieu zurück, wo
sie geschlagen, entwürdigt und ausgebeutet werden, obwohl niemand
sie zwingt (z. B. Frauenhausnutzerinnen, Prostituierte, Kriminelle, aber
auch scheinbar ganz "normale" Menschen aus scheinbar ganz "normalen" Familien).
Wie kann man diese Täter- Opfer- Bindungen verstehen? Menschen binden
sich an andere in einer Art und Weise, dass sie jede Kontrolle verlieren
(Hörigkeit,
Abhängigkeit)
und überwiegend unglücklich leben und meist leiden. Wie ist das
zu verstehen, wie erklärbar? Da begegnet ein Mensch einem anderen
und ist in Sekundenschnelle und völlig an den anderen gebunden und
ebenso schnell kann diese Verliebtheitsbindung von einem Tag zum anderen
wieder verschwunden sein. Von heute auf morgen, scheinbar ohne jegliche
Entwicklung wendet sich ein Kind von einem Elternteil und dessen Bezugssystem
vollständig ab und sieht und akzeptiert nur noch einen Elternteil
und dessen Bezugssystem (PAS).
Ein einziges kleines Merkmal genügt zuweilen, um eine heftige Leidenschaft,
sei es Liebe, sei es Eifersucht, sei es Haß, auszulösen. Wie
sind solche pars pro toto Phänomene
versteh- und erklärbar? (Quelle)
Unverständlich nach der Bindungstheorie ist,
wie innerhalb kürzester Zeit eine Kumari sich von ihrer Familie löst.
Hier stellt sich die Frage: was geschieht da genau und wie geschieht es?
Was für eine religiöse Gehirnwäsche, beginnend in der Schwarzen
Nacht, findet hier statt? Ganz im Sinne der Bindungstheorie ist, dass
das Dasein der Mädchengöttingen auf Zeit bei den meisten späteren
Ex-Kumari-Frauen zu schweren Schäden und Störungen führt.
___
Brahma. Der erste Gott der Hindu-Trinität.
Schöpfer des Universums. Im Laufe der Zeit in der Wichtigkeit hinter
Shiva, Vishnu und Shakti gerückt. Ein berühmter Spruch lautet
z.B. Sucht Atma und ihr werdet Brahma finden. Könnte man in
die Richtung deuten: finde dich selbst, dann findest du Gott, was auch
ein wenig in Richtung der berühmten Inschrift des Tempels von Delphi
geht: Erkenne Dich selbst" (GNWQI
SAUTON ).
___
Buddhismus. Bedeutende Weltreligion
und metaphysische Lebensphilosophie. Eine sympathische, atheistische
Religion und damit eigentlich Lebensphilosophie, die im Gegensatz zum Christentum
und dem Islam nicht missioniert und dem jede fundamentalistisch-auserwählte
Verbohrtheit fremd ist, aber, wie alle Religionen, im Laufe seiner Geschichte
auch zahlreiche Spaltungen erfuhr und viele Varianten hervorbrachte. Von
Buddha (der Erwachte, indischer Prinz, ca. 560-480 v.C., geboren im heutigen
Nepal aus der Kaste der Shakya) begründet. Die Grundlehre besteht
in den Vier
Edlen Wahrheiten, die mit Hilfe des Achtfachen Pfades
erlangt werden. Kurzfassung: Das Sein zeichnet sich durch drei Grundprinzipien
aus: (1) Vergänglichkeit; (2) Leidhaftigkeit (durch Begehren und Unwissenheit
bedingt), (3) Nicht-Selbst oder der Abhängigkeit des Selbst, das nicht
überdauere. Es gibt weder Gott noch ein Weiterleben nach dem Tode,
alles werde vielmehr immer wiedergeboren, Ziel ist die Erlösung im
Nirwana, das ist ein Zustand frei jeder Individualität und jedes Wollens,
womit eine gewisse Verwandtschaft zu den griechischen Kynikern und zu den
Stoikern besteht. Zum Leiden (2) werden folgende Prinzipien gelehrt: 2.1
Alles ist Leiden, 2.2 Ursache des Leidens ist der „Durst“ nach Existenz,
2.3 die Aufgabe dieses Durstes erlöst vom Leiden, 2.4 es gibt einen
Weg zur Erlösung: der hohe achtfache Pfad: 2.4.1 rechte Anschauung,
2.4.2 rechter Entschluß, 2.4.3 rechte Rede, 2.4.4 rechtes Tun, 2.4.5
rechter Lebenserwerb (der Schädigung anderer ausschließt), 2.4.6
rechtes Bemühen, 2.4.7 rechte Achtsamkeit, 2.4.8 rechte Sammlung.
In Deutschland wurde der Buddhismus von Schopenhauer, Richard Wagner, den
Großvater Hermann Hesses und durch die Arbeit theosophischer Kreise
populärer gemacht. Asiatische Lehren wurden in der 2. Hälfte
des 20. Jahrhunderts in der Psychotherapie stärker beachtet. U.a.
durch Fritz Perls Interesse, Graf Dürckheims Einfluß, die Zuwendung
der Musikgruppe Beatles zu einem Guru, die Bedeutung Bhagwans, die Entdeckung
der Meditation. Die Sinnkrise des Westens und die Unfähigkeit der
christlichen Kirchen, die metaphysischen Bedürfnisse der Menschen
angemessen zu befriedigen, trugen zusätzlich zum Interesse an alternativen
und neuen Religionen bei. Insgesamt muss man sagen, dass wir von der asiatischen
Kultur viel lernen können, insbesondere einen anderen und viel wertvolleren
Umgang mit dem Alltäglichen (Satipatthana
Meditation).
___
Chhaupadi-System: In Teilen Nepals
extrem frauenfeindlicher Brauch, Frauen während ihrer Menstruationszeit
aus ihren Familien 11 Tage lang auszuschließen und zu den Tieren
in Ställe zu verbannen, weil man mit Berührungen in dieser Zeit
abergläubische und destruktiv-negative Phantasien verbindet. Die englische
Wikipedia schreibt (12.7.6)
hierzu, dass eine Klage vor dem Obersten Gericht Nepals eingereicht wurde,
um dieser Unsitte ein Ende zu bereiten.
___
Chitaidar. "nennt man in Nepal jene
Person, die im Kumari Bahal die 'lebende Göttin' betreut. Traditionell
war der Chitaidar eigentlich eine allein stehende Frau. Da die derzeitige
Chitaidar aber verheiratet ist, wird auch deren Mann so genannt." (HH,
S. 400, Glossar). In Wahrheit bestimmt der Mann der "alleinstehenden Frau",
während die praktische Arbeit von der Tochter - im Falle Amita von
Durga-didi - getan wird. Auch das zeigt, wie es um Rechte und Stellung
der Frau im Hinduismus und in Nepal bestellt ist. HH, S. 38f, schreibt
hierzu:
" ... Eigentlich ist er lediglich der Ehemann der
Chitaidar und für viele innerhalb der konservativen Priesterschaft
schon deshalb ein personifiziertes Ärgernis. Traditionell nämlich
wurden die Mädchengöttinnen ausschließlich von unverheirateten
Frauen betreut, die ihnen rund um die Uhr zu Diensten waren. Die Mutter
des grauhaarigen Herrn mit der großen Brille aber, die das Amt einst
als Witwe übernommen hatte, war die letzte unverheiratete Chitaidar.
Sie lebte mit dem minderjährigen Sohn im Kumari Bahal, und als dieser
später heiratete, blieb er mit seiner Frau einfach dort wohnen. Schließlich
machte das Kumari-Komitee die Schwiegertochter der greisen Chitaidar zu
deren Nachfolgerin. Die Pragmatiker hatten sich gegen die Traditionalisten
durchgesetzt. Ihrem Argument, dass nämlich die künftigen Kinder
der noch jungen Chitaidar einmal ideale Spielkameraden für die Kumari
sein würden, konnte man nur schwer mit dem Anspruch nach spiritueller
Reinheit für das göttliche Refugium begegnen.
Mittlerweile leben drei Generationen der Chitaidar-Familie
im Kumari Bahal. Das Sagen aber hatte zu keinem Zeitpunkt die Chitaidar,
sondern deren Mann, weshalb die Priesterschaft schon bald begann, ihn abfällig
als Chitaidar zu bezeichnen. Der grauhaarige Herr mit der großen
Brille aber lässt es sich gern gefallen, dass mittlerweile kaum noch
jemand seine Frau, sondern alle ihn »den Chitaidar« nennen.
Beschreibt das doch die wahren Machtverhältnisse im Haus der lebenden
Göttin. Er thront auf seinem Platz neben dem Kumari-Fenster, von wo
aus er das Geschehen innerhalb und außerhalb des Gebäudes argwöhnisch
beobachtet.
Nach Auffassung des Raj Guru, des geistlichen Oberhauptes
der Pancha-Buddha-Priester, hat mit dieser Entwicklung im Kumari Bahal
ein rapider Werteverfall begonnen, der mittlerweile immer gravierendere
Ausmaße annimmt. Dieser Mann ohne offizielles Amt spiele sich als
alles entscheidender Hausherr auf. Dabei seien es doch die Pancha-Buddha-Priester,
die im Erdgeschoss des Kumari Bahal den Agam, jenen dunklen Tempelraum,
betreuen. Schließlich liege doch gerade dort jene spirituelle Energie
verborgen, die überhaupt erst einem Shakya-Mädchen zur göttlichen
Existenz verhilft. Und nur die Pancha-Buddha-Priester würden über
das geheime Wissen verfügen, wie ein solcher transzendentaler Prozess
in Gang gesetzt [<39] werden könne. Daraus leite sich ja wohl das
natürliche Recht ab, dass sie bei der Auswahl einer neuen Kumari ein
wichtiges Wort mitzureden hätten.
Der Chitaidar aber würde dem königlichen
Astrologen von vornherein nur die Horoskope von Mädchen aus ihm genehmen
Familien vorlegen. Kommt das nicht einer Bevormundung der Göttin gleich,
in welchen Körper sie inkarnieren darf und in welchen nicht? Doch
damit nicht genug. Nach dem Spruch des Hofastrologen besucht er auch nicht
mehr, wie früher üblich, die ausgewählte Familie gemeinsam
mit einem der Pancha-Buddha-Priester. Wie oft aber war in der Vergangenheit
gerade die spirituelle Energie eines buddhistischen Priesters vonnöten,
um die Mütter der künftigen Kumari daran zu hindern, ihren Töchtern
die Haare abzuschneiden! Ohne genügend Haupthaar, das sich rituell
zu einem Knoten binden lässt, das wussten sie, kann ein Mädchen
keine Kumari werden. Der Chitaidar aber hat diesmal den Raj Guru gar nicht
erst gefragt. Stattdessen hat er lediglich eine Verwandte des ausgewählten
Mädchens zu dessen Familie geschickt - wenngleich mit Erfolg.
___
Dalai Lama. Auch die Auswahl des Dalai
Lamas ("Kundun") erfolgt bereits im Kleinkindkindalter, das scheint also
eine buddhistische Spezialität zu sein. Auswahl, Leben und Wirken
des 14. Dalai Lama wird im Film "Kundun" (ARD 4.9.6) gezeigt. [W]
[Tibetfocus]
___
Dashain-Fest. HH, S. 400 (Glossar):
"dauert zehn Tage und endet mit der ersten Herbst-Vollmondnacht. Das Fest
ist der Göttin Durga und dem Sieg des Guten über
das Böse gewidmet."
___
Déjà vu. Hier in der Bedeutung
einer starken spontanen positiv gestimmten Vertrautheit, von geborgen und
nahe fühlen, ja fast lieben. Eigentlich nach Peters (1984, S. 109),
der in seinem Wörterbuch der Psychiatrie und medizinischen Psychologie
ausführt: "Déjà-vu-Erlebnis (Phänomen) (n). »Schon
gesehen.« Gefühl, etwas schon einmal gesehen zu haben, obwohl
man sich z.B. in einer noch nie besuchten Stadt befindet. - Das bekannteste
der Erlebnisse falscher Bekanntheitsqualität (fausse reconnaiscance).
Die Bez. wird deshalb auch für gleiche Erlebnisse auf anderen Sinnesgebieten
oder in anderen Vorstellungsbereichen verwandt. Charakteristisch ist das
Bekanntheitsgefühl einer Situation und ihr urteilsmäßiges
Verwerfen im gleichen Erlebnis. Wahrscheinlich schon im Alterturn bekannt.
Von AUGUSTIN unter der Bezeichnung »falsae memoriae« behandelt.
Das Phänomen diente vielfach zu Ausdeutungen i. S. der Wiedergeburt.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts in psychologischer und belletristischer
Literatur erwähnt. In die psychiatrische Literatur von JENSEN (1868)
als »Doppelwahrnehmungen« eingeführt. Wurde zunächst
als ungleichmäßiges Funktionieren der beiden Gehirnhälften
erklärt S. FREUD sah darin Assoziationen zu unbewußten Erlebniskomplexen.
Tritt auf im Traum, bei Erschöpfung, toxischen Zuständen, im
Beginn von Psychosen, als Symptom der Psychasthenie, in der epileptischen
Aura, im Beginn einer Dämmerattacke."
Variante: "Déjà-vécu-Erlebnis:
"Gefühl, die gleiche Situation schon einmal durchlebt zu haben. fr:
Illusion de déjà vecu; e: déjà-vécu
phenomenon."
___
Durga. (Durga-Puja).
"eine der furchtlosen und gelegentlich auch grausamen Manifestationen der
Göttin Parvati - wie auch Bhagvati und Kali."
(HH, S. 401, Glossar).
Im Lexikon der östlichen Weisheitslehren (1995),
wird S. 101 ausgeführt: "Durga, Sanskrit., wörtl.: »die
Unergründliche«; einer der ältesten und am häufigsten
gebrauchten Namen für die Göttliche Mutter, die Gemahlin Shivas.
Ihre zehnarmige Gestalt, auf einem Löwen stehend, symbolisiert ihre
große Macht, die sie, nach den ved. Schriften, bald strafend, bald
gnädig ausübt. Sie zerstört z.B. den Dämon der Nicht-Erkenntnis,
spendet den Armen Speise und segnet mit Liebe und Erkenntnis alle, die
nach Gottverwirklichung streben. Das jährliche Anbetungsfest für
die Göttin (Durgä-Puja) findet im Herbst statt und dauert (in
Bengalen) mindestens fünf Tage. Es beginnt mit der Anrufung Durgas,
damit sie aus ihrem himmlischen Reich kommen möge. Am letzten Tag
wird das für das betreffende Jahr geschaffene Durga Bildnis in einem
Fluß oder im Meer versenkt.".
[, Wikipedia,
]
___
Durga-didi. Durga, hier der Vorname
der Tochter der/s Chitaidar. Das Beiwort "didi" steht für die Bezugspersonenfunktion
"ältere Schwester". Enge Vertraute Amitas vom ersten Augenblick der
ersten Begegnung an, die mit ihr sogar in einem Bett schläft, die
große Schwester, Mutter, engste Freundin, Beraterin und Führerin
alles in einem ist. Nach der Schilderung dieser Beziehung, sollte die Trennung
von Durga-Didi zusammen mit dem Verlust der Kumari-Rolle und der Rückkehr
in eine unbekannte Welt eine traumatische Erfahrung werden.
___
Durga-Puja. HH, S. 401 (Glossar):
Zu Ehren der Göttin Durga wird während des Dashain-Festes die
geheimnisvolle Durga-Puja zelebriert, der die Opferung von vierundfünfzig
Ziegen und vierundfünfzig Büffeln im Mul Chowk vorausging. Was
da genau geschieht bleibt bei HH "geheimnisvoll".
Etwas mehr in Erfahrung bringt B,
(S. 191f) im Zusammenhang der Inthronisation: "Ich versuche mir ins Gedächtnis
zu rufen, was ich über diese berühmte Nacht weiß, in der
die künftige Göttin in ihren Status erhoben wird. Nach der Prüfung
der blutigen Büffelköpfe wird das Kind zu den Priestern in den
Tempel von Taleju gebracht. Sämtliche Rituale müssen geheim bleiben,
damit die tantrische Magie nicht ihre Wirkung verliert. Dennoch habe ich
die Beschreibung eines Abschnitts dieser Initiation gelesen, wie er dem
Ethnologen und Nepal-Forscher Gérard Toffin von einem Priester anvertraut
wurde. Eine Reihe von magischen Vorgängen soll das Mädchen darauf
vorbereiten, von der Göttin beseelt zu werden. Zunächst wird
das nackte Kind vom Oberpriester gewaschen, um es von seinen bisherigen
Erfahrungen zu reinigen. »Auf diese destruktive Phase, eine Desindividuation
gewissermaßen, folgt eine Reihe weiterer Riten, die den Körper
des Kindes in einen göttlichen Körper verwandeln sollen. Zu diesem
Zweck berührt der Priester sechs Körperstellen des Mädchens,
die so genannten
anga, mit einem Büschel aus Eragrotis cynasuroides
kusa, einem Gras, das für religiöse Zwecke so weit verbreitet
ist, dass man glauben möchte, es könne alles reinigen. Die sechs
Körperstellen sind: Augen, Vulva, Vagina, Nabel, Brust [<191] und
Hals. Je weiter der göttliche Geist sich in ihr niederlässt,
desto mehr verfärbt sich der Körper des Kindes rot, was die Farbe
der Kumari ist.« [FN9: Gérard Toffin, »Le Palais
et le Temple«.]"
___
Dyo Maju, auch Dya Maju:
"Ehrwürdige Göttin", Anrede der Kumari.
___
falsche Angaben. Nirgendwo wird
so viel gelogen wie in Medien, der Politik, vor Gericht und in den Religionen
(z.B. sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche, alimentierte Kinder
von Priestern, Indoktrinationen in Heimen). Insofern wären diese Lügen,
falls Boulanger recht hat, nicht besonders überraschend. Darum geht
es hier nicht, sondern um die wahren Gründe für die vorzeitige
Absetzung. Haben die Mädchen-Göttinnnen z.B. nicht mehr wie gewünscht
funktioniert?
___
Feste in Nepal. Nach der Internetquelle
Asien-Feste:
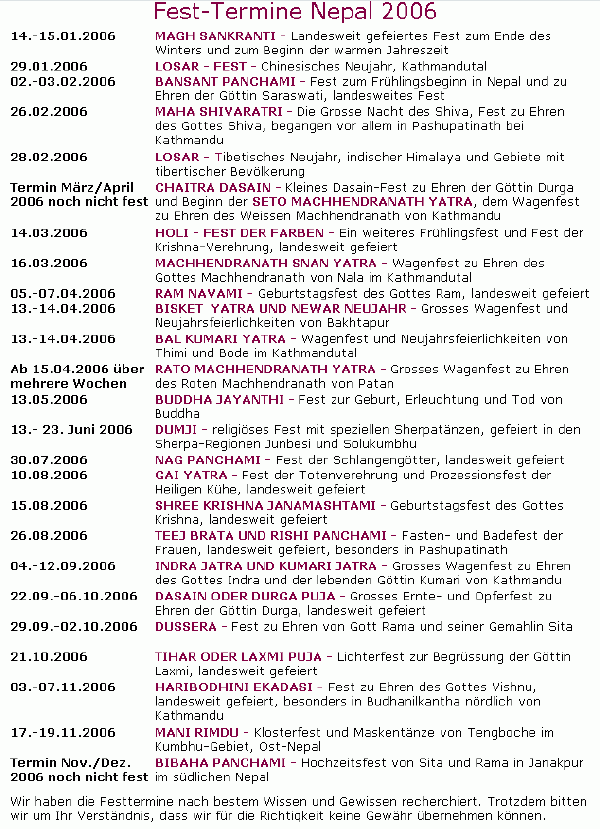
___
Frauen, Kinder
und Religionen in Nepal [Quelle]:
"Frauen: Eine der Folgewirkungen des Hindustaates ist
die untergeordnete Stellung der Frau in Nepal. Sicherlich sind die Frauen
in allen nepalischen Gesellschaftsgruppen mehr oder weniger stark benachteiligt.
Das Problem des Hindustaates ist, daß die besonders negative Einstellung
zum weiblichen Geschlecht (Beispiel: Chhaupadi-System),
wie sie sich in der hinduistischen Gesellschaft findet, für alle Gesellschaftsgruppen
des Landes legalisiert wird. Ein besonderes Beispiel mag das Abtreibungsrecht
sein; eine Gesetzesänderung wurde erst im Oktober 2001 herbeigeführt,
doch ist diese wenig bekannt. Bezeichnend ist, daß trotz dieser Gesetzesänderung
immer noch viele Frauen wegen Abtreibung im Gefängnis sitzen.
Trotz dieser andauernden Benachteiligungen haben
sich Status und Rolle der Frau in der Gesellschaft in jüngster Zeit
erheblich gewandelt. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Zunahme
an Bildung. Die Frauen nutzten die Möglichkeiten der Verfassung von
1990, bildeten Organisationen, die für ihre Rechte eintraten, oder
klagten vor dem Obersten Gerichtshof. Letzterer hat wiederholt zugunsten
klagender Frauen entschieden. Schon vor der Parlamentsauflösung im
Jahre 2002 wurde eine Gesetzesvorlage zur Gleichberechtigung im Erbrecht
im vom Männern dominierten Parlament heiß diskutiert und eine
Umsetzung boykottiert. Mit dem königlichen Putsch von Februar 2005
dürfte sich eine noch konservativere Denkweise durchsetzen. Wichtig
ist auch, daß die Frauen selbst ihren Beitrag zu einer veränderten
Denkweise leisten.
Bereits seit dem 6. Fünfjahresplan (1980-85)
hat der Aspekt der Frauenförderung allmählich auch Einzug in
die staatliche Planung gefunden. Dabei deutete sich in den letzten Jahren
erstmals eine Änderung der gesetzlichen Regelungen an (siehe auch
Artikel von Prativa Subedi). Konservative Hindu-Organisationen sahen darin
eine Bedrohung und riefen zum Protest auf. Die Diskussionen über den
Dialog mit den Maoisten und das Landbesitzrecht drängten jedoch das
für die Frauen so wichtige Thema erneut in den Hintergrund. Frauenaktivisten
rufen zunehmend ihre Geschlechtsgenossinnen auf, für gesetzliche Änderungen
zu kämpfen.
Kinder: Eng verbunden mit dem Schicksal der
Frauen ist das der Kinder, vor allem in den ersten Lebensjahren. Ernährungsprobleme,
Hygiene und mangelnde medizinische Betreuung, insbesondere während
Schwangerschaft und Geburt, sind die Hauptursachen für die nach wie
vor hohe Kindersterblichkeit. Eine weitere Folge ist die hohe Anzahl behinderter
Kinder.
Die Kinderarbeit stellt ein besonderes Problem dar.
Bereits frühzeitig haben die Kinder einen Arbeitsbeitrag in Haus und
Hof zu leisten, damit die Familie überleben kann. Vielen Kindern wird
deshalb eine fundierte Schulausbildung vorenthalten, ganz besonders den
Mädchen. Über 26% der Kinder im Alter von 5-14 Jahren gehen regelmäßig
wirtschaftlichen Tätigkeiten nach; nur 4,5% erhalten dafür eine
Bezahlung. Besonders hoch ist auch hier der Anteil der Mädchen. Der
maoistische Aufstand und die Gegenmaßnahmen der Armee haben das Problem
noch verschärft. Die Kinder und Jugendlichen sind ganz besonders von
der politischen Krise betroffen. Vor allem viele junge Frauen und Mädchen
fliehen nach Indien, wo sie nicht selten erneut zu Ausbeutungsopfern werden.
Mehrere Organisationen widmen sich seit Jahren dem
Thema Kinderarbeit und seinen Folgen, so z.B. Child Workers in Nepal (CWIN);
der Vorsitzende dieser Organisation, Gauri Pradhan, wurde jedoch Mitte
Februar 2005 vom königlichen Militärregime verhaftet. Presselinks
zu Kindern in Nepal und insbesondere zur Kinderarbeit finden Sie über
die entsprechenden Internetseiten von Nepal Research." ...
"Religionen: Nepal ist die Begegnungsstätte
diverser Religionen und Kulturen. Informieren Sie sich über die nepalischen
Erscheinungsformen von Hinduismus und Buddhismus, aber auch über die
Religionsgeschichte des Landes und Formen des Synkretismus.
Hindufundamentalistische Organisationen nutzen die
konstitutionelle Verknüpfung von Staat und Hindu-Religion zum Vorgehen
gegen andere Religionen. Christliche Religionsformen finden in der Tat
zunehmend Anhänger in Nepal, was christlichen Hilfsorganisationen
den Vorwurf illegaler Missionierung eingebracht hat. Angesichts ihres besonderen
Stellenwerts gilt es Religion für die Entwicklung von Staat und Gesellschaft
nutzbar zu machen."
___
Gott. Idee eines höheren Wesens, meist
als Schöpfer und Sinngeber der Welt. > Inkarnation.

___
Gottesbilder. Idee, Bild, Vorstellung,
Phantasie von Gott. Im Judentum und Islam verpönt. > Gott,
Inkarnation.
___
Guthi Sanasthan. HH, S. 403 (Glossar):
"das Kumari-Komitee, dessen offizielle Amtsbezeichung »Amt für
religiöse Güter« lautet."
___
Hinduismus. Hindu ist ein persisches
Wort und bedeutet Inder. Mit Hinduismus werden die religiösen Lehren
der Inder bezeichnet. Im Hinduismus [W]
sind die Veden die ältesten heiligen Schriften. Es gibt keinen
Religionsstifter und auch keinen ausgezeichneten Gott, wenngleich schon
besondere (Hindu-Trinität). Grundlegend
für alle indischen (Hindu) Varianten ist die Lehre des Gesetzes vom
Karma,
die vierfache Betrachtung der ewigen Religion: 1) Karma als geistige
oder körperliche Handlung; 2) Karma als Konsequenz aus einer
geistigen oder körperlichen Handlung; 3) Karma als Summe aller
Konsequenzen aus einem - früheren oder aktuellen - Leben und 4) Karma
als Kette von Ursachen und Wirkungen in der moralischen Welt. Es gibt eine
kaum übersehbare Zahl von Göttern, die ebenso viele unterschiedliche
Namen, Verkörperungen (Inkarnationen) und Aufgaben haben. So
gibt es allein von Shiva 1008 unterschiedliche Namen zur Benennung seiner
vielen Erscheinungen. Es gibt keine einheitliche und schon gar keine dogmatische
Lehre. Aus dieser faktischen und zugelassenen Vielfalt, kann man den aus
metaphysisch liberaler Freidenkerperspektive sehr angenehmen Schluss ziehen,
dass der Hinduismus wie der Buddhismus einen individuellen religiösen
Weg für richtig findet. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass
sich beide Religionssysteme relativ gut vermischen und umdeutend entsprechen
können, wie man am Beispiel
Nepal sehen
kann.
___
Hindu-Trinität. Shiva
(1008 Inkarnationen), Brahma, Vishnu.
___
Hinduismus und Islam. Ziehrer
(S. 120) führt zur Geschichte und zum Verhältnis aus: "Die Begegnung
der beiden Weltreligionen Hinduismus und Islam begann schon sehr früh
und sehr kriegerisch, und hierbei waren die Gegensätze der religiösen
und sozialen Anschauungen zwischen den beiden Lagern sehr bedeutend. Es
gelang weder dem sonst so integrationsfreudigen Hinduismus, jemals den
Islam in sich aufzusaugen, noch glückte es den militanten Moslems,
die Hindus umzuwandeln. Der streng monotheistische, sehr realistische,
bilder- und priesterlose Islam trat kriegerisch und weitgehend demokratisch
in die Arena Indiens, wo er auf eine mehr polytheistische und bilderfreudige
Religion mit brahmanischer Führerschicht, Kastenwesen und autokratischem
Feudalismus traf.
Das waren und sind bis heute grimmige Gegensätze.
Die Moslems verabscheuen das unreine Schwein, die Hindus essen keine Kühe,
die Heiratsbräuche der Moslems sind den Hindus ein Greuel, die hinduistische
Kultmusik und deren Einstellung zur Sexualität werden vom Islam abgelehnt.
Während der Islam eine einmalige Gottesoffenbarung durch den Propheten,
einen Schöpfungsakt nach jüdischer oder christlicher Auffassung
und ein Jüngstes Gericht anerkennt, glauben die Hindus an einen anfangs-
und endlosen Weltprozeß, eine Wiedergeburt der Seelen, an karmische
Vergeltung. Die Moslems begraben ihre Toten, die Hindus verbrennen sie.
Eine gewisse Verbindung beider Religionen gibt es durch das Auftreten der
»Sufis«, der »heiligen Männer«, der asketischen,
in Mystik und Prophetie befangenen Prediger des Islams. Diese Sufis sind
den hinduistischen Asketen, Saddhus und »Magas« ähnlich,
denn sie teilen mit den indischen »Bhakti«-Gläubigen die
Überzeugung, daß Gott überall und in vielen Formen und
daß durch Liebe die Vereinigung mit Gott oder Allah möglich
sei. Von Anfang an betrachtete der autoritäre und absolute Islam den
in seiner Grundtendenz toleranten, weltoffenen und allumfassenden Hinduismus
als minderwertig und menschenunwürdig. Der Hinduismus aber war nur
allzu bereit, Gottesanschauung und Religiosität auch bei den Andersgläubigen
vorauszusetzen. Bei diesen ungleichen Anschauungen war es nur folgerichtig,
daß die Hindus trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit
von den Moslems zur »Raja« — zur Herde der Unterworfenen —
degradiert wurden.
Schon im Jahr 712 kam es durch den Einfall Mohammed-ibn-Kasims
im Sindh zu einer ersten Berührung der beiden Welten. Allerdings durchdrang
der Islam das Indusgebiet erst, als Mahmud Ghazni (1030) ins Panjab einrückte.
Von nun an folgten die islamischen Erobererwellen dicht aufeinander, erfaßten
jedoch meist nur Teile Nordwestindiens. Hinter den Herren kamen Verwaltungsbeamte,
Gelehrte, Prediger, Imame, Mullahs und Mystiker.
Oft war der mohammedanische Griff nach indischem
Lebensraum mit fanatischen Ausschreitungen religiöser Eiferer, mit
Schändung hinduistischer Heiligtümer, Tempeln und Zerstörung
von Kultbildern verbunden. Den Moslems war die hinduistische Lebensweise
und ihre Ausdrucksformen ein Greuel. So verunreinigten die Eroberer häufig
die Heiligtümer der fremden Rasse, verbrannten die religiösen
Bücher, vernichteten Kunstwerke vor allem mit bildhaften, erotischen
und monströsen Darstellungen und zerschlugen die Götterbilder.
Vishnuitische Schriftsteller aus Bengalen berichten etwa aus der Zeit der
Mogulherrschaft von der wiederholten Behinderung der hinduistischen Tempelzeremonien;
unter Kaiser Aurangzeb (1658—1707) steigerten sich die Exzesse gar bis
zur systematischen Verfolgung hinduistischer Religionsausübung. ..."
___
Hofastrologe -
Astrologie
in Nepal.
Die in Nepal gängigen Astrologie-Systeme arbeiten alle auf siderischer
Grundlage, d.h. mit den wirklichen astronomischen Orten der Sternzeichen
im Gegensatz zum im Westen verbreiteten sog. tropischen Tierkreis,
der zur Zeit durch die Präzession
ca. ein Sternzeichen nach vorne gewandert ist (am Beispiel Freud hier
präsentiert: Widder oder Stier?). Ein Kundiger einer Astrologienewsgroup
teilte hierzu noch mit: "Der 2005 gestorbene Königliche Astrologe,
Prof. Mangal Raj Joshi, soll vorhergesagt haben, daß die Geburt von
Prinz Dipendra unter schlechten Gestirnen stand: "Others recall the warning
of the royal astrologer, for whatever it was worth, to the grandfather
King Mahendra (reigned from 1955 to 1972) that the conjunction of stars
at the time of the impending birth of Prince Dipendra was inauspicious
and bode ill for the survival of the royal family. Sedatives administered
to the mother to delay the birth failed and Dipendra was born." [Q]
Über den Hofastrologen als Mensch und Persönlichkeit
äußert sich HH, S. 28:
"IN DER ECKE EINES DUNKLEN HINTERHOFES IN DER ALTSTADT
von Patan, der früheren. Königsstadt südöstlich von
Kathmandu, lebt und wirkt der Chefastrologe des Königs. Aber auch
.Menschen aus der normalen Bevölkerung können zu ihm kommen.
Und da es der Schicksalsgläubigkeit und auch der Tradition der Nepalesen
entspricht, bei der Geburt eines Kindes ein Horoskop erstellen zu lassen,
erarbeitet sich der Hofastrologe auf diese Weise ein nicht zu verachtendes
Zubrot.
Allerdings ist Mangal Raj Joshi trotz der Anerkennung des Monarchen
und dem zusätzlichen Salär durch seine Klienten offensichtlich
ein bescheidener Mensch geblieben. Nichts in diesen beengten Wohn- und
Arbeitsverhältnissen deutet darauf hin, dass jener greise Mann, der
auf dem Fußboden hinter einer schlichten Holzkiste über [<29]
seinen Berechnungen sitzt, ein für die Geschicke des Staates einflussreicher
Mann ist. Der alte Herr stammt aus einer Astrologendynastie und war schon
als Kind in die schicksalsstiftenden Konstellationen der Gestirne eingeweiht
worden. In den dreißiger Jahren hatte er in der heiligen Stadt Benares
in Indien studiert, ehe er in seiner nepalesischen Heimat zum Universitätsprofessor
und königlichen Astrologen aufstieg. Es gibt kaum eine politische
Entscheidung, die der König trifft, ohne ihn zuvor um den Blick in
die Sterne zu bitten."
___
Hohes Lied im Alten Testament.
Da gibt es dann eben so hochgradig sinnliche wie freizüge Stellen
wie: "Liebe das Weib Deiner Jugend, berausche dich an ihren Brüsten
und taumle in ihrer Liebe." Von Ehe ist dort nicht die Rede. Das hört
sich alles ganz normal, gesund und natürlich an - eben ein hohes Lied
auf die (freie) Liebe (Salomo).
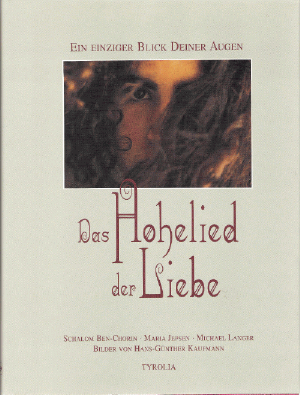
___
Horoskopverweigerung.
HH, S. 232: "Wenngleich er [der Chitaidar] nach dem 11. Geburtstag der
Kumari vorschriftsmäßig die Shakya-Familien Kath-[231]mandus
um die Horoskope ihrer Töchter gebeten hatte — mit magerem Ergebnis.
Jedenfalls war die Zahl der Eltern, die sich weigerten, das Horoskop auszuhändigen,
diesmal höher als jemals zuvor. Im Guthi Sanasthan, dem er darüber
Meldung machte, wurde die »mangelnde Verantwortung« der betreffenden
Familien beklagt, und der Chitaidar spricht seither häufig von einem
»Werteverfall« in dri Gesellschaft. Schließlich konnte
er Mangal Raj Joshi, dem königlichen Chefastrologen, doch noch drei
Horoskope übergeben. Was würde aber geschehen, wenn keines der
drei Mädchen für eine Kumari geeignet ist und die amtierende
Dyo Maiju »unrein« wird Doch eine
solche Überlegung will und kann er dem Vater der jetzigen Kumari ja
schlecht mitteilen, und so begnügt er sich mit der Aussage: »Ich
bin für eine solche Auskunft zwar nicht der richtige Mann, aber meine
Frau und ich gehen nicht davon aus, dass wir an Kala Ratri eine neue Kumari
haben werden.«
___
Ihi-Hochzeit. (auch: Yihee-Hochzeit)
"Bei dieser von Hindus und Buddhisten gleichermaßen gepflegten Tradition
werden die Mädchen vor Beginn der Pubertät mit Vishnu-
oder Shivaje nach Auslegung - vermählt, symbolisch
dargestellt durch die Frucht Bel. Für manche folgt im Anschluss daran
eine Hochzeit mit der Sonne, die mit dem symbolischen Eintreten der Regel
in Zusammenhang steht: Zwölf Tage lang werden die Mädchen in
einem dunklen Raum eingesperrt, ohne Tageslicht und ohne einen Menschen
zu sehen. Sie können sich sogar scheiden lassen, was für jede
andere strenggläubige Hindu-Frau überhaupt nicht in Frage kommt.
Alle jungen Newar-Mädchen, denen ich in Nepal begegnet bin, unabhängig
von ihrer Kaste, ob Ombika oder Sumkra, haben mir gesagt, sie hätten
diese berühmte Phase der Ihi-Hochzeit durchlaufen, denn die mit einem
Gott vermählten Newar-Frauen werden die Schmach von Ehelosigkeit oder
Witwendasein nie erleben. In der Regel lassen nur ehemalige Kumaris als
einstige Göttinnen und Gattinnen Shivas das Ritual aus." (B., S. 174).
Nach HH, S. 308 scheint es zwei "Vorhochzeiten"
mit Göttern zur gesellschaftlichen Absicherung für nepalesische
Mädchen zu geben:
"Wie kann man die Dyo Maiju in die Familie integrieren und dennoch
auf deren noch immer vorhandene Göttlichkeit Rücksicht nehmen?
Vom Chitaidar war in dieser Hinsicht keine Hilfe zu erwarten. Doch dessen
Frau hatte sie vor vier Tagen im Kumari Bahal kurz zur Seite genommen und
gesagt: »Feiert mit eurer Tochter möglichst schnell hintereinander
die newarischen Hochzeiten, das wird ihr helfen, sich zu Hause einzuleben.«
Wie aber würde sich die Dyo
Maiju fühlen, wenn sie mit fast dreizehn Jahren die Yihee-Hochzeit
feiern soll? Die newarischen Mädchen, die während jener Zeremonie
mit einer Bel-Frucht verheiratet werden, dem Symbol des Gottes Narayan
(einer weiteren Inkarnationen Vishnus), sind in der Regel nicht älter
als acht. Andererseits weiß Mimita, wie wichtig für ein newarisches
Mädchen der gesellschaftliche Status ist, der durch diese Zeremonie
erworben wird.
In früheren Zeiten, als es in Nepal nach dem
Tod eines Ehemannes noch die Witwenverbrennung gab, blieb den Newar-Frauen
dieses grausame Schicksal erspart, weil sie durch die Yihee-Hochzeit in
ihrer Kindheit weiterhin als verheiratet galten. Aber auch in den moderneren
Zeiten hat die Vermählung mit dem Gott Narayan eine durchaus positive
Bedeutung. Falls eine newarische Frau nämlich mit einem — meist noch
immer von den Eltern für sie ausgewählten — Ehemann nicht klarkommt,
erleichtert es ihr die Trennung. Denn niemand würde es wagen, die
Eheschließung mit dem unsterblichen Gott Narayan als zweitrangig
einzustufen.
Die zweite Hochzeit erleben die newarischen Mädchen
mit der vedischen Gottheit Surya Bhagawan - dem Sonnengott. Dieser Zeremonie,
die kurz vor der zu erwartenden ersten Menstruation
erfolgen muss, gehen zwölf Tage und Nächte in einem verdunkelten
Raum voraus, den in dieser Zeit nur Frauen betreten dürfen. Da aber
dieses »Bhara Tayegu« genannte Ritual die früher vorgenommene
Eheschließung mit dem Gott Narayan voraussetzt, wird der in vier
Tagen heimkehrenden Amita nichts anderes übrig bleiben, als die Yihee-Zeremonie
mit einigen Jahren Verspätung über sich ergehen zu lassen. Und
Mimita hofft, dass die Chitaidar Recht hat und diese beiden Feierlichkeiten
ihrer Tochter die Eingewöhnung erleichtern werden."
Anmerkung Yihee-Hochzeit:
Eine gute Idee zwar, aber traurig und ärgerlich, dass auch im 21.
Jahrhundert eine solche Rückständigkeit in der Frauenfrage noch
zu beklagen ist. Offensichtlich ist der Hinduismus hier genauso rückständig
und in der Gleichberechtigungsfrage genauso geistig-moralisch verfault
wie der Katholizismus. Allerdings war der Vorschlag der Chitaidar insofern
sehr gut, als er sehr dazu beitrug, die beiden Schwestern, Amita und Anita,
wieder zusammen zu führen.
Anmerkung: Analogie im christlichen Katholizismus:
Die Braut Christi und die Jungfrauenweihe [1,2,3,].
___
Illegale Kinderarbeit:
"MATERIALIEN Tanya Roberts-Davis: Kinder Nepals. Die Stimmen der Rugmark-Kinder
(ab 9 Jahre) ZDF-Dokumentation: Kinder ohne Kindheit (ab 5 Jahren) Ehemalige
Kinderarbeiter aus Nepal erzählen in eigenen Worten und Bildern ihre
Lebensgeschichten und führen dem Leser eindringlich ihre erschütternden
Arbeitsbedingungen vor Augen, zeigen aber auch, wie sich dank der Rugmark-Initiative
durch Schulbildung neue Perspektiven eröffnen. Die internationale
Rugmark-Kampagne zielt auf die Bekämpfung der illegalen Kinderarbeit
in der Teppichproduktion, sowie die Organisation von Sozialprogrammen ab.
Über Rugmark ist auch ein 33-minütiges Video der ZDF-Dokumentation
„Kinder ohne Kindheit“ ausleihbar, das am Beispiel eines befreiten Teppichkindes
die Verhältnisse in der Teppichproduktion und die Arbeit von Rugmark
in Indien beschreibt. Tanya Roberts-Davis: Kinder Nepals. Die Stimmen
der Rugmark-Kinder. Blauburg Verlag, 2002, ISBN 3-935550-30-8, 12 €"
[wusgermany-Daten-Globales-Lernen-Informationsstelle-rundbrief44]

___
Indra-Jatra-Festes.
HH, S. 403 (Glossar): "Indra ist der König der vedischen Götter
und auch der Hindu-Gott des Regens. Am Ende der Monsumzeit wird ihm zu
Ehren ein viertägiges Fest gefeiert. An diesen höchsten Festtagen
im umfangreichen nepalesischen Feiertagskalender kommt die Kumari während
drei Jatras zu ihrem Volk." [siehe auch Feste
in Nepal]
___
Informationen stimmen.
Welchen Informationen aus Politik, Adelshäusern und Priesterschaft
kann man trauen? Welche stimmen, welche nicht, welche sind teilweise richtig?
Was ist frisiert, diplomatisch geschönt, was wird vertuscht, euphemistisch
umgedeutet? Wie viele katholische Priester werden für ihre unehelichen
Kinder von der Kirche alimentiert, wie viele sind des sexuellen Kindesmissbrauchs
überführt? Wie werden die vaterlosen Kinder unterstützt?
Sind hier zuverlässige Angaben vom Vatikan zu erwarten, oder wird
der Vatikan es vorziehen zu schweigen, wenn er schon wenigstens nicht lügt?
Wie stehen die Chinesen und Japaner zu ihrer Kriegsverbrechen und Kolonialpolitik?
Was ist mit Indien, den Witwenverbrennungen und der Frauenfrage? Eingedenk
dieser kritischen Fragen, müssen wir natürlich auch hinsichtlich
der offiziellen Verlautbarungen aus dem Königspalast und der Priesterschaft
zu den Kumaris und ihrer Geschichte vorsichtig sein.
___
Inkarnation. Fleischwerdung, Verkörperung,
Manifestion, Metamorphosen, Verwandlung, Identitätsmodus, Erscheinungsform.
Schlüpft ein Gott z.B. in eine Schlange oder Schildkröte, liegt
eine Inkarnation vor ebenso, wie wenn ein Gott zu einem Menschen wird.
Zur Vielfalt der Gottesmerkmale siehe bitte hier.
Die Vergötterung oder Vergöttlichung heißt Apotheose.
___
Jagadish. Nach einem Fernleihbestellungversuch
- das Buch ist in Deutschland nicht verfügbar - bei der UB Erlangen
ergibt sich, dass der Autor nicht Jagadish - das ist einer seiner Vornamen
- sondern Regmi, Jagadish C[handra] heisst.
Regmi 25.9.6. Inzwischen konnte ich Einsicht
in die Broschüre von Regmi organisieren. Tatsächlich findet sich
dort p. 19 folgende Aussage: "The ultimate object of worshipping
the.virgin is not clear but it seems that after worshipping the virgins
private part the devotee is expected to undergo a sexual intercourse with
her."
___
Jatra HH, S. 403 (Glossar): "nepalesischer
Begriff für eine religiöse Prozession."
___
keine Skrupel. Der Niedergang der
westlichen Kultur und das vielfach angefaulte Staats- und Gesellschaftswesen
ist wesentlich ein Produkt der Medien.
___
Khopi Schlafraum der Kumari.
___
Koan. "Im Zen ist es
eine Formulierung aus einem Sutra [RS: Leitfaden] oder eine Darlegung der
Zen-Erfahrung (Teishõ), eine Episode aus dem Leben alter Meister,
ein Mondo [RS: Dialog zwischen Meister und Schüler] oder Hossen [RS:
Demonstration durch einen Wortwechsel], die alle jeweils auf die Letzte-Wahrheit
hindeuten. Das Wesentliche eines jeden Koan ist das
Paradoxon,
also das, was »jenseits (griech. para) des Denkens (griech.
dokein)«
ist, was logisches, begriffliches Verstehen transzendiert [RS: übersteigt].
Das Koan ist also kein »Rätsel«, da es nicht mit dem Verstand
zu lösen ist; zu seiner »Lösung« bedarf es eines
Sprunges auf eine andere Ebene
des Begreifens. Etwa seit Mitte des 10. Jh. wurden Koan im Zen systematisch
als Mittel der Schulung eingesetzt. Da sich das Koan jeder Lösung
mit den Mitteln des Verstandes entzieht, macht es dem Zen-Schüler
die Grenzen des Denkens deutlich und zwingt ihn schließlich, sie
in einem intuitiven Sprung zu
transzendieren, durch den er sich in der Welt jenseits aller logischen
Widersprüche und dualistischen [RS: richtig-falsch, typisch westliches
Weltbild und naive Wissenschaftsauffassung] Denkweisen wiederfindet.
Aus dieser Erfahrung heraus kann der Schüler dem Meister im Dokusan
[RS: eigenen Weg finden ohne den Meister] seine eigene Lösung des
Koan spontan und ohne Rückgriff auf Hörensagen demonstrieren.
Das Wort oder der Ausdruck, in das sich das Koan auflöst, wenn man
damit als einem geistigen Schulungsmittel ringt, wird Wato (chin. hua-tou]
genannt; es ist die »Pointe« [RS: besser Lösung] des Koan.
In dem berühmten Koan »Chao-chou, Hund« ist z. B. das
Mu [RS: heißt "Nichts"; die Antwort verläßt also die suggestive
Ja-Nein-Vorgabe der Frage nach dem Buddhawesen eines Hundes] das Wato;
manche längeren Koan haben mehrere Wato. Es soll insgesamt etwa 1700
Koan geben, von denen die heutigen jap. Zen-Meister jedoch nur 500-600
verwenden, da viele Wiederholungen darstellen oder zur Schulung nicht so
wertvoll sind. Die meisten dieser Koan sind in den großen Sammlungen
Wu-men-kuan
(jap. Mumonkan), Pi-yen-lu (jap. Hekigan-roku),
Ts'ung-jung-lu
(jap. Shoyo-roku), Lin-chi-lu (jap.
Rinzai-roku) und
Denko-roku
enthalten. Im allgemeinen wird die Koan-Praxis mit der Rinzai-Schule in
Verbindung gebracht (Kanna-Zen), doch wurden Koan in China wie in Japan
auch in der Soto-Schule (Mokusho-Zen) verwendet. Durch die Koan-Schulung
wird zunächst verhindert, daß der Schüler nach einer ersten
Erleuchtungserfahrung (Kensho, Satori) wieder ins Jedermanns-Bewußtsein
(Bonpu-no-Joshiki) zurückfällt; darüber hinaus helfen sie
ihm, seine Erfahrung zu vertiefen und auszuweiten. ... " Quelle: Lexikon
der östlichen Weisheitslehren.
___
Kumari. Als Inkarnation Parvatis gilt die
lebende Göttin, die Kumari.[Q]
___
Kumari Bahal. (- Kumari Ghar) HH,
S. 404 (Glossar): " in dem. zweigeschossigen Palast arn Durbar-Platz von
Kathmandu wohnt und residiert die jeweils amtierende Kumari sowie der Chitaidar
und dessen Familie. Der Palast heißt nur bei den nepalesischen Buddhisten
Kumari Bahal (Kumari-Kloster), von den Hindus wird der Palast Kumari Ghar
(Kumari-Haus) genannt."
___
Kumari Chowk. Innenhof im Kumari
Bahal, dort wo die 54 Büffel und 54 Ziegen am Tag der Schwarzen Nacht
mit einem Schwerthieb enthauptet werden.
___
Kumari Chronologie
Preeti 10.7.2001- . [1,2,3]
Amita 1991-2001.
Rashmila 1986-1991. Internetinformationen: , ecantipur-040616,
Anita 1979-1986.
Die
englische
Wikipedia zitiert
The Kathmandu Post mit folgenden Daten:
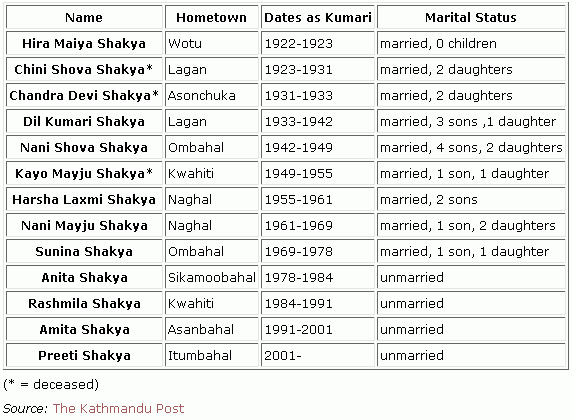
___
Mahayana-Buddhismus. [in
Nepal]
___
Menstruation. Die religiöse
Bewertung als "unrein" ist typisch patriarchalisch und einseitig. Das Frauenhandlexikon
führt zur M. aus: "Menstruation, der in der Vorstellung vieler Kulturen
eine geheimnisvolle Kraft anhaftet, ist mit einem Tabu belegt. Der Begriff
Tabu meint sowohl heilig und geweiht, als auch unheimlich, gefährlich,
verboten und unrein." Nachdem Blut
in der nepalesischen Kultur eine sehr wichtige, reinigende und schützende
und damit eigentlich eine positive Rolle spielt, ist die negative Bewertung
der M. ohnehin schwer zu verstehen. Hinzu kommt, dass man die Menstruation
genau so gut als positiven Reinigungsprozess wie auch die erste M. als
ein positives Zeichen der Befruchtbarkeit ansehen kann. Genau das scheint
aber gefürchtet und negativ bewertet zu werden.Warum? Warum hat man
eine solche Angst vor einer Schwangerschaft der Göttin? Die Sage
zum Ursprung der Mädchengöttin besagt, weil der Herrscher
die Göttin sexuell begehrte.
Beyer,
Johanna; Lamott, Franziska & Meyer. Birgit (1983). Frauenhandlexikon.
Stichworte zur Selbstbestimmung. München: C.H. Beck. Lit-Liste.
___
Narayan. Gott. Seele und Gott in
Gemeinschaft und Verschmelzung (Atman ist eins mit Brahman).
___
Narayanhiti Durbar. Königspalast
in Kathmandu.
___
Nepalesische Staatsreligion. > Frühere
Geschichte. Offizielle Staatsreligion in Nepal ist der Hinduismus,
der aber seinen eigenen Charakter hat. Die Religionsverschmelzung in Nepal
wird von der Internetseite [Q]
gut beschrieben: "Die Religionsverschmelzung zeigt sich deutlich im Kathmandu
Tal. So ist es natürlich, daß Bildnisse von Hindu-Göttern
in buddhistischen Tempeln stehen und umgekehrt buddhistische Stupas in
hinduistischen Tempeln zu finden sind. Das shivaitische Fruchtbarkeitssymbol
"lingam" (Phallus), das auf der Basis "yoni" (weibl. Organ) steht, wird
von den Buddhisten als "flammender Lotos aus heiliger Quelle" umgedeutet,
während für den Hindu Lingam und Yoni die fundamentale Einheit
des Männlichen und Weiblichen in der Zeit vor der Schöpfung ausdrücken.
Im wichtigsten hinduistischen Tempel, Pashupatinath, wird der Shiva Lingam
einmal im Jahr mit einer Maske Buddhas bedeckt. In Swayambhunath huldigen
Hindus dem Gott von Swayambhunath als Sambu (Shiva), obwohl Swayambhunath
durch den großen Stupa auf den ersten Blick ganz als buddhistische
Domäne erscheint und für die Buddhisten Swayambhu = Buddha ist.
In Pashupatinath und Swayambhunath, den wichtigsten Heiligtümern des
Kathmandu Tals, wird der "Gott von Anbeginn" verehrt. Adi Buddha (siehe
"Mahayana-Buddhismus") und Adi Shiva vereinigen sich in Adinatha zu einem
Gott, der von beiden Gemeinden anerkannt wird. Männliche Göttergestalten
tendieren dazu, in Lekesvara/Machendranath, einer Verschmelzung aus Shiva,
dem Yoga-Heiligen Machendranath und dem Bodhisattva Avalokitesvara, aufzugehen,
während weibliche Götter in shivaitischer Sicht mit Kali/Durga,
in buddhistischer Sicht mit Tara, dem bedeutendsten weiblichen Bodhisattva,
verschmelzen. Die Göttin Guhyeswari wird von allen Newar, gleich welcher
Religion, verehrt. Für die Buddhisten ist sie die höchste Göttin
auf gleicher Ebene mit Adi Buddha (Swayambhu). Weibliche Götter werden
häufig als Varianten der Großen Mutter aufgefaßt, eine
Vorstellung, die besonders durch den Tantrismus geprägt wurde."
Ein einfacher praktischer Weg zu den in Nepal bedeutsamen
Gottheiten ergibt sich aus einer Betrachtung der Feste.
___
Newar. Volksstamm, Volksgruppe in Nepal.
[,Wikipedia,]
___
Parvati Gattin des Shiva und Muttergöttin.
(HH, S. 408, Glossar).
___
pars pro toto: Teil für
das Ganze. Wenn man vom Teil auf Ganze schliesst. Häufige alltägliche
Erscheinung falscher Denk- und Schlussweisen, oftmals die Grundlage von
(positiven) Vorurteilen (attraktive Erscheinung => attraktiver, wertvoller
Mensch). [,Wikipedia,]
___
Religiöse
Erklärungen und Begründungen. Ähnlich wie in der Politik
wird in der Religion nicht selten durch Negation
die Wahrheit verschleiert, verharmlost oder euphemistisch umgedeutet,
so dass es sich immer empfiehlt, das sog. Heilige und den religiösen
Ritus kritisch zu hinterfragen, was in den meisten Religionen tabuisiert
oder verboten ist und selbst heute im 21. Jahrhundert noch, z.B. im Islam,
den Kopf kosten kann. Es gehört zum Wesen der Macht, sich gegen Infragestellen
oder Kritik zu immunisieren, am liebsten verbieten sie es bis zur Androhung
der Todesstrafe per Gesetz. Die Wahrheit ist: Religionen und ihren FührerInnen
ist grundsätzlich nichts heilig, außer ihren nicht selten größenwahnsinnig
anmutenden Selbstdefinitionen. Auf keinem geistig-kulturellen Gebiete gibt
es daher so viele euphemistische
Umdeutungen perverser oder kriminellen Praktiken wie auf dem Gebiet der
Religion. Sobald ein Religionsstifter, Prophet oder Hoher Priester
perverse oder kriminelle Handlungen (ritualisiert) durchführt, werden
diese nicht nur exkulpiert (entschuldigt;1),
sondern sogar noch moralisch oder kulturell erhöht.
___
Religion
und Religionsgeschichte in Nepal: > Frühere
Geschichte, > Religionsgeschichte
in Nepal.
___
Schwarze Nacht. HH, S. 403 (Glossar):
"Kala Ratri (»Schwarze Nacht«) ist die neunte Nacht des Dashain-Festes.
In der Nacht, in der die Durga-Puja stattfindet, werden im ganzen
Kathmandu-Tal Tieropfer durchgeführt.
___
sexueller Missbrauch
in der Religion. Der gesamte asiatische Religionskreis ist - wie der
Katholizismus und der Islam - durch seine allgemeine Entwertung der Frau
von vornherein verdächtig, sexuellen Missbrauch zu erleichtern oder
gar zu fördern. Hinduismus und Katholizismus sind aber aus gegensätzlichen
Motivations- und Einstellungslagen besonders gefährdet: der Katholizismus,
weil er Sexualität unterdrückt und entwertet und ein völlig
gestörtes Verhältnis zur Sinnlichkeit und Sexualität entwickelte
(im Gegensatz etwa zum Hohen Lied im Alten
Testament), daher kommt es zum massenhaften sexuellen
Missbrauch von Kindern in der katholischen Priesterschaft, die verständlicherweise
oft mit dem Zölibat oder der Entsagung
nicht zurechtkommen. Der Hinduismus ist gefährdet, weil er eine völlig
freie Einstellung zur Sinnlichkeit und Sexualität hat - jedenfalls
im Grundsatz, wenn man von dem Sonderkapitel der zwanghaften Vorstellungen,
wie sie sich im Kamasutra finden, einmal absieht. Frauen und Mädchen
zählen traditionell nichts in Indien und im Hinduismus. Von daher
ist die faktische Versuchung groß, auch Mädchen sexuell zu missbrauchen.
In der Volkssage beginnt denn die Geschichte der
Mädchengöttin
Kumari auch mit einem sexuellen Missbrauchsversuch bzw. einer Grenzüberschreitung.
Die Göttin Taleju in der Gestalt einer erwachsenen Frau konnte sich
empört wehren. Nun soll ein jungfräuliches Mädchen her.
Bedenkt man die in der asiatischen Geisteskultur sehr verbreitete paradoxe
Denkweise und denkt man daran, dass in der Politik häufig durch Verneinung
die Wahrheit gerade benannt wird, so kann man das auch so verstehen,
dass ein kleines Mädchen zur Kindgöttin gemacht werden musste,
die sich nicht mehr wehren kann, wenn der Herrscher seine Lust mit ihr
ausleben möchte, aber auch nicht mehr zu wehren braucht, wenn der
sexuelle Missbrauch sakralisiert, d.h. zu einer heiligen Handlungen gemacht
wurde.. In diese Richtung weisen auch die Mitteilungen Boulangers (B, S.
192), die schreibt: " ... Ich hatte noch nicht die Zeit gehabt, den englischen
Text des Nepalesen Jagadish zu lesen. Darin geht
es um frühere tantrische Kulte mit jungfräulichen kleinen Mädchen.
Schnell überfliege ich die verschiedenen Gestalten der Shakti, wie
sie Mädchen (im Alter von einem bis sechzehn Jahren) vor ihrer Pubertät
verkörpern. [<192] Der Autor erwähnt die von den Tantras vorgeschriebenen
Voraussetzungen für eine spirituelle Verwirklichung: Zu jeder Kaste
gehöre ein ganz bestimmter Typus von Kindern. Der Autor kommt zu folgendem
Schluss: »Der letzte Zweck der Verehrung einer kindlichen Jungfrau
bleibt im Dunkeln, aber es hat den Anschein, als hätten die Gläubigen
im Anschluss an die Verehrung sexuelle Beziehungen mit ihnen.« [FN10:
C. Regmi Jagadish, »The Kumari of Kathmandu«.].
Jagadish beendet das kurze Kapitel mit dem Hinweis darauf, man könne
aus den Schriften darauf schließen, dass dieser Kult von den nepalesischen
Königen Pratap Malla und Pratap Singh Shah ausgeübt worden sei."
Auch wie man mit den Kindern und ihren Familien
umgeht, aus denen die Kumari ausgewählt wird, zeigt zwar keinen sexuellen
Missbrauch an, aber ganz unzweideutig nach entwicklungspsychologischem
Wissensstand einen Kindesmissbrauch zu religiös-politischen Zwecken.
Der Vater Amitas fällt dem Chitaidar durch
das ganze Buch von HH auf die Nerven, weil er sich für die Interessen
seines Kindes und seiner Familie einsetzt. Am liebsten wäre es dem
Kumari-Komitee ("Guthi Sanasthan") und
dem Kumari-Manager Chitaidar, wenn sie sich das Kind möglichst klein,
am besten noch vor Vollendung des 3. Lebensjahres, einfach greifen könnten,
es kurz einer funktionalen Gehirnwäsche unterziehen könnten,
damit es die wenigen Kumari-Aufgaben ohne Probleme erfüllt, um es
dann, sobald es "unrein" geworden ist, wie einen Sack Kartoffeln einfach
fallen zu lassen und ausmustern zu können. Und gegen solch eine menschenrechtsfeindliche
Praxis muss man ebenso vorgehen wie gegen das Verbrechen der Mädchenbeschneidung
in Afrika.
___
Sexueller
Missbrauch in Nepal und Hindugebieten [Querverweis Kindersexmafia]
Internetquelle: Child Workers in Nepal:
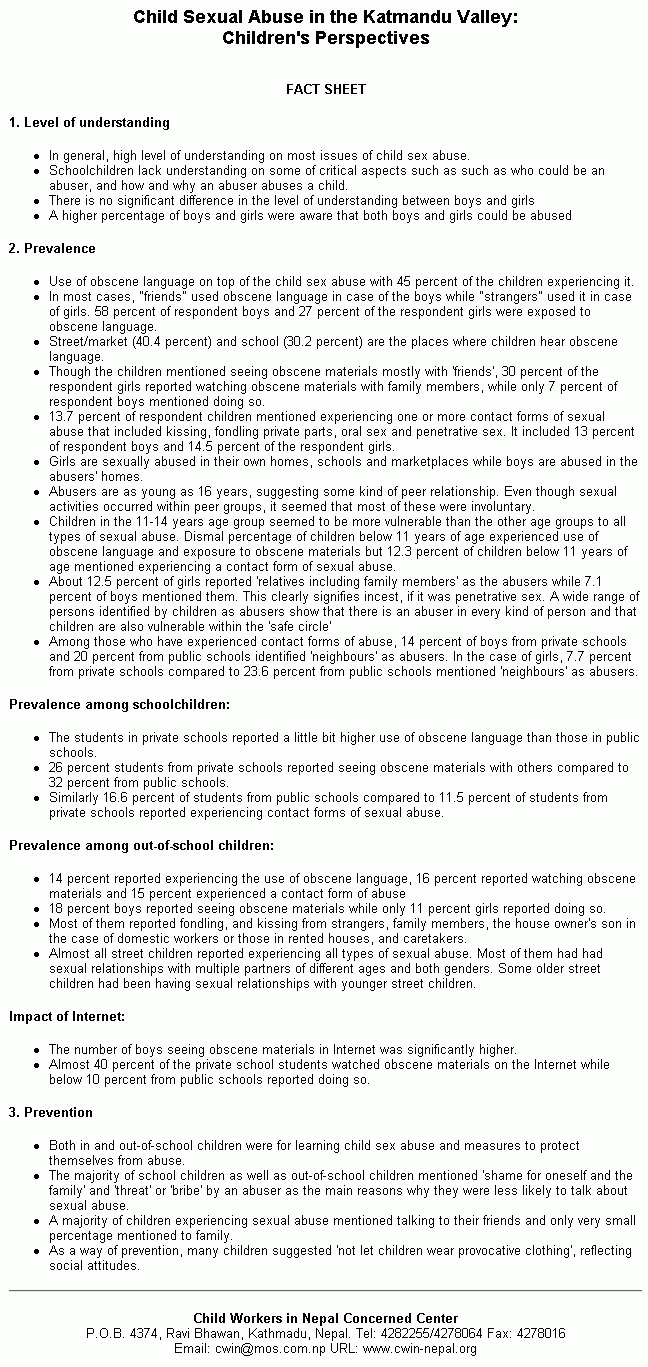 *
Rethinking Social Reintegration of Child Survivors of Trafficking ... As
elsewhere, trafficking in children and child sex abuse is regarded as the
cause and consequence of poverty in Nepal but other underlying factors
like ...
*
Rethinking Social Reintegration of Child Survivors of Trafficking ... As
elsewhere, trafficking in children and child sex abuse is regarded as the
cause and consequence of poverty in Nepal but other underlying factors
like ...
 *
Human Right Watch (1995)
*
Human Right Watch (1995)
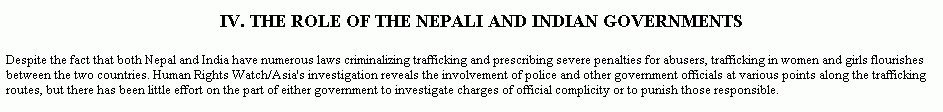 *
Faint Hope For Nepal’s Child Slaves
*
Faint Hope For Nepal’s Child Slaves
"Under the current system, she said, the children’s “owners have the
right to abuse and exploit them.” Indeed the major danger of child domestic
work is that, except for the few hundred at school, the children are invisible
to the outside world and therefore subject to physical, mental, and sexual
abuse. “A lot goes on between the four walls,” Tuladhar added." [Scource]
*
U.S.
State Dept Trafficking in Persons Report, June, 2006
[full
country report]
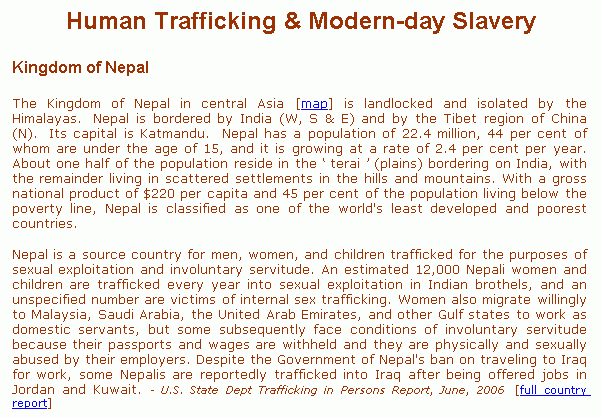
___
Shakti. HH, S. 408 (Glossar): "im
Sanskrit bedeutet dieser Begriff sowohl »spiritiuelle Kraft«
wie auch »Energie«. Im religiösen Sprachgebrauch der Hindus
steht das Wort für den weiblichen Aspekt von göttlicher Allmacht."
___
Shakya-Kaste. "Kastenbezeichnung
und Familienname von Angehörigen der einstigen Gold- und Silberschmiedekaste.
Wenngleich nur noch wenige Shakyas diesem Gewerbe nachgehen." (HH, S. 408,
Glossar). Anderen Quellen entnehmen wir: "(Buddha: sanskrit: der
Erwachte, Erleuchtete); Ehrentitel für Siddhartha Gautama (um 563
bis ca. 486 v.Chr.), in Kapilavastu, heutigem Nepal geboren, als Sohn eines
Königs aus Adelsgeschlecht der Shakyas." [Q]
___
Shiva, Shivaje. Dritte Gottheit der Hindu-Trinität.Obwohl
Shiva wörtl. so viel wie der Gütige oder der Freundliche bedeutet,
ist er der Gott der Auflösung und Zerstörung, was
paradox anmutet, aber auch Sinn macht, wenn er z.B. als Zerstörer
der Nicht-Erkenntnis (doppelte Negation: Nicht-Nicht-Erkenntnis, also Erkenntnis
und Weisheit) als segensreich bewertet wird. Der Name Shiva kommt in den
Veden nicht vor, er heißt dort Rudra. Insgesamt soll es 1008 Namen
zur Benennung der vielen, vielen Erscheinungen Shivas geben.
___
Taleju. "Taleju Bhavani, tantrische
Göttin, Schutzgöttin der Könige von Nepal, verkörpert
durch die Kumari. (B, S. 219). HH, S. 409 (Glossar): Taleju ursprünglich
eine südindische Gottheit. Sie kam vor etwa vierhundert Jahren ins
Kathmandu-Tal, wo sie als Inkarnation von Durga zur Hausgöttin der
Malla-Könige aufstieg. Nach dem Sieg der Shah-Dynastie über die
der Malla im Jahre 1769, wurde sie von Prithvi Narayan Shah — dem ersten
König der neuen Dynastie — übernommen. Entspricht in buddhistischer
Deutung der Hauptgöttin Vajra Devi (HH, S. 234).
___
Tantra. wörtl. Gewebe, Zusammenhang,
Kontinuum. Ursprung: indisch (Hinduismus). Zentrales Thema göttliche
Energie und Schöpfungskraft. Darstellung meist als Dialog zwischen
Shiva und einer seiner Shakti. Im tibetischen Buddhismus Oberbegriff für
die Meditationssysteme des Vajrayana (wörtl. Diamant-Fahrzeug), auch
Bezeichnung für verschiedene Arten von Texten, z.B. medizinische oder
astrologische.
___
Tantrismus. "Ungefähr 500 n.Chr.
entwickelte sich im nordindischen Mahayana-Buddhismus - unter dem Einfluß
des Yoga-Kultes - eine Bewegung, die man Tantrismus nennt. Ihre Lehren
und Praktiken wurden in den Tantras (Schriften) zusammengefaßt. Der
Tantriker sucht die Erlösung durch magische Riten, mitunter auch durch
orgiastische Praktiken." [aus: Die
Religionsgeschichte Nepals]
Eine überzeugende Erklärung habe ich bei Zierer
(1985,
S. 158f) im Glossar gefunden:
"Tantrismus: Die Heilsbewegung entstand im 7. Jahrhundert
n. Chr. Die Seele des Tantrismus ist das magische Wort und hat vornehmlich
rituellen Charakter. Sie versucht mittels besonderer Zeremonien, magischer
Handlungen, ja orgiastischer Akte eine geistige Wirkung zu erzielen, die
es dem Menschen möglich macht, nach Überwindung seiner niederen
Triebe Kontakt mit [<158] dem Überirdischen zu gewinnen. Der Tantrismus
besitzt innerhalb des Hinduismus große Breitenwirkung, ist aber nicht
für jeden Gläubigen verbindlich, sondern stellt nur einen Heilsweg
unter vielen dar. Das komplizierte Ritual des Tantrismus hat später
auch auf den Buddhismus besonders in Nepal, Tibet, China und Japan eingewirkt."
___
Thuloma, Thuloba. HH, S. 409
(Glossar) newarisch: älteste Tante und ältester Onkel. Tante
= "Kaki", Onkel = "Kaka".
___
Unicef zur Lage
der Mädchen in Nepal: Bal Shiksha“ – Eine Chance auf Bildung für
Mädchen [Hieraus]:
"In Nepal haben fast 600.000 Kinder noch nie eine Schule besucht. Ein Viertel
aller Mädchen im Grundschulalter hat keine Chance, am Unterricht teilzunehmen.
Die meisten müssen Geld verdienen oder im Haushalt helfen. Zudem fehlt
es in abgelegenen Bergdörfern an Lehrern. Die schlechte Qualität
des Unterrichts lässt die Kinder frühzeitig die Schule abbrechen.
UNICEF ermöglicht vor allem Mädchen aus armen Familien mit dem
landesweiten Programm „Bal Shiksha“ eine Grundbildung. Jährlich lernen
23.000 Kinder in „Bal Shiksha“-Kursen Lesen, Schreiben und Rechnen. UNICEF
hilft zudem, den Unterricht in staatlichen Schulen zu verbessern. Arbeit
lässt kaum Zeit für die Schule. Fast 40 Prozent der Menschen
in Nepal müssen mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen.
Etwa zwei Millionen Kinder arbeiten, um ihre Familien
zu unterstützen. Sie haben deshalb kaum Gelegenheit, die Schule zu
besuchen. 14 Prozent der Schülerinnen und Schüler verlassen die
Schule schon vor dem Ende der ersten Klasse. Nur die Hälfte der Kinder
schließt die fünfjährige Grundschulzeit ab. Die Gründe:
Vor allem auf dem Land gibt es zu wenig Schulen. Die Lehrer sind oft schlecht
ausgebildet und haben nicht gelernt, die Kinder aktiv in den Unterricht
einzubeziehen. Es fehlt an Tafeln, Büchern und Stiften. Viele Familien
entscheiden sich deshalb dagegen, ihre Kinder in die oft weit entfernten
Schulen zu schicken. Mädchen werden benachteiligt Verglichen mit anderen
Ländern in Asien ist das Bildungsniveau in Nepal sehr niedrig. Die
Alphabetisierungsrate liegt bei nur 48 Prozent. Besonders geringe Bildungschancen
haben Frauen: Trotz großer Fortschritte in den vergangenen Jahren
kann nur ein Drittel von ihnen Lesen und Schreiben.
Mädchen werden viel seltener eingeschult als
ihre männlichen Altersgenossen und brechen die Schule noch häufiger
ab. Oft müssen die Mädchen die Schule verlassen, weil sie schon
mit zehn oder elf Jahren verheiratet werden. Fast die Hälfte aller
15- bis 19-jährigen Mädchen ist bereits Ehefrau. Auch der Mangel
an Mädchentoiletten und die Tatsache, dass drei Viertel aller Lehrer
Männer sind, halten Mädchen vom Schulbesuch ab. Die Benachteiligung
der Frauen spiegelt sich in Nepal sogar in ihrer Lebenserwartung wider:
Sie liegt mit 52 Jahren vier Jahre unter dem Durchschnitt bei den Männern."
___
Vajrayana-Buddhismus.
"Bei der dritten Umdrehung des Rads der Lehre entstand der Vajrayana. Vajrayana
heißt 'Diamantenes Fahrzeug'. Seinen Namen erhielt er durch den Gedanken,
dass der Gläubige einen makellosen, kostbaren und unzerbrechlichen
Geist besitzt – vergleichbar mit den Eigenschaften eines Diamanten. Der
Vajrayana führte in Tibet zu einer Sonderform: dem Lamaismus. Der
Vajrayana-Buddhismus basiert auf der Erkenntnis der Leere, der Liebe zu
allen Lebewesen und der Vervollkommnung. Durch Geben, Sittlichkeit, Geduld,
Ausdauer, Tatkraft, Meditation und Weisheit und unter Anleitung eines religiösen
Führers gelangt der Gläubige zur Erleuchtung. Zahlreiche Götter
und Buddhas helfen ihm dabei." [Quelle URL verändert] [ ,Wikipedia,
]
___
Vajra. Im Hinduismus Blitzstrahl Indras
oder sein Donnerkeil, also eine Waffe. Im Buddhismus ein Symbol des Unzerstörbaren
(die wahre Wirklichkeit), daher als Diamant bezeichnet.
___
Vajra Devi . "Hauptgöttin des
nepalesischen Vajrayana-Buddhismus. Aus newarisch-buddhistischer
Sicht ist die Kumari deren Inkarnation." (HH, S. 410, Glossar). "Devi"
ist nur ein Zusatz und bekräftigt eine weibliche Gottheit.
___
Veden. Wörtlich Wissen, heilige Lehre.
Gesamtheit der ältesten heiligen Schriften der indischen Literatur,
vielleicht vergleichbar in der Bedeutung den fünf Büchern Moses
im Juden- ("Tora") und Christentum.
___
Vishnu. Hauptgott - der Erhaltende - des
Hindu-Trinität.
In der Staatsreligion Nepals im König verkörpert (inkarniert).
___
Wahn. Die meisten religiösen Lehren
- egal welcher Herkunft - beinhalten psychopathologisch formal streng betrachtet
ein Wahnsystem, jedenfalls dann, wenn der Glaube unkorrigierbar verankert
("gewiss") ist. Das hat nichts mit einer anderen Wirklichkeits-Interpretation
zu tun, wie z.B. H.W. Schumann in seinem Werk "Buddhismus. Stifter, Schulen
und Systeme" (1998, S. 222) ausführt.
___
Wirklichkeitsbegriff
im Buddhismus. Der Wirklichkeitsbegriff des Buddhismus stimmt vollkommen
mit dem psychologischen überein - jedenfalls in der Interpretation
Schuhmann (1998, S. 222, kursiv-fett RS): "Der Abendländer, daran
gewöhnt, nur Nachprüfbares für wirklich zu nehmen, hält
ideierte Wesenheiten, die nur ihrem Urheber sichtbar sind, für Wahngebilde.
Der Vajrayänin denkt anders. Wirk-lichkeit ist alles,
das wirk-sam ist, gleichgültig ob äußerlich
oder innerlich, für einen oder viele. ..."
Interessanterweise fand ich einen ähnlichen Wirklichkeitsbegriff
bei Ernst Mach: "Nichts ist wirklich, was nicht unter gewissen Bedingungen,
die sinnlichen Elemente, den Bewußtseinsinhalt dieses oder jenes
Menschen beeinflussen kann. Was wir
erlebt haben, hinterläßt uns Erinnerungen,
Vorstellungen." In: Die Empfindungen, 9.A., 1922, S. 303, Zusätze
zu S. 30.
___
Yihee-Hochzeit > Ihi-Hochzeit.
___
Zen. Im Prinzip die eine lebensphilosophische
Orientierung, durch ganz persönliche innere Erfahrungen
zum Erwachen und Erleuchtung zu gelangen. Zen-Buddhismus.
[ ,Wikipedia, ]
___
Zum ersten Mal. Das stimmt so
nicht ganz: Das Buch von Boulanger wurde bereits 2004 auch in deutscher
Sprache vorgelegt.
___
Zur Auswahl
schreibt Brigitte Merz in ihrer Dissertation [Volltext,
S.75]: "Wie zu Beginn des Kapitels schon erwähnt wurde, erfolgt die
Wahl einer Kumàri nach bestimmten Regeln. Die Wahl findet bevorzugt
vor dem Dasai-Fest im Herbst statt. Normalerweise ist das Mädchen
im Kleinkindalter, sie muß gesund und möglichst vollkommen sein,
darf keine Wunde haben und darf vor allem noch kein Blut verloren haben.
[FN83] Sowohl die zukünftige königliche Kumàri
aus Kathmandu als auch die zukünftige Kumàri aus Patan müssen
in der Nacht vom achten auf den neunten Tag des Dasai-Fests im Herbst ein
bestimmtes Qualifizierungsverfahren durchlaufen bei dem sie ihre Eignung
als Gottheit unter Beweis stellen müssen. Dazu wird das jeweilige
Mädchen, das für die Nachfolge der Kumàri in Frage kommt,
in den Palasthof des Tempels der Göttin Taleju geführt, der voller
blutiger, abgeschnittener Büffelköpfe ist, die in dieser besonderen,
der “schwarzen” Nacht (nep. kàlaràtri), der Göttin geopfert
werden. Die zukünftige Kumàri muß sich [< 76] zwischen
diesen Tierköpfen ohne Zeichen der Angst hindurchbewegen (Lienhard
1978: 169). Hat sie diese ‘Prüfung’ bestanden, wird die neue Kumàri
mittels eines bestimmten Rituals (Kumàri sthàpanà
påjà) inthronisiert (Allen 1987: 20f; Slusser 1982: 313f).
Nur in Bhaktapur findet die Inthronisation einer neuen Kumàri bereits
einige Tage vor dem ersten Tag des Dasai-Fests statt und die ‘Tests’, welche
ihre Eignung als Kumàri beweisen sollen, finden in einem anderen
Rahmen statt (Allen 1987: 47). Dennoch muß sich auch diese Kumàri
in der “schwarzen” Nacht, der Nacht vom achten auf den neunten Tag von
Dasai, im Palasthof des Tempels der Göttin Taleju aufhalten, wo sie
von den Köpfen der getöteten Tiere umgeben ist und von Priestern
in einer geheimen Zeremonie verehrt wird (Allen 1987: 49f). Michael Allen
betont in diesem Zusammenhang “… the marked contrast between the initial
selection procedure in which the aim was to find a pure young virgin, one
who above all else had not yet bled in any kind of way, and the installation
rites in which the scene itself is one of extreme goriness and the goddesses
invoked to possess the girl are both erotic and bloodthirsty” (1987: 22).
In der Kumàri spiegeln sich somit zwei Wesenszüge einer Göttin
wider: die der reinen Jungfrau und die der blutrünstigen, zerstörerischen
Göttin. Die Gegensätze, die beim Kumàri-Kult zum Vorschein
kommen, können daher auch als Sinnbild für den Einfluß
des Tantrismus auf das rituelle Leben der Newar gesehen werden."
FN83 Allen (1987: 105, n.7) gibt eine
Liste mit 32 Bedingungen an, die eine zukünftige Kumàri erfüllen
sollte. Sie werden auch als die 32
Zeichen der Schönheit (new. battislakùaõa) bezeichnet
(Toffin 1984: 475)
___