4 Analyse einiger Phantasieeinträge in Büchern, Wörterbüchern und Lexika
In geschweiften Klammen {} werden die Kriterien von mir eingefügt.
Zur Philosophie-Geschichte
des Phantasiebegriffs.
Darüber informiert Eislers Wörterbuch der Philosophie [Online]
- Aristoteles, Scholastik.
- Hobbes, Cartesianer.
- Kant.
- Schulze, Maass.
- Hegel, Ritter.
- Wundt, Nietzsche.
Arnold, Eysenck, Meili (1987), Bd. 2, Sp.
1603-05.
gk
{}
"Phantasie. GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK. Der Begriff „Phantasie"
(gr.) bedeutet soviel wie Vorstellungskraft. Trevisa (1398) schreibt, daß
bei Nacht häufiger P.n auftreten als am Tag. Newton erwähnt die
Kraft der P., die es möglich macht, farbig zu träumen. Der Begriff
bezieht sich auf subj. >Vorstellungen (keine >Erinnerungsbilder) {K08m},
seien es >Wachträume und Träume {Q02} im Schlaf oder >Halluzinationen
{Q03,
Q04}, in denen visuelle, auditive, taktile und andere Sinnesmodalitäten
(deren Kombinationen) enthalten, sein können. Hume (1883) trennt Vorstellungen
von >Empfindungen; letztere seien eindringlicher und lebhafter. Er meint
aber, daß die Vorstellungen den Empfindungen im >Schlaf {Q02},
im Fieber {Q03} und bei >Geisteskrankheiten {Q04} an Lebendigkeit
nahekommen können. Maury (1861) verwendete den Begriff . „hypnagog"
(wie S. Freud in seiner „Traumdeutung") für die Vorstellungsbilder,
die im Halbschlaf {Q05} auftauchen. Freud beschäftigte sich
mit P. unter dem Konzept der „Primärprozesse" im Ggs. zu den „Sekundärprozessen"
des zielgerichteten Denkens. Die Primärprozesse äußern
sich selbst in Träumen und Tagträumereien {Q02} durch
Wunscherfüllungsphantasien
{K04h}.
Eine weitere Bezeichnung für P. hat Bleuler in seinem Konzept des
>Autismus eingeführt. Autistisches (im Ggs. zu realistischem) Denken
kann Sekunden oder ein ganzes Leben lang dauern und die Realität vollständig
verdrängen (z. B. bei der >Schizophrenie). „Ergebnisse autistischen
Denkens werden nicht durch realistische und logische Kritik geprüft
... es interessiert sich nicht für die Wirklichkeit, sondern für
die Erfüllung seiner Wünsche" {K04h} (Bleuler, 1922; s.
Rapaport, 1951). Bleuler fügt hinzu, daß das normale Denken
eine Mischung aus realistischem (R-Denken) und autistischem (A-Denken)
ist (McKellar, 1957). Das A-Denken kann die Persönlichkeit zerstören,
was bei den >Psy[>1604]chosen vorkommt, oder es kann zeitweilig überhandnehmen,
wie z. B. im Traum, in hypnagogen Zuständen, unter dem Einfluß
von halluzinogenen Stoffen und bei sensorischer Deprivation. Ebenfalls
taucht es bei Tagträumereien auf, in der Mythologie und im Aberglauben.
Einige >projektive Verfahren
{K05h}, wie z. B. der >TAT, enthalten
Standardbilder, die die P. anregen sollen; je nach der vom Pbn gegebenen
(phantasievollen, -armen) Interpretation dieser Bilder werden dann Informationen
über die >Persönlichkeit gewonnen.
In seinen frühen Untersuchungen über Vorstellungsbilder
fand >Galton (1883) „eine ausreichende Verschiedenheit von Fällen,
um beweisen zu können, daß die Stärke von Vorstellungsbildern
kontinuierlich zunimmt, angefangen mit fast völligem Fehlen von Vorstellungen
bis zu ausgeprägten Halluzinationen". Er beobachtete, daß kulturelle
Einflüsse die P.tätigkeit unterdrücken oder verstärken
(anregen) können, z. B. dann, wenn „die nur schwach wahrgenommenen
P.n der Durchschnittsmenschen von hochgestellten Autoritätspersonen
als von großer Bedeutung betrachtet werden ... dadurch, daß
man sich in solchen Fällen regelmäßig mit ihnen beschäftigt,
gewinnen sie immer mehr an Präzision".
NEUERE ERGEBNISSE. Das Konzept des A-Denkens wurde
widerlegt, als man entdeckte, daß registrierbare Phänomene,
auch die schnellen Bewegungen der Augen (REM's = rapid eye movements),
Begleiterscheinungen der Träume zu sein scheinen (>Traum; >Schlaf)
(Aserinsky & Kleitmann, 1958). Durch die Registrierung der REM-Phasen
kann die Traumdauer bestimmt und die Zahl der Träume in einer Nacht
festgestellt werden. Träumen scheint ein allgemein verbreitetes Phänomen
zu sein, und Kleitmann (1963) unterscheidet weniger zwischen Träumern
und Nicht-Träumern als zwischen solchen Menschen, die sich an die
Träume erinnern, und solchen, die sich nicht erinnern können.
Singer und Craven (1961; vgl. Singer, 1966), die Tagträumereien und
allgemeinere P.n mit Hilfe der REM-Phasen untersucht haben, finden einen
Höhepunkt der Tagträumereien in der Gruppe von 18-29 Jahren,
und sie berichten, daß [>1605] 96 % ihrer Versuchspersonen täglich
Tagträume hatten.
Holt (1964) betont die Bedeutung der Erforschung
der P. und der Vorstellungstätigkeit für die der Praxis sehr
nahen Probleme der modernen >Verkehrs- und Betriebspsychologie. Der Test
von R. Gordon (1949), der die Beweglichkeit von Vorstellungsbildern prüft,
und der Test von Bett (1909) für deren Lebhaftigkeit werden immer
mehr verwendet (Richardson, 1969). Synästhesien wurden intensiv von
Luria (1969) an einer Vp untersucht, die diese Art von Vorstellungen hatte.
Heute kennt man viele Pflanzen und deren Extrakte, die das A-Denken hervorrufen;
Untersuchungen der Ethnobotanik lassen vermuten, daß es noch viele
unerforschte Quellen von halluzinogenen Stoffen gibt. Hierin ist ein vielversprechendes
Gebiet für die Erforschung der chemisch stimulierten P. zu sehen (Efron,
Holmstedt & Kline, 1967). Auf diesem Gebiet, ebenso wie bei der Erforschung
der sensorischen Deprivation, wurde der Begriff >„Halluzination" (wie auch
P.) viel zu weit ausgedehnt. Der allgemeinere Begriff >Vorstellung
ist eine zutreffendere Bezeichnung für viele der hier erwähnten
Phänomene.
Lit.: Efron, D. H, Holmstedt, B. & N. S.
Kline (Eds.): Ethnopharmacologic search for psychoactive drugs. Washington,
1967; Galton, F.: Inquiries into human faculty. London, 1883; Holt,
R. R.: Imagery: the return of the ostracized. Amer. Psychologist, 1964;
Kleitman,
N.: Sleep and wakefulness. Chicago, 1963; Luria, A. R.: The
mind of a mnemonist. London, 1969; McKellar, P.: Imagination and
thinking: London, New York, 1957; Rapaport, D.: Organization and
pathology of thought. New York, 1951; Richardson, A.: Mental imagery.
London, 1969; Singer, J. L.: Daydreaming: an introduction to the
experimental study of inner experience. New York, 1966. P. McKellar"
Vollzitat mit freundlicher Genehmigung
des Herderverlages vom 07.08.2017.
Kriterien Diskussion: Es werden folgende
Kriterien genannt: {K04h, K05h, K08m} und an Quellen {Q02, Q03,
Q04, Q05}. Nicht genannt werden: {K01h, K02h, K03h, K06h, K07m}.
Bertelsmann (1995) Lexikon der Psychologie (1995). {}
"Phantasie [griech.], Einbildungskraft (> Imagination); die Fähigkeit, etwas nicht sinnlich Gegebenes und auch nicht erinnerungsmäßig Vergegenwärtigtes anschaulich {K08m} vorzustellen, gleichviel, ob das Ergebnis dieser Vorstellung nur eine neue {K03h} Kombination früherer Wahrnehmungen ist oder eine völlig neuartige Schöpfung, ob es auch in der Wirklichkeit existieren könnte oder nicht {K02h}. - Die Ph. wird oft (neben der > Inspiration) als Hauptbedingung der künstlerischen Produktivität angesehen; andererseits sind auch Traumbilder echte Ph.-Vorstellungen. Die Ph.-Inhalte sind meist durch triebhafte oder emotionale Momente mitbestimmt.
Die biologische Funktion der Ph. wird in der durch die Vorstellungskraft geschaffenen Möglichkeit eines inneren Probehandelns gesehen, das es erlaubt, verschiedene Verhaltensalternativen durchzuspielen, ohne in der Wirklichkeit ein Risiko eingehen zu müssen. Psychologisch gilt die Ph. als ein Intelligenzfaktor, weil sie zum Finden von Problemlösungen {K01h} beitragen kann. Bei S. Freud ist die Ph. den > Primärprozessen zugeordnet."
Kriterien Diskussion: Es werden genannt: {K01h, K02h, K03h, K08m}. Nicht genannt werden: {K04h, K05h, K06h, K07m}.
Boreas (1939) Phantasiebegriff. S. 248: {}
"Phantasie nennen wir die psychische Fähigkeit, die auf Grund von im Bewußtsein vorhandenen Elementen neue {K03h} Vorstellungen {K08m} und neue Bilder schafft. Man unterscheidet zwei Erscheinungsarten der Phantasie, die anschauliche {K08m} und die schöpferische. Die erstere äußert sich in der genauen Erfassung und der deutlichen Darstellung der Bilder, die andere mehr in der vielfachen Verbindung und in der Schöpfung neuer {K03h} Gestalten."
Kriterien Diskussion: Es werden genannt: {K03h, K08m}. Nicht genannt werden: {K01h, K02h, K04h, K05h, K06h, K07m}.
Dorsch "Fantasie {}
(= F.) [engl. fantasy, imagination; gr. ... (phantasia) Vorstellung {K08m}, Erscheinung, Gespinst], gleichbedeutend mit Vorstellungskraft, [KOG, PER], ebenso die Vorstellungen, die neu {K03h} in unser Bewusstsein treten und sich mit den vorhandenen Bewusstseinsinhalten verbinden. Entscheidend ist das Neuartige der F.kombinationen. Sie enthalten meist weder Erinnerung noch Wiedererkennen, wenn sie auch die Neuorganisation von Erfahrenem sein können. Die F. kann absichtlos schweifen {K06h} (passiv) oder planvoll (aktiv), mehr reproduzierend oder rein kombinatorisch geartet sein. Sie kann im Traum {Q02}, durch Drogen {Q04} erzeugt, bei sensorischer Deprivation {Q05}, im Aberglauben {Q07} und vor allem bei Psychosen {Q04} überhandnehmen und die Persönlichkeit beeinträchtigen. Freud ordnete die F. den Primärprozessen (Primärvorgang) zu." [Quelle: https://portal.hogrefe.com/dorsch/fantasie/]
Kriterien Diskussion: Es werden genannt: {K03h, K06h, K08m} und es fehlen: {K01h, K02h, K04h, K05h, K07m}. Als für mich neue Quelle wird Aberglaube genannt, deshalb habe ich Quelle Q07 eingeführt.
Anmerkung: In dem Text erkennt man die Handschrift des Vorläufers (> Giese).
Aus der Enzyklopädie der Philosophie und Wissenschaftstheorie, Mittelstraß (2016, Hrsg.), 2. Auflage, Bd. 6, S. 184f: {}
"Phantasie ... Im heutigen Sprachgebrauch Bezeichnung sowohl für den Vorgang der Einbildung und > Vorstellung {K08m} als auch für das entsprechende Vermögen, und zwar im Sinne der Produktion neuer wie der Neukombination {K03h} erinnerter Denk- und Vorstellungsgehalte.
P. gilt als unabdingbar für alltagspraktische, künstlerische, technische und wissenschaftliche Kreativität und > Spontaneität (>spontan / Spontaneität). Auf Grund ihres möglichen antizipatorischen (>Antizipation) Charakters können P.n motivationale Bedeutung haben (> Motiv), auf Grund ihrer wirklichkeitsignorierenden {K02h} und wirklichkeitsüberbietenden Tendenz Realitätsflucht begünstigen (>Leben in der bloßen P.<). Dieser möglichen negativen Funktion entsprechend werden P.n psychopathologisch {Q04} nach dem Grad unterschieden, in dem sie das Realitätsbewußtsein eines Menschen einschränken (von gesteuerten und ungesteuerten P.n {K06h} im Wachzustand und bei vollem Bewußtsein ihrer Irrealität bis zu Träumen {Q02}wahrend des Schlafs und Trug- und Wahnvorstellungen bei Psychosen). {Q04} ... ..."
Kriterien Diskussion: Es werden genannt: {K02h, K03h, K06h} und es fehlen: {K01h, K04h, K05h, K07m}.
Giese (1920) Psychologisches Wörterbuch
"Phantasie [gr. phantasia Vorstellung] Vorst., die als neu {K03h}, fremd in unser Bew, treten und sich mit dem vorhandenen Bew.Inh. verbinden. Sie zeigen weder Erinnerung, noch Wiedererkennen, sondern stellen neue, spielerisch verknüpfte Gedankenverbindungen dar, die meist lustbetont sind. Ph. kann absichtslosschweifend {K06h} = (passiv), planvoll-zielbewußt (= aktiv), mehr *reproduzierend oder rein *kombinatorisch geartet sein. Ihr Inhalt ist *konkret oder *abstrakt, vorst.-reich oder -arm, abstrahierend oder determinierend, subj. oder obj. Die höchste Art der Ph. zeigt sich erlebt vom Künstler. Sie ist in bescheidener Weise erforschbar durch Beob. künstlerisch schaffender Menschen, Sammlung von Selbstzeugnissen, durch Stellen von Erfindungsaufgaben, Ausdeutenlassen von Bildern und sinnlosen Figuren (s. Intelligenzprüf.), Analyse der Träume"
Kriterien Diskussion: Es werden genannt: {K03h, K06h, K08m} und es fehlen: {K01h, K02h, K04h, K05h, K07m}. Interessant ist, dass Giese auch unanschauliche Inhalte für phantasieren zulässt.
Spektrum Lexikon der Psychologie {}
"Phantasie 1) Produktionskraft des Bewußtseins, wie Märchen oder Mythen als eine besondere Verarbeitungsform der Wirklichkeit. Der Entwurf von Alternativen {K03h} im Gegensatz zur Realität kann unterschiedliche Bedürfnisse {K04h} erfüllen: a) ästhetische Bedürfnisse, um den persönlichen Erlebnisraum zu vergrößern; b) praktische Bedürfnisse, um Konsequenzen in der Zukunft {K07m} gedanklich vorwegzunehmen (Problemlösen). c) Ersatzbefriedigung {K04h}, indem das durch den Alltag beschädigte Selbstbewußtsein durch Tagträume und Utopien ausgeglichen wird. Das Phantasieren hilft, Wohlbehagen und narzißtisches Gleichgewicht zu stabilisieren, und Bedrohungen oder beschämende Erfahrungen abzuwehren. Es ist außerdem eine Quelle kreativer Handlungen (Kreativität). 2) Zentraler, mehrdeutiger Begriff der Psychoanalyse: a) Phantasie im Sinne von Einbildungskraft, d.h. als Vermögen zu imaginieren; b) Phantasien als Inhalte der phantasierten, imaginären Welt {K02h}; c) Phantasie als schöpferische Aktivität, die diese Phantasie-Inhalte belebt. Nach Freud sind Phantasien auf die stimulierende Funktion von Triebimpulsen zurückzuführen. Phantasietätigkeit sei der Gegensatz zum realitätsgerechten Denken, die Fortsetzung des Kinderspiels, sie sei mit Träumen verwandt und würde aus Wunschvorstellungen {K04h} heraus gebildet. Ihre Funktion sei, in der Wirklichkeit nicht gegebene Befriedigungsmöglichkeiten {K02h} auszumalen und Lustwünsche unabhängig vom Triebobjekt zu befriedigen {K04h}. Im Gegensatz zur Vorstellung beinhalte Phantasie eher eine Szenen- oder Handlungsabfolge, bei der die Realitätsprüfung weitgehend ausgeschaltet wird."
Kriterien Diskussion: Es werden genannt: {K02h, K03h, K04h, K07m} und es fehlen: {K01h, K05h, K06h, K08m}.
Husserl (1980), S. 4: Zum Phantasiebegriff {}
- "15 ... ...
... ...
Sicherlich spielt im gewöhnlichen Wortsinn der Phantasie ein
Moment seine Hauptrolle: Das Phantasieren ist gegenübergesetzt
dem Wahrnehmen und dem anschaulich Für-wahr-Ansetzen des
20 Vergangenen und Künftigen, kurz, allen Akten, die individuell
Konkretes als seiend ansetzen. Die Wahrnehmung lässt uns eine
gegenwärtige Wirklichkeit als gegenwärtig und als Wirklichkeit
erscheinen, die Erinnerung stellt uns eine abwesende Wirklichkeit
vor Augen, nicht zwar als selbst gegenwärtig, aber doch als
25 Wirklichkeit. Der Phantasie hingegen fehlt das auf das Phan-
tasierte bezogene Wirklichkeitsbewusstsein {K01h}. Ja noch mehr. Ge-
meiniglich drückt das Wort, zumal das parallele Wort „Einbil-
dung”, die Un-Wirklichkeit{K01h}, die Vorspiegelung aus, das
Phantasierte ist bloss Einbildung, d.h. bloss Schein {K01h}. Freilich
30 merken wir auch, dass nicht jeder Schein, auch nicht jeder sinn-
lich-anschauliche Schein als Einbildung, als Phantasieschein gilt.
Die Quelle des Scheins muss im Subjekt liegen, der Schein muss
dem Subjekt, seinen Tätigkeiten, seinen Funktionen, seinen
Dispositionen zugerechnet werden. Wird er physikalischen Grün-
35 den zugerechnet, gründet er in der äusseren Natur, wie der ge-
brochene Stab im Wasser, der wundermächtig aufgehende Mond
u.dgl., dann spricht man nicht von einer Phantasieerscheinung."
Kriterien Diskussion: Das grundlegend wichtige Kriterium {K01h}, wonach es darauf ankommt, dass ein Geschehen nur im Geiste und nicht in der realen Wirklichkeit stattfindet, das bei den meisten Definitionsversuchen fehlt, hat bei Husserl den gebührenden zentralen Stellenwert. Und er bestimmt auch sehr klar: "Die Quelle des Scheins muss im Subjekt liegen." Es fehlen in dieser Zitatstelle alle anderen: {K02h, K03h, K04h, K05h, K06h, K07m, K08m}.
Kritik: Husserl analysiert zwar sorgfältig, aber nur sein eigenes Bewusstsein - das er damit zum Maßstab aller Wissenschaft macht - und sein Wissen (auf das er nach seiner eigenen Reduktions-Lehre verzichten müsste) und das er auch nicht belegt. Auf konstruktive Definitionen verzichtet er, weil er seine Phänomenologie und Wesensschau fundamental für vorgeordnet hält. Es ist natürlich völlig klar, dass man um sein Vorverständnis, seine Erfahrungen und Vorurteile zu kontrollieren - eine große Stärke der Phänomenologen - , dieses explizit heranziehen und untersuchen muss. Damit wird aber - wenn auch naive und unkritische - Psychologie betrieben, der Husserl eigentlich sagen möchte, wie sie seiner Meinung nach zu betreiben ist. Seine Behauptung, Wesensschau sei keine Tatsachenwissenschaft ist völlig falsch. Um zum Wesen vorzustoßen, muss er vergleichen, nämlich was er - besser wäre auch noch andere - erlebt, erfahren hat und weiß. Wie will er denn herausfinden, dass es das Wesen des Dreiecks ist, drei Ecken zu haben, wenn er nicht viele Dreiecke miteinander vergleicht? Mit diesen Vergleichen befindet sich in der Welt der Tatsachen. Das nicht erkennen ist sein Grundwiderspruch.
James, William Phantasie aus der Psychologie (1909) > ausgelagert, da zu umfangreich. Obwohl nicht ausdrücklich methodisch erläutert, beginnt James mit Definitionscharakteristiken (Abbilder neu kombiniert := Phantasie). Er hat viele Selbstversuche gemacht und empirisches Material zusammengetragen, was ihn wohltuend hervorhebt. {}
Einige Extrakte
- "Die Fähigkeit, solche Abbilder früher erlebter Originale zu reproduzieren, wird Phantasie oder Einbildungskraft genannt. {K08m} Wir heißen die Phantasie „reproduktiv", wenn die Abbilder dem Original genau entsprechen; „produktiv", wenn Elemente von verschiedenen Originalen zusammengefügt werden, so daß ein neues Ganzes {K03h} entsteht.
- "Galton begann im Jahre 1880 eine statistische Untersuchung, von der man sagen kann, daß sie eine neue Phase in der Entwicklung der deskriptiven Psychologie herbeigeführt hat. Er schickte an eine große Anzahl von Leuten ein Zirkular mit der Aufforderung, das optische Erinnerungsbild, ihres Frühstückstisches an einem gegebenen Morgen zu beschreiben. Die dabei beobachteten Verschiedenheiten waren enorm; und sonderbarerweise zeigte es sich, daß wissenschaftlich hervorragende Menschen im Durchschnitt eine geringere Fähigkeit zur Visualisierung bezeugten, als jüngere und unbedeutendere Personen." (S. 304)
- Im weiteren (304-309) geht es um Erinnerungs- und Vorstellungstypen bis James S. 309 unten auf Pathologische Verschiedenheiten zu sprechen kommt, wobei er zunächst feststellt: "Das Studium der Aphasie (Seite 111) hat in den letzten Jahren gezeigt, wie über alle Erwartung groß die Verschiedenheit der Individuen im Gebrauch [>310] ihrer Phantasie ist."
Werden diese Bilder {K08m} mit Begleitumständen vorgestellt, die konkret genug sind, um ein Datum zu konstituieren, dann bilden sie, wenn sie erweckt werden, Erinnerungen. Den Mechanismus der Erinnerung haben wir soeben kennen gelernt. Wenn diese geistigen Bilder sich aus frei kombinierten Gegebenheiten zusammensetzen und keine frühere Kombination genau wiedergeben, dann haben wir es mit eigentlichen Akten der Phantasie zu tun.
Die Menschen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer optischen Phantasie. — Unsere Ideen oder Bilder von vergangenen sinnlichen Erlebnissen können entweder deutlich und genau oder dunkel, verwischt und unvollständig sein. " (S. 303)
Kriterien Diskussion: In diesen Extrakten werden genannt: {K03h, K08m}. Bemerkenswert ist, dass James anschauliche Reproduktionen von Erinnerungen der Phantasie zuordnet. Im übrigen betont James die enorme Vielfalt, die bereits damals bei Untersuchungen (z.B. Aphasie-Studien) festgestellt wurde.
Lucka, Emil (1908) Die Phantasie. Eine psychologische Untersuchung. Leipzig: Braumüller.
- Lucka 1908 Inhaltsverzeichnis
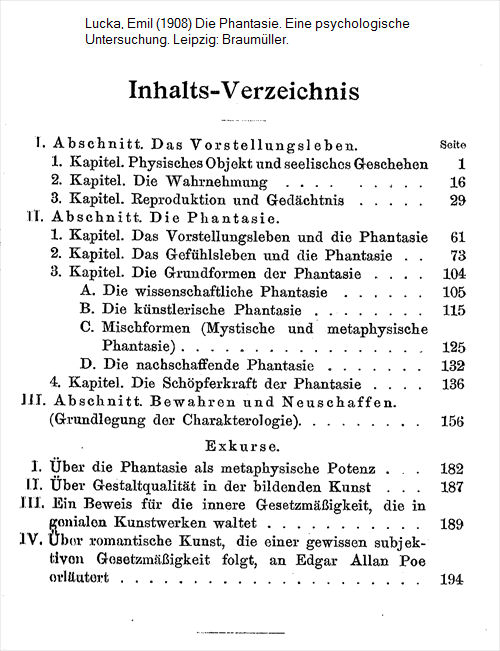
Lucka: Verlagerung {}.
Quelle Lucka (1908), S. 63: "Eine interessante Abart der Bildkombination
findet sich besonders im Traume {Q02} häufig. Ein Gebilde wird
in eine ganz neue Umgebung {K03h} versetzt, durch die es selbst
in seiner Gestalt verändert wird. So kann z. B. das gutmütige
Gesicht eines Bekannten auf dem eisengepanzerten Leib eines Condottiere
gesehen {K08m} werden, der unbewegt über ein Leichenfeld reitet.
Die neue Umgebung wirft ihren blutigen Reflex auf das vertraute, anders
gewordene Gesicht."
Kriterien Diskussion: In dem kurzen Ausschnitt
werden genannt: {K03h, K08m} und die Quelle {Q02}.
Lucka: Kombinationen
durch Wiederholung {}.
Quelle Lucka (1908), S. 63: "Oder die Kombination {K03h} entsteht
durch eine Wiederholung des gleichen Gebildes. Das gesehene und
später wiedererinnerte Bild {K08m} eines römischen Soldaten
kann vielleicht zur Vorstellung einer ganzen Legion werden. Auch hier ist
Kombination {K03h} im Spiel: die Vorstellung einer geordneten Menschenmenge
tritt gewissermaßen mit der des Söldners in Beziehung und formt
sie um {K03h}."
Kriterien Diskussion: In dem kurzen Ausschnitt
werden genannt: {K03h, K08m}.
Lucka: Überlagerungen {}.
Quelle Lucka (1908), S. 63: "2. Ein ganz typisches Gebilde der
Traumphantasie ist es, daß verschiedene Bilder {K08m} nicht
wie in der Kombination zu einem gegliederten Neuen verschmelzen, sondern
sich gewissermaßen übereinander lagern, ohne doch ein neues
Bild entstehen zu lassen. Etwas Unbestimmtes, Unfaßbares haftet diesen
Gebilden an. Die unklare Vorstellung eines Menschen ist da, der aber doch
wieder ein wildes Tier, dann ein Berg zu sein scheint {K05h}. Verschiedene
Vorstellungen {K08m} fallen wie halbdurchsichtige Bilder übereinander,
hemmen sich gegenseitig und bilden doch nichts geformtes Neues."
Kriterien Diskussion: In dem kurzen Ausschnitt
werden genannt: {K05h, K08m}.
Ribot, Theodule (dt. 1902; orig 1900) Die Schöpferkraft der Phantasie. > Inhaltsverzeichnis.
- Phantasie bei einer
Begegnung {}.
Quelle Ribot (1902), S. 224: "... Von vielen Beispielen gebe ich nur eins. Einer meiner Gewährsmänner schreibt mir, wenn seine Aufmerksamkeit sich in der Kirche, im Theater, auf Plätzen ober Bahnhöfen auf irgend eine Person, Mann oder Frau, richte, stelle er sich sogleich nach ihrem Aussehen, ihrer Kleidung und ihrem Benehmen ihre augenblickliche und frühere Lage, ihre Lebensweise und Beschäftigung vor und sogar das Stadtviertel, in dem sie lebe, ihre Wohnung mit Einrichtung u.s.w., eine in den meisten Fällen irrige {K02h} Konstruktion, wofür ich mannigfache Beweise habe. Sicherlich ist diese Veranlagung normal; sie entfernt sich vom Durchschnitt nur durch eine ungewöhnliche Phantasiekraft, die bei anderen durch eine übermäßige Neigung zur Beobachtung und Analyse, zur Kritik, zum logischen Denken oder zu Spitzfindigkeiten ersetzt ist. Um den entscheidenden Schritt zu tun, um anormal zu werden, muß eine weitere Bedingung hinkommen, die Intensität der Vorstellungen. {K08m}"
Anmerkung: Ribot geht von der Phantasie direkt zu Vorstellungen über, als ob das für ihn das Gleiche sei.
Kriterien Diskussion: In dem Beispiel werden genannt: {K01, K02h, K08m}.
Bilder als Kriterium bei Rubinstein (1968), S. 410 {}
Kriterien Diskussion: Es werden genannt: {K02h, K03h, K08m} und es fehlen: {K01h, K04h, K05h, K06h, K07m}.
Sanders Phantasietest (Fortsetzung einer angefangenen Zeichnung) {}.
"Bei diesem Test wurden die Probanden dazu aufgefordert eine Zeichnung fortzusetzen, die bereits mit ein paar Linien und Kurven auf einem Blatt begonnen wurde. Er wurde nur 1955 und nur bei den Kriegskindern verwendet." [Q]
Kriterien Diskussion: Diesem kurzen Text sind zwei Kriterien zu entnehmen: {K05h, K06h}. Wichtig ist hier noch, dass die Phantasieäußerung auf der Handlungsebene erfolgt (wie im kindlichen Spiel).
Berger (1939), führt S. 500f zum Sander'schen Phantasietest aus:
Der Phantasietest, wie ihn F. SANDER seit 1920 im psychologischen Praktikum anwendet und 1927 zum erstenmal an einem Beispiel beschrieben hat [FN1]), besteht aus Vorlagen, die in einem rechteckigen Rahmen „zusammenhanglose Teilgestalten" aufweisen, die als „Glieder in ein gestalthaftes Ganzes einzubauen" sind [FN2]). Der Test diente ursprünglich der Untersuchung struktureller Angelegtheiten des Gestalterlebens. Es erwies sich bald, daß damit auch andere Seiten des seelischen Gesamtgefüges erfaßt werden. „Die meisten dieser Lösungen leuchten blitzartig auf in einem ausgesprochen gefühlsartigen Vorgestalterlebnis und gewähren Einblick in wesentliche Züge schöpferischer Phantasie, in die individuelle Struktur ihres Urhebers und die durch individuelle Erlebnisniederschläge gestifteten Einstellungen" [FN2]). Das Problem dieser Art Phantasietest erscheint in der Literatur noch in zwei Arbeiten E. WARTEGGS [FN3]). WARTEGG berichtete erstmalig 1934 über Ergebnisse, die er mit dem Zeichentestverfahren erzielt hat. WARTEGGS Zeichentest zeigt genau dasselbe [>501] Prinzip wie der von F. SANDER und unterscheidet sich von diesem nur in der Anordnung der Gegebenheiten und in der Bearbeitungsweise. WARTEGG gibt eine Vorlage, die in 8 kleine Teilflächen eingeteilt ist. Jede dieser Teilflächen enthält eine besondere Anordnung der Ausgangsfiguren. Diese sollen, wie es auch in F. SANDERS Instruktion verlangt wird, von der Vp. zu einem Ganzen ergänzt werden, jedoch besteht hier bei F. SANDER der Vorzug, daß die Vorlage beliebig gedreht werden kann, während sie bei WARTEGG in einer bestimmten Lage gegeben wird. ..."
- FN1) F. SANDER, Experimentelle Ergebnisse der Gestaltpsychologie.
Bericht über den X. Kongreß für experimentelle Psychologie
in Bonn, Jena 1928. S. 64 ff.; ders., Zur neueren Gefühlslehre. Bericht
über den XV. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
in Jena 1937. S. 43.
FN2) F. SANDER, Exp. Ergebn., a. a. 0. S. 66.
FN3) E. WARTEGG, Gefühl. Neue Psychologische Studien, Bd. XII, Leipzig 1934. S. 121—127; ders., Gefühl und Phantasiebild. Bericht über den XV. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Jena, Jena 1937. S. 70—81."
Segals Phantasiebegriff (1916) .
Das Buch Segals ist eine hochinteressante und reiche Sammlung mit sehr vielen Fundstellen von 12 hochprofessionellen Versuchspersonen (studierte PsychologInnen) für viele Phantasien. Diese Arbeit ist echter empirischer Schatz für die Phantasieforschung.
Letztes und 11. Kapitel Zum Begriff der Phantasie, S. 490-492: {}
"... Überall [>491] sehen wir hier, daß die „alte" Situation und die „alte" Umgebung, in der wir uns wirklich befinden, zurücktritt und daß die neue, sei es vorgestellte oder wahrnehmungsmäßig gegebene und dargestellte ihre Stelle einnimmt. Überall ist die Folge, daß unser Ich in die neue Situation versetzt wird und zwar entweder als bloßer Zuschauer oder als handelnde, fühlende und denkende Persönlichkeit {K01h}. Wenn wir uns auf die Fälle beschränken, in welchen die neue Situation nur vorstellungsmäßig {K08m} gegeben wird, so werden wir das Gemeinsame des Traumes {Q02}, des Wachträumens {K06h} und des ästhetischen Verhaltens während der Lektüre darin sehen, daß wir in den vorgestellten Situationen, welche den Wirklichkeits- und den Gegenwartscharakter tragen, uns passiv oder aktiv verhalten, daß wir von einem idealen Standort aus sie betrachten, in ihnen handeln, denken und fühlen. Dieses Gesamtverhalten, welches verschiedene Grade der Kompliziertheit von dem bloßen „unpersönlichen Sehen" einer Situation „irgendwo" bis zu dem persönlichen Handeln, Fühlen und Denken in der vorgestellten {K08m} Situation, die sich im „realen Raum", d. h. in einer bekannten Umgebung oder auch „irgendwo" befinden, glauben wir Phantasievorgang nennen zu dürfen {K01h}.Und zwar können wir von einem Phantasievorgang im engeren Sinne sprechen, wenn wir den Nachdruck auf das vorstellungsmäßige Gegebensein {K08m} der Situation legen, und von Phantasievorgang im weiteren Sinne, wenn wir auch das ähnliche Verhalten in den dargestellten und wahrnehmungsmäßig zugänglichen Situationen in Betracht ziehen. Wenn wir den Phantasiebegriff in so weitem Sinne nehmen, finden wir uns in Übereinstimmung mit dem Sprachgebrauche, der zur Phantasietätigkeit nicht nur die Träume und das Wachträumen, sondern auch das ästhetische Verhalten und das Spiel. rechnet. Jetzt sehen wir, daß dieser Sprachgebrauch auf einer richtigen psychologischen Beobachtung beruht.
Wir verhehlen uns freilich nicht, daß im Sprachgebrauche noch vieles andere Phantasie heißt und daß es einfach unmöglich ist, einen einheitlichen Phantasiebegriff zu finden, welcher mit alledem, was der Sprachgebrauch Phantasie nennt, im Einklang stehen würde. Wir glauben aber nicht, daß ein solcher Einklang das Ziel wissenschaftlicher Begriffsbildung ist. Wir dürfen nicht vergessen, daß auf die Bildung des populären Phantasiebegriffs [>492] viele heterogene und auch manchmal völlig einander entgegengesetzte und widersprechende Gesichtspunkte zusammengewirkt haben. Da macht sich einmal der Gesichtspunkt der Neuheit der Vorstellungen {K03h} und der „Produktivität" („neue Kombination aus früheren Wahrnehmungselementen", z.B. eine grüne Schultafel), also der des Ursprungs der Vorstellungen {K08m} geltend, dann der Gesichtspunkt der phänomenologischen Eigenart der Gegebenheitim Unterschied zu anderen Gegebenheiten, dann wiederum der erkenntnistheoretische Gesichtspunkt der Unwirklichkeit im Gegensatz zur Realität (z. B. Vorstellung von dem Zentaur, der nur „Phantasie" ist) {K02h}, der Gesichtspunkt der Deutlichkeit und der Lebhaftigkeit der Vorstellungen {K08m}, der Gesichtspunkt der Originalität der Leistungen auf allen Gebieten des seelischen Lebens (so spricht man von wissenschaftlicher Phantasie des Mathematikers und des Philosophen) und noch manche andere. Allen diesen Gesichtspunkten in einem Begriffe Rechnung tragen zu wollen, wäre ein erfolgloses Unternehmen.
Unser Begriff der Phantasie, die wir ganz allgemein als ein Denken, Fühlen und Wollen in vorgestellten Situationen mit Wirklichkeits- und Gegenwartscharakter {K01h} definieren können, berücksichtigt das charakteristische psychische Gesamtverhalten des Individuums, die phänomenologische Eigenart der Vorstellungsgegebenheit, mag die letztere eine originelle produktive Leistung sein, oder bloß ein Nacherleben einer Situation, die man schon einmal erlebt hat und an die man sich erinnert. Die wichtige Tatsache, daß die Vorstellungsgegebenheiten, die ursprünglich mit dem Erinnerungscharakter auftreten, im weiteren Verlauf sich in Vorstellungsgegebenheiten mit dem Gegenwartscharakter verwandeln, gibt uns ein Recht dazu. Wir richten uns hier nicht nach dem Ursprung der Gegebenheit, sondern bloß sozusagen nach ihrem Aussehen im Bewußtseinsquerschnitt. Und in dieser Beziehung unterscheidet sich das Phantasieren über ein neues Thema von dem Phantasieren, das sich mehrere Male wiederholt, gar nicht. Dafür sprechen nicht bloß Tatsachen, die wir unseren Versuchen entnehmen, sondern auch viele Tatsachen aus dem täglichen Leben. So geschieht es. nicht selten, daß man während des Wachträumens {K06h, Q02}, das das typische Beispiel des Phantasierens ist, zu denselben Situationen und Ereignissen zurückkehrt: ..."
Kriterien Diskussion: Es werden genannt: {K01h, K02h, K03h, K05h, K06h, K08m} und es fehlen nur: {K04h, K05h, K07m}.
Anmerkung zu den Versuchspersonen,
S. 302: "An den Versuchen beteiligten sich die Vpn.: Miss Tucker und die
Herren: Dr. Behn, Dr. Bühler, Dr. Grünbaum, Prof. Külpe,
stud. phil. Noltein, cand. phil. Pohl, cand. phil. Rangette, cand. phil.
Rüster, Dr. Silberstein und Dr. Wirtz. Ihnen allen soll auch an dieser
Stelle ein herzlicher Dank ausgesprochen werden. Außer diesen Vpn.
fungierte auch der Verfaßer als Vp. Die Vpn. sind im Folgenden mit
den Zahlen I—XII bezeichnet, wobei zu bemerken ist, daß die Zahlen
nicht der Reihenfolge entsprechen, in der die Vpn. oben genannt worden
sind. Wir möchten hier betonen, daß manche Vpn. die Anonymität
ausdrücklich gewünscht haben. Vp. XII ist der Verfasser. Alle
Vpn. zusammen reagierten auf 1977 Reizwörter, nämlich die Vp.
I auf 182, II auf 200, III auf 76, IV auf 200, V auf 182, VI auf 188, VII
auf 181, VIII auf 157, IX auf 206, X auf 212, XI auf 90 und XII auf 103
Rw."
Stern, William (1950) 18. Kap.: Phantasie und 19. Kap.: Sonderfunktionen der Phantasie (Träumen, Spielen Schaffen) in Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage. in Arbeit. Im Netz als PDF.
Titchener (1912) § 119 Die Phantasievorgänge. Volltext ausgelagert. {}
Einige Extrakte hieraus:
- S. 422, Neues Kriterium {K-Titm}: von einem
Gefühl der Neuheit oder Fremdheit umgeben
"Soviel scheint aber klar zu sein, daß eine Vorstellung {K08m} nur dann für uns eine Phantasievorstellung sein kann, wenn sie als eine unbekannte {K03h} in unser Bewußtsein eintritt und von einem Gefühl der Neuheit oder Fremdheit {neues, von mir bislang nicht erfasstes Kriterium} umgeben ist; dieses Gefühl der Fremdheit ist für die Phantasie ebenso wichtig wie das der Bekanntheit für das Gedächtnis. Die Bewußtseinslage bei der Phantasievorstellung kann dann entweder die der aktiven oder der passiven Aufmerksamkeit sein (S. 275 f.), und wir sprechen je nachdem von passiver oder reproduktiver und von aktiver, schöpferischer oder konstruktiver Phantasie. In beiden Fällen ist das Bewußtsein eher synthetisch als diskursiv. Der Umfang der Aufmerksamkeit ist begrenzt, das Spiel der Assoziationen geregelt. Die schöp[>423]ferische Phantasie geht in Denken über und vollendet so den psychologischen Entwicklungsgang von S. 414."
S. 424, "Nach der ersteren Hypothese ist das mit Phantasie begabte Individuum der Träumer der Träume {Q02} und der Seher der Visionen {Q04?};
S. 424f: "Welches sind nun die fokalen Vorgänge? Es liegt natürlich nahe zu sagen — Vorstellungsbilder {K08m}. Und die Antwort ist wahrscheinlich richtig, wenn es gestattet ist den Ausdruck „Vorstellungsbild" entsprechend zu definieren. In vielen Fällen sind es Bilder im wörtlichen Sinne, visuelle, akustisch-kinästhetische, kinästhetische. In vielen Fällen sind es Wortvorstellungen. Aber der Name muß auch auf Vorgänge ansgedehnt werden, die nur noch Symbole für ein Wahrnehmungserlebnis sind, und der Wahrnehmung selbst nicht ähnlicher als etwa der gedruckte Bericht über eine Theateraufführung dieser Aufführung selbst. Wenn wir die Phantasievorstellungen jenseits des Stadiums der wahr[>425]nehmungsartigen Zusammengesetztheit |§ 118) verfolgen, so finden wir, daü sie eine Übertragung und eine Vereinfachung erfahren: eine Übertragung von einem Sinnesgebiet in ein anderes entlang der Linie des kleinsten nervösen Widerstandes; und eine Vereinfachung von der expliziten Abbildung zur symbolischen. Vereinfachung bedeutet nicht Annäherung an einen Typus; vielmehr tritt eine Schematisierung ein, eine Teilansicht oder ein Fragment des Ganzen vikariiert für das Ganze selbst wie ein stenographisches Zeichen. Dies scheint das einzig wahre an der herkömmlichen Behauptung zu sein, daß die Phantasievorstellungen dazu neigen, sich ins allgemeine und abstrakte zu verflüchtigen und zu Schatten ihres einstigen Selbst herabzusinken. Sie verflüchtigen sich überhaupt nicht in dem gewöhnlichen Sinne des Wortes, im Gegenteil behalten sie alle, die eigentlichen Reproduktionen, die Wörter und Symbole, eine beinahe sensorische Beständigkeit und Realität; das ist der Punkt, den wir schon betont haben, und den wir vor allem im Auge behalten müssen; aber sie werden einfach und konventionell, und werden aus Abbildern zu bloßen Symbolen.
Der Leser bedenke, daß diese Darstellung nur ein Versuch ist und über die experimentellen Tatsachen weit hinaus geht. Sie hat das Verdienst die zwei oben erwähnten Hypothesen zu vereinheitlichen und stimmt mit den bisherigen Befunden der Selbstoeobachtung überein. Sie kann indessen durch zukünftige Untersuchungen erheblich verändert werden"
Kriterien Diskussion: Es werden genannt: {K03h, K08m, K-Titm} und es fehlen: {K01h, K02h, K04h, K05h, K06h, K07m}. Das Kriterium K-Tit := von einem Gefühl der Neuheit oder Fremdheit umgeben ist eine Neukreation von Titchener, die ich in meinen bisherigen Literaturrecherchen nicht gefunden hatte. Ich werde es nicht übernehmen, da es bestensfalls hin und wieder, eher selten als Gefühl - als eine Art Gegenstück zum Déjà-vu - vorkommen dürfte.
Wundt (1918) zur Phantasie > Gesamttext ausgelagert, da zu umfangreich. {}
Wundt erkennt zwar zu Beginn des § 17 den konstruktiven Charakter der Analyse der Bewusstseinsvorgänge, aber er verfolgt ihn nicht konsequent und redet so, als entsprächen seine Interpretationen DER Wirklichkeit, DIE es so nicht gibt, weil sie notwendigerweise konstruiert werden muss. Die konstruktive Notwendigkeit der Begriffsunterscheidungen für die Teile des Bewusstseinsstroms ist aber vielfach auch heute von der akademischen Psychologie nicht verstanden. Unser Erleben - nach Wundt zutreffend eine "Gesamtvorstellung" - gibt es natürlich, aber wie wir es wissenschaftlich erfassen, dafür gibt es mindestens mehrere, wenn nicht viele Wege und damit Konstruktionen. Ohne konsensorientierte Normierung wird die wissenschaftliche Psychologie nicht weiter kommen.
Einige Extrakte zunächst aus § 17 Apperzeptionsverbindungen:
- "14. Insofern die Vorstellungsbestandteile {K08m} eines durch apperzeptive Synthese entstandenen Gebildes als die Träger des übrigen Inhaltes betrachtet werden können, bezeichnen wir ein solches Gebilde allgemein als eine Gesamtvorstellung."
- "praktisch kaum eine scharfe Grenze zwischen Phantasie- und Erinnerungsbild zu ziehen." (§ 17)
- "Man kann daher in Phantasiebildern {K08m} sich ergehen wie in wirklichen Erlebnissen. Bei Erinnerungsbildern ist das nur dann möglich, wenn sie zu Phantasiebildern werden, d. h. wenn man die Erinnerungen nicht mehr bloß passiv in sich aufsteigen läßt, sondern bis zu einem gewissen Grade frei {K06h} mit ihnen schaltet, wobei dann freilich auch willkürliche Veränderungen {K03h} derselben, eine Vermengung erlebter und erdichteter Wirklichkeit, nicht zu fehlen pflegt. Darum bestehen alle unsere Lebenserinnerungen aus "Dichtung und Wahrheit". Unsere Erinnerungsbilder wandeln sich unter dem Einfluß unserer Gefühle und unseres Willens in Phantasiebilder um, über deren Ähnlichkeit mit der erlebten Wirklichkeit wir meist uns selbst täuschen. {K02h}" (§ 17)
- "18. Phantasie- und Verstandestätigkeit sind nach allem dem nicht spezifisch verschiedene, sondern zusammengehörige, in ihrer Entstehung und in ihren Äußerungen gar nicht zu trennende Funktionen, die in letzter Instanz auf die nämlichen Grundfunktionen der apperzeptiven Synthese und Analyse zurückführen." (§ 17)
- "Indem sich diese ungehemmte Beziehung und Verknüpfung {K03h} der Phantasiebilder mit Willensantrieben verbindet, die den Vorstellungen {K08M} gewisse, wenn auch noch so dürftige Anhaltspunkte in der unmittelbaren Sinneswahrnehmung zu schaffen suchen, entsteht der Spieltrieb des Kindes. Das ursprüngliche Spiel des Kindes ist ganz und gar Phantasiespiel, während umgekehrt das des Erwachsenen (Kartenspiel, Schachspiel, Lotteriespiel u. dgl.) fast ebenso einseitig Verstandesspiel ist. ... " (§ 20)
- "10. Aus der ursprünglichen phantasiemäßigen Form des Denkens entwickeln sich nun sehr allmählich die Verstandesfunktionen, indem in der früher (§ 17, 16 f.) angegebenen Weise die in der Wahrnehmung gegebenen oder durch kombinierende {K03h} Phantasietätigkeit gebildeten Gesamtvorstellungen in ihre begrifflichen Bestandteile, wie Gegenstände und Eigenschaften, Gegenstände und Handlungen, Verhältnisse verschiedener Gegenstände zueinander, gegliedert werden. ..." (§ 20)
- Kriterien Diskussion: Es werden genannt: {K02h, K03h, K06h,
K08m} und es fehlen: {K01h, K04h, K05h, K07m}.
Gesamt-Inhaltsverzeichnis Psychologische Analyse des Phantasiebegriffs.
Standort: Psychologische Analyse des Phantasiebegriffs Teil 4 Beispiel-Analysen einiger Phantasieeinträge in Büchern, Wörterbüchern und Lexika
*
- Definieren und Definition. * ist * Nicht * Alle & Jeder * Paradoxien * Was ist Fragen * Welten *
- Überblick Forensische Psychologie in der IP-GIPT * Aussagepsychologie.
- Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben.
- Definitionen, Nominal- und Realdefinitionen (Abschnitt aus der Testtheorie).
- Definition aus Eisler Wörterbuch der philosophischen Begriffe (1927-1930).
- Einführung in die Definitionsproblematik am Beispiel Trauma.
- Zum Universalienstreit am Beispiel der Schneeflocke.
- Gleichheit und gleichen im alltäglichen Leben und in der Wissenschaft. Näherungen, Ideen, Ansätze, Modelle und Hypothesen.
- Aufbau einer Wissenschaftssprache in Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie.
- Allgemeine Theorie und Praxis des Vergleichens und der Vergleichbarkeit. Grundlagen einer psychologischen Meßtheorie.
- Überblick Wissenschaft in der GIPT.
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Definition definieren site: www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Psychologische Analyse des Phantasiebegriffs, Teil 4 Fachliteratur: Beispiel-Analysen einiger Phantasieeinträge in Büchern, Wörterbüchern und Lexika. Ein Ansatz und Entwurf aus integrativer Perspektive zur Weiterentwicklung. Internet Publikation - General and Integrative Psychotherapy IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/allpsy/phantas/APBFP4.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, wie bei einigen Zitaten, sind die Nutzungsrechte bei den Copyrightinhabern zu erkunden und die Erlaubnisse einzuholen. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen
korrigiert: 25.08.2017 irs
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
30.10.17 Zur Philosophie-Geschichte des Phantasiebegriffs (Links zu Eislers Wörterbuch der philosophischen Begriffe).
06.09.17 Kritik Husserl.
31.08.17 Boreas Arbeiten erfasst.
30.08.17 Titchener (1912) § 119 Die Phantasievorgänge.
28.08.17 Segals Phantasiebegriff (1916) im Teil 4 erfasst.
26,08,17 IRS Korrektur
24.08.17 1. Version ans Netz.
23.08.17 rs Rechtschreibprüfung.
07.08.17 Nach Vorarbeiten angelegt.
Materialien