(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=20.11.2019 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 25.11.19
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_ Begriffsanalyse Dialektik im engeren logische Sinne_Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:
Materialien zur Dialektischen
Logik im engeren, logischen Sinne
Materialien zur Begriffsanalyse
und Untersuchungen zur Dialektik
Zur Einführungs,
Haupt- und Verteilerseite Dialektik.
_

Originalarbeit von Rudolf
Sponsel, Erlangen
_Aufgrund gelegentlicher
Ergänzungen und Korrekturen mit F5-Taste updaten empfohlen
Vorbemerkung
Ein formal dialektisch-logischer Kalkül wurde meines Wissens bislang nicht entwickelt (auch nicht von Günther, eher von Bense), was angesichts der weltweit logisch-mathematischen Kompetenzen sehr verwundert. Selbst in den drei Logikbüchern von A.A. Sinowjew, die mir vorliegen, spielt dialektische Logik keine Rolle. Die Probleme und Möglichkeiten werde ich unten in einem eigenen Abschnitt erörtern.
Information zu den Signierungen.
Dialektische
Logik im Woerterbuch der Logik [s]
Kondakow, N. I. (dt. 1978 russ. 1975). Wörterbuch der Logik. Berlin:
Das europäische Buch.
Im Abschnitt IV, S. 285f, wird zur Definition der
dialektischen Logik ausgeführt:
"IV. Die Definition des Begriffs d.
L. (DialLenin)
und seine Interpretation dieses Terminus brachte LENIN nur ein einziges
Mal, und zwar in der Arbeit »Noch einmal über die Gewerkschaften,
die gegenwärtige Lage und die Fehler Trotzkis und Bucharins«.
Aber auch hier versteht LENIN den Terminus d. L.
(DialLenin) völlig
eindeutig als philosophische Lehre. Bei der Kritik der Scholastik, Eklektik
und Metaphysik in den Überlegungen der Trotzkisten und der Bucharinleute
wies LENIN auf das Neue hin, in dem die d. L.
(DialLenin) gerade
im Vergleich.zu der von den Trotzkisten und Bucharinleuten metaphysisch
interpretierten formale Logik weitergeht: „Um einen Gegenstand wirklich
zu erkennen, muß man alle seine Seiten, alle Zusammenhänge und
Vermittlungen' erfassen und erforschen. Wir werden das niemals vollständig
erreichen, die Forderung der Allseitigkeit wird uns aber vor Fehlern und
vor Erstarrung bewahren. Das zum ersten. Zweitens verlangt die dialektische
Logik, daß man den Gegenstand in seiner Entwicklung, in seiner ,Selbstbewegung'
(wie Hegel manchmal sagt), in seiner Veränderung betrachte ... Drittens
muß in die vollständige 'Definition' eines Gegenstandes die
ganze menschliche Praxis sowohl als Kriterium der Wahrheit wie auch als
praktische Determinante des Zusammenhangs eines Gegenstandes mit dem, was
der Mensch braucht, eingehen. Viertens lehrt die dialektische Logik, daß
es .eine abstrakte Wahrheit nicht gibt, daß die Wahrheit immer konkret
ist'...“ (L. 32. S. 85).
Wie leicht zu sehen ist, vergleicht LENIN die d.
L. (DialLenin)
hier nicht mit der traditionellen allgemeinmenschlichen Logik, wie das
manchmal einige Philosophen darzustellen versuchen, sondern mit der Scholastik,
Eklektik und der Metaphysik, d. h. mit dem konservativen, toten, antirevolutionären
philosophischen Theorien, die sich auf eine metaphysisch interpretierte
formale Logik zu stützen versuchten. In [>286] j^iuwicmung, reranaerung
und „setostoewegung", das Einbeziehen der Praxis als Kriterium der Wahrheit
in die Logik. Aber diese Merkmale charakterisieren nicht die Alternative
zur traditionellen Logik, sondern den dialektischen Prozeß der Widerspiegelung
der Außenwelt im Bewußtsein des Menschen, den Erkenntnisweg
vom Nichtwissen zum Wissen, der der Interpretation des Erkenntnisprozesses
durch die metaphysische eklektische Philosophie direkt entgegengesetzt
ist. Die formale Logik ist keine Richtung in der Philosophie, sie ist eine
spezielle Wissenschaft.
Unter Hinweis darauf, daß die formale Logik
sich davon leiten läßt, „was am gewöhnlichsten ist oder
was am meisten ins Auge fällt, und sich darauf beschränkt“ kritisierte
LENIN weiterhin die eklektische Definition, gegen die auch die formale
Logik immer aufgetreten ist. LENIN sagt: „Nimmt man dabei zwei oder mehrere
Definitionen und vereinigt sie ganz zufällig (sowohl Glaszylinder
wie auch Trinkgefäß), so erhalten wir eine eklektische Definition,
die auf verschiedene Seiten des Gegenstandes hinweist, und sonst nichts“
(L. 32. S. 85).
Aber LENIN konnte das nicht auf die traditionelle
formale Logik beziehen, da ihm das hauptsächliche Verfahren der Begriffsbestimmung,
das in der Logik üblich ist, - über die nächste Gattung,
den nächsten umfassenderen Begriff und die Artunterscheidung, den
Artbegriff, der zur nächsten Gattung gehört, - schon seit- seiner
Gymnasialzeit gut bekannt war und stets von ihm selbst bei der Begriffsbestimmung
angewendet wurde. So fragt LENIN in »Materialismus und Empiriokritizismus«:
„Was heißt etwas .definieren'“ und antwortete: „Es heißt vor
allem, einen gegebenen Begriff auf einen anderen, umfassenderen zurückzuführen“
(L. 14. S. 141). Dieses Verfahren der Begriffsbestimmung der formalen Logik
schließt die Eklektik aus. Daß LENIN in der Arbeit »Noch
einmal über die Gewerkschaften ...« Dialektik und Metaphysik,
marxistische und nichtmarxistische Konzeption vergleicht, davon zeugt auch
die Tatsache, daß er d. L. (DialLenin)
und Marxismus in folgender Weise betrachtet, wenn er schreibt: „Marxismus,
das heißt dialektische Logik (DialLenin)
, ...“ (L. 32. S. 86). Dabei legt er die Betonung auf die Kopula „est“
(wie es in der Originalfassung heißt - d. Üb.), indem er sie
durch Kursivschrift hervorhebt.
V. ..."
- Kommentar zu Kondakow: Der Artikel
über Logik, dialektische ist zwar mit 8 Spalten oder 4 Seiten sehr
lang, aber er enthält keinen dialektischen Logik-Kalkül oder
auch nur ein Regelwerk zum dialektisch-logischen Schließen, noch
nicht einmal einen Ansatz. Im wesentlichen erfolgt eine Darstellung der
Auffassung von Lenin. Nachdem Russland und die UdSSR über hervorragende
Mathematiker- und LogikerInnen verfügte, darf man sich über dieses
sehr dürftige Ergebnis schon einigermaßen wundern.
Dialektische Logik in der Modernen Logik von Georg Klaus [m]
Klaus, Georg (1966) Moderne Logik. Berlin: VEB Wiss.
Sachregistereinträge Logik, dialektische: 126-129, 173, 193-200.
Zusätzliches Vorkommen: 180
S. 126-129
"... Wir sind der Auffassung, daß die nachfolgende Textstelle
von Hegel einen für unsere Zweck sehr erheblichen rationellen Kern
enthält.
„In alles, was ihm (dem Menschen — G. K.) zu einem
Innerlichen, zur Vorstellung überhaupt, wird, was er zu dem Seinigen
macht, hat sich die Sprache eingedrängt, un< was er zur Sprache
macht und in ihr äußert, enthält eingehüllter, vermischter,
ode: herausgearbeitet, eine Kategorie; so sehr natürlich ist ihm das
Logische, oder viel mehr dasselbe ist seine eigentümliche Natur selbst.
Stellt man aber die Natur über haupt, als das Physikalische, dem Geistigen
gegenüber, so müßte man sagen, dass das Logische vielmehr
das Übernatürliche ist, welches sich in alles Naturverhalten
des Menschen, in sein Empfinden, Anschauen, Begehren, Bedürfnis, Trieb
eindrängt: und es dadurch überhaupt zu einem Menschlichen, wenn
auch nur formell, zu Vorstellungen und Zwecken, macht. Es ist der Vorteil
einer Sprache, wenn sie einen Reichtum an logischen Ausdrücken, nämlich
eigentümlichen und abgesonderten/ für die Denkbestimmungen selbst
besitzt; von den Präpositionen, Artikeln, gehören schon viele
solchen Verhältnissen an, die auf dem Denken beruhen.“34
Im Hinblick darauf, was Hegel meint, wenn er von
Logik spricht, ist es ganz klar, daß er die Sprache nicht nur ob
ihres Reichtums an formallogischen Bestimmungen lobt. Ihm geht es um die
dialektische
Logik (). Mit dieser aber haben es auch die von uns hier
behandelten Denkbestimmungen zu tun.
Hier wäre zunächst der Begriff
der dialektischen Logik () zu erläutern. Er wird nicht
einheitlich gebraucht, und viele zur Zeit noch vorhandene Mißverständnisse“
ergeben sich gerade aus dem recht unterschiedlichen Gebrauch dieses Begriffes.
Wenn man unter dialektischer Logik ()
einfach die subjektive Dialektik ()
bzw. die dialektische Methode () versteht,
so würde dieser zusätzliche Begriff nur unnötig Verwirrung
hervorrufen und wäre überflüssig. Wir möchten ihn anders
verstehen und, definieren: Die formale Logik ist die Theorie der
extensionalen Denkbestimmungen. [>127] und Beziehungen, die dialektische
Logik aber die Theorie der intensionalen Denkbestimmungen und Beziehungen.
Dies sei an einem Beispiel erläutert:
- Die Aussage p bedeute: Durch diese elektrische Spule fließt ein
Strom.
Die Aussage q bedeute: In dieser elektrischen Spule entsteht ein Magnetfeld.
Ähnliche Überlegungen ließen sich auch zum logischen Gehalt solcher sprachlichen Bestimmungen wie „obwohl“, „aber“ usw. anstellen. Wenn wir beispielsweise sagen: „Es regnet nicht, aber das Pflaster ist naß“, so ist hier ein Gegensatz ausgedrückt, und zwar der Gegensatz zwischen dem tatsächlich existierenden Zustand und dem natürlicherweise vorhandenen Zustand, daß es im allgemeinen nur bei Regen ein Naßwerden des Pflasters gibt. Der Unterschied zwischen diesen Bestimmungen und der logischen Konjunktion ist eben keinesfalls nur ein psychologischer, etwa in dem Sinne, daß wir unter Zugrundelegung der eben genannten Bedeutungen für p und q die Aussagenverbindung „p aber q“ nur deswegen gebrauchen, weil wir gewohnt sind, bei Naßwerden des Pflasters Regen zu erwarten. Mit derselben Begründung könnte man die Aussagenverbindung, ,q weil p“ abweisen und sie in den Bereich der Psychologie verbannen, wie dies David Hume getan hat. Tatsächlich sind diese intensionalen Aussagenverbindungen Abbildungen von realen Zusammenhängen. Sie lassen sich nicht durch extensionale Aussagenverbindungen ersetzen, wohl aber besitzen sie eine extensionale, ihnen zugrunde [>128] liegende Struktur. Gewisse Momente einer so aufgefaßten dialektischen Logik () gab es schon lange im Bereich der Modalitätenlogik. Ihre Nutzbarmachung für die dialektische Logik steht noch aus.
Wir sind der Meinung, daß sich das Verhältnis von formaler Logik und Dialektik nicht durch einen Globaleinfall lösen läßt, sondern dadurch, daß man Lenins These zu diesen Fragen ernst nimmt. Sie besagt, daß man bei den Bestimmungen der formalen Logik nicht stehenbleiben darf, sondern weitergehen muß. Das bedeutet in unserem Falle, daß man nicht bei den extensionalen Bestimmungen stehenbleiben darf, sondern zu den intensionalen weitergehen muß. Wenn wir wieder vom Beispiel unserer Konjunktion ausgehen, so bedeutet das, daß man nicht bei der Tatsache des Zusammenbestehens oder Nichtzusammenbestehens von Sachverhalten und ihrer Abbildung auf die extensionale Aussagenverbindung der logischen Konjunktion stehenbleiben darf, sondern die Arten und Weisen des, Zusammenbestehens von Sachverhalten (notwendig, zufällig usw.) untersuchenmuß. Andererseits ist es ebenso wichtig, die extensionale Struktur einer solchen Aussagenverbindung wie ,.p obwohl q“ zu untersuchen.
Beziehungen der dialektischen Logik () werden nämlich sicherlich falsch formuliert,; wenn die ihnen zugrunde liegende extensionale Struktur nicht beachtet wird. So ist die formale Logik eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Voraussetzung der dialektischen Logik (). Der oft gebrauchte Vergleich des Verhältnisses von formaler Logik und Dialektik () mit dem Verhältnis von niederer und höherer, Mathematik ist insofern durchaus zulässig, als die extensionalen Beziehungen die Grundlage, das Fundament sind, auf dem die dialektische Logik () aufbauen kann.
Damit erübrigt sich auch eine weitere Erörterung der Behauptung, daß dies formale Logik etwa nur für den Hausgebrauch gelte. Extensionale Beziehungen; sind zwangsläufig in jedem Denken enthalten, und zwar gleichgültig, ob es sich; um den Hausgebrauch oder die höchste Stufe der Wissenschaft handelt. Überall, wo dialektisch gedacht wird, ob im Hausgebrauch oder in der Wissenschaft, müssen die extensionalen Bestimmungen, die jeweils zugrunde liegen, in Ordnung sein, sonst ergeben sich nicht dialektische Einsichten, sondern logische Unsinnigkeiten.
Fassen wir das zum Problem des Extensionalen und des Intensionalen Gesagte zusammen, so können wir, wie schon betont, für den Bereich der Aussagenverbindungen sagen: Die Extensionalitätsthese der Logik ist in Wirklichkeit gar keine These, sondern eine Grenzziehung. Das heißt, die Aussagenverbindungen sind; nicht reduzierbar auf extensionale, also solche, deren Wahrheitswert nur von den, Wahrheitswerten der Einzelaussagen abhängt. Allerdings hat jede Aussagenverbindung einen extensionalen Aspekt, und dieser gehört zum Gegenstandsbereich der formalen Logik. Was sich nicht extensional erfassen läßt, der intensionale Aspekt also, ist Gegenstand der dialektischen Logik. [>129]
Wir sprachen bereits einleitend davon, daß es nicht unsere Absicht sein könne, gewissermaßen nebenbei eine dialektische Logik zu entwerfen. Es geht uns nu darum, bestimmte Hinweise zu ihrer Ausarbeitung zu geben. So könnten wir uns beispielsweise vorstellen, daß eine systematische Untersuchung der intensionalen Komplemente zu den Bestimmungen der Aussagenlogik und später der Prädikatenlogik zum Aufbau einer dialektischen Logik () führen kann.
Wir könnten uns eine solche Untersuchung etwa so vorstellen, wie zum Beispiel der logischen Konjunktion und an ihrer intensionalen bzw. dis Komplemente ungefähr skizziert haben. Von diesem Gesichtspunkt her ist es uns auch verständlich, weshalb es nicht gelungen ist, die sogenannte strenge Implikation, d. h. „Aus p folgt notwendigerweise g“ als organischen Bestandteil in die formale Logik einzufügen. Diese Aussagenverbindung ist nämlich Komplement zur formallogischen Implikation, hat also in der formalen Logik nichts zu suchen. — Wir sprachen schon über den Unterschied zwischen und dialektischem Widerspruch () und haben eine Reihe von Bestimmungen Unterschieds gegeben. Wir können jetzt noch eine weitere Bestimmung hinzufügen; aussagenlogischer Widerspruch ist eine extensionale Aussagenverbindung, der begriffliche dialektische Widerspruch () ergibt, in Aussagen formuliert, eine intensionale Aussagenverbindung. Wir werden auf das Thema der dialektitschen Logik () anläßlich der Behandlung der Logik der Begriffe nochmals zurückkommen.
- KmL126-34 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der
Logik, Bd. I, Leipzig 1961, S. 10."
S. 193-200
"
Dialektische Logik bei Fogarasi in Dialektische Logik [s] > Inhaltsverzeichnis.
Fogarasi, Bela (1953) Dialektische Logik. - mit einer Darstellung erkenntnistheoretischer Begriffe. Berlin: Aufbau. (auch Rotdruck 1971, mein Exemplar mit Fehlbindung 385-400)
"Unsererseits möchten wir noch die Berechtigung und Notwendigkeit
einer besonderen Ausarbeitung der dialektischen Logik durch folgende Erwägung
unterstreichen. Die Wissenschaft der Dialektik
(DialDefiniendum)
- im weiteren Sinne des Begriffs - ist die Wissenschaft von den universellen
Zusammenhängen, den gemeinsamen Gesetzen der Natur, der Gesellschaft
und des Denkens (DialDefiniens).
Es kann nicht bezweifelt werden, daß die Dialektik
(DialDMat) in diesem weiten
Sinne auch die Grundlage der dialektischen Logik
(DialLog) ist. Nun aber hat,
außer den gemeinsamen Gesetzen der Natur und Gesellschaft, sowohl
die Natur als auch die Gesellschaft besondere Gesetzmäßigkeiten.
Ebenso hat auch das Denken außer den gemeinsamen allgemeinen Gesetzmäßigkeiten,
die für die Natur, [>25] die Gesellschaft und das Denken gültig
sind, seine besonderen Gesetzmäßigkeiten. Das Denken ist nämlich
nach dem Marxismus eine qualitativ höhere Bewegungsform als die übrigen
bekannten Bewegungsformen; demzufolge müssen seine spezifischen Bewegungsformen
und Bewegungsgesetze in einer besonderen dialektischen
Disziplin (DialLog)
untersucht werden. Diese besondere Disziplin ist die dialektische
Logik
(DialLog).
In gewissem Sinne bildet sie einen Teil der Wissenschaft der Dialektik,
als der Wissenschaft von den Gesetzen aller Bewegungsformen, in gewissem
Sinne aber auch nicht. Die dialektische oder marxistische Logik muß
auf der Grundlage der allgemeinen marxistischen, materialistischen Dialektik
als eine besondere Disziplin ausgearbeitet werden. Ebenso, wie Marx die
allgemeine Methode der Dialektik auf eine Einzelwissenschaft, die politische
Ökonomie anwendet, ebenso, wie die sowjetische Wissenschaft die Dialektik
bewußt in den verschiedenen Naturwissenschaften anwendet, müssen
wir die Grundgesetze, die Prinzipien, die Methode der
Dialektik (DialMeth)
auch in der dialektischen Darstellung der Logik anwenden. Das aber macht
besondere Forschungen und Untersuchungen sowie eine besondere Darstellung
nötig, die aus den Eigentümlichkeiten des Denkens folgen.
Im Interesse der Genauigkeit der Terminologie wird
es zweckmäßig sein, das oben Gesagte in folgenden Begriffsbestimmungen
zusammenzufassen :
Objektive Dialektik: (DialDefiniendum)
Dialektik der Naturvorgänge und der gesellschaftlichen Vorgänge.
(DialDefiniens)
Subjektive Dialektik: (DialDefiniendum)
Widerspiegelung der objektiven Dialektik im Denken, dialektisches Denken.
(DialDefiniens)
Dialektik als Wissenschaft:
(DialDefiniendum),
(DialWis) die Wissenschaft
von den universellen Zusammenhängen, von den Gesetzen aller Bewegungsformen.
(DialDefiniens)
Dialektische Logik: (DialDefiniendum),
(DialLog) die mittels der dialektischen Methode ausgearbeitete
Wissenschaft von den Gesetzen der Denkformen und des Denkens. (DialDefiniens)
Wesentlich in diesem Sinne gebrauchen wir im vorliegenden
Werk die hier besprochenen Ausdrücke. Es kommt aber vor, daß
wir einfach von „Logik“ sprechen und darunter die traditionelle formale
Logik verstehen oder auch das Wort Logik in einem ganz allgemeinen Sinne
gebrauchen, der sowohl die formale als auch die dialektische
Logik (DialLog)
in sich faßt. Oft wäre es schwierig gewesen, mit dem längst
eingewurzelten Wortgebrauch völlig zu brechen. Diesen Wortgebrauch
haben wir uns jedoch nur in Fällen gestattet, bei denen die Möglichkeit
eines Mißverständnisses ausgeschlossen war.
Noch eine terminologische und nicht nur terminologische
Bemerkung! Die Gegenüberstellung von formaler und dialektischer Logik
ist geschichtlichen Ursprungs. Sie entstand in einer Zeit, in der die Klassiker
des Marxismus um die Anerkennung der Dialektik, der dialektischen
Methode (DialMeth)
und
dialektischen Logik (DialLog),
einen Kampf führten. In unserer Zeit, in der der Kampf zwischen Materialismus
und Idealismus auch in der Logik in verschärften Formen geführt
wird, ist es nötig, zu unterstreichen, daß die von uns anerkannte
dialektische
Logik die materialistisch-dialektische
Logik (DialMatLog)
ist.1 Wenn wir also in dieser Arbeit ohne besonderes Beiwort
von dialektischer Logik sprechen, so
verstehen wir darunter ausgesprochenermaßen die materialistisch-dialektische
Logik (DialMatLog).
Wir gehen nun zur Frage der Vortragsweise, der Darstellung
der Logik über. Die radikale prinzipielle Verschiedenheit der Methode
(DialLog) der formalen und
der dialektischen Logik (DialLog)
darf nicht so aufgefaßt werden, als ob beide voneinander ständig
durch eine chinesische Mauer völlig getrennt wären oder getrennt
werden könnten. Das würde eine völlig pedantische und in
der Praxis unfruchtbare Auffassung der Frage bedeuten. In der Darstellung
der Logik müssen wir an den sehr zutreffenden Vergleich von Engels
zwischen dem Verhältnis der niederen und höheren Mathematik einerseits
und dem Verhältnis der formalen Logik und der dialektischen
Logik (DialLog)
andererseits erinnern. Ohne Kenntnis der niederen, elementaren Mathematik
kann man sich nicht mit höherer Mathematik befassen. Wer so etwas
versuchen wollte, würde sich nur der Lächerlichkeit preisgeben.
Ebenso verhält es sich mit der Logik. Zum Studium und zur Ausarbeitung
der dialektischen Logik (DialLog)
ist die gründliche Kenntnis der formalen Logik nötig. Man muß
alles, was in ihr brauchbar und von bleibendem Werte ist, kennen, und zwar
gründlich kennen. Die formale Logik kann (wenn auch nicht vollkommen)
ohne die Kenntnis der dialektischen Logik
(DialLog) dargestellt werden,
nicht aber umgekehrt. Was folgt hieraus für ein Werk wie das vorliegende,
dessen Hauptziel die Darstellung und Weiterentwicklung der dialektischen
Logik (DialLog)
ist? Wenn uns einst gute Lehrbücher der formalen Logik zu Gebote stehen
werden, wenn die formale Logik in unseren Mittel- und Hochschulen systematisch
unterrichtet werden wird, so wird es genügen, sich auf diese Lehrbücher
zu berufen und die Darstellung auf die dialektische
Logik (DialLog)
zu konzentrieren, so wie die bekannten Darstellungen der höheren Mathematik
die Kenntnis der elementaren Mathematik voraussetzen. Heute aber sind wir
bekanntlich auf dem Gebiete der Logik noch nicht so weit. Die alten, in
den Schulen verwandten Lehrbücher der Logik waren wertloses Flickwerk.
Das zeitgemäße Lehrbuch der formalen Logik ist selbst in der
Sowjetunion vorläufig noch eine Forderung, die durch die bisher erschienenen
Darstellungen nicht befriedigt wird.
In dieser Lage gab es für die Darstellung der
Logik praktisch nur eine reale Möglichkeit: in einer Arbeit „die niedere
und die höhere Mathematik“ der Logik zu exponieren. Zuerst stellen
wir bei den einzelnen Fragen die Sätze der formalen Logik dar. Die
Verbesserung der Darstellung besteht darin, daß wir möglichst
zeitgemäßes Beispielmaterial verwenden und den ungeheuren scholastisch-formalistischen
Wust über Bord werfen. Hierauf gehen wir zur Darstellung der „höheren
Mathematik“ der Logik über.
Auf beiden Linien aber beschränken wir uns
nicht auf Darlegung und Zusammenfassung: wir tragen neue Gesichtspunkte
in die Darstellung hinein. Das ist auch die Antwort auf die Frage, die
in der Diskussion der ersten Auflage dieser Arbeit aufgeworfen wurde: ob
meine Darstellung der Logik dialektische
(DialLog) oder formale
Logik (DialFlog)
oder keines von beiden, sondern irgendeine dritte Art von Logik sei. Die
Antwort ist klar und eindeutig: diese Arbeit ist hinsichtlich ihrer Methode
dialektische
Logik (DialLog),
aber die Darstellung mußte auch die formale Logik umfassen.
Indessen war nicht nur die praktische Brauchbarkeit,
nicht nur der pädagogische Gesichtspunkt für uns maßgebend,
als wir die vorliegende Form der Darstellung wählten und in der zweiten
Auflage beibehielten. Der tiefere Grund dafür ist folgender: die dialektische
Logik (DialLog)
kann auch, rein theoretisch betrachtet, von der formalen Logik nicht gänzlich
getrennt behandelt werden. Die formale, richtiger gesagt, die elementare
Logik ist der Ausgangspunkt; die dort behandelten ständigen, oberflächlichen,
formalen Zusammenhänge in Bewegung zu bringen, zu vertiefen, in erkenntnistheoretischem
Zusammenhang zu behandeln, bildet die Aufgabe der dialektischen
Logik (DialLog).
Wir wollen also die formale Logik nicht „dialektisieren“,"
- Kommentar zu Fogarasi: Die Arbeit definiert erfreulicherweise einige
Begriffe: objektive D., subjektive D., Dialektik als Wissenschaft und Dialektische
Logik. Ansonsten wird der Anspruch erhoben, dass die dialektische Logik
umfassender und tiefer als die formale Logik sei und diese einschließe
bzw. umfasse.
Dialektik und formale Logik bei Kopnin [ts]
Kopnin, P.V. (russ. 1969, dt. 1970) Dialektik - Logik - Erkenntnistheorie. Lenins philosophisches Denken - Erbe und Aktualität. Berlin: Akademie-Verlag.
Das dritte Kapitel trägt den Titel "Dialektik und formale Logik". Man sollte erwarten, dass hier das logische Regelwerk der dialektischen Logik dargestellt wird. Zu Beginn wird S. 135 ausgeführt:
"III. KAPITEL
Dialektik und formale Logik
§ 1 Der Gegenstand der formalen Logik und seine Veränderung
im Laufe der Wissenschaftsentwicklung
Da das Denken sowohl von der formalen Logik als auch von der Dialektik
(DialonS) untersucht wird,
entsteht der Fragenkomplex, in welchem Verhältnis beide zueinander
stehen, was von der formalen Logik, was von der Dialektik
(DialonS) untersucht wird,
welcher Unterschied zwischen den Methoden, mit denen Dialektik
(DialonS) bzw. formale Logik
das Denken untersuchen, existiert.
Will man das Wesen der Dialektik
(DialWesen) und ihre Bedeutung
für die Entwicklung des modernen wissenschaftlichen Denkens verstehen,
so muß man diese Fragen lösen. Das Denken wird außerdem
auch von anderen Wissenschaften erforscht, zum Beispiel von der Psychologie.
Die Psychologie untersucht die Denktätigkeit des Individuums in Abhängigkeit
von den Bedingungen, unter denen sie sich vollzieht; sie hat die Aufgabe,
die Gesetzmäßigkeiten aufzudecken, nach denen das Denken verläuft,
welches zu bestimmten Erkenntnisresultaten führt. Die Logik hat die
Untersuchung dieser Erkenntnisresultate zum Gegenstand; sie untersucht
nicht die Gesetze, nach denen das Denken des Individuums verläuft,
sondern die Gesetze, nach denen das Denken zur Wahrheit gelangt. Lenin
schrieb: „Nicht Psychologie, nicht Phänomenologie des Geistes, sondern
Logik = Frage nach der Wahrheit.“1 Das bedeutet natürlich
nicht, daß es die Psychologie überhaupt nicht interessiert,
zu welchen Erkenntnisresultaten der Denkprozeß führt — zu wahren
oder zu falschen —, sondern, daß das Problem der Wahrheit des Denkens
kein spezieller Gegenstand der Psychologie ist.
Dialektik (DialonS)
und formale Logik entstanden und entwickelten sich beide im Schoße
der Philosophie. Wie verhalten sie sich jetzt zueinander, welchen Einfluß
üben sie auf die Wissenschaftsentwicklung aus ? Zur Beantwortung dieser
Frage genügt es nicht, nur die Bedeutung dieser Termini zu klären;
man muß auch den realen Inhalt der in ihnen enthaltenen Begriffe
aufdecken.
1 W. I. Lenin, Werke, Bd. 38, S. 164."
Es folgen Ausführungen zur Geschichte. § 3 Kommt dann zur Kern der Sache, S. 164f wie folgt (RS 14pt fett-kursiv hervorgehoben):
"Wie die Geschichte der Logik zeigt, kann die Analyse des Erkenntnisprozesses
und seiner verschiedenen Seiten als objektive Grundlage dienen, um den
Gegenstand der formalen Logik von dem der dialektischen Logik abzugrenzen.
Jede Logik schafft einen Apparat für das Funktionieren des Denkens.
Wenn es keinen solchen Apparat gibt, gibt es keine Logik. Deshalb ist es
nur berechtigt, von der materialistischen Dialektik
(Dialmat) als von einer Logik
zu sprechen, sofern sie einen solchen Apparat schafft — genauer, einen
Organismus des Denkens, [>165[ den es in keinem anderen logischen
System gibt. Was ist das für ein Apparat?
Auf diese Frage gibt es in der marxistischen Literatur
keine eindeutige Antwort. Von einigen Wissenschaftlern wird angenommen,
daß die Dialektik (DialElog)
ihre eigene Logik der Ableitung von Folgerungen aus Prämissen schafft,
d. h. ihren eigenen logischen Kalkül, der nicht auf den formallogischen
Gesetzen (Identität, ausgeschlossener Widerspruch), sondern auf den
Gesetzen
der Dialektik (DialGes)
aufbaut.
Wir können hier die Formen
solcher Kalküle nicht analysieren, weil es noch niemandem gelang,
sie aufzubauen. Das, was vorgeschlagen wurde, verdient keine
ernsthafte Beachtung. Aber selbst diese negative Erfahrung ist überaus
lehrreich und zweifellos bedeutungsvoll für die Entwicklung des logischen
Denkens. Sie beweist nochmals, daß man keinen logischen Kalkül
aufbauen kann, wenn man gleichzeitig das formallogische Gesetz vom ausgeschlossenen
Widerspruch verwirft.
Der logische Kalkül ist ein Apparat, um nach
angegebenen Regeln mit Zeichen zu operieren. Einige dieser Regeln sind
für einen jeden Kalkül unerläßlich, die anderen nur
für bestimmte Formen. Von den ersteren ist das Gesetz vom ausgeschlossenen
Widerspruch das formallogische Minimum; wenn man es verletzt, kann man
keinen einzigen logischen Kalkül aufbauen.
Aber das bedeutet nicht, daß es prinzipiell
unmöglich ist, die Gesetze der Dialektik
() zu Regeln des logischen Kalküls zu machen. Beim Operieren mit Zeichen
können wir jede inhaltliche Behauptung als Regel einschließen,
auch ein dialektisches Gesetz (),
aber dabei muß das Minimum für das Funktionieren eines logischen
Kalküls, das formallogische Gesetz vom ausgeschlossenen Widerspruch
in dieser oder jener Formulierung, erhalten bleiben. Hier ist die Erfahrung
des russischen Logikers N. A. Vasil’ev
lehrreich, der versuchte, ein System aufzubauen, das er nichtaristotelische,
phantasiegeborene Logik nannte, in der er von der Anerkennung der Existenz
von Widersprüchen in der realen Welt ausgeht. Dabei nimmt er als absolut
für jedes logische System das Gesetz des absoluten Unterschieds von
Wahrheit und Falschheit an („ein Urteil kann nicht gleichzitig wahr und
falsch sein“), das seinem Inhalt nach mit dem formallogischen Gesetz vom
ausgeschlossenen Widerspruch identisch ist. Als Resultat erhielt Vasil’ev
ein neues formallogisches System nicht mit zwei (behauptenden und verneinenden),
wie bei Aristoteles, sondern mit drei Arten von Urteilen (als drittes —
Urteil des Widerspruchs), mit einigen ergänzenden Modi des Syllogismus.
[>]
Das war jedoch im Prinzip keine neue dialektische
Logik (), sondern einfach eine Bereicherung des formallogischen
Apparates um neue Ergänzungen. Vasil’ev schloß in sein logisches
System Aussagen ein, die die Einheit widersprüchlicher Eigenschaften
und Beziehungen in einem Gegenstand fixieren. Die moderne modale Logik
ging in dieser Hinsicht noch weiter und baute einen Kalkül mit möglichen,
unmöglichen, notwendigen, zufälligen Aussagen auf. Die sogenannte
deontische Logik unterscheidet unabdingbare, erlaubte, gleichgültige,
verbotene Aussagen. Aber niemand nennt die moderne modale Logik mit allen
ihren Bereichen „dialektische Logik“
(), denn sie funktioniert als Apparat eines logischen Kalküls, der
nach der Methode der formalen Logik aufgebaut ist.
Die materialistische Dialektik
ist in anderem Sinne Logik als die formale, und folglich schafft sie einen
logischen Apparat von anderem Charakter, der nicht als logischer Kalkül
funktioniert. Sie nimmt das Denken nicht als Operieren mit
Zeichen nach bestimmten Regeln (das ist die Aufgabe der formalen Logik),
sondern als Prozeß der Herausbildung von Begriffen, in denen die
Natur, in einer den menschlichen Bedürfnissen gemäß umgebildeten
Form, gegeben ist. Deshalb ist hier ein Apparat nicht erforderlich, um
nach bestimmten Regeln von einem Zeichen zu einem anderen überzugehen,
sondern um von einem Begriff zu einem anderen fortzuschreiten, wobei diese
strengen Regeln fehlen."
- Kommentar zu Kopnin : Das Eingeständnis
S. 165: "Wir können hier die Formen solcher Kalküle nicht analysieren,
weil es noch niemandem gelang, sie aufzubauen." ist beachtlich. Weniger
S. 166: "Die materialistische Dialektik ist in anderem Sinne Logik als
die formale, und folglich schafft sie einen logischen Apparat von anderem
Charakter, der nicht als logischer Kalkül funktioniert." Ein solcher
Apparat lag bis 1969 nicht vor, was nicht gerade für Kompetenz und
Niveau der dialektischen Wissenschaft spricht.
Diskussion in der Sowjetunion der 1950er Jahre [i]
- Inhaltsverzeichnis
"Vorbemerkung der Herausgeber 5
K. S. Bakradse Über das Verhältnis von Logik und Dialektik 7
W. I. Tscherkessow Über Logik und marxistische Dialektik 27
M. S. Stroowitsch Über den Gegenstand der formalen Logik 47
S. B. Morotschnik Der Grundwiderspruch zwischen Dialektik und Sophistik 60
1.1. Osmakow Über die Logik des Denkens und die Wissenschaft der Logik 77
W. P. Tugarinow und L. J. Maistrow Gegen den Idealismus in der mathematischen Logik
S. A. Janowskaja Brief an die Redaktion 113
P. S. Popow Der Gegenstand der formalen Logik und der Dialektik 118
N.W. Sawadskaja Zur Diskussion über Fragen der Logik 131
A. O. Makoweiski Was muß die Logik als Wissenschaft sein? 138
Dobrin Spassow Die dialektische Logik darf man nicht ablehnen, sondern muß sie ausarbeiten 143
M. N. Alexejew Die Diskussion über Fragen der Logik an der Moskauer Staatlichen Universität 147
A. D. Alexandrow Über die Logik 159
F. J. Ostrouch Gegen die Entstellung des Marxismus in Fragen der Logik 177
B. M. Kedrow Uber das Verhältnis der Logik zum Marxismus 193
M. Alexejew und W. Tscherkessow Über die Logik und das Logikstudium 217
Zu den Ergebnissen der Logikdiskussion 233"
Erdei, Laszlo (1972) Gegensatz und Widerspruch in der Logik. Budapest: Akademiai Kiado. [m]
"Der grundlegende Unterschied in der Natur der formalen und der dialektischen Logik () zeigt sich am meisten in der abweichenden oder scheinbar abweichenden Einstellung zum Satz vom Widerspruch. Die formale Logik erfordert nämlich eine Widerspruchsfreiheit, während die dialektische Logik () bekanntlich eine Logik ist, die auf dem Widerspruch basiert. Die einschlägigen Diskussionen haben meines Erachtens bis heute eine falsche Richtung genommen und zumeist nur zu Missverständnissen geführt. Zur Beseitigung dieser Missverständnisse versuche ich nachstehend das wahre Problem zu präzisieren und zu lösen.
1 Der Satz vom Widerspruch (principium contradictionis) in der formalen Logik besagt lediglich "kontradiktorische Aussagen sind nicht gleichzeitig wahr".1
- E1 Aristoteles (1) Buch IV, Kapitel 6, 1011b"
Max Benses Theorie dialektischer Satzsysteme.
Bense, Max (1949/50) - Eine Untersuchung über die sogenannte dialektische Methode. In: Philosophische Studien, Bd. 1, 1949, S. 202 ff., Bd. 2, 1950, S. 153 ff.
Im Teil I, 1949, S. 205 gibt Bense seine vier Ziele mit dieser Untersuchung an:
- "Unsere Untersuchung hat vier Ziele: erstens die Klärung der Frage
nach der formalen Dialektik, d. h. die Klärung der Frage nach der
exakten Methodologie des dialektischen Verfahrens; zweitens die Klärung
der Frage nach der Erweiterung unseres Rationalitätsbereiches durch
die sogenannte dialektische Methode; drittens die systemtheoretische Stellung
der dialektischen Methode bis zur Darstellung eines „Systems dialektischer
Sätze", insbesondere eines „Systems des dialektischen Materialismus"
und viertens — im Anschluß an Günthers Problem — die Frage einer
Reduzierung der Transzendentallogik."
Gliederung der Arbeit (von mir nach der Darstellung Benses)
1. Vorbemerkung. 202-205
2. Historischer Rückblick. 205-209
3. Formulierung des Problems. 209-215
4. Interpretation zu Hegels „Wissenschaft von der
Logik" von 1812. 215
Historische Vorbemerkung.
215-
1. Das Jahr 1781 ... 215.
2. Drei Punkte Kants ... 215f
3. Zum 3. Punkt Kants. 216ff
4. Zur Vorgeschichte der transzendentalen Logik Kants ... 218f
5. In die nachkantische Geschichte der kritizistischen Kritik ... Hegel
große Logik 1812 und 1815. 219
6. Herauspräparation der Hauptsätze die Hegelschen Logik
Interpretation
Erste Vorrede. 8 Punkte. 219-222
Zweite Vorrede. 5 Punkte. 222-224
Einleitung
Allgemeiner Begriff der Logik. Punkt 15-24. 224-232
Allgemeine Einteilung der Logik Punkt 25-28. 232-233 (Ende Erster Teil)
Zweiter Teil und Schluss (1950/51)
Hegels Logik als komplementäre aristotelische Logik. 153-
1. Der Anti-Aristotelismus muß abgeschwächt werden. 153-154.
2. Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch darf nicht festzuhalten werden,
da er hervorgerufen werden muss.
3. Prüfung der Frage an das aristotelische Axiomensystem (AS.) 155
[Ziffer 4. fehlt, 4 und 4a ist im ersten Teil]
[Ziffer 5. fehlt]
6. Definition dialektische Methode. 157
6a, 6b [die Numerierung ist verwirrend]
6. Kontradiktorische Axiomsysteme 158f
7. Die Hegelsche Synthese 159ff
8. Unverträglichkeits-Systeme 161
9. Klassifikation der Hegel-Systeme 164ff
Hier gibt Beisse 9 Definitionen (7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 9b, 10, 11)
und formuliert sodann drei Hauptsätze.
S. 166: Fazit
"Die Tatsache, daß neben der euklidischen Geometrie auch die
nichteuklidischen Geometrie axiomatisch-deduktiv entwickelt werden können,
und die Tatsache, daß es effektiv Realitätsbereiche gibt, die
sich mit Hilfe und zwar nur mit Hilfe euklidischer Geometrie, und andere,
die sich mit Hilfe, und zwar mit Hilfe einer nichteuklidischen Geometrie
beherrschen lassen, legt, zwingend den Gedanken nahe, daß die reale
Welt nicht in einem einheitlichen axiomatisch-deduktiven System von Aussagen
beschrieben werden kann, sondern daß dazu ein komplementäres
Aussagensystem notwendig ist, das von zwei kontradiktorischen Axiomsystemen
aus zu entwickeln ist. Wir würden
das folgendermaßen ausdrücken können: Versteht man
unter M die Menge von Aussagen, die auf ein AS reduziert werden können,
und [>167] unter M' die Menge aller Aussagen, die zur gegebenen Menge M
nicht gehören, kann man sagen, daß M und M' im Sinne der in
der Mengenlehre üblichen Komplementbildung komplementär sind.
Auch zwei
auf kontradiktorische Axiomsysteme AS und AS' reduzierbare Satzsysteme
können in diesem Sinne als komplementäre Systeme bezeichnet werden.
Ein besonderes Beispiel für eine solche Lage
bietet der bekannte Welle-Partikel-Dualismus in der neueren Quanten-(Wellen)-Mechanik.
Selbst wenn man den verwendeten beiden Bildern, dem anschaulichen Wellenbild
einerseits und dem anschaulichen Partikelbild andererseits durchaus keinen
anschaulichen Gehalt zuschreibt, sondern darin nur unverträgliche
Beobachtungsdaten oder eine formale Redeweise sieht, die bestimmte Eigenschaften
ein- und desselben Realitätsbereiches — eben dem der Wellen und Partikel
des mikrophysikalischen Gebietes —
beschreibt, ist es doch so, daß zumindestens Heidelbergs Quantenmechanik
und Schrödingers Wellenmechanik von — semitisch gesprochen — jeweils
völlig verschiedenen formel-sprachlichen Ausdrucksmitteln, bzw. linearen
Zeichenreihen ausgehen und ihre Theorien jeweils Systeme von Aussagen darstellen,
die auf Aussagen über strukturell
verschiedene Aussagen, bzw. formal verschiedene Zeichenreihen reduziert
werden können und somit zumindestens als dialektische Hegelsysteme
zweiter Ordnung interpretiert zu werden vermögen. Der von Bohr entwickelte
Begriff der Komplementarität besagt vom Standpunkt der Aussagetechnik,
bzw. der Theorie der Aussagensystem nichts anderes, als daß perfekte
Realitätsbereiche nur durch komplementäre Satzsysteme, zumindestens
durch Hegelsysteme zweiter Ordnung, einigermaßen vollständig
dargestellt werden können."
S. 154f: 2. Das neue Verfahren
"5a. Wir verstehen unter einer dialektischen Methode eine satzerzeugende
Deduktion, deren Regeln (der Umformung, Substitution, bzw. Abtrennung)
die systematische Bildung von Widersprüchen im Sinne eines Hegelschen
Produktes (Synthese) gestatten.
5b. Wir verstehen unter einem dialektischen System ein System des eingeschlossenen
Widerspruchs.
Das hat natürlich seine Schwierigkeiten. Nach
einem bekannten logischen Theorem folgt aus einem auftretenden Widerspruch
p • -p jede nur mögliche Formel bzw. jeder nur mögliche Satz.
Offenbar enthält aber auch ein dialektisches System nicht jeden möglichen
Satz. Es muß also für die dialektische Methode des dialektischen
Systems des eingeschlossenen p • -p ein Auswahlaxiom, ein kontrollierbares
Bildungsverfahren angegeben werden."
S. 157, Definition dialektische Methode
6. Wir verstehen unter der dialektischen Methode eine Methode der Erzeugung
kontradiktorischer Satzpaare.
6a. Wir verstehen unter einem dialektischen Satzsystem ein System kontradiktorischer
Satzpaare.
6b. Der formale Sinn einer hegelschen Synthese ist das kontradiktorisch
gebaute Satzpaar, ein Satz, der nicht chrysippisch wahr oder falsch ist,
sondern Efalsch wahr oder falsch ist.
S. 230, Erster Teil
"Man kann auch das Negat eines Satzes p als Komplement
zu p bestimmen und sagen: die Hegelsche Negation des Satzes p, also T,
bildet das logische Komplement zu p, wobei allerdings zu berücksichtigen
ist, daß das Komplement jeweils ein konjunktives oder ein disjunktives
sein kann und daß das, was wir speziell als Hegelsche Negation oder
als Hegelsches Komplement zu p ansprechen, das disjunktive Komplement darstellt.
Wir sagen dann:
4a. Unter einem Hegelschen Satz 1' (Thesis) verstehen wir den Sachverhalt
(Inhalt) einer Aussageform.
4.b. Unter einer Hegelschen Negation (Antithesis) verstehen wir das
disjunktive Komplement zu einem Hegelschen Satz p.
4c. Unter einem Hegelschen Produkt (Synthesis) verstehen wir die logische
Summe (Vereinigungsklasse) aus einem Hegelschen Satz und seinem disjunktiven
Komplement.
Das richtig verstandene Hegelsche dialektische Verfahren arbeitet also
z. B. wie folgt:
_
Literatur
- Bense, Max (1960) GRUNDLAGENFORSCHUNG UND EXISTENZBESTIMMUNG.
- In: Merkur 14 (II), 1960, 687-690. [i] Im wesentlichen positive Ausführungen zu Gotthard Günther.
- Bense, Max (1980) NACHWORT zu: "Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik"
- Galland, Georg (1980) SEMIOTISCHE ANMERKUNG ZUR "THEORIE DIALEKTISCHER SATZSYSTEME". semiosis 17/18, Jg 5, Heft 1/2, 62-64.
Der Ansatz von Gotthard Günther - die morphogrammatische Logik [i]
Günther, Gotthard (1962) Das metaphysische Problem einer Formalisierung der transzendental dialektischen Logik In: Heidelberger Hegeltage 1962, Hegel Studien Beiheft 1, p. 65-123. Auch published in vordenker.de: Oct 10, 2004 (PDF)
I. S. 9
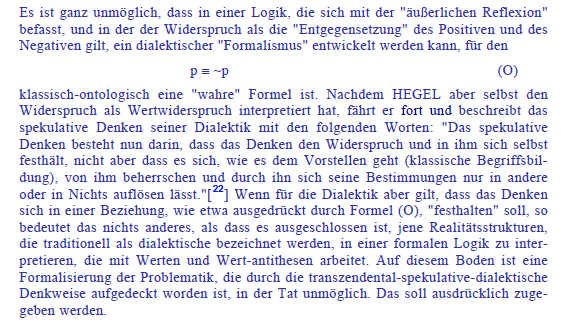
- Kommentar-GG: Dass die Formel O zumindest
in der traditionellen Aussagenlogik nicht gelten kann, ist klar. Hierzu
gibt es zweierlei zu sagen: Erstens erscheint mir fraglich, ob die Formel
O den dialektischen Grundgedanken richtig interpretiert, denn auch dialektisch
sollte klar sein, dass der Sachverhalt und sein Gegenteil nicht gleich
sind, sondern "nur" gleichzeitig gelten. Liebe ist nicht gleich Hass, aber
Liebe und Hass können gleichzeitig bestehen. Zweitens ist ja klar,
dass eine dialektische Logik nicht direkt mit der aussagepsychologischen
Konzeption verträglich ist. Will man eine dialektische Logik in ein
zweiwertiges Logikkonzept zwingen, dürfte das in aller Regel scheitern.
- III. (S. 19ff). Günther geht von der zweiwertigen Logiktabelle
der 16 Funktionen (IIa) und des Widerspruchs (Ia) aus. Als erstes setzt
er Platzhalter S (Stern) und V(Viereck) in das Schema ein, wobei S und
V jeweils den Wahrheitswert W oder F einnehmen können. Er nennt die
nun entstehenden Tabellen "Morphogramme". Werden in ein Morphogramm Werte
("ontologische Wertdesignationen") eingetragen, nennt er die Tabelle "Reflexionsmuster".
Es ist mir nicht klar geworden, was das Platzhaltersystem für einen
Sinn und Nutzen haben soll. Günther gibt Beispielanwendungen,
wie mit seinem Morphogrammansatz praktisch dialektisch logisch gearbeitet
und geschlussfolgert werden kann.
Lorenzen Das Problem einer Formalisierung der Hegelschen Logik [i]
Lorenzen, Paul (1962): Das Problem einer Formalisierung der Hegelschen Logik. Koreferat zu einem Vortrag von G. Günther, in: Hegel-Studien Beiheft 1. (PDF bei Vordenker)
"Definiert man die logische Wahrheit durch die Existenz einer Gewinnstrategie auf Grund der Form allein, so sind die Aussagen "p oder nicht p" nicht logisch wahr." (S.5, PDF Version Vordenker)
Dialektisches
Logik-Modell von Popper [i] > Ausführliche
Kritik Poppers.
Popper, Karl (1970) Was ist Dialektik. In (261-290) Topitsch, Ernst
(1970,
Hrsg.) Logik der Sozialwissenschaften. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
"Nun kann man die Frage aufwerfen, ob diese Lage der Dinge in jedem
logischen System gegeben ist oder ob wir ein System konstruieren können,
in dem sich aus kontradiktorischen Aussagen nicht jede beliebige Aussage
ergibt. Mit dieser Frage habe ich mich beschäftigt, und meine Antwort
geht dahin, daß ein derartiges System konstruiert werden kann. Es
erweist sich allerdings als ein außerordentlich schwaches System.
Von den üblichen Schlußregeln bleiben nur sehr wenige übrig,
nicht einmal der Modus ponens, der besagt, daß wir aus einer Aussage
der Form »Wenn p, dann q« in Verbindung mit p zu dem Schluß
q gelangen können. Meiner Meinung nach ist ein solches System8
für das Ziehen von Schlüssen nutzlos, obwohl es vielleicht von
[>272] Interesse für Forscher sein kann, die an der Konstruktion formaler
Systeme per se ein besonderes Interesse haben."
- Endnote/Anmerkung 8: "8. Das angedeutete
System ist der »dual-intuitionistische Kalkül«; vgl. meinen
Aufsatz »On the Theory of Deduction I and II«, Proc, of the
Royal Dutch Academy, 51, Nr. 2 und 3, 1948, 3.82 auf S. 182 und 4.2 auf
S. 322 sowie 5.32, 5.42 und auch Fußnote 15. Joseph Kalman Cohen
hat das System eingehender entwickelt. Ich kann eine einfache Interpretation
dieses Kalküls geben: Alle Aussagen können als modale Aussagen
aufgefaßt werden, die Möglichkeiten behaupten. Aus »p
ist möglich« und »>wenn p, dann q< ist möglich«
können wir »q ist möglich« tatsächlich nicht
ableiten (denn falls p falsch ist, kann q eine unmögliche Aussage
sein). Und in gleicher Weise können wir aus »p ist [>290] möglich«
und »non-p ist möglich« offensichtlich nicht die Möglichkeit
aller Aussagen ableiten."
Essler Die sogenannte dialektische Logik [m]
Essler, Wilhelm K. (1971) Die sogenannte dialektische Logik. In () Wissenschaftstheorie II. Theorie und Erfahrung. Freiburg: Alber.
"16. Die sogenannte dialektische Logik
()
So wichtig es für bestimmte Untersuchungen ist, alle Äußerungen
der verschiedensten Philosophen, die Verwendungsweisen des Ausdrucks „deduktive
Logik“ (oder kurz: „Logik“) betreffend, kommentierend zusammenzustellen,
so wenig tragen diese rein begriffsgeschichtlichen Untersuchungen etwas
zur Frage bei, nach welchen Regeln man ihn zweckmäßigerweise
verwendet, wie man seine Verwendung also am besten normiert; Untersuchungen
über Fakten liefern auch hier keine Ergebnisse über Normen.
Auch bezüglich des Ausdrucks „dialektische
Logik ()“ (oder kurz: „Dialektik“) kann man begriffsgeschichtlich
nach seinen faktischen Verwendungen in der Geschichte oder systematisch
nach seiner zweckmäßigsten (und auf diese Weise zu normierenden)
Verwendung fragen. Das „oder“ ist hier nicht im ausschließenden Sinn
zu verstehen, d. h. man sollte im idealen Fall begriffsgeschichtliche und
systematische Untersuchungen miteinander verbinden. Eine historisch-systematische
Behand-[>97]lung des Begriffs „Dialektik“ würde jedoch den Rahmen
dieser Untersuchung sprengen, weshalb hier das Gewicht auf den systematischen
Teil gelegt wird. Eine solche historische Untersuchung müßte
nämlich nicht nur die Verwendung des Ausdrucks „Dialektik“ bei Kant,
sondern auch dessen Verwendung bei Aristoteles, Platon und den Logikern
des Mittelalters berücksichtigen und dürfte sich nicht auf solche
Verwendungsweisen beschränken, die gegenwärtig modern sind. Von
einer systematischen Entwicklung dieses Begriffs hingegen darf man mit
Recht erwarten, daß sie zumindest beiläufig kritisch auf Zeitströmungen
eingeht und ein begründetes Urteil über den Wert der Dialektik
für die menschliche Erkenntnis und ihre Anwendung zur Lösung
der menschlichen Probleme gibt.
Es ist von Verfechtern der dialektischen
Logik () bisher nirgendwo klar gesagt worden, was sie mit
der Entwicklung ihrer Theorie anzugeben gedenken: eine Gesamtheit von Naturgesetzen,
eine Gesamtheit von Methoden zur Gewinnung von Erfahrungserkenntnissen
oder eine Gesamtheit von Verfahren zur Beurteilung soldier Methoden.
Als Gesamtheit von Naturgesetzen wird die Dialektik von jenen Philosophen
und Ideologen verstanden, die der Ansicht sind, daß die Vorgänge
in der Natur (oder, eingeschränkt: in den sozialen Bereichen) dialektisch
ablaufen, womit sie folgendes meinen: Die Verwirklidiung eines Zustands
trägt bereits Widersprüche - besser: Konflikte - in sich, die
zu seiner Aufhebung führen; die Aufhebung besteht dann in der Verwirklichung
eines neuen Zustands, der seinerseits Widersprüche enthält, die
schließlich zu dessen Aufhebung führen usw. - ad infinitum oder
bis zur Erreichung eines Endzustands nach einer begrenzten Zeitspanne.
Diese Vorstellungen sind außerordentlich vage,
so daß sie nur teilweise rational diskutierbar und kritisierbar sind.
Es ist nicht auszuschließen, daß mit ihnen eine Tautologie
ausgesprochen werden soll, daß also die Behauptung, die Abläufe
in der Welt seien dialektisch, folgendes aussagt: Zustände entwickeln
sich solange weiter, bis sie aufhören, sich weiter zu entwickeln,
und sie werden somit von anderen [>98] Zuständen abgelöst, es
sei denn, sie sind Endzustände. Auf solche Äußerungen,
die logisch wahr sind, kann man aber verzichten, da sie nichts über
die Welt und über die Form der Gesetze aussagen. Wenn mit der Behauptung,
die Abläufe in der Welt seien dialektisch, etwas anderes gemeint ist,
so hat man empirisch nachzuweisen, daß sie zutrifft, d. h. man hat
jene Behauptung mit ihrer Negation im Hinblick auf Erfahrungsdaten zu vergleichen;
dies wird im allgemeinen so geschehen, daß man aus jeder der beiden
Thesen singuläre Voraussagen erschließt und diese auf ihren
Wahrheitswert hin überprüft.22"
Perelman, Chaïm (1979) Dialectic and Dialogue. In: The New Rhetoric and the Humanities pp 73-81 [SL] [i]
Since Plato, the word ‘dialectic’ has been used in so many different meanings that some have said that it is advisable to make no further use of it. If the confusion of concepts constituted a strong argument invalidating their usage, then each philosopher would be forced to renew almost the whole philosophical vocabulary. Nevertheless the handling of these different meanings requires particular precaution, awareness of the previous uses and some idea of their historical evolution. If the Begriffsgeschichte is valuable for all philosophical notions then it is certainly so when we want to deal with the term ‘dialectic’.
GÜ: Seit Platon wurde das Wort „dialektisch“ in so vielen verschiedenen Bedeutungen verwendet, dass einige sagen, dass es ratsam ist, es nicht weiter zu verwenden. Wenn die Verwirrung der Begriffe ein starkes Argument wäre, das ihre Verwendung ungültig macht, dann wäre jeder Philosoph gezwungen, fast das gesamte philosophische Vokabular zu erneuern. Der Umgang mit diesen unterschiedlichen Bedeutungen erfordert jedoch besondere Vorsicht, die Kenntnis der bisherigen Verwendungen und eine gewisse Vorstellung von ihrer historischen Entwicklung. Wenn die Begriffsgeschichte für alle philosophischen Begriffe wertvoll ist, dann ist es sicherlich der Fall, wenn wir uns mit dem Begriff „Dialektik“ befassen wollen.
Zitierung mit Signierung erwogen: Esser, Garcia, Hage, Holz, Kesselring, Müller.
Esser, Helmut ; Klenovits, Klaus & Zehnpfennig, Helmut (1977) Wissenschaftstheorie 2 Funktionalanalyse und hermeneutisch-dialektische Ansätze. Teubner.
García, Adolfo De La Sienra (1992) The Dialectical Method. In (91-128) García, Adolfo De La Sienra (1992) The Logical Foundations of the Marxian Theory of Value. Dordrecht: Springer.
Hage, Jaap (2005) Dialectical Models in Artificial Intelligence and Law. In (227-264) Hage, Jaap (2005) Studies in Legal Logic.
Holz, Hans Heinz (1997) Einheit und Widerspruch. Problemgeschichte der Dialektik in der Neuzeit. 3 Bde. Bd.3: Die Ausarbeitung der Dialektik. Stuttgart: Metzler.
Kesselring, Thomas (2013) Formallogischer Widerspruch, dialektischer Widerspruch, Antinomie. Reflexionen über den Widerspruch. In (15-38) Müller, Stefan (2013, Hrsg.) [PDF vorh]
Diese Arbeit enthält keine Formalisiering einer dialektischen Logik im engeren, logischen Sinne, also keinen Kalkül.
Müller, Stefan (2013, Hrsg.) Jenseits der Dichotomie Elemente einer sozialwissenschaftlichen Theorie des Widerspruchs. Wiesbaden: Springer.
Wissenschaftlicher Apparat
- Adorno, Theordor W. (1966) Negative Dialektik. Suhrkamp, Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Adorno, Theordor W. (1970) Gesammelte Schriften, Band 6: Negative Dialektik. Jargon der Eigentlichkeit. Suhrkamp. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Adorno, Theordor W. (2007) Vorlesung über Negative Dialektik. Fragmente zur Vorlesung 1965/66. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Arruda, Ayda I. () On the Imaginary Logic of N. A. Vasil'év
- Bense, Max (1949/50) Theorie dialektischer Satzsysteme - Eine Untersuchung über die sogenannte dialektische Methode. In: Philosophische Studien, Bd. 1, 1949, S. 202 ff., Bd. 2, 1950, S. 153 ff.
- Bense, Max (1949) Moderne Dialektik - Neue Forschungen. In: Universitas, Stuttgart, Jg. 1, H. 4, April 1949, S. 493-495.
- Bochenski, J.M. () Der sowjetrussische dialektische Materialismus (DIAMAT).
- Bochenski, J.M. (1973) Marxismus Leninismus. Wissenschaft oder Glaube. München; Bayerische Landeszentrale für Bildungsarbeit.
- Brieskorn E. (1974) Über die Dialektik in der Mathematik. In: Otte M. (1974, Hrsg.) Mathematiker über die Mathematik. Wissenschaft und Öffentlichkeit. Springer, Berlin, Heidelberg
- Eisler, Rudolf (1904) Dialektik.
- Engels, Friedrich (1925) Dialektik der Natur. [Online] Zeno.org: Karl Marx, Friedrich Engels: Werke. Berlin 1962, Band 20, S. 307. Fragment. Entstanden 1873-1883, ergänzt 1885/86. Teildrucke: Der Abschnitt »Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen« erschien 1896 in der Zeitschrift »Die neue Zeit«, der Abschnitt »Die Naturforschung in der Geisterwelt« im »Illustrierten Neuen Welt-Kalender für das Jahr 1898«. Erstdruck des Manuskripts in: Marx-Engels-Archiv, Bd. 2, Moskau, Leningrad 1925.
- Erdeis, Laszlo (1972) Gegensatz und Widerspruch in der Logik. Budapest: Akademiai Kiado.
- Esser, Helmut ; Klenovits, Klaus & Zehnpfennig, Helmut (1977) Wissenschaftstheorie 2 Funktionalanalyse und hermeneutisch-dialektische Ansätze. Teubner.
- Essler, Wilhelm K. (1971) Die sogenannte dialektische Logik. In () Wissenschaftstheorie II. Theorie und Erfahrung. Freiburg: Alber.
- Flammer, August (2008). Entwicklung als dialektischer Prozess. In (127-243) Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung. Bern: Huber.
- Fogarasi, Bela (1953) Dialektische Logik. - mit einer Darstellung erkenntnistheoretischer Begriffe. Berlin: Aufbau. (auch Rotdruck 1971)
- García, Adolfo De La Sienra (1992) The Dialectical Method. In (91-128) García, Adolfo De La Sienra (1992) The Logical Foundations of the Marxian Theory of Value. Dordrecht: Springer.
- Gottschlich, Max & Wladika, Michael (2005, Hrsg.) Dialektische Logik: Hegels Wissenschaft der Logik und ihre realphilosophischen Wirklichkeitsweisen. Königshausen und Neumann.
- Günther, Gotthard (1962) Das metaphysische Problem einer Formalisierung der transzendental dialektischen Logik In: Heidelberger Hegeltage 1962, Hegel Studien Beiheft 1, p. 65-123. Auch published in vordenker.de: Oct 10, 2004 (PDF)
- Hage, Jaap (2005) Dialectical Models in Artificial Intelligence and Law. In (227-264) Hage, Jaap (2005) Studies in Legal Logic.
- Hoffmann, Dieter (1990, Hrsg.) Robert Havemann, Dialektik ohne Dogma. Aufsätze, Dokumente und die vollständige Vorlesungsreihe zu naturwissenschaftlichen Aspekten philosophischer Probleme. Berlin: DVdWis.
- Hegselmann, Rainer (1965) Formale Dialektik. Ein Beitrag zu einer Theorie des rationalen Argumentierens. Hamburg: Meiner.
- Heise, Steffen () Analyse der Morphogrammatik von Gotthard Günther. Klagenfurter Beiträge zur Technikdiskussion Heft 50
- Hörz, H. (1968). Der dialektische Determinismus in Natur und Gesellschaft. Berlin: VEB Verl. D. Wissenschaften.
- Holz, Hans Heinz & Losurdo, Domenico (1996, Hrsg.) Dialektik-Konzepte. Topos, Heft 7. Bonn. Pahl-Rugenstein Nachfolger.
- Holz, Hans Heinz (1997) Einheit und Widerspruch. Problemgeschichte der Dialektik in der Neuzeit. 3 Bde. Bd.3: Die Ausarbeitung der Dialektik. Stuttgart: Metzler.
- Hubig, Christoph (1978) Dialektik und Wissenschaftslogik: Eine sprachphilosophisch- handlungstheoretische Analyse. Berlin: de Gruyter
- Kesslering, Thomas (1981) Entwicklung und Widerspruch. Ein Vergleich zwischenm Piagets genetischer Erkenntnistheorie und Hegels Dialektik.Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Kesslering, Thomas (1984) Die Produktivität der Antinomoe. Hegels Dialektik im Lichte der genetischen Erkenntnistheorie und der formalen Logik. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Kesselring, Thomas (2013) Formallogischer Widerspruch, dialektischer Widerspruch, Antinomie. Reflexionen über den Widerspruch. In (15-38) Müller, Stefan (2013, Hrsg.)
- Klaus, Georg (1966) Moderne Logik. Berlin: VEB Wiss.
- Klaus, Georg & Buhr, Manfred (1969, Hrsg.) Philosophisches Wörterbuch. 2 Bde. Leipzig: Beb Bibliographisches Institut.
- Kondakow, N. I. (dt. 1978 russ. 1975). Wörterbuch der Logik. Berlin: Das europäische Buch..
- Kopnin, P.V. (russ. 1969, dt. 1970) Dialektik - Logik - Erkenntnistheorie. Lenins philosophisches Denken - Erbe und Aktualität. Berlin: Akademie-Verlag.
- Kuczynski, Jürgen & Steinitz, Wolfgang (1952, Herausgeber) Über formale Logik und Dialektik. Diskusionsbeiträge. (Redakteure: Kosing, Eva ; Kosing, Alfred). Verlag Kultur und Fortschritt.
- Lorenzen, Paul (1962): Das Problem einer Formalisierung der Hegelschen Logik. Koreferat zu einem Vortrag von G. Günther, in: Hegel-Studien Beiheft 1.
- Markin, Vladimir & Zaitsev, Dmitry (2017,ed.) The Logical Legacy of Nikolai Vasiliev and Modern Logic
- Mikirtumov, Ivan B. () The laws of reason and logic in Nikolai Vasiliev’s system
- Maximov, Dmitry (2017) N. A. Vasil’ev’s Logic and the Problem of Future Random Events. Axiomathes April 2018, Volume 28, Issue 2, pp 201–217
- Markin, Vladimir & Zaitsev, Dmitry (2017,ed.) The Logical Legacy of Nikolai Vasiliev and Modern Logic
- Mikirtumov, Ivan B. (o.J.) The laws of reason and logic in Nikolai Vasiliev’s system
- Mittelstraß, Jürgen (1980-1996, Hrsg.). Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. 4 Bde. Die ersten beiden Bände erschienen bei BI, Mannheim. Die letzten beiden Bände bei Metzler, Stuttgart. 2. Auflage 2005ff.
- Müller, Stefan (2011) Logik, Widerspruch und Vermittlung. Aspekte der Dialektik in den Sozialwissenschaften. Wiesbaden: Springer.
- Müller, Stefan (2013, Hrsg.) Jenseits der Dichotomie Elemente einer sozialwissenschaftlichen Theorie des Widerspruchs. Wiesbaden: Springer.
- Perelman, Chaïm (1979) Dialectic and Dialogue. In: The New Rhetoric and the Humanities pp 73-81 [SL]
- Popper, Karl (1970) Was ist Dialektik. In (261-290) Topitsch, Ernst (1970, Hrsh.) Logik der Sozialwissenschaften. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Popper, Karl (1963) Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. Routledge & Kegan Paul. [GB]
- Reich, W. (1934). Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse. [PDF im Netz]
- Schwemmer, Oswald (2005) Dialektik, In Mittelstraß (2005, Hsrg,).
- Sinowjew, A.A. (dt. 1970, russ.1967). Komplexe Logik. Grundlagen einer logischen Theorie des Wissens. Berlin: VEB d.Wiss.
- Sinowjew, A.A. (dt. 1968, russ.1968). Über mehrwertige Logik. Ein Abriß. Braunschweig: Vieweg.
- Sinowjew, A.A. (dt. 1968, russ.1968). Über mehrwertige Logik. Ein Abriß. Braunschweig: Vieweg.
- Sinowjew, A. & Wessel, H. (1975). Logische Sprachregeln. München: Fink. [Biographie]
- Topitsch, Ernst (1970, Hrsg.) Logik der Sozialwissenschaften. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Vasil'év, Nicolas A. (1993) Logic and metalogic Axiomathes December 1993, Volume 4, Issue 3, pp 329–351
- Wetter, Gustav A. (1963) Dialektischer und historischer Materialismus. Frankfurt aM: Fischer
https://iphras.ru/uplfile/logic/log19/LI19_Mikirtumov.pdf
https://iphras.ru/uplfile/logic/log19/LI19_Mikirtumov.pdf
Links (Auswahl: beachte)
Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort. > Eigener weltanschaulicher Standort.
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Fogarasi "INHALT
- Vorwort zur deutschen Ausgabe 5
Erstes Kapitel. Gegenstand und Methode der Logik 11
§ 1. Der Gegenstand der Logik 11
§ 2. Die Methode der Logik 15
§ 3. Dialektik, .dialektische Logik, Erkenntnistheorie 22
§ 4. Einteilung der Logik 28
Zweites Kapitel. Die Grundgesetze des Denkens. Logische Grundsätze
. . 33
§ 1. Das Gesetz der Identität 34
§ 2. Das Prinzip des Nicht-Widerspruchs 52
§ 3. Das Prinzip des ausgeschlossenen Dritten 75
§ 4. Das Prinzip (Gesetz) des zureichenden Grundes 84
Drittes Kapitel. Arbeit, Sprache und Denken 88
§ 1. Sprache und Denken 88
§ 2. Kritisches über Logistik 98
§ 3. Arbeit und Denken 107
Viertes Kapitel. Der Begriff 112
§ 1. Der Begriff des Begriffs 113
§ 2. Empfindung, Vorstellung, Begriff 117
§ 3. Die Merkmale der Gegenstände und die Kennzeichen des
Begriffs 122
§ 4. Inhalt und Umfang des Begriffs 126
§ 5. Verhältnis von Inhalt und Umfang des Begriffs 129
§ 6. Die Klassifizierung der Begriffe 131
§ 7. Die Verhältnisse der Begriffe 142
§ 8. Begriff und Wirklichkeit 150
§ 9. Das geschichtliche Moment in der Dialektik der Begriffe
157
§10. Die Kategorien 160
§ 11. Die Definition 165
§ 12. Die Regeln der Definition 169
§ 13. Die verschiedenen Arten der Definition 171
§ 14. Die Bedeutung der Definition 172
§ 15. Die fehlerhafte Definition 175
§ 16. Der veränderliche, historische Charakter der Definition
178
Fünftes Kapitel. Das Urteil 181
§ 1. Vom Urteil im Allgemeinen 181
§ 2. Begriff und Urteil. Wort und Satz 184
§ 3. Wahres und falsches Urteil 188
§ 4. Die Einteilung der Urteile 190
§ 5. Die Urteile ihrem Umfange nach 190
§ 6, Die Urteile ihrer Qualität nach 195
§ 7. Die Urteile ihrer Relation nach 204
§ 8. Die Modalität des Urteils 207
§ 9. Die Verhältnisse zwischen den Urteilen 208
§ 10. Engels über die Lehre vom Urteil 209
Sechstes Kapitel. Der Schluß 212
§ 1. Übergang vom Urteil zum Schluß. Vom Schluß
im Allgemeinen . 212
§ 2. Der Begriff des Syllogismus 217
§ 3. Die Struktur des Syllogismus 220
§ 4. Das Axiom des Syllogismus 223
§ 5. Die Regeln des Syllogismus 224
§ 6. Die Figuren des Syllogismus 228
§ 7. Die Modi des Syllogismus 231
§ 8. Die wissenschaftliche Bedeutung der Figuren und Modi des
Syllogismus 233
§ 9. Der hypothetische Syllogismus 236
§ 10. Der disjunktive Syllogismus 240
§ 11. Der verkürzte Syllogismus („Enthymem“ und „Epicherem“)
. . . 244
§ 12. Der zusammengesetzte Syllogismus (Polysyllogismus) 246
§ 13. Der Marxismus-Leninismus über den Schluß 250
§ 14. Von den Induktionsschlüssen im Allgemeinen 258
§ 15. Die sogenannte vollständige Induktion 261
§ 16. Die unvollständige Induktion 263
§ 17. Der Induktionsschluß durch einfache Aufzählung
265
§ 18. Die wissenschaftliche Anwendung der Induktion 267
§ 19. Induktion und Kausalität 268
§ 20. Fehlerhafte Induktionsschlüsse 272
§ 21. Die Verknüpfung der Deduktion und der Induktion 275
Siebentes Kapitel. Der Analogieschluß 288
§ 1. Vom Analogieschluß im Allgemeinen 288
§ 2. Die Rolle des Analogieschlusses in der Wissenschaft 291
§ 3. Die falsche Analogie 301
Achtes Kapitel. Die Hypothese 305
§ 1. Der Begriff der Hypothese 305
§ 2. Die Hypothese in der Geschichte der Wissenschaft und die
Logik der Hypothese 307
§ 3. Hypothese und Wahrheit in der Naturwissenschaft 311
§ 4. Hypothese und Gesellschaftswissenschaft 316
§ 5. Die Regeln der Hypothese 319
Neuntes Kapitel. Der Beweis 322
§ 1. Der Begriff des Beweises 322
§ 2. Zur Geschichte der Theorie des Beweises 324
§ 3. Die Struktur des Beweises 326
§ 4. Deduktions- und Induktionsbeweis 328
§ 5. Der direkte und der indirekte Beweis 332
§ 6. Beweis und Axiome 334
§ 7. Die Rolle des Beweises in den verschiedenen Wissenschaften
. . . 338
§ 8. Der Beweis und die Praxis 340
§ 9. Die Regeln des Beweises — Der falsche Beweis 342
§ 10. Die Widerlegung 352
§ 11. Zusammenfassung 356
Zehntes Kapitel. Erkenntnistheoretische Grundbegriffe 360
§ 1. Was ist Erkenntnistheorie? 360
§ 2. Kurze Geschichte der materialistischen Erkenntnistheorie
.... 366
§ 3. Der erkenntnistheoretische Grundsatz des Materialismus 369
§ 4. Weiterentwicklung der materialistischen Erkenntnistheorie
durch den dialektischen Materialismus 373
§ 5. Lenin über die Praxis 379
§ 6. Widerspiegelungstheorie und Dialektik 380
§ 7. Die Widerspiegelung in der gesellschaftlichen Erkenntnis
.... 381
§ 8. Der philosophische Begriff der Materie 384
§ 9. Ursache und Wirkung 387
§ 10. Der Marxismus-Leninismus über die Gesetze der Wissenschaft
. . 389
Elftes Kapitel. Fragen der Methode 398
§ 1. Methode und Theorie 398
§ 2. Kritik des methodologischen Dualismus 404
§ 3. Schlußfolgerungen 408
Literaturverzeichnis 411
Namenregister 415
stipulieren
Ausdruck bei Gotthard Günther. Duden: "1. vertraglich vereinbaren, übereinkommen 2.festlegen, festsetzen
Synonyme zu stipulieren abmachen, abschließen, aushandeln, ausmachen, sich einigen, festmachen, schließen, übereinkommen, vereinbaren, sich verständigen"
__
Standort: Dialektische Logik im engeren, logischen Sinne.
*
Zur Einführungs, Haupt- und Verteilerseite Dialektik.
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen und Untersuchungen zur Dialektik.
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen.
Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Wissenschaft site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, R. (DAS). Materialien zur Dialektischen Logik im engeren, logischen Sinne. Materialien zur Begriffsanalyse und Untersuchungen zur Dialektik Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Dialektik/BA_DialLog.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_ Begriffsanalyse Dialektik im engeren logische Sinne_Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_
noch nicht end-korrigiert
Aenderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt. « » » «
20.11.19 Grundversion erstmals ins Netz gestellt.
22.10.19 Vorläufig abgeschlossen, aber noch nicht endkorrigiert.
03.12.18 Unterbrochen bis 5.1.19
10.11.18 Zerlegt, weil zu groß.
07.11.18 Vorläufiger organisatorischer Abschluss
01.11.18 angelegt
Interne Notizen
« » » «
Arruda, Ayda I. () On the Imaginary Logic of N. A. Vasil'év
Nicolas A. Vasil'év Logic and metalogic Axiomathes December
1993, Volume 4, Issue 3, pp 329–351
Imaginary (non-aristotelian) logic
NA Vasil'ev, R Vergauwen, EA Zaytsev - Logique et Analyse, 2003 - JSTOR
[53] The aim of this paper** is to show the possibility of a logic
and of logical operations
different from those we use and to show how our Aristotelian [54] logic
is only one of the
many possible logical systems. This new logic will not be a novel account
of the old one. It
differs from it not as an account, but in the very train of its logical
operations; this is a" new
logic" and not a new treatise on logic. Different treatises on logic
differ in their contents, but
all have the same subject matter: our logical world, our logical operations.
Imaginary (non …