(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=01.11.2018 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 22.09.22
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_ Begriffsanalyse Gegensatz_Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:
Begriffsanalyse Gegensatz
_
Zur Einführungs,
Haupt- und Verteilerseite Dialektik.
Information zu den Signierungen.
Zum Geleit-1
"Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung
des Verstandes durch die Mittel unserer Sprache."
Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, 109]

Originalarbeit von Rudolf
Sponsel, Erlangen
_Aufgrund gelegentlicher
Ergänzungen und Korrekturen mit F5-Taste updaten empfohlen
_
"Denn jeder, der Wert auf Reinheit im Denken legt, wird von jedem sprachlichen
Ausdruck, der mit dem Anspruch auftrift, Allgemeingültiges zu verkünden,
als Mindestes verlangen dürfen, daß sich derselbe den elementarsten
Gesetzen des Verstehens fügt."
Gotthard Günther 1940/41 Logistik und Transzendallogik,
S. 135
Zusammenfassung - Abstract - Summary Begriffsanalyse Gegensatz
Die Lehre von den Gegensätzen hat wie der Dialektikbegriff einige Hauptschwächen: (1) Es gibt keine klaren Definitionen, die manche für unnötig bzw. für nicht erbringbar halten. (2) Man unterscheidet die wichtigen ontologischen Bereiche und Ebenen nicht oder nicht sorgfältig genug. (3) Es fehlt an klaren Referenzierungen, detaillierten Beispielen und Operationalisierungen. (4) es wird viel behauptet, gemeint, statt wirklich zu zeigen, wie es sich wissenschaftlich gehört. (5) Bei den verschiedenen Theorien ist meist unklar, was Postulate (Axiome), (prüfbare) Aussagen oder Hypothesen sind. Das gilt von den Anfängen im Altertum bis heute. Und deshalb kann man auch von einer wissenschaftlichen Gegensatzlehre bis heute kaum sprechen. Die meisten GegensatztheoretikerInnen verstehen nichts vom wissenschaftlichen Arbeiten (Zum Geleit Aristoteles), wie z.B. auch die falsche Klassifizierung bei objektiv-subjektiv zeigt.
| Definition:
Zwei Sachverhalte heißen gegensätzlich, wenn sie sich wechselseitig
aufheben (Inverse) oder verneinen (Widerspruch). Mathematisch entspricht
ersteres der Idee des Inversen. Die Inverse von 1 ist -1, denn 1-1 = 0.
Eine Aussage und ihre Negation bilden den bekanntesten und akzeptiertesten
Gegensatz. "Es regnet" und "es regnet nicht" sind Gegensätze (sophistische
Sonder- und Problemfälle wie tröpfeln, nieseln außer Acht
gelassen).
Begriffsbasis: Sachverhalt, wechselseitig, aufheben, Inverse, verneinen, Negation. Abgestufte, quantitative Gegensätze: Man kann Gegensatz auch quantitativ definieren, so dass man von einem mehr oder weniger Gegensatz sprechen kann. Als Modell kann ein Kreis dienen. Vollständiger (frontaler, totaler) Gegensatz wäre dann, wenn zwei Radien mit 180° direkt aufeinander stoßen. 90° entspräche dann einem "halben" Gegensatz, wenn z.B. an einem Bahnübereingang ein Auto in einen Zug fährt. Ein anderes Modell böten negative Korrelationskoeffizienten 0 > r < -1). |
Je mehr ich mich mit dem Gegensatz-Sachverhalt und dem Gegensatz-Begriff beschäftigt habe, desto schwieriger wurde mir die Klärung. Aber die Unterscheidung der ontologischen Bereiche sollte hilfreich sein wie auch die Angabe des (dialektischen) Bezugssystems. Fragen wir, ob es Gegensätze in der objektiven Wirklichkeit, in der Natur gibt, so hängt die Antwort natürlich davon ab, wie Gegensatz für die objektive Wirklichkeit, für die Natur definiert oder zumindest charakterisiert ist. Um der allgemein-abstrakten Falle zu entgehen, empfiehlt es sich von konkreten Beispielen auszugehen. Verallgemeinern können wir später immer noch. Mein theoretisches Bezugssystem ist hier formuliert: > wissenschaftlicher Standort, ergänzt durch meinen > weltanschaulichen Standort. Zwar brauchen wir zur Kommunikation über die objektive Wirklichkeit die Sprache, aber es ist wichtig, deutlich zu machen, dass es um die objektive Wirklichkeit geht, die es auch ohne die Menschen und ihre Sprache gibt. Für zwischenmenschliche Gegensätze brauchen wir natürlich Menschen, menschliche Gesellschaften, Gemeinschaften und Völker.
Gegensatzbeispiele in der Wahrnehmung,
im Denken und in der Sprache
Für die menschliche Wahrnehmung, das Denken und die Sprache sind
schwarz
und weiss Gegensätze, aber nicht in der objektiven Wirklichkeit.
Dort ist schwarz ein Körper, der kein Licht reflektiert und weiss
eine Mischung der Komplementarfarben, die es als "Komplementärfarben"
so in der Natur nicht gibt, aber die zugrundeliegenden entsprechenden Wellenlängen.
Das Beispiel schwarz und weiss lehrt uns, dass wir vorsichtig sein müssen
mit dem, was wir als Gegensatz bezeichnen. Gegensätze in unserer Wahrnehmung,
in unserem Denken oder in unserem Sprachgebrauch sind oft kognitive Gewohnheiten
und müssen in der objektiven Wirklichkeit keine Entsprechung haben.
In der Sprache gibt es die Wendung "im Gegensatz zu ...", wobei sachlich
betrachtet, das Wort "Unterschied" meist angebrachter wäre. In der
Sprache werden Unterschied und Gegensatz oft synonym gebraucht. Man ist
immer gut beraten an die Wittgenstein'sche Warnung zu denken: "Die
Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung des Verstandes durch die
Mittel unserer Sprache."
Gegensatzbeispiele in der objektiven
Wirklichkeit
Wir können aber als eine Gegensatzrealisation (Operationalisierung)
in der objektiven Wirklichkeit einführen, dass es Körper gibt,
die sich abstoßen. Das lässt sich herstellen und zeigen; es
muss nicht geglaubt werden.
Eine andere Gegensatzrealisation (Operationalisierung) ist, dass man
einen Körper gegen einen anderen bewegt, so dass er mit ihm zusammenstößt,
das muss nicht 180° entgegensetzt erfolgen, es könnte auch 90°
sein, wenn etwa ein Auto am Übergang in einen Zug fährt.
Signierungen.
Dialektik,
dialektisch.
Widerspruch,
widersprüchlich.
Gegensatz,
gegensätzlich.
Ende der Zusammenfassung
Sprache
Duden Gegensatz, der (Abruf
6.1.19)
Bedeutungsübersicht?
- Verhältnis äußerster Verschiedenheit
- etwas (z. B. ein Begriff, eine Eigenschaft) oder jemand, das bzw. der etwas, jemand anderem völlig entgegengesetzt ist
- Widerspruch
- Meinungsverschiedenheiten, Differenzen
- (Musik) erster Kontrapunkt zum Thema einer Fuge
- Andersartigkeit, Gegeneinander, Gegensätzlichkeit, Kluft, Kontrast, Unterschied, Unterschiedlichkeit, Verschiedenartigkeit, Verschiedenheit, Widerstreit; (bildungssprachlich) Antagonismus, Divergenz, Heterogenität, Inhomogenität, Polarität; (Jargon) Schere; (veraltet) Kontrarietät; (Philosophie) Widerspruch; (Völkerkunde, Soziologie, Philosophie) Alienität
- Gegenbegriff, Gegenbehauptung, Gegensatzwort, Gegenstück, Gegenteil[wort], Gegenthese, Gegenwort; (bildungssprachlich) Antithese; (Sprachwissenschaft) Antonym, Oppositionswort
- Widerspruch, Widersprüchlichkeit, Zwiespalt; (bildungssprachlich) Diskrepanz; (Jargon) Schere; (Philosophie) Kontradiktion, Repugnanz
Zum Vergleich Gegenteil beim Duden (Abruf 3.11.19)
Bedeutung
etwas (z. B. eine Eigenschaft, Aussage) oder jemand, das bzw. der etwas, jemand anderem völlig entgegengesetzt ist
Beispiele
er ist ganz das Gegenteil von ihr
sie hat genau, gerade das Gegenteil behauptet, erreicht
etwas wendet sich in sein Gegenteil
die Stimmung schlug ins Gegenteil um
ich bin nicht nervös, [ganz] im Gegenteil (ganz und gar nicht)
Synonyme zu Gegenteil
Gegensatz, Gegenstück; (veraltet) Gegenspiel, Widerspiel
_
Sprachbrockhaus (1956)
der Gegensatz, 1) Unterschied eines Begriffes von anderen, z. B. der Gegensatz von Gut und Böfe. 2) Widerlpruch, Feindseligkeit. 3) erster Kontrapunkt zum Thema der Fuge. EIGW.: gegensätzlich. HPTW.: die Gegensätzlichkeit.
Gegensatz durch Negation
"Beispiel: direkter Gegensatz:
Aussage 1 – Aussage 2
„Prüfung bestanden“ – „Prüfung nicht bestanden“
Quelle: https://deutschegrammatik20.de/komplexer-satz/satzverbindung-adversativwaehrend-aber-demgegenueber/
Sprachgebrauch zu Gegensätzen / Gegenteilen - Kandidaten oder Beispiele
Auch wenn unser Denken und Sprachgebrauch von Gegensätzen spricht,
muss das nicht bedeuten, dass es sich auch "tatsächlich" um Gegensätze
und nicht um bloße Unterschiede oder Andersheiten handelt. Hier ist
also Vorsicht geboten.
Anmerkung: Die Beziehung zwischen zwischen Gegensatz und Gegenteil
ist bislang noch nicht geklärt. Sie werden einstweilen im wesentlichen
als gleichbedeutend (synonym) verwendet. Die Richtigkeit der Verwendung
des Gebrauchs hängt natürlich von der Definition oder Charakterisierung
ab, was Gegensatz bedeuten soll.
Brainstorming Hilfsbegriffe zur Erfassung
von Gegensätzen
Sind klare Abgrenzungen zu Verneinung (Negation), Gegenteil, Polarität,
und Widerspruch möglich?
- Ein Objekt, das auf ein anderes Objekt trifft (aufprallt, zusammenstösst), kann u.U. als Modell für einen Gegensatz dienen.
- Richtung, entgegengesetzt
- Aufeinander zustreben, von einander wegstreben.
- Vektoren (gerichtete Größen oder Kräfte), die sich überschneiden oder aufeinander treffen.
- Kontakt (Begegnung, Berührung, z.B. zusammenstossen)
- Unterschied
- Äußerste maximale Verschiedenheit (Duden), +unendlich -unendlich (hier nicht in der Sache, nur in der Richtung, ausgedrückt durch das Vorzeichen.
- Inverse (Umkehrfunktion, +1 und -1, Matrix und ihre Inverse, Behandlung und Krankheit)
- Neutralisieren (Inverse in der Mathematik, Lauge und Säure in der Chemie, Gewinn und Verlust ind Wirtschaft und Spiel, )
- Man braucht immer zwei Objekte, Kräfte, ... und ihre Beziehung zueinander. Kein Objekt oder Sachverhalt steht zu sich selbst im Gegensatz, wenn auch das gerade die klassische dialektische Lehre auszudrücken scheint. Ausnahme vielleicht die Mengenlehre. Hier enthält jede Menge immer auch die leere Menge.
- Etwas rückgängig machen, z.B. schließen nach öffnen.
- Verneinung. A und Nicht-A. Kontradiktorischer Gegensatz. A und konträr-A konträrer Widerspruch (konträr als Gegenteil). Das Gegenteil von A ist nicht Nicht-A, sondern Konträr-A.
- Wenn die beiden Sachverhalte keine Dynamik zeigen, nicht aufeinander wirken, liegt kein Gegensatz vor, eher Zustände, die ein Gegenteil ausdrücken.
- Wenn etwas Konträres ausgedrückt wird, kann man von Gegensatz sprechen, aber auch von Gegenteil. Wo liegt der Unterschied?
- Wenn A auf B stösst, liegt kein Gegenteil vor, eher ein Gegensatz.
- Lässt sich Gegensatz oder gegensätzlich quantifizieren? Gibt es es mehr oder weniger an Gegensatz?
- Inverse.
Metakriterien zur Diagnose
von Gegensätzen
Wenn eine Definition (noch) nicht möglich sein sollte, so kann
man doch immer die Methode Beispiele und Gegenbeispiele für die Prädikationen
anwenden, um näherungsweise Klarheit zu schaffen.
GSKDud
Gegensatzkriterium des Dudens "Verhältnis äußerster Verschiedenheit."
Bei Eigenschaftspaaren prüfen, ob eine Steigerung darüber oder
darunter formulierbar ist. Äußerste Verschiedemheit kann es
nur zwischen den höchsten Steigerungsgraden geben.
GSKNkd
Negatives Gegensatzkriterium nicht kontradiktorisch. Beim Paar gut und
böse ergibt die Verneinung von gut (böse) nicht böse (gut),
sondern nicht gut (nicht böse).
GSKanab
Gegensatzkriterium in der näheren Umgebung wirken bei beiden Objekten
Anziehungs- oder Abstossungskräfte
GSKkrw
Gegensatzkriterium es wirkt eine Kraft eines Objektes auf ein anderes.
GSKverb
Gegensatzkriterium verbunden sein, damit eine Kraft wirken kann. Aber was
heißt verbunden?
GSKebp Gegensatzkriterium
eindimensionale oder bipolare Dimension oder Skala. Farben sind in einem
Spektrum angeordnet.
GSKbf
Gegensatzkriterium Konträre Urteile können beide falsch sein.
GSKsprg Im Sprachgebrauch ist
Gegensatz dokumentiert.
GSKww Wechselwirkung
GSKsilb Die Vorsilben
"a", "dis", "im", "in", "mis", "un" oder "a" stehen für eine Negation
und drücken das Gegenteil und keinen Gegensatz aus.
- in
Transitiv-intransitiv
Diskutabelä-indiskutabel
transparent-intransparent
mis
Vertrauen-Misstrauen
Verstehen-misversten
beliebt-missliebig
a
tonal-atonal
typisch-atypisch
musisch-amusisch
GSKerg Ersetzbarkeit
durch Gegenteil. Wenn bei einem Gegensatzpaar das Wort "Gegensatz" ohne
Sinneinbuße durch "Gegenteil" ersetzt werden kann, dann spricht das
gegen den Gebrauch von Gegensatz. Z.B. a) Kalt und warm als Gegensätze
ersetzt durch b) kalt und warm sind das Gegenteil. b) hört sich holpriger,
nicht so gut wie a) an.
GSKNeg Ersetzbarkeit durch
Negation. Wenn bei einem Gegensatzpaar der Gegensatzpaarling durch Negation
hergestellt werden kann, dann spricht das gegen einen echten Gegensatz.
Der Gegenteilbegriff kann durch Negation entstehen: logisch-unlogisch,
klar-unklar.
Gegensatzzuschreibung wichtig, relevant?
Sprachliche Methoden
zur Beurteilung des richtigen Gebrauchs von Unterschied, Gegensatz, Negation/
Verneinung und Widerspruch.
Ersetzungsmethode
Kann man A, G, N, U, W wechselseitig ersetzen, ohne dass Verständniseinbußen
auftreten, sind A, G, N, U, W nicht spezifisch.
A Im Gegensatz zu vorher, ist es nun anders.
G Im Gegensatz zu vorher, ist es nun leichter.
U Im Unterschied zu vorher, ist es nun leichter.
W Im Widerspruch zu vorher, ist es nun leichter.
N In Negation zu vorher, ist es nun leichter.
Gegensatzpaarsammlung
teilweise noch nicht signiert.
GSac-re Gegensatz actio
und reactio, Kraft und Gegenkraft
GSa-u Gegensatz angenehm-unangenehm
GSA-E Gegensatz anfangen
- aufhören
GSauf-zu Gegensatz auf
- zu. Sprachlich passt nach meinem Gefühl besser Gegenteil. Gegensatz
im menschlichen Denken und in der Sprache, aber nicht in der Natur. Beim
Schalter gibt es mehrer Möglichkeiten: Auf, Stufe (Dimmer bei Beleuchtung),
Zu. Zwischen den Zuständen auf und zu wirken keine Kräfte.
GSan-aus Gegensatz
GSans-abs Gegensatz Anziehung-Abstoßung
GSanz-ausz Gegensatz
anziehen - ausziehen
GSatm Gegensatz atmen
nicht atmen, aus- und einatmen.
GSA-I Gegensatz Äußeres
und Inneres
GSvvg-vk Gegensatz augmentativ
(vergrößerend)-diminutiv (verkleinernd)
GSb-u Gegensatz begrenzt-unbegrenzt
> endlich-unendlich.
GSb-r Gegensatz bewegt
(dynamisch)-unbewegt (statisch)
GSb-nb Gegensatz bewusst-nicht
bewusst
GSE-N Gegensatz Etwas-Nichts
> Sein-Nichts
GSe-u Gegensatz endlich-unendlich.
> begrenzt-unbegrenzt.
Gneu
Neutralisieren als Gegensatz: Kraft und Gegenkraft
GSfr-un Gegensatz freundlich-unfreundlich.
GSFeuWas Gegensatz Feuer und Wasser.
GSG-M Gegensatz Geist-Materie,
nicht bei Guardini S.25 (der auch zwischen Gegensatz und Widerspruch unterscheidet).
GSgeb-un Gegensatz gebildet-ungebildet
GSged-un Gegensatz Geduld-Ungeduld
GSgrz-kl Gegensatz großzügig-kleinlich.
- Das Gegenteil von größzügig ist kleinlich.
- Großzügig und kleinlich sind Gegensätze.
- Großzügig und kleinlich sind ein Widerspruch.
- Im Gegensatz zum großen Tisch ist der Aschenbecher klein. Verglichen werden Größen. Die Vergleichsobjekte sind austauschbar.
- Groß ist das Gegenteil von klein.
- Groß und klein sind ein Widerspruch.
- Die Negation von groß ist klein (und umgekehrt)
- Die Negation von groß ist nicht groß. Nicht groß sein muss nicht klein sein.
- Ein kleiner Liliputaner kann in seiner Bezugsgruppe groß sein.
- Bei groß und klein kommt es ganz auf den Massstab an.
- Bei groß und klein kommt es ganz auf die Entfernung an.
GSh-h Gegensatz herlaufen - weglaufen
GSk-w Gegensatz kalt-warm
GSk-u Gegensatz klar-unklar. Hier liegt kein Gegensatz vor, weil durch Negation von klar nicht klar = unklar hervorgeht.
GSk-d Gegensatz klug-dumm
GSK-S Gegensatz Körper-Seele
GSK-W Gegensatz Korpuskel-Welle
GSa-r Gegensatz Kraft und Gegenkraft, actio et reactio
GSL-T Gegensatz Leben-Tod
GSg-k Gegensatz leichtgläubig-kritisch, skeptisch
GSL-S Gegensatz Licht-Schatten
GSl-u Gegensatz logisch-unlogisch. Hier liegt kein Gegensatz vor, weil durch Negation von logisch nicht logisch = unlogisch hervorgeht.
GSm-d Gegensatz manisch-depressiv
GSM-F Gegensatz Mann-Frau. Falsche Gegensatzbildung. rtl (Abruf 17.11.18): "Tag und Nacht, Schwarz und Weiß, Mann und Frau – unser Leben ist voller Gegensätze.". Uni Zürich (Abruf 17.11.18): "Der Gegensatz zwischen Mann und Frau"
GSna-fe Gegensatz nahe-fern
GSof-ge Gegensatz offen - geschlossen
GSpe-no Gegensatz periodisch-nicht periodisch. Das ist kein Gegensatz, sondern eine Verneiung, Kontradiktion oder Widerspruch.
GSre-ar Gegensatz reich-arm.
GSRi-Ge Gegensatz Richtung - Gegenrichtung
GSs-l Gegensatz schnell-langsam
GSs-h Gegensatz schön-hässlich
GSs-u Gegensatz schuldig-unschuldig
GSs-n Gegensatz sorgfältig-nachlässig
GSS-N Gegensatz Sein-Nichts >Etwas-Nichts.
- Sein ist sehr allgemein irgendetwas identifizierbares.
- Das Gegenteil von Sein ist Nicht-Sein.
- Sein und Nichts wird aber auch als Gegensatz gebraucht.
GST-N Gegensatz Tag-Nacht
GST-A Gegensatz These-Antithese
GSun-ob Gegensatz unten - oben.
GSvo-hi Gegensatz vorne - hinten
GSw-f Gegensatz wahr-falsch, richtig-falsch
GSw-e Gegensatz weit-eng
GSw-u Gegensatz wesentlich-unwesentlich
GSY-Y Gegensatz Yin-Yang
_
Untersuchungs-Tabelle zur Analyse gegensätzlicher Beziehungen
Die Idee ist, dass man zwei Objekte oder Sachverhalte daraufhin analsiert, ob, welche und evtl, wie sehr Metakriterien der Diagnose für Gegensätze erfüllt sind. Ganz allgemein kann es Merkmale geben, die für einen Gegensatz sprechen oder gerade auch nicht. Hierbei ist es sinnvoll, die ontologischen Bereiche und das dialektische Bezugssystem DBS anzugeben von dem aus die Beurteilung erfolgt.
Ontologische Bereiche Referenzwelt-Kürzel
O, M,
ME,
MW,
MD,
MP,
MN,
MB,
MS,
m,
onS.
Dialektische Bezugssysteme
(DialonS), (DialBild),
(DialEntwT), (DialHeg),
(DialDMat), (DialEWET),
(DialMeth), (DialArgL),
(DialAnd)
Die Beurteilungen in der Tabelle erfolgen auf dem weltanschaulichen,
wissenschaftlichen
Hintergrund und dem dialektischen Bezugssystem (DialMeth).
| Beschreibung des Analyse Paares mit Index betrachteter on- tologischer Bereich | GSKDud
Verhältnis äus- serster Verschie- denheit. |
GSKNkd
Keine Kontra- diktion _ |
GSKanab
Anziehungs- oder Abstos- sungskräfte wirken |
GSKverb
Verbunden sein, damit Kraft wirken kann |
GSKkrw
Krafteinwir- kung _ _ |
GSKebp
eindimensio- nale oder bipolare Dimension |
GSKbf
Konträre Ur- teile können beide falsch sein |
GSKsprg
Sprachge- brauch Ge- gensatz _ |
GSKww
Wechselwir- kung |
GSKsilb
Die Silben un-, a-, an-, non-, miss-, ab-, de-, in-, im- drücken eine Negation und das Ge- genteil aus. |
| schwarz-weissO
_ _ _ |
Nein. Physiker sprechen nicht
so. _ _ |
Ja. Auch Physiker würden sagen, dass hier keine Kontradiktion vorliegt. | Nein. Physiker
erkennen hier keine Anzie- hungs- oder Abstossungs- kräfte. |
Nein. Physiker sehen hier kei- nen Gegensatz.
_ _ |
||||||
| schwarz-weissMS | Ja | Ja | Nein | Ja | ||||||
| Proton-ElektronO | Nein | Ja | Ja | Nein | ||||||
| Proton-ElektronMS | Nein | Ja | Ja | Ja | ||||||
| gut-schlechtO | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
| gut-schlechtMS | Ja | Ja | Möglich | Nein | Ja | Ja | Ja | |||
| actio-reactioO | ||||||||||
| actio-reactioO | ||||||||||
Beispiel-Analysen dialektischer Kategorien
- "Gegensatz" schwarz und weiss in den verschiedenen ontologischen Bereichen.
- Gegensatz gleichnamige und ungleichnamige Ladungen.
- Gegensatz bei menschlichen Motiven, Bedürfnissen und Zielen.
- Interessen-Gegensätze in der Gesellschaft und zwischen den Völkern.
"Gegensatz" Schwarz-Weiss S-W
Ergebnis: Schwarz und Weiss sind keine objektiven Gegensätze, sondern Ergebnis eines kognitven Sozialisationsprozesses. Schwarz und weiss werden als Gegensatz soziokulturell gelernt. Schwarz und weiss sind Gegensatz in unserem Denken und in der Sprache. Es sind Konstruktionen aus dem ontologischen Bereich Mensch.
- SW-Objektive-Realität (O)
In der objektiven Realität, in der Welt der Physik, die es auch gibt, wenn man sich die Menschen hinwegdenkt, gibt es kein Schwarz und Weiss.
Moeglichkeit (RWm)
Die Möglichkeit einer S-W-Wahrnehmung setzt Körper, Licht
und Lichtreflexion und ein entsprechend ausgebildetes wahrnehmendes System
voraus.
SW-Erleben (ME) - Zum Erlebensbegriff
in dieser Arbeit > ME
Erleben.
Schwarz und weiss kann im Erleben in mehreren Funktionsbereichen wie
z.B, Wahrnehmen, Empfinden, Vorstellen, Phantasieren, Denken oder Bewerten
auftreten.
SW-Wahrnehmung (MW).
Schwarz erscheinen in der menschlichen Wahrnehmung Körper, die
kein Licht reflektieren. Die Wahrnehmung weiss entsteht durch eine Mischung
von Farben. Schwarz und weiss können aus Mischungen von Komplementärfarben
(Gegenfarben) entstehen. Das Erleben und Beurteilen als "Gegensatz" wird
in Sprach- und Sozialgemeinschaften gelernt ("man spricht
so", "man nennt es so") wie z.B. oben-unten, groß-klein, gut-schlecht.
Rein physikalisch stehen sich gegenüber: keine Lichtreflexion - spezifisch
gemischte Lichtreflexion. Logisch schließen sich schwarz und weiss
nicht mehr aus als schwarz und grün, blau oder rot. Wenn etwas schwarz
oder weiss ist, dann ist es nicht grün, blau oder rot.
- SW-Denken (MD)
S-W sind feste und weit verbreitete Begriffe im Denken sehr vieler Menschen. Man spricht sogar von einem S-W-Denken, wie es für Menschen mit einer Borderlinestörung typisch sein soll. Es ist eine Metapher für eine polare Sicht der Dinge ohne Zwischenstufen. Linehan sieht es als ein Scheitern der Dialektik an.
SW-Phantasie (MP)
Schwarz und weiss kann in Phantasien eine vielfältige Rolle spielen,
besonders auch in der Anwendung Kunst (Malerei, Graphik, Zeichnung), Werbung
und Design.
SW-Wuensche & Beduerfnisse (MB)
Mode, Kleidung, Design.
SW-Sprache (MS)
Schwarz und weiss sind gängige Worte der Alltags- und Bildungssprache.
Exkurs: Metaphern mit Schwarz und weiss.
Schwarz Metaphern: Depression, Trauer, Tod, Umnachtung, anschwärzen,
Dunkelheit, Nacht, schwarz sehen, schwarze Zahlen,
Weiss Metaphern: rein, sauber, unschuldig, Licht, hell, Wand- und Deckenfarbe,
Schwarz und weiss Metaphern: Schwarz auf Weiss (sicher, verbindlich,
Beweis).
Gegensatz gleichnamige und ungleichnamige Ladungen in der Natur
Noch nicht ausgearbeitet.
Gegensatz bei menschlichen Motiven, Bedürfnissen und Zielen.
Noch nicht ausgearbeitet.
Interessen-Gegensaetze in der Gesellschaft und zwischen den Völkern.
Noch nicht ausgearbeitet.
Tabellarische Kontrolle Möglichkeit
Wenn man sicher gehen will, dass man keinen Aspekt vergisst, kann man mit folgendem Tabellensystem (ohne dialektische Logik im engeren Sinne) arbeiten und sich damit zwingen, jede Zelle zu berücksichtigen..
| Gegensatz zwischen
schwarz und weiß. Zeile OB, Spalte DBS. |
sches Bezugs- System. |
Sprachbrock- haus oder ähn- liche Lexika / Wörterbücher. |
These, Anti- these, Synthese _ |
Systematik nach Hegel. _ _ |
_ |
_ |
(DialArgL) für und wider, Betrachtung. |
_ _ |
| O Objektive Realität | In der Natur
gibt es keinen Gegensatz zw. schwarz/weiß |
In der Bildungs- sprache fehlt gewöhnlich der ontologische Bezug. | Bislang keine Ausführung hierzu gefun- den. | Sein und Geist
ist bei Hegel eins. |
Bislang keine Ausführung hierzu gefun- den. | Eher nicht | ||
| RWm Möglichkeit | ||||||||
| ME Erleben | Im Erleben der meisten Men- schen werden schwarz und weiß als Gegen- sätze wahrgen. | differenziert die verschiedenen ontologischen Bereiche, hier das Erleben, nicht. | differenziert die verschiedenen ontologischen Bereiche, hier das Erleben, nicht. | differenziert die verschiedenen ontologischen Bereiche, hier das Erleben, nicht. | differenziert die verschiedenen ontologischen Bereiche, hier das Erleben, nicht. | differenziert die verschiedenen ontologischen Bereiche, hier das Erleben, nicht. | ||
| MW Wahrnehmung | Die meisten Menschen nehmen schwarz und weiß als Gegensätze wahr. | |||||||
| MD Denken | Hauptgrund für das schwarz- weiß Gegensatz- urteil | Entwicklung
des kognitiven Denkens |
||||||
| MP Phantasie | ||||||||
| MB Wünsche
Bedürfnisse |
||||||||
| MN Normen | S-W-Werten als kognitiv-affektive Funktion sollte im Gehirn grund- sätzlich nach- weisbar sein (natcode). | |||||||
| MS Sprache | In der Sprache werden schwarz und weiß als Gegensätze bezeichnet. | In der Bildungs- sprache werden schwarz und weiß als Gegen- sätze bezeichnet. | In der dialekti- schen Entwick- lungstheorie können schwarz und weiß als Ge- gensätze ezeich- net werden. | Unklar | Aktiver und re- zeptiver Gebrauch der Worte in kom- munikativen
Situationen. |
Taxonomie von
Vorgängen
Vorbereitung - Anfang - Verlauf - Ende - Nachgeschehen
Noch nicht ausgearbeitet.
Gegensatz in Fachwörterbüchern und Monographien
Gegensatz in Eislers
philosophischem Wörterbuch
Gegensatz: 1) logischer (Opposition) das Verhältnis, in welchem
zwei Begriffe oder zwei Urteile zueinander stehen, die einander ausschließen.
Es gibt einen kontradiktorischen (s. d.) und einen conträren (subconträren)
Gegensatz. ARISTOTELES erklärt: antikeimena legetai antiphasis kai
tanantia kai ta pros ti kai sterêsis kai hexis kai ex hôn kai
eis ha eschata ai geneseis kai phthorai (Met. V 10, 1018a 20). Er unterscheidet:
antiphatikôs (kontradiktorisch), enantiôs (conträr), kata
têê lexin monon antikeimena (De interpret. 6, 17a 26; 7, 17b
16; Categ. 10, 13b 27. Anal. prior. II 15, 63b 23). So auch CICERO (Top.
11). Die Scholastiker unterscheiden »oppositio terminorum«
und »oppos. enunciationum«. Nach ÜBERWEG ist Opposition
»der Gegensatz, der zwischen zwei Urteilen von verschiedener Qualität
und verschiedenem Sinne bei gleichem Inhalt besteht« (Log. §
97). Schema der Opposition:
»Gegensatz« ist 2) ontologischer (realer)
Gegensatz (»Repugnanz«), Widerstreit zweier Dinge, zweier Qualitäten,
zweier Tätigkeiten, dynamische Entgegensetzung, Willens-Gegensatz,
Gegensatz der Gefühle (physischer-psychischer Gegensatz, ethischer,
sozialer Gegensatz).
Die Pythagoreer stellen eine Tafel von zehn Gegensatz-Paaren
als Prinzipien der Dinge auf (peras kai apeiron, peritton kai artion, hen
kai plêthos, dexion kai aristeron, arrhen kai thêly, êremoun
kai kinoumenon, euthy kai kampylon, phôs kai skotos, agathon kai
kakon, tetragônon kai eteromêkes, ARISTOTELES, Met. I 5, 986a
22 squ.). HERAKLIT macht den Gegensatz zum Prinzip der Entwicklung. Im
»Gegenlauf« (enantiodromia, Stob. Ecl. I, 60) des Geschehens
ist in allem das Entgegengesetzte vereinigt, schlägt eines in das
Gegenteil um (taut' einai zôn kai tethnêkos, kai to egrêgoros
kai to katheudon, kai neon kai gêraion (Fragm. 78). Alles erfolgt
kat' enantiotêta nach der enantia rhoê, palintropia (Plat.,
Cratyl. 413 E, 420 A; panta te ginesthai kath' eimarmenên kai dia
tês enantiotropês hêrmosthai ta onta, Diog. L. IX 1,
7; ginesthai te panta kat' enantiotêta, l.c. 8; panta ... metaballei
eis enantion oion ek thermou eis phychron Arist. Phys. III 5, 205a 6; vgl.
Sext. Empir. Pyrrh. hypot. III, 230). Die Gegensätze gehen in einer
Einheit zusammen wie Bogen und Leier (palintropos harmoniê kosmou
hokôster lyrês kai toxou, Plut., Is. et Osir. 5). Nach PLOTIN
sind Gegensätze Dinge, die nichts Identisches an sich haben (Enn.
VI, 3, 20). - CHR. WOLF definiert: »Opposita sunt, quorum unum involvit
negationem alterius« (Ontol. § 272). KANT betont den Unterschied
zwischen logischer und realer Opposition. »Einander entgegengesetzt
ist, wovon eines dasjenige aufhebt, was durch das andere gesetzt ist. Diese
Entgegensetzung ist zweifach; entweder logisch durch den Widerspruch, oder
real d. i. ohne Widerspruch« (WW. II, 75 ff.). Die »dialektische«
Opposition ist von der auf dem Satze des Widerspruches fußenden »analytischen«
zu unterscheiden (Krit. d. r. Vern. S. 410). Nach J. G. FICHTE, besonders
aber nach HEGEL schlägt jeder Begriff (im logischen Denken) in seinen
Gegensatz um, um sich mit ihm in einem höheren Begriffe zu vereinigen
(Dialektik, s. d. u. Widerspruch). Nach HILLEBRAND kann es keinen metaphysischen,
realen Gegensatz geben, d.h. einen solchen, welcher im Sein unausgleichbar
wäre (Phil. d. Geist. I, 23). Nach HERBART ist der »Gegensatz
zweier Vorstellungen« ein voller, »wenn eine von beiden ganz
gehemmt werden muß, damit die andere ungehemmt bleibe« (Psychol.
als Wiss. I, § 41). Vorstellungen, die einander entgegengesetzt sind
und zusammentreffen, werden zu Kräften, die einander widerstehen,
hemmen (Lehrb. zur Psychol.3, S. 15). Der Grund des Widerstehens ist die
Einheit der Seele (l.c. S. 21). Entgegengesetzte Vorstellungen verschmelzen
(s. d.) miteinander, soweit sie nicht gehemmt werden (l.c. S. 21 f.). Nach
MÜNSTERBERG ist entgegengesetzt in der Vorstellungswelt das, »was
antagonistische Handlungen anregt« (Grdz. d. Psychol. I, 550). WUNDT
sieht in dem psychologischen »Gesetz der Entwicklung in Gegensätzen«
eine Anwendung des Gesetzes der Kontrastverstärkung (s. d.) auf umfassendere
Zusammenhänge. »Diese besitzen nämlich... die Eigenschaft,
daß Gefühle und Triebe, die zunächst von geringer Intensität
sind, durch den Kontrast zu den während einer gewissen überwiegenden
Gefühlen von entgegengesetzter Qualität allmählich stärker
werden, um endlich die bisher vorherrschenden Motive zu überwältigen
und nun selbst während einer kürzeren oder längeren Zeit
die Herrschaft zu gewinnen.« Mehr als im individuellen tritt das
Gesetz im geschichtlichen Leben, im Wechsel geistiger Strömungen hervor
(Gr. d. Psychol.5, S. 401 f.; Syst. d. Phil.2, S. 598; Log. II2, 2, S.
282 ff.; Phil. Stud.X, 75 ff.). Vgl. Widerstreit, Widerspruch, Element."
_
Gegensatz in Klaus & Buhr marxistisch orientiertem Philosophischem Wörterbuch 1969
"Gegensatz - eigtl-, das Entgegengesetzte oder auch Satz, der einem
anderen entgegengesetzt ist und diesen ausschließt. Im allgemeineren
philosophischen Sinne bedeutet der Begriff «Gegensatz»
einen der beiden Pole eines (dialektischen oder logischen) Widerspruchs,
d. h. einen objektiven Sachverhalt, der zu einem anderen Sachverhalt im
Verhältnis des dialektischen Widerspruchs steht (realer Gegensatz),
oder einen Begriff bzw. eine Aussage, der bzw. die zu einem anderen Begriff
bzw. einer anderen Aussage im Verhältnis des logischen Widerspruchs
steht (logischer Gegensatz).
Logische Gegensätze sind Begriffe oder Aussagen, die einander
ausschlicßen. Dabei ist zwischen kontradiktorischem
und konträrem Gegensatz zu unterscheiden. Begriffe
stehen formallogisch im Verhältnis der Kontradiktion, wenn der eine
die logische Negation des anderen darstellt, z. B. «Sein» -
«Nichtsein», «weiß» - «nichtweiß»,
«Möglichkeit» - «Unmöglichkeit» usw.
Konträre Gegensätze liegen
dann vor, wenn beide positive Gegebenheiten widerspiegeln, die sich innerhalb
eines bestimmten Bezugssystems ausschließen, z. B. «Sein»
- «Anders-Sein», «weiß» - «schwarz»,
«Kreis» - «Quadrat», «Maximum» - «Minimum»
usw. Analoges gilt für Aussagen, die sich im Verhältnis der Kontradiktion
(z. B. «Jeder Baum hat Wurzeln» - «Nicht jeder Baum hat
Wurzeln») oder der Kontrarietät (z. B. «Jeder Baum hat
Wurzeln» - «Kein Baum hat Wurzeln») befinden. Kontradiktorische
und konträre Begriffe bzw. Aussagen unterliegen dem - Satz vom ausgeschlossenen
Widerspruch, dem zufolge zwei derartige Begriffe Eigenschaften widerspiegeln,
die einem Objekt unmöglich zugleich und in derselben Hinsicht zukommen
bz.w. dem zufolge zwei derartige Aussagen nicht zusammen wahr sein können.
Während jedoch von zwei kontradiktorischen Sätzen immer der eine
wahr und der andere falsch sein muß, wobei der eine aus dem anderen
durch logische Negation formal ableitbar ist, können zwei konträre
Sätze auch zusammen falsch sein; der eine ist aus dem anderen formallogisch
nicht ableitbar.
Reale Gegensätze sind objektive
Sachverhalte, zwischen denen ein Polaritätsverhältnis besteht,,
d. h. Sachverhalte, die als Glieder einer, disjunktiven Reihe sich polar
gegenüberstchen (> Polarität), einander ausschließen und
sich zugleich gegenseitig bedingen. Reale Gegensätze bilden inner-,
halb eines gemeinsamen Wesens Extreme, z. B. Proletariat - Bourgeoisie,
Notwendigkeit - Zufall, Kontinuität - Diskontinuität usw. Reale
Gegensätze sind nichts Starres, Unbewegliches, sondern unterliegen
wie alle Erscheinungen der objektiven Realität dem Werden und Vergehen:
Sie entwickeln sich aus Unterschieden, sind der Unterschied auf der höchsten
Stufe seiner Ent-' wicklung. Andererseits können reale Gegensätze
sich auch über wesentliche Unterschiede in unwesentliche Unterschiede
verwandeln und unter Umständen ganz zu existieren aufhören. So
wird z. B. der in der antagonistischen Klassengesellschaft bestehende Gegensatz
zwischen Stadt und Land oder zwischen körperlicher und geistiger Arbeit
im Laufe der Entwicklung des sozialistischen Gesellschaftssystems zu einem
wesentlichen Unterschied, der sich seinerseits immer mehr auf einen unwesentlichen
Unterschied reduziert. Die Dynamik realer Gegensätze findet ihren
Ausdruck auch darin, daß beide Gegensätze aufeinander einwirken,
miteinander in Wechselwirkung stehen. In dieser aktiven Wechselwirkung
durchdringen die Gegenstände sich gegenseitig, können ineinander
übergehen und in bestimmter Hinsicht identisch werden.
Das Prinzip von der Identität und der gegenseitigen Durchdringung
der Gegensätze ist eines der wichtigsten Prinzipien der Dialektik.
LENIN (38, 99) bestimmt die Dialektik geradezu als «die Lehre, wie
die Gegensätze identisch sein können und es sind (wie sie es
werden) - unter welchen Bedingungen sie identisch sind, indem sie sich
ineinander verwandeln».
Der reale dialektische Gegensatz unterscheidet sich sowohl vom kontradiktorischen
als auch vom konträren. Während diese in der Realität nicht
[>] existieren, sondern nur den Widerspiegelungen objektiver Gegebenheiten
zukommen, bestehen dialektische Gegensätze objektiv real. Sätze,
die einen kontradiktorischen oder konträren Gegensatz zum Ausdruck
bringen, können nicht zusammen wahr sein, während zwei Sätze,
die einen realen, dialektischen Gegensatz widerspiegeln, beide wahr sein
müssen, z. B, «Ein Elementarteilchen hat Wellencharakter»
- «Ein Elementarteilchen hat Korpuskelcharakter».
> Identität > Unterschied Einheit und «Kampf»
der Gegensätze >Widerspruch, dialektischer"
Zwei Verneinungen:
kontradiktorisch und konträr.
Die übliche und wichtigste Verneinung geschieht gewöhnlich
mit der einfachen Negation, dem nicht., was
man in der Logik meist mit A und -A (Nicht-A) zum Ausdruck bringt, z.B.
das Blatt ist gelb mit der Verneinung das Blatt ist nicht gelb. Diese Verneinung
wird gewöhnlich als kontradiktorische bezeichnet. Die spezielle Verneinung
durch einen direkten Gegensatz, bezeichnet man, wenn es ihn gibt, als konträr,
z.B. schwarz und weiß, groß und klein, dick und dünn.
Eine Bewegung gehe in Richtung R. Eine genau dazu entgegengesetzte
Bewegung wäre dazu konträr. Eine Bewegung, die nicht in Richtung
R geht wäre hingegen kontradiktorisch. Sitzen hat so wenig einen Gegensatz
wie Sauerteig, Aschenbecher, die Zahl 2 oder ein Ausrufezeichen.
Doe logische Beziehung zwischen beiden Vernenungen ist: kontradiktorisch
umfasst konträr bei weitem, das Konträre ist aus den potentiell
unendlichen Möglichkeiten nur eine sehr spezielle Kontradiktion.
Aus dem Wörterbuch der Logik (Kondakow)
Begriffe, kontradiktorische
[contradictoriae lat.]: unvereinbare Begriffe, die einander ausschließen,
zwischen denen es keinen mittleren, dritten Zwischenbegriff gibt.
Die Begriffe weiß und nicht weiß
negieren
einander z. B. völlig. Man kann sie nicht gleichzeitig in ein und
derselben Beziehung auf ein und denselben Gegenstand anwenden, auch die
konträren
Begriffe weiß und schwarz kann man nicht auf ein und denselben
Gegenstand gleichzeitig und in ein und derselben Beziehung anwenden (>
Begriffe, konträre). Aber von konträren Begriffen unterscheiden
sich k. B. dadurch, daß zwischen konträren Begriffen ein Mittelbegriff,
ein dritter, möglich ist, während es zwischen kontradiktorische
Begriffe keinen Mittelbegriff, keinen dritten gibt. Welche Farbe wir auch
in der Tat wählen z. B. Blau oder Gelb, keine kann zum Mittelbegriff
werden, weil sie in den Umfang des Begriffes
nichtweiß
eingeht
(Abb.).
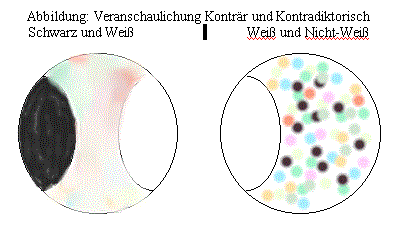 |
 |
Mit kontradiktorischen Begriffen hat man es in jeder Wissenschafl zu tun: in der Mathematik z. B. sind solche Begriffspaare: gleich - nicht gleich, kommensurabel - nicht kommensurabel, spitz - nicht spitz, gerade - nicht gerade, entsprechende Paare in der Chemie sind z. B. organisch - anorganisch, wäßrige Lösung - nicht wäßrige Lösung, gesättigte Lösung - ungesättigte Lösung.
Begriffe, konträre [contrariae
lat.]: unvereinbare Begriffe, zwischen denen ein Drittes, ein Mittleres
möglich ist, und die sich nicht nur gegenseitig negieren, sondern
auch etwa Positives für das im diskordanten [uneinigen] Begriff verneinte
enthalten, z. B. die Paare tapfer - feige, schwer - leicht, warm kalt.
Jeder Begriff des Paares weiß - schwarz
geht in den Umfang des subordinierenden [= unterordnenden; RS] Begriffs
Farbe ein, füllt ihn aber nicht voll aus (Abb.).
Operationen mit k. B. werden in Übereinstimmung
mit den Forderungen des Satzes vom Widerspruch vorgenommen, aus dem sich
folgende Regeln ableiten lassen:
I. Nicht beide konträren Begriffe können,
über ein und dieselbe Klasse von Gegenständen genommen, in ein
und derselben Zeit und in ein und derselben Beziehung
gleichzeitig wahr
sein. Wurde z.B. festgestellt, daß das eine Metall leicht
ist, muß der konträre Begriff schwer in bezug auf dieses
Metall falsch sein.
II. Beide konträren Begriffe können
sich, über ein und dieselbe Klasse von Gegenstanden genommen, zu ein
und derselben Zeit und in ein und derselben Beziehung als falsch erweisen.
Dies erklärt daß zwischen konträren Begriffen ein Drittes,
Mittleres möglich ist. Die Begriffe heller Stern und
schwacher
Stern sind z.B. konträre Begriffe. Daraus folgt, daß zwischen
ihnen ein Drittes möglich ist, z. B. die Sonne, die die Astronomen
als einen der Leuchtkraft nach mittleren Stern klassifizieren, der nicht
sehr hell, aber auch nicht sehr schwach ist.
III. Aus der Wahrheit einer Aussage für
den einen von zwei konträren Begriffen folgt mit Notwendigkeit die
Falschheit der entsprechenden Aussage für den anderen. Wenn
wahr ist, daß durch eine Leitung Schwachstrom fließt, dann
muß die konträre Behauptung, daß durch sie Starkstrom
fließt, falsch sein.
IV. Aus der Falschheit einer Aussage über
den einen von zwei konträren Begriffen folgt logisch
weder die
Wahrheit noch die Falschheit der entsprechenden Aussage für den
anderen. Ist z. B. die Behauptung »dieses Dreieck ist spitzwinklig«
falsch, so kann man über die konträre Behauptung »dieses
Dreieck ist stumpfwinklig« nichts Bestimmtes sagen, weil es zwei
Möglichkeiten gibt: das Dreieck kann stumpfwinklig sein, es kann aber
auch rechtwinklig sein. Die angeführten Regeln gelten für beliebige
k. B., konträre Begriffe unabhängig von ihrem konkreten Inhalt.
Aus der Physik genommene konträre Begriff, z. B.
kalt - warm, weiß
- schwarz, aus der Mathematik gewählte wie groß - klein,
gekrümmt - gerade oder aus jedem beliebigen Wissensbereich herangezogene
konträre Begriff sind in gleichem Maße dem Satz vom Widerspruch
untergeordnet."
Gegensatz in Klaus & Buhr marxistisch orientiertem Philosophischem Wörterbuch.
Konträr
in der Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie
Kuno Lorenz in Mittelstraß, Jürgen (2010, Hrsg.), 2.A.
Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. 2. A., Bd. 4. Stuttgart:
Metzler.
konträr/Kontrarität (von lat. contrarius, über
franz. contraire, entgegengesetzt, griech. ivavrlov), Bezeichnung für
einen speziellen >Gegensatz: Zwei >Aussagen heißen k. zueinander,
wenn jede die >Negation der anderen, ihr Gegenteil, gegebenenfalls unter
Heranziehung bereits anerkannter >Prämissen, impliziert, beide Aussagen
also miteinander unverträglich oder inkompatibel (>inkompatibel/Inkompatibilität)
sind, mit anderen Worten, einander ausschließen. Z. B. sind > Bonn
ist ein Dorf< und >Bonn ist eine Stadt< k.e Aussagen, wenn die [334]
Prämisse >Dörfer sind keine Städte, anerkannt und herangezogen
wird. Entsprechend heißen zwei Prädikatoren >P< und >Q<
und ebenso die zugehörigen >Begriffe IPJ und JQJ bzw. die beiden Eigenschaften,
die ein Gegenstand n haben würde, wenn er unter diese Begriffe fiele,
,zueinander k., oder >einander ausschließend<, wenn die >Elementaraussagen
>n c P< und >n c Q< schematisch allgemein, also unabhängig vom
Gegenstand n, zueinander k. sind. Zu den k.en Aussagen gehören insbes.
die kontradiktorischen (>kontradiktorisch/Kontradiktion) Aussagen, bei
denen jede mit der Negation der anderen sogar äquivalent (>Äquivalenz)
ist; z.B. in der >Syllogistik die Aussagen der Form >SiP< (einige S
sind P) und ,SeP< (kein S ist P) im Unterschied zu den - bei einer extensionalen
(>extensional/Extension) Deutung der syllogistischen >Aussageschemata allerdings
nur unter der Voraussetzung, daß der Begriff JSJ nicht leer ist (Existenzpräsupposition,
>Kennzeichnung) - zueinander bloß k.en Aussagen der Form >SaP<
(alle S sind P) und >SeP< (kein S ist P) (>Quadrat, logisches).
Unter den k.en Prädikatoren spielen die >polar-konträren
eine besondere Rolle, weil sie die (relativen) Enden einer linear geordneten
Reihe von Prädikatoren bilden, die grundsätzlich einer Vergleichsskala,
also einem zweistelligen Prädikator und seinem Konversen (ikonvers/
Konversion), entstammen; z.B. >groß< und >klein< als relative
Enden auf der Skala >größer (als)< bzw. >kleiner (als)<
oder >weiß, und >schwarz< als Enden auf der Grauskala. Auch die
Paare jeweils antonymer (iantonym/ Antonymie) oder als antonym verstandener
Prädikatoren, die auf keine Vergleichsskala zurückgehen, wie
> lieben< und >hassen<, oder die zu einer mehr als zweigliedrigen
Einteilung gehören, wie >Maskulinum< und Femininum< in der lateinischen
oder deutschen Grammatik, gehören zu den k.en Prädikatoren. K.
L.
Kommentar: unverständlich.
kontradiktorisch/Kontradiktionin
der Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie
kontradiktorisch/Kontradiktion (von lat. contradicere/contradictio,
widersprechen/Widerspruch), Terminus der Logik. Zwei Aussagen heißen
>zueinander k.<, wenn eine mit der >Negation der anderen logisch äquivalent
ist (z.B. A und -,A). Sie sind dann stets auch zueinander konträr
(tkonträr/Kontrarität), aber nicht generell umgekehrt. Insbes.
sind in der >Syllogistik >Aussagen der Form SaP bzw. SiP (alle S sind P
bzw. einige S sind P) zu Aussagen der Form SoP bzw. SeP (einige S sind
nicht-P bzw. kein S ist P) k., auch wenn dieser k.e >Gegensatz selbst nicht
mehr syllogistisch ausgedrückt werden kann (>Quadrat, logisches).
Entsprechend heißen zwei >Termini P und Q, für die sowohl die
terminologische Regel x E: P => x E:1 Q (in Worten: was P ist, ist nicht
Q) als auch die terminologische Regel x E:' P gilt, ,zueinander k.<.
Denn wegen x t:1 X >-< -, x E: X und x E: X >-< -, x E:1 X, d. h.,
wenn für jeden Gegenstand des betrachteten Bereichs und für jeden
>Prädikator eines Bereichs von zum Gegenstandsbereich gehörigen
Prädikatoren gilt, daß er entweder einem Gegenstand zukommt
oder ihm nicht zukommt, ist jede der beiden Aussageformen xt:P und xt:Q
mit der Negation der jeweils anderen äquivalent, also /\x(x E: P <-+
-, x E: Q) wahr.
Im verallgemeinerten Sprachgebrauch nennt man auch die Konjunktion
zweier k.er Aussagen >k.< oder ,in sich widersprüchlich< bzw.
eine >K.<, weil aus ihr als einer logisch falschen Aussage jede beliebige
Aussage bereits logisch gefolgert werden kann (iex falso quodlibet), also
auch Aussagen, die ein allgemeinungültiges (tallgemeinungültig/
Allgemeinungültigkeit) iAussageschema erfüllen und daher
bereits ilogisch falsch sind. Eine falsche Aussage ist mit einer logisch
falschen Aussage logisch äquivalent; sie kann deshalb als das Falsche
oder ifalsum (Zeichen: J.), gleichgültig ob als Aussage oder als Aussageschema
genommen, ausgezeichnet werden. Dies ist der Grund für den verbreiteten
Sprachgebrauch, >k.< und ,logisch falsch< als synonym (tsynonym/Synonymität)
zu behandeln. Man nennt auch ein ganzes Aussagesystem, z.B. ein Axiomensystem
(iSystem, axiomatisches), >k.< (auch: ,inkonsistent< oder ,widerspruchsvoll<,
iwiderspruchsfrei/ Widerspruchsfreiheit), wenn eine K. bzw. falsum daraus
logisch geschlossen werden kann.
Literatur: J. Barnes, The Law ofContradiction,
Philos. Quart. 19(1969), 302-309; E. Chavarri, La contradiction chez Aristote
et chez Marx, Estudios Filosoficos 33 (1984), 111-142; P. T. Geach, Logic
Matters, Oxford 1972, 1981; L. Horn, A Natural History of Negation, Chicago
ID./London 1989, Stanford Calif. 2001; ders., tradiction, SEP 2006; A.
Kulenkampff, Antinomie und Dialektik. Zur Funktion des Widerspruchs in
der Philosophie, Stuttgart 1970; J. Lukasiewicz, 0 zasadzie sprzecznosci
u Arystotelesa, Krakau 1910, Warschau 1987 (dt. über den Satz des
Widerspruchs bei Aristoteles, Hildesheim etc. 1993; franz. Du principe
de contradiction chez Aristote, Paris 2000); ders., über den Satz
des Widerspruchs bei Aristoteles, Bull. Int. de l' Acad. des Sei. de Cracovie,
Classe de Philos. (1910), 15-38, Nachdr. in: D. Pearce/J. Wolenski (eds.),
Logischer Rationalismus. Philosophische Schriften der Lemberg-Warschauer
Schule, Frankfurt 1988, 59-75 [dt. Kurzfassung der poln. Fassung] (engl.
On the Principle of Contradiction in Aristotle, Rev. Metaphysics 24 [1971],
485-509); T. Parsons, True Contradictions, Can. J. Philos. 20 (1990), 335-353;
G. Patzig, Widerspruch, in: Hb. ph. Grundbegriffe III, München 1974,
1694-1702; G. Priest, In Contradiction. A Study of the Transconsistent,
Dordrecht 1987, erw. Oxford 2006; ders., To Be and Not to Be - That Is
the Answer. On Aristotle on the Law ofNon-Contradiction, Philos. gesch.
u. logische Analyse l (1998), 91-130; ders./J. C. Beall/B. Armour-Garb
(eds.), The Law ofNon-Contradiction. New Philosophical Essays, Oxford 2004,
2006; F. A. Seddon, The Principle of Contradiction in »Metaphysics«
Gamma, New Scholasticism 55 (1981), 191-207; ders., The Principle of Contradiction
in »Metaphysics« Gamma, Diss. Pittsburgh Pa. 1988; L. Vax,
Logique, Paris 1982. K. L
Gegensatz im DiaMat orientierten Woerterbuch der Logik
"Gegensatz: Kategorie, die eine der Seiten des dialektischen Widerspruchs ausdrückt und als philosophische Kategorie Kontraposition genannt wird. Die Einheit der Gegensätze bildet den dialektischen Widersprach, der die Quelle für die Entwicklung aller Gegenstände, Erscheinungen und Prozesse in der Natur, der Gesellschaft und im Denken ist. - S. a. Dialektik.
Gegensatz, konträrer: Form des Gegensatzes, in dem ein allgemein-bejahendes und ein allgemein-verneinendes Urteil konfrontiert werden, die in bezug auf alle Gegenstände ein und derselben Klasse ausgesagt werden, z. B. die beiden Urteile »alle Studenten unseres Studienjahres spielen Eishockey« und »kein Student unseres Studienjahres spielt Eishockey«. Diese beiden Urteile können nicht zusammen wahr sein. Wenn es wahr ist, daß alle Studenten unseres Studienjahres Eishockey spielen, ist die Aussage, daß kein Student unseres Studienjahres Eishockey spielt, falsch, und umgekehrt: wenn es wahr ist, daß kein Student unseres Studienjahres Eishok- key spielt, ist die Behauptung falsch, daß alle Studenten unseres Studienjahres Eishockey spielen. Konträre Urteile können aber beide falsch sein, und wahr wird dann in bezug auf die Studenten unseres Studienjahres und ihre Beschäftigung mit dem Eishockey das Urteil: »einige Studenten unseres Studienjahres spielen Eishockey«. Folglich gibt es im Fall konträrer Urteile eine dritte Möglichkeit, die als partikuläres oder als individuelles Urteil ausgedrückt wird. Beim Operieren mit konträren Urteilen muß man sich von zwei Regeln lenken lassen: einmal folgt aus der Wahrheit des einen der konträren Urteile die Falschheit des anderen; zum anderen ist aus der Falschheit des einen der konträren Urteile die Wahrheit des anderen nicht ersichtlich; es kann wahr sein und es kann auch falsch sein; z. B. folgt aus der Falschheit des Urteils »an allen Tagen des vergangenen Monats hat es geregnet« nicht die Wahrheit des Urteils: »an keinem Tag des vergangenen Monats hat es geregnet«. - S. a. konträre Begriffe; Satz vom Widerspruch.
Gegensätze, ihre Einheit und ihr Kampf: eines der Grundgesetze
der materialistischen Dialektik, das die Quelle jeder Entwicklung in der
Natur, der Gesellschaft und im Denken enthüllt.
Die Ursache der Selbstbewegung und Selbstentwicklung
der Gegenstände, der Prozesse sind die inneren dialektischen Widersprüche.
LENIN schreibt: „Spaltung des Einheitlichen und Erkenntnis seiner widersprechenden
Bestandteile ... ist das Wesen (eine der „Wesenheiten“, eine der grundlegenden,
wenn nicht die grundlegende Besonderheit oder Seite) der Dialektik“ (L.
38. S. 338). Deshalb definierte LENIN die Dialektik kurz als „Lehre von
der Einheit der Gegensätze“.
Damit, so sagte er, „wird der Kem der Dialektik erfaßt sein...“ (L.
38. S. 214). Das Gesetz von der Einheit und dem Kampf
der Gegensätze ist für das Verständnis der
Gesetze der Logik und der Denkformen, der Wege der Aufdeckung und der Ermittlung
der Wahrheit von großer Bedeutung. Dieses Gesetz steht nicht im Gegensatz
zum formal-logischen Satz, vom Widerspruch. Der dialektische Widerspruch
ist der Widerspruch des lebendigen Lebens. Er bedeutet das Vorhandensein
von zwei entgegengesetzten Seiten, bzw. Tendenzen im Gegenstand, in der
Erscheinung, die sich in ständig wechselndem Kampf befinden, aber
im Gegenstand gleichzeitig existieren, bis eine der gegensätzlichen
Tendenzen, die progressive Tendenz die zweite, die konservative Tendenz
besiegt und den Anfang für das Erscheinen eines neuen Gegenstands
gelegt hat, in dem ein neuer Widerspruch entsteht. Der logische Widerspruch
dagegen wird vom formal-logischen Satz vom Widerspruch verboten. Ein
logischer Widerspruch taucht dann auf, wenn einem einzigen Gegenstand
gedanklich zu ein und derselben Zeit, in ein und demselben Sinne und in
ein und derselben Beziehung zwei entgegengesetzte Eigenschäften zugeschrieben
werden, die einander gänzlich negieren und nicht gleichzeitig in diesem
Gegenstand existieren können. Als das klassische Beispiel eines logischen
Widerspruchs kann man die Überlegungen von MILL über die Profitraten,
die Produktionskosten und den Lohn, ansehen, die, nach den Worten von MARX
auf folgenden unlogischen Satz hinausgehen: „Obgleich es falsch ist, ist
es doch wahr“ (?/?. 26,3. S. 195). Ein derartiger Widersprach stört
die Überlegung, da er sie unklar macht: was ist denn wirklich richtig
oder falsch? Einen solchen Widerspruch im Denken bezeichnet LENIN als einen
verbalen, erdachten Widerspruch. „Logische Antinomien“ dürfen - richtiges
logisches Denken natürlich vorausgesetzt - weder in einer ökonomischen
noch in einer politischen Analyse vorkommen“ 1 (L. 23. S. 32). "
Quelle: Guardini, Romano (1998) Der Gegensatz. Versuch einer Philosophie des Lebendig-Konkreten. 1. A. 1925. Mainz/Paderborn: Grünewald/Schöningh.
Guardini unterscheidet Gegensatz und Widerspruch, S. 28: "Und doch keine Aufhebung der Art, wie sie etwa in der Aussage liegt: »Es ist hell« gegenüber der anderen; »Es ist dunkel«; oder in der Aussage: »Das ist gut« gegenüber der zweiten: »Das ist böse«. Hier handelt es sich um Widersprüche, die einander verneinen, daher in keiner Weise zusammen sein können. Aussagen hingegen, wie sie in den Begriffen des Aktseins und Bauseins liegen, der Kontinuität und Gliederung, stehen anders. Auch hier heben die beiden Aussagen einander zunächst auf. Sobald sie in ihrem besonderen Sinne genommen werden, duldet eine die andere nicht. Sofern etwas Akt ist, kann es kein Bau sein. Diese Ausschließung geht aber nicht bis auf die Wurzel. Sie ist nicht absolut, sondern relativ. Und zwar dann, wenn wir sie wesensgemäß nehmen, das heißt, sie nicht abstrakt, sondern am konkreten Ding vollzogen denken. Denn »das Ding« ist offenbar eins und das andere zugleich, Akt und Bau. Nicht durch Vermischung der beiden spezifischen Bedeutungen; nicht durch deren Ausgleich oder Synthese in einem höheren Dritten. Hier liegt Einheit vor, aber offenbar besonderer Art.
[Def Geg Guardini] Dieses eigentümliche Verhältnis, in dem jeweils zwei Momente einander ausschließen, und doch wieder verbunden sind, ja, wie wir später sehen werden, einander geradezu voraussetzen; dieses Verhältnis, das innerhalb der jeweiligen quantitativen, qualitativen und gestaltmäßigen Bestimmtheiten auftritt, nenne ich Gegensatz.
3. Umriß eines Systems der Gegensätze
Der ganze Bereich des menschlichen Lebens scheint von der Tatsache des
Gegensatzes beherrscht zu werden. In all seinen Inhalten scheint sie aufgezeigt
werden zu können. Wahrscheinlich nicht nur hier; wahrscheinlich liegt
sie allem Lebendigem, vielleicht dem Konkreten überhaupt zu Grunde.
Ich beschränke mich aber ausdrücklich auf den Bereich des Menschlichen,
auf das, was sich mir darbeitet, wenn ich auf mich selbst blicke.
Darin finden sich unzählige Vorgänge,
Tatbestände, Akte und [>29] Beziehungen, die gegensätzlich gebaut
sind. Die Wissenschaften vom Psychischen, die vom Gesellschaftlichen, vom
Sittlichen und andere bringen dafür stets neue Beweise. Wir stellen
nun die Frage: Lassen sich diese vielen gegensätzlich gestellten Erscheinungen
auf angebbare Grundformen der Gegensätzlichkeit überhaupt zurückführen?
Im Laufe langer Jahre haben sich mir aus Einzelbeobachtung
und Überlegung eine Anzahl letzter Gegensätze
ergeben. Ich glaube, daß sie die gesuchten sind. Viele Rückproben
aus verschiedenen Gebieten menschlicher Selbsterfahrung scheinen zu bestätigen,
daß es sich hier wirklich um die Grundgegensätze
des Menschlich-Lebendigen handelt. Diese Reihe von Gegensätzen
tritt sogar mit dem Anspruch auf, außer ihr gebe es keine derartigen
letzten
Gegensatzformen mehr. Vielmehr müssen diesem Anspruch
nach alle Gegensätze, die sich noch aufzeigen lassen, besondere sein,
und in jene, als den allgemeinen, aufgelöst werden können. Ob
es freilich gelungen sei, hier auch wirklich die letzten
Gegensatzformen zu erfassen, bleibt eine Frage. Immerhin
hat mir vielfache Beobachtung und Überlegung so zahlreiche Bestätigungen
gebracht, daß jener Anspruch nicht unberechtigt scheint.
Diese Gegensätze
nun bilden keinen losen Haufen, sondern bestimmte Ordnungen und Gruppen,
die ihrerseits zueinander in einem angebbaren Verhältnis stehen. So
daß es erlaubt ist, in einem noch näher zu bestimmenden Sinne
von einem System der Gegensätze
zu reden.
Darin unterscheide ich eine erste Gruppe, und nenne
sie die intraempirischen. Sie wirken
sich innerhalb des Bereiches des Menschlichen aus, soweit es erfahren wird,
oder erfahren werden kann. Dazu gehört das Körperliche wie das
Psychische, jenes äußerer, dieses innerer Wahrnehmung zugänglich.
Ich ]>30] ..."
- Wikipedia führt aus (Abruf 17.11.2018): "Guardini
(Dialogik) Romano Guardini hat in seiner Gegensatzlehre (1925) polare Gegensätze
grundsätzlich von Widersprüchen unterschieden und als sich ständig
neu konkretisierende, also lebendig-konkrete Spannungseinheit beschrieben,
ohne dass dabei die jeweiligen Pole zu existieren aufhören. Dies führt
zu einer dialogischen statt dialektischen Struktur der Gegensätze
im Sinne von Polarität."
Enantiologie (gr.) Gegenrede, Widerspruch.
Begriff Guardinis (1998), S. 163.
_
Wikipedia: "Guardini (Dialogik)
Romano Guardini hat in seiner Gegensatzlehre (1925) polare Gegensätze
grundsätzlich von Widersprüchen unterschieden und als sich ständig
neu konkretisierende, also lebendig-konkrete Spannungseinheit beschrieben,
ohne dass dabei die jeweiligen Pole zu existieren aufhören. Dies führt
zu einer dialogischen statt dialektischen Struktur der Gegensätze
im Sinne von Polarität."
Falscher Gebrauch von Gegensatz
Hegels Gegensaetze
Das Beispiel Raum von Hegel
überzeugt nun gar nicht. Die beste Abbildung, was wir unter Raum verstehen
ist sicher nicht "auseinandersein", was Hegel einfällt, sondern schlicht
und einfach Raum. Und das Gegenteil von Raum ist -Raum (Nicht-Raum).
Objektiv-Subjektiv
Objektiv und subjektiv sind keine Gegensaätze, sondern Unterschiede
und außerdem verschiedene Kategorien. Ausführliche Auseinandersetzung
unter Objektiv in Eislers Wörterbuch
der philosophischen Begriffe.
Objektiv in Klaus & Buhr 1969 Philosophisches Wörterbuch (marxistisch orientiert)
- "objektiv [lat] - unabhängig vom einzelnen Subjekt und
seinem Bewußtsein. Ggs: subjektiv. ..."
Kommentar: Ich sehe in dieser allgemeinen Behauptung zunächst nur einen Unterschied, keinen Gegensatz. Wieso zwischen objektiv und subjektiv ein Gegensatz bestehen soll, wird nicht erklärt und begründet. Ausführliche Analyse des falschen Gebrauchs zu Eisler.
Objektiv in Eislers Wörterbuch
der Philosophie
Quelle: Aus "objektiv" in Eislers Wörterbuch der philosophischen
Begriffe [Online]
"Der Gegensatz von objektiv-subjektiv
wird von den Stoikern durch kath' hypostasin - kat' epinoian ausgedrückt
(Sext. Empir. adv. Math. VII, 426)."
- Kommentar: Ich sehe in dieser allgemeinen Behauptung zunächst
nur einen Unterschied, keinen Gegensatz. Es wird auch gar nicht näher
begründet worin genau der Gegensatz und zwischen wem er bestehen soll.
Um da vernünftig weiter zu kommen, muss man von konkreten Beispielen
ausgehen. Nehmen wir an, es gehe bei objektiv-subjektiv um Urteile. Dann
wäre die erste Unterscheidung:
1. Urteil, z.B. Da steht ein Baum
Dieses Urteil kann richtig, falsch oder nicht entscheidbar sein.
1.1 Richtig
1.2 Falsch
1.3 Unklar, ob richtig oder faslsch, nicht entscheidbar
Es ist klar, dass zwischen 1.1 und 1.2 ein Gegensatz vorliegt, aber
nicht zwischen 1.1 und 1.3 oder zwischen 1.2 und 1.3. Ob ein Urteil zutrifft
hängt natürlich zunächst davon ab, was die Tatsache ist:
2. Tatsache, wobei hier offen bleibt, wie die Tatsache festgestellt
werden kann.
2.1 da steht ein Baum
2.2 da steht kein Baum
2.3 Es ist unklar, ob da ein Baum steht
Der Vergleich 2.1 mit 2.2 kann als Gegensatz bezeichnet werden. Aber
nicht die Vergleiche 2.1 mit 2.3 oder 2.2 mit 1.3.
3. Sodann könnte man fragen: wer urteilt, von wem stammt das Urteil?
Von einem erkennenden Subjekt, von mehreren, von vielen, von allen
oder gar von einem objektiv erkennenden System, wobei sich natürlich
die Frage stellt, was das sein soll, ein objektiv erkennendes System?
3.1 ein subjektiv erkennendes System (z.B. ein Mensch, der den Ort,
wo der Baum sein soll, betrachtet.)
3.2 Mehrere subjektiv erkennende Systeme (z.B. mehrere Menschen, die
den Ort, wo der Baum sein soll, betrachten.)
3.3 Viele subjektiv erkennende Systeme (z.B. viele Menschen, die den
Ort, wo der Baum sein soll, betrachten.)
3.4 Alle subjektiv erkennenden Systeme (z.B. alle Menschen, der den
Ort, wo der Baum sein soll, betrachten)
3.5 Ein objektiv erkennendes System, z.B. Meßgerät (etwa
ein Fotapparat der den Ort, wo der Baum sein soll, fotografiert)
Anmerkung: man beachte dass 3.5 (objektiv) nicht einfach eine Fortsetzung
der Folge 3.1-3.4 (subjektiv, gruppen-subjektiv, intersubjektiv) ist, sondern
eine andere Kategorie.
4. Objektiv
Objektiv kann sich auf die Tatsache, das Urteil, die Urteilsquelle
oder auf die Gültigkeit beziehen.
4.1 Objektiv hinsichtlich der Tatsache: Dass da ein Baum steht, ist
eine objektive Tatsache.
4.2 Objektiv hinsichtlich des Urteils: Das Urteil, dass da ein Baum
steht, ist objektiv
4.3 Objektiv hinsichtlich der Urteilsquelle: die Urteilsquelle viele
Menschen, ist objektiv
4.4 Objektiv hinsichtlich der Gültigkeit des Urteils: Das Urteil,
dass da ein Baum steht, ist objektiv richtig
5. Subjektiv
Das kann sich auf die Tatsache, das Urteil, die Urteilsquelle oder
auf die Gültigkeit beziehen.
5.1 Subjektiv hinsichtlich der Tatsache: Dass da ein Baum steht, ist
eine subjektive Tatsache.
5.2 Subjektiv hinsichtlich des Urteils: Das Urteil, dass da ein Baum
steht, ist subjektiv
5.3 Subjektiv hinsichtlich der Urteilsquelle: die Urteilsquelle viele
Menschen, ist (gruppen-) subjektiv
5.4 Subjektiv hinsichtlich der Gültigkeit des Urteils: Das Urteil,
dass da ein Baum steht, ist subjektiv richtig
Damit gibt es viele Möglichkeiten der Kombination, die jeweils eine eigene Untersuchung erfordern, wo und zwischen welchen Vergleichen eine Gegensatz oder einfach nur ein Unterschied besteht. Das eröffnet viele erkenntnistheoretisch interessante Fragestellungen.
Objektiv erkennendes System
Ein besonderes Problem ist die Kreation und Konstruktion "objektiv
erkennendes System". Eine erste Idee ist, dass ein objektiv erkennendes
System unabhängig von subjektiv erkennenden Systemen
sein sollte, womit sich als erstes die Frage stellt, was unter unabhängig
zu verstehen ist.
| Definition:
Eine Tatsache T2 heißt von einer Tatsache T1 unabhängig,
wenn eine Veränderung von T1 keine Veränderung von T2 bewirkt.
Voraussetzungen: Zwei Tatsachen, die voneinander unabhängig sein sollen, müssen erstens existieren und zweitens muss man sie feststellen können. Begriffsbasis: Tatsache, Veränderung, bewirken, existieren, feststellen. Aber: Man beachte auch, dass es auch Scheinveränderungen gibt wie bei den Storchennestern, Geburtenraten und ihren Scheinkorrelationen. |
Tatsache 2: Ein vom Menschen unabhängiges erkennendes System.
Tatsache 1: Das erkennende System der Menschen.
Kommt es zu Veränderungen bei Tatsache 2, wenn Tatsache 1 verändert
wird? Oder ausführlich:
Wird ein unabhängiges (objektives) erkennendes System verändert,
wenn sich das erkennende System der Menschen verändert?
Konkretes Beispiel: Tatsache 2: Fotoapparat. Tatsache 1: Mensch. Wenn
sich das erkennende System des Menschen verändert, ändert sich
dann auch das erkennende System Fotoapparat? Sicher nicht. Also ist das
erkennende System des Fotoapparates vom erkennenden System des Menschen
unabhängig. Aber liefert der Fotoapparat auch objektive Ergebnisse?
Sicher nicht, denn die Natur kennt keine Farben, nur unterschiedliche Wellenlängen,
die, wenn sie auf ein geeignetes erkennendes System treffen, ein Bild erzeugen,
das nur teilweise veridikal
ist.
"Allianz (franz. Alliance, spr. -...), Bündnis, völkerrechtlicher Vertrag, zwischen zwei oder mehreren Mächten zu einem bestimmten Zweck abgeschlossen. Im Gegensatz () zu einer organisierten und auf die Dauer berechneten Staatenverbindung, wie sie uns in einer Union oder Konföderation, im Staatenbund und im Bundesstaat entgegentritt, hat die Allianz einen vorübergehenden Charakter. Die verbündeten Mächte, welche zu gunsten des Bündnisses von ihrer politischen Selbständigkeit nichts aufgeben, werden Alliierte genannt."
Quelle: https://peter-hug.ch/01_0379?q=Gegensatz#I0376.
- Kommentar: Falsche Verwendung, hier wäre "Unterschied" treffender.
Quelle: https://peter-hug.ch/01_0664?q=Gegensatz#I0222
- Kommentar: Falsche Verwendung, hier wäre "Unterschied" treffender.
"Faulheit wird gerne als Gegensatz zur Arbeit angesehen"
Wissen57 (Abruf 18.11.18): https://www.wissen57.de/konrad-paul-liessmann_mut-zur-faulheit.html
- Kommentar: Falsche Verwendung auf der Kategorien- und der Bedeutungsebene.
Richtiger
Gebrauch von Gegensatz
Noch nicht ausgearbeitet.
Unklarer oder fraglicher Gebrauch von Gegensatz
Noch nicht ausgearbeitet.
Wissenschaftlicher Apparat
- Adorno, Theodor W. (1966) Negative Dialektik. Suhrkamp, Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Adorno, Theodor W. (1970) Gesammelte Schriften, Band 6: Negative Dialektik. Jargon der Eigentlichkeit. Suhrkamp. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Adorno, Theodor W. (2007) Vorlesung über Negative Dialektik. Fragmente zur Vorlesung 1965/66. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Albert, Hans (1987) Kritik der reinen Erkenntnislehre.Tübingen: Mohr.
- Angehrn, E.; Fink-Eitel, H.; Iber, Chr. & Lohmann, G. (1991, Hrsg.): Dialektischer Negativismus. M. Theunissen zum 60. Geburtstag. Frankfurt: Suhrkamp.
- Arruda, Ayda I. () On the Imaginary Logic of N. A. Vasil'év
- Barwinski, R.; Bering, R. & Eichenberg, Chr. (2010, Hrsg.): Dialektische Psychologie und die Zukunft der Psychotherapiewissenschaft (Festschrift für Gottfried Fischer). Kröning: Asanger.
- Bense, Max (1949/50) Theorie dialektischer Satzsysteme - Eine Untersuchung über die sogenannte dialektische Methode. In: Philosophische Studien, Bd. 1, 1949, S. 202 ff., Bd. 2, 1950, S. 153 ff.
- Bense, Max (1949) Moderne Dialektik - Neue Forschungen. In: Universitas, Stuttgart, Jg. 1, H. 4, April 1949, S. 493-495
- Blendinger, Heinrich (1947) Polarität als Weltgesetz. Stuttgart: Wunderlich.
- Bloch, Walter (1972) Polarität. Ihre Bedeutung Für Die Philosophie Der Modernen Physik, Biologie Und Psychologie.
- Bochenski, J.M. () Der sowjetrussische dialektische Materialismus (DIAMAT).
- Bochenski, J.M. (1973) Marxismus Leninismus. Wissenschaft oder Glaube. München; Bayerische Landeszentrale für Bildungsarbeit.
- Brieskorn E. (1974) Über die Dialektik in der Mathematik. In: Otte M. (1974, Hrsg.) Mathematiker über die Mathematik. Wissenschaft und Öffentlichkeit. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Cobben, Paul; Cruysberghs, Paul; Jonkers, Peter & De Vos, Lu (2006, Hrsg.) Hegel Lexikon. Darmstadt: WBG.
- Eisler, Rudolf (1904) Dialektik.
- Engels, Friedrich (1925) Dialektik der Natur. [Online] Zeno.org: Karl Marx, Friedrich Engels: Werke. Berlin 1962, Band 20, S. 307. Fragment. Entstanden 1873-1883, ergänzt 1885/86. Teildrucke: Der Abschnitt »Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen« erschien 1896 in der Zeitschrift »Die neue Zeit«, der Abschnitt »Die Naturforschung in der Geisterwelt« im »Illustrierten Neuen Welt-Kalender für das Jahr 1898«. Erstdruck des Manuskripts in: Marx-Engels-Archiv, Bd. 2, Moskau, Leningrad 1925.
- Erdei, Laszlo (1972) Gegensatz und Widerspruch in der Logik. Budapest: Akademiai Kiado.
- Esser, Helmut ; Klenovits, Klaus & Zehnpfennig, Helmut (1977) Wissenschaftstheorie 2 Funktionalanalyse und hermeneutisch-dialektische Ansätze. Stuttgart: Teubner.
- Flammer, August (2009). Entwicklung als dialektischer Prozess. In (127-243) Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung. Bern: Huber.
- Fogarasi, Bela (1953) Dialektische Logik. - mit einer Darstellung erkenntnistheoretischer Begriffe. Berlin: Aufbau. (auch Rotdruck 1971)
- Glasersfeld, Ernst von (1987) Wissen, Sprache und Wirklichkeit: Arbeiten zum radikalen Konstruktivismus. Braunschweig: Vieweg. [GB]
- Glockner, Hermann (1957, Hrsg.) Hegel-Lexikon. 2 Bde. A-Leibniz-Z. Bd. 23 und 24 der Jubiläumsausgabe. 2 verb.A. Stuttgart: Fromanns.
- Greiner. Josef (1986) Dialektik des Kraftbegfriffs. Wien: VWGÖ.
- Guardini, Romano (1998) Der Gegensatz. Versuch einer Philosophie des Lebendig-Konkreten. 1. A. 1925. Mainz/Paderborn: Grünewald/Schöningh.
- Günther, Gotthard (1962) Das metaphysische Problem einer Formalisierung der transzendental dialektischen Logik In: Heidelberger Hegeltage 1962, Hegel Studien Beiheft 1, p. 65-123. Auch published in vordenker.de: Oct 10, 2004 (PDF)
- Günther, Gotthard (1976) Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik. Erster Band: Metakritik der Logik - Nicht-aristotelische Logik - Reflexion - Stellenwerttheorie - Dialektik - Cybernetic Ontology - Morphogrammatik - Transklassische Maschinentheorie. Hamburg: Meiner.
- Hegselmann, Rainer (1965) Formale Dialektik. Ein Beitrag zu einer Theorie des rationalen Argumentierens. Hamburg: Meiner.
- Heise, Steffen () Analyse der Morphogrammatik von Gotthard Günther. Klagenfurter Beiträge zur Technikdiskussion Heft 50
- Höhl, Gudrun & Kessler, Herbert (1974, Hrsg.) Polarität als Weltgesetz und Lebensprinzip. Mannheim: Verlag der Humboldtgesellschaft.
- Hörz, H. (1968). Der dialektische Determinismus in Natur und Gesellschaft. Berlin: VEB Verl. D. Wissenschaften. [PDF im Internet]
- Hoffmann, Dieter (1990, Hrsg.) Robert Havemann, Dialektik ohne Dogma. Aufsätze, Dokumente und die vollständige Vorlesungsreihe zu naturwissenschaftlichen Aspekten philosophischer Probleme. Berlin: DVdWis.
- Holz, Hans Heinz (1997) Einheit und Widerspruch. Problemgeschichte der Dialektik in der Neuzeit. 3 Bde. Bd.3: Die Ausarbeitung der Dialektik. Stuttgart: Metzler.
- Holz, Hans Heinz & Losurdo, Domenico (1996, Hrsg.) Dialektik-Konzepte. Topos, Heft 7. Bonn. Pahl-Rugenstein Nachfolger.
- Hubig, Christoph (1978) Dialektik und Wissenschaftslogik: Eine sprachphilosophisch- handlungstheoretische Analyse. Berlin: de Gruyter.
- Jaeschke, Walter (2016) Hegel-Handbuch. Leben - Werk - Schule. 3.A. Stuttgart: Metzler.
- Jakowenko, Boris (1936) Zur Kritik der Logistik, der Dialektik un der Phänomenologie. Prag: , Internationale Bibliothek für Philosophie. Periodische Sammelschrift Bd. II, mNr. 3/4, März-April,
- Jooß, Christian (2017) Selbstorganisation der Materie: Dialektische Entwicklungstheorie von Mikro- und Makrokosmos. Neuer Weg.
- Kopnin, P. V. (russ. 1969, dt. 1970) Dialektik - Logik - Erkenntnistheorie. Lenins philosophisches Denken - Erbe und Aktualität. Berlin: Akademie-Verlag.
- Kesselring, Thomas (1981) Entwicklung und Widerspruch. Ein Vergleich zwischen Piagets genetischer Erkenntnistheorie und Hegels Dialektik. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Kesselring, Thomas (1984) Die Produktivität der Antinomie. Hegels Dialektik im Lichte der genetischen Erkenntnistheorie und der formalen Logik. Frankfurt aM: Suhrkamp.
- Kesselring, Thomas (2013) Formallogischer Widerspruch, dialektischer Widerspruch, Antinomie. Reflexionen über den Widerspruch. In (15-38) Müller, Stefan (2013, Hrsg.)
- Kesselring, Thomas (1991) Rationale Rekonstruktion von Dialektik im Sinne Hegels. In (273-303) Angehrn, E.; Fink-Eitel, H.; Iber, Chr. & Lohmann, G. (1991, Hrsg.): Dialektischer Negativismus. M. Theunissen zum 60. Geburtstag. Frankfurt: Suhrkamp.
- Kesselring, Thomas (2010) Paradoxien und Widersprüche – ihre Rolle in der Psychotherapie. In (9-33) Barwinski, R. et al. (2010, Hrsg.)
- Kesselring, Thomas (2010) Widerspruch und Antinomie. Zwei unterschiedliche logische Phänomene mit Bedeutung für die Psychotherapie. In: Psychotherapie Forum. Wien/New York: Springer, 2010, Heft 2, pp.108-115.
- Klaus, Georg (1966) Moderne Logik. Berlin: VEB Wiss.
- Klaus, Georg & Buhr, Manfred (1969, Hrsg.) Philosophisches Wörterbuch. 2 Bde. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.
- Kobusch, Theo (1987) Sein Und Sprache: Historische Grundlegung Einer Ontologie Der Sprache. Leiden: Brill. [GB]
- Köhne, Otto (1993) Die Urheber Der Abendländischen Polaritätslehre Lehren Und Bedeutung Für Die Gegenwart.
- Köhne, Otto (1981) Polarität. Einführung in die Polaritätstheorie. Mannheim: Sokrates.
- Kondakow, N. I. (dt. 1978 russ. 1975). Wörterbuch der Logik. Berlin: Das europäische Buch.
- Kopnin, P.V. (russ. 1969, dt. 1970) Dialektik - Logik - Erkenntnistheorie. Lenins philosophisches Denken - Erbe und Aktualität. Berlin: Akademie-Verlag.
- Leinfellner, Elisabeth & Leinfellner, Werner (1978) Ontologie Systemtheorie und Semantik. Berlin: Duncker & Humblot. [GB]
- Lorenzen, Paul (1962) Das Problem einer Formalisierung der Hegelschen Logik. Koreferat zu einem Vortrag von G. Günther, in: Hegel-Studien Beiheft 1.
- Lorenzen, Paul (1962) Szientismus versus Dialektik. In: Hermeneutik und Dialektik, H. G. Gadamer zum 70. Geburtstag, hrsg. v. R. Bubner u. a., Tübingen 1970, Bd. 1, S.57ff.
- Marcuse, Herbert (1989) Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit. Frankfurt aM: Suhrkamp. [wenig ergiebig zur Frage der Ontologie]
- Markin, Vladimir & Zaitsev, Dmitry (2017,ed.) The Logical Legacy of Nikolai Vasiliev and Modern Logic.
- Maximov, Dmitry (2017) N. A. Vasil’ev’s Logic and the Problem of Future Random Events. Axiomathes April 2018, Volume 28, Issue 2, pp 201–217
- Mikirtumov, Ivan B. () The laws of reason and logic in Nikolai Vasiliev’s system
- Mittelstraß, Jürgen (1980-1996, Hrsg.). Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. 4 Bde. Die ersten beiden Bände erschienen bei BI, Mannheim. Die letzten beiden Bände bei Metzler, Stuttgart. 2. Auflage 2005ff.
- Müller, Stefan (2011) Logik, Widerspruch und Vermittlung. Aspekte der Dialektik in den Sozialwissenschaften. Wiesbaden: Springer.
- Müller, Stefan (2013, Hrsg.) Jenseits der Dichotomie Elemente einer sozialwissenschaftlichen Theorie des Widerspruchs. Wiesbaden: Springer.
- Piaget, Jean (fr 1968, dt. 1973) Strukturalismus und Dialektik. In (103-109) Der Strukturalismus. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Piaget, Jean (fr 1970, dt. 1974) Genetische Erkenntnistheorie. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Popper, Karl (1970) Was ist Dialektik. In (261-290) Topitsch, Ernst (1970, Hrsh.) Logik der Sozialwissenschaften. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Puntel, Lorenz B. (1996) Läßt sich der Begriff der Dialektik klären? Journal for General Philosophy of Science – Zeitschrift fiir allgemeine Wissenschaftstheorie, Vol. 27, No.1, 131-165. [Online]
- Rauschenberger, Walther (1951) Das Weltgesetz der Polarität, Frankfurt aM: Selbstverlag.
- Ridder, Lothar (2002) Mereologie Ein Beitrag zur Ontologie und Erkenntnistheorie. Frankfurt aM: Klostermann.
- Reich, W. (1934). Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse. [PDF im Netz]
- Ritsert, Jürgen (2017) Summa Dialectica. Ein Lehrbuch zur Dialektik. Weinheim: Beltz.
- Schwemmer, Oswald (2005) Dialektik, In Mittelstraß (2005, Hrsg,).
- Seiffert, Helmut (1973) Einführung in die Wissenschaftstheorie Band 1 Sprachanalyse, Deduktion, Induktion in Natur- und Sozialwissenschaften. 6.A. München: Beck.
- Seiffert, Helmut (1983) Einführung in die Wissenschaftstheorie Band. 2 Geisteswissenschaftliche Methoden: Phänomenologie - Hermeneutik und historische Methode - Dialektik. 8.üeA. München: Beck.
- Simon-Schaefer, Roland (1973) Dialektik Kritik eines Wortgebrauchs. Stuttgart: Fromanns.
- Sinowjew, A.A. (dt. 1970, russ.1967). Komplexe Logik. Grundlagen einer logischen Theorie des Wissens. Berlin: VEB d.Wiss.
- Sinowjew, A.A. (dt. 1968, russ.1968). Über mehrwertige Logik. Ein Abriß. Braunschweig: Vieweg.
- Sinowjew, A. & Wessel, H. (1975). Logische Sprachregeln. München: Fink. [Biographie]
- Stöhr, Hans-Jürgern (1983) Dialektik und Physik 2. Philosophische Probleme in der physikalischen Forschung. Rostock: W.Pieck Universität.
- Stuckenschmidt, Heiner (2009) Ontologien: Konzepte, Technologien und Anwendungen. Heidelberg: Springer.[GB]
- Svilar, Maja & Zahler, Peter (1984. Hrsg.) Selbstorganisation der Materie? Bern: Lang.
- Topitsch, Ernst (1970, Hrsg.) Logik der Sozialwissenschaften. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Ulbricht, Heinz & Schmelzer, Jürn (1983. Hrsg.) Dialektik und Physik 1. Zur Dialektik der Entwicklung physikalischer Theorien. Rostock: W.Pieck Universität.
- Vasil'év, Nicolas A. (1993) Logic and metalogic Axiomathes December 1993, Volume 4, Issue 3, pp 329–351
- Wandschneider, Dieter (1995) Grundzüge einer Theorie der Dialektik. Stuttgart:
- Wandschneider, Dieter (1997): Zur Struktur dialektischer Begriffsentwicldung. In (114-169): Wandschneider, Dieter (1997, Hrsg.) Das Problem der Dialektik. Bonn: S.114-169
- Wetter, Gustav A. (1963) Dialektischer und historischer Materialismus. Frankfurt aM: Fischer.
- Winter, Reiner (o.J.) Was ist Dialektik? PDFOnline.
- Wundt, Max (1949) Hegels Logik und die moderne Physik. Köln: Weststeutscher Verlag.
Specht, Ernst Konrad (1967) Sprache und Sein: Untersuchungen zur sprachanalytischen Grundlegung der Ontologie, Berlin: De Gruyter. [GB]
Links (Auswahl: beachte)
- Nicht und nicht nicht. Sprachkritische und logische Studie zu Negation,Verneinung, doppelter Verneinung und zum Prinzip Tertium non datur.
- Negation - die Verneinung im Deutschen: https://www.lernort-mint.de/sprache/deutsch/negation_deutsch.html
- Gegenteile.net: http://gegenteile.net/
Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Coincidentia Oppositorum Aufhebung der irdischen Widersprüche im Unendlichen, im göttlichen All (bei Nikolaus von Kues und Giordano Bruno) [Quelle Duden]
__
dialektischer Materialismus nach Wirtschaftslexikon24 (Ausgabe 2018)
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/dialektischer-materialismus/dialektischer-materialismus.htm
"Lehre von den allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Gesellschaft und des Denkens auf der Basis des Primats des Seins (Materie) gegenüber dem Bewusstsein (Geist, Denken). Sie gilt zusammen mit dem historischen Materialismus als philosophische Grundlage des Marxismus-Leninismus. Ausgangspunkt war die von Karl Marx vollzogene Umkehrung der Hegelschen Dialektik: Nicht der Geist, sondern die Materie und die in ihr enthaltenen Widersprüche sind die treibende Kraft der Weltgeschichte. Die hiernach von Marx vor allem für den gesellschaftlichen Bereich aufgestellten dialektischen Entwicklungsgesetze übertrug Friedrich Engels auch auf den Bereich der Natur, die ebenfalls den Gesetzen der Dialektik unterliege. Als die drei grundlegenden Gesetze der materialistischen Dialektik entwickelte Engels (1) das "Gesetz des Umschlagens von der Quantität in die Qualität", nach dem die Entwicklung nicht nur auf quantitativen Veränderungen (Evolution), sondern zugleich auch auf qualitativen (Revolution) beruht; (2) das "Gesetz von der Durchdringung der Gegensätze", dem Wladimir I. Lenin eine zentrale Stelle einräumte, indem er die Fortbewegung zu Neuem und Höherem aus den inneren, dialektischen Widersprüchen der Erscheinungen (Einheit und "Kampf" der Gegensätze) erklärte; (3) das "Gesetz der Negation der Negation" (z.B. Gemeinbesitz als Negation des Privateigentums und dieses als Negation des Stammeseigentums), nach dem frühere Stadien nicht einfach überwunden werden, sondern ihre positiven Seiten erhalten bleiben und zu einer Höherentwicklung führen. Die berühmte Triade "These - Antithese - Synthese" ist nach Lenin eher ein Formalprinzip, das nicht das Wesen des dialektischen Materialismus ausmache. Er sah im dialektischen Materialismus nicht nur eine theoretische Begründung des Weltgeschehens, sondern (unter Berufung auf Engels) auch eine methodische "Anleitung zum Handeln" (Prinzip der Einheit von Theorie und Praxis), d.h. zur revolutionären Umgestaltung der (kapitalistischen) Produktionsverhältnisse im Interesse der Arbeiterklasse. Der Erkenntniswert dieser Entwicklungstheorie ist dadurch eingeschränkt, dass sich mit ihr jede nur denkbare Entwicklung nachträglich rechtfertigen lässt.
bildet zusammen mit dem historischen Materialismus nach verbreiteter
Auffassung die Philosophie des Marxismus-Leninismus. Unter Einschluss von
dessen ökonomischen und politischen Lehren und Auffassungen stellt
der dialektische Materialismus jene einheitliche Weltanschauung dar, die
beim Aufbau der sozialistischen und kommunistischen Gesellschaft ebenso
wie bei der Entwicklung der Wissenschaft Anwendung findet. Die Bezeichnung
»dialektischer Materialismus« stammt von dem russisischen Marxisten
Georgij Walentinowitsch PLECHANOW (1891). Dabei schreibt er das Verdienst,
nicht nur die Geschichte, sondern auch die Natur dialektisch-materialistisch
begriffen zu haben, fälschlich Karl MARX zu. Die Lehre von MARX enthält
dagegen alle Elemente einer Kritik zu den später unter dem Signum
»dialektischer Materialismus« hergestellten Philosophen, denn
einmal verwirft MARX sowohl den mechanischen Materialismus, dem es um »die
Materie« i.S. der zeitgenössischen Naturwissenschaft ging, zum
anderen zeigt er, dass es keine wesensmäßige Identität
von Natur und Geschichte und damit auch keine beide umgreifende Ontologie
geben kann. Vielmehr führt er die materielle Realität als immer
schon gesellschaftlich vermittelte Größe ein: Mensch (Geschichte,
Ökonomie und Gesellschaft), Denken und Natur bilden nur da eine dialektische
Einheit, wo die Arbeit von Menschen im Verein mit den Naturkräften
und den von Menschen erkannten Naturgesetzen Dinge und soziale Sachverhalte
produziert. Eine »Dialektik der Natur« war für MARX undenkbar,
fehlte hier doch die Grundvoraussetzung jeder Dialektik, die Subjekt-Objekt-Beziehung.
Ganz anders ist Friedrich ENGELS in die Entwicklungsgeschichte des dialektischen
Materialismus involviert. Er glaubte, »die ideologische Verkehrung«
in HEGELS Prinzip der Identität von Denken und Sein sei so zu beseitigen,
dass man die Begriffe »unseres Kopfes wieder materialistisch als
sich so in Stand gesetzt sieht, die Dialektik als Wissenschaft von den
allgemeinen Gesetzen der Bewegung sowohl der äußeren Welt wie
des menschlichen Denkens neu zu formulieren. Dann nämlich erhalte
man »zwei Reihen von Gesetzen, die der Sache nach identisch, dem
Ausdruck nach aber insofern verschieden sind, als der menschliche Kopf
sie mit Bewußtsein anwenden kann, während sie sich in der Natur
und bis jetzt auch großenteils in der Menschengeschichte in unbewußter
Weise, in Form der äußeren Notwendigkeit, inmitten einer endlosen
Reihe scheinbarer Zufälligkeiten durchsetzen«. Der Gegensatz
ist offensichtlich: MARX erfaßte Natur und Mensch als die durch Praxis,
durch Arbeit vermittelte dialektische Einheit; ENGELS will dagegen eine
dialektische Entwicklung der Natur auch unabhängig vom Menschen und
vom Denken ausmachen. In ENGELS/' Kampfschrift gegen Eugen DUHRINGs »Wirklichkeitsphilosophie«
finden sich die für den späteren STALINschen »Diamat«
maßgeblichen Grundsätze und Gesetze. Grundsätze: ·
Die Einheit der Welt besteht in ihrer stofflichen Materialität. ·
Die Grundformen allen Seins sind Raum und Zeit. · Die Bewegung ist
die Daseinsweise der Materie (die mechanische, die chemische und psychische
Materie sind jeweils höhere Bewegungsformen). Gesetze: · Gesetz
des Umschlagens von Quantität in Qualität; · Gesetz
der Durchdringung der Gegensätze; · Gesetz der
Negation der Negation. Während MARX\' Naturbegriff durchaus geeignet
ist, die hemmungslose Ausbeutung der Natur durch die Menschen kritisch
zu fassen und damit zur wirklichkeitsimmanenten Kritik seiner Warenanalyse
hinführt, reformuliert ENGELS in seiner Naturdialektik das abgehobene
traditionelle Programm einer Philosophie der Natur. Wladimir Iljitsch LENINS
Beitrag zum wesentlichen darin, den philosophischen Materie-Begriff so
allgemein zu formulieren, dass ihm die Ergebnisse der neueren physikalischen
Forschung nichts anhaben konnten. Nicht die Zusammensetzung der Materie
aus Molekülen, Atomen, Elektronen usw. sei entscheidend, sondern ihre
Eigenschaft, objektive Realität zu sein und außerhalb des Bewußtseins
zu existieren. Es blieb Josef STALIN (1938) vorbehalten, ENGELS und LENIN
zu vulgarisieren und den dialektischen Materialismus als »Verallgemeinerung
all dessen« auszugeben, »was die Wissenschaft an Wichtigem
und Wesentlichem errungen hat«. Alle Erscheinungen seien materiell;
ihr Zusammenhang bilde die eine und mannigfaltige Welt; alle Erscheinungen
unterlägen dem Gesetz der Veränderung (die ein Kampf der Gegensätze
sei). Es handelt sich um eine Sammlung von Gemeinplätzen ohne jede
operative Bedeutung, die aber vermöge ihrer politischen Verwertung
im Herrschaftsbereich des Sowjetmarxismus als normative Instanz dortiger
Wissenschaft und als »eine politische Polizei in Wahrheitsfragen«
fungierten. Wie das Zerfallsprodukt des dialektischen Materialismus, die
Rechtfertigungsphilosophie der Staatspartei, dazu benutzt wurde, alle Wendungen
der politischen Linie als Anwendung der dialektischen Gesetze zu verbrämen,
ist noch weitgehend unthematisiert. Die von kritischen Marxisten vor knapp
einem Jahrzehnt gestellte Frage, was wohl von diesem pervertierten Marxismus
in zukünftigen theoretischen Debatten übrigbleibe, ist bereits
heute zu beantworten: Nichts. Literatur: Havemann, R. (1990). Schmidt,
A. (1971a). Marcuse, H. (1964)"
__
Elenktik Kunst des Beweisens, Widerlegens,
Überführens. Methodol von Sokrates, wie Metzelers Lexikon der
Philosophie darlegt. https://www.spektrum.de/lexikon/philosophie/elenktik/537
__
Engels' Hegel-Kritik
"Es ist also die Geschichte der Natur wie der menschlichen Gesellschaft,
aus der die Gesetze der Dialektik abstrahiert werden. Sie sind eben nichts
andres als die allgemeinsten Gesetze dieser beiden Phasen der geschichtlichen
Entwicklung sowie des Denkens selbst. Und zwar reduzieren sie sich der
Hauptsache nach auf drei:
- das Gesetz des Umschlagens von Quantität in Qualität und umgekehrt;
- das Gesetz von der Durchdringung der Gegensätze;
- das Gesetz von der Negation der Negation.
__
Flammer unterscheidet 7 Faktoren
Flammer, August (2009). Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung. 4. A. Bern: Huber, S. 18:
- "1.2 Entwicklung 18
1.2.1 Entwicklung = Abfolge alterstypischer Zustandsbilder? 18
1.2.2 Entwicklung = Veränderung? 18
1.2.3 Entwicklung = reifungsbedingte Veränderungen? 19
1.2.4 Entwicklung = Veränderungen zum Besseren oder Höheren? 19
1.2.5 Entwicklung = qualitative resp. strukturelle Veränderungen? 20
1.2.6 Entwicklung = universelle Veränderungen? 21
1.2.7 Entwicklung = Sozialisation? 22"
Fogarasi "INHALT
- Vorwort zur deutschen Ausgabe 5
Erstes Kapitel. Gegenstand und Methode der Logik 11
§ 1. Der Gegenstand der Logik 11
§ 2. Die Methode der Logik 15
§ 3. Dialektik, dialektische Logik, Erkenntnistheorie 22
§ 4. Einteilung der Logik 28
Zweites Kapitel. Die Grundgesetze des Denkens. Logische Grundsätze
33
§ 1. Das Gesetz der Identität 34
§ 2. Das Prinzip des Nicht-Widerspruchs 52
§ 3. Das Prinzip des ausgeschlossenen Dritten 75
§ 4. Das Prinzip (Gesetz) des zureichenden Grundes 84
Drittes Kapitel. Arbeit, Sprache und Denken 88
§ 1. Sprache und Denken 88
§ 2. Kritisches über Logistik 98
§ 3. Arbeit und Denken 107
Viertes Kapitel. Der Begriff 112
§ 1. Der Begriff des Begriffs 113
§ 2. Empfindung, Vorstellung, Begriff 117
§ 3. Die Merkmale der Gegenstände und die Kennzeichen des
Begriffs 122
§ 4. Inhalt und Umfang des Begriffs 126
§ 5. Verhältnis von Inhalt und Umfang des Begriffs 129
§ 6. Die Klassifizierung der Begriffe 131
§ 7. Die Verhältnisse der Begriffe 142
§ 8. Begriff und Wirklichkeit 150
§ 9. Das geschichtliche Moment in der Dialektik der Begriffe
157
§10. Die Kategorien 160
§ 11. Die Definition 165
§ 12. Die Regeln der Definition 169
§ 13. Die verschiedenen Arten der Definition 171
§ 14. Die Bedeutung der Definition 172
§ 15. Die fehlerhafte Definition 175
§ 16. Der veränderliche, historische Charakter der Definition
178
Fünftes Kapitel. Das Urteil 181
§ 1. Vom Urteil im Allgemeinen 181
§ 2. Begriff und Urteil. Wort und Satz 184
§ 3. Wahres und falsches Urteil 188
§ 4. Die Einteilung der Urteile 190
§ 5. Die Urteile ihrem Umfange nach 190
§ 6, Die Urteile ihrer Qualität nach 195
§ 7. Die Urteile ihrer Relation nach 204
§ 8. Die Modalität des Urteils 207
§ 9. Die Verhältnisse zwischen den Urteilen 208
§ 10. Engels über die Lehre vom Urteil 209
Sechstes Kapitel. Der Schluß 212
§ 1. Übergang vom Urteil zum Schluß. Vom Schluß
im Allgemeinen 212
§ 2. Der Begriff des Syllogismus 217
§ 3. Die Struktur des Syllogismus 220
§ 4. Das Axiom des Syllogismus 223
§ 5. Die Regeln des Syllogismus 224
§ 6. Die Figuren des Syllogismus 228
§ 7. Die Modi des Syllogismus 231
§ 8. Die wissenschaftliche Bedeutung der Figuren und Modi des
Syllogismus 233
§ 9. Der hypothetische Syllogismus 236
§ 10. Der disjunktive Syllogismus 240
§ 11. Der verkürzte Syllogismus („Enthymem“ und „Epicherem“)
244
§ 12. Der zusammengesetzte Syllogismus (Polysyllogismus) 246
§ 13. Der Marxismus-Leninismus über den Schluß 250
§ 14. Von” den Induktionsschlüssen im Allgemeinen 258
§ 15. Die sogenannte vollständige Induktion 261
§ 16. Die unvollständige Induktion 263
§ 17. Der Induktionsschluß durch einfache Aufzählung
265
§ 18. Die wissenschaftliche Anwendung der Induktion 267
§ 19. Induktion und Kausalität 268
§ 20. Fehlerhafte Induktionsschlüsse 272
§ 21. Die Verknüpfung der Deduktion und der Induktion 275
Siebentes Kapitel. Der Analogieschluß 288
§ 1. Vom Analogieschluß im Allgemeinen 288
§ 2. Die Rolle des Analogieschlusses in der Wissenschaft 291
§ 3. Die falsche Analogie 301
Achtes Kapitel. Die Hypothese 305
§ 1. Der'Begriff der Hypothese 305
§ 2. Die Hypothese in der Geschichte der Wissenschaft und die
Logik der Hypothese 307
§ 3. Hypothese und Wahrheit in der Naturwissenschaft 311
§ 4. Hypothese und Gesellschaftswissenschaft 316
§ 5. Die Regeln der Hypothese 319
Neuntes Kapitel. Der Beweis 322
§ 1. Der Begriff des Beweises 322
§ 2. Zur Geschichte der Theorie des Beweises 324
§ 3. Die Struktur des Beweises 326
§ 4. Deduktions- und Induktionsbeweis 328
§ 5. Der direkte und der indirekte Beweis 332
§ 6. Beweis und Axiome 334
§ 7. Die Rolle des Beweises in den verschiedenen Wissenschaften
338
§ 8. Der Beweis und die Praxis 340
§ 9. Die Regeln des Beweises — Der falsche Beweis 342
§ 10. Die Widerlegung 352
§ 11. Zusammenfassung 356
Zehntes Kapitel. Erkenntnistheoretische Grundbegriffe 360
§ 1. Was ist Erkenntnistheorie? 360
§ 2. Kurze Geschichte der materialistischen Erkenntnistheorie
366
§ 3. Der erkenntnistheoretische Grundsatz des Materialismus 369
§ 4. Weiterentwicklung der materialistischen Erkenntnistheorie
durch den dialektischen Materialismus 373
§ 5. Lenin über die Praxis 379
§ 6. Widerspiegelungstheorie und Dialektik 380
§ 7. Die Widerspiegelung in der gesellschaftlichen Erkenntnis
381
§ 8. Der philosophische Begriff der Materie 384
§ 9. Ursache und Wirkung 387
§ 10. Der Marxismus-Leninismus über die Gesetze der Wissenschaft
389
Elftes Kapitel. Fragen der Methode 398
§ 1. Methode und Theorie 398
§ 2. Kritik des methodologischen Dualismus 404
§ 3. Schlußfolgerungen 408
Literaturverzeichnis 411
Namenregister 415
Internetseite
Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren, geben wir nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia, DER SPIEGEL)
__
stipulieren
Ausdruck bei Gotthard Günther. Duden: "1. vertraglich vereinbaren, übereinkommen 2.festlegen, festsetzen
Synonyme zu stipulieren abmachen, abschließen, aushandeln, ausmachen, sich einigen, festmachen, schließen, übereinkommen, vereinbaren, sich verständigen"
__
Zellsterben
- "Wie viele Zellen sterben jeden Tag in deinem Körper? Weit mehr als wir Haare auf dem Kopf haben! Und mit Sicherheit mehr als es Autos auf unseren Straßen gibt! Täglich sterben nämlich zwischen 50.000.000.000 und 70.000.000.000 Zellen in unserem Körper..." [science.lu 21.11.2013, Abruf 29.10.19]
- "Bei einem erwachsenen Menschen sterben in jeder Sekunde rund 50 Millionen Zellen ab – das hört sich viel an, entspricht aber aneinandergelegt allenfalls einer ein Kilometer langen Zellenkette. Zudem werden in jeder Sekunde auch beinahe genauso viele Zellen neu gebildet, so dass die Bilanz unterm Strich fast ausgeglichen ist. Aber eben nur fast, denn der erwachsene Mensch baut nach und nach ab." [Spektrum.de 27.07.2003 Abruf 29.10.19]. Das ergibt auf einen Tag hochgerechnet: 4.32*10^12, also rund 4 Billionen.
- RP online (ohne Datum; Abruf 29.10.19): "
- Augenzellen Diese Zellen halten ein Leben lang. Dies ist jedoch problematisch: Durch die Abnutzung der äußeren Netzhaut-Zellen kommt es im Alter zu Sehmängeln.
- Blutzellen Blutzellen legen eine Strecke von 1600 Kilometern zurück, bevor sie nach ungefähr 120 Tagen sterben. Ihr "Friedhof" befindet sich in der Milz.
- Darmzellen 1,4 Tage lang ist das Leben von Dünndarmzellen im Schnitt, im Dickdarm ist ihre Lebenserwartung etwas höher: zehn Tage.
- Schweißdrüsenzellen Diese halten ein Leben lang, werden also auch nicht erneuert.
- Nervenzellen Auch die Nervenzellen erneuern sich zeitlebens nicht.
- Hautepidermis Die Zellen der Oberhaut haben sich nach durchschnittlich 19,2 Tagen neu gebildet.
- Knochenzellen Sie haben eine "Haltbarkeitsdauer" von ca. 25-30 Jahren.
- Hirnzellen Die weitverbreitete Ansicht, dass sich Hirnzellen nicht mehr regenerieren würden, ist falsch. Auch wenn für 100 abgestorbene Zellen nur ein bis zwei Stück "nachwachsen".
- Lymphozyten (Zellen des Immunsystems) Die Lebenserwartung dieser Zellen ist unterschiedlich. So können sie 5 Tage oder sogar Jahre alt werden.
- Magenzellen Sie leben nicht lange. Nach 1,8 Tagen werden sie von Nachfolgezellen ersetzt.
- Zellen der Harnblase Sie existieren durchschnittlich 66 Tage.
Standort: Begriffsanalyse Gegensatz.
*
Zur Einführungs, Haupt- und Verteilerseite Dialektik.
Information zu den Signierungen.
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen.
Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Wissenschaft site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, R. (DAS). Begriffsanalyse Gegensatz. Hilfsseite zu den Untersuchungen zur Dialektik. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Dialektik/BA_Gegensatz.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_ Begriffsanalyse Gegensatz__Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_
korrigiert: irs 18.11.2018
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
18.09.22 Layout, Inhaltsverzeichnis, Organisation.
00.00.19 Grundversion erstmals ins Netz gestellt.
22-23.10 Weitere Differenzierungen und Präzisierungen der Referenzwelten.
21.10.19 Stand vergegenwärtigt.
02.-10.19 Bis 21. Oktober unterbrochen für die Auswertung der ersten 10 rechtswissenschaftlichen Werke.
00.02.19 Analysen und Ausarbeitungen bis 21.2.2019 fortgesetzt.
03.12.18 Unterbrochen bis 5.1.19
10.11.18 Weil zu groß geworden, zerlegt und einige Bereiche ausgelagert.
07.11.18 Vorläufiger organisatorischer Abschluss
01.11.18 angelegt
Interne Notizen
« » » «
Südpol-
Imaginary (non-aristotelian) logic
NA Vasil'ev, R Vergauwen, EA Zaytsev - Logique et Analyse, 2003 - JSTOR
[53] The aim of this paper** is to show the possibility of a logic
and of logical operations
different from those we use and to show how our Aristotelian [54] logic
is only one of the
many possible logical systems. This new logic will not be a novel account
of the old one. It
differs from it not as an account, but in the very train of its logical
operations; this is a" new
logic" and not a new treatise on logic. Different treatises on logic
differ in their contents, but
all have the same subject matter: our logical world, our logical operations.
Imaginary (non …
Aus meiner Sicht auch für Dialektik noch wichtige Grundbegriffe
Ähnlichkleit Sachverhalte können sich mehr oder mindern ähneln,
in letzter Instanz darin, dass sie Sachverhalte sind.
Anders Vielfach sind Sachverhalte nur anders, sie unterscheiden sich,
bilden aber keinen Gegensatz oder bedeuten einen Widerspruch)
Identität Ob es Identität streng betrachtet im Realen gibt,
ist fraglich, da sich alles fortwährend ändert. Ideale Gegenstände
hingegen können als echt identisch angesehen werden 1 = 1, Dreieck
= Dreieck. Alles Identische ist gleich und ähnlich.
Gleichheit In Bezug auf die und die Merkmale. Alles Gleiche ist auch
ähnlich.
Sachverhalt
Unterschied
Welten.
Grundfragen an Nutzer Dialektischer Konzepte
Wird der ontologische Bereich, in dem Dialektik genutzt wird, genau
angegeben?
Werden die dialektische Begriffe (> Vokabular der Dialektik), die benutzt
werden, genau erklärt und referenziert?
Werden die dialektischen Momente (> Vokabular der Dialektik) des betrachteten
dialektischen Sachverhalts genau erklärt und referenziert?
Das Vokabular der Dialektik (DialonS)
- einige wichtige dialektische Kategorien
Je nach theoretischem Bezugssystem DBS. Die Auffassung des dialektischen
Materialismus finden Sie hier.
- Antithese
- Bewegung
- Einheit und Kampf der Gegensätze
- Entwicklung
- Gegensatz
- Identität
- Komplementarität
- Materie
- Mat.Einh.d.Welt
- Negation, dialektische
- Negation der Negation
- Polarität
- Qualität
- Qualität und Quantität
- Raum und Zeit
- Ruhe
- Sachverhalt
- Sprung, dialektischer
- Synthese
- These
- Umschlagen
- Unterschied
- Veränderung
- Wesen
- Widerspiegelung
- Widerspruch
Verkehrsunfallrekonstruktion: [GB]