(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=10.10.2018 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 03.10.24
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org__ Zitierung & Copyright
Anfang Buch-Vorstellungen 03 Datenschutz_Überblick _Rel. Aktuelles _Rel. Beständiges _Titelblatt _Konzept _Archiv _Region _Service-iec-verlag _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Bücher, Literatur und Links zu den verschiedensten Themen, hier:
Buch-Vorstellungen 03
präsentiert von Rudolf Sponsel, Erlangen
Organisations-, Übersichts- und Verteilerseite.
* Buch-Vorstellungen 01 *
Zum Partnerprogramm zeitkritische Bücher.
Angeboten, eingegangen und teilweise noch zu präsentieren:
- Gordeeva. Katerina (2024) Nimm meinen Schmerz GESCHICHTEN AUS DEM KRIEG. München: Knaur. [In die Datenbank Erleben aufgenommen]
- Müller, Viktoria (2024) Be a Rebel. Mut zum Ungehorsam. München: Knaur.
- Maurer, Matthias & Knonrad, Sarah (2023) Cosmic Kiss. Sechs Monate auf der ISS. Eine Liebeser klärung an den Weltraum. München: Droemer.
- Theiss, Anna (2023) die abwertung der mütter. wie überholtedamilienpolitik uns den wohlstand kostet. München: Droemer.
- Abbou, Kenza Ait Si (2023) Menschen verstehen. Wie emotionale künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert. München: Droemer.
- Petterson, Maria (2023) ANFÜHRERINNEN, AGENTINNEN, AKTIVISTINNEN Außergewöhnliche Frauen, die Regeln brachen. München: Droemer-Knaur.
- Marche, Stephen (2022) Aufstand in Amerika. Der nächste Bürgerkrieg - ein Szenario. München: Droemer.
- Möhn, Ulia; Harms, Wiebke & Jaax, Liske (2021) Team F. Feminismus einfach leben. 12 Impulse für den Alltag. München: Knaur.
- Leberecht, Tim (2020) Gegen die Dikatur der Gewinner. Wie wir verlieren können, ohne Verlierer zu sein. München: Droemer.
- Jürgens, Sabine (2020) Haben wir noch alle Tassen im Schrank? Was wir über die Psyche zu wissen glauben und was wirklich stimmt. München: mvg.
- Theiss, Anne (2023) Die Abwertung der Mütter. Wie überholte Familienpolitik uns den Wohlstand kostet. München: Droemer.
- Dingmann, Marc (2020) Das Gehirn. Neueste Erkenntnisse der Neurowissenschaften über unser wichtigstes Organ und seine Macken. München: riva.
- Rothe, Wolfgang (2021) Missbrauchte Kirche. Eine Abrechnung mit der katholischen Sexualmoral und ihren Verfechtern. München: Droemer.
- Lewis, Herbert Clyde (engl. 1937; dt. 2023) Gentleman über Bord. Roman OT: Gentleman Overboard. Aus dem Amerikanischen von Klaus Bonn. Mit einem Nachwort von Jochen Schimmang. Leineneinband im Schuber, fadengeheftet und mit Lesebändchen. 176 Seiten. ISBN: 978-3-86648-696-6. Erscheinungsdatum: 14.03.23. Erlebnispsychologische Analyse hier.
- Precht, David & Welzer, Harald (2022) Die vierte Gewalt – Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Frankfurt: Fischer.
- Slomka, Marietta (2022) Nachts im Kanzleramt. München: Droemer.
- YouTube: Der Aufstieg der Video-Plattform zur globalen Supermacht. Ein brisanter Investigativ-Bericht
- Putinland: Leonid Wolkow, der Nawalny-Vertraute, über Russlands Weg zur Diktatur und über eine Zukunft ohne Putin
- KLAUS SCHERER KUGEL INS HIRN Lügen, Hass und Hetze im Netz bedrohen die Gesellschaft
- Pretis, Manfred (2022, Hrsg.) ICF-basierte Gutachten erstellen. Entwicklung im interdisziplinären Team. München: Reinhardt.
- Nehring, Christopher (2022) Geheimdienst Morde. Wenn Staaten töten - Hintergründe, Motive, Methoden. München: Heyne.
- Shum, Desmond (2022) Chinesisches Roulette. Ein Exmitglied der roten Milliardärskaste packt aus. München: Droemer.
- Wildt, Bert te & Schiele, Timo (2021) Burn on. Immer kurz vorm burn out. Das unbekannte Leiden und was dagegen hilft. München: Droemer.
- Günther, Mari; Teren, Kirsten; Wolf, Gisela (2021) Psychotherapeutische Arbeit mit trans*Personen. Handbuch für die Gesundheitsversorgung. München: Reinhardt.
- Ebert, Theodor (2021) Widerworte. Zwischenrufe zu Politik und Religionskritik. Aschaffenburg: Alibri.
- Urner, Maren (2021) Raus aus der ewigen Dauerkrise Mit dem Denken von morgen die Probleme von heute lösen. München: Droemer.
- Nguyen-Kim, Mai Thi (2021) Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Wahr, falsch, plausibel. Die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. München: Droemer.
- Möhn, Julia; Harms, Wiebke & Liske Jaax (2021) Team F. Feminismus einfach leben. 12 Impulse für den Alltag (Einfache Schritte für mehr female empowerment im Alltag). München: Knaur.
- Manuellsen & Damsch, Nina (2021) König im Schatten. München: Droemer.
- Comey, James (2021) Nichts als die Wahrheit. Der Ex-FBI-Direktor über die Unterwanderung des amerikanischen Justizsystem. München: Droemer.
- Sellin, Fred (2020) Nur Heringe haben eine Seele. Geständnis eines Serienmörders. Der Fall Pleil. München: Droemer.
- Kleiner, Marcus S. (2020) Wie Netflix, Amazon Prime, Disney & Co unsere Gesellschaft verändern. München: Droemer Knaur
- Giesa, Christoph (2020) Echte Helden Falsche Helden. Was Demokraten gegen Populisten stark macht. München: Droemer.
- Mahmoud Al-Zein (2020) Der Pate von Berlin. Mein Weg, meine Familie, meine Regeln. München: Droemer.
- Wiener, Anna (2020) Macht und Dekadenz im Silicon Valley. München: Droemer Knaur. Erscheinungstermin: 20.08.2020.
- Bischof, Norbert (2020) Moral. Ihre Natur, ihre Dynamik und ihr Schatten. Buchreihe: Forum Psychosozial Verlag: Psychosozial-Verlag. 724 Seiten, Broschur, 148 x 210 mm. Erschienen im Juni 2020. ISBN-13: 978-3-8379-2957-7.
- Dingmann, Marc (2020) Das Gehirn. Neueste Erkenntnisse der Neurowissenschaften über unser wichtigstes Organ und seine Macken. München: riva.
- Jürgens, Sabine (2020) Haben wir noch alle Tassen im Schrank? Was wir über die Psyche zu wissen glauben und was wirklich stimmt. München: mvg.
- Schlaffer, Philip (2020) Hass, Macht, Gewalt. Ein Ex-Nazi und Rotlicht Rocker packt aus. München: Droemer.
- Steffens, Jan (2020) Intersubjektivität, soziale Exklusion und das Problem der Grenze. Reihe Dialektik der Be-Hinderung. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Unterwegs mit Strafverfolgern.
Geisler, Wolff (2017) Morde alle Jubeljahre. Urheber und Methoden von Massenmorden. Köln: Wolff Geisler.
Gordeeva, Katerina (2024) Nimm meinen Schmerz GESCHICHTEN AUS DEM KRIEG. München: Knaur. [In die Datenbank Erleben aufgenommen]
Verlags-Info: "Katerina Gordeeva erhält in diesem
Jahr den Geschwister-Scholl-Preis des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels – Landesverband Bayern e. V. und der Landeshauptstadt
München. »In ihrem auch literarisch sehr beeindruckenden Buch
Nimm meinen Schmerz stehen die Stimmen dieser Frauen und einiger Männer
im Vordergrund.« Nimm meinen Schmerz: 24 erschütternde Berichte
aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine – erstmals in Buchform
festgehalten von der preisgekrönten russischen Journalistin Katerina
Gordeeva. "
Inhaltsverzeichnis: gibt es nicht.
Leseproben:
- S.17: "Tanja umarmt mich und sagt ganz leise, als würden Blätter
rascheln: »Ich weiß nicht, warum ich lebe, wozu ich überlebt
habe und wie ich weiterleben soll. Wenn Sie wollen, können Sie meine
Geschichte für Ihr Buch nehmen.«"
S.42: "Ich frage: »Yulia, hast du gar keine Angst vor denen?« Sie zuckt mit den Achseln: »Ich habe keine mehr übrig. Ich kann mich nicht mehr fürchten. Als hätte ich dieses Gefühl aufgebraucht. Ich weiß nicht, was passieren müsste, damit es mir noch schlechter geht als jetzt, verstehst du? Nein, tust du nicht. Und das ist auch gut so. Das heißt, du hast das nicht erlebt.«"
S.46: "Sie spricht weiter, während sie an mir vorbeischaut, aus dem Fenster.
Ist Ihnen klar, dass meine zweite Tochter überlebt hat, weil sie in meinem Bauch war? Und meine erste Tochter gestorben ist,
weil ich sie wegen diesem Bauch, in dem ihre Schwester war, nicht beschützen konnte? Ich weiß nicht, wie wir mit der Erin-
nerung an das, was geschehen ist, weiterleben werden. Wozu wir leben werden. Ich weiß nicht einmal, warum ich Ihnen das [>47]
alles erzähle. Ehrlich gesagt hatte ich bloß nicht die Kraft, nein zu sagen.«"
S.71: "»Ich schätze, das, was wir erlebt haben, ist etwas, das alle erleben, die aus dem Fleischwolf des Kriegs in die Falle des Hasses
geraten, der durch diesen Krieg entfesselt wurde. Meine Geschichte ist in ihren Einzelheiten besonders. Aber eigentlich handelt sie nicht von mir. Sie handelt von den Menschen. Manche verwandelt der Krieg schnell zu Bestien. Ich habe solche gesehen: Man gibt ihnen eine Waffe, und sie verlieren sofort alles Menschliche. Verlieren ihr Gewissen und Mitgefühl. Ich habe gesehen, wie schnell das geht."
Bewertung: Ein wichtiges Buch besonderes weil die es Betroffenen selbst zu Wort kommen lässt.
Anmerkung: Das Buch ist unsere Datenbank Erleben eingetragen und wird im Erlebnisregister unter Kriegserlebnisse vermerkt..
Müller, Viktoria (2024) Be a Rebel. Mut zum Ungehorsam. München: Knaur.
Verlagsinfo: Über das Buch:
Kriege. Erderwärmung. Industrielle Tierausbeutung. Aufstieg der
Rechten. Es ist höchste Zeit, aktiv zu werden und Widerstand zu
leisten! Doch angesichts ungezählter Krisen ist das eine echte
He
rausforderung – denn wo soll man anfangen?
Victoria Müller ermutigt dazu, den Kampf für eine bessere
Zukunft
aufzunehmen. Sie selbst wehrte sich schon als Teenagerin gegen die
Nazis in ihrer Stadt und ist seitdem politisch aktiv, manchmal bis
an
die Grenze des Erlaubten. In ihrem Buch belegt sie am Beispiel er-
folgreicher Revolten die Wirkmacht von Protest. Und sie zeigt, dass
Wandel oft im Kleinen beginnt und wir alle etwas bewegen können.
Über die Autorin:
Victoria Müller, 1988 in Ostdeutschland geboren, studierte Germa-
nistik, Anglistik und Geschichte. Sie arbeitet als Moderatorin, freie
Autorin und haltungsstarke ContentCreatorin. In ihrer Kolumne
»Retrospektiv« im VETO Magazin behandelt sie soziale Bewegun-
gen. Zusätzlich engagiert sie sich aktiv im Tierschutz und hat
mit
anderen den Verein ddao Tierschutz e. V. gegründet, der vor allem
in der Ukraine und anderen Krisen und Kriegsgebieten tätig ist.
Für ihre Tierschutzarbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Sie
er
klärt in ihrem InstagramFormat »Das kritische Wörterbuch«
kom-
plexe politische Begriffe verständlich, um mehr Menschen in gesell-
schaftliche Diskussionen einzubeziehen. Victoria lebt in Berlin und
arbeitet an ihrem Traumprojekt, dem Aufbau eines Lebenshofs in
Brandenburg.
Bibliographie: Maurer, Matthias & Knonrad, Sarah (2023) Cosmic Kiss. Sechs Monate auf der ISS. Eine Liebeser klärung an den Weltraum. München: Droemer.
Verlags-Info: " Sechs Monate auf der ISS – Eine Liebeserklärung an den Weltraum | Den Sternen so nah: Die Autobiografie des deutschen Astronauten
Die Faszination unendlicher Weiten: Astronaut Matthias Maurer hat sie erlebt. In seiner Autobiografie erzählt er von seiner spektakulären Mission zur ISS, seiner Forschung, und was er im Weltall, über die Erde und die Menschheit gelernt hat.
Nur zwölf Deutsche haben unseren Planeten je verlassen. Und Matthias Maurer ist einer von ihnen. Doch für den Wissenschaftler ist der Weg in den Weltraum lang und steinig. 2009 besteht er das harte Auswahl-Verfahren der europäischen Weltraum-Behörde ESA und beginnt 2015 mit dem Astronauten-Training. Dabei reist er quer durch Europa, trainiert in China, Japan, Russland, Kanada und in den USA, um sich auf alles vorzubereiten, was im All passieren kann.
Im Herbst 2021 startet er schließlich mit der Mission »Cosmic Kiss« zur Internationalen Raumstation. Fast sechs Monate lang lebt und arbeitet er an Bord der Raumstation ISS. Dabei erlebt er nicht nur einen Satellitenabschuss durch Russland, sondern auch den Kriegsausbruch in der Ukraine aus dem All. 400 Kilometer über seiner Heimat schwebend, erkennt er, wie verletzlich die Erde ist. Lediglich durch eine dünne Hülle vom lebensfeindlichen Vakuum getrennt, erfährt er was Zusammenhalt und Teamwork bedeuten.
»Und da ist er endlich, mein erster freier, fast schon poetisch berührender Blick auf diese magisch wundervolle Oase inmitten der dunkelsten Finsternis des absoluten Nichts. Eine Erkenntnis, die mich ein wenig erschreckt: Die Erde ist leuchtend und vibrierend blau. Der Himmel hingegen ist immer schwarz. Auch am Tag.« Matthias Maurer
Matthias Maurers autobiografischer Bericht über seinen Weg zu den Sternen und sein Leben in der Umlaufbahn begeistert durch wissenschaftliche Details, mitreißende Geschichten aus dem Astronauten-Alltag und ungebremste Entdeckerfreude. Der 600. Mensch, der je die Erde verlassen hat, schildert seine packenden Abenteuer aus ganz persönlicher Sicht und erklärt dabei für alle verständlich, wie Raumfahrt funktioniert und wie sich das Leben in der Schwerelosigkeit anfühlt.
Nach dem Erfolg der ISS-Mission hat Maurer das nächste Ziel fest im Blick: einen Flug zum Mond im Rahmen des Artemis-Programms."
Inhaltsverzeichnis:
- VORWORT VON
REINHOLD EWALD 9
PROLOG IM HIMMEL – GEFANGEN IM NICHTS 13
AUF UMWEGEN ZUM TRAUMBERUF 15
GALAKTISCHE ERLEBNISSE AUF DER ERDE 35
- Eine Reise ins Innere unseres Planeten .................. 35
Donnerndes Ungeheuer in der Steppe .................. 45
Aquanauten auf dem Meeresgrund ..................... 53
Eisige Stunden in der Wildnis ......................... 68
Historisches Training im Gelben Meer .................. 74
Mondmission auf Lanzarote .......................... 81
Grenzenlose Freiheit ................................. 87
It’s Showtime! ....................................... 91
Ein Spielplatz für Astronauten ......................... 97
Ein Stückchen Weltraum auf Erden .................... 112
Kosmische Notaufnahme ............................. 128
Geheimnisvolles Sternenstädtchen ..................... 139
Auge in Auge mit dem Drachen ....................... 152
AUF DIENSTREISE IM ALL 163
- »To boldly go« ...................................... 163
Ritt mit dem Drachen ................................ 172
Kosmischer Kuss .................................... 179
Schweben und Schwindel ............................. 192
Das bisschen Haushalt ............................... 200
Gefahr aus dem All .................................. 208
Wettlauf gegen die rote Linie .......................... 221
Die Wunden der Erde ................................ 229
Vertrauen .......................................... 233
Galaktisch gudd gess ................................. 239
Licht und Schatten .................................. 245
Ein Raumschiff zu Weihnachten ....................... 251
In der Weihnachtsbäckerei ............................ 258
Die beste Nachricht der Welt .......................... 261
Neujahrsgrüße aus der chinesischen Raumstation ........ 267
Maurer in der Schwerelosigkeit ........................ 270
Weltneuheit im All .................................. 277
Small Talk im Schlafanzug ............................ 280
Sprechstunde bei Dr. Brigitte .......................... 283
100 Tage im All ..................................... 289
Achtung, Feuer! ..................................... 298
Millionen leuchtender Punkte ......................... 302
Blick auf eine boshaft veränderte Welt .................. 304
Die Folgen des Krieges ............................... 308
Operation am offenen Herzen ......................... 315
Freunde im Anflug .................................. 326
Die wildeste Party ALLer Zeiten ....................... 330
Die Stunden vor dem Ausstieg ins Nichts ............... 335
414 Minuten im freien Universum ..................... 339
Schreckmoment zum Ende ............................ 352
Chaos im außerirdischen Paradies ..................... 354
»Go, Eytan!« ........................................ 362
Kosmisches Couchsurfing ............................ 365
Abschiedstour ...................................... 368
Auf Wiedersehen! ................................... 376
Sturzflug durch die Atmosphäre ....................... 384
QUELLEN 389
Leseprobe [Von der Verlagsseite]:
"PROLOG IM HIMMEL – GEFANGEN IM NICHTS
Mittwoch, 22. März 2022. Ich bin ein kleines Raumschiff im
ewigen Nichts, ein winziger Punkt zwischen
funkelnden
Sternen, ein lebendiger Satellit in der
Unendlichkeit. Die pure
Schwärze des Universums umhüllt mich
wie ein schützender
Schleier. Sie vermittelt eine trügerische
Geborgenheit in dieser
menschenfeindlichen Umgebung, die jeden noch so geringfügi-
gen Fehler gnadenlos bestraft. Es waren
nur Sekunden der
Unachtsamkeit, einige nicht durchdachte Bewegungen, ein paar
falsche Drehungen, aufgrund derer das
größte Abenteuer mei-
ner Astronautenkarriere nun ein jähes Ende zu finden droht.
Seit vier Stunden bin ich schon
im freien Weltraum unter-
wegs, lediglich durch zwei Leinen mit der Internationalen Raum-
station ISS verbunden. Sie sollen mich davor bewahren, ins All
hinaus zu treiben. Doch jetzt halten sie mich gefangen. In dem
unbeweglichen Raumanzug, der mich vor dem tödlichen Vaku-
um abschirmt, kann ich die Situation
nicht hundertprozentig
analysieren. Aber wie es aussieht, hat sich das lange Rettungsseil
mehrmals um meine Beine und zusätzlich
um meinen Ober-
körper geschlungen. Hilflos wie ein
Insekt, das sich in einem
Spinnennetz verheddert hat, taumle ich in der Schwerelosigkeit.
Satte 400 Kilometer über meinem Heimatplaneten, mit einer Ge-
schwindigkeit von 28 000 Kilometern pro Stunde. ...
AutorInnen [Von der Verlagsseite]:
"Dr. Ing. Matthias Maurer studierte u. a. Werkstoffwissenschaften in
Deutschland, England, Frankreich und Spanien. Nach seiner Promotion, zehn
internationalen Patentmeldungen und mehreren Forschungspreisen ist er seit
2010 bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA angestellt. 2015
wurde er Mitglied im Astronautenkorps und begann mit seiner Ausbildung
für die Reise zur Internationalen Raumstation ISS, wo er von November
2021 bis Mai 2022 lebte und arbeitete. Seit der Rückkehr zur Erde
ist er stellvertretender Leiter des Astronautenzentrums in Köln und
koordiniert den Aufbau des Trainingszentrums LUNA, das Raumfahrer und Technik
auf die Monderkundung vorbereiten soll.
matthiasmaurer.esa.int
X: @astro_matthias
Instagram: @esamatthiasmaurer"
Bewertung: Ein hochinteressantes Buch,
besonders natürlich auch für die ErlebnisspsychologInnen, weil
es nur wenige Quellen zum Erleben von Astronauten gibt. Daher gibt es neben
diese Standardpräsentation eine eigene erlebnispsychologische
Analyseseite zu diesem einmaligen Werk.
Bibliographie: Theiss, Anna (2023)
die abwertung der mütter. wie überholtedamilienpolitik uns
den wohlstand kostet. München: Droemer.
Verlags-Info: Die Abwertung der Mütter
Wie überholte Familienpolitik uns den Wohlstand kostet | Eine
Streitschrift über die Benachteiligung von Frauen
Ein überfälliger Beitrag zur Care-Debatte:
Warum der schlechte Umgang mit Müttern den Wohlstand des Landes gefährdet.
Kaum werden Frauen zu Müttern, verändert sich alles: Sie
werden entmündigt und übergangen, gegebene Versprechen werden
nicht gehalten. Vor allem aber sind sie die unbezahlte Arbeitskraft, auf
die ein ganzes System sich verlässt. In Zeiten der Krisen und darüber
hinaus.
Warum unser antiquiertes Mutterbild wirtschaftlichen
Schaden anrichtet
Dabei ist ihr Einsatz – privat und beruflich – von zunehmender, ja
essenzieller Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes.
Trotzdem werden massenhaft gut ausgebildete Mütter vom Arbeitsmarkt
ferngehalten, weil institutionelle Betreuungssysteme versagen, überkommene
Mütterbilder Frauen unter Druck setzen und fragilere Familienstrukturen
weniger verlässlich sind.
Und so hat der schlechte Umgang mit Müttern
gesamtwirtschaftliche Konsequenzen.
»Alles an der Familienpolitik in unserem Land schreit nach Veränderung.«
Anne Theiss
Klug und pointiert skizziert Anne Theiss in diesem
Buch die Missstände, an denen sich bis heute wenig geändert hat
und zeigt, wie die Politik ihre Verantwortung gegenüber Müttern
und Familien endlich ernst nehmen kann. Sie beleuchtet, warum ein »Weiter
so« langfristig das Wirtschafts-Modell der Bundesrepublik gefährdet
und warum wir es besser nicht so weit kommen lassen.
Ein fundierter Beitrag zu einer sich verschärfenden
Debatte von einer Mutter, die es leid ist zu schweigen.
Inhaltsverzeichnis:
Vorbemerkung 9
Vorwort 11
1 »Das sagt einem niemand!« 19
Was ich gerne gewusst hätte, bevor ich Mutter wurde, was die Leistung,
eine eigene Blase, Mentalität und Resilienz damit zu tun haben.
Warum
die Liebe nicht zu Ende gehen muss, weil alles bleiben kann – bis auf
die
Ratschläge von anderen.
2 »Das hat die Natur so nicht vorgesehen« 44
Das Individuum versus »die Mutter«: Warum das Gebären
in der Norm
angesagt ist, wie stark Etiketten noch
wirken, warum das keinen Sinn
macht – genauso wie manch politische Maßnahme.
3 »Und wo ist das Kind gerade?« 59
»Frischgebacken« und doch vergessen: Warum Mütterzufriedenheit
un
terschätzt wird, warum sie ökonomische und generationsübergreifende
Bedeutung hat und trotzdem mühsam
erarbeitete Fortschritte verloren
gingen.
4 »Das Kind ist viel zu warm angezogen« 75
Was Mangel und unechte Sorge mit
Müttern macht: Viele Systeme in
diesem Land funktionieren noch für
viele, aber schon nicht mehr für
Familien, für Mütter, Väter, ihre Kinder. Warum das
nicht nur sie, son
dern alle dringlichst kümmern sollte.
5 »Wir freuen uns aufs Babysitten« 95
Auf der Suche nach Verlass: Tradierte
Rollen überdauern die Jahrtau
sendwende, haben Einfluss auf die heutige Infrastruktur. Warum junge
Mütter ihre Vorstellungen von einem
zeitgemäßen Leben im 21. Jahr
hundert erkämpfen müssen und was eine falsche »Logik«
damit zu tun hat.
6 »Toll, wie du das alles schaffst!« 117
Einmal Multitasking, bitte: Mütter bestehen
zwischen multiplen An
sprüchen, während sie Mühe haben,
ihre eigenen durchzusetzen. Wa
rum das auch mit Kindergeburtstagen, Familiengerichten und Vätern
zu tun hat.
7 »Das könnte ich nicht!« 134
Warum die Entmündigung bei der Schwangerschaftsdiagnostik beginnt,
weshalb es herausfordernd ist, in diesem Land Kinder großzuziehen,
die
nicht »mitlaufen«, und warum nicht alles therapiert werden
muss.
8 »Aus der Nummer kommst du nicht raus!« 154
Sprüche, die wahr sind und wahr
bleiben: Was (werdende) Mütter in
diesem Land öfter hören sollten
und warum wir dafür unter anderem
Kränkungen über Bord werfen müssen.
9 »Ihr müsst euch halt wehren!« 164
Das Land braucht einen »New Deal« – oder besser »First
Deal« mit Müt
tern. Ihre Wertschätzung durch neue Kinderbetreuungs, Arbeits,
Part
nerschaftsModelle wird unser aller Wohlstand
mehren. Warum dafür
zunächst weniger Affirmation und mehr Gegenwehr angebracht ist.
Danksagung 189
Anmerkungen 191
Leseprobe: [Aus dem Verlagsangebot und dem Vorwort]
"... Ich würde gerne auch positiv
über die Lage von Müttern
schreiben. Wenn es ansatzweise Anlass dazu gäbe. Ich würde
ebenso gerne über Väter und Mütter schreiben.
Wenn sie in der gleichen Lage wären.
Doch wenn es um Mütter geht,
passiert etwas untypisch
Deutsches: Ihre Lage wird schöngeredet,
obwohl sie desolat
ist, uns wirtschaftlichen Wohlstand kostet.
Es wird überstri
chen, übertüncht, was negativ ist. Dabei müssen wir
als Land
in der Gegenwart ankommen, unser volles
Potenzial aus
schöpfen, den Lack abkratzen: Bei den Idealen und den Rol
lenbildern. Die gegenwärtige Lebensrealität
der Mütter be
darf eines »Wummses«1 à
la Bundeskanzler Olaf Scholz, der
»DoppelWumms«Auswirkungen auf uns
alle hätte. Wäh
rend nämlich immer noch alte Vorstellungen gepredigt wer
den, brauchen wir in Wahrheit mehr
Mütter im neuen Ge- [>12]
wand, Mütter, die frühzeitig wieder arbeiten, auch in Vollzeit.
Und dies auch sein wollen, weil die Bedingungen gut sind.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Mütter einer
bezahlten Ar
beit nachgehen, steigt um 35 Prozent, wenn ihre Kinder ver
lässlich betreut werden.2
Larissa Zierow, Professorin
für Volkswirtschaftslehre an der
Hochschule Reutlingen, erklärt
in der Wochenzeitung »Die Zeit«: »Öffnet eine
Kita ganztags
statt halbtags, steigt das Einkommen
der Mütter im Schnitt
um 290 Euro pro Monat, bei Akademikerinnen
sogar um
425 Euro.«
Dadurch erhöhe sich ihr Lebenseinkommen, das
Risiko für Altersarmut sinke, die Sozialausgaben eines Staates
auch, die Steuereinnahmen durch zusätzlichen Verdienst füll
ten vielmehr die Sozialkassen auf, und
»Produktivität und
Wirtschaft wachsen«.3
Aber was passiert in Deutschland –
trotz der bekannten
Zahlen, trotz der immensen Vorteile,
die es für die Gesell
schaft mit sich bringen würde, wenn mehr Mütter mehr be
rufstätig wären? Das Gegenteil, es
droht Rückschritt statt
Fortschritt. Mit dieser Entwicklung hat auch, aber nicht nur,
ein Virus zu tun, der das Leben aller beeinträchtigte, aber ir
gendwie doch das Leben der Mütter
am meisten (und zwar
um einiges mehr als das der Väter!). Betrachtet man Studien
oder fragt nach der Einstellung von
jungen Vätern, können
auch Optimistinnen angesichts der aktuell herrschenden Be
dingungen nicht auf die große Transformation hoffen. Denn
selbst bei größtem SelbstEngagement kommen viele Mütter
immer noch viel zu oft nicht so weit, wie sie es unter besseren
Bedingungen könnten. Und das ist
nicht nur schade, das ist
tragisch, das ist Vergeudung.
Schlimmer noch: Zu viele der heutigen berufstätigen Müt
ter mit Kleinkindern werden psychisch und physisch auf der
Strecke bleiben, durch die andauernde Mehrfachbelastung bei
13
schlechter Infrastruktur Folgekrankheiten entwickeln. Wenn
Mütter heute nicht mehr können,
sind ihre Krankheitsbilder
diffiziler und damit aufwendiger zu behandeln als noch vor ein
paar Jahren. Psychologinnen berichten von nie gesehenen Zu
ständen.
4
Erschöpfte Mütter, Mütter, die zu krank sind,
können
nicht ihre Stimme erheben und auch nicht mehr leisten. Viele
von uns werden das womöglich erst gar nicht merken oder ver
drängen, manche werden Zusammenhänge
verneinen. Die
Idee, dass Frauen »Selbst schuld!« an ihrer Lage sind,
ist weit
verbreitet und wirft doch nur alle in einen Riesentopf.
Der Staat, die Politik, die Gesellschaft, die Männer – profi
tieren einmal wieder (kurzfristig) von der Selbstaufgabe von
Müttern für die Familie. Sie lässt verdecken, dass Hausaufga
ben nicht erledigt, Versprechen nicht
eingehalten wurden.
Und während den Müttern durch zu wenig verlässliche
Rah
menbedingungen immer mehr Erschöpfung droht, unflexible
Betreuungs und Arbeitsmodelle
ihre Berufstätigkeit er
schweren, sogar – fast wie in früheren
Zeiten – unmöglich
machen, gehen dem Arbeitsmarkt vor unser aller Augen drin
gend benötigte Arbeitskräfte verloren.5
Es ist eben nicht wie beim Wechselkurs: Sinkt der Wert des
Euros, steigt oft (im Verhältnis)
der Wert des Dollars. Eine
»Einheit« Mutter, deren »Wert« nur vermeintlich
geringer ist,
lässt den Wert der anderen Einheiten auch nur vermeintlich
steigen. Früher konnte diese Art
des Verlustes übertüncht
werden. Das starke Wirtschaftswachstum und
die Masse an
Steuerzahlerinnen6 im Land ließen
zu, dass die Berufstätig
keit von Frauen und insbesondere Müttern
nicht gefördert
wurde. Inzwischen ist das verheerend:
Heute bedeutet der
»sinkende Wert«, die Abwertung der Mütter, einen sinkenden
Wohlstand. Und das betrifft auch die Männer beziehungswei
se die gesamte alternde Gesellschaft – auf lange Sicht. Je län-[>]
ger wir brauchen, um das zu erkennen,
desto mehr müssen
wir wieder investieren, um das brachliegende
Potenzial der
Mütter abzurufen. Dabei wären Mechanismen
aus anderen
Ländern bekannt, die pragmatisch eingesetzt und angewandt
innerhalb kürzester Zeit mehr Müttern mehr Berufstätigkeit
ermöglichen könnten. Und ja, kurzer Spoiler, darunter gehö
ren kluge, effiziente Investitionen und
fällt auch der Slogan:
»Männer an den Herd!« Aber nicht nur.
Die Geschichte deutscher Mütter hat
mit gesamtgesell
schaftlichem Schweigen, mit der Verneinung
von (spät)mo
dernen Entwicklungen7, mit zu wenig Einsatz aktueller, wis
senschaftlicher Erkenntnisse in der Betreuungsrealität,
mit
festgefahrenen Ansichten und Strukturen zu tun. Junge Müt
ter, die relativ schnell nach der
Geburt ihres Kindes wieder
arbeiten möchten, werden abgewertet, weil tradierte Rollen
(vor)bilder, mit denen viele von uns (vor allem in Westdeutsch
land) sozialisiert wurden, noch zu viel
Einfluss haben: Das
»Kindeswohl« gilt auch im 21. Jahrhundert für die
Mehrheit
der Deutschen als Begründung, dass
Frauen mindestens ein
Jahr zu Hause bei den Kindern bleiben sollen, am besten noch
länger. Politische Instrumente wie das Elterngeld, die eigent
lich für den leichteren beruflichen
Wiedereinstieg gedacht
sind, befördern das sogar. Auch
dass die KitaGebühren in
Deutschland häufig noch um einiges
höher sind als die für
den Kindergarten. Währenddessen profitieren
Männer wei
terhin durch das »Gender Care Gap«. Also davon, dass Frau
en im Durchschnitt eineinhalbmal so viel
der unbezahlten
Haushalts und Sorgearbeit übernehmen.8 Und das »Gender
Pay Gap«9 offenbart ihnen, dass Männer in der
Wirtschaft im
mer noch größtenteils mehr verdienen
als sie. Den Kindern
versuchen sie vor diesem Hintergrund
unermüdlich beizu
bringen, was Gleichberechtigung und Gerechtigkeit bedeutet. [>15]
Bei Müttern klaffen der Anspruch, der Schein (Podest) und
die Wirklichkeit (Alltag) auseinander. Sie sind die Eier legen
den Wollmilchsäue, kämpfen Tag für Tag, dass bei Mangel
an
KitaPlätzen und Fachkräften sowie
schlechter werdender
Gesundheitsversorgung trotzdem alles funktionieren
mag.
Die Überschrift ihres Lebens ist: »Immer auf der Suche nach
ausreichender Unterstützung und Alternativen!« – anstatt
auf
Entfaltung, auf sich selbst setzen zu
können. Weil immer
noch vorherrschende MütterIdeale nicht der spätmodernen
MütterRealität entsprechen.
Völlig kurios, wenn man bedenkt, welchen Dienst die Müt
ter diesem Staat, dieser Gesellschaft, der Wirtschaft erweisen:
Sie gebären trotz allem Bürgerinnen10,
spätere Arbeitneh
merinnen und bei gleichzeitiger Berufstätigkeit helfen sie mit,
dass dieses alternde Land eine Zukunft
hat.11 Sie arbeiten
mehrfach für den Wohlstand. Aber beklatscht werden vor al
lem die neuen, engagierten Väter. Obwohl jungen Frauen al
lerlei Versprechen gemacht werden, bevor sie Kinder bekom
men, stehen zu viele von ihnen vor dem Scherbenhaufen ih
rer eigentlichen Pläne, sobald der
Nachwuchs da ist. Kurz
gesagt: Würden werdende Mütter einen
Vertrag mit Vater
Staat schließen, wären sie gut beraten, das Kleingedruckte
zu
vor zu lesen.
In Deutschland leben circa 7,5 Millionen
erwerbstätige
Mütter mit mindestens einem minderjährigen
Kind. Die
meisten arbeiten in Teilzeit, da oft die Infrastruktur nur wenig
andere Modelle möglich und attraktiv
macht, am wenigsten
Schichtdienste.12 Würden alle diese Mütter nur wenige
Stun-
den in der Woche mehr arbeiten können, wenn sie woll(t)en,
wäre das ein bedeutender Teil einer Lösung des Arbeitskräfte
mangels. Und wir würden den gigantischen Herausforderun
gen des demografischen Wandels begegnen: 2023 erreicht der [>16]
Jahrgang 1958 das Rentenalter von 65 Jahren. Auf ihn würden
Millionenjahrgänge folgen, alle größer als die bisherigen,
sagt
Soziologe Stefan Schulz und fügt hinzu: »So etwas kennen
wir
nicht, und es wird uns überfordern.
Die Frage ist, ob wir es
geschehen lassen oder ob wir es
mitgestalten.« Und er hebt
die Bedeutung der Familien hervor und
damit der Mütter:
»Es ist eine große politische Aufgabe, dass Familien funktio
nieren. Wir müssen langsam mal einsehen,
dass der Nach
wuchs die einzige Ressource für
unsere Volkswirtschaft ist.
Wir haben sonst nichts, und von dem, was wir haben, haben
wir zu wenig. Das sind Dinge, die
von der Politik nicht auf
Augenhöhe mit der Notwendigkeit organisiert werden.« 13
Vor diesem Hintergrund, angesichts dieser gewaltigen Auf
gabe, gibt es für Frauen mit Kindern entgegen jeglicher Logik,
entgegen jeglichen Anstands viel zu viele Rollen rückwärts
–
und die Frage bleibt: Wann kommt
er, der »Wumms«, der
»DoppelWumms« [>14] , wann geht es endlich spürbar
vorwärts
für spätmoderne Mütter in Deutschland?
Bücher über Frauen, über Mütter sind immer noch
– oder
wieder – ein Balanceakt, man könnte
auch sagen »Spießru
tenlauf«. Für manche wird es ein Affront sein, dass ich
mich
überhaupt beschwere. Viele, auch nicht wenige Frauen, den
ken noch immer: Mütter haben zufrieden zu sein. Den mög
lichen Mini oder MegaShitstorm vor
Augen, wage ich zu
behaupten: Nein, haben sie nicht! Sie sollten – über alle poli
tischen Lager hinweg – mehr Einigkeit
demonstrieren, für
mehr Sichtbarkeit ihrer Probleme kämpfen.
Sie haben ver
dient, sich zu wehren, sie sollten sich wehren, sich für ihren
Wert einsetzen, der nichts mit der Anzahl ihrer Kinder zu tun
hat, sondern mit ihrem Potenzial als Mensch, als Individuum.
Am Ende wird genau dieses Wehren
die Zukunft Deutsch
lands, die Wirtschaft stärken, die Gesellschaft modernisieren,
[>17]
nach gleichberechtigten Maßstäben formen
und damit auch
das künftige Leben der nachfolgenden Generationen auf ein
besseres Fundament stellen. Das Abwenden
der Abwertung
von heutigen Müttern, ihrer Erschöpfung,
der mangelnden
Wertschätzung wird ebenso die spätere
Entscheidung von
heutigen Mädchen für oder gegen Kinder beeinflussen.
Aber zunächst gilt zu klären, warum Abwertung von Müt
tern in der Gegenwart überhaupt noch eine Rolle spielt. Wa
rum geläufige Sprüche gegenüber
ihnen einiges offenbaren.
Über uns. Über unser Land.
Über
die darin lebende Gesell
schaft. Und warum wir bei all den Worten, Ratschlägen und
Ideen von MütterIdealen vor allem
Antworten auf die fol
genden Fragen benötigen: Wie bekommen wir mehr Aufwer
tung, mehr Verlässlichkeit für die
so dringend gebrauchten
jungen, berufstätigen Mütter hin – nach all den Jahrzehnten
verheerender Familienpolitik und vor dem Hintergrund tra
dierter Rollenbilder, die gesellschaftlich immer noch zu stark
akzeptiert sind?
Und das möglichst schnell?"
AutorInnen "Anne Theiss ist Journalistin und persönliche Referentin von Hubert und Jacob Burda. Sie ist Mutter zweier Kinder und kennt die Belastung des Mütter-Multitaskings aus eigener Erfahrung. Anne Theiss lebt mit ihrer Familie in Tutzing bei München."
Bewertung: Ein sehr wichtiges Buch
zu einem sehr wichtigem Thema, das aufzeigt worauf es ankommt und wie zum
Wohle aller gemanagt werden könnte und sollte.
Abbou, Kenza Ait Si (2023) Menschen verstehen. Wie emotionale künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert. München: Droemer.
Petterson, Maria (2023) ANFÜHRERINNEN, AGENTINNEN, AKTIVISTINNEN Außergewöhnliche Frauen, die Regeln brachen. München: Droemer-Knaur.
Marche, Stephen (2022) Aufstand in Amerika. Der nächste Bürgerkrieg - ein Szenario. München: Droemer.
Möhn, Ulia; Harms, Wiebke & Jaax, Liske (2021) Team F. Feminismus einfach leben. 12 Impulse für den Alltag. München: Knaur.
Leberecht, Tim (2020) Gegen die Dikatur der Gewinner. Wie wir verlieren können, ohne Verlierer zu sein. München: Droemer.
Jürgens, Sabine (2020) Haben wir noch alle Tassen im Schrank? Was wir über die Psyche zu wissen glauben und was wirklich stimmt. München: mvg.
Theiss, Anne (2023) Die Abwertung der Mütter. Wie überholte Familienpolitik uns den Wohlstand kostet. München: Droemer.
Dingmann, Marc (2020) Das Gehirn. Neueste Erkenntnisse der Neurowissenschaften über unser wichtigstes Organ und seine Macken. München: riva.
Rothe, Wolfgang (2021) Missbrauchte Kirche. Eine Abrechnung mit der katholischen Sexualmoral und ihren Verfechtern. München: Droemer.
Bibliographie: Lewis, Herbert Clyde (engl. 1937; dt. 2023) Gentleman über Bord. Roman OT: Gentleman Overboard. Aus dem Amerikanischen von Klaus Bonn. Mit einem Nachwort von Jochen Schimmang. Leineneinband im Schuber, fadengeheftet und mit Lesebändchen. 176 Seiten. ISBN: 978-3-86648-696-6. Erscheinungsdatum: 14.03.23
Verlags-Info: "Ein wohlsituierter New Yorker Geschäftsmann stürzt urplötzlich in eine mentale Krise. Um zu gesunden, so spürt er, muss er seinen von grauem Erfolg geprägten Alltag hinter sich lassen, und kurzerhand tritt er eine Schiffsreise an. Kaum auf See, stellt sich die erhoffte Erleichterung tatsächlich ein, doch dann … macht er einen einzigen falschen Schritt und landet mitten im Pazifik, während sein Schiff sich immer weiter von ihm entfernt. Was denkt ein Mensch in solch einer Situation? Woraus schöpft er Hoffnung? Und wie blickt er nun auf sein Leben, dessen er vor Kurzem noch so überdrüssig war?
Mit Gentleman über Bord gelang Herbert Clyde Lewis ein tiefgründiges, genial komponiertes Meisterwerk, das fast ein Jahrhundert lang weitgehend unbeachtet blieb und in der vorzüglichen Übersetzung von Klaus Bonn jetzt endlich auf Deutsch vorliegt."
Inhalt Gesamter Inhalt in Stichworten mit Kurzzitaten in der erlebnispsychologischen Analyse des Romans.
Der Roman ist in 10 Kapitel gegliedert. Von den 10 Kapitel sind zwei vollständig dem Geschehen auf der Arabella gewidmet - das erste enthält auch Erleben , die andern 7 bieten viel Erleben. Verlagsinhalt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Titelcharakteristiken von mir,
- Eins Paukenschlagbeginn - Reise mit dem Frachter Arabella 13-23.
- Zwei Sturz in den Ozean 27-38.
- Drei Wie es dazu kam: Lebensgeschichte, Ehe und Krise, 41-50.
- Vier Anpassung im Ozean 53-65.
- Fünf Arabella 69-82.
- Sechs Angst und Erkentnisdurchbruch 85-94.
- Sieben Auseinandersetzung mit dem sich abzeichnenden Schicksal: warum, warum? 97-107.
- Acht Arabella Standish seit 13 h vermisst - Umkehr angekündigt 111-129.
- Neun Sterben steht an: Helft mir! Helft mir! 133-145.
Zehn Lebensbilanz im Sterben 149-157.
"Als Henry Preston Standish kopfüber in den Pazifischen Ozean fiel, ging am östlichen Horizont gerade die Sonne auf. Das Meer war so still wie eine Lagune, das Wetter so mild und die Brise so sanft, dass man nicht umhinkam, sich auf wunderbare Art traurig zu fühlen. In diesem Teil des Pazifiks vollzog sich der Sonnenaufgang ohne großes Tamtam: Die Sonne setzte lediglich ihre orangefarbene Kuppel auf den fernen Saum des großen Kreises und schob sich langsam, aber beständig nach oben, bis die matten Sterne mehr als genug Zeit hatten, mit der Nacht zu verblassen. Tatsächlich dachte Standish gerade über den gewaltigen Unterschied zwischen dem Sonnenaufgang und dem Sonnenuntergang nach, als er den unglücklichen Schritt machte, der ihn in die See beförderte. Er dachte, dass die Natur ihre ganze Freigebigkeit auf die herrlichen Sonnenuntergänge verschwendete, die Wolken mit einem solchen Schwall von Farben malte, so glänzend, dass kein Mensch mit einem Sinn für Schönheit sie je vergessen könnte. Und er dachte, dass aus irgendeinem unerklärlichen Grund die Natur über eben diesem Ozeanungewöhnlich knausrig sei mit ihren Sonnenaufgängen.
Die S. S. Arabella setzte planmäßig ihre Fahrt von Hono-[>11] lulu zur Kanalzone fort. Noch acht Tage und Nächte, dann würde sie Balboa erreichen. Wenige Schiffe nahmen die Reiseroute zwischen Hawaii und Panama, nur dieses eine Passagierschiff alle drei Wochen und gelegentlich ein Trampdampfer. Fremdländischen Seefahrzeugen bot sich selten ein Grund, diesen Weg einzuschlagen, denn die amerikanischen Schiffe kontrollierten den größten Teil des Handels mit den Inseln, und ein Großteil der Güter ging nach San Pedro, San Francisco und Seattle. Während der dreizehn Tage und Nächte auf See hatte die Arabella nur ein einziges Schiff gesichtet, das in der anderen Richtung nach Hawaii unterwegs
war. Standish hatte es nicht gesehen. Er hatte in seiner Kajüte eine Zeitschrift gelesen, aber der Erste Offizier, Mr. Prisk, erzählte ihm später davon. Es war ein Frachter mit irgendeinem skandinavischen Namen, den er prompt vergaß.
Die ganze Reise war bis dahin auf so freundliche Weise ereignislos, dass Standish nicht müde wurde, seinem Glücksstern für die Entscheidung zu danken, mit der Arabella zu fahren. In einem von vielen Sorgen und Pflichten geplagten Leben, wie es sich für seine Position ziemte, würde diese Reise stets als etwas Schlichtes und Gutes hervorstechen. Sollte er auch niemals mehr eine solche Seelenruhe erfahren, würde er sich nicht ärgern, denn jetzt wusste er, dass es so etwas gab. Sein Glücksstern war der Polarstern, der in diesen Breiten tief am Himmel stand, und er hatte ihn von allen anderen ausgewählt, weil er sich wenig mit Sternen auskannte und dieser am leichtesten zu orten und zu merken war. ..."
Rezensionen: viele begeisterte Rezensionen.
Autor-Info (aus dem Buch S.174): "HERBERT CLYDE LEWIS (1909-1950) wurde als zweiter Sohn russisch-jüdischer Einwanderer im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren. Er führte ein rastloses Leben als Sportreporter in Newark, Berichterstatter in Shanghai und Drehbuchautor in Hollywood. Er schrieb für den Mirror und das Time Magazine in New York und verfasste vier Romane. Sein Debüt Gentleman über Bord ist das erste seiner Bücher, das auf Deutsch vorliegt."
Bewertung: Ein sehr interessantes Buch von dem ich am 16.04.2023 durch den Literaturclub erfuhr. Das Thema hat mich sofort aus mehreren Gründen stark angesprochen, besonders aber aus erlebnispsychologischer Perspektive (Gentleman über Bord), weil ich zur Zeit an der Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse arbeite, wo sich mir aktuell die Frage stellte, inwieweit literarische Schilderungen des Erlebens berücksichtigt werden können oder gar müssen. Diese tödliche Unglücksreise berührt vor allem das Erleben grundlegender existenzieller Fragen: warum ich, warum jetzt, warum so?
Bibliographie: Precht, David & Welzer, Harald (2022) Die vierte Gewalt – Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Frankfurt: Fischer.
Verlagsinfo: Das erste gemeinsame Buch der beiden Bestseller-Autoren Richard David Precht und Harald Welzer: Wie Massenmedien die Demokratie gefährden
Was Massenmedien berichten, weicht oft von den Ansichten und Eindrücken großer Teile der Bevölkerung ab – gerade, wenn es um brisante Geschehnisse geht. So entsteht häufig der Eindruck, die Massenmedien in Deutschland seien von der Regierung oder »dem Staat« manipuliert. Aber die heutige Selbstangleichung der Medien hat mit einer gelenkten Manipulation nichts zu tun. Die Massenmedien in Deutschland sind keine Vollzugsorgane staatlicher Meinungsmache. Sie sind die Vollzugsorgane ihrer eigenen Meinungsmache: mit immer stärkerem Hang zum Einseitigen, Simplifizierenden, Moralisierenden, Empörenden und Diffamierenden. Und sie bilden die ganz eigenen Echokammern einer Szene ab, die stets darauf blickt, was der jeweils andere gerade sagt oder schreibt, ängstlich darauf bedacht, bloß davon nicht abzuweichen. Diese Angst ist der bestmögliche Dünger für den Zerfall der Gesellschaft. Denn Maßlosigkeit und Einseitigkeit des Urteils zerstören den wohlmeinenden Streit, das demokratische Ringen um gute Lösungen.
In ihrem ersten gemeinsamen Buch analysieren die Bestseller-Autoren Richard David Precht und Harald Welzer die Mechanismen, die in diese Sackgasse führen: Wie kann eine liberale Demokratie mit pluraler Medienlandschaft sich selbst so gefährden? Wie ist es in Deutschland, dem Land einer lange vorbildlichen Qualitätspresse und eines im internationalen Vergleich ebenso vorbildlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunks dazu gekommen? Wie konnte und kann die Medienlandschaft durch die »vierte Gewalt« selbst unfreier werden? Und was bildet das veröffentlichte Meinungsbild ab, wenn es mit dem öffentlichen so wenig übereinstimmt?
Wir müssen verstehen, wie unsere Demokratie nicht durch Willkür und Macht »von oben«, sondern aus der Sphäre der Öffentlichkeit selbst unterspült wird – erst dann kann die »vierte Gewalt« ihrer Rolle wieder gerecht werden.
Inhaltsverzeichnis:
- Einleitung 7
Der Brief 19
Ungleiche Meinungen über das Gleiche Eine kleine Geschichte der Öffentlichkeit 39
Eine Frage des Systemvertrauens Die Repräsentationslücke 67
The Unmarked Space Was Leitmedien nicht thematisieren 94
Gala-Publizistik Politischer Journalismus ist Journalismus über Politiker, weniger über Politik 114
Auf den Cursor kommt es an! Warum Dabeisein wichtiger ist als Unabhängigkeit 136
Kapieren kommt von Kopieren Wie der Cursor-Journalismus seine Breitenwirkung entfaltet 157
Die große Ansteckung Wie es kam, dass die Leitmedien so erregt wurden 178
Verzweiseitigung Wie Leitmedien durch die Direktmedien an Qualität verlieren 199
Erregungsökonomie Der Verlust des Kontextes 218
Vertrauen herstellen In welche Richtung der neue Kurs der Leitmedien gehen könnte 249
Danksagung 269
Anmerkungen 270
Bewertung: Ein sehr wichtiges Buch zur völlig unbefriedigenden Lage der sog. Qualitäts- und Wahrheitsmedien.
Bibliographie: Bergen, Mark (2022) YouTube. Die globale Supermacht. Wie Googles Videoplattform unsere Weltsicht dominiert. München: Droemer.
Verlags-Info: Eine Erkenntnis des Buches ist, dass man die wirtschaftliche Macht von YouTube nicht von seiner emotionalen und psychologischen trennen kann - Voyeurismus war die treibende Kraft dahinter…Solange die Plattform der Ort ist, an dem jeder im Internet seine Hausaufgaben macht und seine Klempnerarbeit erledigt, wird YouTube weiterhin eine der unverzichtbaren Seiten im Internet sein.« The New Yorker
Wie YouTube das Weltbild formt: ein exklusiver Investigativ-Bericht
Der Aufstieg der Video-Plattform zur globalen Supermacht
Die Macht des YouTube-Algorithmus über den
Alltag seiner Nutzer*innen
YouTube ist weit mehr als eine Video-Plattform: Mit mehr als zwei Milliarden
User*innen und 500 Stunden Video-Uploads pro Minute ist die Google-Tochter
die mächtigste Bildmaschine aller Zeiten. Der YouTube-Algorithmus
entscheidet, wie wir die Welt sehen. Der Tech-Insider und renommierte Journalist
Mark Bergen schreibt nun das definitive Buch über diesen global einflussreichsten
Kultur-Produzenten. Packend und scharfsichtig erzählt er vom Aufstieg
einer kleinen, hochinnovativen Plattform, die später mitverantwortlich
sein wird für Googles Billionen-Monopol. Seine explosive Geschichte
über Korruption, Gier und Profit im Silicon Valley zeigt, wie mit
YouTube ein digitaler Macht-Apparat entstanden ist, in dem sich die Frage
nach der Moral erst stellt, wenn die Bilanzsumme stimmt.
Seit mehreren Jahren bereits berichtet Mark Bergen
über die Geschäfts-Praktiken von Google und YouTube, unter anderem
für Bloomberg, die New York Times, das Wall Street Journal und den
New Yorker. Basierend auf jahrelangen Recherchen zeigt sein Buch nun erstmals,
wie es YouTube vom kleinen Start-up hin zu einem der wichtigsten Player
auf dem weltweiten Medienmarkt geschafft hat – mit einem skrupellosen Geschäfts-Modell
und Algorithmen, die ethische Fragen ausklammern, solange das Wachstum
gesichert ist. Wer verstehen will, wie die digitale Öffentlichkeit
heute funktioniert, muss dieses Buch lesen.
»Noch vor Kurzem glaubte praktisch niemand
an das Geschäftsmodell oder die sozialen Auswirkungen von YouTube.
Niemand kümmerte sich um seine Parolen. Inzwischen war YouTube, getrieben
von blinder Technologiegläubigkeit, so schnell und in so viele Richtungen
gewachsen – und versuchte dann verzweifelt, die eigene Schöpfung zu
bändigen.« Mark Bergen
Inhaltsverzeichnis:
- Prolog: 15. März 2019 ... 11
Teil I
Kapitel 1: Leute wie du und ich 27
Kapitel 2: Krude und willkürlich 44
Kapitel 3: Zwei Könige 64
Kapitel 4: Die Sturmtruppen 81
Kapitel 5: Clown & Co. 93
Kapitel 6: Die Bardin von Google 112
Kapitel 7: Mit Vollgas voraus 126
Teil II
Kapitel 8: Die Diamantenfabrik 143
Kapitel 9: Nerdfighters 155
Kapitel 10: Kitesurfing TV 165
Kapitel 11: YouTube wird erwachsen 182
Kapitel 12: Wird das Boot dadurch schneller? 195
Kapitel 13: Let’s Play 208
Kapitel 14: Disney Baby Pop-up Pals Ü-Ei
Ostereier Kinderüberraschung 219
Kapitel 15: Die fünf Familien 232
Kapitel 16: Lehn dich einfach zurück 246
Kapitel 17: Die Mutter von Google 255
Teil III
Kapitel 18: Down the ’Tube 269
Kapitel 19: True Fake News 282
Kapitel 20: Unglaublich 294
Kapitel 21: Ein Junge und sein Spielzeug 305
Kapitel 22: Scheinwerferlicht 318
Kapitel 23: Lächerlich, gefährlich, selbstverständlich
333
Kapitel 24: Die Party ist vorbei 348
Kapitel 25: Boykott 360
Kapitel 26: Verstärkung 371
Kapitel 27: Elsagate 387
Kapitel 28: Schlechte Akteure 403
Kapitel 29 : 901 Cherry Avenue 421
Kapitel 30: Bringt den Ozean zum Kochen! 428
Kapitel 31: Die Werkzeuge des Meisters 448
Kapitel 32: Roomba 463
Kapitel 33: Kompromisse 479
Epilog 495
Danksagung 515
Anmerkungen zu den Quellen 519
Anmerkungen 521
Leseprobe:
- "Obwohl YouTube.com schon seit
14 Jahren existierte, war es doch nach wie
vor ein Wunderwerk der modernen Welt. Binnen weniger als zwei
Jahrzehnten hatte sich das blitzschnelle
OnDemand-Internetfernsehen von einer schieren Unmöglichkeit zu einer
simplen Tatsache entwickelt. YouTube war nun der Ort, wo man
sich online kostenlose Videos anschaute.
»Das Video-Baugerüst des Internets«,
nannte es ein Mitarbeiter. Über zwei
Milliarden Menschen besuchten YouTube jeden
Monat. Es war die am zweithäufigsten
aufgerufene Website der Welt (nach Google)
und die zweitbeliebteste Suchmaschine der
Welt (nach Google). 1,7 Milliarden Menschen gingen Mitte
2019 täglich auf YouTubes
Website – das war mehr als ein Drittel aller Internetnutzer weltweit. Ein Besuch auf YouTube bot ihnen Unterhaltung und Informationen und spendete Trost. Umfragen zeigten, dass ein Viertel der Amerikaner ihre Nachrichten über YouTube bezogen. YouTube hatte mehr regelmäßige Besucher als Facebook, Instagram und jede andere Social-Media-Plattform. Eine ganze Generation von Kindern schaute kein Fernsehen mehr, sondern nur noch
YouTube. In vielen Ländern war YouTube das Fernsehen. Regenbogenpresse und Gebrauchsanweisungen bekamen auf YouTube einen neuen Anstrich. Manche besonders progressive Köpfe im Silicon Valley malten sich sogar aus, dass YouTube bald Professoren und Ärztinnen ersetzen würde.
Und im Gegensatz zu praktisch jeder anderen der breiten Masse zugänglichen Website konnte man mit YouTube Geld verdienen. Dieses Novum hatte eine neue Kreativbranche hervorgebracht, einen ganzen Stall voller Entertainer, Persönlichkeiten, Künstlerinnen, Influencer, Dozentinnen und Franchises. In nur wenigen Jahren war so ein neues Medium entstanden, das nicht weniger revolutionär war als seinerzeit Radio und Fernsehen. Dank YouTube konnte nun jeder auf Sendung gehen. "
Bibliographie: Wolkow, Leonid (2022) PUTINLAND DER IMPERIALE WAHN,
DIE RUSSISCHE OPPOSITION UND DIE VERBLENDUNG DES WESTENS. München: Droemer.
Verlags-Info: Putinland Der imperiale Wahn, die russische Opposition und die Verblendung des Westens Was der Westen nicht wissen wollte: die brisante Analyse des »Außenministers der russischen Opposition«
Unter Putin hat sich Russland zu einer imperialistischen Diktatur verwandelt, die die Werte und das Lebensmodell des Westens bedroht. Wie das passiert ist und warum Europa es bis zuletzt ignoriert hat – das analysiert Leonid Wolkow, ein enger Vertrauter des inhaftierten Dissidenten Alexei Nawalny. Anhand persönlicher Erfahrungen im Kampf gegen Korruption und Willkürherrschaft legt er die brutale imperialistische Dynamik in Putins Reich offen und zeigt, was man in Deutschland und Europa nicht wahrhaben wollte. Wer Russland, Putin und den Angriffskrieg gegen die Ukraine verstehen will, kommt an seiner brisanten Analyse nicht vorbei.
Noch zu Beginn der ersten Amtszeit von Wladimir Putin war Russland ein Land bis dahin ungeahnter Möglichkeiten und Entwicklungschancen. Junge Menschen, unter ihnen auch Leonid Wolkow, begannen, sich politisch zu engagieren, forderten Teilhabe und waren bereit, die Zukunft mitzugestalten. Doch Putins Ziel war nie die offene Gesellschaft. Spätestens, als er 2012 seine Rückkehr ins Präsidentenamt verkündete, brach sich der Autoritarismus vom Kreml ausgehend Bahn. Nach der Annexion der Krim, der Zerschlagung der Opposition und dem Giftanschlag auf Alexei Nawalny eskalierte diese Entwicklung 2022 mit dem völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine.
Als Wahlkampfmanager, enger Mitarbeiter und Freund Nawalnys hat Wolkow die Entstehung der russischen Diktatur hautnah miterlebt und war selbst mehrfach inhaftiert. Aus dem Exil heraus analysiert er nun, was in Deutschland und Europa aufgrund wirtschaftlicher Interessen und geopolitischer Naivität geflissentlich ignoriert wurde. Doch trotz aller Gefahr, die von Moskau für die freie Welt ausgeht, so Wolkow: Putins Zeit läuft ab. Und Russlands Zukunft liegt in Europa.
Wolkow ist politischer Direktor der von Alexei Nawalny begründeten Antikorruptionsstiftung FBK. Seit 2009 ist er politisch aktiv, als er für vier Jahre zum Abgeordneten der städtischen Duma von Jekaterinburg gewählt wurde. 2013 leitete er die Kampagne Alexei Nawalnys bei der Moskauer Bürgermeisterwahl und 2018 als Stabschef dessen Präsidentschaftswahlkampf. Seit 2019 lebt er in Litauen.
Inhaltsverzeichnis:
- Einführung 9
Russlands »wilde Neunziger« 17
Die Errichtung der Machtvertikale 29
Widerstandsgeist und Protestbewegung 39
Bürgermeisterwahl in Moskau 57
Nach der Annexion der Krim 72
Nawalnys Präsidentschaftswahlkampf 78
Die Schlagkraft vernetzter Opposition 98
Der Giftanschlag 116
Russland überfällt die Ukraine 128
Medienmacht und Meinungsbildung 140
Angriffsziel Internet 151
Andersdenken verboten 164
Putins Oligarchen 178
Wir gehören zu Europa 195
Nach Putin: Szenarien und Hoffnungen 203
Dank 225
- "Über eines bin ich mir ganz sicher: dass der Putinismus Putin
nicht überleben wird. Das System, das Putin errichtet hat, kann er
niemandem vererben, es ist absolut personalisiert. Es basiert, wie ich
gezeigt habe, auf einem komplizierten Gefüge persönlicher Absprachen
und gegenseitiger Verpflichtungen, die Putin und die Schlüsselfiguren
seiner Gefolgschaft fest mit- [>204] einander verkettet – Absprachen
und Verpflichtungen, die in dem Moment, da Putin nicht mehr ist, null und
nichtig werden. Wir haben außerdem gesehen, dass es niemanden aus
Putins Umkreis gibt und niemanden geben kann, der sein politisches Erbe
antreten könnte. Wenn Putin einmal abtritt, wird er einen Scherbenhaufen
hinterlassen. Der Umbau des Systems wird Jahre eines inneren Kampfes erfordern.
Dann beginnt ein Streit um die Fleischtöpfe, ein Krieg jeder gegen
jeden, in dem nur einer überleben wird. Ein anderes System der Thronfolge
kennt Putins System nicht."
Bibliographie: SCHERER, Klaus (2022) KUGEL INS HIRN Lügen, Hass und Hetze im Netz bedrohen die Gesellschaft Unterwegs mit Strafverfolgern. München: Droemer.
Verlags-Info: Wie Staatsanwältinnen, Richter, Polizistinnen und verdeckte Ermittler rechten Hetzern auf die Spur kommen: der Kampf gegen Hassrede im Internet als packende, detailreiche Polizei-Reportage. Das Internet ist voller Hass. Wie aus dem Nichts stürzen sich Hetzer auf ihre Opfer, diffamieren und bedrohen sie. Doch der digitale ist kein rechtsfreier Raum mehr. 2021 trat das Gesetz gegen Hass-Kriminalität im Internet in Kraft. Seitdem verfügen Justiz und Strafverfolger über Werkzeuge, um Hassredner zur Rechenschaft zu ziehen. Dank bester Zugänge begleitet NDR-Sonderreporter Klaus Scherer Fahnder, Verfassungsschützer und Ankläger im Einsatz. Er trifft Täter, die Parlamentarier als »Abschaum« verhöhnen und »ins KZ stecken« wollen, und sieht bei ihren Hausdurchsuchungen zu. Er spricht mit netten Nachbarn, die zugleich Hasstiraden posten, und mit ihren Opfern. Und mit Politikern, denen er vorhält, ihr eigenes Gesetz zu unterlaufen. So führt diese fesselnde True-Crime-Reportage sowohl in den Abgrund rechter Mobilmachung als auch darüber hinaus.
Inhaltsverzeichnis:
- Einleitung
Für einen Perspektivwechsel Unterwegs mit Strafverfolgern 9
1 Sachsens Rekordschreiber Das Gesetz gegen Hass im Netz zeigt Wirkung 35
2 Wenn der Anwalt selber hetzt Milieubesuch in Chemnitz 25
3 »Dem ne Kugel ins Hirn« Staatsanwältin gegen Richterin 45
4 Juden, Schwule, Fremde, Frauen Fallbeispiele aus Niedersachsen 53
5 Baerbock im Zielfernrohr Gerichtstermin in Peine 61
6 Vom guten Handwerker und bösen Hacker Der singende Maler von Einbeck 71
7 Extrem digital Schockkunst im Emsland 84
8 Bin ich jetzt ein Denunziant? Zeugen in der Klemme 93
9 »Hättest am Krebs verrecken sollen« Bürgerportal am Limit 103
10 Die Müll-Abräumer Medienjob Community Management 111
11 Jenseits von Idar-Oberstein Bei V-Leuten in Rheinland-Pfalz 128
12 Der Fall Schäuble Ermittler vor Hindernissen 140
13 Nette Nazis von nebenan? Zaungast in Celle 157
14 Ignorieren war gestern Die Hinrichtungen der Claudia Roth 167
15 Kugel ist Kugel Finale am Landgericht 176
16 Trumps Trickkiste Lehrstunden in Amerika 185
Ausblick
Justiz in Bewegung
Grenzziehungen 197
Dank 211
Quellen 215
- Falsche Maßstäbe
In den Monaten, in denen dieses Buch entstand, haben die ausgewählten Strafverfolger und Ankläger von Hass- und Hetzkriminalität sich vor Gerichten also weithin durchgesetzt. Signalwirkung ging zudem vom Bundesverfassungsgericht aus, das der klageführenden Politikerin Renate Künast recht gab in ihrem Streit mit nachgeordneten Gerichten, die lange die Urheber von Hassbotschaften geschützt hatten.
In seltener Klarheit warfen die Karlsruher Richter diesen Urteilen nun »Fehlverständnis« und »falsche Maßstäbe« vor. Niemand müsse sich Beleidigungen wie »Stück Scheisse« und
»Drecks Fotze« gefallen lassen, auch nicht als Politikerin und auch nicht, wenn die Tatbestände, ähnlich wie im Falle unseres Bersenbrücker »Kugel ins Hirn«-Kommentars, als Reaktion auf gefälschte Beiträge verfasst worden seien.
Auch die Verbindung des NS-Judensterns mit der Inschrift »Nicht geimpft«, die vor allem in der »Querdenker«-Szene [>199] verbreitet war und die von der Göttinger Staatsanwaltschaft
von Beginn an als Straftat angesehen wurde, bringen Strafverfolger mittlerweile bundesweit als Holocaust-Verharmlosung und folglich als Volksverhetzung zur Anklage.
Als wegweisend könnte sich auch ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln erweisen, das den Tatbestand der Volksverhetzung auch auf Online-Hetze gegen Frauen anwandte und
etwa den Kommentar »Weiber sind Menschen zweiter Klasse« entsprechend unter Strafe stellte. Zu ersten Anzeichen, dass auch in diesem Bereich »Gerichte endlich entschiedener
handeln«, zählt die Süddeutsche Zeitung zudem Schmerzensgeld-Urteile bis zu 10 000 Euro in Fällen von »sexualisierter Beleidigung«.
Das öffentliche Bewusstsein, dass niemand mehr das Netz als rechtsfreien Raum begreifen sollte, ist also zweifellos gewachsen. Wenn es stimmt, was uns die Strafverfolger anfangs
sagten, haben allein schon die Berichte über die zunehmende Zahl von Ermittlungsverfahren und über aufsehenerregende Urteile mehr Prävention bewirkt als alle Strafbefehle zuvor, von denen niemand außer den Beschuldigten erfuhr.
- »Klaus Scherers Buch ist eine Ermutigung.« – Titel, Thesen,
Temperamente (ARD)
»Hass, Hetze und Lügen im Netz sind Kriegserklärungen. Der Rechtsstaat, die Demokratie sind nicht wehrlos. Doch wir alle müssen es wollen.« – Kulturzeit, 3Sat
»Klaus Scherer ist ein leidenschaftlicher Reporter. Und er ist ein wunderbarer Erzähler.« – Ulrich Wickert
»Klaus ist das, was man einen großen Erzähler nennt. Er hat einen wunderbaren Blick für Menschen und deren Geschichten.« – Anne Will
Klaus Scherer ist Bestseller-Autor und prämierter TV-Journalist, er erhielt u.a. den Deutschen Fernsehpreis, den Grimme-Preis und den Hollywood Independent Documentary Award.
Geprägt von seiner Zeit als Korrespondent in den USA plädiert er in seinem neuen Sachbuch für einen routinierten Rechtsstaat.
»Eindrucksvoll.« – Süddeutsche Zeitung
»Eindrücklich. Sehenswert.« – Redaktionsnetzwerk Deutschland
»Sehenswerte Dokumentation.« – Weserkurier
Der Film wurde mehrfach international ausgezeichnet.
Bibliographie: Pretis, Manfred (2022, Hrsg.) ICF-basierte Gutachten erstellen. Entwicklung im interdisziplinären Team. München: Reinhardt.
Bischof, Norbert (2020) Moral. Ihre Natur, ihre Dynamik und ihr Schatten. Buchreihe: Forum Psychosozial Verlag: Psychosozial-Verlag. 724 Seiten, Broschur, 148 x 210 mm. Erschienen im Juni 2020. ISBN-13: 978-3-8379-2957-7.
- Verlags-Info: "Die Moral stellt für eine evolutionäre Anthropologie
die anspruchsvollste Herausforderung dar, denn sie gilt als gesellschaftlicher
Gegenpol der menschlichen Natur. Norbert Bischof zeigt jedoch, dass sie
selbst tief in der Natur wurzelt und deren Ambivalenz nicht aufhebt, sondern
teilt. Gut und Böse gebärden sich als Antipoden und sind doch
nur zwei Seiten derselben Sache. Anstatt die Moral zu idealisieren, beschäftigt
sich der Autor empirisch mit der Psychodynamik der Mechanismen, die ihr
zugrunde liegen. Dabei kann es nicht ausbleiben, dass unbequeme Fragen
aufgeworfen, politisch korrekte Antworten problematisiert, Tabus infrage
gestellt werden und dass dort, wo das Undenkbare sich abzeichnet, die Augen
geöffnet bleiben.
Dies ist der dritte Teil einer Trilogie, in der Norbert Bischof seinen Beitrag zur psychologischen Grundlagenforschung in Sachbuchform dargestellt hat. Während im ersten Buch (Das Rätsel Ödipus) die vergleichend-ethologischen Fundamente einer Systemtheorie der Motivdynamik gelegt wurden und das zweite (Das Kraftfeld der Mythen) die Persönlichkeitsentwicklung anhand ihres Widerscheins in den Bildern kultureller Weltdeutung analysiert, geht es hier um die Frage nach der Entstehung und dem Stellenwert des normativen Überbaus menschlicher Verhaltensorganisation."
Nehring, Christopher (2022) Geheimdienst Morde. Wenn Staaten töten - Hintergründe, Motive, Methoden. München: Heyne. > Verlagsinfo.
Ein wichtiges Buch, das zeigt, dass politische Morde im Auftrag von Regierungen "normal" sind.
Shum, Desmond (2022) Chinesisches Roulette. Ein Exmitglied der roten Milliardärskaste packt aus. München: Droemer.
Verlagsinfo: "Ein Ex-Mitglied der roten Milliardärskaste packt aus. Der brisante Insiderbericht aus Chinas Elite. Übersetzt von: Stephan Gebauer. Das Buch, von dem die chinesische Regierung nicht will, dass wir es lesen: Money, Macht und Willkür in China
Leseprobe: "Am 5. September 2017 verschwand die fünfzigjährige Whitney Duan in Beijing. Zum letzten Mal gesehen worden war sie am Vortag in ihrem weitläufigen Büro im Genesis Beijing, einem Gebäudekomplex im Wert von mehr als 2,5 Milliarden Dollar, den sie gemeinsam mit mir gebaut hatte. Dort hatte sich Whitney in einem Arbeitsbereich, den Besucher erst erreichen, nachdem sie eine Reihe von Sicherheitskontrollen passiert und sich in einem Labyrinth aus gepflegten Gärten und zahlreichen Varianten von italienischem Marmor zurechtgefunden haben, Immobilienprojekte im Wert von Milliarden Dollar ausgedacht. Und jetzt war sie plötzlich fort.
Was war geschehen? Und wer ist Whitney Duan?
Whitney Duan war mehr als ein Jahrzehnt lang meine Frau und Geschäftspartnerin. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens waren wir geschieden, aber wir hatten viele Jahre eng zusammengearbeitet, wir waren Vertraute, und gemeinsam hatten wir eine atemberaubende Zeit erlebt. Wir hatten unseren Traum verwirklicht, in China große Dinge für China zu leisten. Wir waren beide aus der Armut aufgestiegen und wurden von der Sehnsucht angetrieben, etwas aus unserem Leben zu machen. Unser Erfolg erfüllte uns mit Ehrfurcht.
Wir hatten am Beijing Capital International Airport eine der größten Logistikdrehscheiben der Welt errichtet. Wir hatten das spektakulärste Hotel- und Geschäftszentrum in der chinesischen Hauptstadt entworfen und gebaut, das sich in erstklassiger Lage unweit des geschäftigen Stadtzentrums erhob. Wir hatten Hunderte Millionen Dollar mit Aktiengeschäften verdient. Wir hatten im Machtzentrum des Landes gearbeitet und gute Beziehungen zu [>] Ministerpräsidenten, hochrangigen Funktionären der Kommunistischen Partei und ihren Familien geknüpft. Wir hatten aufstrebende Parteikader beraten, die sich anschickten, die Kontrolle über ganz China zu übernehmen. Wir hatten auf soziale und politische Veränderungen gedrängt, um China zu einem besseren Land zu machen. Wir waren überzeugt, dass wir Gutes tun konnten, indem wir unsere Arbeit gut machten. Wir hatten es uns durchgerechnet: Wir hatten ein Nettovermögen von mehreren Milliarden angehäuft.
Und jetzt war Whitney verschwunden. Von meinem Wohnort in England aus kontaktierte ich ihre Haushälterin, die mir erklärte, dass Whitney an jenem Septembertag im Jahr 2017 nicht nach Hause gekommen war und dass sie seitdem nichts von ihr gehört hatte. Es war, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. ... "
Bewertung: Ein ebenso hochinteressanter wie abstoßender Insiderbericht über ein durch und durch perverses angeblich kommunistisches System, das eine große Gefahr für humanistisch und freiheitlich orientierte Gesellschaften ist.
Bibliographie: Wildt, Bert te & Schiele, Timo (2021) Burn on. Immer kurz vorm burn out. Das unbekannte Leiden und was dagegen hilft. München: Droemer.
Verlags-Info: "Burn On: Immer kurz vorm Burn Out. Das unerkannte Leiden und was dagegen hilft (Verdeckte Depressionen erkennen, behandeln und loswerden; Psychologie-Ratgeber zur Selbstheilung)
»Permanent gestresst und erschöpft zu sein gehört längst zum guten Ton. Das geschäftige Ausgebranntsein ist zur allgemeinen Betriebstemperatur geworden.« Prof. Dr. Bert te Wildt und Timo Schiele
Ein Leiden, über das noch niemand spricht
Ein gesellschaftlicher Weckruf
Direkte Hilfe für alle Betroffenen
Zwar wissen wir alle um die Gefahren eines Burn Outs, doch grassiert längst eine neuartige Störung, deren negative Konsequenzen häufig unerkannt bleiben: der Burn On. Während uns diese chronische Erschöpfungsdepression immer weiter »funktionieren« lässt, raubt sie uns jegliche Lebensenergie.
Die renommierten Experten Prof. Dr. Bert te Wildt und Timo Schiele beschreiben erstmals das Burn-On-Syndrom, bei dem es trotz hohen Leidensdrucks nicht mehr zum Zusammenbruch, wohl aber zu gravierenden seelischen und körperlichen Folgen kommt.
Ihr Buch bietet konkrete Hilfe für Betroffene und ist ein gesellschaftlich dringend notwendiger Weckruf."
Inhaltsverzeichnis: In der Leseprobe auf der Verlagshomepage.
Leseprobe: Leseprobe auf der Verlagshomepage bis Seite 30: Die Geschichte krankhafter Erschöpfung.
LP1 S. 41: "Die Daueranspannung und der Zusammenbruch: die Abgrenzung des Burn On vom Burn Out
Was ein Burn Out ist, das meinen wir wohl alle verstanden zu haben. Die Medien warnen, ja, es ist auch Thema in Schule und Büro. Landläufig wird ein Burn Out am ehesten als Vorläufer einer entstehenden oder als eine Erschöpfungsdepression selbst betrachtet. Aus unserer Sicht steht der Burn Out für eine akute und fulminante Form der Erschöpfungsdepression. Ein Burn-On-Syndrom ist im Gegensatz dazu die chronische Form der Erschöpfungsdepression, die bislang individuell und kollektiv im Verborgenen geblieben ist."
LP2 S. 95: "Das Burn-On-Syndrom kann als eine arbeitsbezogene Störung definiert werden, bei der es durch eine kontinuierliche Stressbelastung zu einer chronischen Erschöpfung mit charakteristischen Symptomen kommt, die sich aus dem Spannungsfeld widersprüchlicher Emotionen und Impulse ergeben. Für die Diagnose eines Burn On schlagen wir vor, dass alle drei folgenden Kriterien über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erfüllt sein müssen:
1. Auf der Verhaltensebene verselbstständigt sich für Arbeitsprozesse ein geschäftiger Aktionismus, während es bei aufschiebbaren alltäglichen Aufgaben zunehmend zu einer Handlungslähmung kommt.
2. Auf der emotionalen Ebene zeigt sich vordergründig ein angestrengter Positivismus, der im Widerspruch zu einer tatsächlich erlebten Freudlosigkeit steht.
3. Auf der kognitiven Ebene dominiert ein Perfektionismus, der einem tief empfundenen Unzulänglichkeitserleben kompensatorisch gegenübersteht."
Autoren (Verlagsinfo): "Prof. Dr. med. Bert te Wildt ist Chefarzt der Psychosomatischen Klinik im Kloster Dießen am Ammersee. Zuletzt war er als Leiter der Ambulanz am LWL-Universitätsklinikum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Ruhr-Universität Bochum tätig. Seine klinischen und wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen im Bereich der Verhaltenssüchte, insbesondere der Internetabhängigkeit sowie der Nutzung digitaler Technologien in der Psychotherapie. 2015 erschien im Droemer Verlag sein Buch „Digital Junkies. Internetabhängigkeit und ihre Folgen für uns und unsere Kinder“.
Timo Schiele ist leitender Psychologe der Psychosomatischen Klinik im Kloster Dießen am Ammersee. Zuvor war er am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München sowie einer Psychosomatischen Klinik am Starnberger See tätig. Zuletzt arbeitete er in der psychosomatischen Tagesklinik München mit den Schwerpunkten Depressions- und Essstörungsbehandlung. Seit 2018 ist er als Dozent in der Ausbildung von Psychologischen Psychotherapeuten im Bereich kognitive Verhaltenstherapie tätig."
Bewertung: Für die Proklamation einer neuen Störung von Krankheitswert, wäre bei einem knapp 300 Seiten Buch eine ICD analoge gründliche und operationale Kriterologie zu erwarten. "Dem Leiden einen Namen geben" (S. 95) ist zu wenig.
Bibliographie: Günther, Mari; Teren, Kirsten; Wolf, Gisela (2021) Psychotherapeutische Arbeit mit trans*Personen. Handbuch für die Gesundheitsversorgung. München: Reinhardt.
Verlags-Info: "Wie können trans* Personen vor, während und nach ihrer Transition respektvoll und kompetent im Gesundheitssystem beraten und in der Psychotherapie begleitet werden? Durch die Vielfalt von Genderidentitäten, -ausdrucksweisen und Erfahrungen der Behandlungssuchenden treffen TherapeutInnen auf ein großes Spektrum von Bedürfnissen, denen sie nur unvoreingenommen gerecht werden können. Dieses Buch hilft bei diesen Anforderungen, indem es die psychosozialen und medizinischen Grundlagen darstellt. LeserInnen bekommen nicht nur einen Überblick über die aktuellen Versorgungsstandards und -möglichkeiten im Bereich der Psychotherapie bei Transsexualität. Das Buch rückt auch die Perspektiven unterschiedlichster Trans*Lebensweisen in den Vordergrund, sodass ein Dialog auf Augenhöhe möglich wird.
Neu in der 2. Auflage: Eine kritische Rezeption der MDS-Begutachtungsanleitung 2020 mit ihren Folgen für die Versorgung von trans* Personen."
Inhaltsverzeichnis: PDF auf der Verlagsseite.
Leseprobe: PDF auf der Verlagsseite.
Autorinnen: "Dipl-Gemeindepäd. Mari Günther, arbeitet als Systemische Therapeutin in eigener Praxis, in der Trans* Beratung und beim Bundesverband Trans* e, V. Dr. Kirsten Teren und Dr. Gisela Wolf sind als Psychologische Psychotherapeutinnen in freier Praxis tätig. Die drei Autor_ innen (alle Berlin) verbindet neben ihrer praktischen Arbeit die Zugehörigkeit zu queeren Comunitys."
Bewertung: Ein wichtiges, gründliches, hilfreiches und orientierendes Werk zum Thema *trans.
Anmerkung queere Community: Wikipedia (Abruf 19.05.2021): "Das Adjektiv queer (['kw??(?)]) ist ein Anglizismus und bezeichnet Personen, Handlungen oder Dinge, die durch den Ausdruck einer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität von der gesellschaftlichen Cisgender-Heteronormativität abweichen. Früher wurde die Bezeichnung queer im Sinne von „sonderbar, eigenartig, suspekt“ verwendet, um Homosexuelle abzuwerten (siehe Homophobie). Seit Mitte der 1990er-Jahre wird queer als ins Positive gewendete Selbstbezeichnung nicht-heterosexueller Menschen gebraucht."
Bibliographie: Ebert, Theodor (2021) Widerworte. Zwischenrufe zu Politik und Religionskritik. Aschaffenburg: Alibri.
Verlags-Info: "Der Einfluss der Religionsgesellschaften in Deutschland geht weit über den Bereich hinaus, in dem ihnen ein nachvollziehbares Interesse zugestanden werden muss. Der besondere Zugang zum Gesetzgebungsprozess wäre hier ebenso zu nennen wie die im Vergleich zu anderen zivilgesellschaftlichen Kräften bevorzugte Berücksichtigung bei der Besetzung öffentlicher Gremien wie beispielsweise dem Ethikrat. Gleichzeitig wird die starke Präsenz kirchlicher Positionen in ethische Fragen betreffenden Diskursen und die dabei vertretenen Positionen von wissenschaftlicher Seite nur selten kritisiert.Die acht Texte dieses Bandes bieten kritische Detailansichten dieses Zustands.
Inhaltsverzeichnis:
- Vorbemerkung 7
Wie deutsche Bischöfe in der Bundespolitik mitmischen Eine kritische Rezension zur Erklärung der deutschen Bischöfe zur Bundestagswahl 1965 9
Von der Euthanasie zum Mord?
Eine logisch-philologische Analyse des Kinsauer Manifestes 19
Ernst-Wolfgang Böckenforde - Ein Mann und sein Dictum
Von einem, der auszog, justizpolitisch Karriere zu machen 37
Der Deutsche Ethikrat. Eine Besichtigung 63
Eine Geschichte des europäischen Atheismus
Zur Neuauflage von Fritz Mauthners Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande 73
Sag mir, wie hältst Du es mit dem Plagiat?
Von Elisabeth Ströker zu Annette Schavan.
Nebst einigen Forderungen an den deutschen Wissenschaftsbetrieb 93
Ein deutscher Intellektueller und ein Kardinal
Jürgen Habermas im Gespäch mit Joseph Ratzinger über „Vorpolitische moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates“ 109
Mein Tod gehört mir
Uwe-Christian Arnold: Letzte Hilfe.
Ein Plädoyer für das selbstbestimmte Sterben 153
"Vorbemerkung Die acht Texte, die in diesem Band versammelt sind, lässt man den ersten und ältesten einmal außen vor, stammen aus einem Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren. Der rote Faden, der sie alle zusammenhält, ist die kritische Auseinandersetzung mit dem Machtanspruch der Religionsgesellschaften in Deutschland. Dabei geht es zum einen um die Kritik an Personen, die sich in ihrem Berufsfeld oder allgemein in der Öffentlichkeit für den Einfluss dieser Organisationen stark machen, zum anderen die Vorstellung von Personen, die sich diesem Einfluss entgegenstellen. Zu den politisch ungesundesten Erscheinungen in Deutschland gehört zweifelsohne der Einfluss der Kirchen auf die Politik. Er wirkt sich nicht nur in der Gesetzgebung aus, sondern auch in einer Reihe anderer Gebiete: Dazu gehört nicht zuletzt die finanzielle Förderung der Kirchen und der ihnen zugehörigen Organisationen mit staatlichen Mitteln. All das in einem Staatswesen, für das die Trennung von Staat und Kirche verfassungsrechtlich vorgesehen ist. Dass die Kirchen dabei von der Schwächung, ja der Zerstörung fortschrittlicher Organisationen im Dritten Reich durch die Nationalsozialisten recht schamlos profitieren konnten, macht ihren Einfluss im Nachkriegsdeutschland nur noch ärgerlicher. Dabei hat gerade die Aufdeckung von Missbrauchsfällen, für die Geistliche der christlichen Kirchen verantwortlich waren und deren Ausmaß erst in der letzten Zeit deutlich geworden ist, den moralischen Kredit der Kirchen gründlich zerstört und wohl auch zu der zunehmenden Austrittsbewegung aus den Kirchen beigetragen, auch wenn die abnehmende Mitgliederzahl der Kirchen keineswegs schon zu einem abnehmenden Einfluss der Kirchen in der Politik geführt hat. Die Unverfrorenheit, mit der die Kirchen, die katholische wie auch die protestantische, ihre Privilegien, insbesondere auch finanzieller Art, verteidigen und zum Teil sogar nach der Wiedervereinigung noch ausgebaut haben, kann einem bei unvoreingenommener Betrachtung nur erstaunlich erscheinen, um härtere Charakterisierungen zu vermeiden.
Wenn die Veröffentlichung der hier zusammengestellten Texte einen kleinen Beitrag zur Änderung dieser Umstände leisten kann, hätte sie ihren Zweck erfüllt. Für die Möglichkeit, diese Textsammlung im Alibri Verlag zu publizieren, danke ich dem Verlag und dem Verleger, meinem Freund Gunnar Schedel, ganz herzlich. Erlangen, im März 2021 Theodor Ebert"
Autor: "Theodor Ebert, geboren 1939, lehrte bis zu seiner Pensionierung Philosophie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er hat vor allem zur Philosophie der griechischen Antike und der Neuzeit publiziert."
Bewertung: Durch und durch lesenswert - nicht nur für Atheisten, Agnostiker und Freigeister.
Bibliographie: Urner, Maren (2021) Raus aus der ewigen Dauerkrise. Mit dem Denken von morgen die Probleme von heute lösen. München: Droemer.
Verlags-Info: "Psychologie als Gesellschaftspolitik: Wir müssen unser Denken und unsere Denkmuster ändern, um die Krisen unserer Zeit zu meistern, fordert Maren Urner, Professorin für Medien-Psychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) in Köln.
Nach ihrem Bestseller „Schluss mit dem täglichen Weltuntergang“ präsentiert die Kognitions- und Neurowissenschaftlerin Maren Urner in ihrem neuen Buch Methoden, die uns helfen, gesellschaftliche und persönliche Krisen zu meistern, indem wir unsere Denkmuster ändern und unser Denken neu ausrichten.
Krisen haben Konjunktur - unser Alltag ist vielfach geprägt von persönlichen Herausforderungen (Privates und Berufliches unter einen Hut bringen, Gutes tun, immer up to date sein ...) und gesellschaftlichen Problemen (Klima-Krise, Corona-Krise, Finanz-Krise, Wirtschafts-Krise, Rechtspopulismus).
Wie treffen wir hier die richtigen Entscheidungen?
Wir kriegen wir es hin, Gutes zu tun und uns dabei gut zu fühlen?
Die gewohnten Rezepte und Denkmuster sind überholt und funktionieren in Zeiten wie diesen nicht mehr, sagt Maren Urner. Folgen wir unseren biologischen Mustern wie Sicherheitsstreben, Kosten-Nutzen-Analysen und Lager-Denken, ist der Misserfolg vorprogrammiert.
Diesem "statischen" Denken setzt Maren Urner ein Modell des "dynamischen" Denkens entgegen, das sie aus neuen Erkenntnissen der neurowissenschaftlichen und psychologischen Forschung entwickelt. Es braucht Neugier, Mut und Verstehen, um unsere Denkmuster zu ändern und die Herausforderungen und Probleme kreativ und lösungsorientiert angehen zu können - das ist der einzige Weg aus der Dauer-Krise. Er führt zu einem nachhaltigen Leben, das von Kooperation, Sinnstiftung und positiven Beziehungen bestimmt ist, so Maren Urner."
Inhaltsverzeichnis: Verlags-Seite.
Leseprobe: Verlags-Seite. Und: Am wichtigsten sind gute soziale Beziehungen, so S. 194: "Seit 1938 läuft an der Harvard University die längste Studie zu der Frage, was ein glückliches und gesundes Leben ausmacht.15 Ihr wichtigstes Ergebnis lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Nicht Ruhm, nicht Geld, nicht der IQ und nicht unsere Gene sind der wichtigste Faktor, sondern gute menschliche Beziehungen.
Anders gefragt: Was unterscheidet sehr glückliche Menschen von den weniger glücklichen Menschen? Antwort: Sie verbringen mehr Zeit mit anderen Menschen. In ihrer berühmten Studie »Very Happy People«16 zeigten die beiden US-amerikanischen Psychologen Martin Seligman17 und Ed Diener genau das. Die obersten 10 Prozent mit Blick auf das langfristige Glücksempfinden waren im Vergleich zu durchschnittlich glücklichen und unglücklichen Menschen nicht sportlicher, nicht religiöser und erlebten nicht mehr Gutes. Keiner der zahlreichen untersuchten Faktoren war ausreichend, um »Glück« zu generieren, aber ein Faktor war notwendig: gute soziale Beziehungen."
Autorin: "Prof. Dr. Maren Urner ist Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) in Köln. Nach dem Studium der Kognitions- und Neurowissenschaften in Deutschland, Kanada und den Niederlanden wurde sie am University College London in Neurowissenschaften promoviert. 2016 gründete sie Perspective Daily mit, das erste werbefreie Online-Magazin für Konstruktiven Journalismus. Seit ihrem Bestseller "Schluss mit dem täglichen Weltuntergang" (2019 bei Droemer erschienen) ist sie eine viel gefragte Keynote-Speakerin und Interviewpartnerin für TV, Radio und Podcast.
https://twitter.com/PositiveMaren
https://www.facebook.com/maren.urner"
Bewertung: Ein interessantes und hilfreiches Buch, das zur konstruktiven Veränderung mit dem Werkzeug lösungsorientiertes Denkens anregt.
Bibliographie: Nguyen-Kim, Mai
Thi (2021) Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Wahr, falsch, plausibel.
Die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. München:
Droemer.
Verlags-Info: "Die bekannte Wissenschaftsjournalistin
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim untersucht mit analytischem Scharfsinn und unbestechlicher
Logik brennende Streitfragen unserer Gesellschaft. Mit Fakten und wissenschaftlichen
Erkenntnissen kontert sie Halbwahrheiten, Fakes und Verschwörungsmythen
– und zeigt, wo wir uns mangels Beweisen noch zurecht munter streiten dürfen.
Themen:
Die Legalisierung von Drogen, Videospiele, Gewalt, Gender Pay Gap,
systemrelevante Berufe, Care-Arbeit, Lohngerechtigkeit, Big Pharma vs.
Alternative Medizin, Homöopathie, klinische Studien, Impfpflicht,
die Erblichkeit von Intelligenz, Gene vs. Umwelt, männliche und weibliche
Gehirne, Tierversuche und von Corona bis Klimawandel: Wie politisch darf
Wissenschaft sein?
Fakten, wissenschaftlich fundiert und eindeutig belegt, sind Gold wert.
Gerade dann, wenn in Gesellschaft und Politik über Reizthemen hitzig
gestritten wird, braucht es einen Faktencheck, um die Dinge klarzustellen
und Irrtümer und Fakes aus der Welt schaffen. Leider aber werden Fakten
oft verkürzt, missverständlich präsentiert oder gerne auch
mit subjektiver Meinung wild gemischt. Ein sachlicher Diskurs? Nicht mehr
möglich. Dr. Mai Thi Nguyen-Kim räumt bei den derzeit beliebtesten
Streitthemen mit diesem Missstand auf.
Bestechend klarsichtig, wunderbar unaufgeregt und herrlich kurzweilig
ermittelt sie anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse das, was faktisch
niemand in Abrede stellen kann, wenn es beispielsweise um Erblichkeit von
Intelligenz, Gender Pay Gap, Klimawandel oder Legalisierung von Drogen
geht. Mai Thi Nguyen-Kims Suche nach dem Kern der Wahrheit zeigt dabei
nicht nur, was unanfechtbar ist und worauf wir uns alle einigen können.
Mehr noch: Sie macht deutlich, wo die Fakten aufhören, wo Zahlen und
wissenschaftliche Belege fehlen – wo wir also völlig berechtigt uns
gegenseitig persönliche Meinungen an den Kopf werfen dürfen.
Ein spannender und informativer Fakten- und Reality-Check, der beste
Bullshit-Detektor für unsere angeblich postfaktische Zeit.
Inhaltsverzeichnis:
- Vorwort 11
KAPITEL 1 DIE LEGALISIERUNG VON DROGEN: KEINE MACHT DEN PAUSCHALISIERUNGEN
15
Cannabis ist kein Brokkoli, aber Ecstasy ist auch kein Pferde¬reiten
16 · Methoden, Methoden, Methoden 2D · Kein Alkohol ist auch
keine Lösung 23 · Der Fall Portugal 28 · Die Teufligkeit
steckt im Detail 34 · Alle Drogen sind schon da 38 · Lieber
fehlerhaft als gar keine Wissenschaft? 45
KAPITEL 2 VIDEOSPIELE UND GEWALT: VIEL »NOISEBLAST« UN NICHTS
48
Psychologie in (k)einer Krise: Das umstrittene Reproduzier-barkeitsproblem
52 · Puzzle für Fortgeschrittene: Warum Aggressionsforschung
besonders kompliziert ist 56 · Wer sucht, der findet: Das signifikante
Problem mit dem p-Hacking 69 · Auf die Größe kommt es
an 76 · Meta-Krieg um einen Hauch von nichts 77 · Die verlockende
Suche nach einfachen Antworten 83
KAPITEL 3 GENDER PAY GAP: DIE UNERKLÄRLICHEN UNTERSCHIEDE ZWISCHEN
MÄNNERN UND FRAUEN 89
Wie rein darf’s sein? - Warum es für den Gender Pay Gap unter-schiedliche
Zahlen gibt 91 · Die unerklärliche Lücke: Warum der bereinigte
Gender Pay Gap nicht automatisch eine »Diskriminierungs-lücke«
ist 95 · Der (un)faire erklärte Rest 97 · Der dynamische
Gender Pay Gap 99 · Gewollt, aber nichtgekonnt? 103 · Who
cares? 106 · Systemrelevant 8t verkannt 107
KAPITEL 4 BIG PHARMA VS. ALTERNATIVE MEDIZIN: EIN UNGESUNDER DOPPELSTANDARD
114
Zwischen gesunder Skepsis und Verschwörungsmythen: Genaue Lupen
für alle!! 117 · Der Markt regelt das! Nicht. 122 ·
Wirksamkeit ist das, was du draus machst 128 · All die geheimen
Wundermittel· Der Mythos der unterdrückten Heilmittel 139 ·
Kurkuma - ein schmerz¬haftes Multi-Hit-Wonder 141 · Mir hat's
aber geholfen: Warum der Placeboeffekt Falle und Hoffnung zugleich ist
146 · Lasst uns reden: Die Kraft der sprechenden Medizin 153 ·
Die unbequeme Wahrheit: Der Fall Hevert 156 · Schadet ja nicht?
Fünf Geschichten 158 · Ergänzend, nicht ersetzend 162
KAPITEL 5 WIE SICHER SIND IMPFUNGEN? GETRÜBTE RISIKOFREUDE 169
There's no glory in prevention 170 · Lasst die Impfgegner in
Ruhe! 175 · Die Schweinegrippe und Narkolepsie 180 · No risk,
no Zulassung: Warum sich seltene Nebenwirkungen immer erst nach der Zulassung
zeigen 189 · Vernunft ist keine Bürgerpflicht. Schade eigentlich
197
KAPITEL 6 DIE ERBLICHKEIT VON INTELLIGENZ: WARUM DIE ANZAHL UNSERER
FINGER WENIGER ERBLICH IST ALS DAS ERGEBNIS EINES IQ-TESTS 200
Ein doppeltes Missverständnis 201 · Was ist Intelligenz?
205 · Drei Gesetze für die Genetik komplexer Persönlichkeitseigenschaften
217 » Die Anzahl unserer Finger ist kaum erblich: Was Erblichkeit
bedeutet - und vor allem, was nicht 221 · Woher weiß man,
wie groß die Erblichkeit ist? 230 · Die große Matschepampe
aus Genen und Umwelt 232 · Epigenetik: Die Wissenschaft hinter weiblichen
und männlichen Schildkröten 235 · Zeig mir deine Gene,
und ich sage dir, wie schlau du bist? 238 · Gute und schlechte Gründe
für IQ-Tests 243
KAPITEL 7 WARUM DENKEN FRAUEN UND MÄNNER UNTERSCHIEDLICH? ACHTUNG,
DIESES KAPITEL VERÄNDERT DEIN GEHIRN
Ähnlicher oder verschiedener als gedacht? 248 · Dieser
Abschnitt verändert dein Gehirn - denk mal drüber nach 253 ·
Auf der Suche nach Unterschieden: Verschieden vernetzt 260 · Was
Unterschiede im Gehirn bedeuten: Zeig mir dein Gehirn, und ich sag dir
nicht, was du denkst 262 · Spektrum oder Mosaik? Über Gehirne
und Affengesichter 272 · Warum eigentlich? 277
KAPITEL 8 SIND TIERVERSUCHE ETHISCH VERTRETBAR? DER ZUG BLEIBT NICHT
STEHEN
Emotional· Bilder von Stella 283 · Irrational: Von Hunden,
Lämmern und Schweinen 285 · Müssen Tierversuche wirklich
sein? - IN MICE. Just saying 288 · Kosten vs. Nutzen: Warum eine
Abwägung schwerer ist, als es scheint 302 · Das echte Trolley-Problem:
Eine faktenbasierte ethische Diskussion 310
KAPITEL 9 DIE KLEINSTE GEMEINSAME WIRKLICHKEIT: NICHT WENIGER STREITEN,
NUR BESSER
Warum wir eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit brauchen 317 ·
Falsche Bilder von »Wissenschaftsreligion« und »Cancel
Culture« 320 · Die Kunst des wissenschaftlichen Konsenses
324 · Der wissenschaftliche Spirit 334 · Der Debattenfehlschluss
341
Danke * Anmerkungen * Bildnachweis
Autorin: "Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ist Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin. Sie ist bekannt aus der WDR-Wissenssendung Quarks und produziert den mehrfach ausgezeichneten und millionenfach abonnierten YouTube-Kanal maiLab. Für ihre Arbeit erhielt sie zahlreiche renommierte Preise, zuletzt 2020 das Bundesverdienstkreuz. Bei Droemer erschien 2019 ihr erstes Buch »Komisch, alles chemisch«, das sofort zum Bestseller wurde."
Bewertung: Ein sehr interessantes und vielfach anregendes Buch (das mich noch eine Weile beschäftigen und hier noch ergänzt wird). Eine Antwort auf die Kernfrage, was die Fakten sind und wie wir zu einer Übereinstimmung, zumindest zur kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit gelangen können, habe ich in kompakter und übersichtlicher Form nicht gefunden. Sachlichkeit ("Der Unterschied zwischen Fake News und echter Information sowie zwischen valider Kritik und persönlichem Angriff liegt in der Sachlichkeit. Ohne ein Verständnis der Tatsachen können wir diese Unterscheidungen also nicht machen. Solange wir kein gemeinsames Verständnis darüber haben, was wirklich Wirklichkeit ist, können wir auch nicht richtig streiten. Nur, wie definiert man Fakten? Oder Wirklichkeit?", S. 319; RS: das genau ist das Problem, das hier nicht gelöst wird). Wissenschaftlicher Konsens (Beispiel Stellungnahme Scientists for futures 2019, S. 324; S. 329: "97 Prozent der Klimaforscher sind sich einig, dass der Klimawandel menschengemacht ist." Zitat eines papers aus 2013). Kenntnis der Methoden der Erkenntnisgewinnung (S. 339: "Wenn ihr nur eins aus diesem Buch mitnehmt, dann, dass wissenschaftliche Ergebnisse wenig aussagen, solange ihr nicht die Methoden kennt, mit denen diese Ergebnisse erstellt wurden."). Evidenzbasierte Argumentation und Belege (S. 339: "Zur Wissenschaft gehört, dass nicht jede Studie gleich Studie, nicht jeder Beleg gleich Beleg ist. Evidenz kann knallhart oder nachgiebig schwammig sein. Und ohne diese Einordnung kann man auch nicht evidenzbasiert argumentieren. In diesem Buch haben wir unterschiedliche Begriffe kennengelernt, mit denen man Evidenz einordnen kann: Meta-Analysen, Kohortenstudien, randomisierte kontrollierte Studien, statistische Signifikanz, p-Hacking, HARKing, Effektgrößen, Korrelationskoeffizienten, Präregistrierung von Studien - wenn solche wissenschaftlichen Begriffe Bestandteile unserer Allgemeinbildung wären, würden sich viele unnötigen Streitfragen bereits von selbst auflösen.")
Obwohl das Buch "plausibel" im Titel enthält, habe ich keinen Abschnittseintrag im Inhaltsverzeichnis aber auch keine Textstelle mit "plausibel" gefunden.
Bibliographie: Möhn, Julia; Harms, Wiebke & Liske Jaax
(2021) Team F. Feminismus einfach leben.
12 Impulse für den Alltag (Einfache Schritte für mehr female
empowerment im Alltag). München: Knaur.
Verlags-Info: "„Wir brauchen vier Umarmungen am Tag zum Überleben,
acht Umarmungen am Tag zum Leben und 12 Umarmungen am Tag zum innerlichen
Wachsen“
– so die These der Psychotherapeutin Virginia Satir. Jeden Tag 12 Umarmungen.
Klingt das nicht schon nach einem guten Versprechen? Aber wie müssten
diese 12 Umarmungen beschaffen sein, damit sie uns Frauen helfen, voranbringen,
unterstützen, gut tun?
Wiebke Harms, Julia Möhn und Liske Jaax stellen in diesem Buch
12 Impulse vor, mit denen Frauen sich in ihrem Alltag gegenseitig unterstützen
und stärken können: Zum Beispiel mit Komplimenten an der Fahrradampel,
Empathie ohne Erklärmanie, radikaler Ehrlichkeit und dem Schaffen
eines Sicherheitsnetzes. Denn Solidarität, Gemeinschaft und Zusammenhalt
lebt und erlebt man am besten täglich, um kleine Herausforderungen
des Lebens und große gesellschaftspolitische Fragen besser bewältigen
und verändern zu können und Feminismus einfach zu leben.
Die 12 Impulse sind eine Antwort auf die Frage: Was können wir
jetzt tun? Ein feministischer Call-to-action Plan, der im Kleinen oder
im Großen funktioniert. Im Job und im Privaten. Die 12 Impulse befreien
uns von dem Gefühl der Machtlosigkeit und helfen uns, ins Handeln
zu kommen.
„Wir glauben daran, dass Frauen, wenden sie einige der Impulse an,
eine Veränderung in ihrem Umfeld erzeugen können. Frauen sollen
sich durch uns gestützt und gesehen fühlen.“
"Inhaltsverzeichnis:
- EINLEITUNG 9
1. ZEIGE LIEBE 15
Warum wir Politik mit Liebe machen sollten, wie sie sich organisieren
lässt und warum du deinen Feminismus einfach lieben musst
2. LASS MAL DRÜCKEN 29
Wenn Frauen sich Gefühlen öffnen – denen der anderen und
den eigenen – erleben sie Nähe und Heilung. Empathie gibt den sozialen
Bewegungen von Frauen weltweit Kraft
3. VERTEILE LOB 45
Warum wir das Loben trainieren sollten, wie eine persönliche Cheerleaderin
dabei helfen kann und wie wir uns und andere systematisch aufbauen können
4. STELL SIE VOR 59
Empfehlen, erzählen, vorstellen, auswählen: Wir haben viele
Möglichkeiten, andere Frauen sichtbar zu machen. So finden wir neue
Role Models und entdecken wunderbarerweise auch neue Seiten an uns selbst
5. SCHAU HIN 75
Inwiefern Gewalt gegen Frauen ein Muster hat, wie wir es durchbrechen
und wie wir hinschauen, einschreiten und uns organisieren können,
um Widerstand zu leisten
6. BIETE HILFE AN 91
Unsere größte Herausforderung ist es, selbst um Hilfe zu
bitten. Deshalb gibt es hier viele Heldinnengeschichten und Trainingsideen
für Newbies. Und eine Forderung: Care-Arbeit muss uns wichtiger und
wertvoller werden!
7. KÄMPFT ZUSAMMEN 109
Allein kommt keine weit, doch mit einer gemeinsamen Vision und der
Bereitschaft, sich selbst zu reflektieren, können Frauen sich verbünden
und viel erreichen
8. SPRICH’S AUS 123
Seien wir ehrlicher zu uns selbst und zu anderen. So bauen wir nicht
nur inneren Druck ab – Ehrlichkeit hilft auch, Veränderungen anzustoßen
9. RÜCKEN STÄRKEN 137
Unterstützung durch andere Frauen? Yes! Bekommen wir, mit einer
Guerilla-Taktik, mit neuen Regeln für Meetings, mit einem Blick zurück
in unsere Jugend. Und dem Abschied der Bienenköniginnen
10. SEI OFFEN 155
Warum es uns glücklicher macht, nicht mehr zu lästern; wie
man Vorurteile aushebelt und warum uns Kooperation weiter bringt als Konkurrenz
11. HÖR IHR ZU 171
Gemeinsam schaffen wir Räume, in denen wir Platz zum Wachsen haben.
In Gemeinschaften finden wir Sicherheit, erkennen, was uns wirklich wichtig
ist, und bringen uns in Aufbruchsstimmung
12. SEI DIE ERSTE 187
Wir entdecken Frauen wieder, die Großartiges geleistet haben.
Und lernen, wie wir ihre Geschichten fortschreiben können
DIE PROTAGONISTINNEN 203
GLOSSAR 211
ANMERKUNGEN 219
- "IMPULS
Diese Schritte helfen dir, die Liebe zu dir selbst zu entdecken
- 1. Die kleine Selbstlieberoutine beginnt damit,
in sich hineinzuhorchen: Welche Gefühle
sind da gerade? Welche Gedanken treiben dich
um?
2. Versuche, einfach nur wahrzunehmen, was du entdeckst. Ohne ein Label wie »gut« oder »schlecht« dranzuhängen, ohne zu bewerten.
3. Versuche, deine Gedanken zu respektieren. Sie sind ein Teil von dir. Das ist okay.
4. Wenn du dich ein bisschen besser kennengelernt hast: Gesteh dir selbst deinen Wert zu und vertraue dir selbst. Du kannst dich bei dir selbst sicher fühlen. So kommst du zu mehr Selbstsicherheit. Ist es nicht eigentlich toll, wer du bist?
Wer selbstsicher ist und Selbstvertrauen
entwickelt, hat auch den Mut und die Kraft, etwas
zu verändern. Eine gehörige Ladung Mut und Kraft können
wir nämlich gut gebrauchen, denn oft genug wird uns eingeredet, dass
wir das Problem sind, wenn wir Missstände ansprechen. Feminist*in
sein, das heißt, anderen auf die Nerven zu gehen. Die britischaustralische
GenderForscherin Sara Ahmed hat dafür den Begriff der »Feministischen
Spaßbremse« (»Feminist Killjoy«) erfunden.
Eine Art Berufsbezeichnung, die wir uns stolz anheften können,
um uns nicht kleinmachen zu lassen. ..."
AutorInnen:
Bewertung: Das Buch hat mich schon
angesprochen, bevor ich begann es zu lesen, und zwar schon durch die klare
Ansage des Umschlags: Feminismus einfach leben 12 Impulse für
den Alltag. Das hat mich an eine Postkarte erinnert, die ich vor einiger
Zeit in einem Postkartenshop entdeckte, die seitdem über meinem Monitor
hängt: sollte hätte könnte würde jedes Wort in einer
eigenen Zeile, in weißen Buchstaben geschrieben und mit rotem Stift
durchgestrichen und darunter in roter Schrift und alle Buchstaben groß
geschrieben MACHEN. Als Verhaltenstherapeutin weiß ich, das MACHEN
extrem viel erfolgreicher ist als Normen aufstellen, Konjunktive, Möglichkeiten.
Die 3 Autorinnen bezeichnen ihr Buch deshalb auch immer wieder treffend
als einen "Call-to-action-Plan".
Kapitel 1 Inhalt: Der Apoll von Bellac. S. 15 - 27
Kapitel 2 Inhalt: Empathie als Möglichkeit systemische Fehler
wahrzunehmen und zu verändern. S. 29 - 44
Kapitel 3 Inhalt: Lob und Anerkennung sind der beste Dünger zum
Wachsen und Gedeihen S. 45 - 57
Kapitel 4 Inhalt: Andere Frauen sichtbar zu machen ist eine lohnende
Aufgabe und ein praktischer Schritt auf dem noch langen Weg zur voller
Gleichberechtigung, raus aus der typisch weiblichen Zuhörerrolle und
über eigene Erfolge sprechen bietet anderen Frauen andere weibliche
Rollen-Vorbilder als die der stillen und bescheidenen Frauen. S. 59 - 74
Kapitel 5 Inhalt: Solidarisch sein. Genaues Hinschauen, ansprechen
und dagegenhalten, wenn wir irgendwo in unserem Umfeld Gewalt gegen Frauen
wahrnehmen. Denn Gewalt gegen Frauen "... ist ein Muster, kein individuelles
Problem. ..." S. 83. Im Internet gegen Hassreden gegen (andere) Frauen
ist nicht Schweigen, sondern aktive Widerrede das Mittel der Wahl. "...
Wir haben verstanden: hinschauen, sich zu Wort melden, handeln, sich solidarisch
zeigen. So können wir auf unsere Art die Amazonen aus Wonder Woman
sein." S. 89 S. 75 - 90.
Manuellsen & Damsch, Nina (2021) König im Schatten. München: Droemer.
Comey, James ()2021 Nichts als die Wahrheit. Der Ex-FBI-Direktor über die Unterwanderung des amerikanischen Justizsystem. München: Droemer.
Sellin, Fred (2020) Nur Heringe haben eine Seele. Geständnis eines Serienmörders. Der Fall Pleil. München: Droemer.
Kleiner, Marcus S. (2020) Wie Netflix, Amazon Prime, Disney & Co unsere Gesellschaft verändern. München: Droemer Knaur
- Noch vor wenigen Jahren waren Streaming-Dienste ein Nischenmarkt, heute
dominieren sie die Medienlandschaft. Die Öffentlich-Rechtlichen sind
angezählt, die Privaten kränkeln. Denn niemand hat dem so bestechend
auf unsere Bedürfnisse abgestimmten Angebot von Netflix, Amazon Prime
und Co. noch etwas entgegenzusetzen. So nimmt der Siegeszug der Streaming-Dienste
kein Ende - Netflix und Co. werden zu neuen Leitmedien.
Welche Wirkung aber haben die Algorithmen der Streaming-Dienste? Kann unsere Gesellschaft das aushalten, wenn wir nur noch einen Ausschnitt der Wirklichkeit wahrnehmen? Wenn sich die Medienlandschaft unumkehrbar verändert, weil wir zu passiven Konsumenten werden?
Der führende Medienwissenschaftler Prof. Marcus S. Kleiner zeigt, warum der Streaming-Boom das Zeug dazu hat, unsere Demokratie zu erschüttern – und wie wir eine aufgeklärte Konsumentenhaltung entwickeln. Denn die Streaming-Dienste bestimmen längst, was wir sehen - Wann bestimmen sie auch, was wir wissen?
Giesa, Christoph (2020) Echte Helden Falsche Helden. Was Demokraten gegen Populisten stark macht. München: Droemer.
Mahmoud Al-Zein (2020) Der Pate von Berlin. Mein Weg, meine Familie, meine Regeln. München: Droemer.
Wiener, Anna (2020) Macht und Dekadenz im Silicon Valley. München: Droemer Knaur. Erscheinungstermin: 20.08.2020. Verlagsinfo: "Anna Wieners gefeierte Reportage über das Silicon Valley zu Zeiten des digitalen Goldrausches ist viel mehr als eine literarisch brillante Coming-of-Age-Geschichte: Ihr persönliches Protokoll entlarvt den Sexismus, die Machtbesessenheit und die Dekadenz jener Start-up-Elite, die unseren digitalen Alltag bestimmt. Mit Mitte zwanzig ist Anna Wiener Teil der New Yorker Literaturszene am Ende der Nullerjahre: viele Träume und wenig Geld. Als sie zufällig einen Job bei einem Startup bekommt, steht ihr Leben plötzlich Kopf. Sie stürzt sich in den digitalen Goldrausch an der Westküste, arbeitet am Aufstieg des Hightech-Kapitalismus mit und gerät so immer tiefer in die digitale Parallelwelt des Silicon Valley. Aber je länger sie die schöne neue Startup-Welt miterlebt, desto klarer wird ihr: Im Zentrum der globalen Disruption stehen keine Ideale, sondern Hybris, Risikokapital und eine übersteigerte Männlichkeit." Autorin: "Anna Wiener ist Journalistin und schreibt für den New Yorker, The Atlantic und Wired über das Silicon Valley, Start-Up-Kultur und die digitale Welt. Sie lebt und arbeitet in San Francisco, Code kaputt ist ihr erstes Buch und sorgt seit Erscheinen in den USA und Großbritannien für Furore."
Bibliographie: Gottfried Fischer / Peter Riedesser (2020) Lehrbuch der Psychotraumatologie. Überarbeitung von Adrian Georg Fischer, Monika Becker-Fischer, Theo O. J. Gründler, Ferdinand Haenel, Kurt Mosetter, Reiner Mosetter, Peter Zimmermann. 5., aktualisierte und erweiterte Auflage 2020. 470 Seiten. 25 Abb. 21 Tab. München: UTB-L (978-3-8252-8769-6) kt (Reinhardt).
Verlags-Info: Verlags-Info: "Seelische Verletzungen, ihre Ursachen und Folgen, Prävention, Rehabilitation und therapeutische Möglichkeiten - von diesen Fragen und Problemen handelt dieses Standardwerk der Psychotraumatologie. Die Autoren stellen ein allgemeines Verlaufsmodell vor, analysieren die Unterschiede des individuellen Traumaerlebens sowie spezielle traumatisierende Situationen. Verschiedene Therapieformen (psychodynamisch, verhaltenstherapeutisch, EMDR) werden erklärt und kritisch eingeordnet. Neu in der 5. Auflage: Erweiterung der Themen um Kriegstraumata, Flucht und Vertreibung, Psychotraumatherapie des Körpers und Psychopharmakotherapie."
Inhaltsverzeichnis:
- Vorbemerkung zur 5. Auflage 9
- Schweregrad 153
- Häufung traumatischer Ereignisse oder Umstände 155
- Mittelbare vs. unmittelbare Betroffenheit 155
- Gesichtspunkt der Verursachung 156
- Verhältnis zwischen Täter und Opfer 156
- Klinisch relevante Situationsdynamiken 157
- Aktuelle Disposition 163
- Überdauernde Dispositionen 164
- Protektive Faktoren 164
- Risikofaktoren 165
- Differenzielle physiologische Dispositionen 167
Aufbau des Lehrbuchs und Hinweise für die Lektüre 10
Abkürzungen 12
Teil I: Allgemeine Psychotraumatologie
1 Einführung 17
1.1 Psychotraumatologie als Forschungs- und Praxisfeld 17
1.1.1 Psychisches Trauma in einem polyätiologischen Modell 21
1.2 Seelische und körperliche Verletzungen: Gemeinsamkeiten und
Unterschiede 24
1.3 Zur Geschichte der Psychotraumatologie 33
1.3.1 Naturgeschichte der Psychotraumatologie 34
1.3.2 Wissenschaftsgeschichte der Psychotraumatologie 36
1.4 Diagnostik als „Momentaufnahme“: Syndrome der allgemeinen und speziellen
Psychotraumatologie 45
2 Situation, Reaktion, Prozess - ein Verlaufsmodell der psychischen
Traumatisierung 67
2.1 Zur Phänomenologie der traumatischen Situation 73
2.2 Der Riss zwischen Individuum und Umwelt: Peritraumatische Erfahrung
im Modell des „Situationskreises“ 82
2.2.1 Pathogenese des psychischen Traumas 93
2.2.2 Zur Psychobiologie der peritraumatischen Erfahrung 97
2.3 Fassen des Unfasslichen - die traumatische Reaktion
100
2.4 Anpassung an das Trauma: Strukturveränderungen im traumatischen
Prozess 106
2.4.1 Struktur und Dynamik des traumatischen Prozesses 107
2.4.2 Idiographische Untersuchung traumatischer Prozessverläufe
110
2.4.3 Kontrolloperationen und Strukturveränderung im traumatischen
Prozess 117
2.4.4 Psychobiologie des traumatischen Prozesses 124
2.4.5 Die ICD im Kontext 133
2.4.5.1 Die nosologische Pyramide 135
2.4.5.2 Die traumatische Ätiologie in Störungsbildern der
ICD 139
2.5 Zusammenfassung von Kapitel 2: Das Verlaufsmodell der psychischen
Traumatisierung in seinen wichtigsten Implikationen 145
3 Differenzielle Psychotraumatologie: Erforschung von Traumafolgen
nach dem Verlaufsmodell 151
3.1 Objektiver Zugang zum Trauma 153
3.1.1 Typologie traumatischer Situationen 153
3.2 Subjektiver Zugang zum Trauma 163
3.2.1 Subjektive Disposition: Die Erwartung des Unerwartbaren 163
3.2.3 Motivation und Triebdispositionen 170
3.3 Differenzieller Verlauf der traumatischen Reaktion und des traumatischen Prozesses 172
3.3.1 Direkte Folgen des Traumas 172
3.3.2 Differenzielle Betrachtung der mittelbaren Folgen 184
3.4 Forschungsstrategien der Psychotraumatologie 187
3.4.1 Methodenintegration am Beispiel der Deprivationsforschung 191
3.4.2 Forschungsdesigns der Psychotraumatologie 203
3.4.3 Untersuchungsinstrumente 206
4 Traumatherapie 211
4.1 Sozialpsychologische Abwehrprozesse bei Erforschung und Therapie
psychischer Traumatisierung 211
4.2 Krisenintervention 218
4.3 Gesichtspunkte der postexpositorischen Traumatherapie 219
4.3.1 Regeln für die Traumatherapie 223
4.3.2 Psychodynamisch orientierte Ansätze der Traumatherapie
227
4.3.3 Verfahren der Verhaltenstherapie 234
4.4 Prinzipien der Psychotherapie traumatischer Prozesse 236
4.5 Psychotraumatologisch fundierte Psychotherapie (PFP) 250
4.5.1 Trauma-Akuttherapie nach der MPTT 257
4.6 Psychotraumatherapie des Körpers 261
4.7 Psychopharmakotherapie 270
4.7.1 Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 272
4.7.2 Trizyklische Antidepressiva 272
4.7.3 Antipsychotika 273
4.7.4 Monoaminoxidase-Hemmer (MAO-Hemmer) 273
4.7.5 Benzodiazepine und Z-Drugs 274
4.7.6 Spezielle Substanzen und Ausblick 274
4.7.7 Therapieentscheidungen 275
5 Prävention 277
Teil II: Spezielle Psychotraumatologie
6 Holocaust 286
7 Folter, Krieg und Vertreibung 293
7.1 Die Folter und ihre Verbreitung 293
7.2 Die traumatische Situation 295
7.3 Psychische Folterfolgen 297
7.4 Symptome als diagnostische Hindernisse 298
7.5 Nachfolgende traumatische Erfahrungen 299
7.6 Besondere psychosoziale Faktoren als therapeutische Hindernisse
301
7.7 Psychotherapeutische Behandlung 301
7.8 Gegenübertragung oder was geschieht mit den Therapeuten? 304
7.9 Pharmakologische Behandlung 305
7.10 Sprachliche Hindernisse in der Behandlung von Folterüberlebenden
306
7.11 Risiken und Nebenwirkungen für die Therapeuten 307
7.12 Fazit 309
8 Kriegstrauma 310
8.1 Einleitung 310
8.2 Aktuelle Situation bei Soldaten 311
8.3 Psychodynamisches Modell der Entwicklung traumaassoziierter psychischer
Erkrankungen im militärischen Kontext 312
8.4 Traumatherapie im militärischen Kontext 314
8.5 Gruppenprogramm zur werteorientierten Psychotherapie 316
8.6 Perspektiven der Psychotraumatologie in der Bundeswehr 317
9 Kindheitstrauma 320
9.1 Risikofaktoren und protektive Faktoren in der Kindheitsentwicklung
324
9.2 Situation - Reaktion - Prozess: Das Kindheitstrauma im Verlaufsmodell
326
9.3 Traumatherapie bei Kindern 329
9.4 Sexueller Kindesmissbrauch 331
9.4.1 Soziodynamik und psychotraumatologische Abwehrprozesse beim Thema
des sexuellen Kindesmissbrauchs 333
9.4.2 Gedächtnisforschung und die sog. „False-Memory‘‘-Bewegung
334
9.4.3 Traumatische Situationsfaktoren und symptomatische Folgen 337
9.4.4 Täterprofile und Familiendynamik 341
9.4.5 Glaubhaftigkeitskriterien kindlicher Zeugenaussagen 345
9.4.6 Traumatischer Prozess und Langzeitfolgen 346
9.4.7 Psychotherapie 352
9.4.8 Transgenerationale Weitergabe im traumatischen Prozess 358
9.4.9 Prävention 360
9.5 Auswirkung von Kriegsereignissen auf Kinder 361
10 Vergewaltigung 366
11 Gewaltkriminalität 374
Objektive Situationsfaktoren 375
Dissoziatives Erleben in der traumatischen Situation 376
Symptomverbreitung und -ausprägung 376
Psychotraumatisches Belastungssyndrom bei Gewaltopfern: Häufigkeit,
Verlauf, Formen 379
Risikofaktoren für die Entwicklung langfristiger Symptome und
Beschwerden 381
Praxis im Kölner Opferhilfe Modell 386
Auszüge aus dem Text der Informationsbroschüre für Gewaltopfer
aus dem Kölner Opferhilfe Modell 386
12 Arbeitslosigkeit als psychisches Trauma 390
13 Lebensbedrohliche Erkrankung als Faktor psychischer Traumatisierung 398
14 Mobbing 404
15 Ausblick: Die Zukunft der Psychotraumatologie und die Frage der Ausbildung 412
Glossar 416
Literatur 433
Sachregister 463
S.24: "In einer ersten Arbeitsdefinition können wir psychisches Trauma als seelische Verletzung verstehen (von dem griechischen Wort traûma = Wunde, Verletzung). Wie die verschiedenen somatischen Systeme des Menschen in ihrer Widerstandskraft überfordert werden können, so kann auch das seelische System durch punktuelle oder dauerhafte Belastungen in seinen Bewältigungsmöglichkeiten überfordert und schließlich traumatisiert/verletzt werden."
S. 47f zitiert die DSM-5 Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung.
S. 88f: "Definition der traumatischen Erfahrung.
Von diesen Überlegungen aus können wir psychisches Trauma jetzt
näher definieren, und zwar als ein
- vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren
und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen
von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte
Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.
In der traumatischen Situation sind einige Regeln der normalen Erlebnisverarbeitung
gewöhnlich außer Kraft gesetzt. Es kommt zu Veränderungen
der rezeptorischen Sphäre (Veränderungen des Zeit-, Raum-
und Selbsterlebens). Mit Bezug auf die effektorische Sphäre
können wir Trauma als unterbrochene Handlung in einer vital
bedeutsamen Problemsituation definieren. Aktuell tritt entweder eine (katatonoide)
Lähmung und Erstarrung ein oder es kommt zu einem panikartigen Bewegungssturm.
Langfristig setzt sich die aus der experimentellen Psychologie bekannte
Tendenz
zur [>89] Wiederaufnahme unterbrochener Handlungen durch.
Dieses als „Zeigarnik-Effekt“ bekannte Phänomen tritt bei einer vital
bedeutsamen unterbrochenen Handlung natürlich verstärkt in Erscheinung
und kann zur Erklärung der verschiedenen Wiederholungstendenzen (Wiederholungszwang,
-> Traumatophilie, Traumasucht) herangezogen werden. Werden Traumabetroffene
postexpositorisch über ihr Erleben befragt, so schildern sie vor allem
Symptome des völligen Absorbiert- und Gefangenseins in der Situation,
von Depersonalisierung (z.B. neben sich stehen) und Derealisierung (es
ist nicht Wirklichkeit, Phantasie, nur ein Traum) sowie amnestische Erfahrungen
des Vergessens entscheidender Vorkommnisse. Die Schemata unserer Wahrnehmungsverarbeitung
werden durch traumatische Erlebnisse anscheinend strukturell verändert
bzw. außer Kraft gesetzt. ..."
Autoren: Prof. Dr. Gottfried Fischer
(1944-2013) war Direktor des Inst. für Klin. Psychologie und Psychotherapie
an der Universität zu Köln sowie Gründungsmitglied und Forschungsleiter
des Deutschen Instituts für. Psychotraumatologie.
Prof. Dr. med. Peter Riedesser (1945-2008) war Direktor der
Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitäts-Krankenhauses
Eppendorf/Hamburg.
Dr. Adrian Georg Fischer ist wiss. Mitarbeiter im Arbeitsbereich
Biologische Psychologie und Kognitive Neurowissenschaft an der Freien Universität
Berlin.
Bewertung:
Ein umfangreiches Werk, wovon das Inhaltsverzeichnis zeugt, das zu den
meisten Fragen der Psychotraumatologie grundlegende Informationen vermittelt.
Zum Thema Unfälle (kein Sachregistereintrag), Unglück und Katastrophen
(viele Sachregistereinträge) wurde noch kein eigenen Kapitel bzw.
kein eigener Abschnitt eingerichtet. Die erste Auflage erschien 1998, hatte
13 Kapitel (endend mit Mobbing) und 383 Seiten. Trotz der Überarbeitung
und 5. Auflage sind die Grundgedanken und Gliederung weitgehend gleich
geblieben. Neu hinzu kam das Kapitel Kriegstrauma und der Ausblick.
Querverweise:
- Traumatisierte Zeugen: Müssen und dürfen traumatisierte Zeugen aussagepsychologisch und vernehmungstechnisch anders behandelt werden? Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kapitel "Psychotraumatologie der Zeugenaussage und Begutachtung vor Gericht" aus dem Buch "Psychotraumatologie der Gedächtnisleistung" von Hinckeldey und Fischer (2002)
- Was soll ein Trauma heißen? Ein kritischer Beitrag zur psychologisch- psychotherapeutischen Definitionslehre an den Beispielen Singkirchnat, Singkirchnat Orgasmus, Kamtangoschnee, Ödipuskomplex, gottgefällig, Zwangsvorstellungen, Panikstörung und Trauma.
Bibliographie: Fellinger, Brigitte (2018) Spielfilme in der Psychotherapie. München: Reinhardt-Verlag.
Verlags-Info: "Ein guter Spielfilm nimmt uns von der ersten Sekunde an mit auf eine Reise in eine andere Welt. Wohl jeder Mensch hat einen Lieblingsfilm, der ihn berührt oder bewegt. Was aber macht die Faszination eines Spielfilms aus? Warum haben Spielfilme überhaupt eine Wirkung auf uns? Und vor allem: Wie können Spielfilme helfen zu heilen?
Das Buch gibt einen umfassenden Einblick in die Wirkweisen von Spielfilmen als Therapieinstrument in der Psychotherapie. Praktische Erfahrungen aus dem psychotherapeutischen Arbeitsalltag zeigen, welche Verhaltensweisen bestimmte Spielfilme auslösen können. Ausgewählte Beispiele aus der Welt der bewegten Bilder unterstreichen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz von Spielfilmen in der Psychotherapie ergeben."
Inhaltsverzeichnis:
- Vorwort 7
1 Filmgeschichtlicher Hintergrund 10
1.1 Von den Anfängen des Films 10
1.2 Der Film ab dem Ersten Weltkrieg 10
1.3 Der Film ab 1930 und im Zweiten Weltkrieg 11
1.4 Der Film in der Nachkriegszeit 14
1.5 Filmtherapie als Beitrag zu einer Erinnerungskultur
17
2 Spielfilme als Therapeutikum 24
2.1 Von der Bibliotherapie zur Filmtherapie 24
2.2 Wirkweisen und Faszination des Mediums Film 25
2.2.1 Schwarz-weiß, Farbe, Licht, Bild 26
2.2.1 Ton, Musik 33
2.2.3 Kamera, Schauspiel-Figuren, Narration 36
2.2.4 Film als „emotion machine“ (Empathie) 43
2.3 Einführung in die Filmtherapie 53
2.4 Indikationen und Kontraindikationen der Filmtherapie
60
2.5 Rechtliche Voraussetzungen über das Vorführen von
Filmen in der Therapie 62
2.6 Filmtherapie als Beitrag zur transgenerationalen Thematik
in der Psychotherapie 63
2.7 Filmtherapie als Beitrag zur bindungsbasierten Psychotherapie
73
2.8 Zusammenfassung: Wirkweisen der Filmtherapie
78
3 Filmtherapie - eine schulenübergreifende Intervention
82
3.1 Was wirkt? Mensch oder „Therapiemethode“? 82
3.2 Beziehungsgestaltung und Filmtherapie 83
3.2.1 Grundlegende Überlegungen zur therapeutischen Beziehung
83
3.2.2 Wechselwirkungen von Spielfilmen auf die Beziehungsgestaltung
im Rahmen der Filmtherapie 87
3.3 Voraussetzungen für die Arbeit mit Spielfilmen in der
Therapie 93
4 Praktische Anwendungsbeispiele der Filmtherapie
96
4.1 Einsatz der Filmtherapie im stationären Setting als
Gruppentherapie — Psychosomatische Patienten 96
4.1.1 Patienten mit Burnout, Traumafolgestörung oder Ess-Störung
97
4.1.2 Patienten in einer psychosozialen Rehabilitation
104
4.2 Patienten im ambulanten Setting (Einzelsetting)
106
4.2.1 Erwachsene 106
4.2.2 Kinder und Jugendliche 111
4.3 Filmtherapie im Strafvollzug 114
4.3.1 Filmtherapie zur Behandlung von Spielsucht in der JVA
114
4.3.2 Filmtherapie im Gefängnis — Der Ablauf 120
4.3.3 Wirkweisen der Filmtherapie in einer JVA 121
4.4 Filmtherapie in Supervision und Coaching 130
5 Integration der Filmtherapie in den psychotherapeutischen Prozess - Zusammenspiel der Interventionsmöglichkeiten 133
6 Wir gestalten unsere eigenen Filme - ein theoretisches Konzept
140
Anhang 145
Weiterführende Literatur 145
Zitierte Literatur 147
Filmregister 150
Sachregister 152
Leseprobe: Einführung in die Filmtherapie, als PDF auf
der Verlagsseite einseh- und downloadbar. Hieraus ein Filmbeispiel:
- PAPPA ANTE PORTAS
Regisseur: Loriot Hauptdarsteller: Loriot, Evelyn Hamann, Ortrud Beginnen u. a.
Deutschland 1991, Spieldauer ca. 87 Minuten
Inhalt: Heinrich Lohse (dargestellt von Loriot) ist 59 Jahre alt, Einkaufsdirektor bei der Deutsche Röhren AG, und wird von einem Tag auf den anderen in den Vorruhestand versetzt. Er ist mit Renate (dargestellt von Evelyn Hamann) verheiratet, die bisher die Rolle der Hausfrau und Mutter innehatte. Der gemeinsame Sohn Dieter (Gerrit Schmidt-Foß) ist 16 Jahre alt. Der Vorruhestand und das Gefühl der Nutzlosigkeit, veranlassen Heinrich nun dazu, den Villenhaushalt nach seinen Vorstellungen zu strukturieren. Durch seine unbeholfene Art führt dies zu zahlreichen Missgeschicken, Missverständnissen und Konflikten. Das Ehepaar – hin und her gerissen zwischen dem Versuch des gegenseitigen Verständnisses und dem Bemühen, die Entfremdung und Wortlosigkeit der Ehejahre zu bewältigen – gerät immer mehr in einen veritablen Ehekonflikt. Anlässlich des 80. Geburtstags von Renates Mutter ist letztlich doch wieder eine Versöhnung möglich.
Eignung für die Filmtherapie: Dieser Film eignet sich für
viele Lebensthemen, z. B. Pensionierung oder Beziehungsfragen.
Folgende Themenbereiche ergeben sich aus dem Filminhalt:
– Arbeit als Wert
– Umgang mit der Pensionierung
– Einblicke in den Ehealltag
– Kommunikation in Beziehungen
– eine Sinnhaftigkeit im Lebensalltag finden
– Etikette und Benehmen – Umgang mit Missverständnissen
– mehr Schein als Sein
– Humor; über sich selbst lachen können
Der Film eignet sich als Lehrgeschichte, zur Bewusstwerdung und zur Entlastung.
Eignung für welches Setting: Einzel- wie Gruppensetting; Supervision;
Coaching
Eignung für welche Diagnosegruppen: alle
Pressestimmen: "Fellinger richtet sich primär an praktizierende
Therapeuten, denen sie die Wirkung und den Gewinn der Arbeit mit Filmen
nahe bringen will. Nach einem kurzen filmhistorischen Abriss erläutert
sie gewissenhaft die Indikation und Kontraindikation dieser Methode sowie
deren rechtliche Voraussetzungen. Sodann entfaltet sie anhand zahlreicher
Filme, warum und wie diese in der Therapie produktiv eingesetzt werden
können. ...
Fellingers engagiertes Plädoyer für die Arbeit mit Spielfilmen
in der Psychotherapie ist durch seine Informationsfülle spannend für
Fachleute, macht aber auch darüber hinaus Lust, sich von der zu Selbsterkundung
einladenden Wirkung von Spielfilmen überraschen zu lassen.
Gabriele Michel in: Psychologie heute, April 2019."
Autorin: "Dr. Brigitte Fellinger, Retz, Österreich, ist
Psychotherapeutin in eigener Praxis für Existenzanalyse und Logotherapie
und im stationären Setting einer psychosomatischen Klinik tätig.
Zudem bietet sie Fortbildungen zum Thema Filmtherapie an."
Bewertung: Ein ausgezeichnetes Werk
zum Thema Film in der Psychotherapie, das als integrativer Baustein von
vielen Therapieschulen verwendet werden kann.
Bibliographie: Bauer, Susanne (2018) Musiktherapie. München: Reinhardt-Verlag.
Verlags-Info: "Welche therapeutischen Funktionen erfüllt Musik? Um welche Musik handelt es sich dabei? Wird gespielt oder gehört, zusammen oder alleine, auf welchen Instrumenten? Wie gestaltet sich die musiktherapeutische Beziehung zum Klienten? Dieses Buch stellt die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Musiktherapie vor. Es vermittelt therapeutische Haltungen und „Arbeitsmodelle“ vor dem Hintergrund medizinischer Erklärungsansätze und gesellschaftlicher Bedingungen. Zahlreiche Fallbeispiele vertiefen Fragen des Settings und den Einsatz als Gruppen oder Einzelverfahren. Ein berufspolitischer Blick auf die Musiktherapie befasst sich abschließend mit der Aus- und Weiterbildung und künftigen Entwicklungen."
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Einführung 9
- Setting im institutionellen Kontext 52
- Setting im ambulanten Kontext 56
- Aktive Musiktherapie – Musiktherapieraum 59
- Aktive Musiktherapie – Musiktherapieinstrumente 60
- Rezeptive Musiktherapie – Musiktherapieraum 60
- Ko-Therapie 61
- Behandlungsformate: Einzel- versus Gruppenmusiktherapie 64
- Aktive Verfahren 82
- Rezeptive Verfahren 82
- Gemischte Verfahren 83
- Aktive Musiktherapie 83
- Rezeptive Musiktherapie 105
- Störungsspezifische Ansätze der Musiktherapie 111
- Musiktherapie an und in Musikschulen 126
- Musiktherapie an und in Schulen 129
- Musiktherapie mit Menschen mit Traumafolgestörungen 131
- Musiktherapie in der Palliativmedizin mit Kindern und Erwachsenen 136
- Musiktherapie in der Gerontopsychiatrie 141
- Aus- und Weiterbildungen in Deutschland 146
- Berufliche Anerkennung 149
- Musiktherapeuten im Angestelltenverhältnis 152
- Selbständig arbeitende Musiktherapeuten 154
2 Geschichte 12
2.1 Krankheitsverständnis, seelische Störungen und die Behandlung mit Musik 12
2.2 Entstehungsgeschichte der Musiktherapie in Deutschland 20
3 Theorie: Wissenschaftliche Grundlagen zum Zusammenspiel von
Musik und Mensch 27
3.1 Anthropologie 28
3.2 Physik und Physiologie 30
3.3 Neurowissenschaften 32
3.4 Entwicklungspsychologie 35
3.5 Tiefenpsychologie 39
3.6 Musik- und Kunstpsychologie 40
4 Der therapeutische Prozess 46
4.1 Beziehungen im Leben – Beziehung leben 46
4.2 Die therapeutische Beziehung 48
4.3 Die musiktherapeutische Beziehung 49
4.4 Setting 52
5 Evaluation 117
5.1 Erste Forschungsschritte während des Studiums
120
5.2 Qualitative und quantitative Forschungsmethoden – Beispiele
121
Die qualitative Forschungsmethode: Die Bedeutung von Stimme und Stimmklang
im psychotherapeutischen Prozess aus der Sicht der Patienten und Patientinnen
122
Die quantitative Forschungsmethode: Schizophrene Patienten und musikalische
Verständigung 123
6 Zukünftige Entwicklungen 126
6.1 Anwendungsbereiche 126
7 Zusammenfassung 155
Glossar 157
Empfohlene Literatur 161
Zitierte Literatur 164
Register 173
Leseprobe: Wird vom Verlag als PDF angeboten (Einführung).
Autorin: Prof. Dr. Susanne Bauer leitet den Masterstudiengang
Musiktherapie an der Universität der Künste Berlin und ist in
der Gruppen- und Einzelmusiktherapie an der Wiegmann Klinik für Psychogene
Störungen, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie tätig.
Bewertung: Ein wichtiges, nützliches
und hilfreiches Buch für allej,
die an Musiktherapie interessiert sind mit fundiertem und weiterführendem
wissenschaftlichen Apparat (Literaturverzeichnis, Glossar und Register).
Bibliographie: Döll, Michaela (2020) : Frauenherzen schlagen anders. Warum Frauen in der Medizin falsch behandelt werden und wie sie die richtige Therapie bekommen. München: mvg Verlag. Softcover, 208 Seiten. ISBN: 978-3-7474-0140-8. 16,99 € (D) bzw. 17,50 € (A)
Verlags-Info: "Frauen haben …
- andere Symptome bei einem Herzinfarkt als Männer – sie beginnen zum Beispiel im Magen
- einen komplexen Hormonzyklus, was zu einer anderen Verträglichkeit von Medikamenten führt
- einen empfindlicheren Darm und leiden daher auch häufiger unter Reizdarm
Das sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie sehr sich Frauen von Männern unterscheiden. Das wurde von der Medizinforschung zu lange ignoriert – mit gefährlichen Folgen für die Gesundheit von Frauen. Bei vielen gesundheitlichen Problemen kann auch eine frauenspezifische Ernährung – Gender Nutrition – Linderung verschaffen. In Kombination mit bestimmten Pflanzenstoffen können Patientinnen damit verschiedenste Beschwerden positiv beeinflussen.
Prof. Michaela Döll ist Gesundheitsexpertin und weiß, wie wichtig Gender-Medizin für eine kompetente ärztliche Behandlung ist. In diesem Buch erklärt sie anschaulich und verständlich, mit welchen Beschwerden und Nebenwirkungen von Arzneimitteln Frauen zu kämpfen haben. Sie gibt Empfehlungen für natürliche und komplementärmedizinische Therapieansätze und spezielle Lebensmittel, damit Frauen endlich richtig behandelt werden und genauso gesund leben können wie Männer."
Inhaltsverzeichnis: [PDF auf der Verlagsseite]
Leseprobe: [PDF auf der Verlagsseite]
Autorin: "Prof. Dr. rer. nat. Michaela Döll ist als ernährungsmedizinische Expertin bekannt. Sie ist Professorin an der Universität Braunschweig, ihre Arbeitsschwerpunkte sind Vitalstoffmedizin, Ernährung, Zivilisations- und umweltbedingte Erkrankungen. Ihr Expertenwissen ist nicht nur bei zahlreichen Vortragstätigkeiten gefragt, sondern auch im Hörfunk und TV."
Bewertung: Ein sehr informatives Werk der Gender, hier Frauenmedizin.
Bibliographie: Riedel, Andreas & Clausen, Jens
Jürgen (2020) Autismus-Spektrum-Störungen
bei Erwachsenen. Köln: Psychiatrie-Verlag.
Format: Kartoniert, 2., aktualisierte Auflage 2020, 160 Seiten. ISBN:
978-3-96605-030-2
Verlags-Info: "Hochfunktionaler Autismus
bei Erwachsenen. Autismus-Spektrum-Störungen wurden lange Zeit vor
allem als eine Entwicklungsauffälligkeit bei Kindern wahrgenommen.
Es liegt aber in ihrer Natur, dass sie in späteren Lebensphasen andauern.
Das vorliegende Buch bietet fundiertes Wissen zu
Autismus im Erwachsenenalter und hilft psychiatrisch, psychotherapeutisch
und psychosozial Tätigen, erwachsene Menschen aus dem Autismus-Spektrum
diagnostisch richtig einzuschätzen und angemessen zu begleiten.
Die Autoren nehmen Ausprägungen, Diagnostik
und Therapie in den Blick und legen dabei das Hauptaugenmerk auf hochfunktionalen
Autismus. Sie geben einen fundierten Überblick über das Thema
und stärken das gegenseitige Verstehen zwischen Menschen mit und ohne
Autismus."
[https://psychiatrie-verlag.de/product/autismus-spektrum-stoerungen-bei-erwachsenen/]
Inhaltsverzeichnis:
- "Intuition und Fachwissen sinnvoll verbinden - Einleitung
7
Was ist Autismus? 12
Historische Entwicklung, Definition und Terminologie 12
»Autistische Züge« - der Randbereich des autistischen Spektrums 18
Ursachen und Häufigkeit 20
Symptomatik 23
Kognitionspsychologische und neurobiologische Erklärungsansätze 26
Kompensationsleistungen 29
Krankheit, Behinderung, Normvariante? 33
Diagnosestellung und Komorbidität 34
Hochfunktionaler Autismus und Sprache 39
»Autistische« Ressourcen 43
Helfender und therapeutischer Zugang 45
Gestaltung der Kommunikationssituation 45
Sich einlassen und Vertrauen bilden - Beziehungsaufbau 51
Die Gegenübertragung: Was löst der Patient bei mir aus? 53
Umgang mit den Varianten des autistischen Gedächtnisses 59
Psychotherapeutische Konzepte 63
Achtsamkeitsbasierte und andere therapeutische Verfahren 64
Lebenswelten und Lebenslagen autistischer Menschen 68
Erfahrungen in der Arbeitswelt - berufliche Teilhabe 68
Gestaltung des Wohnens - kommunale Teilhabe 73
Freie Zeit, Urlaub, Sport, Kreativität - kulturelle Teilhabe 77
Selbsthilfe, Selbstvertretung, Partizipation - gesellschaftliche Teilhabe 81
Freundschaften - Partnerschaften - Beziehungen 83
Rechtliche Aspekte und Unterstützungsmöglichkeiten 88
Krankheit und Behinderung - sozialrechtlich verstanden 88
Die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention 92
Rechtliche Unterstützungsmöglichkeiten 96
Das Persönliche Budget 99
Bedarfsermittlung, Hilfeplanung und persönliche Zukunftsplanung 101
Berufliche Unterstützung 104
Konkrete schwierige Situationen im Umgang
mit Erwachsenen aus dem Autismusspektrum 109
Umgang mit Schwierigkeiten in der Kommunikation 109
Umgang mit Aggression und selbstverletzendem Verhalten 113
Umgang mit Overloads 116
Umgang mit Suizidalität 119
Häufige Fehlerquellen im Umgang mit Erwachsenen 127
aus dem Autismusspektrum 122
Häufige Themen im therapeutischen Umgang 127
Psychoedukation 127
Hilfe bei Organisation und Strukturierung 134
Alltagsthemen im helfenden Kontakt 136
Offenlegung der Diagnose 137
Klärung konkreter sozialer Situationen 140
Vorwürfe und Schuldgefühle - Angehörigenarbeit 143
Die rationale Arbeit am Wertesystem 144
Zielfindung 145
Vom Defiziterleben über die »autistische Identität«
zum menschlichen Pluralismus - Schlussbemerkungen 148
Ausgewählte Literatur 154"
- "OFFENE FRAGEN In den Berufsausbildungen wird psychiatrisch
Tätigen beigebracht, Patienten zuerst einmal mit offenen und eher
unkonkreten Fragen zu begegnen, also »Raum« zu geben für
das Anliegen des Patienten. Dies ist für die Mehrzahl der Patientengruppen
sinnvoll, aber im Umgang mit Menschen aus dem Autismusspektrum wenig hilfreich.
Diese sind durch offene Fragen verunsicherbar, verstehen nicht, worauf
der Helfer hinauswill, fühlen sich unter Druck gesetzt und reagieren
womöglich verärgert. Fragen wie »Wie geht es Ihnen?«
werden mitunter für neurotypischen Small Talk gehalten, Fragen nach
der »Stimmung« nicht verstanden, da oft kein sinnvolles Konzept
von »Stimmung« zur Verfügung steht, und eine Frage wie
»Was hat Sie zu mir geführt?« kann auch völlig ernsthaft
mit »Mein Fußgängernavigationsgerät« beantwortet
werden.
Um eine vertrauenswürdige Situation zu schaffen, ist es deshalb oft hilfreich, zuerst eher geschlossene, sehr konkrete Fragen zu stellen, bei deren Beantwortung sich der Patient sicher fühlt, und erst später offene, raumgebende Fragen ins Spiel zu bringen.
SENSORIK In manchen Fällen ist schon das äußere zwischenmenschliche Setting für Menschen mit ASS schwer zu verkraften. Zu vermeiden sind deshalb sensorische Überlastungen wie unerwartete Berührungen, zu intensive Parfums oder Aftershaves, abrupte laute Geräusche, flackernde Lichtquellen (manche Neonröhren), häufiges Umstellen der Möbel und eine unklare Zeitplanung."
Expositionsbelastungen vermeiden.
"»ABWEHR« Viele Erwachsene mit ASS, die Erfahrung mit tiefenpsychologischen Behandlungen gemacht haben, berichten, dass ihre Art, zu denken, zu sprechen und mit Gefühlen umzugehen, im Rahmen dieser Behandlung einer deutlich negativen Bewertung ausgesetzt war. Ihnen wird - mehr oder weniger explizit - unterstellt, dass sie ihre Gefühle dadurch »abwehren«, dass sie sich der Welt, dem Zwischenmenschlichen und dem Emotionalen auf sehr rationale und analytische Weise nähern. Ihre natürliche Art, zu sein und zu denken, wird so mit dem Label des Minderwertigen und Pathologischen versehen. Meist wird dies davon begleitet, dass der Therapeut seinen eigenen Wunsch, dass dies geändert werden solle, auf den Patienten projiziert. Und wenn der Patient dann diesen Wunsch (nach unmittelbarerem Zugang zu Gefühlen und Gefühlsausdruck) gar nicht teilt, wird auch dies pathologisiert." (S. 123)
METAPHORIK: Vorsicht! und Verständnis-Klärung. (S. 124)
"ABSTINENZ DES THERAPEUTEN Bei der Therapie von Erwachsenen mit ASS ist es immer wieder notwendig, sich bewusst zu machen, dass diese (etwa im Gegensatz zu Menschen mit Persönlichkeitsstörungen) oft einen echten Mangel an »sozialem Handwerkszeug« und am nötigen »unbewussten Wissen« haben, um im zwischenmensch-[>126]lichen Alltag zu bestehen. Es gilt also - zuerst einmal - nicht, innere Fehlhaltungen oder dysfunktionale Kognitionen zu korrigieren, ; sondern konkrete und detaillierte Hilfestellungen zur Bewältigung des Alltags anzubieten. Dabei sind auch persönliche (Lebens-)Erfahrungen des Therapeuten als modellhafte Wahrnehmungs- und Verhaltensmöglichkeiten durchaus von Nutzen. Der Therapeut sollte also auf keinen Fall in dem Sinne abstinent sein, dass er sein Weltwissen, seine Erfahrung und seine Kenntnis sozialer Zusammenhänge aus der Therapie herauszuhalten versucht. Vielmehr ist es unter anderem seine Aufgabe, dem Patienten das Leben und dabei insbesondere die soziale Kommunikation und deren Fallstricke zu erklären.
Hier empfiehlt es sich, sich als Therapeut Zusammenhänge der sozialen und emotionalen Kommunikation, die sonst eher intuitiv und unbewusst ablaufen, bewusster zu machen und sie in möglichst klare und konkrete Worte zu fassen: So wird von Menschen mit ASS gelegentlich mokiert, dass »neurotypische« Menschen »unlogische« Aussagen zuerst bejahten, um dann das Gegenteil zu behaupten. Bei genauerer Betrachtung stimmt das tatsächlich, bleibt aber meist unbewusst; man antwortet dem zweijährigen Kind, das sagt: »Da Kuh«, : mit; »Ja, da steht ein Pferd«. Auch im Umgang beispielsweise mit Vorgesetzten gibt es derartige Phänomene, die nach aller Wahrscheinlichkeit der sozialen Kohäsion und der Ausbalancierung von Inhalts- und Beziehungsebene im sozialen Kontakt dienen. Und genau das sollte der Therapeut dem Patienten dann erklären können."
- "PD Dr. med. Dr. phil. Andreas Riedel ist Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg und leitet die Spezialsprechstunde für Autismus-Spektrum-Störungen im Erwachsenenalter.
- Prof. Dr. phil. Jens Jürgen Clausen ist Erziehungswissenschaftler und Analytischer Gruppentherapeut und lehrt im Studiengang Heilpädagogik an der Katholischen Hochschule Freiburg."
Bibliographie: Levy, Steven (2020) Facebook - Weltmacht am Abgrund. Der unzensierte Blick auf den Tech-Giganten. München: Droemer.
Verlags-Info: "Amerikas führender Tech-Journalist Steven Levy über das Unternehmen, das unsere Gesellschaft für immer verändert hat: Facebook.
- Über zehn Jahre Gespräche mit Mark Zuckerberg: Niemand hat direkteren Zugang zu dem umstrittenen Tech-Genie als Steven Levy.
- Inside Facebook: Wie hinter verschlossenen Türen über das Schicksal von Milliarden Usern entschieden wird.
- Was auf uns zukommt: Mark Zuckerbergs Pläne für die Zukunft seines Unternehmens und die unserer Gesellschaft.
- Facebook, WhatsApp, Instagram: Wie das Unternehmen sich von einer Social-Media-Plattform zu einem der einflussreichsten Unternehmen unserer Zeit wandeln konnte.
- Mit welchen skrupellosen Strategien es Mark Zuckerberg gelang, seine Mitbewerber im Kampf um die Vormachtstellung im Silicon Valley auszubooten.
- Was bei dem Skandal um Cambridge Analytica hinter den Kulissen geschah und wie Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg um die Zukunft von Facebook ringen."
- Einführung 9
TEIL EINS 29
1 ZuckNet 31
2 Vor dem Verwaltungsrat 51
3 Thefacebook 73
4 In der »Casa Facebook« 98
5 Moralisches Dilemma 122
6 Das »Book of Change« 143
TEIL ZWEI 175
7 Die Plattform 177
8 »Pandemie« 213
9 Sheryls Welt 228
10 Wachstum! 249
11 »Move Fast and Break Things« 283
12 Parad igmenwechsel 328
13 Die Zukunft kaufen 357
TEIL DREI 397
14 Die Wahl 399
15 P wie Propaganda 440
16 Clown-Show 479
17 Das Hässliche 520
18 Integrität 556
19 The Next Facebook 587
Epilog 631
ANHANG 639
Danksagung 641
Quellen 644
Anmerkungen 645
Personenregister 676
Sachregister 682
Autor: "Steven Levy, Amerikas renommiertester Technik-Journalist (The Washington Post), schreibt einen mitreißenden Bericht aus dem Inneren des Unternehmens, der veranschaulicht, warum Facebook die Welt unumkehrbar verändert hat und dafür heute die Konsequenzen trägt."
Weiterlesen
Bewertung:
Bibliographie: Fromm, Erich (2020) Wissenschaft vom Menschen. Ein Lesebuch. Herausgegeben und eingeleitet von Rainer Funk. Gießen: Psychosozial-Verlag. 209 Seiten, Broschur, 148 x 210 mm. Erschienen im Februar 2020. ISBN-13: 978-3-8379-2958-4, Bestell-Nr.: 2958.
Verlags-Info: "Rainer Funk hat mit insgesamt 34 Texten eine konzentrierte und kompetente Einführung in Erich Fromms Denken zusammengestellt, die einen hervorragenden Überblick über die vielfältigen Aspekte seiner Vorstellung von einer »Wissenschaft vom Menschen« gibt.
Erich Fromm hat mit seiner Sozialpsychologie eine wichtige Grundlage für eine interdisziplinäre Wissenschaft vom Menschen geschaffen, die das Ganze des Menschseins nicht aus den Augen verliert. Die kenntnisreiche Einleitung und Auswahl der Texte macht mit dem weitgefächerten Werk des humanistischen Wissenschaftlers Erich Fromm bekannt. Ein Lesebuch für alle, die mehr wissen wollen über das wissenschaftliche Werk des Autors von Die Kunst des Liebens und Haben oder Sein."
Inhaltsverzeichnis:
- Einleitung des Herausgebers
1. Psychoanalyse der Gesellschaft
Die Verbindung von Psychoanalyse und Soziologie
Zur Methode der Analytischen Sozialpsychologie
Der sozial typische Charakter
Die Aufgabe des Gesellschafts-Charakters
Mein wissenschaftlicher Ansatz
Eine humanistische Wissenschaft vom Menschen
2. Das humanistische Menschenbild
Gibt es eine Natur des Menschen?
Die grundlegende Alternative des Menschen
Existenzielle Bedürfnisse und das Wohl-Sein des Menschen
Die angeborene Fähigkeit zur Biophilie
3. Die Bedeutung der Charakterbildung
Der Charakter als Ersatz für den Instinkt
Der autoritäre Charakter
Der Marketing-Charakter
Der narzisstische Charakter
Der nekrophile Charakter
4. Das Unbewusste
Das Unbewusste nach Sigmund Freud
Verdrängung, Widerstand, Übertragung
Das gesellschaftliche Unbewusste
Das Unbewusste ist der ganze Mensch
5. Das Selbst
Individuation und Wachstum des Selbst
Freiheit von und Freiheit für
Selbstliebe und Selbstsucht
6. Seelische Gesundheit und Gesellschaft
Gesellschaftlich ausgeprägte psychische Defekte
Was ist seelische Gesundheit?
Visionen einer seelisch gesunden Gesellschaft
Die Alternative eines humanistischen Sozialismus
7. Die psychotherapeutische Beziehung
Meine Revision der psychoanalytischen Therapie
Psychoanalyse der Konflikte mit irrationalen Kräften
Wirkungen der psychoanalytischen Therapie
Therapeutisches Bezogensein als »direkte Begegnung«
8. Religion und Humanismus
Religion als Orientierungsrahmen
Autoritäre und humanistische Religion
Gotteserfahrung mit und ohne Gottesbegriff
Credo eines Humanisten
Quellen- und Copyrighthinweise
Rezensionen:
AutorInnen:
Bewertung:
Bibliographie: Berth, Hendrik; Brähler, Elmar; Zenger, Markus & Stöbel-Richter, Yve (2020, Hrsg.) 30 Jahre ostdeutsche Transformation. Sozialwissenschaftliche Ergebnisse und Perspektiven der Sächsischen Längsschnittstudie. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Verlags-Info: "Seit 1987 begleitet die Sächsische Längsschnittstudie eine identische Gruppe Ostdeutscher auf dem Weg von DDR- zu BundesbürgerInnen. In diesem Buch werden ihre Einstellungen und Meinungen in Bezug auf die deutsche Wiedervereinigung sowie ihre Identitätsentwicklung ausführlich dargestellt. Obwohl die Mehrheit von ihnen die deutsche Einheit begrüßt, sich über gewonnene Möglichkeiten freut und die innere Einheit weiter voranschreitet, besteht doch immer noch eine Doppelidentität. Sie betrachten sich als BundesbürgerInnen, aber zugleich auch als BürgerInnen der ehemaligen DDR. Beiträge renommierter GastautorInnen ergänzen die Untersuchungsergebnisse und ordnen sie in einen übergreifenden Rahmen der ostdeutschen Transformation ein.
Inhaltsverzeichnis: Auf der Verlagsseite als PDF.
1 Die Sächsische Längsschnittstudie
Die Sächsische Längsschnittstudie 21
Zahlen und Fakten
Hendrik Berth, Elmar Brähler, Markus Zenger & Yve Stöbel-Richter
Über eine Studie, die schon mehrmals sterben sollte, noch immer
lebt und weiterleben muss 33
Peter Förster
Quo vadis Deutsche Einheit? 143
Ausgewählte Ergebnisse aus 30 Jahren Sächsische Längsschnittstudie
Hendrik Berth, Elmar Brähler, Markus Zenger & Yve Stöbel-Richter
Selbstsorge als Weg aus der Arbeitslosigkeit 157
Yve Stöbel-Richter, Kilian Erlen, Detje Vellema, Markus Zenger,
Elmar Brähler & Hendrik Berth
Daten, Quellen, offene Fragen 197
Die Sächsische Längsschnittstudie aus zeithistorischer Perspektive
Kathrin Zöller
Verwirklichung von Lebenszielen bei TeilnehmerInnen der Sächsischen
Längsschnittstudie 211
Was unterscheidet Umsetzer von Nichtumsetzern?
Anne-Kathrin Rehfeld
Auswirkungen (früh-)kindlicher Traumatisierung im Lebensverlauf
247
Eine Analyse von Daten der Sächsischen Längsschnittstudie
Marie-Luise Stolze
2 Kommentare
Bemerkungen zur Sächsischen Längsschnittstudie 273
Stefan Priebe
Anhaltende Sehnsucht nach einer Gesellschaft des guten Lebens
277
30 Jahre begleitende Forschung
Michael Brie
Deutsch-deutsche Erfolgsgeschichten 293
Michael Geyer
Die Sächsische Längsschnittstudie – ein Juwel? 299
Harald J. Freyberger († 2018 )
Wie geht es weiter? 301
Gert G. Wagner
3 30 Jahre Transformation Ostdeutschland
Zu möglichen Effekten der Teilnahme an einer Längsschnittstudie
307
Olaf Reis
Das Dilemma von Vereinigungsprozessen und die Sächsische Längsschnittstudie
327
Wolf Wagner
Wo bleiben sie denn? 333
Zur Marginalisierung Ostdeutscher in der Elitenrekrutierung
Raj Kollmorgen
Bibliografie zur Sächsischen Längsschnittstudie 357
Hendrik Berth
- "Vorwort
Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina stellte 2016 fest: »Bevölkerungsweite Längsschnittstudien bilden das Rückgrat der empirischen
Forschung in den Sozial-, Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaften sowie der Epidemiologie und der Gesundheitsforschung.« Längsschnittstudien
seien notwendig, so die Leopoldina weiter, um
1. »[sowohl] stabile Muster als auch Veränderungen im Zeitverlauf zu dokumentieren, neue Trends zu identifizieren sowie Zusammenhänge
zwischen sozioökonomischen und biomedizinischen Mechanismen zu analysieren«,
2. »unter klar definierten Bedingungen theoriegestützte Hypothesen zu Ursache-Wirkungs-Beziehungen« zu untersuchen und
3. »Vorhersagen über zukünftig zu erwartende Entwicklungen [abzuleiten, …] die eine wichtige Orientierungs- und Planungshilfe für gesellschafts-, wirtschafts- und gesundheitspolitische Entscheidungen bilden« (Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, 2016, S. 6).
Im Anhang der Leopoldina-Veröffentlichung findet sich eine Übersicht
über laufende bevölkerungsweite Längsschnittstudien in Deutschland.
Diese umfasst insgesamt 32 Untersuchungen, darunter auch die Sächsische
Längsschnittstudie. Die (angestrebten oder tatsächlich realisierten)
Teilnehmendenzahlen reichen bis hin zu 200.000 Personen in der 2014 begonnenen
Nationalen Kohorte (https://nako.de). In der Sächsischen Längsschnittstudie
wurden 1987 initial N = 1.407 Personen befragt. Zur weiteren Teilnahme
erklärten sich 1989 N = 587 Menschen schriftlich bereit. In der letzten
Welle 2017/2018 waren es 313 TeilnehmerInnen (53,4%). Damit weist die Sächsische
Längsschnittstudie in dieser Übersicht die kleinste Fallzahl
auf.
... ....
Der erste Abschnitt des Buches ist mit »Die Sächsische Längsschnittstudie
« überschrieben. Im ersten Kapitel des Buches wird zunächst
die Studie kurz vorgestellt. Leser, die mit der Anlage, Geschichte und
Entwicklung der Untersuchung vertraut sind, können das erste Kapitel
getrost [>10]
Website: www.wiedervereinigung.de/sls
GESIS: http://bit.ly/sls-gesis
Bewertung: Ich konnte im Buch keine Ausführungen zu den Zielen der Sächsischen Längsschnittstudie entnehmen, die ich am Anfang erwartet hätte. Dem Wikipedia-Eintrag: "Sächsische Längsschnittstudie" (Abruf 27.02.2020) konnte ich entnehmen, der "Schwerpunkt der Studie ist die sozialwissenschaftliche Erforschung des Erlebens der Wiedervereinigung", eine zweifellos psychologisch sehr interessante Fragestellung. Da die Studie bereits 1987 in DDR begann, stellt sich die Frage, wie damals das Erleben der Wiedervereinigung vorzustellen ist? Ich wollte das Buch präsentieren, weil mich im Titel der Ausdruck "Transformation" neugierig gemacht hat. Zwar ist dem III. Teil des Buches die Überschrift "30 Jahre Transformation Ostdeutschland" vorangestellt, aber dezidierte Ausführungen zu diesem Transformationsprozess habe ich nicht gefunden. Im Anhang spätestens hätte ich den Fragenkatalog der Längsschnittstudie erwartet. Ein Stichwortregister wäre hilfreich gewesen.
Bibliographie: Altstötter-Gleich, Christine & Geisler, Fay C.M. (2018) Perfektionismus. Mit hohen Ansprüchen selbstbestimmt leben. Mit herunterladbaren Arbeitsmaterialien. BALANCE ratgeber. Köln: Balance.
Verlags-Info:
- "Dieser wissenschaftlich fundierte Ratgeber beschreibt Chancen und
Risiken perfektionistischer Tendenzen. Sie erfahren, welche psychologischen
Prozesse dazu führen, dass das Streben nach anspruchsvollen Zielen
zur Belastung wird. Denkanstöße und Übungen unterstützen
Sie darin, Ihren Perfektionismus zu verstehen und einen gesunden Umgang
mit hohen Ansprüchen zu erlernen.
Was unterscheidet gesunden vom ungesunden Perfektionismus? Wie entsteht Perfektionismus? Wann ist therapeutische Unterstützung notwendig? Wie ist es möglich, sich selbst wertzuschätzen, ohne anzunehmen, dafür perfekt sein zu müssen?
Erratum: Kaum etwas im Leben ist perfekt. Das gilt leider auch für dieses Buch. Auf S. 138 der Printausgabe fehlt die zweite Hälfte der Aussagen zum Selbstwertgefühl. Sie finden diese vollständig bei den Downloadmaterialien. Wir bitten um Ihr Verständnis."
- Einleitung 9
Perfektionismus - was genau ist das eigentlich? 13
Normaler und neurotischer Perfektionismus
Oder warum es gesünder ist, dem Misslingen nicht mehr Aufmerksamkeit
zu schenken als dem Gelingen 14
Positiver und negativer Perfektionismus
Oder warum es gesünder ist, Erfolg haben zu wollen, als zu versuchen,
Misserfolge zu vermeiden 17
Zwischenfrage:
Normalen oder positiven Perfektionismus - gibt es das überhaupt?
21
Klinisch relevanter Perfektionismus
Oder warum das Festhalten an hohen Ansprüchen zum Problem werden
kann 22
Zwischenfrage:
Sind die Ansprüche von klinisch relevanten Perfektionisten zu
hoch? 25
Gesunder und ungesunder Perfektionismus
Oder unter welchen Bedingungen anspruchsvolle Standards krank machen
26
Perfektionistische Bedenken
Oder was dazu beiträgt, dass Perfektionismus zum Problem wird
29
Die Ansprüche anderer
Oder warum nicht nur die Ansprüche an sich selbst zu psychischen
Problemen führen können 39
Fazit
Oder wie man zusammenfassen kann, unter welchen Bedingungen hohe Ansprüche
zum Problem werden können 44
Wie entsteht Perfektionismus? 48
Nochmal das Wichtigste 55
Therapie 62
Woran merken Sie, dass therapeutische Unterstützung notwendig ist? 73
Therapie? Das brauche ich nicht, ich krieg’ das schon selber hin! 76
Hilfe zur Selbsthilfe 80
Zur Erinnerung: Wann wird Perfektionismus zum Problem? 85
Ein Modell zum problematischen Perfektionismus 88
In Grautönen denken
Oder warum es für Perfektionisten hilfreich sein kann, ihren ersten
Eindruck zu überprüfen 90
Ich denke, also fühle ich
Oder warum es gut tun kann, die eigenen Gedanken einem Realitätscheck
zu unterziehen 100
Stellen Sie Ihre Ziele auf die Probe
Oder warum es lohnend sein kann, sich mit seinen Zielen etwas genauer
auseinander zu setzen 119
Sich selbst wertschätzen statt zu bewerten
Oder wie es gelingen kann, Selbstwertkontingenzen zu entschärfen
134
Der unproblematische Perfektionismus 144
Zum Schluss 146
Danksagungen 147
Anhang 149
Emotionen 149
Literatur 151
- Hoffnung auf Erfolg oder Angst vor Misserfolg - was motiviert Sie?
- Vermeidungsverhalten unter der Lupe
- Ein Blick zurück in die Kindheit
- Nutzen und Kosten meines Perfektionismus
- Perfektionismus auf der Waagschale
- Nutzen und Kosten einer Veränderung
- Wägen Sie Kosten und Nutzen einer Veränderung ab
- Das Schwarz-Weiß-Tagebuch
- Kriterien für eine depressive Episode
- Das Gedankentagebuch
- Sieben Fragen zum Realitätscheck Ihrer Gedanken
- Alternative Gedanken zu einem Misserfolg
- Was will ich wie verändern?
- TIC-TOC-Liste
- Weil ich es mir wert bin
- Informationen zum Selbstwertgefühl
- "Perfektionismus - was genau ist das eigentlich?
Die systematische Forschung zum Thema Perfektionismus ist relativ jung. Erst 1980 erschien einer der ersten Artikel zu dem Thema im Fachjournal Psychology Today. Der Autor, David BURNS, ein inzwischen emeritierter Professor der Stanford University of Medicine, zeichnet darin ein sehr dunkles Bild des Perfektionismus: Ängste und zwanghaftes Verhalten, Depressionen, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Selbstmord zu begehen, usw. - die Liste von psychischen Erkrankungen, die für den Pionier der Perfektionismusforschung mit diesem Persönlichkeitsmerkmal einhergehen, ist lang. Ergänzt werden muss sie heute um Ess- und sexuelle Funktionsstörungen, bei denen hohe Ansprüche an den eigenen Körper zu schweren psychischen Beeinträchtigungen führen können. Einen guten, kurz gefassten Überblick zum Zusammenhang zwischen Perfektionismus, körperlicher Gesundheit und psychischen Störungsbildern bietet der Psychotherapeut Nils SPITZER (2016). Auch die australische Psychologin Sarah EGAN und ihre Kolleginnen fassen eine Vielzahl empirischer Studien zu den wichtigsten psychischen Störungen zusammen (EGAN u.a. 2011). Sie kommen zu dem Schluss, dass Perfektionismus sowohl ein Risikofaktor ist für das Entstehen so unterschiedlicher psychischer Erkrankungen wie Anorexie und Bulimie, Angst- und Zwangserkrankungen oder Depressionen und Selbstmordneigung, als auch ein wichtiger Faktor, der diese Störungen aufrechterhält.
Um zu verstehen, warum Perfektionismus ein Risiko für das physische und psychische Wohlergehen ist, und um daraus geeignete Maßnahmen abzuleiten, um den negativen Konsequenzen [>14] zu begegnen, ist es sinnvoll und notwendig, »den« Perfektionismus genauer zu betrachten. Schließlich erkranken ja nicht alle Menschen, die Perfektion erreichen wollen, sondern sie werden auch zu Erfindern, deren Erkenntnisse und Produkte unser Leben bereichern, zu Spitzensportlern, deren Leistungen wir bewundern, oder zu Künstlern, deren Können uns Freude macht und Respekt abverlangt.
Normaler und neurotischer Perfektionismus
Oder warum es gesünder ist, dem Misslingen nicht mehr Aufmerksamkeit
zu schenken als dem Gelingen
Zwei Jahre vor David Burns beschreibt Don HAMACHEK (1978) von der University
of Michigan Perfektionismus etwas differenzierter als dieser. Er unterscheidet
zwischen einem normalen Perfektionismus und einem neurotischen
Perfektionismus. Beide Formen des Perfektionismus haben gemeinsam,
dass sich Menschen mit einer hohen Ausprägung in diesen Merkmalen
sehr anspruchsvolle Ziele setzen. Um diese zu erreichen, sind sie bereit,
große Anstrengungen auf sich zu nehmen. »Normale« Perfektionisten
ziehen dabei aus ihrem Streben nach exzellenten Leistungen ein Gefühl
von Befriedigung. Sie freuen sich über Erfolge, stärken so ihr
Selbstwertgefühl. Bei »neurotischen« Perfektionisten ist
das nicht der Fall. Sie empfinden nur selten Befriedigung über ihre
Leistungen, weil sie kaum jemals etwas als gut genug beurteilen. Nach ihrer
Einschätzung gibt es immer noch Spielraum für Verbesserungen,
ist da immer noch etwas, das sie hätten besser machen können
oder sollen.
Bringt man die Annahmen von Hamachek auf den Punkt,
kann man sagen, dass die Aufmerksamkeit von -normalen« Perfektionisten
auf das Gelingen dessen was sie tun gerichtet ist und auf das, was erforderlich
ist, um Erfolg mit dem zu haben, was sie tun. Kleine Abweichungen von einem
vollkommenen, idealen oder eben perfekten Ergebnis können so leichter
akzeptiert werden oder werden sogar zum positiven Anreiz, sich noch ein
bisschen mehr zu bemühen. Gleichzeitig ist der Blick auf das, was
gelungen ist, Belohnung für die .Mühen, macht stolz und trägt
so zu einer Stärkung des Selbstwertgefühls bei.
»Neurotische« Perfektionisten richten ihre Aufmerksamkeit
dagegen eher auf alles, was darauf hindeuten könnte, dass etwas nicht
gelungen ist und auf das, was auf ein mögliches Scheitern hinweist.
Dabei ist ihre Perspektive häufig durch ein ausgeprägtes Schwarz-Weiß-Denken
geprägt. Pointiert ausgedrückt hat unter dieser Perspektive kaum
etwas die Chance, als gelungen angesehen zu werden: selbst kleine Abweichungen
werden registriert und als Hinweis auf ein Scheitern der eigenen Bemühungen
interpretiert.
Damit keine Missverständnisse entstehen: Es
ist wichtig, dass wir in der Lage sind, Fehler zu erkennen. Ohne diese
Fähigkeit würden wir uns und anderen viel Schaden zufügen
und ohne zu erkennen, was nicht optimal ist, wäre sozialer, wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Fortschritt nicht denkbar. Aber es fällt nicht
schwer, sich vorzustellen, dass eine zu starke Fokussierung auf die Defizite
unseres Handelns kein Gefühl der Belohnung für die unternommenen
Anstrengungen nach sich zieht, dass statt Stolz eher Schuld und Scham über
das subjektive Versagen empfunden wird und dass dieses Erleben das Selbstwertgefühl
eher schwächt als stärkt."
Es schließt die erste Wahrnehmungsübung
an.
AutorInnen:
- Dr. Christine Altstötter-Gleich ist Dozentin an der Universität Koblenz-Landau und Perfektionismus-Expertin.
- Dr. Fay Geisler ist psychologische Psychotherapeutin, lehrt an der Universität Greifswald Persönlichkeitspsychologie und forscht zur Selbstregulation und Selbstkontrolle.
Bewertung:
Übersichtlich, informativ, kompakt und praktisch, auch verständlich,
mit vielen Anregungen und Übungen (Arbeitsmaterialien) und daher hilfreich,
also empfehlenswert.
Bibliographie:Teismann, Tobias (2018) Grübeln. Wie Denkschleifen entstehen und wie man sie löst. Unter Mitarbeit von Ruth von Brachel, Sven Hanning & Ulrike Willutzki. 3. kor. A. Mit herunterladbaren Arbeitsmaterialien. Köln: Balance.
Verlags-Info: "Grübeln belastet und kann zum Entstehen von Depressionen beitragen und sie aufrecht erhalten. In diesem Buch erfahren Sie, was Grübeln von anderen Formen des Nachdenkens unterscheidet und welche Ursachen es dafür gibt. Viel-Grübler/innen lernen, fruchtloses Grübeln zu überwinden.
Dieses Buch informiert über den neuesten Wissensstand zu Erscheinungsbild, Ursachen und Konsequenzen häufigen Grübelns, in der Psychologie auch Rumination genannt (von lat. Ruminare = wiederkäuen). Der erfahrene Psychotherapeut Dr. Tobias Teismann schafft mit seinem Buch Abhilfe und vermittelt ein nachweislich erfolgreiches Programm zur Überwindung depressiven Grübelns. Wie es funktioniert, erklärt der Autor leicht verständlich und mit vielen praktischen Beispielen. Das Buch enthält ausführliches Übungsmaterial, das seinen Lesern auch als Download zur Verfügung gestellt wird."
Inhaltsverzeichnis:
- Einleitung 7
Grübeln: was es ist und wie es sich auswirkt 10
Wann spricht man von Grübeln? ??
Was unterscheidet Grübeln von anderen Arten des Nachdenkens? 13
Wie wirkt sich Grübeln aus? 18
- Ein Netzwerk von Gedanken und Gefühlen 19
Wie das Grübeln untersucht wird 21
Wie wirkt sich Grübeln auf die Stimmung aus? 24
Wie wirkt sich Grübeln auf das Denken aus? 28
Wie wirkt sich Grübeln auf die Fähigkeit, Probleme zu lösen, aus? 31
Wie wirkt sich Grübeln auf Motivation und aktives Verhalten aus? 34
Wie wirkt sich Grübeln auf soziale Beziehungen aus? 35
Wie wirkt sich Grübeln auf das Überwinden traumatischer Erlebnisse und auf Ängste in sozialen Situationen aus? 37
Wie wirkt sich Grübeln auf die körperliche Gesundheit aus? 40
Ursachen depressiven Grübelns 43
Versprechungen des Grübelns 43
Besorgnis über das Grübeln 46
Gedanken sind Gedanken und nicht die Realität 49
Grübeln lohnt sich manchmal - zumindest kurzfristig 51
An negativen Informationen kleben 54
Überwinden depressiven Grübelns 57
Grübeln unter der Lupe 58
Aufmerksamkeit und Konzentration schulen 67
- Exkurs: Achtsamkeitsmeditation und Aufmerksamkeit 73
- Ablenkung 78
Aktivität 80
Aufmerksamkeit auf gegenwärtige Sinneseindrücke 82
Vorsicht Falle: Gedankenunterdrückung 83
Grübelaufschub und Grübelzeiten 86
Versprechungen des Grübelns prüfen 98
Probleme auf konkrete Weise angehen 106
Emotionale Verarbeitung 116
- Aufschreiben, was einen bewegt 117
Über persönliche Ziele schreiben 124
Hilft das alles? 128
Literaturverzeichnis 133
- ARBEITSBLATT 1 Grübeln unter der Lupe (Teismann u. a. 2012, S. 148)
- ARBEITSBLATT 2 Ablenkung, Aktivität und Achtsamkeit
- ARBEITSBLATT 3 Versprechungen des Grübelns
- ARBEITSBLATT 4 Strukturiertes Problemlösen
- Audiodatei: Blätter im Fluss (Imaginations Übung nach Steven Hayes)
- Audiodatei: Aufmerksamkeitstraining
- "Wann spricht man von Grübeln?
- sich wieder und wieder um ähnliche Inhalte drehen,
- sich auf vergangene oder gegenwärtige Erfahrungen beziehen, [>11]
- eher abstrakter Natur sind und
- nicht auf eine Lösung oder Veränderung ausgerichtet sind.
- ... gehen mir dieselben Gedanken immer und immer wieder durch den Kopf.
- ... denke ich an all meine Probleme, ohne eines von ihnen zu lösen.
- ... stelle ich mir immer wieder Fragen, auf die ich keine Antwort finde.
- ... verhindern meine vielen Gedanken, dass ich mich konzentrieren kann.
- ... fühle ich mich gezwungen, immer wieder über das Gleiche nachzudenken.
- ... nehmen meine Gedanken meine volle Aufmerksamkeit in Anspruch.
- ... kommen mir Erinnerungen und Gedanken an das Ereignis auch dann in den Kopf, wenn ich gar nicht daran denken will.
- ... beginne ich, über meine Vergangenheit, Personen, [>13] die mich verletzt haben, Fehler, die ich gemacht habe, und andere schlechte Erlebnisse in meiner Lebensgeschichte nachzudenken.
Grübeln ist dadurch gekennzeichnet, dass man von negativen Gedanken über die eigene Person, über vergangene bzw. gegenwärtige Entscheidungen, Begegnungen oder Geschehnisse nicht loskommt. Immer wieder drehen sich die Gedanken um vermeintliche Schwächen, Misserfolge und Betrübnisse. Anfangs kreisen die Gedanken dabei meist um ein konkretes Ereignis (z. B. »Warum hat mein Nachbar mich heute Morgen nicht gegrüßt?«). Doch mit der Zeit greifen sie auf andere Ereignisse und Erfahrungen über und schließlich wenden sich die Gedanken allgemeineren Themen, dem Großen und dem Ganzen zu: »Lebe ich das Leben, das ich leben sollte?« »Warum kann ich nie richtig glücklich sein?« »Warum mache ich es mir immer so schwer?« Die Gedanken werden also immer abstrakter und die Wahrscheinlichkeit, dass einem eine Antwort auf seine Fragen einfällt, wird zunehmend geringer. Gleichzeitig wird das Denken immer negativer. Man setzt sich nicht neutral und neugierig mit seiner eigenen Person, dem eigenen Erleben und Verhalten auseinander, sondern betrachtet sich zunehmend selbstkritisch und abwertend. Daraus folgt, dass das Denken in einer passiven Betrachtung persönlicher Verfehlungen und Unzulänglichkeiten verharrt.
Zusammenfassend beschreibt Grübeln also eine Kette von Gedanken und Vorstellungen, die
BEISPIELE Bei Monika Zwerch, einer 32-jährigen Hausfrau, drehen sich die Grübeleien stets um die Frage, warum sie sich vor sechs Jahren auf die Ehe mit ihrem wortkargen, einzelgängerischen Mann eingelassen hat und ob sie sich nun trennen soll oder nicht. Konkrete Anlässe für ihr langwieriges Gedankenkreisen können bereits kleinste Äußerungen ihres Mannes sein. In solchen Momenten denkt sie zunächst darüber nach, warum er dieses und jenes gesagt und wie er es gemeint haben könnte. Später wirft sie sich dann vor, dass sie so passiv ist, dass sie es nicht besser verdient hat und dass sie ohnehin zu unattraktiv ist, um jemals einen anderen Partner zu finden.
Richard Bisinger, ein 50-jähriger selbstständiger Handelskaufmann, kann den Anlass für seine Grübeleien meist gar nicht benennen. Häufig passiert es ihm schon morgens am Frühstückstisch, dass er in Grübeleien versinkt. Die Gedanken über das Aus seiner Partnerschaft nach zwanzig Jahren Ehe nehmen ihn dann so ein, dass er gar nichts mehr um sich herum mitbekommt und erst nach 20 bis 30 Minuten wieder aus seinen Gedanken »auftaucht«. Er ist dann wie gelähmt.
Während gelegentliches Grübeln über akute Belastungen und Entscheidungen sicher von den meisten Menschen gut weggesteckt wird, verursacht gewohnheitsmäßiges, lang anhalten-[>12]des oder häufig wiederkehrendes Grübeln oftmals deutliches Leiden bei den Betroffenen — zumal sie das viele Grübeln nüchtern betrachtet als sinnlose Zeitverschwendung erleben.
Es existiert allerdings keine klar definierte Trennlinie zwischen unproblematischem Gelegenheitsgrübeln und krankhaftem Dauergrübeln. Inwieweit etwas gegen wiederkehrende Grübeleien unternommen werden sollte, entscheidet somit einzig der Leidensdruck der Betroffenen. Eine Bestandsaufnahme der Art des persönlichen Zu-viel-Denkens kann mit den folgenden Aussagen vorgenommen werden (vgl. EHRING u. a. 2011). Welche treffen auf Sie zu?
ÜBUNG Persönliche Grübelneigung
Nach belastenden Ereignissen oder in negativer Stimmung ...
Was unterscheidet Grübeln von anderen Arten des Nachdenkens?
Nicht alle Gedanken, die sich wieder und wieder um vergleichbare Inhalte
drehen, werden als Grübeln bezeichnet. Natürlich ist es wichtig,
zwischen ungünstigen Grübeleien und hilfreichem Nachdenken zu
differenzieren. Unter einer klinisch-psychotherapeutischen Perspektive
kommt es außerdem darauf an, Grübeln von Sorgen und von Zwangsgedanken
zu unterscheiden.
Sorgen: In der psychologischen Forschung ist Grübeln etwas
anderes als Sichsorgen. Sorgen beschäftigen sich vor allem mit »Was
ist, wenn ...? «-Fragen, d.h. damit, was in der Zukunft möglicherweise
geschehen könnte: »Was ist, wenn ich die Schule nicht schaffe?
Was ist, wenn die Verabredung nicht gut läuft? Was ist, wenn ich Angst
bekomme?« Grübeleien drehen sich hingegen in erster Linie um
»Warum?«-Fragen, d.h. nicht um mögliche Ereignisse
in der Zukunft, sondern um Ereignisse, die bereits eingetreten sind: »Warum
kann ich nicht richtig fröhlich sein? Warum musste mir das passieren?
Was hat das zu bedeuten, dass ich mich so schlecht konzentrieren kann?«
Sorgen zielen darauf ab, vor zukünftigen Gefahren zu schützen,
während Grübeln eher dazu dient, die Bedeutung von eingetretenen
Situationen und Ereignissen zu erfassen (siehe die Abbildung auf der nächsten
Seite). Sorgen werden eher von Angst, Grübeleien von Gefühlen
von Traurigkeit begleitet.
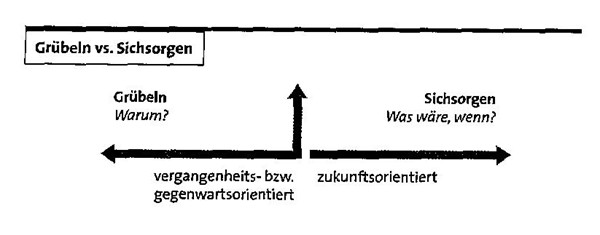
"
Bewertung: kurz, kompakt, praktisch, verständlich, mit vielen Anregungen und Übungen, hilfreich: empfehlenswert.
Querverweise:
Braunsberg, Günter & Wunderling, Katja (2020) Katja Wunderling. Nürnberg: Edition Braunsberg. [ISBN 978-3-00-064252-4] 1. Auflage 116 Seiten mit vielen meist farbigen Abbildungen.
Herb, Vincent (2019) Das kalte Schweigen. Literarische Dokumentation. Weinmar 2013/ Oktober 2019. Weinmar: Selbstverlag. > Info.
Nicoll, Norbert (2016) Adieu, Wachstum! Das Ende einer Erfolgsgesichte. Marburg: Tectum.
Felber, Christian (2019)This is not economy. Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft. Verlag: Deuticke
Bibliographie: Marmion, Jean-François (2019, Hrsg.) Die Psychologie der Dummheit. München: riva.
Inhaltsverzeichnis * Leseprobe * AutorInnen * Definitionen und Definitionsversuche * Bewertung.
Verlags-Info: "Ist eine Welt ganz ohne Dummköpfe möglich? Leider nein. Und dennoch sollte man über die Dummheit nachdenken, denn jeder kennt sie und jeder muss sie täglich ertragen. Die Dummheit ist – und zwar seitdem es den Menschen gibt – eine Bürde, von der wir uns nach Kräften befreien sollten. Obwohl Spezialisten für menschliches Verhalten, haben Psychologen noch nie den Versuch unternommen, der Dummheit auf den Grund zu gehen. Das Phänomen will allerdings erst verstanden werden, bevor wir den Kampf dagegen aufnehmen können. Und so versammelt dieser Band einige der namhaftesten Psychologen aus aller Herren Länder sowie Philosophen, Soziologen und Schriftsteller, die ihre Lesart dieses grundlegenden Wesenszugs des Menschen präsentieren. Eine Weltpremiere!"
Inhaltsverzeichnis (AutorInnen von RS eingebracht):
- 1 Wissenschaftliche Erforschung der Dummheit 17
- Von Serge Ciccotti Psychologe und wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Universität Bretagne-Sud
- Von Jean-François Dortier Gründer und Direktor
der Zeitschriften Le Cercle Psy und Science Humaines
- Von Im Gespräch mit Aaron James Professor für
Philosophie an der Universität von Kalifornien in Irvine
- Von Pascal Engel Philosoph und Direktor der Elitehochschule
École des hautes études en sciences sociales
- Von Jean-François Marmion Psychologe und Chefredakteur
der Zeitschrift Le Cercle Psy
- Von Ewa Drozda-Senkowska Professorin für Sozialpsychologie
an der Universität Paris-Descartes
- Von Im Gespräch mit Daniel Kahneman Professor emeritus
für Psychologie an der Universität Princeton, Nobelpreisträger
für Wirtschaft
- Von Pierre Lemarquis Neurologe und Essayist
- Von Yves-Alexandre Thalmann Doktor der Naturwissenschaften
und Professor für Psychologie am Collège Saint-Michel in Fribourg
(Schweiz)
- Von Brigitte Axelrad Honorarprofessorin für Philosophie
und Psychologie
- Von Im Gespräch mit Nicolas Gauvrit Psychologe und
Mathematiker, Professor an der École supérieure du Professorat
et de l’Éducation in Lille, institutionelles Mitglied des Laboratoire
Universitaire »Cognitions Humaine et Artificielle« (Chart)
- Von Boris Cyrulnik Neuropsychiater und Studiendirektor
an der Universität von Toulon
- Von Patrick Moreau Professor für Literatur am Collège
Ahuntsic in Montreal, Chefredakteur der Zeitschrift Argument
- Von Im Gespräch mit Antonio Damasio Professor für
Neurologie und Psychologie an der University of Southern California in
Los Angeles, wo er das Brain and Creativity Institute leitet
- Von Jean Cottraux Klinischer Psychiater im Gesundheitsdienst
Gründungsmitglied der Akademie für Verhaltenstherapie
in Philadelphia
- Von Im Gespräch mit Ryan Holiday Autor, ehemaliger
Marketing-Director, Kolumnist beim New York Observer
- Von François Jost Professor emeritus für
Kommunikationswissenschaft an der Universität Paris III – Sorbonne
Nouvelle
- Von Im Gespräch mit Howard Gardner Professor für
Kognitionswissenschaft und Pädagogik an der Harvard Graduate School
of Education, Begründer der Theorie der multiplen Intelligenzen
- Von Sebastian Dieguez Neuropsychologe und Forscher am
Laboratory for Cognitive and Neurological Sciences der Université
de Fribourg
- Von Pierre de Senarclens Honorarprofessor für internationale
Beziehungen an der Universität Lausanne Ehemaliger hochrangiger Funktionär
bei der UNESCO und beim Internationalen Roten Kreuz
- Von Claudie Bert Wissenschaftsjournalistin, spezialisiert
auf Humanwissenschaften
- Von Im Gespräch mit Dan Ariely Inhaber des Lehrstuhls
für Verhaltensökonomik am Massachusetts Institute of Technology
(MIT)
- Von Laurent Bègue Mitglied des Institut universitaire
de France (Einrichtung zur Förderung der Spitzenforschung)
und Direktor des Maison des Sciences de l’Homme (Haus der Humanwissenschaften) in Grenoble
- Von Emmanuelle Piquet Psychopraktikerin und Begründerin
der Zentren von Chagrin Scolaire (Schulkummer)
- Von Im Gespräch mit Alison Gopnik Professorin für
Psychologie und Philosophie an der Universität Berkeley
- Von Delphine Oudiette Forscherin am Institut du Cerveau
et de la Moëlle épinière in der
Forschergruppe »Motivation, Gehirn und Verhalten«
- Von Im Gespräch mit Jean-Claude Carrière
Schriftsteller und Drehbuchautor
- Von Stacey Callahan Professorin für klinische Psychologie
und Psychopathologie an der Universität Toulouse 2 »Jean Jaurès«,
Forscherin am Centre d’études et de recherches en psychopathologie
et psychologie de la santé (CERPRS)
- Von Im Gespräch mit Tobie Nathan Professor emeritus
für Psychologie an der Universität Paris VIII in Vincennes –
Saint-Denis, Schriftsteller und Diplomat
Leseprobe: "Warnung an den Leser.
Lasst, die Ihr hier lest, alle Hoffnung fahren!" auf der Verlagsseite als
PDF.
Lasst, die Ihr hier lest, alle Hoffnung fahren!
»Der gesunde Menschenverstand ist die am besten verteilte Sache
auf der Welt«, heißt es bei Rene Descartes. FN1
Doch wie steht es mit der Dummheit?
Ob sie nur tröpfelt oder trieft, ob sie dümpelt
oder tost, sie ist allgegenwärtig und kennt weder Grenzen noch Schranken.
Manchmal nur ein leises, beinahe schon angenehmes Plätschern, manchmal
ein ekliger, stehender Schlammpfuhl, dann wieder ein Beben, eine stürmische
Bö, eine alles auf ihrem Weg verschlingende, zertrümmernde, verhöhnende,
besudelnde Flut, übergießt die Dummheit alles und jeden mit
ihrem Schmutz. Und schlimmer noch - es wird gemunkelt, wir selbst seien
die Quelle. Ich jedenfalls habe so ein Gefühl, als wäre ich nicht
ganz dicht.
Die unerträgliche Schwerfälligkeit des Seins
Jeden Tag sieht, hört oder liest man unweigerlich
von irgendwelchen Dummheiten. Zugleich begeht, denkt, erbrütet und
verzapft ein jeder selbst auch immer wieder Dummheiten. Wir alle sind [>10]
Gelegenheitsdummköpfe, die mal eben schnell Unsinn anstellen, der
aber nicht gleich das Ende der Welt bedeutet. Der entscheidende Punkt dabei
ist, dass man sich bewusst macht, falsch gehandelt zu haben, und das zu
bedauern. Irren ist nun einmal menschlich, und seinen Fehler ehrlich zuzugeben
ist schon die halbe Vergebung. Irgendwer hält einen ja immer für
einen Esel, auch wenn man allzu selten selbst diese Person ist ...
Aber abgesehen von solchen auf eher leisen Sohlen
einherwandelnden, alltäglichen Torheiten hat man es unglücklicherweise
auch immer mit dem lautstarken Getrampel von Dummköpfen erster Ordnung
zu tun: selbstherrlichen, ihre eigene Dummheit herausschreienden Dummköpfen.
Diese Sorte Dummkopf ist nun, egal, ob sie im Beruf oder in der Familie
unseren Weg kreuzt, ganz und gar nicht belanglos. Diese Menschen machen
einen fassungslos. Sie martern dich mit obstinatem Beharren auf ihrer haarsträubenden
Blödheit und ihrer durch nichts gerechtfertigten Arroganz. Welche
sie zementieren und betonieren, während sie deine Meinung, deine Gefühle,
deine Würde am liebsten mit einem Federstrich vom Tisch fegen würden.
Diese Leute vergiften dein Gemüt und machen es einem schwer, an eine
Form von Gerechtigkeit auf Erden zu glauben. Selbst mit einem gerüttelt
Maß an Nachsicht mag man in ihnen nicht seinen Nächsten erkennen.
Dummheit ist ein Versprechen, das nicht eingelöst
wurde: das Versprechen von Verstehen und Vertrauen, preisgegeben vom Dummkopf,
dem Verräter an der menschlichen Natur. Darum belegt man ihn auch
gerne mit Schimpfworten aus dem Tierreich. Wir würden ihn gern nett
finden, ihn zu unseren Freunden machen, doch dafür ist der Dummkopf
nicht zu gebrauchen - er ist mit uns nicht auf Augenhöhe. Er leidet
an einer Krankheit, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Und da er sich
ohnehin weigern würde, sich mit einem solchen Kraut kurieren zu lassen,
aus der festen Überzeugung heraus, der einzige Einäugige in einer
Welt voller Blinder zu sein, ist [>11] die Tragikomödie perfekt. Es
verwundert nicht, wenn von diesem Zombie eine gewisse Faszination ausgeht,
von seiner Scheinexistenz, seiner geistigen Nichtigkeit, seinem großspurigen,
wesenhaften Anspruch, alle Menschen, alle, die etwas Großes geleistet
haben, alle, die einfach nett sind, auf sein Niveau hinunterzuziehen. Schließlich
möchte auch der Dummkopf aus Ihnen einen Hirnamputierten machen: Der
Versager wird es sich nicht versagen, sich zum Richter über Sie aufzuwerfen.
Der Dummkopf ist in seiner höchsten Form manchmal sogar intelligent,
gebildet zumindest: Er würde so manches Buch (und seinen Verfasser
gleich dazu) auf den Scheiterhaufen werfen - im Namen eines anderen Buches,
einer anderen Ideologie oder im Namen dessen, was große Meister (ob
nun ihrerseits Dummköpfe oder nicht) gelehrt haben. So sehr liegt
es ihm im Blut, das Raster, das er über den Text legt, zu Gitterstäben
eines Käfigs zu machen.
Der Zweifel macht irr, Gewissheit macht dumm
Der Dummkopf reinsten Wassers bricht ruckzuck, unwiderruflich und ohne
mildernde Umstände den Stab über Sie, einfach auf den blanken
Augenschein hin, den er dem engen Spalt zwischen seinen Scheuklappen entnimmt.
Er weiß sich als eifrig besorgter Bürger zu präsentieren,
um im Namen der Tugend, des Anstands oder des Respekts seinesgleichen um
sich zu scharen und zur Lynchjustiz aufzurufen. Der Dummkopf jagt im Rudel
und denkt in der Herde. Wie singt doch George Brassens: »Der Plural
bekommt dem Menschen nicht gut. Sobald ihrer mehr als vier sind, sind sie
eine Bande von Dummköpfen.« Und weiter: »Gepriesen sei,
wer keine sakrosankten Ideale hat und sich damit begnügt, seinen Nachbarn
nicht allzu sehr auf die Nerven zu gehen!« Leider lassen die Nachbarn
sich diese Gelegenheit nicht immer nehmen!
Doch damit, Ihnen das Leben zu vermiesen, ist der
penetrante Dummkopf noch nicht zufrieden. Wirklich zufrieden ist er stets
nur mit sich selbst, und zwar unerschütterlich, immun gegen jede [>12]
Art zögerlicher Unsicherheit. Und absolut sicher, im Recht zu sein.
Der glückliche Dummschädel geht Ihnen auf den Sack, ohne sich
deswegen einen Kopf zu machen. Der Dummkopf nimmt seine Überzeugungen
für in Stein gemeißelte Wahrheiten, während alles Wissen
doch letztlich auf Sand gebaut ist. Der Zweifel macht irr, Gewissheit macht
dumm - da heißt es, sich für eine Seite entscheiden. Der Dummkopf
weiß alles besser als Sie, ob es nun darum geht, was Sie denken oder
fühlen, was Sie mit Ihren zehn Fingern anstellen oder was Sie wählen
sollten. Er weiß besser als Sie selbst, wer Sie sind und was gut
für Sie ist. Widersprechen Sie ihm, gießt er seine Verachtung
und Beleidigungen über Ihnen aus und züchtigt Sie, freilich nur
zu Ihrem Besten, im wörtlichen oder im übertragenen Sinn. Und
wenn er es im Namen eines hehren Ideals ungestraft wagen kann, dann wird
er vielleicht sogar versuchen, mit dem Müll, der in seinen Augen die
Essenz Ihres Daseins ist, ein für alle Mal aufzuräumen.
Die bittere Wahrheit ist: Jede Form legitimer geistiger
Selbstverteidigung wird zur Fallgrube. Versuchen Sie, den Dummkopf zur
Vernunft zu bringen, ihn zu ändern, dann sind Sie verloren. Denn falls
Sie es für Ihre Menschenpflicht halten, ihn zu bessern, meinen auch
Sie zu wissen, wie er denken und sich verhalten müsste ... nämlich
wie Sie. Und schon sind Sie selbst zum Dummkopf geworden. Und ein Naivling
obendrein, weil Sie sich einbilden, Sie könnten diese Herausforderung
meistern. Was noch schlimmer ist: Je mehr Sie versuchen, einen Dummkopf
zur Einsicht zu bewegen, desto mehr bestärken Sie ihn in seiner Meinung.
Nur allzu gern wird er sich in der Rolle des Verfolgten sehen, der unbequeme
Dinge sagt und folglich recht hat. Damit bestätigen Sie ihm nur, dass
er sich vollkommen zu Recht für einen unerschrockenen Nonkonformisten
hält, der Mitgefühl und Bewunderung verdient. Ein Querdenker
eben . Vor dem Ausmaß dieses Fluches sollten wir erbeben: Versuchen
Sie, einen Dummkopf zu bessern, und Sie haben ihn, weil das Scheitern auch
für Sie inakzeptabel ist, in seiner Haltung bestärkt und sich
zu seines-[>13]gleichen gemacht. Wo vorher nur eine Hohlbirne war, sind
jetzt deren zwei. Wer die Dummheit bekämpft, bestärkt sie nur.
Je heftiger wir gegen die Dunkelheit angehen, desto mehr frisst sie uns
auf.
Apokalyptische Dummschwätzer
Die Dummheit kann folglich nicht an Macht verlieren, sie nimmt sogar
exponentiell zu. Erleben wir also heute (mehr als gestern und deutlich
weniger als morgen) ihr Goldenes Zeitalter? Wie weit man die Spuren der
Schriftlichkeit auch zurückverfolgt, die besten Köpfe einer jeden
Epoche scheinen das gedacht zu haben. Zu ihrer Zeit hatten sie vielleicht
recht. Oder aber sie sind wie alle anderen auch zu alten Blödmännern
geworden ... Neu an unserer Zeit ist, dass ein Dummkopf und ein roter Knopf
genügen, um die Dummheit mitsamt der ganzen Welt auszulöschen.
Ein einziger Dummkopf, gewählt von Kälbern, die sich einiges
darauf zugutetun, ihren Metzger selbst zu wählen.
Das zweite Hauptmerkmal unserer Zeit ist, dass die Dummheit - auch
wenn man einräumt, dass sie ihren allgemeinen Höhepunkt noch
nicht erreicht hat - noch nie so augenfällig, hemmungslos, kollektiv
und kategorisch war. Grund genug, an unseren fehlgeleiteten Zeitgenossen
zu verzweifeln. Aber auch, wer weiß, Grund genug, sich notgedrungen
der Philosophie zuzuwenden, da es immer schwieriger wird, die Eitelkeit
von allem und den Narzissmus von jedem, die Hohlheit von äußerem
Anschein und pauschalem Urteil zu leugnen. Könnte uns doch ein zweiter
Erasmus von Rotterdam ein neues Lob der Torheit schenken (aber bitte in
nicht mehr als 140 Zeichen am Stück, damit es keine Migräne gibt)!
Könnte uns doch ein neuer Lukrez die tiefe Erleichterung - und vielleicht
auch Freude - schildern, die man empfindet, wenn man vom sicheren Ufer
aus beobachtet, wie das Narrenschiff in den Fluten versinkt: versenkt von
seinen Passagieren, die nun nach Rettung vor dem Ertrinken schreien . Und
wir könnten es genießen zuzusehen, wie die Dummköpfe sich
[>14] mit aufgeplustertem Gefieder und ebensolchem Ego gegenseitig die
Köpfe einschlagen.
Denn während große Geister einander begegnen,
schlagen Dummköpfe aufeinander ein. Wir mögen uns bemühen,
bei der Rolle des Zuschauers zu bleiben, statt die des Akteurs einzunehmen,
doch es ist ziemlich vermessen zu denken, die Dummheit könne uns weniger
anhaben als unseren grölenden, verbitterten, trübsinnigen und
aufgeregten Zeitgenossen. Sollte das aber unerwarteterweise zutreffen,
welch ein Triumph! Dennoch ist hier Bescheidenheit am Platz: Man würde
es Ihnen nicht verzeihen, sich über das Getümmel zu erheben.
Wer sich von der Herde absondert, den führt sie selbst zum Schlachthaus.
Heulen Sie mit den Wölfen, blöken Sie mit den Schafen, aber wagen
Sie nicht zu viele Alleingänge, sonst schlagen Ihnen Stürme der
Entrüstung entgegen. Überflüssig auch zu erwähnen,
dass, sollten Sie sich für klüger und vorbildlicher als der Durchschnitt
halten, eine fatale Diagnose naheliegt: Möglicherweise sind Sie Träger
des Dummheitsvirus, ohne die zugehörigen Symptome zu zeigen ...
Angesichts des herkulischen Ausmaßes der Aufgabe
- und des damit verbundenen Schlamassels - kann die Behauptung, mit diesem
Buch das Terrain der Dummheit erkunden zu wollen, sich eigentlich nur als
weitere Dummheit erweisen. Man muss schon sehr vermessen, naiv oder bescheuert
sein, um sich an ein solches Thema heranzuwagen. Ich weiß das nur
zu gut, doch ein wackerer Tropf musste sich in dieses Abenteuer stürzen.
Mit ein bisschen Glück endet dieses Unterfangen nur in der Lächerlichkeit.
Sich lächerlich zu machen hat noch niemanden umgebracht, die Dummheit
dagegen schon! Und sie wird uns überleben, die Dummheit, ja, sie wird
uns alle unter die Erde bringen. Vorausgesetzt, sie steigt nicht mit uns
zusammen ins Grab ...
Abschließend möchte ich noch eines ausdrücklich
klarstellen: All diese Betrachtungen über Dummköpfe gelten auch
für Dummköpfinnen. Da können Letztere ganz beruhigt sein!
Leider kann nicht ein Geschlecht das andere zurück auf den Pfad der
Einsicht führen. Und darum sage ich euch, oh ihr dummen Mannsund Weibsbilder
jeglicher Natur und Art, ihr Tröpfe, Vollidiotinnen, Pfeifen, Dumpfbacken,
Trottel, blöden Gänse, Ziegen, Kühe und so weiter: Dies
ist die Stunde eures Triumphes, denn dieses Buch handelt nur von euch.
Aber ihr werdet euch darin wohl kaum wiedererkennen ...
Ihr ergebenster Dummkopf Jean-Françios Marmion"
FN1 In der Einleitung zu seinem Discours de la Methode.
Hamburg 2011, S. 5
- Dan Ariely Inhaber des Alfred P. Sloan Lehrstuhls für Verhaltensökonomik am Massachusetts Institute of Technology. Dan Ariely ist Autor folgender Bücher: Amazing Decisions, London 2019, The Honest Truth About Dishonesty. How We Lie to Everyone – Especially Ourselves, New York 2013
- Brigitte Axelrad Honorarprofessorin für Philosophie und Psychologie. Sie ist Mitglied des Observatoire zététique Grenoble und gehört der Redaktion des Magazins Science et pseudo-sciences an, das von der Association française pour l’information scientifique (AFIS, Französische Gesellschaft für wissenschaftliche Information) herausgegeben wird, für das sie auch regelmäßig Beiträge verfasst. Brigitte Axelrad ist Autorin von: The Ravages of False Memory, British False Memory Society 2011
- Laurent Bègue Mitglied des Institut universitaire de France (Einrichtung zur Förderung der Spitzenforschung) und Direktor des Maison des Sciences de l’Homme (Haus der Humanwissenschaften) in Grenoble. Laurent Bègue ist Autor von: Psychologie du bien et du mal, Paris 2011, Traité de psychologie sociale, Louvain-la-Neuve 2013, L’Agression humaine, Malakoff 2015
- Claudie Bert Wissenschaftsjournalistin, spezialisiert auf Humanwissenschaften
- Stacey Callahan Professorin für klinische Psychologie und Psychopathologie an der Universität Toulouse 2 »Jean Jaurès«, Forscherin am Centre d’études et de recherches en psychopathologie et psychologie de la santé (CERPRS), Stacey Callahan ist Autorin von: Les Thérapies comportementales et cognitives. Fondements théoriques et applications cliniques, Malakoff 2016, Cessez de vous déprécier! Se libérer du syndrome de l’imposteur (mit K. Chassangre), Malakoff 2017, Mécanismes de défense et coping (mit H. Chabrol), 3. Auflage, Malakoff 2018
- Jean-Claude Carrière Schriftsteller (Mahabharata, Der Kreis der Lügner, u. a.) und Drehbuchautor (u. a. für Pierre Etaix, Louis Malle, Luis Buñuel und Milos Forman). Zusammen mit Guy Bechtel verfasste er ein Dictionnaire de la bêtise et des erreurs de jugement, Paris 1965
- Serge Ciccotti Doktor der Psychologie und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bretagne-Sud. Er hat zahlreiche populärwissenschaftliche Bücher zu psychologischen Themen verfasst, u. a.: 150 psychologische Aha-Experimente, Heidelberg 2011, Hundepsychologie, Heidelberg 2011
- Jean Cottraux Klinischer Psychiater im Gesundheitsdienst; Dozent an der Universität Lyon 1. Gründungsmitglied der Akademie für Verhaltenstherapie in Philadelphia. Jean Cottraux ist Autor folgender Bücher: La Répétition des scénarios de vie, Paris 2011, À chacun sa créativité. Einstein, Mozart, Picasso … et nous, Paris 2010, Tous narcissiques, Paris 2017
- Boris Cyrulnik Neuropsychiater und Studiendirektor an der Universität von Toulon. Boris Cyrulnik ist Autor folgender Bücher: Un merveilleux malheur, Paris 2017, Ivres paradis, bonheurs héroïques, Paris 2016, Les âmes blessées, Paris 2016
- Antonio Damasio Professor für Neurologie und Psychologie an der University of Southern California in Los Angeles, wo er das Brain and Creativity Institute leitet. Antonio Damasio ist Autor folgender Bücher: Descartes’ Irrtum, Berlin 2014, Im Anfang war das Gefühl, München 2017, Der Spinoza-Effekt, Berlin 2016
- Sebastian Dieguez Neuropsychologe und Forscher am Laboratory for Cognitive and Neurological Sciences der Université de Fribourg. Sebastian Dieguez ist Autor folgender Bücher: Maux d’artistes: ce que cachent les oeuvres, Paris 2010, Total bullshit! Aux sources de la postvérité, Paris 2018
- Jean-François Dortier Gründer und Direktor der Zeitschriften Le Cercle Psy und Science Humaines
- Ewa Drozda-Senkowska Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Paris-Descartes. Sie hat kürzlich herausgegeben: Les Pièges du raisonnement. Comment nous nous trompons en croyant avoir raison, Paris 1997, Menaces sociales et environnementales: repenser la société des risques (mit V. Bonnot et S. Caillaud), Rennes 2017
- Pascal Engel Philosoph und Direktor der Elitehochschule École des hautes études en sciences sociales. Pascal Engel ist Autor folgender Bücher: La norme du vrai. Philosophie et psychologie, Paris 1996, La Dispute, Paris 1997, Les Lois de l’esprit. Julien Benda ou la raison, Paris 2012
- Howard Gardner Professor für Kognitionswissenschaft und Pädagogik an der Harvard Graduate School of Education, Begründer der Theorie der multiplen Intelligenzen. Sehr einflussreich auf dem Gebiet der pädagogischen Forschung, wofür er 1990 den Grawemeyer Award erhielt. Howard Gardner ist Autor folgender Bücher: Intelligenzen, Stuttgart 2013, Abschied vom IQ, Stuttgart 1994
- Nicolas Gauvrit Psychologe und Mathematiker, Professor an der École supérieure du Professorat et de l’Éducation in Lille, institutionelles Mitglied des Laboratoire Universitaire »Cognitions Humaine et Artificielle« (CHArt). Nicolas Gauvrit ist Autor des Buchs: Les surdoués ordinaires, Paris 2014
- Alison Gopnik Professorin für Psychologie und Philosophie an der Universität Berkeley. Alison Gopnik ist Autorin folgender Bücher: Kleine Philosophen, Berlin 2010, Forschergeist in Windeln, Berlin 2005, Anti-manuel d’éducation. L’enfance révélée par les sciences, Paris 2017
- Ryan Holiday Autor, ehemaliger Marketing-Director, Kolumnist beim New York Observer. Holiday hatte bereits mit 28 Jahren drei Bestseller über Marketingstrategien und von den Stoikern inspirierte Persönlichkeitsentwicklung veröffentlicht: Growth Hacker Marketing, London 2014, Das Hindernis ist der Weg, Freiburg 2017, Operation Shitstorm, Kulmbach 2013. In diesen Büchern erklärt er, wie er für seine Klienten mediale Aufmerksamkeit erzeugt.
- Aaron James Professor für Philosophie an der Universität von Kalifornien in Irvine. Aaron James ist Autor folgender Bücher: Arschlöcher: Warum sie uns zu Tode nerven und wie wir sie zum Schweigen bringen, München 2015, Assholes: zum Beispiel Donald Trump, München 2016
- François Jost Professor emeritus für Kommunikationswissenschaft an der Universität Paris III – Sorbonne Nouvelle und Ehrendirektor des Centre d’études sur les images et les sons médiatique. François Jost hat insgesamt 24 Bücher veröffentlicht, u. a.: L’empire du loft, Paris 2002, Le culte du banal, Paris 2007, La méchanceté en actes à l’ère numérique, Paris 2018
- Daniel Kahneman Professor emeritus für Psychologie an der Universität Princeton, Nobelpreisträger für Wirtschaft. 2002 erhielt er den Nobelpreis für seine Arbeiten zu Urteilsbildung und Entscheidungsfindung, die er größtenteils mit seinem Kollegen Amos Tversky durchgeführt hat. Daniel Kahneman ist Autor von: Schnelles Denken, langsames Denken (München 2017)
- Pierre Lemarquis Der Neurologe und Essayist ist Autor folgender Bücher: Sérénade pour un cerveau musicien, Paris 2012, L’empathie esthétique, entre Mozart et Michel-Ange, Paris 2015, Portrait du cerveau en artiste, Paris 2015
- Jean-François Marmion Psychologe und Chefredakteur der Zeitschrift Le Cercle Psy
- Patrick Moreau Professor für Literatur am Collège Ahuntsic in Montreal, Chefredakteur der Zeitschrift Argument. Patrick Moreau ist Autor folgender Bücher: Pourquoi nos enfants sortent-ils de l’école ignorants?, Montreal 2008, Ces mots qui pensent à notre place. Petits échantillons de cette novlangue qui nous aliène, Montreal 2017
- Tobie Nathan Professor emeritus für Psychologie an der Universität Paris VIII in Vincennes – Saint-Denis, Schriftsteller und Diplomat. Tobie Nathan war federführend bei der Einführung der Ethnopsychiatrie und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, u. a.: Ethno-roman, Paris 2012, La folie des autres, Malakoff 2013, Verliebt machen, Berlin 2014
- Delphine Oudiette Forscherin am Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière in der Forschergruppe »Motivation, Gehirn und Verhalten«. Oudiette interessiert sich für die Rolle von Schlaf und Traum bei den hauptsächlichen kognitiven Funktionen wie Gedächtnis oder Kreativität. Sie ist Autorin von: Comment dormons-nous? (mit I. Arnulf), Paris 2008
- Emmanuelle Piquet Sie ist eine der wichtigsten Repräsentantinnen der Kurzzeit-Therapie nach der Schule von Palo Alto. Diese hat sie weiterentwickelt, sodass sie für Mobbing in der Schule einsetzbar ist. So hat Emanuelle Piquet die Zentren von Chagrin Scolaire (Schulkummer) in Frankreich, Belgien und der Schweiz begründet.
- Pierre de Senarclens Honorarprofessor für internationale Beziehungen an der Universität Lausanne. Ehemaliger hochrangiger Funktionär bei der UNESCO und beim Internationalen Roten Kreuz. Autor verschiedener Bücher über Ideengeschichte sowie Geschichte und Soziologie zeitgenössischer internationaler Beziehungen: Mondialisation, souveraineté et théorie des relations internationales, Paris 1998, L’Humanitaire en catastrophe, Paris 1999, Critique de la mondialisation, Paris 2003, Nations et nationalismes, Paris 2018
- Yves-Alexandre Thalmann Doktor der Naturwissenschaften und Professor für Psychologie am Collège Saint-Michel in Fribourg (Schweiz). Er ist Autor u. a. folgender Bücher: Es ist nie zu spät, um glücklich zu sein, München 2019, Positives Denken für Skeptiker, München 2018, Glückstraining, München 2012, Pourquoi les gens intelligents prennent-ils aussi des décisions stupides?, Brüssel 2018
Definitionen oder Definitionsversuche
von Dummheit in diesem Buch
- S. 40 Dortier: "Der französische Neurologe Paul Sollier widmete den »IdiotenTDuIdi und ImbezilenTDuImb« in seinem bahnbrechenden Werk Psychologie de l’idiot et de l’imbécile: essai de psychologie morbide (Paris, 1891) ein ganzes Kapitel. Er bedauert darin, dass die französische Psychologie auf diesem Gebiet der englischen und amerikanischen weit hinterherhinke, und weist darauf hin, dass über die Definition der jeweiligen geistigen Kondition kein Konsens bestehe: So verwendeten einige Ärzte die Intelligenz als Maßstab, andere wiederum die Sprachbeherrschung oder moralische Kriterien (wie eine fehlende Selbstbeherrschung)."
- S. 53 Engel: "... Die Unterschiede zwischen den Formen der DummheitTDuUnt sind so zahlreich, dass all jene, die sich seit der Antike um ihre Definition bemüht haben, den Versuch nur allzu schnell wieder unterließen und sich stattdessen mit anschaulichen Beispielen zufriedengaben. ..."
- S. 56 Engel: "... An diesem Punkt stößt die Definition der DummheitTDuInM als mangelndes intellektuelles Begriffsvermögen an ihre Grenzen. ..."
- S. 86.1 Drozda-Senkowska: "»Wenn man die DummheitTDuMeta definiert, verleiht man ihr einen Status, eine Basis, man ordnet ihr einen Ursprung und eine Funktion zu. Ich sehe sie aber wild ausufern. Sie überwuchert alles, was heißt, dass sie nicht funktional ist«, schreibt Georges Picard in seinem Essay De la connerie3 (Über die Dummheit)."
- S. 86.2 Drozda-Senkowska: "Doch ob es nun eine weitere Dummheit ist oder nicht, nach einer Definition der Dummheit zu suchen, wir müssen uns dennoch Gewissheit verschaffen, wovon wir reden. Also fangen wir vielleicht mit Etymologie an: Das deutsche »dumm«TDuAltD geht zurück auf althochdeutsch »tumb«, was bedeutet »stumm«,TDuAltDstum »taub«TDuAltDtaub, aber auch »töricht«TDuAltDtör und »unerfahren«TDuAltDunerf. Ebenso wie gotisch »dumbs« für »taub« steht – in jedem Fall ist damit ein Mangel an AusdrucksfähigkeitTDuAltDMA gemeint, eine Bedeutung, die sich für »dumm« bis ins 17. Jahrhundert hinein erhalten hat. Erst spät wird aus dem »tummen teufel« ein Schimpfwort. Im 18. Jahrhundert begegnet uns dann plötzlich der »Dummkopf« als abwertende BezeichnungTDuAbw für einen dummen Menschen."
- S. 86.3 Drozda-Senkowska: "Das WiktionaryTDuWik liefert uns im Jahr 2018 für »dumm« folgende Bedeutungen: schwach an Verstand, ohne Intelligenz, ohne Können, unwissend; auf unpassende und kindische Art lustig; mit nachteiligen Folgen, unangenehm, übel. Das ab der späten Neuzeit beleidigende »dumm« büßt diese Nuance mit der Zeit ein, sodass es im Laufe des 19. Jahrhunderts zu »saudumm« oder »strohdumm« verstärkt werden muss. Neutral ist der Begriff »dumm« trotzdem nicht."
- S. 86.4 Drozda-Senkowska: "Der Großteil der Lexika nennt als Hauptbedeutung für »dumm«TDuK einen Mangel an Intelligenz. Der Verweis auf den IrrtumTDuIrr als Kernbedeutung erfolgt schon weit seltener. Im Duden allerdings heißt es: »in seinem Verhalten/Tun wenig Überlegung zeigend«."
- S. 113 Thalmann: "Dummheit, Blödheit, DämlichkeitTDuAbw … es fehlt beileibe nicht an Begriffen, um einen Menschen oder sein Handeln herabzusetzen. Diese abwertenden und häufig beleidigenden Wörter sind ein uns vertrautes Vokabular, so sehr vertraut, dass wir ihre Definition für selbstverständlich halten: ein Mangel an IntelligenzTDuK. ..."
- S. 172 Cottraux: "Dieser Untersuchung zufolge ist ein DummkopfTDuIneM jemand, dem es an emotionaler Intelligenz fehlt und der sich selbst misshandelt, während er andere aufgrund seiner Egozentrik respektlos behandelt. Diese Definition weist Ähnlichkeiten zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung auf. Ich verwende sie hier als roten Faden, der sich durch Arbeit, Liebesbeziehungen und soziale Netzwerke zieht."
- S. 198 Jost: "Eine endogene Definition der DummheitTDuEndo
- S. 202f Jost: "Die drei charakteristischen Merkmale der DummheitTDuM3c, TDuMeta, die ich genannt habe, lassen sich auf weit mehr Gebiete anwenden, als ich in diesem Beitrag erläutern konnte. Besteht ihre Bedeutung darin, eine sozusagen endogene Definition unseres Untersuchungsgegenstandes zu liefern, da sie dem Erdreich selbst entnommen sind, in dem diese wurzelt, so bleibt doch eine Frage offen: Wer sind die Menschen, bei denen sich diese Dummheit offenbart? Die Profile der Internetnutzer sind wenig aussagekräftig, und es ist so gut wie unmöglich herauszufinden, wer sie sind, was ihr sozialer Hintergrund, ihr Alter oder (in manchen Fällen) ihr Geschlecht ist. Angesichts dieser Einschränkungen ist es schwer festzumachen, mit welcher Art von [>203] Dummheit wir es zu tun haben, wenn man davon ausgeht, dass diese wie die Lust altersabhängig ist. Das Einzige, was man mit Sicherheit aus den von mir untersuchten Beispielen schließen kann, ist, dass deren Orthografie eher auf junge Schreiber hindeutet, mit deren Schulbildung es wohl nicht allzu gut steht. Würde ich so weit gehen und die Behauptung wagen, dass es sich um Fälle von jugendlicher DummheitTDuJug handelt? Ja, mache ich."
- S. 204f Jost: "Das Motto hält uns dazu an, von einer ersten Unterscheidung zwischen Dummheiten und Dummheit auszugehen. Wie der Philosoph Vladimir Jankélévitch unterscheidet zwischen »böse sein« und »böse Taten begehen«,8 müssen wir eine Unterscheidung treffen zwischen der DummheitTDuMInd, die ein dummes Individuum charakterisiert, und dem einfachen »Dummes-Zeug-Reden«TDuDZr. Doch während über eine Minimaldefinition der Bosheit, die quasi deren Essenz – nämlich »etwas besudeln, beschmutzen und zerstören«9 erfasst, schnell Einigkeit zu erzielen ist, sieht es in Sachen Dummheit ganz anders aus. Ihre Definition kann nur aus dem Gebrauch im Rahmen von Sprechakten abgeleitet werden. Ein Sprecher kann erkennen, dass er Dummheiten sagt bzw. gesagt hat. Wie [>205] zum Beispiel Laurent Wauquiez, bis vor Kurzem Vorsitzender der Partei Les Republicains, der öffentlich zugibt, dass alles, was er im Fernsehen sagt, »Bullshit« sei. Der umgekehrte Fall ist dagegen häufiger: Der Gesprächspartner, Leser oder Zuhörer entscheidet (insgeheim oder offen), ob das, was sein Gegenüber sagt, eine Dummheit ist.
Ein weiteres Beispiel liefern uns die Kommentare zur Kochsendung »Un dîner presque parfait«, die ich in meinem Buch La Méchanceté en actes analysiert habe. ... "
Eine abschließende Anmerkung: Der Begriff »Dummheit«TDuTHAe kann sowohl eine törichte Handlung wie eine törichte Äußerung meinen. Kann man die Einstufung ersterer (der Handlung) als »dumm« auf eine Pflichtenethik beziehen, worauf dieses Prädikat dann auch auf die Widersprüche und Konsequenzen derselben verwendbar wäre, so drückt sich in der Beurteilung einer Äußerung als »dumm« eine bestimmte Vorstellung von Wissen oder Wahrheit aus, wie in der folgenden Definition des Philosophen Harry Frankfurt: »Das Gequatsche wird unvermeidlich, wann immer die Umstände einen Menschen dazu verleiten, sich über ein Thema zu äußern, von dem er keine Ahnung hat.«10"TDuKA
Bewertung:
Ein interessantes Thema, das hier sehr vielseitig, auch graphisch-illustrativ
aufbereitet und dargestellt wird, ich auch mehr Tiefe mit Scharfsinn und
Ausarbeitung hinsichtlich des Wesens, der Kernbedeutung
von Dummheit, erwartet hätte - obgleich auch viele einzelne Aspekte
verstreut Erwähnung und Erörterung finden. So gesehen ist es
auch ein vielseitig anregendes Werk, um das Phänomen Dummheit besser
zu verstehen.
Bibliographie: Leinow, Leonard & Birnbaum, Juliana (2019) Heilen mit CBD. Das wissenschaftlich fundierte Handbuch zur medizinischen Anwendung von Cannabidiol. München: riva.
Verlags-Info: "Cannabidiol – kurz CBD – ist ein Bestandteil von Cannabis, der bei Schmerzen, Entzündungen, Ängsten, aber auch bei Krankheiten wie Migräne, Diabetes und Depressionen helfen kann. Im Gegensatz zu dem berauschenden Cannabis-Wirkstoff THC ist er legal erhältlich.
Leonard Leinow ist ein Pionier der CBD-Forschung. Zusammen mit der Kulturanthropologin Juliana Birnbaum stellt er die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse vor und lässt zahlreiche in der CBD-Therapie erfahrene Mediziner zu Wort kommen.
Dies ist das erste wissenschaftlich fundierte Handbuch zur Einnahme und Dosierung von CBD und zu den therapeutischen Einsatzmöglichkeiten bei den unterschiedlichsten Beschwerden – für Ärzte, Patienten und gesundheitsbewusste Verbraucher."
Inhaltsverzeichnis:
- Rezensionen zu CBD 3
Dank 11
Wie man dieses Buch am besten verwendet 13
Vorwort 17
Einleitung 23
Synergy Wellness und Pflanzenmedizin 28
Eine Ethnobotanik von CBD-reichem Cannabis 32
Teil I: Eine Einführung: Cannabis und CBD für
Patienten 39
1. Cannabis als Medizin im Wandel der Zeit 40
- Eine Kurzfassung der Geschichte von Cannabis 40
Die Wiederkehr von CBD und anderen Cannabinoiden als Medizin 47
- Das Endocannabinoid-System 53
Chemie und Cannabis: Ein Überblick über die Wirkstoffe 61
Terpene 70
Ein umfassender Ansatz — Therapie mit der ganzen Pflanze 79
- Einnahmeformen: schlucken, einatmen, äußerlich anwenden?
80
Orale Einnahme von CBD-Produkten 83
Inhalierbare Produkte 92
Topische/transdermale/externe Anwendung von CBD-Produkten 100
Pharmazeutische und synthetische Versionen von Cannabis 102
Dosierungsrichtlinien 105
Vorsichtsmaßnahmen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten 115
Der subjektiv-intuitive Ansatz für medizinisches Cannabis 125
Teil II: CBD für die Gesundheit
131
- CBD als Präventivmedizin 133
- ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung)
141
ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) 145
Alzheimer 149
Anfallsleiden 153
Angst und Stress 158
Antibiotikaresistente bakterielle Infektionen 160
Arthritis 163
Asthma 166
Autismus-Spektrum-Störungen 170
Autoimmunerkrankungen 174
Depressionen und Stimmungsstörungen 177
Diabetes 180
Essstörungen (Anorexie, Kachexie, Adipositas) 183
Gehirnerschütterungen, Hirn- und Rückenmarksverletzungen und verwandte Syndrome 187
Hauterkrankungen (einschließlich Akne, Dermatitis, Psoriasis) 190
Krebs 194
Migräne 207
Multiple Sklerose und Spastik 212
Neurodegenerative Erkrankungen (Huntington und Parkinson) 216
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) 220
Reizdarmsyndrom und entzündliche Darmerkrankung (IBS und IBD) 223
Schizophrenie 227
Schlafstörungen (Schlaflosigkeit, Schlafapnoe) 230
Schmerzen 234
Suchterkrankungen 238
Übelkeit und Erbrechen 242
5. Gesundheitliche Probleme bei Frauen 246
- Historischer Überblick 247
Cannabis und der Monatszyklus: Menstruationsbeschwerden und Fruchtbarkeit 248
Menopause 250
Cannabis und Mutterschaft 253
Teil III: CBD in der Tiermedizin 259
6. CBD für Tiere 260
- Tiere und das Endocannabinoid-System 261
Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Cannabis zur Behandlung von Haustieren 263
Verabreichungsmethoden 264
Die Wahl eines Cannabisprodukts für Ihr Haustier 265
Genauigkeit bei der Kennzeichnung 268
CBD aus Cannabis contra Hanf 269
Sichere und effektive Dosierung 271
Die biphasische Dosierungskurve 271
Die Dosis berechnen 272
Die Zukunft von medizinischem Cannabis für Haustiere 273
7. Grundlegendes zur Genetik, um die Sorte an den Gesundheitszustand anzupassen 276
- Cannabis-Unterarten: Sativa, Indica und Ruderalis 278
Industriehanf versus medizinischem CBD aus Cannabis 284
- AC/DC (auch bekannt als ACDC, Oracle, C-6) 286
Cannatonic (auch bekannt als Canna Tonic) 288
Canna Tsu (auch bekannt als Canna Sue) 290
CBD Therapy (auch bekannt als Therapy A) 291
Charlotte's Web 292
Electra 4 294
Harlequin 296
Harle Tsu (auch bekannt als Harle Sue) 297
Omrita RX 299
Remedy 300
Ringo's Gift 302
Sour Tsunami II (auch bekannt als Sour-Tsu, Sour-Sue) 303
Suzy-Q 305
Valentine X 306
Teil V: Die künftige Grenze der Cannabis-basierten
Medizin.. 309
Ein Bericht von Lion Goodman 310
9. Cannabis als Mittel zur Bekämpfung der Opioid-Epidemie
311
10. Politische und rechtliche Trends 316
11. Wie geht es weiter? Der Vorsprung der medizinischen Entwicklungen
in Bezug auf Cannabis 320
Epilog 326
Endnoten 328
Ressourcenliste 355
Glossar 356
Über die Autoren 380
Über die Autoren der Beiträge 382
Leseprobe: "Einleitung", S. 23-37. Auf der Verlagsseite
als PDF
AutorInnen:
- "Leonard Leinow hat drei Jahrzehnte Erfahrung im Anbau und Studium von medizinischem Cannabis. Im Jahr 2009 gründete er Synergy Wellness, ein Cannabiskollektiv in Kalifornien, das biologische und natürliche Produkte für den medizinischen Einsatz herstellt. Sie sind Spezialisten für CBD und Pioniere auf diesem Gebiet.
- Juliana Birnbaum ist Kulturanthropologin und hat in den USA, Europa, Japan, Nepal, Costa Rica und Brasilien gelebt und gearbeitet. Sie hat für eine Vielzahl von Zeitungen, Zeitschriften, Blogs und Anthologien über Ökodörfer, Geburtsrechte und soziale Gerechtigkeit geschrieben."
Bibliographie:Hippel, William (2020) Die Evolution des Miteinander. Ein Evolutionsforscher erklärt, wie soziale Kooperation den Aufstieg der Menschheit ermöglichte. München: Riva.
Verlags-Info: "Alle grundlegenden Aspekte unseres heutigen Verhaltens wurden durch die Verlagerung des Lebensraums unserer Vorfahren vom sicheren Regenwald in die Savanne geprägt. In ihrem Kampf ums Überleben auf dem offenen Grasland haben sie Teamarbeit und soziales Verhalten erlernt und so eine völlig neue Art von Intelligenz erlangt, die unsere Stellung auf diesem Planeten für immer verändert hat.
Der Psychologe William von Hippel zeigt anhand von drei Wendepunkten der Evolution, wie Erlebnisse unserer Vorfahren die menschliche Entwicklung und unser Leben heute geprägt haben. Dieses Buch ist ein frischer und provokanter Blick auf unsere Spezies, der neue Hinweise darüber gibt, wer wir sind, was uns glücklich macht und wie wir dieses Wissen nutzen können, um unser Leben zu verbessern."
Inhaltsverzeichnis:
- Inhalt
Vorwort 9
Woher wissen wir, was unsere frühen Vorfahren dachten und taten? 14
Veranlagung oder Umwelt? 22
Teil 1: Wie wir wurden, wer wir sind 27
1. Die Vertreibung aus dem Paradies 29
Die Dikdik/Pavian-Strategie 31
Löwen mit Steinen bewerfen 34
Die Psychologie kollektiver Aktionen 38
Kollektive Handlungen befördern eine kognitive Revolution 41
Der soziale Sprung, der uns zum Menschen machte 44
2. Jenseits von Afrika 47
Aufrecht gehen 54
Vom Homo erectus zum Homo sapiens 56
Komplexe soziale Beziehungen erfordern große Gehirne 60
Theory of Mind 62
Theory of Mind beim Unterrichten und Lernen 65
Theory of Mind und soziale Manipulation . 69
3. Getreide, Städte, Könige 75
Wie der Ackerbau unsere Psyche formte 75
Die Psyche eines Ackerbauern 79
Privatbesitz . 83
Privatbesitz und die Ungleichheit der Geschlechter 87
Landwirtschaft schuf Staaten, aber auch Hierarchien, Ausbeutung und
Sklaverei 89
Von Dörfern zu Städten 94
Wie uns das Internet an den Ausgangspunkt zurückbrachte 98
4. Sexuelle Selektion und soziales Vergleichen 103
Sexuelle Selektion 107
Was bedeutet es, sexy zu sein? 109
Die Theorie des (sozialen) Relativismus 116
Teil 2: Die Vergangenheit nutzen, um die Gegenwart zu verstehen 121
5. Homo Socialis . 123
Soziale Intelligenz . 127
Die Herausbildung von Selbstkontrolle 129
Jenseits von Selbstkontrolle: die sozialen Vorteile
eines großen Gehirns 141
Die sozialen Vorteile übermäßigen Selbstbewusstseins
145
Selbsttäuschung ist nicht nur etwas für Leute mit
übermäßigem Selbstvertrauen . 149
Selbstbetrug funktioniert 152
6. Homo Innovatio 161
Was sind soziale Erfindungen? 170
Die These der sozialen Erfindungen . 176
7. Elefanten und Paviane 187
Evolution, Moral und Anführerschaft 187
Elefanten und Paviane 190
Elefanten und Paviane als Vorbilder für unterschiedliche Führungsstile
193
Eine Fallstudie: die Hadza und die Yanomami 195
Ungleichheit und das Aufkommen des Pavian-Führungsstils 198
Von kleinen Gemeinschaften zu großen Unternehmen 201
Was kann man tun, um moralische Anführerschaft zu stärken?
206
8. Der Ärger mit dem Stammesdenken 213
Die evolutionäre Psychologie und der Weltfrieden 213
Kooperation innerhalb, aber nicht zwischen Gemeinschaften . 220
Relativismus zerstört Beziehungen zwischen unterschiedlichen Gruppen
228
Die Menschen lernten, sich selbst und andere zu täuschen
234
Teil 3: Die Vergangenheit nutzen, um die Zukunft zu verbessern 239
9. Warum die Evolution das Glück »erfand«
241
Warum können wir nicht immer glücklich sein? 244
Glück und Gesundheit . 248
10. Unsere evolutionär geprägten Bedürfnisse und das
Glück 257
Ein evolutionärer Leitfaden zum Glück 259
Glück und Überleben 268
Kooperation und Konkurrenz 274
Glück und Lernen 280
Glück, Persönlichkeit und Entwicklung . 282
Die Fallstricke einer modernen Welt 284
Zehn Schritte zu einem guten Leben 286
Nachwort 291
Danksagung 295
Quellenangaben 297
Register 313
Anmerkungen 325
Über den Autor 335
- "Resümee der letzten beiden Kapitel in zehn
übergeordneten Punkten, die für ein gutes Leben besonders wichtig
sind.
1. Konzentrieren Sie sich auf die Gegenwart. ...
2. Suchen Sie nach schönen Momenten. ...
3. Achten Sie auf Ihr Glück, um gesund zu bleiben. ...
4. Sammeln Sie nicht Dinge, sondern Erlebnisse. ...
5. Geben Sie Essen, Freunden und Partnerschaften den Vorzug. ...
6. Kooperieren Sie. Mit Verwandten, Freunden und Kollegen zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen, ist eine der wichtigsten Quellen für Zufriedenheit im Leben. Was Sie am Ende gemeinsam erreichen, wird Sie zwar nicht dauerhaft glücklich machen, doch die Kooperation selbst stellt eine Belohnung dar und bietet eine stabile Basis für Lebenszufriedenheit. Glück kommt nicht nur von Spaß und Freizeit, sondern auch von Arbeit und Produktivität, insbesondere wenn Sie zugleich Ihr evolutionäres Bedürfnis, mit anderen zu kooperieren, befriedigen. Natürlich ist nicht jede [>289] kleine Aufgabe von Bedeutung, schließlich ist das Leben eine endlose Schufterei. Doch mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen Sie vertrauen und die Sie wertschätzen, macht das Ganze um einiges
leichter.
7. Werden Sie Teil einer Gemeinschaft. ...
8. Lernen Sie Neues. ...
9. Nutzen Sie Ihre Stärken. ...
10. Begeben Sie sich auf die Suche nach primären Quellen. ... "
Bewertung: Eine interessante Geschichte der Menschheit unter dem Gesichtspunkt der Kooperation.
Querverweis: Peter Kropotkin, Gustav Landauer (Mitarbeiter): Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt
Bibliographie: Hammer, Matthias (2019) Micro Habits. Wie Sie schädliche Gewohnheiten stoppen und gute etablieren. München: mvgverlag. Softcover, 224 Seiten. Erschienen: Oktober 2019. Gewicht: 266 g. ISBN: 978-3-7474-0107-1.
Verlags-Info: "Unser Alltag besteht aus vielen kleinen Gewohnheiten, die das eigene Wohlbefinden beeinflussen und bestimmen. Meist laufen sie ganz unbewusst ab, und wir merken gar nicht, wenn sie uns nicht guttun. Deshalb fällt es uns auch oft so schwer, große Veränderungen herbeizuführen, wie endlich regelmäßig Sport zu treiben, sich das Rauchen abzugewöhnen oder sich gesund zu ernähren.
Mit den fünf Micro-Habits-Schritten des renommierten Verhaltenstherapeuten Matthias Hammer kann jetzt jeder seine Gewohnheiten und sein Verhalten zum Positiven verändern. Leicht verständlich und anschaulich erklärt er, wie man die eigenen schlechten Angewohnheiten erkennt und diese Schritt für Schritt durch gute ersetzt. Denn schon eine kleine Veränderung am Tag reicht, um das Leben nachhaltig zu verbessern und das zu tun, was wertvoll und wichtig ist."
Inhaltsverzeichnis: [PDF auf der Verlagsseite]
- Inhalt
Einleitung .7
DIE MACHT DER GEWOHNHEIT 13
»Warum tue ich das?« 14
Was sind eigentlich Gewohnheiten? 15
Gewohnheiten und Gesundheit 17
Wie entstehen Gewohnheiten? 19
Von guten und von schlechten Gewohnheiten 26
Micro Habits im Detail 36
Gewohnheiten erfolgreich verändern 50
MICRO-HABITS-VERWANDLUNG: GUTE GEWOHNHEITEN IN FÜNF SCHRITTEN
55
Micro-Habit-Schritt 1: Merken – Was geschieht tatsächlich?
60
Micro-Habit-Schritt 2: Intention finden – Was ist mir wirklich wichtig?
69
Micro-Habit-Schritt 3 – Complicationen managen – Schwierigkeiten auf
dem Weg überwinden 84
Micro-Habit-Schritt 4: Routine aufbauen – Wie etabliere ich neue gute
Gewohnheiten? 90
Micro-Habit-Schritt 5: Ohne Vorwurf – Sich selbst ein freundlicher
Coach sein 158
Mit den fünf Micro-Habits-Schritten hinein in ein neues Lebensgefühl
173
MIT DEN RICHTIGEN MICRO HABITS DAS LEBEN VERWANDELN 179
Tech Habits – Gefahr oder Segen? 181
Lebensbereich Arbeit und Leistung 191
Die Lebenswelt der Gefühle 201
Umweltbewusst und nachhaltig 206
Zum Abschluss: Micro Habits freudvoll leben 215
Literatur 219
Über den Autor 221
Anmerkungen 222
- "Einleitung
- Gewohnheiten zu entdecken, die Sie schädigen, und sie dann gezielt aufzulösen. All die Dinge, die Sie davon abhalten, Ihren Werten und Zielen zu folgen und wieder Herr über Ihre Zeit und Ihr Leben zu werden.
- Gewohnheiten zu bilden, mit denen Sie Ihr Leben gemäß Ihren Werten, Träumen und Visionen gestalten können. Es geht darum, Gewohnheiten nutzen zu lernen für das, was Ihnen wirklich wichtig ist im Leben. Sie werden lernen, den Fluss der Gewohn-heiten in die Richtung Ihrer Ziele zu lenken.
Schätzen Sie einmal, wie viele Prozent Ihres täglichen Verhaltens Gewohnheiten sind. Gewohnheitsforscher haben herausgefunden: Es sind 43 Prozent. Dabei sind viele gedankliche Gewohnheiten noch nicht einmal mitberücksichtigt. Doch bleiben wir bei der Zahl: Fast die Hälfte Ihres täglichen Verhaltens verrichten Sie automatisch und nahezu unbewusst, und das Tag für Tag. Ihre Essgewohnheiten sind zumeist hoch automatisiert. Mit welchem Fuß Sie als Erstes aufstehen, in welcher Reihenfolge Sie morgens im Bad beim Waschen und Zähneputzen vorgehen – Gewohnheit. Was und wie viel Sie zum Frühstück essen – Gewohnheit. Auch vieles, was Sie denken, ob Sie sich morgens gleich sorgen oder grübeln – Gewohn-heit. Wann und wie oft Sie Ihr Handy checken – Gewohnheit. Läuft der Fernseher oder nicht – Gewohnheit. Ob Sie mit der S-Bahn, dem Fahrrad oder dem Auto zur Arbeit fahren – Gewohnheit. Wie und womit Sie bei der Arbeit beginnen – Gewohnheit. So könn-ten Sie die Liste für den Ablauf des Tages gedanklich fortsetzen. Sie würden auf ganz einfache Gewohnheiten stoßen wie beim Auto-fahren das Schalten vom dritten in den vierten Gang, und komple-xere Gewohnheiten, die sich beispielsweise durch die Nutzung Ihres Smartphones gebildet haben.
All das bleibt nicht ohne Folgen. Wann und wie oft Sie auf Ihr Handy schauen, beeinflusst Ihre Beziehungen, Ihre Zufriedenheit im Leben und Ihre Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Ihre Essgewohnheiten bestimmen, wie viel Gewicht Sie auf die Waage bringen und wie gesund Sie sich fühlen. Ihre Bewegungsgewohnheiten bestimmen, wie fit Sie sind. Wie viel Alkohol Sie trinken, wie viel Sie rauchen, bestimmt über Ihre Prognosen für das Älterwerden. Ihre Arbeitsgewohnheiten haben einen wichtigen Einfluss [>8]auf Erfolg oder Misserfolg. Und unsere täglichen Konsum- und Fortbewegungsgewohnheiten bestimmen, wie sehr wir der Natur nutzen oder schaden. Der CO2-Verbrauch jedes Einzelnen ist vor allem durch Lebensstil und Gewohnheiten geprägt. Gewohnheitsmäßiges Shoppen, Spielen oder Trinken kann zur Sucht werden. Vermeidungsgewohnheiten – also Dinge, die wir nur tun, um etwas anderes nicht tun oder erleben zu müssen – können in Zwangs- und Angststörungen münden, und intensive Grübeleien machen uns depressiv.
Unbemerkt und doch so mächtig
Meist bemerken wir gar nicht richtig, was wir den ganzen Tag über
tun. Gewohnheiten sind ein bisschen so wie die Tapete an der Wand oder
das Regal in der Ecke. Sie sind so alltäglich, dass wir sie gar nicht
mehr bemerken. Dazu passt ein Witz: Zwei junge Fische begegnen einem alten
Fisch. Der Alte sagt: »Guten Morgen, wie ist das Wasser heute?«
Die beiden jungen Fische schwimmen weiter und schauen sich an: »Was
zum Teufel ist Wasser?«1
So wie das Wasser für die Fische sind für
uns die Gewohnheiten. Und das hat auch seine Vorzüge. Wenn eine Gewohnheit
die Führung übernimmt, müssen wir nicht mehr bewusst entscheiden.
Gewohnheiten sind treue, stille und unsichtbare Begleiter, die uns
viel Energie ersparen. Was wir gewohnheitsmäßig steuern, hilft
uns, dass wir den Kopf frei haben für andere Dinge. Das ist sehr erleichternd.
Allerdings gibt es hier auch eine Kehrseite – oder
sogar mehrere, wie Sie sicherlich wissen, wenn Sie dieses Buch gekauft
haben. Denn wahrscheinlich gefällt Ihnen einiges an Ihren Gewohnheiten
nicht mehr, sodass Sie sie verändern möchten. Das ist nicht so
ganz leicht – [>9] aber es ist möglich. Ich stelle Ihnen dafür
im zweiten Teil des Buches fünf konkrete Micro-Habit-Schritte vor,
wie Sie neue wertvolle Gewohnheiten etablieren und alte Gewohnheiten verändern
können.
Dass Gewohnheiten unsichtbar, unbewusst und automatisch
ablaufen, macht sie nicht zuletzt auch sehr interessant für andere.
Wer unsere Gewohnheiten kapert, bekommt eine große Macht über
unser Leben. Er kann uns Produkte verkaufen, die wir vielleicht gar nicht
benötigen, er kann sich Zugang zu unseren Daten verschaffen, um uns
in seinem Sinne zu manipulieren. Er kann unsere Meinung prägen, ohne
dass uns dies immer so klar bewusst wird. Die Wirtschaft hat die Macht
der Gewohnheit längst entdeckt – und wir wundern uns oft über
unser eigenes Verhalten. »Eigentlich will ich doch gar nicht.«
Wenn ein Unternehmen es schafft, dass wir seine Zahnpasta, seine App oder
sein Computerspiel gewohnheitsmäßig nutzen, dann bedeutet das
langfristigen Gewinn. Deshalb sitzen in vielen Unternehmen Spezialisten,
die das Ziel verfolgen, unsere Gewohnheiten und die unserer Kinder wie
ein Schiff zu kapern, um sie in die gewünschte Konsumrichtung zu lenken.
Dabei ist es wirtschaftlich orientierten Unternehmen meist egal, ob die
Produkte gute oder ungesunde Gewohnheiten erzeugen, ob sie also zu unse-rem
Schaden oder Nutzen sind oder uns sogar süchtig machen.
Bezogen auf die Nutzung neuer Technologien und des
Internets hat der bekannte Silicon-Valley-Investor Paul Graham formuliert,
dass wir nicht die Zeit hatten, um gesellschaftliche »Antikörper
gegen suchterzeugende Neuerungen« zu entwickeln.2 Andererseits betreiben
viele Verbände heute Informationskampagnen und wollen uns zu gesundheitsbewusstem
Verhalten bewegen, zu einer gesunden Ernährung oder mehr körperlicher
Bewegung. Meist wirken solche Kampagnen allerdings nur kurzfristig. Ohne
Einfluss auf unsere alltäglichen Gewohnheiten zu nehmen, kann es keine
langfristigen Veränderungen geben. [>10]
Wie aber funktionieren Gewohnheiten wirklich? Wann
werden sie selbstzerstörerisch? Und wie können sie die Grundsteine
für Glück und Zufriedenheit legen? Wie können wir ihre Macht
für unsere Ziele nutzen? In diesem Buch werden wir uns intensiv mit
diesen stillen und treuen Begleitern beschäftigen. Wir werden uns
auf die Micro-Ebene begeben und die Gewohnheiten wie unter dem Mikroskop
untersuchen. Wir werden uns um die Micro-Habits kümmern – kleine Gewohnheiten,
die das Leben ausmachen. Dazu gibt es wissenschaftliche Ansätze, zeitgemäße
Methoden und all-tagstaugliche Techniken, die wirkungsvoll und effektiv
sind. Um zwei Bereiche wird es gehen:
Zu diesem Buch
Ich lade Sie also auf eine spannende Reise in Ihren Alltag ein.
Machen Sie sich Gewohnheiten, diese unsichtbaren Begleiter, zu Freunden.
Dabei müssen Sie sie als Erstes entdecken und sich bewusst machen.
Und Sie müssen erkennen, was Ihnen wirklich wichtig ist im Leben.
Wenn Ihnen das klar ist, können Sie den Fluss der Gewohnheiten in
genau diese Richtung verändern. Gewohnhei-[>11] ten können
strategisch eingesetzt werden – zu unserem Nutzen oder zu unserem Schaden.
Sie können uns unsere Gesundheit ruinieren und sie können der
Grundstein für Glück, Erfolg und Zufrieden-heit sein. Wir selbst
müssen aktiv die Richtung vorgeben, ansonsten schwemmen uns die Gewohnheiten
dorthin, wo es für uns nicht unbedingt günstig ist.
Inzwischen wissen wir sehr genau, wie Gewohnheiten
funktionieren. Wir können sie beobachten und in Einzelteile zerlegen.
Wir wissen, was Gewohnheiten aufrechterhält und wie sie sich verändern
lassen. Dieses Buch möchte Ihnen helfen, diesen Schatz an Wissen um
unsere Gewohnheiten kennen und nutzen zu lernen. Das kann Ihnen helfen,
sich nicht mehr von Ihren Gewohnheiten bestimmen und ärgern zu lassen,
sondern sie für das zu nutzen, was Sie sich aus tiefstem Herzen für
Ihr Leben wünschen.
Ich habe dieses Buch in drei Teile unterteilt. Im
ersten Teil wird es um Gewohnheiten aus der heutigen Sicht der Wissenschaft
gehen: Was macht Gewohnheiten aus? Warum sind sie so stark? Inwieweit beeinflussen
sie unser Leben und inwieweit können wir sie beeinflussen?
Im zweiten Teil, dem Kernstück dieses Buches,
stelle ich Ihnen fünf Schritte der Micro-Habit-Veränderung vor,
mit denen Sie relativ leicht ungünstige Gewohnheiten stoppen und neue,
sinnvolle und unterstützende Gewohnheiten etablieren können.
Der dritte und abschließende Teil des Buches
bettet das Thema der Gewohnheiten noch einmal in einen größeren
Zusammenhang ein und möchte Ihnen Lust machen, das ganze Leben aus
diesem Blickwinkel neu zu betrachten und in bester und stimmigster Weise
zu gestalten. [>13]
DIE MACHT DER GEWOHNHEIT
Frank Stäbler gehört zu den ganz Großen im Sport. Als
dreifacher Weltmeister im Ringen kennt er sich naturgemäß auch
bestens mit Gewohnheiten aus. Denn die sind im Leistungssport ganz wesentlich.
Gemeinsam mit seinem Trainer Andreas Stäbler verfeinert er seit Jahren
all die Bewegungsabläufe, die zu seinem Sport – und zu seinem Erfolg
– gehören. So ist er ein sehr gutes Beispiel dafür, wie weit
uns klug gepflegte gute Gewohnheiten bringen können. Auch die vielen
wöchentlichen Trainingseinheiten sind für Frank Stäbler
eine Gewohnheit, über die er nicht nachdenken muss. Er geht einfach
zum Training. Allerdings, ab und zu muss er sich doch extra dafür
motivieren. So lautet eine seiner Regeln: Wenn du nicht zum Training gehen
willst, geh trotzdem. Und: Wenn du verlierst, dann mach am nächsten
Tag ein Extra-Lauftraining. Werde noch besser! Solchen Regeln zu folgen,
ist für ihn ebenfalls zur Gewohnheit geworden. Und es zahlt sich aus.
Ich habe Gespräche mit seinem Trainer Andreas
Stäbler führen dürfen. (Die Namensgleichheit beider ist
Zufall, sie sind nicht verwandt.) Er erklärte mir aus seiner Sicht,
wie Gewohnheiten, Motivation, soziale Unterstützung und mentale Stärke
zum Erfolg beitragen. Seine Aussagen sind in dieses Buch mit eingeflossen.
Doch gehen wir nun erst einmal zu Johan. [>14]
»Warum tue ich das?«
Johan wundert sich über sein Essverhalten. Oft steht er abends
oder nachts vor dem Kühlschrank und schlingt hastig vor allem Joghurt
und Sahnequark herunter. Er achtet darauf, dass ihn niemand aus der Familie
dabei ertappt. Manchmal ist ihm danach schlecht. Als er sich einmal fragt,
warum er den leckeren Joghurt nicht wenigstens genießen kann, fallen
ihm mehrere Szenen aus seiner Kindheit ein. Seine Eltern hatten wenig Geld,
und wenn es süßen Joghurt gab, musste er oft schnell und heimlich
die Leckereien verschlingen, ansonsten bestand die Gefahr, dass er entweder
kaum etwas abbe-kam oder beschimpft wurde, wenn er sich mehr nahm. Einmal
gab es sogar Ohrfeigen von seiner Mutter, als sie ihn dabei erwischte,
wie er den Kühlschrank plünderte. Johan ist heute fünfundvierzig
Jahre alt, er hat einen guten Job und könnte sich bergeweise Joghurt
und Sahnequark leisten. Aber die Gewohnheit von früher sitzt tief:
Er kauft sehr gern Joghurt, und sobald er im Kühlschrank steht, muss
er ihn so schnell wie möglich verdrücken.
Gewohnheiten haben immer eine Entstehungsgeschichte. Johan wollte als
Kind unbedingt so viel wie möglich vom leckeren Joghurt im Kühlschrank
abbekommen. Er liebte ihn einfach, es war für ihn der Geschmack von
Fülle und einem guten Leben. Er hatte den tiefen Wunsch, diese Leckerei
zu essen. Und da haben wir bereits eine wesentliche Voraussetzung für
die Bildung einer Gewohnheit: Es braucht ein Ziel, ein Bedürfnis,
das befriedigt werden soll. Auch wenn uns dieses Ziel gar nicht mehr bewusst
ist, folgen wir ihm und stimmen unser Leben darauf ab. Wir tun immer wieder
das, was uns zu diesem Ziel führen soll – ob es dadurch wirklich erreicht
wird oder nicht.
Gewohnheiten haben viel mit unserem gelernten Verhalten in der Vergangenheit
zu tun. Der Ringer Frank Stäbler hat mit vier [>15] Jahren mit dem
Ringen begonnen. Seine Mutter wollte ihn eigent-lich beim Kinderturnen
anmelden, da war aber kein Platz mehr. Also ging er zum Ringen und fing
schnell an, bei diesem Sport Gewohnheiten auszubilden – in diesem Fall
Gewohnheiten, die ihn immer besser werden ließen. Johan hat auch
früh gelernt – in diesem Fall aber eher in eine ungünstige Richtung.
In seinem Inneren gilt die Regel: Wenn es etwas Süßes im Haus
gibt, muss es schnell und heimlich gegessen werden, sonst ist es weg. Dies
knüpft übrigens nicht nur an der Kindheit, sondern an sehr archaischen
Bedürfnissen an, vermutlich hatten unsere Vorfahren auch oft diesen
Drang. Sie wussten ja nicht, wann das nächste Tier erlegt wird oder
ob sie in den nächsten Tagen noch einmal einen Strauch voller reifer
Beeren finden. Also mussten sie sich einmal vorhandene Kalorien schnell
einverleiben. Sie sehen schon: Gewohnheiten sind ein sehr umfassendes Thema,
das in alle Lebensbereiche hineinragt und bis weit zurück in die Menschheitsgeschichte
reicht.
Was sind eigentlich Gewohnheiten?
William James, einer der Urväter und Begründer der Psychologie,
hat in seinem Hauptwerk zu den Prinzipien der Psychologie den Gewohnheiten
– auf Englisch habit – ein ganzes Kapitel gewidmet.
Er geht so weit, zu sagen, dass Gewohnheiten eine
Grundeigenschaft der Dinge und Organismen sind. Es sind Reaktionen auf
die Umwelt bzw. Wechselwirkungen zwischen den Dingen und Organismen. Wie
ein Schloss besser funktioniert, wenn es öfter gebraucht wird, ein
Bachbett langsam breiter wird, wenn mehr Wasser fließt, oder wie
ein Kleidungsstück sich an den Körper anpasst, wenn es öfter
getragen wird (damals gab es noch nicht so viel Elasthan in der Kleidung),
werden auch Verhaltensweisen geschmeidiger, wenn [>16] sie öfter ausgeführt
werden. So oft, bis wir es nicht einmal mehr merken. Denn Gewohnheiten
laufen oft automatisiert und unbewusst ab.
Ich hatte diese Zahl schon genannt: 43 Prozent unseres
Handelns werden von Gewohnheiten bestimmt, Informationen ändern daran
so letztlich nichts. So sagt es Bas Verplanken, Professor für Sozialpsychologie
in Bath, England. Er erforscht Gewohnheiten seit über zwanzig Jahren
und weiß: Wenn sie mit unseren Zielen übereinstimmen, sind sie
uns nützlich, manchmal sind sie sogar überlebenswichtig. Weichen
sie allerdings von unseren tatsächlichen Zielen ab, stören sie
eher, rauben uns Zeit und Energie, und nicht selten schädigen sie
sogar unsere Gesundheit.
Gewohnheiten, so definiert es Bas Verplanken, sind
Verhaltensweisen, die wir regelmäßig in einem stabilen Kontext
ausüben – ohne viel darüber nachzudenken oder abzuwägen.
Meist basieren sie auf Entscheidungen, die wir einmal bewusst getroffen
haben.3 Wenn ich meine Nachbarin sehe, sage ich spontan »Hallo!«.
Dabei muss ich nichts entscheiden und über
nichts nachdenken. Ihr Hund kommt schwanzwedelnd auf mich zu, wenn er mich
sieht, ich rede ein bisschen mit ihm und streichle ihm über den Kopf.
Auch das ist eine Gewohnheit. Sehr früh schon wurden Gewohnheiten
als Neigungen beschrieben, in einer bestimmten Weise zu handeln. Wenn ich
eine rote Ampel sehe, dann trete ich automatisch auf Bremse und Kupplung.
Und Carla, meine Kollegin, steckt sich eine Zigarette an, sobald sie Pause
hat. Beides geschieht hochautomatisch. Unser Gehirn hat im Kopf für
diese Verhaltensweisen eine Autobahn gebildet: Die Informationen und Impulse
rasen darauf schnell und sicher voran. Sie achten auf keinerlei mögliche
Abzwei-gungen oder alternativen Wege. Dies gilt für die meisten ganz
einfachen Handlungen des Alltags wie das Zähneputzen, für komplexe
[>17] Verhaltensweisen wie Arbeitsgewohnheiten, aber auch für gedankliche
Prozesse wie Grübeln oder Selbstvorwürfe.
Wenn Gewohnheiten automatisiert und gut gelernt
sind, dann werden sie mehr von der Umwelt bestimmt als von unserem willentlichen
Handeln. Wenn eine Pause ist, dann raucht meine Kollegin. Wenn Joghurt
im Kühlschrank steht, dann fällt Johan darüber her.
Wenn die Ampel rot ist, trete ich auf die Bremse.
Die Umwelt hat gewissermaßen die Kontrolle über die Gewohnheit
gewonnen. Ein auslösender Reiz genügt, dass die immer gleiche
Reaktion erfolgt.
Das hat den Vorteil, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen,
wie wir uns in den entsprechenden Fällen verhalten. Wenn das Handy
ein Geräusch von sich gibt, hat es automatisch unsere volle Aufmerksamkeit,
und wir spüren den Drang, die neue Nachricht zu checken. Ob eine Gewohnheit
auf längere Sicht für uns nützlich oder schädlich ist,
steht auf einem ganz anderen Blatt. Doch auch damit wollen und müssen
wir uns hier beschäftigen.
Gewohnheiten und Gesundheit
Gewohnheiten sind die vielen kleinen Dinge, die wir täglich tun.
Es sind die Bausteine unseres Lebensstils. Und damit sind es auch die Bausteine
unserer Gesundheit. Kaum einen anderen Lebensbereich beeinflussen Gewohnheiten
so sehr wie unser Wohlbefinden und unsere Vitalität. Oder müsste
ich statt »beeinflussen« sagen »beeinträchtigen«?
Denn sehr viele unserer heute typischen Gewohnheiten tun uns nicht unbedingt
gut. Wahrscheinlich kennen Sie diese gesundheitsschädlichen Habits
– von sich selbst oder von anderen. Das Robert Koch-Institut hat in einem
Gesundheitsbericht die sieben führenden Gesundheitsrisikofaktoren
aufgelistet: Rauchen, zu viel Alkohol, niedriger Obst- und Gemüsekonsum,
zu wenig [>18] Bewegung, Übergewicht, hohe Cholesterinwerte im Blut
und Bluthochdruck. Die ersten Punkte sind Gewohnheiten, die letzten drei
sind die Folgen bestimmter Gewohnheiten. Sie alle werden als wesentliche
Risikofaktoren für den Anstieg von sogenannten Zivilisationserkrankungen
angesehen: Diabetes mellitus, Herzkreislauferkrankungen, Krebs, chronische
Atemwegserkrankungen, aber auch psychische Belastungen und Störungen.
Ernährungsgewohnheiten spielen dabei eine vorrangige
Rolle. Sie beeinflussen unsere körperliche Leistungsfähigkeit,
unser Wohl-befinden und die Gesundheit. Das Robert Koch-Institut stellt
zum Beispiel fest, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene deutlich mehr
Fleisch essen, als der Gesundheit (und der Umwelt) zuträglich wäre.
Außerdem essen die meisten zu süß und zu fett, können
all den Verlockungen aus der Werbung, im Supermarkt und bei den Fast-Food-Ketten
nicht widerstehen und geraten dann leicht ins Übergewicht mit all
seinen gesundheitlichen Folgen.
Zum höchsten Krankenstand führen laut
dem DAK-Gesundheitsbericht 2019 (bezogen auf die Krankenstände von
2018) Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems.4 Die Ursachen können
sehr vielfältig sein, Überlastung, Übergewicht, aber auch
Bewegungsmangel und falsche Sitz- oder Stehgewohnheiten. Die meisten Rückenleiden
kommen daher, dass die Menschen zu viel sitzen – im Büro, vor dem
Fernseher oder Computer, im Auto – und sich zu wenig bewegen. Alles Gewohnheiten.
An zweiter Stelle stehen Erkrankungen der Atemwege
und an dritter Stelle psychische Erkrankungen, deren Anteil an den Fehltagen
sich seit 1997 verdreifacht hat. Zu den Diagnosen gehören insbesondere
Depression, Angststörungen, Anpassungsstörungen und Sucht.5 Auch
diese Störungen haben vielfältige Ursachen – und auch sie haben
mit Gewohnheiten zu tun. Angststörungen werden durch [>19] Vermeidungsgewohnheiten
zumindest verstärkt und die verschie-denen Süchte basieren auf
exzessiven Verhaltensweisen und Kon-trollverlusten. Unsere Leistungs- und
Arbeitsgewohnheiten und überhöhte Ansprüche an uns selbst
führen häufig zu Überforderung und Erschöpfung, und
die Gefahr, Burn-out oder eine Depression zu entwickeln, steigt.
Ich weiß natürlich nicht, aus welchem
Grund Sie sich dieses Buch gekauft haben. Ob Sie bestimmte Gewohnheiten
leid sind und gern loswerden möchten. Oder ob Sie sich nach einem
Leben mit bestimmten Gewohnheiten sehnen, die Sie bisher nicht wirklich
etablieren konnten. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass
so einiges dabei sein dürfte, was in den gesundheitlichen Bereich
fällt. Um gesund zu bleiben oder um es wieder zu werden, um sich im
Körper so richtig wohl und fit zu fühlen und mit Zuversicht und
sogar Freude aufs Leben zu schauen, dafür sind gute Gewohnheiten unerlässlich.
Wie entstehen Gewohnheiten?
Gewohnheiten sind wie Wasser, das durch eine Landschaft
fließt. Je länger und je mehr Wasser in einem Flussbett unterwegs
ist, desto tiefer gräbt es sich in die Landschaft ein und prägt
und verändert somit auch die Gegend. Ebenso prägen uns unsere
Gewohnheiten. Wenn wir mit etwas Menschenkenntnis in ein Gesicht schauen,
dann können wir sehen, ob dieser Mensch in seinem Leben viel gelacht,
viel gegrübelt oder viel geraucht hat. Gewohnheiten prägen die
Gesichtszüge, die Landschaft unseres Gesichts.
Im Talmud heißt es: [>20]
- Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte,
achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen,
achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten,
achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter,
achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.
Es beginnt im Kleinen – bei den Micro Habits, den unschein-baren,
winzigen Alltagsgewohnheiten –, und es endet damit, wie sich unser ganzes
Leben gestaltet. William James, der schon erwähnte Urvater der Psychologie,
verwendete damals bereits den Begriff der Plastizität. Er bezog ihn
auf die Grundeigenschaft von Materialien, sich formen zu lassen, und auf
die Grundeigenschaft des menschlichen Gehirns, das sich durch Aktivität
und Training ebenfalls formt. Je häufiger wir eine Handlung verrichten,
desto häufiger werden dieselben Nervenstränge aktiviert und desto
stärker verändern sich diese Bahnen und Hirnareale im Laufe der
Zeit. Neurophysiologen sprechen von neuronaler oder synaptischer Plastizität.
Unser Gehirn ist formbar wie eine Knetmasse.
Und am besten lässt es sich formen durch Wiederholungen – durch
Gewohnheiten.
Der kanadische Psychologe Donald Hebb formulierte
bereits 1949 die hebbsche Regel: »What fires together, wires together.«
Das heißt, je häufiger Neuron A mit Neuron B gemeinsam aktiv
ist, also gemeinsam feuert, desto bevorzugter und schneller werden diese
Neuronen aufeinander reagieren und eine immer festere Nervenleitung bilden.
Mit den heutigen bildgebenden Verfahren können
wir ganz genau beobachten, wie Nervenverbindungen wachsen. Durch häu-fige
Wiederholung einer Handlung werden die Neuronen immer wieder aktiviert
und die Nervenverbindungen werden größer und stärker. Es
ist wie auf Transportwegen: Aus anfänglichen Trampel [>21] pfaden
werden dort Autobahnen, wo besonders viel Verkehr ist, wo sich besonders
viele Einzelne fortbewegen.
Dazu passt eine sehr bekannte Studie mit Londoner
Taxifahrern gleich in zweifacher Weise. Es wurden deren Gehirne durchleuchtet,
und der Neuropsychologe Chris Frith fand dabei heraus, dass sich bei ihnen
vor allem ein Gehirnteil deutlich vergrößert hatte, nämlich
der Hippocampus. Der ist zuständig für die Abspeicherung von
räumlichen Erinnerungen. Taxifahrer müssen sich sehr gut an die
vielfältigen möglichen Routen in einer verwinkelten Riesenstadt
wie London erinnern. Also haben sie diesen Bereich ihres Gehirns besonders
oft benutzt. Die Studie konnte auch nachweisen: Je länger ein Taxifahrer
diese Tätigkeit verrichtete, desto größer war der Hippocampus
angewachsen.
Ihr Gehirn liebt Gewohnheiten
Das alles gilt auch für Ihr eigenes Leben. Wenn Sie etwas sehr
häufig tun, führt das zu physiologischen Veränderungen in
Ihrem Gehirn. Wiederholung in diesem Sinne ist Veränderung. Tatsächliche
physische Veränderung. Indem Sie etwas wiederholen, lernen Sie es,
bis die Bahn im Gehirn dafür so dick ist, dass es wie von selbst abläuft.
Allein die Häufigkeit des Tuns führt zu einer Vertiefung
dieses Lernens. Irgendwann funktioniert das Verhalten automatisch, Sie
benötigen kaum noch Bewusstheit oder gar kein Bewusstsein mehr dafür.
Unser Gehirn versucht genau das: aus bewährtem
Verhalten möglichst viele Gewohnheiten bilden. Das spart Energie und
ist nicht anstrengend. Wenn wir Dinge jeden Tag immer wieder auf die gleiche
Weise tun, dann wäre es ja unsinnig, wenn wir jedes Mal wieder darüber
nachdenken müssten. Also bildet sich das Gehirn so [... Ende der Verlagsleseprobe]
Autor: "Dr. Matthias Hammer, geboren 1966,
studierte Psychologie in Tübingen, Chicago und New York. Er ist Psychologischer
Psychotherapeut und arbeitet als niedergelassener Psychotherapeut in Stuttgart.
Ausbildung in Verhaltenstherapie, humanistischen Verfahren und Stressmanagement.
Er hält Vorträge, führt Seminare und Weiterbildungen durch.
Leitung wissenschaftlicher Studien und zahlreiche Artikel, Fachbücher
und Selbsthilfebücher zu den Themen Stress, Achtsamkeit und psychische
Erkrankungen. 2015 erschien „Der Feind in meinem Kopf“, 2018 folgte „Liebe
das Kind in dir“."
www.matthias-hammer.de
Bewertung: Ein
kaum zu überschätzendes Thema: Gewohnheiten und ihre Veränderung,
woran viele immer wieder scheitern. Insofern ein wichtiges Buch, das allerdings
gut verstanden sein will, wenn es helfen soll. Mit dem fünf-Schritte
Modell sollte hier ein praktikabler Ansatz vorliegen:
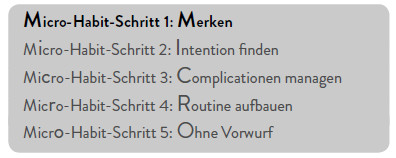
Bibliographie: Ulrich Sollmann (2018) Begegnungen im Reich der Mitte. Mit psychologischem Blick unterwegs in China. Gießen: Psychosozial-Verlag. Buchreihe: Sachbuch Psychosozial.
Verlags-Info: "Ulrich Sollmann gibt Einblicke in die historisch und traditionell geprägte Psyche Chinas. Basierend auf eigenen Reiseerfahrungen schildert er alltägliche Szenen des chinesischen Lebens und skizziert verschiedene Bewegungs- und Begegnungsräume der Menschen. In persönlichen und bildhaften Schilderungen zahlreicher Begegnungsszenen und virtueller Kontakte veranschaulicht er nicht nur typische Verhaltensweisen, sondern auch den Facettenreichtum der Beziehungsgestaltung in China.
Die lebhafte Darstellung eigener Erlebnisse und Beobachtungen ergänzt der Autor durch eine körperpsychotherapeutisch geschulte Perspektive und den kontinuierlichen Blick auf das eigene emotionale Echo. Er lässt die LeserInnen an seinem eigenen Erleben und den oft widersprüchlichen persönlichen Gefühlen teilhaben und lädt dazu ein, sich das Fremde auf diese Weise vertraut zu machen."
Inhaltsverzeichnis (auch als PDF auf der Verlagsseite):
- Einleitung 7
Durch die Lupe betrachtet 11
Erste Erkenntnisse 19
Erste Begegnungsszenen 29
»Organisation« von Chaos als China-Erfahrung 35
Lebenswelt, Lebensfeld, Lebensraum 41
Sehen, Schauen, Wahrnehmen, Betrachten von Menschen 51 Raumreise 61
»Mauern« und »Räume« 75
Drei typische Begegnungsräume 131
Brückenkompetenz: Eine besondere Fertigkeit 161
Leben lebt durch sich selbst 215
Man kann sich den Kaiser-Palast in Peking und
den Kölner Dom nicht gleichzeitig vorstellen 247
Körper-zu-Körper-Kommunikation 253
Epilog 277
Literatur 279
- "»Terminologisch und begrifflich sind in Ling
shu und Su wen der individuelle Körper und der politische Körper,
der Staat, weitgehend identisch. Die neue Medizin bot nicht nur einen neuen
Zugang zum Umgang mit dem gesunden und kranken individuellen Körper;
sie bettete diesen Umgang zugleich in eine ganz bestimmte gesellschaftliche
Ordnung ein.«
Paul Unschuld (2015, S. XXI)
Ach, hätte ich das doch schon eher gelesen. Mir wäre so
einiges Kopfzerbrechen erspart geblieben. Nun, es musste aber so kommen,
wie ich es mir selbst schon früh in meiner Jugend auferlegt hatte:
Konfuzius war für mich damals »irgend so ein« chinesischer
Philosoph, der in Zeiten der 69er und Flower-Power in aller Munde war.
Der Satz von Konfuzius ließ mich seitdem nie wieder los:
- »Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: erstens durch
nachdenken, das ist der edelste, zweitens durch nachahmen, das ist der
leichteste, und drittens durch Erfahrung , das ist der bitterste«
(Haupt, 2006).
Mich verbindet inzwischen eine jahrelange enge Freundschaft mit China, die sich aber erst allmählich entwickelte. Seit 2009 habe ich regelmäßige Kontakte zu Chinesen und seit 2013 besuche ich das Land in der Regel dreimal jährlich, für jeweils zwei Wochen. Hätten Sie mich vor einigen Jahren nach meiner Motivation gefragt, China zu besuchen, hätte ich wohl etwas von touristischem Interesse, professioneller Neugier oder Einfach-mal-was-Neues-Machen gestammelt. Aber Freundschaft?
Hans-Jürgen Wirth vom Psychosozial-Verlag lud mich 2013 ein, ein Buch über meine Erfahrungen auf der ethnologischen Wanderung durch die analoge sowie die virtuelle chinesische Lebenswelt zu schreiben - und zwar unter dem Motto: »Ein Körperpsychotherapeut schaut sich in China chinesische Körper an«. Ich möchte Sie also einladen, sich mit mir auf besagte ethnologische Wanderung zu begeben. Ich möchte hier eine kurze Leseleitung zur Orientierung geben - und natürlich auch, um Sie neugierig zu machen.
So wie es anfangs in einem fremden Land üblich ist, sah ich viel und doch auch wieder gar nichts. Ich hatte erste Eindrücke, die - vorbeischwebenden Blättern gleich - da sind, nicht greifbar und dann auch schon wieder weg. Und sie gehen dort zu Boden, wo ich es spontan nicht vermuten würde. Wenn ich um mich schaue, begegne ich immer auch Menschen. Ich möchte Sie also gerne an verschiedenen Begegnungsszenen, mit Menschen, die ich in China getroffen habe, teilhaben lassen. Diejenigen von Ihnen, die noch Landkarten kennen, auf denen man sich anfangs grob zu orientieren pflegte, fühlen sich eventuell an die Bedeutung von allgemeinen Strukturmerkmalen erinnert, wie Berge, Flüsse, Städte, Wüsten. In diesem Fall geht es um Mauern, um Lebensfelder und Räume.
Innerhalb dieser Räume und zwischen denselben findet ein quirliges, reichhaltiges sowie oftmals völlig fremdes Leben statt. Natürlich möchte ich Ihnen auch einen Blick in meinen ethnologischen Instrumentenkoffer ermöglichen und Ihnen verraten, durch welche Brillen ich auf chinesische Körper schaue. Zum Abschluss stelle ich einige »einfache« Verallgemeinerungen in den Raum, die - im Unterschied zu unerlaubten Platitüden - gerade durch ihre Anschaulichkeit überzeugend sind.
Grundsätzlich lasse ich mich durch das Geschehen vor Ort, im jeweiligen konkreten Moment und in der Begegnung mit den anwesenden Menschen leiten. Daher bewege ich mich grundsätzlich entsprechend meiner eigenen Wanderung vom Allgemeinen hin zum Konkreten. Hieraus entwickeln sich dann meine Eindrücke, bedeutsame weiterführende Fragen sowie Vermutungen über Verhaltens-, Wirkungs- und Ausdrucksmuster. Dies, falls sinnvoll, versuche ich, natürlich nur in beschränktem relevanten Rahmen, auf den gesellschaftlichen und kulturellen Hintergrund zu beziehen. Insoweit gehe ich induktiv und nicht deduktiv vor, bereise also China sozusagen von innen heraus.
Besonders wichtig ist mir die transkulturelle Perspektive. Darunter verstehe ich mit Nazarkiewicz und Krämer Folgendes:
- »Transkulturell zu denken und [...] zu [handeln] bedeutet, die
Komplexität und innere Differenzierung der Gesellschaften und Gemeinschaften
zu berücksichtigen, d. h. Interdependenz, Verflechtungen und Überschneidungen
zwischen verschiedenen Lebensformen und Identitäten zu berücksichtigen«
(Nazarkiewicz & Krämer, 2012, S. 32)
Als ethnologischer Wanderer, wie ich mich in diesem Fall verstehe, tauche ich in das sich vor mir auftauende alltägliche Leben ein. Daran persönlich teilzuhaben und szenisch Teil dieser Alltagswelt zu werden erfordert eine grundsätzliche Achtung vor dem Leben dort - davor, wo und wie es sich abspielt. Da ich Sie auch ein wenig neugierig machen möchte, werde ich Ihnen keinen üblichen Reisebericht vorsetzen, sondern Ihnen vom amöbenhaften chinesischen Bewegungskörper berichten, von der »kulturellen Haut« und vom »In-der-Luft-Stehen«. Vielleicht können Sie ja in Zukunft auch mitlachen, wenn der chinesische Gruppenkörper lacht. Die an Psychologie Interessierten werden sich beim Lesen gewiss fragen, was unter dem »doppelten Ödipus«, dem »unterzog« oder der »dritten Hand « der Chinesen zu verstehen ist. Die Kommunikationsexperten wundern sich gewiss über die Wahrnehmungsschaukel oder die »Menage-a-quatre«. Sie haben richtig gelesen: nicht »Menage-a-trois«.
Meine Reisen nach China wären natürlich nie ohne die so wichtige Unterstützung meiner Familie, insbesondere die von meiner Frau, möglich gewesen. Einen ganz besonderen persönlichen Dank möchte ich hierfür an dieser Stelle aussprechen! Meine Frau war meine wichtigste und unverzichtbare Ratgeberin und Sparringspartnerin zugleich. Sie ist wirklich erfahren in dem, was Leben heißt. Ein weiterer großer Dank gebührt meiner Assistentin Carola Gatter, die behutsam-kritisch auf meine Zeilen schaute und sie in hervorragender Kleinarbeit zur endgültigen Fassung brachte; natürlich auch meiner Lektorin Jan Motte vom Psychosozial-Verlag. Ich schätze ihre sensible Geduld, ihre Offenheit sowie ihre klare Sicht der Dinge, die sie mir wohlwollend, aber auch sehr verbindlich zur Orientierung anbot.
Mein kollegial-freundschaftlicher Dank gilt den KollegInnen in der Deutsch Chinesischen Akademie für Psychotherapie (DACH), die mir inzwischen anregende und kritisch-bestätigende professionelle Heimat geworden ist, insbesondere Martert Haas-Wiesegart, Kurt Frische, Mama Madig und Alf Verlach. Auf chinesischer Seite danke ich vor allem den KollegInnen von der DACH wie SH Qijia, Zahl Xudong , EU Jianying, zwei meiner Übersetzerinnen wie Gen HI-jung und He Juan, haben sie mir doch feinfühlig und unmissverständlich durch ihre Begleitung unverzichtbare Einblicke in die chinesische Seele ermöglicht.
Auf keinen Fall vergessen möchte ich Michael Rußland, Jörg M. Rudolph, Paul Unschuld, Volker NOK, Annette hilfreichen, Christoph Pohlmann, Thomas Böser und Ja Li. vergessen. Sie weckten mich in Momenten des drohenden Versinken in meine blinden Flecken frühzeitig »gnadenlos« auf - bis es mir schließlich gelang gestärkt Zutrauen zum von mir eingeschlagenen Weg zu finden. Danke auch an die vielen »namenlosen« Menschen, mit denen ich sprach und die mir schrieben - auch wenn ich viele von ihnen persönlichen nie kennengelernt habe.
Zum Schluss möchte ich noch einmal auflas eingangs angeführte Zitat von Paul Unschuld zurückkommen. In China geht es wirklich immer um eine enge historisch über die Jahrtausende gewachsene Verworrenheit von Mensch und Gesellschaft, Kultur und Politik. Einem tibetanischen Knoten gleich ist diese nicht zu entwirren, stellt diese Verworrenheit doch ein wesentliches Charakteristikum der chinesischen Psyche dar - früher, heute und auch in Zukunft.
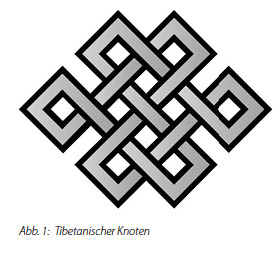
Rezensionen (Auswahl; mehr noch auf der Verlagsseite):
- Peter Schulthess in Psychotherapie-Wissenschaft 8 (2) 89–90 2018
- Tom Levold im Systemmagezin Online-Journal für systemische Entwicklungen. 25. September 2018.
- Susanne Bender DOI 10.2378 / ktb2019.art28d. Reinhardt e-Journals | © 2019 by Ernst Reinhardt.
- Deutsch-Chinesische Akademie: [PDF]
www.psychotherapie-wissenschaft.info
- Homepage: http://www.sollmann-online.de/
Bibliographie: Salzgeber, Jonas (2019) Das kleine Handbuch des Stoizismus. Zeitlose Betrachtungen um Stärke, Selbstvertrauen und Ruhe zu erlangen. München: Finanzbuch-Verlag. Softcover, 304 Seiten Erschienen: September 2019 Gewicht: 306 g ISBN: 978-3-95972-270-4.
Verlags-Info: "»Wie lange willst du warten, bis du das Beste von dir verlangst?« Epiktet
Oft werden wir im Alltagsstress von unseren Gefühlen übermannt und wissen nicht, wie wir mit unseren Ängsten umgehen oder unsere innere Stärke wiederfinden können. Hier kann die stoische Philosophie eine große Hilfe sein. Schon in der Antike war sie eine der erfolgreichsten lebensphilosophischen Schulen. Um 300 vor Christus von Zenon von Kition gegründet und von großen Denkern wie Seneca, Mark Aurel und Epiktet vertreten, ist sie bis heute unschlagbar in ihrer stringenten Art, Gelassenheit und Gleichmut gegenüber den Untiefen des Lebens zu vermitteln.
Dieses Handbuch, gerade auch für Einsteiger in die Thematik geeignet, stellt die wesentlichen Lehrsätze der maßgeblichen Philosophen vor und gibt einen Einblick in den historischen Hintergrund. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Nutzanwendung der Prinzipien des Stoizismus. Jonas Salzgeber zeigt, wie sie sich auf das eigene Leben übertragen lassen."
Inhaltsverzeichnis: Als PDF auf der Verlagsseite.
Vorwort für die deutsche Ausgabe 11
Einführung 13
TEIL 1: Was ist Stoizismus? 22
Kapitel 1: Das Versprechen der stoischen Philosophie 23
- Praktizieren Sie die Kunst des Lebens: Werden Sie ein
Kriegerphilosoph 24
Versprechen #1: Seelisches Wohlbefinden 27
Versprechen #2: Emotionale Belastbarkeit 30
- Die wichtigsten Philosophen des Stoizismus 42
Seneca der Jüngere (circa 4 v. Chr. — 65 v. Chr.) 44
Gaius Musonius Rufus (circa 30 n. Chr. — ca. 100 n. Chr.) 45
Epiktet (circa 55 n. Chr. — ca. 135 n. Chr.) 47
Mark Aurel (121 n. Chr. - 180 n. Chr.) 48
Kapitel 3: Das stoische Glücksdreieck 50
- 1. Leben mit Arete: Zeigen Sie immer die beste Version Ihres Selbst
55
Die Vervollkommnung unseres natürlichen Potenzials 57
Die vier Kardinaltugenden 62
Charakter schlägt Schönheit 66
Die stoische Liebe der Menschheit 69
2. Konzentrieren Sie sich auf das, was in Ihrer Macht liegt: Akzeptieren Sie, was auch immer geschieht, und machen Sie das Beste daraus 72
Der stoische Bogenschütze: Fokussieren Sie den Prozess 77 Stoische Akzeptanz: Genießen Sie die Reise oder lassen Sie sich mitschleifen 81
Das Gute, das Schlechte und das Gleichgültige 86
Beim Pokern wie im Leben können Sie mit jeder Hand gewinnen 90
3. Verantwortung übernehmen: Holen Sie das Gute aus sich heraus 92
Die Entscheidungsfreiheit 96
Der Verstand macht Sie reich, auch im Exil 101
Unausgeglichen oder unerschütterlich — es liegt an Ihnen 103
Kapitel 4: Der Schurke: Negative Emotionen kommen uns in die
Quere 107
- Wir wollen das, was außerhalb unserer Kontrolle liegt 112
Uns fehlt es an Achtsamkeit und wir lassen uns von Eindrücken mitreißen 114
TEIL 2: 55 stoische Übungen 119
Kapitel 5: Wie praktiziert man Stoizismus? 120
- Wappnen Sie sich 122
Seien Sie achtsam 123
Erhöhen Sie Ihre Selbstdisziplin 125
Bezeichnen Sie sich nicht selbst als Philosophen 127
Kapitel 6: Vorbereitende Übungen 129
- Übung 1: Die stoische Kunst des Duldens: Akzeptieren und lieben
Sie alles, was passiert 130
Übung 2: Handeln Sie immer unter Vorbehalt 134
Übung 3: Was im Weg steht, wird zum Weg 137
Übung 4: Seien Sie sich der Vergänglichkeit aller Dinge bewusst 140
Übung 5: Bedenken Sie, dass auch Sie sterben werden 143
Übung 6: Betrachten Sie alles als von der Natur geliehen 145
Übung 7: Negative Visualisierung: Das Vorhersehen schlechter Ereignisse 148
Übung 8: Freiwilliges Unbehagen 151
Übung 9: Bereiten Sie sich auf den Tag vor: Die stoische Morgenroutine 154
Übung 10: Überdenken Sie Ihren Tag: Die stoische Abendroutine 157
Übung 11: Suchen Sie sich ein Vorbild: Handeln mit dem stoischen Weisen im Hinterkopf 161
Übung 12: Stoische Aphorismen: Halten Sie Ihre »Waffen« griffbereit 164
Übung 13: Spielen Sie die Ihnen vorgegebenen Rollen gut 167
Übung 14: Beseitigen Sie das Unnötige 170
Übung 15: Vergessen Sie den Ruhm 172
Übung 16: Minimalismus: Führen Sie ein einfaches Leben 174
Übung 17: Holen Sie sich Zeit zurück: Vermeiden Sie Nachrichten und andere Zeitfresser 177
Übung 18: Erreichen Sie das, was zählt 181
Übung 19: Lernen Sie lebenslang 184
Übung 20: Was können Sie für Ihre Lebenszeit vorweisen? 187
Übung 21: Tun Sie, was getan werden muss 190
- Übung 22: Ihr Urteil schadet Ihnen 195
Übung 23: Wie man mit Trauer umgeht 198
Übung 24: Ziehen Sie Mut und Ruhe der Wut vor 201
Übung 25_ Besiegen Sie Ihre Angst mit Vorbereitung und Rationalität 205
Übung 26: Geben Sie Ihren Erwartungen die Schuld 208
Übung 27: Schmerz und Provokation: Große Chancen für die Tugend 211
Übung 28: Das Gelassenheitsspiel 214
Übung 29: Die Anti-Marionetten-Mentalität 218
Übung 30: Das Leben soll fordernd sein 222
Übung 31: Konzentrieren Sie sich auf das Hier und Jetzt 225
Übung 32: Seien Sie dankbar 229
Übung 33: Wechseln Sie die Perspektive 232
Übung 34: Nehmen Sie die Vogelperspektive ein 235
Übung 35: Alles bleibt gleich 237
Übung 36: Fleisch ist totes Tier: Betrachten Sie Dinge objektiv 239
Übung 37: Seien Sie nicht voreilig: Überprüfen Sie Ihre Eindrücke 242
Übung 38: Tun Sie Gutes, seien Sie gut 246
- Übung 39: Wir alle sind Teil eines großen Ganzen 251 Übung
40: Niemand handelt absichtlich falsch 253
Übung 41: Eigene Fehler finden 256
Übung 42: Vergeben Sie jenen, die straucheln, und lieben Sie sie 259
Übung 43: Bemitleiden Sie Übeltäter, statt ihnen Vorwürfe zu machen 262
Übung 44: Freundlichkeit ist Stärke 265
Übung 45: Der richtige Umgang mit Beleidigungen 267
Übung 46: Blessuren sind im Training normal 271
Übung 47: Lassen Sie weder andere im Stich noch sich selbst 274
Übung 48: Wählen Sie Gelassenheit und Seelenfrieden 278
Übung 49: Versetzen Sie sich in die Lage anderer Menschen 281
Übung 50: Wählen Sie Ihre Gesellschaft mit Bedacht 284
Übung 51: Urteilen Sie über niemand anderen als sich selbst 288
Übung 52: Tun Sie Gutes, nicht nur nichts Schlechtes 291
Übung 53: Sagen Sie nur das, was nicht ungesagt bleiben sollte 294
Übung 54: Bemühen Sie sich um Verständnis 296
Übung 55: Mit gutem Beispiel vorangehen 298
Ausgewählte Literatur 302
Möchten Sie mehr zum Thema erfahren? 304
- "Das Versprechen der stoischen Philosophie
Kein Baum wird kräftig und entwickelt tiefe Wurzeln, wenn er nicht von starken Winden getroffen wird. Erst dieses Rütteln und Schütteln bringt den Baum dazu, seine Wurzeln zu festigen und sicherer zu verankern; fragile Bäume sind dagegen in einem sonnigen Tal gewachsen. »Warum also«, fragt Seneca, »wunderst du dich, dass gute Menschen erschüttert werden, damit sie stark werden?« Genau wie bei den Bäumen sind heftiger Regen und starker Wind von Vorteil für gute Menschen, so können sie Ruhe, Disziplin, Bescheidenheit und Stärke entwickeln.
So wie der Baum seine Wurzeln festigen muss, um nicht bei jeder Brise umzufallen, müssen wir unsere Position stärken, wenn wir nicht von jeder Kleinigkeit aus der Bahn geworfen werden wollen.
Genau dabei hilft die stoische Philosophie – sie wird Sie stärker machen, sie wird den gleichen Regen und Wind leichter erscheinen lassen und sie wird dafür sorgen, dass Sie sich jederzeit auf den Beinen halten können. Mit anderen Worten, sie wird Sie darauf vorbereiten, mit jedwedem stürmischen Wetter, das das Leben Ihnen bringen mag, effektiver umzugehen.
Von ringenden Philosophen bis hin zu emotionalen Wölfen, dieses erste Kapitel beinhaltet alles, was Sie über das Versprechen der [>24] stoischen Philosophie wissen müssen, und zeigt Ihnen, warum Sie in den Stoizismus einsteigen sollten.
Warnung: In diesem Buch werden Ihnen einige fremdartig erscheinende Wörter wie Eudämonie oder Arete begegnen. Lassen Sie sich durch ihr unbekanntes Aussehen nicht dazu verleiten, einfach weiterzublättern, sondern bleiben Sie standhaft und stark. Es lohnt sich, durchzuhalten, und Sie können diese Wörter sogar in Ihr Alltagsvokabular aufnehmen. Und hey, es gibt keine antike Philosophie ohne zumindest ein paar komplizierte Wörter."
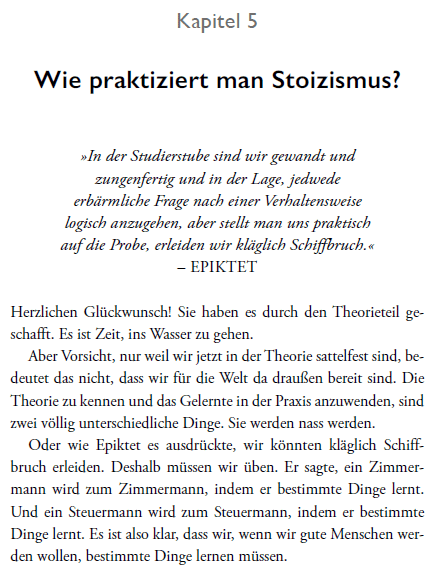
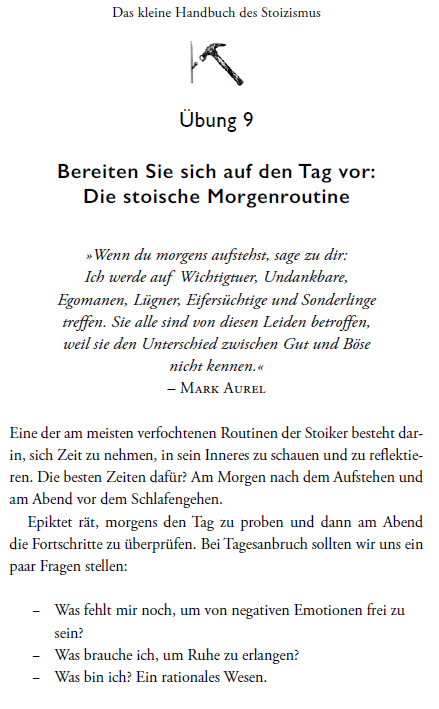
Bewertung: Das Buch gehört zur philosophisch-psychologischen Ratgeberliteratur. Psychotherapeutisch kann man das Buch bei der kognitiven Therapie einordnen mit dem Ziel, eine zur Lebensbewältigung angemessene Einstellung zu entwickeln. Die Einstellung ist in der Tat sehr wichtig, wie uns die Küchenpsychologie lehrt (> kognitive Therapie der Schuldentollwut). Das Buch ist in jeden Fall anregend, vor allem, wenn man sich die Freiheit bewahrt und nimmt, es für die eigene Persönlichkeit und Lebenssituation anzupassen.
Querverweise:
- Dokumente zur Entwicklung der Kognitiven Therapie als Integrative Therapie.
- Buchpräsentation. Craske: Kognitive Verhaltenstherapie.
- Buchpräsentation KVT-Praxis.
- Kritisches zu Seneca.
Bibliographie: Bonner, Stefan & Weiss, Anne (2019) Generation Weltuntergang. München: Droemer. Taschenbuch, Droemer TB 02.05.2019, 320 S. ISBN: 978-3-426-30198-2, € 12,00
Verlags-Info: "Warum wir schon mitten im Klimawandel stecken, wie schlimm es wird und was wir jetzt tun müssen
Ungewöhnlich heiße Sommer, Superstürme, Dauerregen, Überschwemmungen – der Klimawandel ist da. Das Bestsellerduo Bonner/Weiss („Generation Doof“) nimmt sich in "Generation Weltuntergang" die Erderwärmung und den Klimawandel vor und sagt, wie es so weit kommen konnte, wie sehr uns die klimatischen Veränderungen betreffen und was wir jetzt tun müssen.
Obwohl in den Nachrichten Daueralarm herrscht, das Wetter Kapriolen schlägt, der Meeresspiegel steigt und die Pole schmelzen, wettern Scharfmacher allerorten gegen die Klimawissenschaft, und die Politiker haben keinen Plan. Und wir selbst sehen dem Geschehen hilflos zu oder stecken den Kopf in den Sand. Denn was können wir schon tun? Eine ganze Menge, sagen Stefan Bonner und Anne Weiss.
In „Generation Weltuntergang“ erzählen sie auf aufrüttelnde und zugleich leicht verstehbare Weise die Geschichte des Klimawandels und sagen, welche Konsequenzen er für unser aller Leben hat. Denn letztlich geht es um nichts weniger als die Frage: Ist die Menschheit noch zu retten oder sind wir die die Letzten unserer Art?
„In einigen Jahrhunderten werden wir möglicherweise menschliche Kolonien im All haben, aber derzeit haben wir nur diesen einen Planeten, und wir müssen alle zusammen daran arbeiten, ihn zu bewahren.“ Stephen Hawking"
Dieses Werk ist die überarbeitete Neuausgabe des 2017 erschienenen Buches „Planet Planlos. Sind wir zu doof, die Welt zu retten?“."
Inhaltsverzeichnis:
- KAPITEL 1 7 Zweieinhalb Minuten bis Mitternacht
Als wir plötzlich die Generation Weltuntergang waren
KAPITEL 2 19 Global Watning
Wo der Klimawandel schon in vollem Gang ist
KAPITEL 3 71 Was bisher geschah
Die kurze Vorgeschichte des Weltuntergangs
KAPITEL 4 119 Denn sie wissen nicht, was sie alles wissen
Der Stand der Erkenntnisse
KAPITEL 5 141 Heiter bis Weltuntergang
Und wie schlimm wird es nun?
KAPITEL 6 205 Wir Klimawandler
Wie wir täglich dafür sorgen, dass es wärmer wird
KAPITEL 7 235 We will survive
Der 10-Punkte-Masterplan zur Weltrettung
NACHWORT 293
Das Ende
WIR SIND DANKBAR 309
LITERATUR & CO. 312
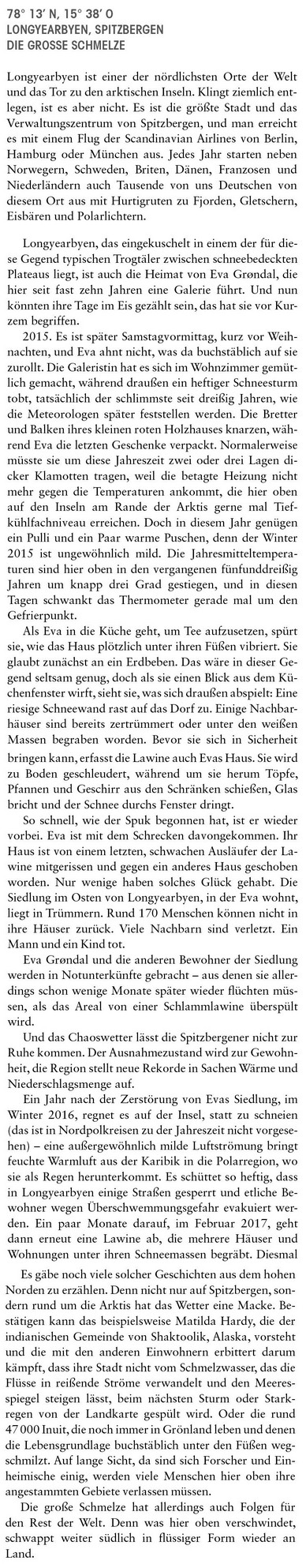
- "Stefan Bonner. Stefan Bonner wurde im Oktober 1975 geboren, zwei Tage, nachdem die Erstausgabe der Zeitschrift YPS erschienen war. Seine Vorbilder sind Tom Selleck und das A-Team. Stefan Bonner hat die gleiche Schule wie Anke Engelke besucht, Geschichte studiert und als Journalist und Lektor gearbeitet. Zusammen mit Anne Weiss schrieb er zahlreiche Bestseller. Er lebt mit seiner Familie in der Heimatstadt von Heidi Klum. "Anne Weiss Anne Weiss kam 1974 in Bremen zur Welt und blieb ihrer Heimatstadt erst einmal treu. Immerhin hat sie im Weserstadion ihr erstes Depeche-Mode-Konzert und im Steintorviertel ihre erste Friedensdemo erlebt. Erst nach dem klassischen Taxifahrerstudium - Sprachen und Kulturwissenschaften - verließ sie das kleinste Bundesland, um als Lektorin in großen deutschen Verlagen zu arbeiten. In einem von ihnen lernte sie Stefan Bonner kennen und schrieb mit ihm zahlreiche Bestseller, darunter "Generation Doof", eines der meistverkauften Bücher des letzten Jahrzehnts. Inzwischen lebt sie als freie Autorin, Übersetzerin und Journalistin in Köln. "
Bibliographie: Urner, Maren (2019) Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. München: Droemer. Klappenbroschur, Droemer HC 03.06.2019, 224 S. ISBN: 978-3-426-27776-8
Verlags-Info: "Wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren
Warum wir vor lauter News die Nachrichten übersehen - in ihrem Sachbuch erklärt die Neurowissenschaftlerin Maren Urner, warum uns die Informationsflut der modernen Medien überfordert und welche Auswege es gibt.
Egal ob morgens in der Zeitung, abends im TV oder gleich den ganzen Tag im Liveticker auf dem Smartphone: Kriege, Skandale, Terroranschläge, Katastrophen. Der Welt scheint es so schlecht zu gehen wie noch nie, und in Zukunft wird alles noch schlimmer. Diese Sicht der Dinge drängt sich auf, wenn wir uns in den Medien über den Zustand der Welt informieren.
Maren Urner warnt vor den fatalen Auswirkungen dieser Art von Berichterstattung: Wir sind ständig gestresst, unser Gehirn ist dauerhaft im Angstzustand, und unsere Sicht auf die Welt wird durch Schwarz-Weiß-Malerei und Panikmache verzerrt. So gewinnen wir keinen Überblick über die Geschehnisse, sondern bleiben überfordert und hilflos zurück.
Mit ihrer wissenschaftlichen Expertise erklärt die Autorin, was in der modernen Medienwelt schiefläuft und wie unser Steinzeithirn täglich von der digitalen Informationslandschaft überfordert wird. Als Gründerin von Perspective Daily berichtet Maren Urner aber auch von einer Alternative: von einem Online-Magazin, das lösungsorientiert berichtet. Als Neurowissenschaftlerin und Vorreiterin des Konstruktiven Journalismus in Deutschland erzählt sie von einer Berichterstattung, die uns nicht hoffnungslos zurücklässt, aber auch nichts schönreden will – inklusive interaktivem Crashkurs in kritischem Denken.
Maren Urner studierte Kognitions- und Neurowissenschaften in Deutschland, Kanada und den Niederlanden und promovierte am University College London. 2016 gründete sie Perspective Daily mit, das erste werbefreie Online-Magazin für Konstruktiven Journalismus. Seit April 2019 ist sie Dozentin für
Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) in Köln.
»Sobald mich meine Berufskrankheiten Zorn, Angst oder Verzweiflung befallen, lese ich Maren Urner. Klug und mit frischer Schärfe zeigt sie, was ein verantwortungsvoller Journalismus leisten kann.« Hajo Schumacher"
Inhaltsverzeichnis:
- Vorwort 9
Kapitel 1
Süchtig nach dem nächsten Update:
Nachrichtenkonsum im 21. Jahrhundert 11
Eigentlich müssten wir richtig viel Zeit haben 11
Ich wollte doch unrein Ticket kaufen ... 14
Der Wert deiner Aufmerksamkeit 17
Wie gut weißt du Bescheid? 18
Wenn es knallt, wird es interessant 23
Kapitel 2
Abhängigkeit mit Folgen:
Das macht die Informationsflut mit Gehirn und Psyche 29
Die Macht unserer Gewohnheiten 30
Besser ängstlich und am Leben als fahrlässig und tot 38
Nachrichten sind stressiger als die Realität 40
Wir lernen, hilflos zu sein 45
Das Versagen der Medien? 48
Unsere Informationswut 50
Die Sache mit dem Medienvertrauen 57
Was wir gewinnen, wenn wir uns auf den Weg machen 63
Kapitel 3
Weg von der Nadel:
Konstruktiver Journalismus als Alternative 65
Von der Idee zum Medien-Start-up: Perspective Daily 69
Zutat I: Ein neuer Blick auf die Welt 71
Zutat 2: Formsache 120
Zutat 3: Das Handwerkszeug der Wissenschaft! 140
Die geheime vierte Zutat 155
Kapitel 4
Deine einzige Chance:
Das Rüstzeug gegen die tägliche Informationsflut 159
Lektion I: Warum du denkst, dass du recht hast 160
Lektion 2: Warum Fake News sich so gut
in deinem Gedächtnis festsetzen 166
Lektion 3: Warum uns unser Ego wichtiger ist
als die Wahrheit 174
Lektion 4: So schnell sind dir die anderen egal 1S2
Lektion 5: Warum du nicht alles frei entscheidest 190
Lektion 6: Dieses Syndrom hat auch dich fest im Griff. 195
Lektion 7: Warum Bullshit gefährlicher ist als jede Lüge
202
Anhang 209
Anmerkungen 211
Bildnachweis 220
Dank 221
- "Vorwort
In einer kleinen montenegrinischen Stadt begegne ich während einer Urlaubsreise der riesengroßen Puppe eines Mädchens, das jeder kennt. Es sitzt auf der Stadtmauer und lächelt in die Sonne. Unverkennbar sind die Sommersprossen und die geflochtenen Zöpfe links und rechts. Es ist das Mädchen, das sich die Welt macht, wie sie ihr gefällt, gemeinsam mit ihrem Affen Herrn Nilsson und dem Pferd Kleiner Onkel. Unweigerlich muss ich schmunzeln, als ich diese übergroße Pippi Langstrumpf erblicke und an ihre wohl bekannteste Liedzeile denke: »Ich mach mir die Welt, widde widde wie sie mir gefällt.«
Denn nicht nur das Mädchen mit den wilden Ideen macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt, sondern wir alle machen das. Geboren mit unserem individuellen Erbgut und geprägt durch jeden einzelnen Moment unseres Lebens, nimmt jeder seine Umwelt ganz individuell wahr. Schuld daran ist niemand anderes als der beeindruckende Zellhaufen in unserem Kopf, unser Gehirn. Knapp zehn Jahre lang habe ich mich damit beschäftigt, wie sehr unser Oberstübchen die eigene Wahrnehmung beeinflusst und sich gleichzeitig ständig verändert, abhängig davon, womit wir unsere Zeit verbringen. Während meiner Promotion in Neurowissenschaften in London kam ich zunehmend ins Grübeln über meine Rolle in der Welt. Die wichtigste Frage dabei war für mich: Wie kann ich meinen Beitrag zu einer besseren Welt leisten? Und weil ich mich so viel damit beschäftigt hatte, was unser Gehirn mit den Informationen anstellt, die ihm begegnen, landete ich schnell bei der Frage, woher diese Informationen eigentlich kamen. Zeitung, Radio, Fernsehen, Internet: Ein Großteil kommt aus den Medien. Leider musste ich auch [>10] feststellen, dass unser Steinzeithirn im digitalen Zeitalter damit hoffnungslos überfordert ist.
Und dann? Dann habe ich ein Medien unternehmen mitgegründet. Klingt verrückt? Ist es aber nicht. Vielmehr war es für mich die logische Konsequenz aus der Erkenntnis, wie sehr unser täglicher Medienkonsum unser Gehirn und damit unser Weltbild und -Verständnis beeinflusst. Denn mit Blick auf die Welt der Nachrichten und Berichterstattung da draußen war mir schnell klar: Die wenigsten Medienschaffenden sind sich ihrer Macht bewusst. Stattdessen sorgen sie mit ihrer Arbeit - häufig unbewusst - nicht nur dafür, dass wir schlecht informiert sind, sondern verstärken auch Vorurteile, Missverständnisse und Konflikte. Weil sie die wichtigste Zutat im Medien- und Informationsalltag vergessen: unser Gehirn."
- "Kapitel 3
Weg von der Nadel: Konstruktiver Journalismus als Alternative
Die große Frage ist also: Wie kann Journalismus aussehen, der uns nicht mit einem zu negativen Weltbild gestresst und hilflos zurücklässt? Diese Frage drängte sich mir im Verlauf meiner Promotion in Neurowissenschaften immer wieder auf. Damals hatte ich zwar schon Journalistische Erfahrungen gemacht, untersuchte als Doktorandin aber, wie wir in unserem Gehirn neue Informationen verarbeiten, welche Rolle beim Erlernen von neuen Tätigkeiten die schon beschriebene aktuelle Hirnaktivität spielt und wie Emotionen unser Gedächtnis, unsere Stressverarbeitung und unsere Weitsicht beeinflussen.
Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich bald ein Medienunternehmen mitgründen würde, hätte ich mein Gegenüber wohl ausgelacht. Zwar war ich schon immer am Journalismus interessiert gewesen, hatte als freie Mitarbeiterin auch die ersten Artikel für die Neue Westfälische geschrieben und spielte sogar kurz mit dem Gedanken, Journalistin zu werden. Doch nur eine journalistische Ausbildung zu machen und zu berichten erschien mir nicht besonders attraktiv. Schließlich wollte ich auch etwas bewirken und fragte mich schon damals: Wie sollte ich die Menschen richtig informieren, wenn ich selbst kein Fachwissen in den Themen mitbrachte, über die ich andere informieren wollte? Das erschien mir zweifelhaft. Selbst die Redakteure der kleinen Lokalredaktion der Neuen Westfälischen empfahlen mir: »Studier erst mal was Richtiges!«
Knapp zehn Jahre später fand ich mich also in London wieder, um meine Promotion in Neurowissenschaften abzuschließen. In der britischen Hauptstadt fällt es nicht schwer, an jeder Ecke auf interessante Personen und faszinierende Geschichte zu treffen. Ich begegnete täglich so vielen Menschen und Organisationen, die an konkreten Lösungen für soziale und politische Probleme arbeiteten, sich auf politischer Ebene engagierten oder bereits geschaffene Lösungsansätze für die großen Fragen unserer Zeit erprobten. Sie alle hatten erkannt, dass wir gesellschaftlich vor riesigen Herausforderungen stehen, sei es nun der menschengemachte Klimawandel,1 weltweit ansteigende Flucht? und Migrationsbewegungen (immer häufiger auch durch die Folgen des Klimawandels bedingt) oder die ebenfalls damit verbundene Frage globaler Ungerechtigkeit.
Warum standen diese Themen und Menschen nicht regelmäßig auf Seite eins der Tages- und Wochenzeitungen? Warum, machten sie keine Schlagzeilen? Warum hörten und sahen wir davon wenig bis gar nichts in den Nachrichtensendungen im Radio und Fernsehen? Die Antwort auf diese zugegeben recht naiven Fragen habe ich in Kapitel 1 natürlich schon selbst gegeben und knüpfe jetzt daran an, wenn ich die alles entscheidende Frage stelle: Wie wollen wir den aktuellen Herausforderungen begegnen, wenn wir nicht zukunftsorientiert darüber sprechen? Und wie sollen wir zukunftsorientiert darüber sprechen, wenn wir nicht wissen, welche Herausforderungen uns bevorstehen und welche Lösungsansätze es bereits gibt? So stellte ich mir immer mehr Fragen nach der Verantwortung der Medien im Allgemeinen und des Journalismus im Speziellen - und war bald nicht mehr allein. Gemeinsam mit Han Langeslag, ebenfalls Neurowissenschaftler, begannen wir uns immer mehr Gedanken darüber zu machen, bis wir schließlich gemeinsam Perspective Daily gründen sollten.
Bis mir die Zusammenhänge, die ich in den ersten beiden Kapiteln beschreibe, klar wurden, dauerte es zwar noch ein wenig, aber der Anfang war gemacht, und ganz persönlich ließ mich eine Frage nicht mehr los: Sollte ich doch meine Berufung im Journalismus finden? Plötzlich sah ich meine mögliche Rolle als Neurowissenschaftlerin ganz klar vor mir. Ganz einfach, weil ich mir in den kommenden Monaten ein paar grundsätzliche Fragen stellte: Woher bekommen wir eigentlich unsere Informationen und damit unsere Sicht der Welt? Die Antwort ist verblüffend einfach: zu einem großen Teil aus den Medien.
Wollte ich selbst daran mitarbeiten, dass mehr Menschen über die Zukunft und mögliche Lösungen nachdachten, musste ich also doch in die Medien. Und das möglichst schnell. Denn gerade mit Blick auf die Herausforderungen durch den Klimawandel hatte ich das Gefühl, dass wir in einem voll besetzten Zug auf den Abgrund zurasten. Es brauchte also möglichst schnell viele motivierte Menschen, die die Schienen in eine andere Richtung verlegten, weg vom Abgrund. Oder die es vielleicht sogar schaffen konnten, den Zug zu stoppen, alle Gäste baten auszusteigen und eine neue Art des Transports im Angebot hatten.
Aber meine akademische Karriere dafür an den Nagel hängen? Egal wie ich es drehte oder wendete, die Überlegungen zu meiner persönlichen beruflichen Zukunft lieferten ein eindeutiges Ergebnis: Ich kann die Erkenntnisse meiner bisherigen wissenschaftlichen Arbeit zum menschlichen Gehirn nutzen, um einen Journalismus voranzutreiben, der es schaffte, die Menschen für aktuelle Probleme zu sensibilisieren, und ihnen gleichzeitig aufzeigte, wie wir diese Probleme bewältigen können.
Genau in dieser Zeit, in der ich mir Gedanken über meine eigene Zukunft machte und zu der Überzeugung kam, dass ich als Journalistin oder Redakteurin deutlich mehr Menschen erreichen könnte denn als Neurowissenschaftlerin, stolperte ich auch das erste Mal über den Ignoranztest von Hans Rosling. Ich muss zugeben, ich schnitt ziemlich schlecht ab, und mein Ergebnis zeigte mir: Auch ich habe ein zu negatives Weltbild.
Eins und eins zusammengezählt, war damit klar: Irgendwas [>68] lief bei der Aufgabe der Journalisten, den Menschen ein realistisches Weltbild zu vermitteln, gehörig schief. So kam der Moment, in dem ich meiner wissenschaftlichen Karriere Lebewohl sagte und nach Deutschland zurückkehrte.
Dabei ging es mir selbstverständlich nicht darum, den Journalismus neu zu erfinden oder jetzt den Journalisten dieser Welt zu erklären, wie unser Gehirn funktionierte und was sie bisher alles falsch gemacht hatten. Denn wenn ich während der vergangenen Jahre als Neurowissenschaftlerin eins gelernt hatte, war es vor allem die Einsicht, dass der Zellhaufen in unserem Kopf noch viel komplexer war, als ich jemals zu ahnen vermutet hätte. Je mehr ich mich mit dem menschlichen Gehirn auseinander- I setzte, desto klarer wurde mir, wie wenig die gesammelten Heerscharen an Neurowissenschaftlern bisher über die Funktionsweise und das Zusammenspiel der 86 Milliarden Zellen in unserem Oberstübchen wussten. Aber auch wenn wir vieles über die Funktionsweise unseres Gehirns noch nicht wissen - und vielleicht niemals begreifen werden können -, haben wir seit der Etablierung der Neurowissenschaften als eigenständige wissenschaftliche Disziplin einiges dazugelernt. ... ...."
Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) in Köln."
Bewertung: Eine gute Idee, die inzwischen offenbar auf gutem Wege ist, wie man dem Wikipediaartikel entnehmen kann, und mit Hilfe der Kritik sich auch weiter entwickelt. Die traditionelle Medienmacht behindert nicht nur echten Fortschritt, sie ist auch undemokratisch und desorientiert.
Bibliographie: Ahnert, Lieselotte (2019, Hrsg.). Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung. 4. Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag. 420 Seiten. 42 Abb. 16 Tab. Innenteil zweifarbig.
Verlags-Info: "Frühe Bindungen sind „innige“ Beziehungen, die das Sozialverhalten prägen. Psychoanalytiker John Bowlby begründete die Bindungstheorie in den 1950er Jahren. Anfängliche Widersprüche können nun zunehmend geklärt werden. Dieses Buch gibt einen anschaulichen Überblick über Entstehung und Entwicklung von frühen Bindungen. Führende deutschsprachige Bindungsforscher erklären, welche Faktoren die Bindungsentwicklung beeinflussen, wie sich frühe Bindung auf das Sozialverhalten auswirkt und wie es zu Fehlentwicklungen kommt. Dabei werden Ansätze der Entwicklungspsychologie, Psychoanalyse, Verhaltensforschung, Neuropsychologie und der Sprachwissenschaft einbezogen."
Inhaltsverzeichnis (auch als PDF beim Verlag herunterladbar):
- Geleitwort
Von Jörg Maywald 15
Vorwort
Von Lieselotte Ahnert 17
Teil I
Einführung in theoretische und methodologische
Orientierungen
Kapitel 1
Theoretische und historische Perspektiven der Bindungsforschung
Von Klaus E. Grossmann 21
Einleitung 21
1 Bindung, Entwicklung und Kultur 21
2 Die Analyse der Psyche: Sehnsucht nach der Erklärung des eigenen
Lebens 27
3 Die Bindungstheorie 28
4 Interaktionen zwischen Kind und Bindungspersonen, die zu sicheren
und unsicheren Bindungen führen 30
5 Die unterschiedlichen Rollen von Müttern und Vätern als
Bindungspersonen 37
6 Bindungsforschung - gestern und heute 38
Kapitel 2
Psychoanalytische Aspekte der Bindungstheorie
Von Martin Dornes 42
1 Bindungstheorie und Psychoanalyse I: Grundthemen der Debatte
45
1.1 Trieblust versus Sicherheit 45
1.2 Innenwelt versus Umwelt 46
1.3 Die (Teil-)Autonomie der Phantasie und die Individualität
der Entwicklung 48
1.4 Phantasie und Realität 50
1.5 Sexualität und andere Motivationssysteme 51
2 Bindungstheorie und Psychoanalyse II: Seelische Dimensionen interaktiver
Feinfühligkeit 53
2.1 Feinfühligkeit und Affekt-Containment 54
2.2 Feinfühligkeit und (unbewusste) Phantasie 56
3 Die Bedeutung der Kindheit und die Bedeutung von Einzelfallstudien
für ihre Erforschung 60
Kapitel 3
Bindung und Bonding: Konzepte früher Bindungsentwicklung
Von Lieselotte Ahnert 63
Einleitung 63
1 Bonding: Die biologische Basis der Mutter-Kind-Beziehung
63
1.1 Hormonelle Mechanismen mütterlicher Fürsorge
64
1.2 Neuronale Schaltkreise als Grundlage der Mutter-Kind-Beziehung
. . . . 65
1.3 Mütterliche Fürsorge und die Frühentwicklung neuronaler
Schaltkreise 66
2 Bindung: Die klassische Bindungstheorie und ihre wesentlichsten Aussagen
67
2.1 Das Bindungsverhalten des Kleinkindes 67
2.2 Die Klassifikation einer Bindungsbeziehung 69
2.3 Die Bindungsbeziehung und ihre Funktionsweise 70
2.3.1 Das innere Arbeitsmodell 71
2.3.2 Verfügbarkeit und Sensitivität der Bindungsperson
72
2.3.3 Kontextuelle Einflüsse 73
2.3.4 Identität und Selbstwertgefühl des Kindes
74
3 Widersprüche in der klassischen Bindungstheorie und ihre Grenzen
. . . 75
3.1 Die multiple Determiniertheit der Mutter-Kind-Bindung
77
3.2 Mutter-Kind-Beziehungen als variable Adaptationen 79
4 Zusammenfassung 80
Kapitel 4
Individuelle Unterschiede in der Bindung und Möglichkeiten
ihrer Erhebung bei Kindern
Von Gabriele Gloger-Tippelt 82
Einleitung 82
1 Theoretischer und forschungsmethodischer Hintergrund der Verfahren
82
2 Methoden zur Beobachtung von Bindungsverhalten 86
2.1 Fremde Situation für Kleinkinder 86
2.2 Beobachtungsmethoden für Kindergarten- und Vorschulalter
92
2.2.1 „Attachment Organization in Preschool Children“ von Cassidy und
Marvin 92
2.2.2 „The Preschool Assessment of Attachment“ von Crittenden
95
2.2.3 Das „Main-Cassidy-System“ 96
2.3 Der „Attachment Q-Sort“ 97
3 Methoden zur Erfassung von Bindungsrepräsentationen
100
3.1 Geschichtenergänzungsverfahren im Puppenspiel
100
3.2 Erhebungsverfahren mit Trennungsbildern 104
4 Ausblick 108
Kapitel 5
Kultur und Bindung
Von Heidi Keller 110
Einleitung 110
1 Definition und Konzeption von Bindung 111
2 Die Normativitätsannahme der Sensitivität 114
3 Die Normativität der Kompetenzhypothese 117
4 Sozialisationsziele, Ethnotheorien und Eltern-Kind-Interaktion
118
5 Zusammenfassung 124
Teil II
Die Entwicklung primärer Bindungsbeziehungen
Kapitel 6
Beziehungsentwicklung im Rahmen der Mutter-Kind-Dyade bei nicht-menschlichen
Primaten
Von Dietmar Todt 127
Einleitung 127
1 Zur normativen Bedeutung der Primatenforschung: Der Rhesusaffe als
Modell 128
1.1 Charakteristika der ersten Lebenswochen 128
1.2 Die Mutter als Schutzspenderin 130
1.3 Interaktionen in der Peer-Gruppe 132
2 Mechanismen der frühen Sozialentwicklung und deren Beitrag zur
Bindungsentwicklung 133
2.1 Allgemeines Ausdrucksverhalten der Jungtiere 134
2.2 Individuelle Variation im Ausdrucksverhalten der Jungtiere: Das
Temperament 137
2.3 Verhaltensbesonderheiten der Primatenmütter 139
2.4 Das Prägungslernen 141
2.5 Neurobiologische Grundlagen von Prägung und Bindung
142
3 Resümee und Ausblick 144
Kapitel 7
Frühe Eltern-Kind-Interaktion
Von Arnold Lohaus, Juliane Ball und Ilka Lißmann
147
Einleitung 147
1 Das intuitive Elternprogramm 148
2 Die Differenzierung eines Bindungs- und Fürsorgesystems
151
3 Das Sensitivitätskonstrukt und weitere Parameter frühen
Elternverhaltens 153
4 Die Differenzierung eines Sicherheits- und Wärmesystems
157
5 Das Komponentenmodell des Elternverhaltens 158
6 Ausblick 160
Kapitel 8
Die sprachliche Formatierung von Beziehungserfahrungen
Von Gisela Klann-Delius 162
Einleitung 162
1 Sprache, Kommunikation und Beziehung 162
2 Vorsprachliche Kommunikationsprozesse und die Herausbildung sowie
Repräsentation von Beziehungserfahrungen 165
3 Der Erwerb von Grundqualifikationen zur sprachlichen Kommunikation
in der frühen Eltern-Kind-Interaktion 167
4 Der sprachliche Dialog und seine Anfänge 170
5 Veränderlichkeit sprachlicher Formatierungen von Beziehungserfahrungen
174
Kapitel 9
Der Einfluss des Temperaments auf das Bindungsverhalten
Von Marcel R. Zentner 175
Einleitung 175
1 Grundlagen derzeitiger Kinder-Temperamentsforschung 176
1.1 Definition des Temperaments 176
1.2 Temperamentseigenschaften und Messmethoden 177
1.3 Temperament-Umwelt-Interaktion 181
2 Einflüsse des Temperaments auf das Bindungsverhalten
182
2.1 Direkte Effekte des Temperaments auf die Bindungssicherheit
182
2.2 Interaktionistische Effekte des Temperaments auf das Bindungsverhalten
187
2.3 Standardisiert erfasste Temperamentsmerkmale versus Wahrnehmungen
des Kind-Temperaments als Prädiktoren der Bindung 190
3 Die Eltern-Kind-Beziehung im Spiegel der Passung von Kind-Temperament
und Elternverhalten 191
3.1 Passung zwischen Kind-Temperament und elterlichen Wertvorstellungen
192
3.2 Passung zwischen Kind-Temperament und elterlichem Erziehungsverhalten
193
4 Abschließende Bemerkungen und weiterführende Anregungen
196
Kapitel 10
Neugier, Exploration und Bindungsentwicklung
Von Axel Schölmerich und Anke Lengning 198
Einleitung 198
1 Neugier und Explorationsverhalten 198
1.1 Spezifisches und diversives Explorationsverhalten 199
1.2 Formen des Explorationsverhaltens 200
1.3 Entwicklung des Explorationsverhaltens 201
1.4 Entwicklungskonsequenzen individueller Unterschiede der Exploration
202
2 Konzepte der Bindungstheorie: Die „Bindungs-Explorations-Balance“
und die „sichere Basis“ 203
3 Zusammenhang zwischen Bindung und Neugier 205
3.1 Die aktualgenetische Perspektive 205
3.2 Die ontogenetische Perspektive: Die Rolle der Bindungssicherheit
für die Entwicklung der Neugier 207
4 Neuere und erweiterte Modelle des Zusammenhangs zwischen Neugier
und Bindung 207
4.1 Die erweiterte Bindungstheorie 207
4.2 Temperamentstheorien 208
4.3 „differential susceptibility“-Hypothese 209
4.4 Kulturunterschiede in der Beziehung zwischen Bindung und Exploration
209
5 Zusammenfassung 210
Teil III
Bindungserfahrungen in erweiterten Beziehungsnetzen
Kapitel 11
Betreuungsvielfalt und Strategien der Beziehungsregulation bei nicht-menschlichen
Primaten
Von Dietmar Todt 213
Einleitung 213
1 Zur Formenvielfalt der frühen Sozialentwicklung bei Primaten
215
1.1 Exklusive Betreuung durch die Mutter 216
1.2 Ein Modell besonderer Art: Schimpansen und Zwergschimpansen . .
. . 218
1.3 Mitbetreuung durch weibliche Gruppenmitglieder 221
1.4 Mitbetreuung durch männliche Gruppenmitglieder
224
2 Evolutionsbiologische Aspekte der Betreuungspraktiken
231
2.1 Verhaltensstrategien der Mütter und Väter
233
2.2 Strategien der Nachkommen 235
2.3 Interessenkonflikte 237
3 Resümee und Ausblick 238
Kapitel 12
Vater-Kind-Bindung und die Rollen von Vätern in den ersten
Lebensjahren ihrer Kinder
Von Heinz Kindler und Karin Grossmann 240
Einleitung 240
1 Väterliches Investment in der Betrachtungsweise unterschiedlicher
Disziplinen 240
1.1 Die soziobiologische Betrachtungsweise 240
1.2 Die ökologische, kulturelle, ökonomische Betrachtungsweise
242
1.3 Die primär auf den Effekten einer Vaterabwesenheit basierte
Sichtweise 243
1.4 Die entwicklungspsychologische Sichtweise 244
2 Frühe Vater-Kind-Interaktion und die Entwicklung der frühen
Vater-Kind-Beziehung 245
2.1 Die intuitive Kompetenz des Vaters zur Interaktion mit seinem Säugling
246
2.2 Qualitative Merkmale väterlichen im Vergleich zu mütterlichen
Interaktionsverhaltens 246
2.3 Die Vater-Kind-Bindung als ein spezieller Bereich der Vater-Kind-Beziehung
247
2.4 Die Spielbeziehung als zentraler Bereich der Vater-Kind-Beziehung
. . . 249
2.5 Weitere einflussreiche Rollen des Vaters 250
3 Die Seite des Vaters: Bedingungen für väterliche Fürsorglichkeit
251
3.1 Persönliche Merkmale des Vaters 251
3.2 Merkmale des Kindes 252
3.3 Soziokulturelle Einflüsse 252
3.4 Forschungsbedarf 253
3.5 Wunsch und Wirklichkeit 254
4 Ausblick 254
Kapitel 13
Bindungsbeziehungen außerhalb der Familie: Tagesbetreuung
und Erzieherinnen-Kind-Bindung
Von Lieselotte Ahnert 256
Einleitung 256
1 Anthropologische Orientierungen: Kollektive Unterstützung in
der
Nachwuchsbetreuung 257
2 Erzieherinnen-Kind-Beziehungen in dysfunktionalen Betreuungsarrangements
258
3 Erzieherinnen-Kind-Beziehungen in Tagesbetreuung 262
4 Operationalisierung von Erzieherinnen-Kind-Bindungen durch standardisierte
Verfahren 263
4.1 Trennungs- und Wiedervereinigungssequenzen mit Erzieherinnen und
Müttern 263
4.2 Die Fremde Situation für Erzieherinnen 264
4.3 Der „Attachment-Q-Sort“ für Erzieherinnen 265
5 Vergleiche von Erzieherinnen-Kind- und Eltern-Kind-Bindungen . 266
6 Herausbildung der Erzieherinnen-Kind-Bindung und die Faktoren ihrer
Entstehung 267
6.1 Das Betreuungsverhalten der Erzieherinnen 267
6.2 Kindzentriertes und gruppenorientiertes Erzieherverhalten
269
6.3 Der Einfluss der Kindergruppe 270
6.4 Der Einfluss von Gruppengröße, Zeit und Erfahrung
273
7 Entwicklungskonsequenzen von Erzieherinnen-Kind-Bindung
275
8 Zusammenfassung und Ausblick 276
Teil IV
Ursachen und Folgen devianter Bindungsentwicklungen
Kapitel 14
Neurobiologie des Bindungsverhaltens: Befunde aus der tierexperimentellen
Forschung
Von Katharina Braun und Carina Helmeke 281
Einleitung 281
1 Das neurobiologische Substrat frühkindlicher Bindung
282
2 Der Einfluss früher Bindung auf die Entwicklung des kindlichen
Gehirns 287
2.1 Hirnstrukturelle Veränderungen 287
2.2 Neurochemische Veränderungen 291
2.3 Endokrine Veränderungen 293
3 Der Einfluss von endokrinen, strukturellen und neurochemischen Veränderungen
im limbischen System auf die Verhaltensentwicklung 294
4 Schlussfolgerungen: Präventive und therapeutische Ansätze
296
Kapitel 15
Die Desorganisation der frühen Bindung und ihre Konsequenzen
Von Marina Zulauf-Logoz 297
Einleitung 297
1 Entdeckung des desorganisiert/desorientierten Bindungsmusters
297
1.1 Auffinden von Indikatoren für Bindungsdesorganisation in der
frühen Kindheit 298
1.2 Bewertung der Ausprägung der Bindungsdesorganisation auf der
D-Skala 299
1.3 ich sonst nicht helfen lassen kann. Das Erleben der Defizite ist
für die stolzen Menschen am Golf kaum zu ertragen. So wundert es nicht,
wie sehr die augenfälligen Mängel im öffentlichen Leben
in der Verantwortung der westlichen Großmächte gesehen werden.
Der reine Opferstatus, den man sich aber dadurch zuweist, proklamiert letztlich
eine unwürdige Ohnmachtshaltung, die der Situation nicht gerecht wird
und den Einzelnen in politische Apathie und Bequemlichkeit versetzt.“
Widmung
Mutterseelenallein in Arabien
Die Harmonie der arabischen Seele
Unter dem Vergrößerungsglas
1. Das vergiftete Paradies – vom Verbot der Loslösung
Die Mutter als Schicksal
Zentralpunkt Familie
Das große Eine
Hala oder die Suche nach Halt ohne Fesseln
2. Das Nanny-Syndrom – oder die unsichtbaren Eltern
Outgesourcte Mütter
Ferne Väter
Die verlorene Kindheit
Ameera oder die vertrockneten Tränen
3. Die Kälte Allahs – wie Religion Strukturen ersetzt
Vermummte Mütter
Die Übermacht der Struktur
Die Rolle des Vaters
Händler, Krieger und Nomaden
Omar oder die Eintrittskarte ins Paradies
Uthman oder die unerträgliche Wut
4. Der zugedröhnte Narziss – Angst und Narkotika
Die Suche nach dem verlorenen Paradies
Religion – der ideale Ersatz
Zwischen Betäubung und Ernüchterung
Nasser oder die Flucht vor den Gefühlen
5. In der Hand Allahs – eine Gesellschaft ohne jeden Zweifel
Raum für die Wahrheitssuche
Glaube und Zweifel
Wenn Allah es will
Dima oder der lange Weg zum Zweifel
Zain oder die Flut der Zweifel
6. Tabuzone Körper – Sex im Reich von Tausendundeiner Nacht
Der Riss durch die Gesellschaft
Das Bündel auf der Straße
Tabu und Kontrolle
»It’s all hush-hush«
Abdullah oder die doppelte Namenlosigkeit
Khalid oder die Agonie des Vaters
7. Patchwork auf Arabisch – die Fallgruben der Polygamie
Grundlage für Seelennöte
Das Leid der Kinder
Lulwa und Issa oder der lange Schatten der Väter
Mariam und Khalifa oder die Erstarrung der Gefühle
Nour oder die Suche nach dem Vater
8. Das Reich der Fassaden – mit Gebeten gegen Depressionen
Die Matrix des Selbst
Die verdrängte Scham
Die verwöhnte Generation
Pillen und Gebete
Yasmin oder die perfekte Prinzessin
Mohammed S. oder Weg der Anpassung
9. Aus einer anderen Zeit – die Beduinin
Traurige Augen
»Too much pain«
10. Der distanzlose Gott – Macht und Ohnmacht der Glaubensgewissheit
Der Einzelne und die Umma
Der eine Gott und die kopernikanische Wende
Darwin in Arabien
Der Koran und die Leugnung des Unbewussten
Blick in die arabische Seele
Wie umgehen mit dem Fremden?
Dank
Leseprobe: Der Verlag stellt auf seiner Homepage eine umfangreiche Leseprobe zur Verfügung, nämlich die ersten 27 Seiten.
Autor: "Burkhard Hofmann, Jahrgang 1954, arbeitet seit 1991 als niedergelassener Facharzt für Psychotherapeutische Medizin in eigener Praxis in Hamburg-Harvestehude. Schon früh kam er über private Beziehungen in Kontakt mit der arabischen Welt, was zu einem größeren Anteil muslimischer Patienten in seiner Klientel führte. Einer dieser Kontakte in Hamburg führte zu einer Einladung an den Persischen Golf, wo Burkhard Hofmann seit zehn Jahren regelmäßig Patienten behandelt. Er ist der wohl einzige westliche Psychotherapeut in einer Region voller westlicher oder im Westen ausgebildeter Fachärzte. "
Bewertung: Araber psychotherapieren: wie kann das funktionieren? Das interessante Buch mit dem anspruchsvollen Untertitel "Ein Psychogramm der arabischen Seele" gibt Antworten. Und zwar von jemand, der weiß wovon er redet, weil er dort gelebt und praktiziert hat. Das ist fast immer ein großer Vorzug.
Bibliographie: Fischer, Thomas (2018) Über das Strafen.
Recht und Sicherheit in der demokratischen Gesellschaft. München:
Droemer.
Verlags-Info: "Was ist eine gerechte Strafe? Gibt es sie überhaupt?
Für den leidenschaftlichen und wortmächtigen Strafjuristen Thomas
Fischer geht es um das, was unsere Gesellschaft zusammenhält: Ein
selbstgegebenes Regelwerk, unser Rechtssystem, das von vielen Bedingungen
abhängt und in ständiger Bewegung ist. Wie kein anderes Rechtsgebiet
steht das Strafrecht im Fokus öffentlichen Interesses. Als Grundlage
staatlichen Handelns verspricht es Sicherheit; aber es ist auch ein Ort,
an dem grundlegende Fragen des gesellschaftlichen Lebens, der Freiheitsspielräume
und der Verantwortung verhandelt und besprochen werden. Fischers These:
Strafrecht ist Kommunikation und Gewalt. Keiner kennt seine Entwicklung
besser als der weit über seine Fachkreise hinaus bekannte frühere
Bundesrichter. "
Inhaltsverzeichnis Fischer
:
Das Inhaltsverzeichnis im Buch ist kürzer als das Verlagsinhaltsverzeichnis
[...], das Verlagsinhaltsverzeichnis ist kürzer als die Unterkapitel
im Buch selbst [[...]]
Vorwort 9
Einleitung: Das Bedürfnis nach Strafrecht 11
I. Natur, Gesellschaft, Strafrecht 23
1. Handlungen – Über
die Abgrenzung von Agieren und sinnhaftem Verhalten 24
2. Der freie Wille – Setzt
Verantwortung Selbstbestimmung voraus? 29
3. Normativität – Der
Zusammenhang von Wahrscheinlichkeit und Zumutung 34
4. Moral – Verbindung von
Sinn und Empathie 39
5. Kausalität – Was
reicht als Ursache für Verantwortung? 45
6. Herrschaft – Die Übersetzung
von Sinn und Gewalt in Macht und Gesellschaft 50
7. Recht – Regelhaftigkeit
von Erwartungen, Methoden und Legitimationen 56
8. Sanktionen – Machtvolle
Handlungskonzepte zwischen Erwartung, Enttäuschung und Beharren 64
II. Strafrecht und Kommunikation 71
1. Wahrheit – Eine angeblich
eindeutige, notorisch verkannte, sozial entscheidende Erfindungen 73
2. Massenmedien – Agenturen
zwischen Wirklichkeit und Wahrheit 79
3. Grenzüberschreitungen
– Risiken der Selbstüberschätzung 81
4. Berichte über das
Strafen – Welche Wirklichkeit wird rekonstruiert? 84
5. Berichte über Sicherheit
– Verständigungen über Wahrheit nach unerklärten Regeln
91
[5.1. Sachkunde – Wissen Journalisten, was sie über Strafrecht schreiben?
92
5.2. Sicherheitslage – Soziale Wirklichkeit zwischen Hype, Fake und Weltuntergang
94
5.3. Polizei, Justiz – Helden, Versager, Besserwisser?] 97
6. Schuld und Presse – Verantwortung
in kleinem Karo 103
7. Vermittlungen 108
III. Strafrecht und Gerechtigkeit 109
1. Wahrheit – Was soll der
Strafprozess über die Vergangenheit sagen – und warum? 109
[1.1. Wirklichkeit und Wahrheit – Ist Facebook wahr, die Bibel oder der
Koran? 112
1.2. Erkenntnisanspruch – Die Grundlagen von Wahrheit 121
1.3. Verdichtung – Zusammenhang von Wirklichkeit und Wahrheit, Ich und
Wir 124
1.4. »Prozessuale Wahrheit« – Produzieren Strafprozesse lauter
Lügen? 132
1.5. Beispiele] 135
2. Gerechtigkeit – Ewiges
Konzept oder veränderliche Konvention? 140
3. Integration und Prävention
– Welche Zwecke verfolgt Strafrecht? 145
IV. Strafrecht in Deutschland heute 151
1. Strafrechtssystem – Was
ist das Systematische am Konkreten? 151
2. Rechtsgüter – Was
soll das Strafrecht eigentlich beschützen? 162
3. Straf-Tatbestände
– Puzzleteile des Gesetzes 168
[3.1. Äußere Merkmale – Handeln, Begrenzungen, Erfolge 171
3.2. Bestimmtheit und Lücken – Strafrecht als Schutzwall 175
[[3.2.1. Rückwirkungsverbot - Vertrauen auf Vertrauen 177
3.2.2. Gesetzlichkeit - Es gilt das geschriebene Wort 178
3.2.3. Bestimmtheit - Begriffe, Wahrheit, Kommunikation 182
3.2.4. Sprache, Begriffe, Grenzen - Worte und Symbole für Wahrheit
184
3.2.5. Definitionen - Kreativer Freiraum oder Spiegel der Wirklichkeit]]
192
3.3. Vorsatz und Fahrlässigkeit – Der »Tatbestand« in
der Reflexion des Subjekts, und umgekehrt] 201
[[3.3.1. Wissen und Wollen - Die zwei Seiten innerer Einstellung 203
3.3.2. Irrtum - Abweichungen zwischen Wirklichkeit und Vorstellung]] 214
4. Versuche und Erfolge,
Verletzungen und Gefährdungen – Das Eingemachte der Strafrechtsdogmatik
216
5. Täter und Teilnehmer
– Die handelnden Personen 226
[5.1. Täter – Die »Begeher« einer Tat 227
5.2. Gehilfen – Mitwirkende ohne Tatherrschaft 230
5.3. Anstifter und Hinterleute – Steuerung aus der Ferne] 235
6. Rechtswidrigkeit – Die
Einheit der Rechtsordnung 237
[6.1. Die Indizwirkung des Tatbestands 237
6.2. Notwehr und Nothilfe – Ein »Rechtfertigungsgrund«] 242
7. Schuld – Zumessungsmaßstab
persönlicher Verantwortung 246
[7.1. Verantwortung »vor dem Gesetz« 251
7.2. Schuldfähigkeit – Die Berücksichtigung der höchstpersönlichen
Konstitution 254
7.3. Psychiatrie und Psychologie – Die besseren Strafrechtswissenschaften?]
259
V. Strafrechtspolitik 263
1. Kompetenzen – Von wem
und wie wird Strafrecht gemacht? 263
[1.1. Das Verfahren der Strafgesetzgebung 265
1.2. Strafrecht als »lebendes« Recht] 267
2. Aktualitätsbezogene
Strafrechtsproduktion – Rechtspolitik nach Regeln der Talkshow 268
3. »Geldwäsche«
– Ein Beispiel misslungener Strafrechtspolitik 273
4. »Bekämpfungs«-Gesetze
– Politische Versprechungen mittels Wortakrobatik 281
5. Strafrechtspolitik und
Wissenschaft – Ein interessenüberwuchertes Verhältnis 287
6. Fehlerkorrektur – Das
kurze Gedächtnis der Strafrechtspolitik 290
7. Steuerung durch Strafrecht
– Kann man Moral durch Strafrecht lenken? 293
VI. Strafrechtspraxis 297
1. Strafjustiz – Die Organe
der Rechtsverwirklichung 297
[1.1. Richter – Die Entscheider] 303
[[1.1.1. Richterkarriere und Richterpersönlichkeit 305
1.1.2. Ein wenig Dienstrecht]] 311
[1.2. Richter im Strafverfahren] 316
[[1.2.1. Verfahrensrollen 319
1.2.2. Schöffen - Das Laienelement]] 320
[1.3. Staatsanwälte – Herren des Verfahrens] 321
2. Strafverfahren – Vom
Wert der Form 326
3. Strafverteidigung – Die
andere Perspektive 332
[3.1. Rechtslage 335
3.2. Was ist »gute« Strafverteidigung? 337
3.3. Missbrauch von Verteidigern 341
3.4. Missbrauch von Verfahrensrechten] 343
4. Privatisierung von Strafverfolgung
349
5. Strafvollzug 351
VII. Perspektiven 355
1. Abschaffung des Strafrechts?
356
2. Fortschritt durch Strafrecht?
361
3. Strafrecht, Demokratie,
Rechtsstaat 369
VIII. Schlussbemerkung 373
Abkürzungsverzeichnis 375
Leseprobe 1 Freier Wille
:
Der Verlag bietet auf seiner Homepage eine umfangreiche Leseprobe bis zur
Seite 44 an. Ein besonders heißes Thema ist für PsychologInnen
und Sachverständige das Thema I.2 freier Wille (S. 29-34), die in
der vom Verlag angebotenen Leseprobe enthalten ist. Hieraus kann als Fazit
festgehalten werden (S.33f):
- "... Denn letzten Endes ist man sich heute auf der Welt ziemlich einig,
dass die Geister und die Seelen ohne lebendige Materie und diese ohne die
tote nicht existieren und also eine Form derselben sind, nicht ihr Gegenteil,
|e mehr man lernt über die Neurologie, desto unhaltbarer wird die
Annahme, der Körper sei eine Art Aufbewahrungsgefäß für
das zentrale Nervensystem und dieses eine Entwicklungsstätte für
eine substanzfreie »Freiheit« des Denkens und Entscheidens.
Denn unzweifelhaft denkt der Mensch mit seinem (ganzen) Körper und
nicht in einer Sphäre jenseits von ihm: ohne Neuronen kein Input,
keine Bewertung, kein Output, Und die Neuronen sind, wie sie sind: keine
Rechenmaschinen oder Speicherchips, und keine Antennen für göttliche
Funksprüche.
Damit kann man — als Mensch, Philosoph oder Strafrechtler - nicht nur leben, sondern muss es. Die Erkenntnis, dass das Ich, mit all seinen Entscheidungen, Geheimnissen und Bedingungen, im Körper und durch ihn entsteht, wohnt und existiert, verhindert die Annahme von »Freiheit« nicht, wenn es diese nicht als metaphysische Instanz voraussetzt, sondern als Funktion des biologischen Lebens begreift.
Nur »letzten Endes« scheint sich Entscheidungsfreiheit hier aufzuheben in einer — jedenfalls möglichen Kausalitätsbehauptung: Denn wenn, idealtypisch, alle individuellen Verschaltungsvorgänge des Gehirns verstanden, gemessen und bestimmt werden können und dem »freien Willen« daneben kein eigener Raum mehr verbleibt, stellt sich die Freiheit des individuellen Denkens und Entscheidens selbstverständlich als jeweils »zwangsläufige« Folge gegebener Bedingungen dar. Das ist überaus naheliegend und nicht schlimmer als die Erkenntnis, dass der menschliche Geist zu seinem Wirken Sauerstoff benötigt.
Das Entscheidende ist also nicht das Entstehen dessen, was der Mensch als »Freiheit« empfindet, aus der Geltung unfreier [>34] oder jedenfalls vom menschlichen Wollen unabhängiger Gesetzmäßigkeiten der Natur. Für die Betrachtung des Zusammenlebens viel wichtiger ist das Verständnis dessen, was man, auf jeder Ebene, als »Kausalität«, als Zusammenhang von Wirkung und Ursache ansieht. Chaostheorien und Theorien komplexer Systeme, die dynamisch, also grundsätzlich deterministisch sind, geben Anhaltspunkte dafür, dass zwar »Freiheit« des Willens eine Illusion sein mag, das Bewusstsein von ihr aber eine Wirklichkeit ist, die eine Grundbedingung menschlichen Lebens darstellt» Dabei kann es hier dahingestellt bleiben, ob und wie man das Bewusstsein als »Rätsel« versteht."
- "Es muss also, damit das Verantwortlichmachen und
Bestrafen eine Grenze findet, eine Schranke des »Zurechnens«
eingebaut werden. Die Ursächlichkeit muss eingeschränkt
werden. Das könnte man ganz formal machen: In einer Kette von Ursachen
[>49] werden nur die letzten drei Glieder gezählt, diese aber gleichwertig.
Oder man könnte es auf bestimmte Verantwortungsformen beziehen, zum
Beispiel unmittelbare und mittelbare Ursachen unterscheiden. »Rache«
beschränkt Verantwortung oft auf bestimmte Personenkreise (Familie,
Clan, Freunde). Schließlich kann man auch an der Frage anknüpfen,
was, wie und warum eine Person mit dem - von ihr verursachten - Schaden/
Erfolg zu tun hat und ob und welche rechtlich relevanten Pflichten
sie möglicherweise verletzt hat: Ist ein Bankmitarbeiter »verantwortlich«
dafür, dass der Geldbetrag, den Täter A an Täter B überweist,
bei Letzterem ankommt und für den Kauf einer Tatwaffe verwendet wird
?
All das sind Fragen und Probleme, die im Bereich der Ursächlichkeit immer wieder auftauchen und mit schlichten Formeln, wie sie im Alltag schnell gefunden werden, nicht zu lösen sind. Wer war »ursächlich« und verantwortlich für die Pleite der HSH-Nordbank in der zweiten Finanzkrise? Alle Mitarbeiter? Oder keiner? Alle Geschäftspartner, Konkurrenten, Eigentümer? Oder gar die Kunden, die blindlings Verbriefungen kauften und per Krediten finanzierten, die eine fiktive Geldmenge von Billionen Euro wie eine Wolke in den Himmel der Hoffnung und des Trugs bliesen?"
- In Strafverfahren, in denen es möglicherweise auch um die Frage
geht, ob der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tat in seiner »Schuldfähigkeit«
(also Einsichts- oder Hemmungsfähigkeit) eingeschränkt war, werden
regelmäßig Sachverständige aus dem Bereich der Psycho-Wissenschaften
als Gutachter vernommen. Meist sind das Psychiater, also Ärzte, deren
Fachgebiet auch die körperlichen, neurologischen und geistigen Voraussetzungen
dessen umfasst, was wir (normale) Schuldfähigkeit nennen. Die Stellung
dieser Sachverständigen zwischen den normativen Anforderungen des
Rechts, den empirischen Regeln der Diagnostik und den ärztlichen Regeln
der Therapie ist kompliziert und schwierig. Das liegt vor allem daran,
dass die Psychiatrie (ebenso wie die Psychologie) eine Kategorie von »Schuldfähigkeit«
nicht kennt - in der Medizin geht es nicht um Schuld und Unschuld, sondern
um Krankheit und Gesundheit.
Es müssen daher die rechtlichen Kategorien und Anforderungen in medizinisch-psychiatrische »übersetzt« werden, und umgekehrt. Das ist nicht einfach und auch nicht vollständig möglich. Es bleibt immer ein Rest von Unklarheit oder Dezisionismus (absichtsvoller Zielgerichtetheit). Überdies handelt es sich bei dem geistig-seelischen Zustand des Beschuldigten zum (möglichen) Zeitpunkt einer lange zurückliegenden Tat um einen höchst unsicheren Gegenstand, dessen nachträgliche Fest-[>260]stellung von vielen Voraussetzungen, Voreinstellungen und Annahmen beeinflusst sein kann.
Die Gutachter müssen sich bei ihren Feststellungen an den Kriterien des Rechts orientieren — also »Fähigkeit, Unrecht einzusehen« und »Fähigkeit, das eigene Verhalten nach der Unrechtseinsicht zu steuern« —, sollen aber gleichzeitig nicht in die Rolle von Richtern schlüpfen, die über »Schuld« (oder gar über die Täterschaft) entscheiden. Diese Rollenabgrenzung gelingt nicht immer. In der Praxis werden Sachverständige nicht selten auch vom Gericht in die Position eines »Entscheiders« gedrängt, indem ihnen Fragen vorgelegt werden, die sie nach dem Gesetzes-Programm gar nicht entscheiden dürfen. Viele Sachverständige — die ja auch nur Menschen sind — meinen allerdings, dass sie das mindestens ebenso gut können wie die Richter, die nicht ganz selten ratlos zwischen den psychiatrischen Fachbegriffen und Diagnosen herumstolpern und froh sind, wenn sie die Verantwortung auf Fachleute abschieben können. Dies kann dann dazu führen, dass der Gutachter zur entscheidenden Figur eines Prozesses wird."
- "Der verstehende kleine Rundgang durch die Voraussetzungen, Bedingungen,
Regeln und die Praxis des staatlichen Strafens sollte beispielhaft und
auszugsweise einen Überblick geben. Einzelheiten zum materiellen Recht,
insbesondere auch zum Prozessrecht, sind nur im Rahmen von Beispielen dargestellt.
Denn das Anliegen des Buches ist nicht, das »Lernen« von Strafrecht
zu ermöglichen, sondern sein Verstehen, also ein Grundverständnis
dafür zu schaffen oder zu beschreiben, was das Strafen in einer Gesellschaft
überhaupt bedeutet und welche Rolle es weit über seine unmittelbar
alltägliche Wahrnehmung hinaus spielt.
Es zeigt sich, dass — auch hier — im sozialen Leben wieder einmal alles mit allem zusammenhängt. Obwohl es nur ein kleiner, abgegrenzter Bereich des gesellschaftlichen Systems zu sein scheint, haben Vorstellungen und Darstellungen des Strafrechts bedeutenden Einfluss auf die gesellschaftliche Verfassung. Materielles Strafrecht ist die hoch symbolische Grenze zwischen »innen« und »außen«, Recht und Unrecht. Sie prägt die Vorstellung davon, was die Gesellschaft unter »Schuld« und Verantwortung versteht, zwischen welchen Handlungen und Folgen sie einen Verantwortungszusammenhang herstellt. Das Strafprozessrecht ist nicht nur die »Magna Charta des Verbrechers«, sondern vor allem auch diejenige des Unschuldigen, des Beschuldigten, des Verdächtigen. Sie bestimmt die Grenze zwischen staatlicher Gewalt und bürgerlicher Freiheit.
Strafrecht hängt daher unmittelbar und intensiv mit der politischen und rechtlichen Verfassung einer Gesellschaft insgesamt [> 374] und mit dem Verfassungsrecht zusammen: Menschen- und Bürgerrecht müssen sich gerade auch im Strafrecht verwirklichen, wenn sie Geltung haben und nicht zu Wohlfühl-Formeln herabgewürdigt werden sollen.
Strafrecht ist Gewalt und Kommunikation. Es gibt kein überzeitliches Strafrecht und kein statisches Recht. Was Strafrecht bedeutet, wie es in der Wirklichkeit wirkt, wird ununterbrochen von einer großen Vielzahl von Akteuren und letztlich allen Bürgern diskutiert, mit Sinn erfüllt, weiterentwickelt oder verworfen.
Strafrecht ist damit auch eine der wichtigsten Institutionen für die Herstellung gesellschaftlicher Rationalität, ein System, das als Gradmesser und Aktionsfeld sozialer Sinn-Produktion funktioniert. Es hängt auf das Engste mit der Verfasstheit der Gesellschaft zusammen.
Demokratie an sich erzeugt nicht gutes Strafrecht. Sie ist aber ein Legitimationsmodell, das ein rationales, auf Menschenwürde basierendes Modell einer Wahrheits-Findung ermöglicht, die den Einzelnen vor fremdem Unrecht, aber auch vor obrigkeitlicher Unfreiheit und Objektstellung schützt und - mit allen Vorbehalten, Unsicherheiten und Fehlern - an der Idee des Rechtsstaats weiterarbeitet."
Bewertung: Ein spannendes und wichtiges Buch und wie man dem Inhaltsverzeichnis entnehmen kann, auch ein sehr reichhaltiges und vielschichtiges Buch - von einem der weiß, wovon er redet und der etwas zu sagen hat, wenn auch manche Aspekte mit keinen eigenen Kapiteln oder Abschnitten bedacht wurden, z.B. das Erleben der Bestraften, die tatsächliche Wirkung der Strafen und die große Schwachstelle des Strafrechts: die Grund- und Begründungslosigkeit der Strafmaße, die, genauer betrachtet, doch ziemlich willkürlich anmuten. Dafür werden viele andere wichtige Aspekte und Themen angesprochen, z.B. auch das wichtige Thema der Sachverständigen (> Leseprobe 3).
Querverweis-1: Allgemeine und integrative Psychologie der Strafe.
Querverweis-2: Unrecht im Namen des Rechts: Kapitalrecht - Justizkritik.
Anmerkungen
__
Inhaltsverzeichnisse Wenn Verlage auf ihren Seiten keine Inhaltsverzeichnisse mitteilen, kann man solche aber inzwischen öfter bei Universitätsbibliotheken finden (Beispiel). Da die die URL Adressen sich mit Neuauflagen oder aus anderen Gründen des öfteren ändern, werden hier keine direkte Links mitgeteilt, um die Fehlermeldungen 404 auf unseren Seiten zu reduzieren.
__
Bewertung. Bewertungen sind immer subjektiv, daher sind wir in unseren Buchpräsentationen bemüht, möglichst viel durch die AutorInnen selbst sagen zu lassen. Die Kombination Inhaltsverzeichnis und Zusammenfassungen sollte jede kundige oder auch interessierte LeserIn in die Lage versetzen selbst festzustellen, ob sie dieses oder jenes genauer wissen will. Prinzipiell ist die IP-GIPT nicht kommerziell ausgerichtet, verlangt und erhält für Buchpräsentationen auch kein Honorar. Meist dürften aber die BuchpräsentatorInnen ein kostenfreies sog. Rezensionsexemplar erhalten. Die BuchpräsentatorIn steht gewöhnlich in keiner Geschäftsbeziehung zu Verlag oder den AutorInnen; falls doch. so wird dies ausdrücklich vermerkt: Geschäftsbeziehungen. Die IP-GIPT gewinnt durch gute Buchpräsentationen an inhaltlicher Bedeutung und Aufmerksamkeit und für die PräsentatorInnen sind solche Darstellungen auch eine Art Fortbildung - so gesehen haben natürlich alle etwas davon, am meisten, wie wir hoffen InteressentInnen und LeserInnen.
___
Standort: Buch-Vorstellungen 03.
*
Buch-Vorstellungen 01 * Buch-Vorstellungen 02
Buch-Präsentationen, Literaturhinweise und Literaturlisten in der IP-GIPT. Überblick und Dokumentation.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
Buchpräsentation site: www.sgipt.org. |
Information für Dienstleistungs-Interessierte.
*
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS). Buch-Vorstellungen 03. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/lit/BuchVor/BuchV03.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
10.10.18 angelegt.
Bibliographie:
Verlags-Info:
Inhaltsverzeichnis:
Leseprobe:
Rezensionen:
AutorInnen:
Bewertung: