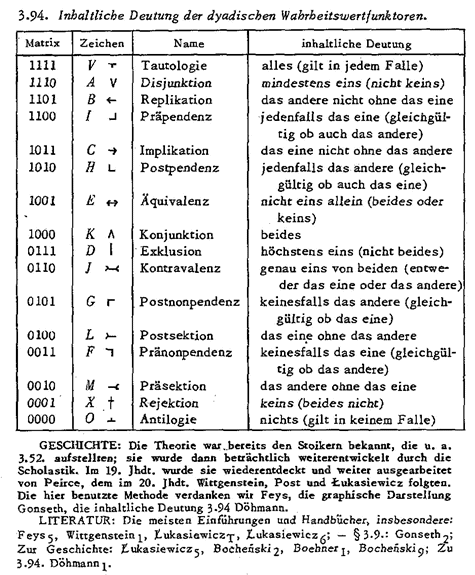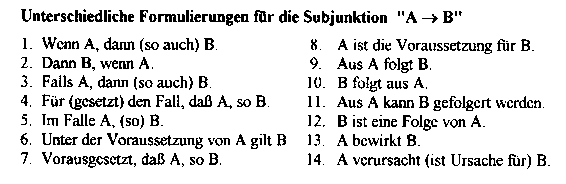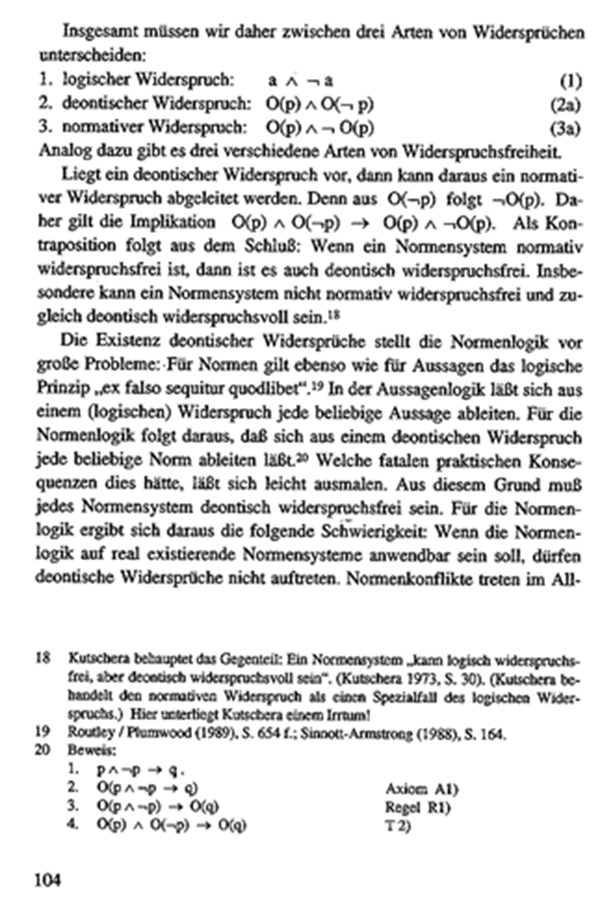(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=29.09.2019 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 17.11.19
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_Juristische Normentheorie Datenschutz_ Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Wissenschaft, Bereich Recht und Rechtswisenschaft und hier speziell zum Thema:
Juristische Normentheorie
zu Recht und Rechtswissenschaft
Eine wissenschaftstheoretische Analyse
aus interdisziplinärer Perspektive
Spezialseite zu Recht und Rechtswissenschaft
Eine kritische wissenschaftstheoretische Analyse mit Schwerpunkt Begriffswelt
aus interdisziplinärer Perspektive
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
Zum Geleit:
_
/ga
Zusammenfassung - Abstract - Summary
Die juristische Normentheorie befasst sich mit allem, was die Normen im Recht betrifft. Man könnte auch sagen, es handelt sich um eine Wissenschaftstheorie der Rechtsnormen. Das ist viel mehr als "nur" Rechtsnormlogik oder deontische Logik mit der ohnehin die wenigsten praktisch etwas anfangen können.
Wie so vieles im Recht und in der Rechtswissenschaft, ist auch der Rechtsnormbegriff unklar und verwirrend (>Tabelle). Das mag verwundern, weil doch zumindest der allgemeine Normbegriff wirklich sehr einfach ist, so dass man sagen könnte: eine Rechtsnorm ist eine Norm im Recht. So einfach ist es aber in den Rechtswissenschaften leider nicht. Das hat im Wesentlichen drei Gründe: Erstens die vielen Formen und Varianten der Rechtsnormen und ihrer Sprache (deutsches Kauderwelsch); zweitens die unnötige Komplikation und Unklarheit mit den Rechtsfolgen. Zusätzlich komplizieren Fragen der Logik und die Beziehung zu Werten. Drittens fehlt eine einfache, praktische Deontologie mit Anwendung auf die Gesetze. Rechtsnormen sind Wertsetzer, sie definieren Werte durch gebieten, verbieten, erlauben oder Rechtsausstattung, aber Werte existieren unabhängig davon, ob sie Gegenstand einer Rechtsnorm werden. Norm und Wert sind zweierlei.
Eine vollständige Rechtsnorm besteht, wie in der Eingangsgraphik dargelegt, aus 6 Teilen. Aber die wenigsten Rechtsnormen sind vollständig und klar formuliert. Irgendeines oder auch mehrere der sechs Kriterien fehlen meistens. Nach 1500 Jahren Rechts"wissenschaft" eine sehr ernüchternde und unverständliche Bilanz, im Grunde ein unerträgliches Durcheinander.

Auf dieser Seite soll eine klare, präzise aber auch praktische Terminologie als Grundlage für eine Theorie der Rechtsnormen entwickelt werden, deren Nützlichkeit an zahlreichen Beispielen - vom Kodex Hammurabi bis hin zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) - demonstriert wird, wobei wir uns an folgenden
Grundfragen der Rechtsnormentheorie orientieren:
- Was soll Norm heißen? (Man beachte, es geht um Prädikation oder Definition). Was sind die Elemente einer Norm?
- Was soll Rechtsnorm heißen? (Man beachte, es geht um Prädikation oder Definition). Was sind die Elemente einer Rechtsnorm?
- Welche Formen und Varianten von Rechtsnormen gibt es?
- In welchen Beziehungen können Rechtsnormen zueinander stehen?
- Was soll der Rang einer Rechtsnorm bedeuten? (Man beachte, es geht um Prädikation oder Definition).
- Zu was braucht man Ränge der Rechtnormen?
- Wie wird der Rang einer Rechtsnorm festgestellt? (empirisch rechtswissenschaftliche Frage)
- Was heißt Rechtsnormlogik, was wird darunter verstanden?
- Zu was braucht man eine Rechtsnormlogik? (Man beachte, es geht um Prädikation oder Definition).
- Was soll eine Rechtsnormlogik leisten?
- Was genau soll Logik (logisch) heißen und warum? (Man beachte, es geht um Prädikation oder Definition).
- Kann man die Rechtsnormlogik nicht als einfache Aussagenlogik betreiben?
- Sollen Rechtsnormen und Werte unterschieden werden? (Man beachte, es geht um Prädikation oder Definition).
- Welche genaue Beziehung besteht zwischen SEIN und SOLLEN?
Nach dem Einstiegsbeispiel definieren wir einige Grundbegriffe,
die wir dann auf eine Reihe von Beispielen aus Norm- oder Gesetzestexten
anwenden und ihre Tauglichkeit zur Analyse der Rechtsnormen erproben.
Einstiegsbeispiel Diebstahl
ist verboten und wird bestraft.
Zum Einstieg eine Beispielanalyse mit den vorgeschlagenen Unterscheidungen:
Tatbestand (T), Erfüllung des Tatbestandes (T+), Deontor beim Tatbestand
D(T) bzw. beim erfüllten Tatbestand D(T+), Rechtsfolge (F), Deontor
bei der Rechtsfolge D(F) und der WENN-SO-Beziehung "=>"
| Kürzel | Interpretation des Rechtstext: Diebstahl ist verboten und wird bestraft. |
| T | Diebstahl |
| T+ | als gemeint erfüllt interpretiert |
| D(T) | als T+ interpretiert |
| D(T+) | D = verboten |
| F | bestraft |
| D(F) | wird = soll bestraft werden |
| WENN-SO | Erfüllter Tatbestand wird mit der Rechtsfolge WENN-SO verknüpft |
| Rechtsnormformel | RN01 = D(T+) => D(F) |
Grundbegriffe und Kürzel zur Analyse von Rechtsnormen
- Sprache, Objektsprache und Metasprache. Spricht man in einer Sprache, nennt man dies in der Wissenschaftstheorie objektsprachliche Verwendung. Spricht über eine Sprache heißt das metasprachliche Nutzung. So kann man das auch mit Normen machen: Diebstahl ist verboten zeigt eine objektsprachliche Sicht. Diebstahl ist verboten ist eine Norm zeigt eine metasprachliche Sicht. Fragt man, ist es richtig, dass Diebstahl verboten ist, so ist die Frage doppeldeutig. Nämlich, ob die Norm gilt, z.B. Gesetz ist, dann ist die Antwort wahr oder falsch. Oder, ob die Norm als Verbot zu Recht besteht. Dann ist die Antwort nicht wahr oder falsch, sondern man gibt eine Antwort, ob die Norm gelten soll oder nicht. Diese Seite gehört zur Metanormsprache. Die analysierten Gesetze gehören zur Objektnormsprache, die Analysen selbst wiederum zur Metanormsprache.
- Sein und Sollen In fast allen Gesetzen ist Sein (Tatbestand) mit Sollen (D: geboten, verboten, erlaubt, Recht) verknüpft. Die These, dass man dies nicht dürfe oder könne, ist also weitgehend absurd. Man muss es, wenn man Gesetze will. Jeder Normkern besteht aus Deontor und Sachverhalt, formal D(S+) im Allgemeinen und aus Deontor und Tatbestand, formal D(T+), im Rechtsnormfall. Das lässt sich vielfach auch gut begründen. Das "+" zeigt die Erfüllung des Sachverhaltes oder Tatbestandes an. (Rechts-)Folgen können ja nur dann greifen, wenn der Sachverhalt oder Tatbestand erfüllt sind. Aus bloßen Beschreibungen ergibt sich gar nichts. Das wird leider oft vergessen.
- Saetze
- die Sachverhalte, die Wirklichkeit beschreiben, heißen Aussagen (Propositionen) und sie haben einen Wahrheitswert. Elementaraussagen sind wahr, falsch oder nicht entscheidbar. Komplexe Aussagen können auch teilweise wahr, falsch oder nicht entscheidbar sein (der Regelfall vor Gericht).
- Normaussagen: Aussagen, die einen Deontor (geboten, verboten, erlaubt) enthalten, heißen Normaussagen.
- Wertaussagen: Aussagen, die einen Valenzor enthalten (positiv, negativ, ...), also ein Werturteil enthalten, heißen Wertaussagen oder Werturteile.
- S Sachverhalt irgend etwas, das es gibt oder nicht gibt (in beliebigen Welten). Ein Sachverhalt muss mindestens aus einer Elementaraussage bestehen X e P oder X e' P (Kamlah & Lorenzen 1973, S. 35)
- S+ Ein Sachverhalt, der erfüllt ist, wird mit S+ gekennzeichnet.
- T Tatbestand Ein juristisch bedeutsamer Sachverhalt heißt Tatbestand. Tatbestände werden gewöhnlich in Aussagen formuliert. Das sind Sätze oder Texte, die wahr oder falsch, mitunter unentscheidbar (non liquet) sein können. Ein Tatbestand muss mindestens aus einer Elementaraussage bestehen X e P oder X e' P (Kamlah & Lorenzen 1973, S. 35). Aussagen haben Wahrheitswerte (w, f, ?). Tatbeständen oder Sachverhalten kann man auch Wirklichkeitswerte (wirklich, existiert/nicht, existiert/nicht in dieser oder jener Weise, ...) zuordnen.
- T+ Erfüllung des Tatbestandes. Aus der bloßen Formulierung eines Tatbestandes ergibt sich noch nicht, dass dieser Tatbestand auch gegeben ist. Ist ein Tatbestand T erfüllt, so kennzeichne ich das mit T+.
- r Relatoren heißen logische Verknüpfer, wie nicht, und, oder, genau dann-wenn, ... die Tatbestände oder Rechtsfolgen miteinander verbinden. Relatoren werden hier in Großbuchstaben wiedergegeben: NICHT; UND; ODER; WENN-DANN ("=>"), GENAU DANN, WENN = DANN UND NUR DANN, WENN. Hier ist bei der Zugrundelegung des logischen Modells und der Interpretation wegen der WENN-DANN-Problematik allergrößte Vorsicht geboten. Kommt ausdrücklich Kausalität ins Spiel, wie etwa beim § 20 StGB mit dem Wörtchen "wegen" verwenden wir das Zeichen "=k=>", wobei "k" für Kausalität steht. Was links des Kausalitätszeichens "=k=>" steht, wird als Ursache oder Grund angesehen, die rechte Seite gibt die Wirkungen an, formal: Ursachen/Gründe =k=> Wirkungen/Folgen.
- D Deontoren heißen Operatoren wie geboten (Dg), verboten (Dv), erlaubt (De), Recht erteilen (DR), oft sprachlich unsauber verpackt als z.B. "ist" (GG 1) , "sind" (GG 1,3), "genießen" (GG 11,1), kann(BGB § 1923, 1) "hat" (GG Art. 2 Abs. 2 Satz 1), "so" (GG 19 (4). 1. Deontoren definieren Werte. Aber Werte und Normen sind etwas Unterschiedliches. Deontoren können vor dem Tatbestand oder vor der Rechtsfolge stehen. In vollständig formulierten Rechtsnormen ist das auch so.
- N Allgemeine Norm Eine allgemeine Norm hat die Form N = D(S), d.h. ein Sachverhalt ist geboten, verboten, erlaubt oder mit einem Recht ausgestattet.
- NF Allgemeine Norm mit Folge. NF=D(S) UND S => F. WENN S VERBOTEN ist und S GEGEBEN ist, DANN tritt die Folge F ein. Das kann auch einfach mit D(S+) => F ausgedrückt werden.
- RN Rechtsnorm ohne Rechtsfolge. RN = D(T). Es ist verboten, zu stehlen: Dv(T). T als Tatbestand, Dv als Deontor VERBOTEN.
- RNF Rechtsnorm mit Rechtsfolge. RNF = (D(T+) => D(F). WENN es verboten ist zu stehlen (T) UND es hat jemand gestohlen (T+), DANN wird der Dieb bestraft. Es gibt viele Rechtsnormformen und Varianten, wie unten gezeigt wird. Auch die Rechtsfolge kann man bestehend aus erfülltem Tatbestand und Deontor auffassen.
- Anmerkung: Die meisten rechtswissenschaftlichen Arbeiten legen keine differenzierte formal-strukturelle Normanalyse vor, schon gar nicht am Beispiel tatsächlicher Rechtsnormen (Ausnahme TU Potsdam, wo aber der Deontor fehlt > GG Art 19 (4) 1 ).
- Der Rechtssatz ist eine generell adressierte Norm.
- Der Rechtssatz ist ein bedingter Normsatz. Er beschreibt in seinem Tatbestand die Bedingungen, bei deren Vorliegen er angewendet werden soll.
- Der Rechtssatz enthält eine Sollensanordnung.
- Der Rechtssatz schreibt ein bestimmtes menschliches Verhalten vor.
- (Rechtsfolge)."
Sätze können vieles bedeuten: Aussagen, Fragen, Wünsche, Befehle, Meinungen, Vermutungen, Phantasien, Werturteile, Normen u.a.m.
_
Tabelle Norm- und Rechtsnormbegriffe
Eine genaue Analyse, Definition und Erklärung einer vollständigen Rechtsnorm findet man hier auch nach 1500 Jahren Rechtswissenschaft nirgendwo. Hier einige Bestimmungen:
_
|
|
Norm/ Rechtsnorm: Erklärung Charakterisierung Definition | Kurzkommentar |
| Alexy (1978) | nicht erklärt trotz 651facher Erwähnung | Merkwürdig, unverständlich |
| Bydlinski (2018). | Bei 13facher Erwähnung nicht erklärt | Merkwürdig, unverständlich |
| DRL (2001), S. 3039
_ _ |
Rechtliche Sollensanforderung
_ _ |
Erlaubnis fehlt (dürfen). Vollständige Struktur der Rechtsnorm nicht erkannt und erörtert. |
| Engisch 1971
_ |
Rechtssatz=Rechtnorm bestehen aus Tatbestand und Rechtsfolge (S. 19). | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |
| Hassemer/ Neumann /Saliger 2016 (Hrsg.)
_ |
Schroth S. 253 Tatbestand und Rechtsfolge
Philipps S. 291: Normen als Verbote, Gebote und übrigens auch Erlaubnisse |
Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |
| Honsell & Mayer-Maly 2015
_ |
Rechtsnormen entsprechen durchwegs dem Schema: „Wenn A ist, soll B sein“. (S. 46) | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |
| Hruschka 1972 | Nur Erwähnungen keine Bestimmung des Normbegriffs. | Keine Befassung. |
| Kelsen (1960), S. 4
_ _ |
ein Sollen
_ _ |
Kürz. Variante, Erlaubnis fehlt. Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |
| Kirchmann 1848 | Der Ausdruck "Norm" kommt bei von Kirchmann nicht vor. | Keine Ausführung. |
| Kutschera (1973), S. 11 f | geboten, verboten oder erlaubt | Vollständig, perfekt für die Norm. |
| Larenz (1991) [bis S. 188 Geschichte] verwendet für Norm auch Rechtssatz. | S. 271 "Wir haben früher gesehen, daß ein vollständiger Rechts- satz seinem logischen Sinne nach besagt: Immer wenn der Tat- bestand T in einem konkreten Sachverhalt S verwirklicht ist, gilt für S die Rechtsfolge R. ..." | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert.
_ _ |
| Mastronardi 2003 | Vollständige Rechtsnorm setzt sich aus Tatbestand und Rechtsfolge zusammen (S. | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |
| Möllers (2017), S. 102 (§ 2 Rn. 7 ff.). | "Als Imperative bestehen Rechtsnormen regelmäßig aus Tatbestand, Kopula und Rechtsfolge" | Traditionelle jur. Bestimmung
Deontoren fehlen |
| Muthorst 2011 | ||
| Ott 1979 | "Unter der Rechtsfolge verstehen wir ganz allgemein die Folge, die in der Norm an den Fall der Erfüllung ihres Tatbestandes geknüpft ist." (S. 211) | Genaue Erklärungen fehlen.
Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |
| Ott 1992 | "2. Die vollständige Rechtsnorm setzt sich aus Tatbestand
und Rechtsfolge zusammen" (S. 14-16) |
Genaue Erklärungen fehlen. Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |
| Ott 2006 | Auf den ersten 20 Seiten kommt das Wort "Norm" 65 mal (von insgesamt 715 Treffern) vor, aber keine klare und genaue Erklärung zum Begriff der Rechtsnorm. | Genaue Erklärungen fehlen.
Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |
| Puppe 2014 | S. 170 "... Eine Rechtsnorm bezeichnet in ihrem Tatbestand in der Regel eine hinreichende Bedingung, für den Eintritt einer be- stimmten Rechtsfolge. ..." | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |
| Radbruch 1932 | S. 34 Rechtssatz: Tatbestand und Rechtsfolge. | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |
| Röhl & Röhl (2008), S. 77
Rechtsstab = Gerichte
|
»Als Rechtsnormen können ... diejenigen Normen bezeichnet werden, die von einem speziellen Rechtsstab angewendet werden, der innerhalb territorialer Grenzen für sich die Kompetenz in Anspruch nimmt und diese im wesentlichen auch faktisch durchzusetzen in der Lage ist.« | Keine Definition. Formal pragma- tische Charakterisierung, Die Deontoren Gebote, Verbote, Erlaubt; Tatbestand und Rechtsfolge spielen hier keine Rolle. |
| Rüthers/ Fischer/ Birk (2018), S. 82 Rn
120
Vermutlich gehört unter 4. die Rechtsfolge als eigener 5. Punkt erfasst wofür Rn 113 S. 76 spricht. |
|
Sehr ausführlich, es fehlt die Erlaubnis. Vollständige Struktur
der Rechtsnorm nicht erkannt und erörtert.
Punkt 5 S. 82 Rn 120 unklar ausgeführt.
|
| Savigny 1802-1842 | Norm oder Rechtsnorm werden nicht erwähnt. | Keine Ausführungen. |
| Weinberger (1970), S. 32
_ _ |
Gebot, Verbot oder eine Erlaubnis
_ _ |
Vollständig, perfekt für die Norm.
Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |
| Wienbracke 2013 | 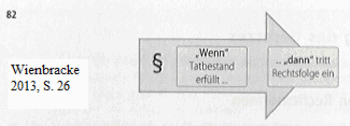 |
Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und
erörtert.
Wienbracke erfasst aber die Erfüllung des Tatbestandes. |
| Wright (1974), S. 26 | Indirekt ergibt sich: Gebot, Verbot, Erlaubnis | Indirekt Vollständig, perfekt für die allgemeine Norm, nicht Rechtsnorm |
| Zippelius 1974, S. 32f | Rechtsnorm: "Wenn ... (Tatbestand), dann ... (Rechtsfolge)." | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |
| Zippelius 2012, S. 23 | Rechtsnorm: "Wenn ... (Tatbestand), dann ... (Rechtsfolge)." | Vollständige Struktur der Rechts- norm nicht erkannt und erörtert. |
| Zoglauer (1998), S. 23
_ _ |
"Normen sagen, wie sich Menschen verhalten sollen."
_ _ |
Erlaubnis fehlt (dürfen). Vollständige Struktur der Rechtsnorm nicht erkannt und erörtert. |
- F Rechtsfolge ist vom Wort her ein trefflicher Begriff, weil hier sehr klar und deutlich zum Ausdruck kommt, dass etwas folgt. Rechtsfolgen in Rechtstexten können sehr allgemein und unbestimmt, schwierig zu erkennen sein oder auch fehlen, wie die Analyse zeigt.
- W Werte Werte heißen Sachverhalte, die Menschen zu erreichen suchen (z.B. Rechte, Vorteile, Annehmlichkeiten) oder zu vermeiden trachten (z.B. Strafen, Nachteile, Unannehmlichkeiten). G. v. Wright 1963, S. 96: "... kann man von Normen sagen, dass sie logisch Wertungen voraussetzen, die Wertungen, können jedoch unabhängig von Normen existieren." (Sekundär-Quelle Iwin)
- V Valenzoren heißen wertdefinierende Operatoren wie gut (Vp), schlecht (Vn), positiv (Vp), negativ (Vn), neutral (V0), ambivalent(Va), multivalent (Vm), unklar (V?)... , ... , z.B. Rechtssicherheit (S) ist gut: Vp(Rechtssicherheit) oder Willkür (S) ist schlecht Vn(Willkür). Im Allgemeinen repräsentieren Tatbestände, die einer Rechtsnorm unterliegen, Werte.
- NR Normen haben einen Rang, der ein eigenes Gebiet der Normlogik begründet und an dieser Stelle noch keine Rolle spielt, aber schon erwähnt werden soll, z.B. mit den Kennzeichnungen:
- NR Rang ohne Index ;= ohne nähere Spezifikation hinsichtlich des Ranges.
- NRVerf Norm mit nationalem Verfassungsrang
- NREU Norm Europarecht.
- NRMR Norm aus den allgemeinen Menschenrechte (UN-Charta)
- NRVR Norm Völkerrecht.
- ERBVerfG
- ERBGH
- ERBVerwG
- EROLG
- ERLG
- ERAG
ER Neben dem Normrang gibt es noch Entscheidungsränge.
Kombinatorik formaler Strukturen von Normen und Rechtsnormen
Mit Hilfe dieser vorab eingeführten Grund- und Hilfsbegriffe analysieren wir nun einige Gesetzestexte, um die Vielfalt an Formen und Varianten normativer Regelungen deutlich zu machen und die Tauglichkeit der Begriffe und Ausdrucksweisen zu prüfen. Im Anschluss werden die Begrifflichkeiten systematisch diskutiert und Probleme erörtert. Zunächst geht es um die Klärung der formalen Struktur von Normen und Rechtsnormen. Um hinter die normative Struktur eines Rechtstextes zu kommen, kann es hilfreich sein, die formal-kombinatorischen Möglichkeiten zu kennen, die im folgenden Zug um Zug aufgebaut und analysiert werden sollen, zunächst formal, dann an Gesetzestextbeispielen vom Kodex Hammurabi bis zur DSGVO.
Die sechs Elemente einer vollständigen
Rechtsnormformel
Zu einer Rechtsnorm gehören wenigstens zwei Elemente: Deontor
und Tatbestand. Ohne Deontor keine Norm. Im Recht spielt aber die Rechtsfolge
eine große Rolle. Wir verwenden folgende Kürzel:
- T Tatbestand ist irgendein rechtlich relevanter Sachverhalt was der Fall ist oder nicht.
- + Das Zeichen zeigt die Erfüllung des Tatbestandes an.
- D Deontor GEBOTEN, VERBOTEN, ERLAUBT, RECHT.
- D(T) Deontor für den Tatbestand
- D(T+) Deontor für einen erfüllten Tatbestand (T+).
- F Rechtsfolge in WENN-DANN Struktur. Im DANN wird angegeben, was folgt, wenn T erfüllt (T+) ist.
- D(F) Deontor für die Rechtsfolge.
- => Folgepfeil WENN-SO in äquivalenter Bedeutung.
Formal-kombinatorische Betrachtungen
Formal-kombinatorisch ergeben sich in Bezug auf die Kriterien (Parameter) der vollständigen Rechtsnormformel folgende Ausführungs- und Darstellungs-Möglichkeiten, also 2^6= 64. Nur die Nr. 01 ist vollständig. Allen anderen fehlt etwas. Man kann die Rechtsnormformel auch allgemeiner als Normformel sehen. In diesem Fall ist lediglich T (Tatbestand) durch S (Sachverhalt) zu ersetzen. Alle 63 Rechtsnormformeln ab 02 bis 64 sind unvollständig und die meisten nicht sinnvoll bis unsinnig. Nicht sinnvolle Rechtsformeln wurden gelb hinterlegt.
Tabelle der
64-formal-kombinatorischen Möglichkeiten
| Nr | D | T | + | => | D | F | Darstellung | Kurz-Interpretation |
| 01 | J | J | J | J | J | J | D(T+)=>D(F) | vollständige Rechtsnormformel |
| 02 | J | J | J | J | J | N | D(T+)=>D | unsinnig, es fehlt die Rechtsfolge |
| 03 | J | J | J | J | N | J | D(T+)=>(F) | es fehlt der Deontor bei der Rechtsfolge |
| 04 | J | J | J | J | N | N | D(T+)=> | unsinnig, es fehlen Deontor und Rechtsfolge |
| 05 | J | J | J | N | J | J | D(T+) D(F) | unsinnig, es fehlt der WENN-SO-Pfeil |
| 06 | J | J | J | N | J | N | D(T+) D | unsinnig, es fehlen WENN-SO-Pfeil u. die Rechtsfolge |
| 07 | J | J | J | N | N | J | D(T+) F | unsinnig, WENN-SO-Pfeil u. Deontor bei der Folge fehlen |
| 08 | J | J | J | N | N | N | D(T+) | es fehlen WENN-SO-Pfeil u. Deontor, Rechtsfolge |
| 09 | J | J | N | J | J | J | D(T)=>D(F) | Es fehlt die Erfüllung des Tatbestandes |
| 10 | J | J | N | J | J | N | D(T)=>D | unsinnig, Erfüllung bestandes u. Rechtsfolge fehlen |
| 11 | J | J | N | J | N | J | D(T)=>F | Erfüllung Tatbestand u. Deontor Rechtsfolge fehlen |
| 12 | J | J | N | J | N | N | D(T)=> | unsinnig, Es fehlen Tatbestandserfüllung und Rechtsfolge |
| 13 | J | J | N | N | J | J | D(T) D(F) | unsinnig, Tatbestandserfüllung u. WENN-SO-Pfeil fehlen |
| 14 | J | J | N | N | J | N | D(T) D | unsinnig, Tatbestandserfüllung, Pfeil u. Folge fehlen |
| 15 | J | J | N | N | N | J | D(T) F | unsinnig, Tatbestandserf., WENN-SO, Deontor Folge fehlen |
| 16 | J | J | N | N | N | N | D(T) | es fehlen Tatbestand erf. WENN-SO, deontierte Folge |
| 17 | J | N | J | J | J | J | D=>D(F) | unsinnig |
| 18 | J | N | J | J | J | N | D=>D | unsinnig |
| 19 | J | N | J | J | N | J | D + => F | unsinnig |
| 20 | J | N | J | J | N | N | D(T)=> | unsinnig |
| 21 | J | N | J | N | J | J | D(T) D(F) | unsinnig |
| 22 | J | N | J | N | J | N | D + D | unsinnig |
| 23 | J | N | J | N | N | J | D + F | unsinnig |
| 24 | J | N | J | N | N | N | D + | unsinnig |
| 25 | J | N | N | J | J | J | D => D(F) | unsinnig |
| 26 | J | N | N | J | J | N | D => D | unsinnig |
| 27 | J | N | N | J | N | J | D => F | unsinnig |
| 28 | J | N | N | J | N | N | D => | unsinnig |
| 29 | J | N | N | N | J | J | D D(F) | unsinnig |
| 30 | J | N | N | N | J | N | D D | unsinnig |
| 31 | J | N | N | N | N | J | D F | unsinnig |
| 32 | J | N | N | N | N | N | D | unsinnig |
| Nr | D | T | + | => | D | F | Darstellung | Kurz-Interpretation |
| 33 | N | J | J | J | J | J | (T+)=>D(F) | Es fehlt beim Tatbestand der Deontor (Ephoren Sparta) |
| 34 | N | J | J | J | J | N | (T+)=>D | unsinnig Deontor ohne Rechtsfolge |
| 35 | N | J | J | J | N | J | (T+)=> F | Deontoren fehlen beim Tatbestand und der Rechtsfolge |
| 36 | N | J | J | J | N | N | (T+) => | unsinnig |
| 37 | N | J | J | N | J | J | (T+) D(F) | unsinnig |
| 38 | N | J | J | N | J | N | (T+) D | unsinnig |
| 39 | N | J | J | N | N | J | (T+) F | unsinnig |
| 40 | N | J | J | N | N | N | (T+) | unsinnig |
| 41 | N | J | N | J | J | J | T => D(F) | Deontor beim Tatbestand u. die Tatbestandserf. fehlen |
| 42 | N | J | N | J | J | N | T => D | unsinnig |
| 43 | N | J | N | J | N | J | T => F | Es fehlen die Deontoren und die Tatbestandserfüllung |
| 44 | N | J | N | J | N | N | T => | unsinnig |
| 45 | N | J | N | N | J | J | T D(F) | unsinnig |
| 46 | N | J | N | N | J | N | T D | unsinnig |
| 47 | N | J | N | N | N | J | T F | unsinnig |
| 48 | N | J | N | N | N | N | T | unsinnig |
| 49 | N | N | J | J | J | J | + => D(F) | unsinnig |
| 50 | N | N | J | J | J | N | + => D | unsinnig |
| 51 | N | N | J | J | N | J | + => F | unsinnig |
| 52 | N | N | J | J | N | N | + => | unsinnig |
| 53 | N | N | J | N | J | J | + D(F) | unsinnig |
| 54 | N | N | J | N | J | N | + D | unsinnig |
| 55 | N | N | J | N | N | J | + F | unsinnig |
| 56 | N | N | J | N | N | N | + D(F) | unsinnig |
| 57 | N | N | N | J | J | J | => D(F) | unsinnig |
| 58 | N | N | N | J | J | N | => D | unsinnig |
| 59 | N | N | N | J | N | J | => F | unsinnig |
| 60 | N | N | N | J | N | N | => | unsinnig |
| 61 | N | N | N | N | J | J | D(F) | unsinnig |
| 62 | N | N | N | N | J | N | D | unsinnig |
| 63 | N | N | N | N | N | J | F | unsinnig |
| 64 | N | N | N | N | N | N | unsinnig (Nichtsformel) |
Ergebnis der formal-kombinatorischen
Analyse: 10 interpretierbare Rechtsnormformeln.
Von den 64 Möglichkeiten ist nur eine vollständig und korrekt.
9 sind insgesamt interpretierbar. 54 sind sinnlos und nicht vernünftig
interpretierbar.
| RNNr | Rechtsnormformel | Kurz-Interpretation / Kommentar |
| RN01 | D(T+)=>D(F) | vollständige und richtige Rechtsnormformel |
| RN03 | D(T+)=>(F) | es fehlt der Deontor bei der Rechtsfolge |
| RN08 | D(T+) | es fehlen WENN-SO-Pfeil u. Deontor, Rechtsfolge |
| RN09 | D(T)=>D(F) | Es fehlt die Erfüllung des Tatbestandes |
| RN11 | D(T)=>F | Erfüllung Tatbestand u. Deontor Rechtsfolge fehlen |
| RN16 | D(T) | es fehlen Tatbestand erf. WENN-SO, deontierte Folge |
| RN33 | (T+)=>D(F) | Es fehlt beim Tatbestand der Deontor (Ephoren Sparta) |
| RN35 | (T+)=> F | Deontoren fehlen beim Tatbestand und der Rechtsfolge |
| RN41 | T => D(F) | Der Deontor beim Tatbestand, die Tatbestandserf. fehlen |
| RN43 | T => F | Es fehlen die Deontoren und die Tatbestandserfüllung |
Im Folgenden werden die Rechtsnormen, wie sie sich in den Gesetzen und
Verordnung finden analysiert, welcher Typ Rechtsnormformel vorliegt oder
zugeordnet werden kann. An jeden Text zu einer Rechtsnormen werden 6 Fragen
gerichtet:
Grundfragen an Rechtsnormen
bei der Analyse
- Was ist der Tatbestand bzw. wie ist der Tatbestand beschrieben?
- Ist der Tatbestand als erfüllt beschrieben?
- Hat der Tatbestand einen Deontor? (geboten, verboten, erlaubt, Recht)?
- Ist eine WENN-SO Beziehung in äquivalenter Bedeutung genannt?
- Was ist die Rechtsfolge bzw. wie ist die Rechtfolge beschrieben?
- Hat die Rechtsfolge einen Deontor? (geboten, verboten, erlaubt, Recht)?
Analyse von Normen und Rechtsnormen aus Gesetzestexten
1. Beispiele zur Vielfalt der Rechtsnormen
- 1.1 Historische Rechtstexte: Kodex Hammurabi, Kyros Zylinder, Altes Testament.
- 1.2 Menschenrechte.
- 1.3 Deutsche aktuelle Rechtstexte.
- 1.4 Andere aktuelle Rechtstexte.
- 1.5 Rechtstexte anderer Kontinente und Völker.
Die allgemeine Struktur der Normen ist seit ihrer Erfindung vor
Jahrtausenden gleich: D(S), d.h. ein Sachverhalt wird geboten, verboten
oder erlaubt / mit einem Recht ausgestattet. Auch die Rechtsnorm ist in
ihren Hauptformen so aufgebaut und an einem T für Tatbestand statt
Sachverhalt erkennbar. Die moderne formale Version RN43
= (T => F) ist falsch, weil der Deontor nicht ausdrücklich mit eigener
Symbolik in der Rechtsnorm vorkommt. Das Notwendige an jeder
Norm, gerade auch bei der Rechtsnorm, ist der Deontor (geboten, verboten,
erlaubt / mit einem Recht ausgestattet). Eine "Norm" ohne Deontor ist keine
Norm, sondern eine bloße Sachverhalts- oder Tatbestandsbeschreibung.
1.1 Historische Rechtstexte
Eine der größen Sünden - neben der Rechtssprache, der
exzessiven Regelungswut und mangelhaften Methodik - der Rechtswissenschaft
und besonders der Savigny-Schule ist die narzißtische Fixierung auf
das römische Recht und damit auf ein einziges Volk und Rechtssystem
von Tausenden in der Welt.
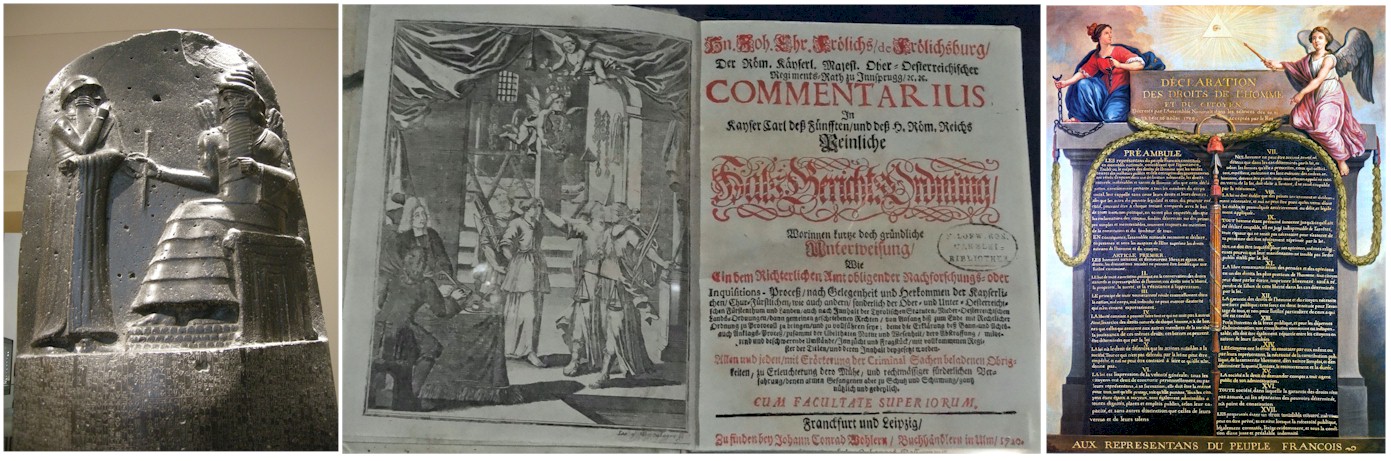
Bildquellen
Wikipedia.: Stele Hammurabi, Halsgerichtsordnung, Menschenrechte Französische
Revolution.
Kodex Hammurabi [Q]
ca. 1800 v.Chr.
§ 191 Gesetzt, ein Mann hat ein minderjähriges Kind, das
er an Kindesstatt angenommen und aufgezogen hatte, - er hat sich ein Haus
gebaut und nachher Kinder bekommen - sich vorgenommen, das Ziehkind zu
verstoßen, so wird jenes Kind nicht leer ausgehen. Sein Ziehvater
wird ihm von seinem Besitz ein Drittel seiner Erbschaft geben und es wird
gehen. Von dem Felde, Garten oder Haus braucht er ihm nichts zu geben.
"Gesetzt" wird als WENN interpretiert.
Zur Analyse stellen wir die
6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor
beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge,
(6) Rechtsfolge.
Formale Analyse: Der übersetzte Text ist ohne
Probleme zu verstehen. Das Gesetz stellt sicher, dass Ziehkinder nicht
vom Erbe ausgeschlossen werden dürfen. Was ist hier genau Tatbestand
T, Erfüllung des Tatbestandes T+, Deontor D beim Tatbestand, die Rechtsfolge
und der Deontor bei der Rechtsfolge?
Interpretation-1: Der Tatbestand ist das
"Ziehkind" und die Rechtsfolge ist "nicht leer ausgehen". Der Deontor ist
"so wird" (geboten) steht bei der Rechtsfolge. WENN ein Kind ein Ziehkind
ist (T+), DANN darf es (Dg) vom Erbe nicht ausgeschlossen werden
(F). Die Rechtsnormformel kann in den Varianten GEBOTEN oder VERBOTEN gleichwertig
formuliert werden. Dies führt in der Geboten-Variante zur Rechtsnormformel
RN33:
(Kodex Hammurabi § 191 Interpretation-1) (T+) =>Dg(F).
Diskussion: Beim Tatbestand fehlt verglichen
mit der vollständigen Rechtsnormformel der Deontor. Lässt sich
das durch geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten
bleibt?
Interpretation-2: Ein vorangestelltes
"Es gilt" führt zum gewünschten Ergebnis mit der Rechtsnormformel
RN01:
(Kodex Hammurabi § 191 Interpretation-2) Dg(T+) => Dg(F).
Anmerkung zu den Interpretationen: Die kürzeste
und klarste Fomulierung wäre: (1) Ein Ziehkind ist erbberechtigt.
(2) Ihm steht 1/3 des Besitzes zu, aber nicht vom Feld, Garten oder Haus.
_
Kyros Zylinder Persien
538 v.Chr. [Q]
> Menschenrechtsgesichtspunkt hier.
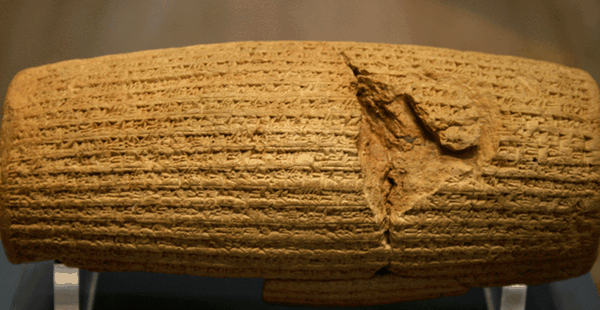
_
Altes Testament (10 Gebote)
[Q]
ca. 10.-.6. Jhd. v. Chr. [Gottesbild
im Alten Testament]
1. Gebot: Du sollst keine anderen Götter
neben mir haben. Die Text ist ohne Probleme zu verstehen. Moses 1. Gebot
formuliert einen Alleinvertretungsanspruch.
Analyse: Was ist hier
Sachverhalt, Deontor und Folge? Der Deontor ist klar: Du sollst nicht;
ebenso der Sachverhalt: keine anderen Götter neben mir haben.
Eine Folge wird nicht angegeben. Hier ist das Gebot, etwas zu unterlassen,
nicht zu tun. Dg sollst, S keine anderen Götter
neben mir haben. Damit ergibt sich in
Interpretation-1: die
Normformel N16(Bibel 1. Gebot Interpretation-1) =
Dg(S) oder in
Interpretation-2: die N08(Bibel
1. Gebot Interpretation-2) = Dg(S+).
Diskussion: Da es sich um keine Rechtsnorm
handelt, sondern um ein religiöses Gebot, signiere ich mit S für
Sachverhalt und nicht mit T für Tatbestand. Ist hier S oder S+ zu
signieren? Hier müssen wir uns zunächst fragen, was S und
S+ in diesem Fall genau bedeuten. Der Sinn der Norm ist, dass S := keine
anderen Götter neben mir haben erfüllt sein soll, Also S+,
also RN08, auch wenn von Erfüllung des Sachverhaltes nichts ausdrücklich
da steht. Das ist ein interessantes und bemerkenswertes Phänomen,
das im Recht bei den Gesetzen oft anzutreffen ist, und das noch einmal
gründlicher mit mehr Beispielen untersucht werden sollte.
Ergebnis: Interpretation-2
mit der Normformel N08(Bibel
1. Gebot Interpretation-2) = Dg(S+)
ist angemessen. Man sieht, Sachverhalt erfüllt oder nicht erfüllt,
S oder S+, ist wesentlich, weil es zu unterschiedlichen Normformeln führt.
Anmerkung: Eine Folge
F wird nicht angegeben, könnte aber aus dem 3. Gebot gefolgert werden:
"Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn
der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht."
F = Strafe Gottes. WENN es GEBOTEN ist, keine anderen Götter zu haben
und WENN erfüllt ist, dass jemand auch noch andere Götter hat
(S+), DANN hat es sich Gott GEBOTEN, dass er bestraft. Als Normformel ergäbe
sich dann:
N01(Bibel 1. UND 3. Gebot) = (Dg(S+)
=> Dg(F)._
_
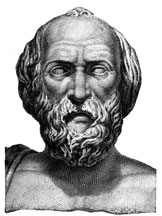 |
 |
Wanderer,
kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl. |
 |
_
Ephoren in Sparta [Q] ca. 4-5. Jhd. v. Chr. > Ephoren und Ephorat.
Die Idee der Ephoren als Kontrollinstanz, um die Mächtigen zur Einhaltung des Rechts zu zwingen, wurde im antiken Sparta realisiert. Eine entsprechende Rechtsnorm könnte lauten: WENN Könige, Richter, Beamte oder andere sich nicht an die Gesetze halten, DANN können sie von Ephoren abgesetzt werden.
Zur Analyse stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Interpretation-1: Eine entsprechende Rechtsnorm könnte lauten: WENN Könige, Richter, Beamte oder andere sich nicht an die Gesetze halten (T+), DANN können (De) sie von Ephoren abgesetzt werden (F). Damit ergibt sich nach dem Wortlaut die Rechtsnormformel RN33(Ephoren Sparta Interpretation-1) = T+ => De(F)
Diskussion-1: Beim Tatbestand fehlt der Deontor. Der Fall ist ganz interessant, weil er zwar implizit enthält, dass jeder sich an die Gesetze halten soll, aber es ist nicht ausdrücklich formuliert. Das Gebot denken wir zwar als selbstverständlich in die Formulierung hinein, aber es steht nicht ausdrücklich da.
Interpretation-2: 1Jeder, auch Könige oder Richter, muss (Dg) sich an die Gesetze halten (T). 2Wer sich nicht an die Gesetze hält (T2+), kann (De) von den Ephoren abgesetzt werden (F). Damit ergibt sich die Rechtsnormformel RN01(Ephoren Sparta Interpretation-2) = Dg(T1) UND T2+) => De(F)
Ergebnis: Deontoren können beim Tatbestand fehlen, vor allem, wenn sie wie hier klar und selbstverständlich scheinen, können aber vom Interpreten hineingedacht werden. Obwohl in Interpretation-1 der Deontor beim Tatbestand fehlt, wird er von vielen so gelesen, wie in Interpretation ausformuliert.
_
Athener Recht [Q] Am Beispiel Der Tod des Sokrates
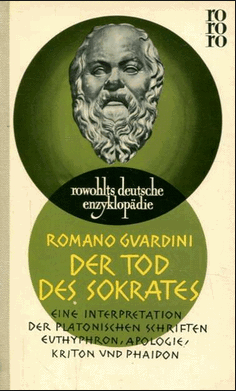 |
Aus der Anklage kann auf die Rechtsnormen im antiken Athen
zurückgeschlossen werden, nämlich wie folgt:
|
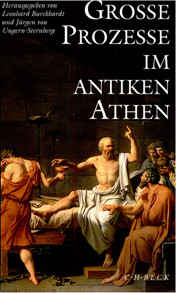 |
Germanisches Recht [Q]
[noch kein Beispiel]
Römisches Recht [Q]
| NE QUIS IN SUA CAUSA
IUDICET VEL SIBI IUS DICAT.
3,5. Niemand soll in seiner eigenen Sache richten oder sich selbst Recht sprechen. Der Text ist dem Sinn nach ohne Probleme zu verstehen. Doch was sind hier Tatbestand, De- ontor und Rechtsfolge? Der Deontor ist klar: soll. Tatbestand: Niemand in eigener Sache? Die Rechtsfolge lautet F nicht selbst richten. Jedem in eigener Sache (T+) ist geboten (Dg), nicht selbst zu richten oder Recht zu sprechen. RN03 (CJC 3,5 Interpretation-1) = Dg(T+) => F. Es fehlt beim Tatbestand das Zeichen für den Erfül- lungsstatus "+"., das hier zwar implizit klar scheint, aber bei strenger Wortlautbeachtung nicht aus- drücklich dasteht. Man kann aber auch vereinfacht interpretieren: RN08 (CJC 3,5 Interpretation-2) = Dv(T+), d.h. es ist verboten, in eigener Sache zu richten. Dann fehlt hier die Rechtsfolge, die man sich zwar denken kann (Nichtigkeit des eigenen Urteilsspruchs), die aber so nicht dasteht. Die Interpretation bleibt unklar. |
 |
Bereits im Römischen
Recht wurde man der Explosion der Rechtstexte nicht Herr.
"70 ... Alle Anstrengungen, die Masse des Rechts überschaubarer und damit handhabbarer zu gestalten, lösten die Probleme nicht. 71 Der Kodifikationsgedanke konnte sich erst im Rahmen des politischen und kulturellen Restaurationsprogramms des Kaisers Justinian (527-565) durchsetzen. ... 72 Die Kodifikation Justinians, die vor allem von seinem Justizminister Tribonian vorangetrieben und angesichts der Stofffülle in erstaunlich kurzer Zeit (fünf Jahre) fertig gestellt wurde, wird seit dem 16. Jh. als Corpus Iuris Civilis bezeichnet. ... Das Gesamtwerk gliedert sich in die Institutionen, Digesten oder Pandekten, den Codex und die Novellen." Quelle: Schröder (2015), S. 21, Rn 70 ff. |
Unsinnige Buchstabenkleberei im frühen Römischen Recht
Schröder (2015), S. 5, Rn 19: "Das wurde besonders im legis-actionen-Verfahren deutlich. Gaius, der sein berühmtes Institutionen-Lehrbuch - Einführungslehrbuch für Anfänger - ca. 160 n. Chr. schrieb, berichtet über den legis-actionen-Prozess, also über ein zu seiner Zeit bereits unübliches Verfahren (IV, 11 ff.):
„Die Klagen, die unsere Vorfahren anwandten, wurden legis actiones genannt, entweder weil sie in Gesetzen (leges) überliefert waren - damals waren nämlich Edikte der Prätoren, in denen die meisten Klagen eingeführt worden sind, noch nicht üblich - oder deswegen, weil sie genau an die Worte des Gesetzes angepasst waren und deshalb als genauso unverletzlich galten wie die Gesetze. Daher gibt es eine Rechtsauskunft, dass jemand, der wegen abgehauener Weinstöcke geklagt und dabei in der Klage das Wort Weinstöcke gebraucht hatte, seinen Prozess verloren habe, weil er das Wort ,Bäume' hätte nennen müssen, denn im Xll-Tafel-Gesetz, nach dem ihm die Klage wegen der abgehauenen Weinstöcke zustehe, sei allgemein von ,abgehauenen Bäumen' die Rede."
Die Textstelle verdeutlicht die starke Bindung an Formalien innerhalb dieser Prozessform. Bereits ein einfacher Versprecher führt zum Prozessverlust. Fest vorgeschriebene Spruchformeln prägen das Verfahren bereits vor dem Prätor. Dieser entschied nach dem Vorbringen des Klägers darüber, ob eine „actio", ein Klageanspruch für das Begehren zur Verfügung stand. Im dem sich anschließenden Verfahren vor einem Laienrichter (Verfahren „apud iudicem") wurde letztlich Beweis erhoben und der Streit entschieden."
Zur Analyse stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Interpretation-1: T+ Wenn falsche Wortwahl in der Anklage vorliegt, Dg ist F das Verlieren des Prozesses Dg geboten. Daraus lässt sich (1) die Rechtsnormformel RN33 (Gaius Beispiel XII Tafelgesetz abgehauene Bäume Interpretation-1) = (T+) => Dg(F) ableiten.
Diskussion: In Interpretation-1 fehlt der Deontor beim Tatbestand (falsche Wortwahl in der Anklage), wenn auch klar ist, dass falsche Wortwahl verboten sein soll (besser: richtige Wortwahl geboten). Lässt sich das durch geeignete Umformulierung berichtigen? Die Formulierung "Wenn falsche Wortwahl in der Anklage vorliegt" kann man als Tatbestandserfüllung (T+) deuten. Täte man dies nicht, entstünde mit nur T statt T+ eine andere Rechtsnormformel RN09 (Gaius Beispiel XII Tafelgesetz abgehauene Bäume) = Dv(T) => Dg(F). Für die Rechtsnormformel ist es wesentlich, ob nur ein Tatbestand beschrieben oder auch als erfüllt angesehen wird.
Interpretation-2: 1Falsche Wortwahl in der Anklage (T1) ist verboten (Dv). 2Wenn Falsche Wortwahl in der Anklage vorliegt (T2+), ist es geboten (Dg), den Prozess zu verlieren (F). Rechtsnormformel RN01 (Gaius Beispiel XII Tafelgesetz abgehauene Bäume Interpretation-2) = Dv(T1 UND T2+) => Dg(F).
Ergebnis: Für die Rechtsnormformel ist es wesentlich, ob nur ein Tatbestand beschrieben oder auch als erfüllt angesehen wird. Nicht immer sind Deontoren beim Tatbestand angegeben und nicht immer gelingen Umformulierungen, es sei denn mit Zusätzen, die dann aber den Sinn nicht verändern dürfen.
_
Lüshu ältester chinesischer Kodex
[noch kein Beispiel]

Schäfer, Anton (202) Zeittafel der Rechtsgeschichte: von den Anfängen über Rom bis 1919. 3. A. BSA. [GB]
Peinliche
Halsgerichtsordnung (Constitutio Criminalis Carolina) 1532 [Q-OrigDeutsch;
Q]
Vorbild war 1507 die Bamberger peinliche Halsgerichtsordnung von Johann
von Schwarzenberg (1463-1528). Ein neues Strafrecht für Deutschland
wurde erst 1871 geschaffen. Bis dahin galt die CCC neben den Gesetzen der
"Kleinstaaten" und Stände als Rahmenorientierung.
_37K.jpg)
Quelle: Schroeder, Fr. Chr. (2000, Hrsg.) Die pein- liche
Gerichtsordnung (Carolina) Kaiser Karls V. und des Heiligen Römischen
Reichs von 1532. Stuttgart: Reclam, S. 206:
|
Vorschriften über die Gerichtspersonen
und ihren Eid 1-5
Strafprozeßrecht 6-103 Einleitung des Strafverfahrens Einleitung von Amts wegen 6-10 Einleitung auf Privatklage Indizien (anzeygungen) für Straftaten 11-17 Allgemeine Bestimmungen 18-32 Indizien für einzelne Straftaten 33-44 Folter 45-61 Beweis durch den Kläger mittels Zeugen 62-76 Gerichtsverhandlung 77-101 Geistlicher Beistand für zum Tode Verurteilte 102-103 Strafvorschriften 104-180 Allgemeine Vorschriften 104-105 Straftaten gegen die Religion 106-109 Schmähschriften 110 Fälschungsdelikte 111-115 Sittlichkeitsdelikte 116-123 Verräterei und Straftaten gegen den Öffentlichen Frieden 124-129 Tötung 130-156 Diebstahl 157-175 Allgemeine Bestimmungen 176-180 Pflichten des Gerichtsschreibers 181-203 Protokollierung Formulierung von Todesurteilen und von ... 181-189 Urteilen über ewiges Gefängnis 190-195 Leibesstrafen 196-198 Freispruch 199-201 Aktenverwahrung 202 Erkundigungspflicht 203 Schlußvorschriften 204-219 Gerichtskosten 204 Belohnungsverbot 205 Beschlagnahme des Vermögens Flüchtiger 206 Verwendung gestohlener oder geraubter Gegenstände 207-214 Pflicht zur Galgenerrichtung 215-217 Abschaffung von Mißbräuchen in der Strafrechtspflege 218 Zuständigkeit für Rechtsgutachten 219 |
Bürgerrechte Französische Revolution [Q]
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte [EdMuBR] (20.08.1789) [Q] Art. I. 1Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. 2Soziale Unterschiede dürfen nur im gemeinen Nutzen begründet sein.
Zur Analyse stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse Satz 1: Der Text Satz 1 dürfte bis auf die Bedeutung von "frei" ohne Probleme verstanden werden.
Interpretation-1: WENN einer Mensch ist, DANN ist es GEBOTEN, ihn von Geburt an als frei mit gleichen Rechten ausgestattet, anzusehen. T+ Mensch sein, Dg sind und bleiben als geboten, F von Geburt an frei und gleich an Rechten anzusehen. (1) Rechtsnormformel RN33(EdMuBR Art I, 1 Interpretation-1) = (T+) => Dg(F).
Diskussion-1: In Interpretation-1 RN33 stört mich, dass beim Tatbestand "Mensch sein" ein Deontor fehlt. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Interpretiert man T+ Für jeden Menschen von Geburt und bleibend Dg1 gilt, frei und gleich an Rechten F zu sein Dg2. Diese Interpretation führt zur Rechtsnormformel RN01(EdMuBR Art I, 1 Interpretation-2) = Dg1(T+) => Dg2(F)
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur Form D(T+) => D(F) ist möglich. Die Umformulierung ist also annehmbar.
Analyse Satz 2:
Man kann den Satz 2 nur verstehen, wenn geklärt ist, was "Soziale
Unterschiede" und besonders "gemeiner Nutzen" sowie "begründet sein"
heißen soll. Auch dann ist die Rechtsnormlogik nicht einfach zu verstehen.
Mir ist schon nicht klar, ob Satz 2 mit Satz 1 zusammenhängen soll,
und falls wie, oder ob Satz 2 einen eigenen, vom Satz 1 unabhängigen
Gedanken, ausdrückt. Hier wäre in der Tat mehr Auslegung vonnöten.
_
Unabhaengigkeitserklaerung-USA
4. Juli 1776 [Q]
"Wir halten die nachfolgenden Wahrheiten für klar an sich und
keines Beweises bedürfend, nämlich: daß alle Menschen gleich
geboren; daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen
Rechten begabt sind; daß zu diesem
Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit gehöre; daß,
um diese Rechte zu sichern, Regierungen eingesetzt sein müssen, deren
volle Gewalten von der Zustimmung der Regierten herkommen; daß zu
jeder Zeit, wenn irgend eine Regierungsform zerstörend auf diese Endzwecke
einwirkt, das Volk das Recht hat, jene zu ändern oder abzuschaffen,
eine neue Regierung einzusetzen, und diese auf solche Grundsätze zu
gründen, und deren Gewalten in solcher Form zu ordnen, wie es ihm
zu seiner Sicherheit und seinem Glücke am zweckmäßigsten
erscheint. - Klugheit zwar gebiete, schon lange bestehende Regierungen
nicht um leichter und vorübergehender Ursachen willen zu ändern,
und dieser gemäß hat alle Erfahrung gezeigt, daß die Menschheit
geneigter ist, zu leiden, so lange Leiden zu ertragen sind, als sich selbst
Rechte zu verschaffen, durch Vernichtung der Formen, an welche sie sich
einmal gewöhnt. Wenn aber eine lange Reihe von Mißbräuchen
und rechtswidrigen Ereignissen, welche unabänderlich den nämlichen
Gegenstand verfolgen, die Absicht beweist, ein Volk dem absoluten Despotismus
zu unterwerfen, so hat dieses das Recht, so ist es dessen Pflicht, eine
solche Regierung umzustürzen, und neue Schutzwehren für seine
künftige Sicherheit anzuordnen. Dieser Art war das nachsichtige Dulden
dieser Kolonien, und dieser Art ist nun auch die Nothwendigkeit, durch
welche sie gezwungen werden, das frühere System der Regierung zu ändern.
Die Geschichte des gegenwärtigen Königs von Großbritannien
ist eine Geschichte von wiederholten Ungerechtigkeiten und eigenmächtigen
Anmaßungen, die alle die direkte Absicht haben, eine unumschränkte
Tyrannei über diese Staaten zu errichten."
Zur Analyse stellen wir die
6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor
beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge,
(6) Rechtsfolge.
Analyse Satz 1: Der Satz "Wir halten die
nachfolgenden Wahrheiten für klar an sich und keines Beweises bedürfend,
nämlich: daß alle Menschen gleich geboren, daß sie von
ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt
sind; daß zu diesem Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit
gehören; " ist dem groben Sinn nach ohne Probleme verstehbar.
Interpretation-1:
- T1+ Wir halten die nachfolgenden Wahrheiten für klar an sich und
keines Beweises bedürfend, nämlich:
T2+ alle Menschen, genauer jeder Mensch
F gleich geboren, daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten F1 begabt sind; daß zu diesem F1.1 Leben, F1.2 Freiheit und das F1.3 Streben nach Glückseligkeit gehöre;
Das ergibt die Rechtsnormformel RN03(USA-1776 Satz 1 Interpretation-1) = (T1+ UND T2+) => F.
Interpretation-2:
- Allgemein gelten (Dg1) die nachfolgenden Wahrheiten als
klar an sich und keines Beweises bedürfend (T1+), nämlich:
daß für alle Menschen gilt (Dg2)
F dass sie gleich geboren, daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten F1 begabt sind; daß zu diesem F1.1 Leben, F1.2 Freiheit und das F1.3 Streben nach Glückseligkeit gehören;
Das ergibt die Rechtsnormformel RN01(USA-1776 Satz 1 Interpretation-2) = Dg1(T1+ UND T2+) => Dg2(F)
Anmerkung-diesem: "diesem" ist vermutlich ein Übersetzungsfehler und grammatikalisch korrekt "diesen" heißen, da es die unveräußerlichen Rechte erläutert: Leben, Freiheit, Glück. Wenn zu den unveräußerlichen Rechten Leben gehört, dann schließt dies die Todesstrafe aus, was in den USA aber nicht der Fall ist. Auf diesen Widerspruch sei hier nur hingewiesen.
_
Bill of Rights USA 1789-1791 [Q]
Das sind die ersten 10 Zusatzartikel zu amerikanischen Verfassung, 1789 beschlossen, 1791 ratifiziert.
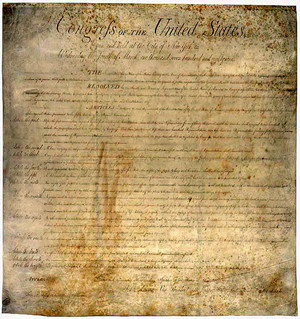
Allgemeines Landrecht
für die Preußischen Staaten
[Q] [APLR]

§. 47. Findet der Richter den eigentlichen
Sinn des Gesetzes zweifelhaft, so muß er, ohne die prozeßführenden
Parteyen zu benennen, seine Zweifel der Gesetzcommißion anzeigen,
und auf deren Beurtheilung antragen.
Zur Analyse stellen wir die
6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor
beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge,
(6) Rechtsfolge.
Analyse: § 47
ist ohne Probleme verständlich.
Interpretation-1: WENN
ein Richter den eigentlichen Sinn des Gesetzes zweifelhaft findet, DANN
ist ihm GEBOTEN, dies der Gesetzeskommission anzuzeigen und um eine Beurteilung
nachzusuchen. Signierung: T+ Findet der Richter den eigentlichen
Sinn des Gesetzes zweifelhaft, Dg so muss er, F seine
Zweifel der Gesetzcommißion anzeigen, und auf deren Beurtheilung
antragen. Das lässt sich in der Rechtsnormformel darstellen: RN33(§
47 APLR Interpretation-1) = (T+) => Dg(F).
Diskussion-1: Die Erfüllung
des Tatbestandes (T+) ist bereits in der Formulierung "Findet der Richter
den eigentlichen Sinn des Gesetzes zweifelhaft" enthalten, daher sehe ich
in der T+ Signierung kein Problem.. Es stört mich aber, dass beim
Tatbestand kein Deontor steht. Ich habe daher eine Umformulierung gemacht:
Interpretation-2: Es
ist dem Richter geboten (Dg), WENN er den eigentlichen Sinn
des Gesetzes zweifelhaft findet (T+), dies DANN der Gesetzeskommission
anzuzeigen und um eine Beurteilung nachzusuchen (F). RN03(§
47 APLR Interpretation-2) = Dg(T+)
=> F.
Diskussion-2: Aber
in dieser Umformulierung wird der Deontor nur von F auf T+ verschoben.
Nun hat zwar T+ einen Deontor, aber F nicht mehr. Es hat den Anschein,
als bliebe der Sinn des § 47 APLR auch bei Vertauschung der Deontoren
erhalten. Das scheint mir ein beachtliches Phänomen, das weiter und
näher zu untersuchen wäre. Hier gibt es also in der Grundlagenarbeit
textanalytisch noch einiges zu tun. Andererseits ist klar, das die Rechtsfolge
als Gebot aufzufassen ist, auch wenn kein ausdrücklicher Deontor dabeisteht.
Ich habe versucht, eine weitere Umformulierung zu finden, die zusätzlich
zum Deontor beim Tatbestand auch einen Deontor bei der Rechtsfolge hat,
aber es ist mir ohne Anwendung sprachlicher Gewalt nicht gelungen.
Interpretation-3 (Vorsicht! suchen ergibt sich nicht
aus dem Originaltext): Mit sprachlicher Gewalt:
Es ist dem Richter geboten (Dg1), im eigentlichen Sinn des Gesetzes
Zweifel zu suchen (T1+) und WENN er solche findet (T2+),
ist ihm geboten (Dg2) diese DANN der Gesetzeskommission anzuzeigen
und um eine Beurteilung nachzusuchen (F).
Diskussion-3:
Zweifel suchen steht so nicht im Originaltext. Dort ist nur
vom finden die Rede, nicht vom suchen. Finden ist nicht unbedingt
eine Folge von suchen. Vieles findet man, ohne dass man es gesucht hat.
Manches fällt einem einfach auf oder ein.
_
Kodex Napoleon / Code civil [Q]
[KN / CC]
Präliminar-Artikel 1, 4 (Rechtsverweigerungsverbot)

Zur Analyse stellen wir die
6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor
beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge,
(6) Rechtsfolge.
Analyse: Der Präliminar-Artikel
[PA] 1,4 ist ohne größere Problem dem Sinne nach verständlich,
auch wenn hier nicht erklärt wird, was die einzelnen Tatbestandsmerkmale
(Stillschweigen, Dunkelheit, Unzulänglichkeit) genau bedeuten. Es
wird Entscheidungszwang vorgeschrieben, auch wenn das Gesetz eine
Lücke ("Stillschweigens"), eine Unklarheit ("Dunkelheit") oder eine
"Unzulänglichkeit" enthält. Damit ist sozusagen Rechtsfortbildung
durch den Richter vorgeschrieben, andernfalls kann (De)
der Richter wegen Verweigerung der Justizpflege verfolgt werden.
Interpretation-1: WENN
(T+) ein Richter wegen Unzulänglichkeit eines Gesetzes keine Entscheidung
trifft, DANN (De) KANN er F verfolgt werden.
Das kann in Rechtsnormformel RN33(KN PA 1,4 Interpretation-1)
= (T+) => De(F) dargestellt werden.
Diskussion: In der Interpretation-1
stört, dass beim Tatbestand kein Deontor steht. Es stellt sich
die Frage, ob eine Umformulierung möglich ist, z.B. derart:
Interpretation-2: Es
ist geboten Dg, dass Richter, trotz Unzulänglichkeit des
Gesetzes, urteilen (T+), andernfalls kann De er verfolgt werden
(F). Dies führt zur Rechtsnormformel
RN01(KN PA
1,4 Interpretation-2) = Dg(T+)
=> De(F).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) ist ohne Sinnverzerrung möglich. Die Umformulierung
ist also annehmbar.
_
1.2 Menschenrechte
Kyros Zylinder * Franz. Rev. * UN
Charta 1948 * Menschenrechte im Islam *
Der Begriff Allgemeine Menschenrechte ist ohne größere Probleme dem Sinn nach zu verstehen. Intuitiv bedeutet er die Rechte, die jeder Mensch hat, weil er ein Mensch ist. Er hat sie von Geburt oder von der Zeugung an. Aber was sind diese Rechte? Hierüber scheiden sich die Geister, vor allem zwischen dem Islam und dem Westen.
Kyros Zylinder Persien 588 v. Chr. [Q]
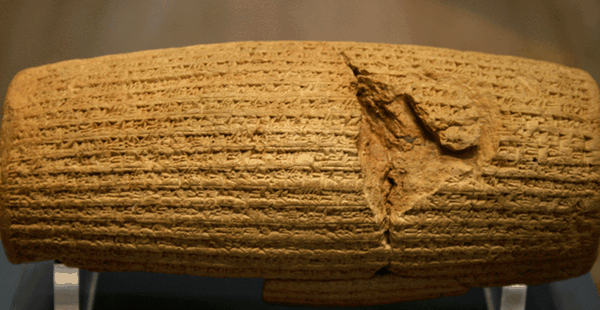
Wikipedia (Abruf 03.06.2019): "Das antike Persien gilt allerdings als das Ursprungsland der Menschenrechte. 539 v. Chr. eroberten die Armeen von Kyros dem Großen, dem ersten König von Altpersien, die Stadt Babylon. Er befreite die Sklaven und erklärte, dass alle Menschen das Recht haben, ihre eigene Religion zu wählen. Auch stellte er die Gleichheit der Menschen aus allen Teilen der bekannten Welt heraus. Diese sowie weitere Erlasse wurden auf einem gebrannten Tonzylinder – dem Kyros-Zylinder – aufgezeichnet, welcher offiziell als erste Menschenrechtserklärung durch die Vereinten Nationen anerkannt ist.[16] Sie sind in alle sechs offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen übersetzt worden und ihre Bestimmungen entsprechen den ersten vier Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte." Auf der Wikipediaseite von Kyros ist allerdings zu lesen (Abruf 06.06.2019): "Die Vereinten Nationen veröffentlichten 1971 in allen offiziellen UNO-Sprachen die Inschrift des Kyros-Edikts, wobei dieses auf Initiative der iranischen Regierung als „erste Charta der Menschenrechte“ bezeichnet wurde. Dies geschah ohne neutrale Prüfung des historischen Hintergrunds. Bis heute hat die UNO nicht zu kritischen Fragen, die sich auf den propagandistischen Zweck des Textes beziehen, Stellung genommen.[65] Die Konstruktion eines Zusammenhangs mit dem modernen Begriff der Menschenrechte, der zur Zeit des Kyros nicht existierte, wird von Historikern nicht akzeptiert, da eine solche Betrachtungsweise unhistorisch ist und der damaligen Wirklichkeit nicht gerecht wird.[66] So widerspricht der Althistoriker Josef Wiesehöfer unwissenschaftlichen Darstellungen, die Kyros als König beschreiben, „der Menschenrechtsideen in den Umlauf brachte“."
Allgemeine-Menschenrechte-1948 [AMR UN 1948] [Q]
Menschenrechtserklärungen im Islam
Vorbemerkung: Im Islam herrscht seit dem Tode Mohammeds ein Durcheinander
und Mischmasch zwischen Religion und Recht, das sich bis in die Gegenwart
erhalten hat. Dazu gehört auch der Auserwähltterror und der anscheinend
ewige Kampf zwischen Schiiten und Sunniten. Das spiegelt sich auch in den
verschiedenen Erklärungen zu den Menschenrechten. Am ehrlichsten wäre
es wohl, wenn man sagte: Der Islam braucht kein Menschenrecht, er hat den
Koran
und die Sunna,
das muss reichen. Man sollte den blumigen und wohlklingenden Worten und
Versicherungen daher kritisch gegenüberstehen.
humanrights (Abruf 07.06.19) informiert: "Verhältnis
zur Kairoer Erklärung für Menschenrechte
Die Kairoer Erklärung der Menschenrechte wurde 1990 von der Organisation
der Islamischen Konferenz (OIC) verabschiedet. Sie ist nicht zu verwechseln
mit der Arabischen Charta der Menschenrechte. In der Kairoer Erklärung
werden die Rechte und Freiheiten der Scharia unterstellt, welche als «einzig
zuständige Quelle für die Auslegung oder Erklärung jedes
einzelnen Artikels» dient (Art. 25). Die Kairoer Erklärung der
Menschenrechte hat im Gegensatz zur Arabischen Charta keine rechtliche,
sondern bloss eine symbolische und indirekt menschenrechtspolitische Bedeutung.
Auf dieser Ebene markiert sie einen islamischen Gegenentwurf zur Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte."
1981-Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte im Islam * (AEdMRiI 1981)
[PDF]
Artikel 3b Alle Menschen haben den gleichen menschlichen Wert:
...
Zur Analyse stellen wir die
6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor
beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge,
(6) Rechtsfolge.
Analyse: Die Rechtsnorm ist ohne Probleme dem Sinn
nach verstehbar, wobei offen bleibt, wie das in der Praxis realisiert werden
kann und soll und was "gleicher menschlicher Wert" faktisch und praktisch
bedeutet.
Interpretation-1: WENN einer Mensch ist,
DANN ist es GEBOTEN, ihm den gleichen menschlichen Wert anzuerkennen. Rechtsnormformel
RN33(Art.
3b AEdMRiI 1981 Interpretation-1) = (T+) =>
Dg(F).
Diskussion: In RN41 stört,
dass bei T der Deontor fehlt und die Erfüllung des Tatbestandes nicht
ausdrücklich genannt wird, obwohl sie sehr wahrscheinlich natürlich
gemeint ist und damit implizit vorliegt.
Interpretation-2:
Ausführlich
müsste es heißen: Für jeden, der Mensch ist (T+)
ist
es geboten ("haben", D), ihm den gleichen menschlichen Wert zuzuerkennen
(F) mit der Rechtsnormformel
RN11(Art.
3b AEdMRiI 1981 Interpretation-2) = Dg(T+)
=> F.
Beide Rechtsnormformeln von
Interpretation-1 und Interpretation-2 drücken m.E. den gleichen Sinn
aus, obwohl die Deontoren vertauscht sind.
Interpretation-3:
Für jeden Menschen gilt, jeder hat den gleichen menschlichen Wert.
In dieser Formulierung kann sowohl dem Tatbestand (jeder, der ein Mensch
ist) und der Rechtsfolge (den gleichen Wert haben) jeweils ein eigener
Deontor zugeordnet werden, und damit auf die Form der vollständigen
Rechtsnorm-Formel bringen: Für jeden, der Mensch ist (T+) gilt
(Dg),
dass es geboten ist ("hat"), ihm den gleichen menschlichen Wert
zuzusprechen (F). Die Formulierung und Interpretation ergibt nun die Rechtsnormformel
RN01(Art.
3b AEdMRiI 1981 Interpretation-3) = Dg(T+)
=> Dg(F).
Ergebnis: Der Art 3b
(AEdMRiI 1981) kann mit Interpretation-3 auf
die Form der vollständigen Rechtsnormformel RN01 gebracht werden.
1990 (1994
in Kraft) Arabische
Charta der Menschenrechte. (ACdMR 1994) * [PDF]
Artikel 18 Jeder hat das angeborene Recht, überall als rechtsfähig
anerkannt zu werden.
Zur Analyse stellen wir die
6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor
beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge,
(6) Rechtsfolge.
Analyse: Die Rechtsnorm ist ohne Probleme dem Sinn
nach verstehbar, wenn auch nicht klar ist, was "jeder", "angeboren", "überall"
und "rechtsfähig" genau bedeuten.
Interpretation-1: T+ Jeder Mensch,
Dghat, F das angeborene Recht, überall als rechtsfähig
anerkannt zu werden. Dies kann in der Rechtsnormformel RN33(Art.
18 ACdMR 1994 Interpretation-1) = (T+) =>
Dg(F) ausgedrückt werden.
Diskussion: Hier stört,
dass es in der Interpretation-1 beim Tatbestand keinen Deontor gibt. Lässt
sich das umformulieren, so ein Deontor beim Tatbestand steht?
Interpretation-2:
Für
jeden, der ein Mensch ist (T+), gilt (Dg),
dass
ihm das angeborene Recht zusteht (Dg),
überall als rechtsfähig anerkannt zu werden (F). "gilt" und
"zusteht" steht wörtlich nicht so da, sondern "hat". Interpretation-2
führt zur Rechtsnormformel RN01(Art.
18 ACdMR 1994 Interpretation-2) = Dg(T+)
=> Dg(F).
Ergebnis: Der Art 18 (ACdMR
1994) kann mit Interpretation-2 auf die Form der
vollständigen Rechtsnormformel RN01 gebracht werden.
2004-(2008
in Kraft) Arabische Charta der Menschenrechte * [PDF]
[noch kein Beispiel]
GG Art 19 (4) 1 Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen.
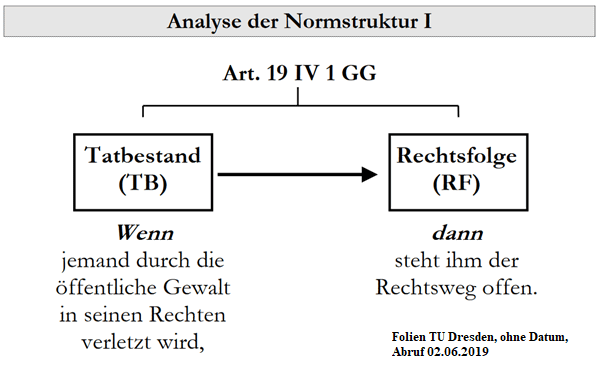
Analyse: Der Text ist ohne Probleme verstehbar.
Zur Analyse stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand
(T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO
Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Interpretation-1: T+ Wird jemand durch
die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt; DR so
steht offen; F der Rechtsweg. Der Rechtsweg kann, muss
aber nicht beschritten werden. Rechtsnormformel: RN33(GG
Art 19 (4),1 Interpretation-1) = (T+) => DR(F). Man könnte
statt "R" für Recht auch erlaubt, also "e" beim Deontor der Rechtsfolge
spezifizieren.
Diskussion: In der Interpretation-1 fehlt
der Deontor beim Tatbestand. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
berichtigen? Der Deontor bei der Rechtsfolge ist "steht offen", d.h.
der Rechtsweg kann beschritten werden, muss aber nicht. Es ist eine Erlaubnis
oder ein Recht, das gewährt wird, den Rechtsweg zu beschreiten
Interpretation-2: Niemand darf (Dg)
durch
öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt werden (T) UND wenn
er verletzt wird (+), so steht (DR) ihm der Rechtsweg offen
(F). Das führt zur vollständigen Rechtsnormformel RN01(GG
Art 19 (4),1 Interpretation-2) = Dv(T) UND (T+) => DR(F),
vereinfacht
RN01(GG Art 19 (4),1) = Dv(T+)
=> DR(F),
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) ist möglich. Die Umformulierung ist also
annehmbar.
Anmerkung: In der Strukturdarstellung der
TU Dresden fehlt beim Tatbestand der Deontor.
Vollständig und richtig formuliert könnte
es heißen: Dv Es ist verboten, T jemanden durch öffentliche
Gewalt in seinen Rechten zu verletzten. Geschieht das (T+), De so
steht ihm G der Rechtsweg offen.
_
GG Art 3 (1) Alle Menschen sind vor
dem Gesetz gleich.
Analyse: Der Text wird im Allgemeinen ohne
Probleme verstanden.
Interpretation-1: WENN einer ein Mensch
ist, DANN SOLL er vor dem Gesetz gleich sein. Dg:= Geboten ("sind"),
T+ Mensch sein, F Gleichbehandlung vor dem Gesetz.
In formelhaften Worten: WENN jemand ein Mensch ist, DANN ist Gleichbehandlung
vor dem Gesetz GEBOTEN. Rechtsnormformel: RN33(GG Art
3 (1) Interpretation-1) = (T+) => Dg(F).
Diskussion: Der Tatbestand T+ Mensch sein
hat in der Interpretation-1 keinen Deontor. Lässt sich das durch geeignete
Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Für jeden Menschen
(T+) gilt Dg, dass er vor dem Gesetz gleich (F) ist Dg.
Das führt zur vollständigen Rechtsnormformel RN01(GG
Art 3 (1) Interpretation-2) = Dg(T) UND (T+) => Dg(F),
vereinfacht
RN01(GG Art 3 (1) = Dg(T+)
=> Dg(F).
Ergebnis: Geeignete
Interpretation führt ohne Sonnverzerrung zur vollständigen Rechtsnormformel
RN01.
_
GG Art. 2 Abs. 2
1Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 2In
diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
Analyse Satz 1 und 2: Der Text wird im Allgemeinen
ohne Probleme verstanden.
Interpretation-1: Dg Geboten
("hat"), T+ Mensch sein ("jeder"), F1 das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit, F2 := In diese Rechte darf nur
auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. In formelhaften Worten:
WENN jemand ("jeder") ein Mensch ist, DANN ist das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit GEBOTEN UND In diese Rechte darf nur auf
Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Rechtsnormformel:
RN33(GG
Art 2 (2) Interpretation-1) = [(T+) => Dg(F1 UND F2)].
Diskussion: "hat" klingt im Zusammenhang
mit "das Recht auf Leben ..." wie eine Erlaubnis. Aber Erlaubnis, die man
nutzen kann oder auch nicht, trifft den Sinn nicht. "hat" muss hier daher
ein GEBOT bedeuten. Beim Tatbestand ("jeder" = Mensch sein) gibt es keinen
Deontor, es sei denn, man rechnet "hat" zum Tatbestand "jeder" dazu oder
interpretiert wie folgt:.
Interpretation-2: Für jeden Menschen
(T+) gilt (Dg), dass es geboten ist (Dg), sein Recht
auf Leben und körperliche Unversehrtheit zu wahren (F1) UND in die
Rechte, darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden (F2). Rechtsnormformel:
RN01(GG
Art 2 (2) Interpretation-2) = Dg(T+) => Dg(F1 UND
F2)].
Ergebnis: Geeignete
Interpretation führt zur vollständigen Rechtsnormformel
RN01.
Interpretation-3 mit neuer Voranstellung Satz
1: 1Es ist geboten, die allgemeinen Menschenrechte zu beachten. 2Jeder
hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 3In diese
Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Nachdem neuen
voranstellenden Einschub 1, wird die Rechtsnormformel vollständig
und kann entsprechende ausgedrückt werden: RN01(GG
Art 2 (2) ergänzt) = Dg(T+) => Dg(F1 UND F2).
Ergebnis: Auch die Voranstellung "1Es ist
geboten, die allgemeinen Menschenrechte zu beachten" führt
zur vollständigen Rechtsnormformel
RN01,
wobei an diesem Punkt offen bleiben kann, inwieweit hier der Sinn erhalten
bleibt oder erweitert wurde.
_
GG Art 11 (1) Alle Deutschen genießen
Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.
Analyse: Der Text wird im Allgemeinen ohne Probleme
verstanden, wenn man weiß, was unter Freizügigkeit (Wahl des
Aufenthaltsortes) zu verstehen ist.
Interpretation-1: T+ Alle Deutschen,
De
erlaubt ("genießen"), F Freizügigkeit
im ganzen Bundesgebiet. In formelhaften Worten: WENN jemand Deutscher
ist, DANN ist Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet ERLAUBT. Rechtsnormformel:
RN33(GG
Art 11 (1) Interpretation-1) = (T+) => De(F)).
Diskussion: Bei dieser Interpretation gibt
keinen Deontor beim Tatbestand T+ Deutscher sein. Lässt sich
das durch geeignete Umformulierung berichtigen?
Interpretation-2: Für jeden Deutschen
(T+) gilt Dg, dass er im ganzen Bundesgebiet Freizügigkeit
(F) genießt. Rechtsnormformel RN01(GG
Art 11 (1) Interpretation-2) = Dg(T+) =>
De(F).
Ergebnis: Geeignete
Interpretation führt zur vollständigen Rechtsnormformel
RN01.
Dieses Ergebnis kann auch durch eine neue Voransstellung erzielt werden:
Interpretation-3 durch neue Voranstellung: 1Deutsche
genießen besondere Rechte. 2Alle Deutschen genießen Freizügigkeit
im ganzen Bundesgebiet und zur Rechtsnormformel RN01(GG
Art 11 (1) ergänzt Interpretation-3) = Dg(T+)
=> De(F))
Kritik: Die Norm ist für Kinder, Geschäftsunfähige
oder Betreute mit Einwilligungsvorbehalt nicht erfüllt, also falsch
formuliert und enthält damit eine erhebliche Fehler und Lücken.
So nachlässig und falsch sollten Verfassungsgrundsätze nicht
formuliert und belassen werden.
_
GG Art 1 1Die Würde des Menschen
ist unantastbar. 2Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt.
Analyse Satz 1: Der Text ist zwar sehr wohlklingend,
aber unverständlich, so lange man nicht weiß, was "Würde"
(>Anmerkung) und "unantastbar", heißen
soll.
Interpretation-1: T+ Mensch sein.
Dg
ist als geboten zu verstehen, F1 Würde unantastbar.
In
formelhaften Worten: WENN einer Mensch ist, DANN SOLL seine Würde
unantastbar sein. RN33(GG Art 1, Satz1 Interpretation-1)
= (T+) => Dg(F1).
Diskussion: Beim Tatbestand findet sich bei
dieser Interpretation kein Deontor. Es fragt sich, ob eine geeignete Umformulierung
möglich ist, zu die zur vollständigen Rechtsnormformel RN01 führt?
Interpretation-2: Für jeden Menschen
(T+) gilt (Dg1), dass seine Würde (F1) nicht
angetastet werden darf (Dg2) mit der vollständigen
Rechtsnormformel RN01(GG Art 1, Satz1 Interpretation-2)
= Dg1(T+) => Dg2(F1).
Ergebnis: Geeignete
Interpretation führt zur vollständigen Rechtsnormformel
RN01.
Interpretation-3: Vervollständigung durch
Voranstellung eines neuen Satzes: 1Es ist geboten, die unveräußerlichen
Grundrechte des Menschen zu beachten. 2Die Würde des Menschen ist
unantastbar. 3Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt mit der nun vollständigen Rechtsnormformel RN01(GG
Art 1,1 ergänzt Interpretation-3) = Dg(T+) => Dg(F1
UND F2).
Analyse Satz 2: 2Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Fasst man Satz 2 insgesamt
als F2 auf, muss die Rechtsnormformel nur noch um F2 ergänzt werden:
RN01(GG
Art 1, Satz 2) = Dg1(T+) => Dg2(F1 UND F2).
Anmerkung-GG-Art-1: In § 1 (1)
SGB I wird ausgeführt: "Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung
sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen einschließlich
sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten. Es soll dazu beitragen, ein
menschenwürdiges Dasein zu sichern, ..." Damit ist ein Merkmal der
Menschenwürde näher bestimmt. Verbot der Todesstrafe oder der
Folter wären andere.
_
BVerfG § 1 (1) Das Bundesverfassungsgericht
ist ein allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbständiger
und unabhängiger Gerichtshof des Bundes.
Analyse: Der Text wird im Allgemeinen ohne Probleme
verstanden. Er definiert die Stellung (selbständig, unabhängig)
des BVerfG in der Bundesrepublik Deutschland.
Interpretation-1: T+ Das BVerfG,
Dg ist, F allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber
selbständiger und unabhängiger Gerichtshof des Bundes. Dies
kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt werden: RN33(BVerfG
§ 1 (1) Interpretation-1) = (T+) => Dg(F)).
Diskussion-1: Beim Tatbestand Bundesverfassungsgericht
sein steht es kein Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
berichtigen?
Interpretation-2: Für das Bundesverfassungsgericht
T+
gilt
Dg, dass es ein allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber
selbständiger und unabhängiger Gerichtshof des Bundes F ist
Dg.
RN01(BVerfG § 1 (1) Interpretation-2) = Dg
(T+) => Dg(F)).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) ist möglich, aber:
Diskussion-2: An dieser Stelle fragt sich,
aus welchen Elementen ein Tatbestand bestehen soll? Denn "Für das
BVerG gilt" ist keine Aussage. Nach dem Modell der Elementaraussage (Kamlah
& Lorenzen 1973, S. 35) gilt die Form: "X e P". Wenn X := BVerG ist
fehlt das Prädikat P. Ein Inhalt P taucht erst in der Rechtsfolge
auf. Wenn also ein Tatbestand aus mindestens einer Elementaraussage bestehen
soll, dann ist der Satz "Für das BVerG gilt" keine Aussage, weil P
fehlt. Dann könnte auch "Für das BVerG gilt" nicht für den
Tatbestand stehen.
Anmerkung: Das BVerfG steht praktisch über
dem Gesetzgeber, indem es die Befugnis hat, Gesetze des Gesetzgebers zu
bestätigen oder zu verwerfen. Das ist ein Eingriff in die und ein
Widerspruch zur Gewaltenteilung. Theoretisch könnte mit dieser formalen
Macht zwar ein Hitler in die Schranken verwiesen werden, aber nur, wenn
das BVerfG z.B. den Oberbefehl über Armee und Polizei hätte und
diese sich daran hielte. Das ist also mindestens doppelt nicht richtig
durchdacht.
_
BVerfG § 2 (1) Das Bundesverfassungsgericht
besteht aus zwei Senaten.
Analyse: Der Text wird im Allgemeinen ohne Probleme
verstanden, auch wenn man nicht ganz genau weiß, was ein Senat ist,
was aber leicht geklärt werden kann. Aber worin besteht hier die Rechtsnorm?
Interpretation-1: T+ Das BVerfG, Dgbesteht
aus, F zwei Senaten. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel
ausgedrückt werden: RN33(BVerfG § 2(1) Interpretation-1)
=> (T+) => Dg(F)). Diese formale Umsetzung erscheint mir
dennoch plausibel.
Diskussion: Zum Tatbestand gibt es bei dieser
Interpretation keinen Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
berichtigen?
Interpretation-2: Für das Bundesverfassungsgericht
(T) gilt (Dg), dass es aus zwei Senaten bestehen (F) soll (Dg).
Das lässt sich zwar formal in die vollständige Rechtsnormformel
RN01(BVerfG § 2(1)) => Dg(T+) => Dg(F)
bringen, aber wie schon bei BVerfG § 1 (1) oben, ergibt "Für
das Bundesverfassungsgericht gilt", formal Dg(T+), inhaltlich
ohne weitere Erklärungen keinen interpretierbaren Sinn, weil fehlt,
was gilt. Das ist wie in der Prädikatenlogik mit Aussageformen, die
Leerstellen ("Lücken") oder freie Variablen enthalten. Solche Tatbestände
sind schwer nachvollziehbar. Wir müssen also verlangen, dass ein Tatbestand
wenigstens aus einer Elementaraussage vom Typ S(P) besteht, von irgendeinem
Subjekt S wird ein Prädikat P ausgesagt. Eine umständlich
wirkende Variante wäre: Für ein Gericht, das Bundesverfassungsgericht
ist T+, gilt Dg, dass es aus zwei Senaten bestehen (F) soll
Dg. So betrachtet wäre die Rechtsnormformel RN01(BVerfG
§ 2(1) Interpretation-2) => Dg(T+) => Dg(F)
Interpretation-3: Kann man "Das Bundesverfassungsgericht
besteht aus zwei Senaten" als einzigen Tatbestand auffassen? Es ist geboten
Dg, dass das Bundesverfassungsgericht aus zwei Senaten besteht
(T+)? Also durch die Form RN08(BVerfG §
2(1) Interpretation-3) => Dg(T+). Man kann, ich habe es ja so
eben gemacht. Aber ist es vernünftig, ist es sinnvoll?
Ergebnis: Mir erscheint Interpretation-1
am angemessensten. Hier ist noch weitere sprachanalytische Kriterienarbeit
vonnöten, denn "angemessener erscheinen" ist zu wenig.
__
BVerfG 25 (4) Die Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts ergehen "im Namen des Volkes".
Analyse: Der Test ist nur oberflächlich betrachtet
verständlich. Denn die Bedeutung "im Namen des Volkes" bleibt unklar
(Kritik).
Interpretation-1: T+ Die Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts, Dg ergehen, F "im Namen des
Volkes". In formelhaften Worten: WENN das BVerg entscheidet, DANN ist
es GEBOTEN, dass diese Entscheidung "im Namen des Volkes" ergeht. Dies
kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt werden: RN33(BVerfG
25(4) Interpretation-1) = T+ => Dg(F).
Diskussion: Zum Tatbestand gibt es keinen
Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung berichtigen?
Interpretation-2: Für Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts (T+) gilt (Dg1), dass
sie "im Namen des Volkes" (F) ergehen (Dg2). RN01(BVerfG
25(4) Interpretation-2) = Dg1(T+) => Dg2(F).
Ergebnis: Hier hat der Tatbestandsteil
keine Leerstelle, die Interpretation-2 ist also vertretbar.
Kritik-BVerfG-25-(4): Man
weiß nicht genau, was die Formel "im Namen des Volkes" bedeutet.
Intuitiv wird mit dieser Formel der Eindruck hervorgerufen als ob das BVerfG
tatsächlich im Namen des Volkes spräche, obwohl es natürlich
nur in seinem eigenen Namen spricht. Man sollte meinen, dass das Volk darüber
abstimmen sollte. Darüberhinaus sollte das Quorum definiert sein,
d.h. wie viele der Wahlberechtigten dafür sein müssen (z.B. 51%,
67%, 76%, 91%, oder ...), damit diese Formel verwendet werden darf.
_
BVerfG § 31
(1) Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane
des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden.
(2) In den Fällen des § 13 Nr. 6, 6a, 11, 12 und 14 hat die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Gesetzeskraft. Das gilt auch
in den Fällen des § 13 Nr. 8a, wenn das Bundesverfassungsgericht
ein Gesetz als mit dem Grundgesetz vereinbar oder unvereinbar oder für
nichtig erklärt. Soweit ein Gesetz als mit dem Grundgesetz oder sonstigem
Bundesrecht vereinbar oder unvereinbar oder für nichtig erklärt
wird, ist die Entscheidungsformel durch das Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen.
Entsprechendes gilt für die Entscheidungsformel in den Fällen
des § 13 Nr. 12 und 14.
Analyse Absatz (1) BVerfG § 31 (1):
Der Text (1) wird im Allgemeinen ohne Probleme verstanden, wenn auch nicht
klar gesagt wird ab wann und unter welcher Bedingung die Bindung gilt (Verkündung,
Veröffentlichung?).
Interpretation-1: T+ Die Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts, Dg
binden, F1 die
Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und
Behörden. Dies kann durch folgende Form ausgedrückt werden:
RN33(BVerfG
§ 31,1 Interpretation-1) = T+ => Dg(F1)).
Diskussion: In Interpretation-1 ist der Deontor
bei der Rechtsfolge plaziert. Beim Tatbestand fehlt der Deontor. Lässt
sich das durch geeignete Umformulierung berichtigen?
Interpretation-2: Für Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts T+ gelten Dg1, dass
die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte
und Behörden F daran gebunden sind Dg2. RN01(BVerfG
§ 31,1 Interpretation-2) = Dg1(T+) => Dg2(F).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) gelingt. Die Umformulierung ist also annehmbar..
Analyse Absatz (2) BVerfG § 31
(2): Der Text (2) kann nur dann verstanden werden, wenn man die angegebenen
Fälle verstanden hat.
Interpretation-1: T+ Entscheidungen
der Fälle § 13 Nr. 6, 6a, 8a, 11, 12 und 14, Dg2entfalten
im
Sinne von gebieten, F2 Gesetzeskraft. Dies kann durch folgende
Form ausgedrückt werden: RN33(BVerfG§ 31
(2)Interpretation-1) = (T+ => Dg(F2)).
Diskussion: In Interpretation-1 ist der Deontor
bei der Rechtsfolge plaziert. Beim Tatbestand fehlt der Deontor. Lässt
sich das durch geeignete Umformulierung berichtigen?
Interpretation-2: T+ Für
Entscheidungen
der Fälle § 13 Nr. 6, 6a, 8a, 11, 12 und 14 Dg1 gilt
dass sie Gesetzeskraft (F2) entfalten Dg2 . RN01(BVerfG
§ 31,2 Interpretation-2) = Dg1(T+) => Dg2(F).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung
zur Form D(T+) => D(F) gelingt. Die Umformulierung ist also annehmbar..
Analog können die beiden folgenden Fälle
behandelt und umformuliert werden.
F3 Die Entscheidungsformel der Entscheidungen der Fälle §
13 Nr. 6, 6a, 8a, 11, 12 und 14, Dg3 muss veröffentlicht
werden.
F4 durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
im Bundesgesetzblatt. Dies kann durch folgende Form ausgedrückt
werden: RN33(BVerfG § 31 (2)) = T+
=> Dg3(F4).
__
BGB § 1 Die Rechtsfähigkeit
des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.
Analyse: Der Text ist nur oberflächlich betrachtet
verständlich, aber nicht, so lange unklar ist, was "Rechtsfähigkeit"
und "Vollendung der Geburt" bedeutet. Hier wäre es sicher besser gewesen
z.B. nach "Vollendung der Geburt" in Klammern z.B. anzugeben "(Durchtrennung
der Nabelschnur)" und einen Querverweis zur Erklärung der Rechtsfähigkeit.
Interpretation-1: T+ Vollendung der Geburt
eines Menschen, DR beginnt, F
Rechtsfähigkeit.
In formelhaften Worten: WENN ein Mensch geboren ist, DANN ist es GEBOTEN,
ihm Rechtsfähigkeit zuzurechnen. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel
ausgedrückt werden: RN33(BGB § 1 Interpretation-1)
= T+ => Dg(F).
Diskussion: In Interpretation-1 ist der Deontor
bei der Rechtsfolge plaziert. Beim Tatbestand fehlt der Deontor. Lässt
sich das durch geeignete Umformulierung berichtigen?
Interpretation-2: Für jeden Menschen
T+ gilt Dg1, dass seine Rechtsfähigkeit mit der
Geburt zu beginnen F soll Dg2. RN01(BGB
§ 1 Interpretation-2) = Dg(T+) => Dg(F).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) gelingt. Die Umformulierung ist also annehmbar.
Anmerkung: BGB § 1 widerspricht BGB
§ 1923 (2) Wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits
gezeugt war, gilt als vor dem Erbfall geboren.).
_
BGB § 1923 Erbfähigkeit (1)
Erbe kann nur werden, wer zur Zeit des Erbfalls lebt. (2) Wer zur Zeit
des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, gilt als vor dem
Erbfall geboren.
Zur Analyse der Rechtsnorm
stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+),
(3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor
Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse (1) und (2): Die Rechtsnorm (1) und
(2) ist sprachlich widersprüchlich, geradezu wirr (>Kritik unten),
wenn man auch versteht, was gemeint ist. Bei einem Erbfall liegt eine Geburt
schon bei Zeugung vor
Analyse (1):
(1) Erbe kann nur werden, wer zur Zeit des Erbfalls lebt.
Interpretation-1 zu (1): T1+ nur
wer zur Zeit des Erbfalls lebt, Dg kann F1 Erbberechtigt
werden. In formelhaften Worten: WENN einer zur Zeit des Erbfalls lebt,
DANN ist es GEBOTEN ihn als erbberechtigt anzusehen. Dies kann durch folgende
Rechtsnormformel ausgedrückt werden: RN33(BGB
§ 1923, (1) Interpretation-1) = T1+ => Dg(F1).
Diskussion-1 zu (1): Es stört mich,
dass es zum Tatbestand es keinen Deontor gibt. Lässt sich das durch
geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2 zu (1): (1) Es ist erforderlich=geboten
(Dg), zur Zeit des Erbfalle zu leben (T1+), damit man zur Zeit
des Erbfalles erben (F1) kann (Dg). Dies führt zur Rechtsnormformel
RN01(BGB
§ 1923, (1) Interpretation-2) = Dg1(T1+) => Dg2(F1).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T1+) => D(F1) ist möglich. Die Umformulierung ist also
annehmbar.
Analyse (2): Wer zur Zeit des Erbfalls
noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, gilt als vor dem Erbfall geboren.
Interpretation-1 zu (2): T2+ Wer
zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, Dg
gilt
als, F2 vor dem Erbfall geboren. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel
ausgedrückt werden: RN33(BGB § 1923,
(2) Interpretation-1) = T2+ => Dg(F2).
Diskussion-1 zu (2): Zum Tatbestand gibt
es keinen Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung so
berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2 zu (2): Es ist erforderlich=geboten
(Dg1) zur Zeit des Erbfalles bereits gezeugt zu sein (T2+),
um als vor dem Erbfall geboren (F2) zu gelten (Dg2). RN01(BGB
§ 1923, (2) Interpretation-2) = Dg(T2+) => Dg(F2).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) ist möglich. Die Umformulierung ist also
annehmbar.
Kritik-BGB-§1923 (1) und
(2):
- (a) § 1923 widerspricht BGB § 1 Beginn der Rechtsfähigkeit. Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.
- (b) Erbe und Erbfall sind nicht erklärt.
- (c) Gezeugt sein bedeutet nicht leben und gilt dennoch als geboren. Der Text (1) und (2) sind zusammen unverständlich und widersprüchlich und wirr: ein noch nicht Geborener gilt als geboren. Warum sagt man nicht einfach: (2umformuliert) Wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, soll einem Geborenen gleichgestellt werden. Oder noch einfacher: (2umformuliert) Wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, ist erbberechtigt.
BGB § 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.
Zur Analyse der Rechtsnorm stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse: Auf den ersten Blick ist der Text dem Sinn nach verständlich. Beim genaueren Lesen stellt sich die Frage, was die Worte "Kindeswohl" und seine Dimensionen "körperlich, geistig, seelisch", eine "Gefährdung des Kindeswohls" und seine Dimensionen bedeuten. Klärungsbedürftig sind auch die Begriffe "nicht gewillt" oder "nicht in der Lage".
Interpretation-1: T1+ Wird das T1.1+ körperliche, T1.2+ geistige oder T1.3+ seelische Wohl des Kindes oder T1.4+ sein Vermögen gefährdet und sind T2+ die Eltern T2.1+ nicht gewillt oder T2.2+ nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, Dg so hat F das Familiengericht die Maßnahmen zutreffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. WENN von den ersten vier Tatbestandsmerkmalen eines UND WENN von den zweiten zwei Tatbestandsmerkmalen auch eines erfüllt ist, DANN ist es dem Familiengericht GEBOTEN, geeignete Maßnahmen zu treffen. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt werden: RN33(BGB § 1666 (1) Interpretation-1) = (T1.1+ ODER T1.2+ ODER T1.3+ ODER T1.4+) UND (T2.1+ ODER T2.2+) => Dg(F)). Aus dem ersten Tatbestandskomplex genügt ein Tatbestandsmerkmal von vieren und aus dem zweiten Tatbestandskomplex genügt ein Tatbestandsmerkmal von zweien.
Diskussion-1: In der Interpretation-1 gibt es bei den Tatbeständen es keinen Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Es ist geboten (Dg), T1 das (T1.1+) körperliche, (T1.2+) geistige oder (T1.3+) seelische Wohl des Kindes oder sein (T1.4+) Vermögen nicht zu gefährden und sind T2 die Eltern T2.1 nicht gewillt oder T2.2 nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, (Dg) so hat F das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. Interpretation-2 kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt werden: RN33(BGB § 1666 (1) Interpretation-2) = Dg [(T1.1+ ODER T1.2+ ODER T1.3+ ODER T1.4+) UND (T2.1+ ODER T2.2+)] => Dg(F)).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur Form D(T+) => D(F) ist ohne Sinnverzerrung möglich. Die Umformulierung ist also annehmbar.
_
FamFG § 163 Sachverständigengutachten (1) In Verfahren nach § 151 Nummer 1 bis 3 ist das Gutachten durch einen geeigneten Sachverständigen zu erstatten, der mindestens über eine psychologische, psychotherapeutische, kinder- und jugendpsychiatrische, psychiatrische, ärztliche, pädagogische oder sozialpädagogische Berufsqualifikation verfügen soll. Verfügt der Sachverständige über eine pädagogische oder sozialpädagogische Berufsqualifikation, ist der Erwerb ausreichender diagnostischer und analytischer Kenntnisse durch eine anerkannte Zusatzqualifikation nachzuweisen.
Zur Analyse der Rechtsnorm stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse: Der Text ist verständlich und legt fest, welche Fachgruppen in Frage kommen.
Interpretation-1: T+ In Verfahren nach § 151 Nummer 1 bis 3 Dg ist das Gutachten zu erstatten von F einem geeigneten Sachverständigen der mindestens über eine psychologische, psychotherapeutische, kinder- und jugendpsychiatrische, psychiatrische, ärztliche, pädagogische oder sozialpädagogische Berufsqualifikation verfügen soll. Verfügt der Sachverständige über eine pädagogische oder sozialpädagogische Berufsqualifikation, ist der Erwerb ausreichender diagnostischer und analytischer Kenntnisse durch eine anerkannte Zusatzqualifikation nachzuweisen. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt werden: RN33(FamFG § 163, 1 Interpretation-1) = (T+ => Dg(F)).
Diskussion: In Interpretation-1 gibt es zum Tatbestand gibt es keinen Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Dg Es ist geboten, T+ in Verfahren nach § 151 Nummer 1 bis 3 das Gutachten durch einen Sachverständigen erstatten zu lassen, für den Dg gilt , F das er mindestens über eine psychologische, psychotherapeutische, kinder- und jugendpsychiatrische, psychiatrische, ärztliche, pädagogische oder sozialpädagogische Berufsqualifikation verfügen soll. Verfügt der Sachverständige über eine pädagogische oder sozialpädagogische Berufsqualifikation, ist der Erwerb ausreichender diagnostischer und analytischer Kenntnisse durch eine anerkannte Zusatzqualifikation nachzuweisen. Interpretation-2 führt zu Rechtsnormformel RN01(FamFG § 163, 1 Interpretation-2) = Dg(T+) => Dg(F)).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur Form D(T+) => D(F) ist ohne Sinnverzerrung möglich. Die Umformulierung ist also annehmbar.
_
StGB § 11 (2) [Zweiter Titel Sprachgebrauch] Vorsätzlich im Sinne dieses Gesetzes ist eine TatKaut auch dann, wenn sie einen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht, der hinsichtlich der Handlung Vorsatz voraussetzt, hinsichtlich einer dadurch verursachten besonderen Folge jedoch Fahrlässigkeit ausreichen läßt.
Zur Analyse der Rechtsnorm stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse: Der Text ist dunkel und schwierig, weil plötzlich die Folgen einer vorsätzlichen Handlung hereingebracht werden, die mit Fahrlässigkeit in Verbindung gebracht werden. Der Satz "hinsichtlich einer dadurch verursachten besonderen Folge jedoch Fahrlässigkeit ausreichen läßt." ist völlig dunkel. Die Idee ist möglicherweise, eine vorsätzliche strafbare Handlung weniger streng zu beurteilen, wenn die Folgen die fahrlässiger Handlungen nicht überschreiten. Das ist schwer nachzuvollziehen, weil auch geringe fahrlässige Handlungen große Folgen nach sich ziehen können. Folge und Vorsatz haben sachlich gar nichts miteinander zu tun. Ungeachtet der Verständnisprobleme, sollte eine formale Analyse der Rechtsnorm aber möglich sein. Offenbar soll der Begriff vorsätzlich als Definiendum spezifiziert werden. Auch wenn die Folgen minder schwer wiegen weil Fahrlässigkeit vergleichbar, so soll vom Vorsatz nicht abgewichen werden. Der gesunde Menschenstand sagt: Ob eine Handlung vorsätzlich oder nicht vorsätzlich ist, hat mit den Folgen nichts zu tun, zumindest im richtigen Leben und in der Wirklichkeit. Die Zurechnung Vorsatz einer Handlung ist unabhängig von den Folgen dieser Handlung.
Interpretation-1: T+ Wenn eine verursachte Folge Fahrlässigkeit ausreichen lässt [was immer das bedeuten mag], Dg soll das F nichts für die Wertung und das Bestehen eines Vorsatz ändern. Das führt zur Rechtsnormformel RN33(StGB § 11 (2) Interpretation-1) = T+ => Dg(F).
Diskussion: Zum Tatbestand gibt es keinen Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Ergebnis: Eine Interpretation 2 mit einer entsprechende Umformulierung zu finden, ist mir nicht gelungen, was vielleicht auch daran liegt, dass mir der ganze StGB § 11 (2) nicht geheuer ist.
Sprachkritik: Eine Tat ist kein autonom handelndes Subjekt. Und daher hat eine Tat hat auch keinen Vorsatz, Täter haben Vorsätze. Man versteht zwar, was gemeint ist, aber es ist eine unsaubere Sprache.
_
StGB § 15 Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht.
Zur Analyse der Rechtsnorm stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse: Das Gesetz ist dem Sinne nach ohne Problem zu verstehen. Ein genaues Verständnis der Norm setzt aber voraus, dass die Begriffe vorsätzlich und fahrlässig geklärt und verständlich sind.
Interpretation-1: T1+ vorsätzliches Handeln ODER T2+ wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht, Dg nur dann F strafbar. Dies kann durch folgende Form ausgedrückt werden: RN33(StGB § 15 Interpretation-1) = (T1+ UND T2+) => Dg(F).
Diskussion: Der Erfüllungsstatus (+) erfüllt ist nicht ausdrücklich genannt, obwohl die meisten Interpreten keine Probleme haben dürften, den Erfüllungsstatus hineinzudenken. Besser wäre es natürlich, Rechtsnormen vollständig und klar zu formulieren. Intepretation-1 hat beim Tatbestand keinen Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Es ist geboten (Dg), vorsätzliches Handeln nachzuweisen (T1+), damit Strafbarkeit (F) vorliegt, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht (T2+). Das ergäbe dann die Rechtsnormformel RN01(StGB § 15 neu Interpretation-2) = Dg(T1+) UND T2+) => Dg(F).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur Form D(T+) => D(F) ist möglich. Die Umformulierung ist also annehmbar.
_
StGB § 16 Irrtum über Tatumstände
(1) Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt.
(2) Wer bei Begehung der Tat irrig Umstände annimmt, welche den Tatbestand eines milderen Gesetzes verwirklichen würden, kann wegen vorsätzlicher Begehung nur nach dem milderen Gesetz bestraft werden.
Zur Analyse der Rechtsnorm stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse-StGB-§-16: Diese Norm ist eine Art höhere Norm, die für viele oder sogar alle Straftaten gilt.
Analyse-StGB-§-16(1): Zum Textverständnis gehört das Wissen der Bedeutungen von "bei Begehen der Tat", "Umstand", "gesetzlichen Tatbestand", "vorsätzlich". Nach dem Wortlaut genügt ein einziges Umstandsmerkmal von mehreren oder allen.
Interpretation-1: T+ Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, Dg, F1 handelt nicht vorsätzlich, F2 Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt werden: RN33(StGB § 16,1 Interpretation-1) = (T+ => Dg(F1) UND (F2)).
Diskussion: Interpretation-1 zum 16(1) liefert zum Tatbestand keinen Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Dg Es ist geboten, T1+ bei Vorsatz die Kenntnis der Tatumstände zu berücksichtigen. T2+ Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, Dg, F1 handelt nicht vorsätzlich, F2 Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt werden: RN01(StGB § 16,1 Interpretation-2) = Dg (T1+) UND T2+ => Dg(F1) UND (F2)).
Ergebnis: Es geht zwar, aber nur um den Preis einer Voranstellung, die allerdings einleuchtend ist und den Sinn auch nicht verzerrt. Es wird ja nur noch einmal ausdrücklich vorangestellt, was anschließend speziell ausgeführt wird.
Analyse-StGB-§-16(2):
Zum Textverständnis muss man wissen, was "irrig", "Umstände eines
milderen Gesetzes" und "annehmen" genau bedeutet.
Interpretation-1: T1+ Wer bei Begehung
der Tat irrig Umstände annimmt, welche den Tatbestand eines milderen
Gesetzes verwirklichen würden, Dg kann nur,
F wegen vorsätzlicher Begehung nach dem milderen Gesetz bestraft
werden. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt
werden: RN33(StGB § 16,2 Interpretation-1) = (T+
=> Dg(F)) "kann ... nur" wird als Gebot interpretiert,
obwohl der reine Wortlaut "kann" eine Erlaubnis bedeutet.
Diskussion: Interpretation-1 zum 16(2) liefert
zum Tatbestand keinen Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Dg Es ist geboten,
T1+ die Annahme irriger Umstände zu berücksichtigen. T2+ Wer
bei Begehung der Tat irrig Umstände annimmt, welche den Tatbestand
eines milderen Gesetzes verwirklichen würden, Dg kann
nur, F wegen vorsätzlicher Begehung nach dem milderen Gesetz
bestraft werden. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt
werden: RN01(StGB § 16,2 Interpretation-2) = Dg(T1+)
UND T2+ => Dg(F). "kann ... nur" wird als
Gebot interpretiert, obwohl der reine Wortlaut "kann" eine Erlaubnis bedeutet.
Ergebnis: Es geht zwar, aber nur um den Preis
einer Voranstellung, die allerdings ebenso einleuchtend ist wie bei 18(1)
und den Sinn auch nicht verzerrt. Es wird ja nur noch einmal ausdrücklich
vorangestellt, was anschließend speziell ausgeführt wird.
_
StGB § 17 Verbotsirrtum 1Fehlt
dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt
er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. 2Konnte der
Täter den Irrtum vermeiden, so kann die Strafe nach § 49 Abs.
1 gemildert werden.
Zur Analyse der Rechtsnorm
stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+),
(3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor
Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse § 17 Satz 1 und 2:
Satz 1 regelt den unvermeidbaren Irrtum mit der Folge ohne Schuld (und
damit auch ohne Strafe, was so zwar nicht ausdrücklich da steht, aber
sich ergibt) ...
Satz 2 regelt den vermeidbaren Irrtum mit der möglichen Folge
gemilderter Strafe.
Analyse Satz 1: Der Text kann nur dann genau
verstanden werden, wenn geklärt ist, was "bei Begehung der Tat", "Einsicht
Unrecht zu tun", "Schuld", "Irrtum", "nicht vermeiden konnte" hier genau
bedeuten. Das zentrale Tatbestandsmerkmal ist "die Einsicht Unrecht zu
tun durch Irrtum".
Interpretation-1: T1 Fehlt dem Täter
bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, Dg so
handelt er (Definitionsgebot), F ohne Schuld . Nach der
Definitionslehre
ist "ohne Schuld" das Definiendum,
und T+ ist das Definiens.
Damit ergibt sich folgende Rechtsnormformel: RN33(StGB
§ 17 Satz 1 Interpretation-1) = T+ => Dg(F).
Diskussion: Interpretation-1 liefert keinen
Deontor beim Tatbestand. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Dg Es gilt,
T+ Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu
tun, Dg so handelt er (Definitionsgebot), F
ohne
Schuld . Nach der Definitionslehre
ist "ohne Schuld" das Definiendum,
und T1 ist das Definiens.
Damit ergibt sich folgende Rechtsnormformel: RN33(StGB
§ 17 Satz 1 Interpretation-2) = Dg(T+) => Dg(F).
Ergebnis: Das Voransetzen von "Es gilt" führt
zur Form D(T+) => D(F). Die Umformulierung erhält den Sinn,
ist also annehmbar.
Analyse Satz 2 Konnte der Täter den Irrtum
vermeiden, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.
Der Rechtsnorm kann nur dann richtig verstanden werden, wenn geklärt
ist, was "konnte", "Irrtum" und "vermeiden" bedeuten. Der Inhalt ist nicht
einfach zu verstehen: Dissertation Grotguth,
Diskussion,
Literaturrecherche
Verbotsirrtum..
Interpretation-1: T+ Konnte der Täter
den Irrtum vermeiden, De so kann F die Strafe nach § 49
Abs. 1 gemildert werden. Das führt zur Rechtsnormformel RN33(StGB
§ 17,2 Interpretation-1) = T+ => De(F).
Diskussion: Interpretation-1 liefert keinen
Deontor beim Tatbestand. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Dg Es gilt,
T+ konnte der Täter den Irrtum vermeiden, De so kann F
die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden. Das führt zur Rechtsnormformel
RN01(StGB
§ 17,2 Interpretation-2) = Dg(T+) => De(F).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) ist ohne Sinnverzerrung möglich. Die Ergänzungsformulierung
ist also annehmbar.
_
StGB § 20 Schuldunfähigkeit
wegen seelischer Störungen. > Schuldfähigkeit.
"Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften
seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung
oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit
unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht
zu handeln."
Zur Analyse der Rechtsnorm
stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+),
(3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor
Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse: Der Text ist für Laien
weitgehend unverständlich, weil er viele für ihn unbekannte Rechtsbegriffe
enthält, nämlich: 1. Schuld§, 2. bei Begehung§
3. der Tat§, 4. krankhafte seelische Störung§,
5. tiefgreifende Bewußtseinsstörung§, 6. Schwachsinn§,
7. schwere andere seelische Abartigkeit§, 8. unfähig§,
9. Unrecht§ der Tat einzusehen§ oder 10.
nach dieser Einsicht§ 11. zu handeln§".
Das sind also mindestens 11 Rechtsbegriffe, die verstanden sein müssen.
Interpretation-1: T0 Wer bei Begehung der
Tat wegen T1 krankhafter seelischen Störung ODER T2 tiefgreifenden
Bewußtseinsstörung ODER T3 Schwachsinns ODER T4 schweren anderen
seelischen Abartigkeit, T5 unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen
oder nach dieser Einsicht zu handeln", F der handelt bei Begehung der Tat
ohne Schuld. Nach der Definitionslehre
ist die Rechtsfolge F "ohne Schuld handeln" das Definiendum,
und T1-T5 sind die Definientia,
von denen lediglich ihre Namen mitgeteilt werden, aber nicht ihr (Rechts-)Begriff.
Referenz ist die seelisch geistige Verfassung bei Begehung der Tat und
ihre Auswirkungen auf Einsichts- (das Unrecht der Tat) und Steuerungsfähigkeit
(nach dieser Einsicht handeln). Dies kann durch folgende Rechtsnormformel
ausgedrückt werden: RN33(StGB § 20 Interpretation-1)
= (T0 UND (T1 ODER T2 ODER T3 ODER T4) =k=> T5 => Dg(F). Aufgrund
des kausalen "wegen" wird hier "=k=>" verwendet.
Diskussion: Zum Tatbestand ist kein Deontor
formuliert. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung so berichtigen,
dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Durch Voranstellen von
"Es gilt" erreicht man RN01(StGB § 20 Interpretation-2)
= Dg(T0 UND (T1 ODER T2 ODER T3 ODER T4) =k=> T5) => Dg(F).
Ergebnis: Die voranstellende Ergänzung
von "Es gilt" liefert den gewünschten Deontor beim Tatbestand eine
Sinnverzerrung. Die Ergänzung ist also annehmbar.
Kritik: Die Voraussetzungen sind viel zu
kompliziert und unnötig. Besser und einfacher: Ohne Schuld handelt,
wer bei Begehung der Tat aufgrund einer seelischen Störung unfähig
ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln."
Querverweise:
>
Schuldfähigkeit.,
>
Einsichtsfähigkeit.
_
StGB § 21
Verminderte Schuldfähigkeit > Einsichtsfähigkeit.
"Ist die Fähigkeit des Täters, das
Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem
der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich
vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden."
Zur Analyse der Rechtsnorm
stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+),
(3)
Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor
Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse: Voraussetzung
zum vollen Verständnis sind die in § 20 StGB aufgelisteten Rechtsbegriffe.
Neu zum § 20 kommt der Rechtsbegriff erheblich vermindert§
hinzu. Die drei zentralen Rechtsbegriffe sind: a) erheblich vermindert,
b) das Unrecht der Tat einzusehen (Einsichtsfähigkeit) und
c) nach dieser Einsicht zu handeln (Steuerungsfähigkeit).
Interpretation-1:
T Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen
oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten
Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermindert (im § 20
T1-T4), De so kann,
F die Strafe gemildert werden. Die Rechtsfolge F ist an den
komplexen Tatbestand T geknüpft. Der Deontor De
ist
eine Erlaubnis an das Gericht, die Strafe mildern zu dürfen, wenn
T erfüllt ist (T+).
Dies kann durch folgende Rechtsnormformel
ausgedrückt werden:
RN33(StGB § 21 Interpretation-1)
= (T+) =k=> De(F). Im § 21 fehlt das kausalitätsanzeigende
Wort "wegen", das aber aufgrund des Bezuges zum § 20 begründet
angenommen werden darf, so dass man "aus einem" interpretieren kann "wegen
eines".
Diskussion: Bei Interpretation-1 stört,
dass beim Tatbestand kein Deontor ausgewiesen ist. Lässt sich das
durch geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Durch Voranstellen
von "Es gilt" erreicht man RN01(StGB § 21 Interpretation-2)
= Dg(T+) =k=> Dg(F).
Ergebnis: Die voranstellende Ergänzung
von "Es gilt" liefert den gewünschten Deontor beim Tatbestand eine
Sinnverzerrung. Die Ergänzung ist also annehmbar.
Anmerkungen:
Im Lichte der Definitionslehre interpretiert: Nach
der Definitionslehre
sind die beiden Definienda
"Einsichtsfähigkeit" und "Steuerungsfähigkeit". Hier werden nur
ihre Namen mitgeteilt, aber nicht ihre Begriffsinhalte, ihre Definientia.
Referenz ist die seelisch geistige Verfassung bei Begehung der Tat, genau
die "Einsichtsfähigkeit" und "Steuerungsfähigkeit".
Die Bezeichnung "verminderte
Schuldfähigkeit" ist irreführend, streng genommen falsch, da
es sachlich um verminderte Einsichtsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit
geht.
Psychologisch
ist die juristische Trennung zwischen Einsicht (das Unrecht der Tat einzusehen
) und Steuerung ("nach dieser Einsicht zu handeln") nachvollziehbar und
nicht zu beanstanden. Juristisch stellt sich die Frage nach der Steuerungsfähigkeit
erst dann, wenn die Einsicht in das Unrecht gegeben ist. Fehlt schon die
Einsicht, muss über die Steuerung nicht mehr nachgedacht und befunden
werden.
Querverweise: >
Schuldfähigkeit.,
>
Einsichtsfähigkeit.
_
StGB § 242 Diebstahl
(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt,
die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
Zur Analyse der Rechtsnorm
stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+),
(3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor
Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse: Zum Verständnis ist vorausgesetzt,
dass man weiß, was unter fremd§, beweglich§,
Sache§, bewegliche Sache§,
Absicht§, rechtswidrig§,
rechtswidrige Absicht§, zuzueignen§,
zu verstehen ist. Diese Rechtsbegriffe sind allesamt nicht definiert, sondern
bloße Worthülsen, Definienda, die ihrer Definientia harren.
Interpretation-1: Es gibt hier zwei zentrale
Tatbestands-Bedingungen: (T1)
wegnehmen einer fremden beweglichen Sache
(T2) in rechtswidriger Absicht, Dgwird F mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Dies
führt zur Rechtsnormformel RN33(StGB § 242
Interpretation-1) = (T1 UND T2) => Dg(F).
Diskussion: Es fällt auf, dass beim
Tatbestand kein Deontor VERBOTEN verwendet wird. Das ist zwar klar für
uns weil wir es in den Text hinein denken, aber es steht nicht da. Und
auch die Tatbestandserfüllung bleibt offen. Lässt sich das durch
geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Es ist verboten (Dv),
eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegzunehmen (T1),
die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig (T2) zuzueignen. Wer
das gemacht hat (T+), wird (Dg) mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (F). Interpretation-2 führt zur
Rechtsnormformel: RN01(StGB § 242 Interpretation-2)
= Dv(T1+ UND T2+) => Dg(F).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) ist ohne Sinnverzerrung möglich. Die Umformulierung
ist also annehmbar.
_
HGB § 1 (1) Kaufmann im Sinne
dieses Gesetzbuchs ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. (2) Handelsgewerbe
ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, daß das Unternehmen nach Art
oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb
nicht erfordert.
Zur Analyse der Rechtsnorm
stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+),
(3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor
Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse (1): Es handelt sich um eine
scheinbare Definitionsnorm. In (1) wird das Definiendum
Kaufmann durch den Definiens-Namen Handelsgewerbe betreiben
zwar benannt, aber ohne Begriffsinhalt und Referenzierung. Dessen ungeachtet
lässt sich eine Rechtsnormformel bilden.
Interpretation-1: T+ wer ein Handelsgewerbe
betreibt, Dg ist, F Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuchs.
Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt werden: RN33(HGB
§ 1 (1) Interpretation-1) = T+ => Dg(F)
Diskussion-1: Interpretation-1 liefert keinen
Deontor beim Tatbestand. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Durch ein vorangestelltes
"Es gilt" lässt sich die gewünschte Form erzielen: RN01(HGB
§ 1 (1) Interpretation-2) = Dg(T+) => Dg(F)
Analyse (2): In (2) wird das Definiendum
Handelsgewerbe
mit dem allgemeineren Begriffs-Namen Gewerbebetrieb benannt, aber
ohne Begriffsinhalt und Referenzierung. Begriffsinhalt und Referenzierung
werden also nur auf ein anderes Wort verschoben, also vertagt, nämlich
von Handelsgewerbe auf Gewerbebetrieb. Zusätzlich wird
eine Ausnahme für Kleinbetriebe bestimmt: es sei denn, daß
das Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise
eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert. Der entscheidende
Begriff Gewerbebetrieb wird nicht erklärt. Es gibt auch keinen
Querverweis. Hier wird mit bloßen Worten ohne Inhalt und Referenz
so getan, als sagte man etwas. Und den Worten nach sieht es ja auch so
aus. Doch der Schein trügt wie die genauere Betrachtung dieses
Abschnitts zeigt: es fehlt wie so oft im Recht auch hier, im HGB §
1 (1) an ordentlichen Definitionen.
Dessen ungeachtet lässt sich eine Rechtsnormformel bilden.
Interpretation-1: T+ jeder Gewerbebetrieb,
es sei denn, daß das Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert, Dgist,
F Handelsgewerbe. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt
werden: RN33(HGB § 1 (2) Interpretation-1)
= T+ => Dg(F)
_ Diskussion:
Interpretation-1 liefert keinen Deontor beim Tatbestand. Lässt sich
das durch geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten
bleibt?
Interpretation-2: Durch Voranstellen von
"Es gilt" ost die gewünschte Form RN33(HGB §
1 (2) Interpretation-2) = Dg(T+) => Dg(F) erreichbar.
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) ist ohne Sinnverzerrung möglich. Die Umformulierung
ist also annehmbar.
GVerfG § 184 1Die Gerichtssprache
ist deutsch. ...
Zur Analyse der Rechtsnorm
stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+),
(3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor
Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse: Die Rechtsnorm ist ohne Probleme
zu verstehen, wenn man weiß, was unter "deutsch" zu verstehen ist.
Das aber ist praktisch-faktisch betrachtet völlig unklar. Denn die
Realität zeigt, dass die Gerichtssprache nicht deutsch, sondern deutsches
Kauderwelsch ist. Die Sprache des Rechts besteht nämlich aus deutschen
Alltags-
und Bildungsbegriffen, aus meist unklaren und schlecht definierten
Rechtsbegriffen,
(auch), die gewöhnlich
nicht einmal gekennzeichnet sind, obwohl Herberger und Simon schon 1980,
S. 271, eine Indizierung vorschlugen, und aus Fachbegriffen
und Fremdworten. Der § 184 GVerfG wird in fast jedem
Gesetz, jeder Verordnung, in fast allen Entscheidungen und in der rechtswissenschaftlichen
Literatur gebrochen. Dessen ungeachtet lässt sich eine Rechtsnormformel
bilden.
Interpretation-1: Das Gebot ist einfach:
Wenn im Gericht gesprochen wird, so ist deutsch zu sprechen.
T Gerichtssprache, Dg ist, F deutsch.
Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt werden: RN41(GVerfG
§ 184 Interpretation-1) = T => D(F).
Diskussion-1: Interpretation-1 liefert keinen
Deontor beim Tatbestand. Problematisch in dieser Interpretation ist, dass
beim Tatbestand (Gerichtssprache) kein Erfüllungsplus (+) vermerkt
ist, den wir aber ohne Probleme hineindenken.
Interpretation-2: T+ Gerichtssprache,
Dg ist, F deutsch. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel
ausgedrückt werden: RN33(GVerfG § 184 Interpretation-2)
= T+ => Dg(F).
Diskussion-2: Interpretation-2 erscheint
angemessener als Interpretation-1. Aber es fehlt noch der Deontor beim
Tatbestand (Gerichtssprache). Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-3: Durch Voranstellen "Es
gilt: 1Die Gerichtssprache ist deutsch. ... " lässt die die gewünschte
Form erzielen: RN01(GVerfG § 184 Interpretation-3)
= Dg(T+) => Dg(F).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) ist ohne Sinnverzerrung möglich. Die Umformulierung
ist also annehmbar.
_
SGB I § 18 (1) Leistungen
der Ausbildungsförderung
(1) Nach dem Recht der Ausbildungsförderung können
Zuschüsse und Darlehen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung
in Anspruch genommen werden.
(2) Zuständig sind die Ämter und die Landesämter für
Ausbildungsförderung nach Maßgabe der §§ 39, 40, 40a
und 45 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.
Zur Analyse der Rechtsnorm
stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+),
(3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor
Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse (1): Es fehlt die Nennung der Anspruchsbedingungen.
Dessen ungeachtet lässt sich eine Rechtsnormformel bilden.
Interpretation-1: T+ Nach dem Recht der
Ausbildungsförderung, De können,
F Zuschüsse und Darlehen für den Lebensunterhalt und die Ausbildung
in Anspruch genommen werden. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel
ausgedrückt werden: RN33(SGB I §
18 (1) Interpretation-1) = T+ => De(F)
Diskussion-1: Interpretation-1 liefert beim
Tatbestand keinen Deontor. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Ein vorangestelltes "Es
gilt" führt zum gewünschten Ergebnis mit der Rechtsnormformel
RN01(SGB
I § 18 (1) Interpretation-2) = Dg(T+) => De(F)
Analyse (2): Zuständig sind die Ämter
und die Landesämter für Ausbildungsförderung nach Maßgabe
der §§ 39, 40, 40a und 45 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.
Die Verweise auf die §§ 39, 40, 40a und
45 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes sind als abstrakt-formale
Verweise dem Rechtsverständnis nicht nur nicht förderlich, sondern
sie behindern es geradezu. Außerdem wird auch im (2) nicht auf die
persönlichen Voraussetzungen hingewiesen, denn die sind in den §§
8, 9, 10 im Abschnitt II aufgeführt. Hier liegt sozusagen ein Doppelfehler
vor. Ungeachtet dessen, kann (2) auch normtheoretisch analysiert werden.
Interpretation-1: T+ Zuständig Dg
sind F die Ämter und die Landesämter für Ausbildungsförderung
nach Maßgabe der §§ 39, 40, 40a und 45 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.
Diese Interpretation-1 wählt für den Tatbestand die Zuständigkeit
mit der Rechtsnormformel RN33(SGB I § 18
(2) Interpretation-1) = T+ => Dg(F)
Diskussion: Interpretation-1 liefert keinen
Deontor beim Tatbestand. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Ein vorangestelltes "Es
gilt" führt zum gewünschten Ergebnis mit der Rechtsnormformel
RN01(SGB
I § 18 (2) Interpretation-2) = Dg(T+) => De(F)
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) ist ohne Sinnverzerrung möglich. Die Umformulierung
ist also annehmbar.
_
SGB I § 11 Erster Titel Allgemeines
über Sozialleistungen und Leistungsträger 17.08.2017 BGBl. I
S. 3214
§ 11 Leistungsarten
1Gegenstand der sozialen Rechte sind die in diesem Gesetzbuch vorgesehenen
Dienst-, Sach- und Geldleistungen (Sozialleistungen). 2Die persönliche
und erzieherische Hilfe gehört zu den Dienstleistungen.
Zur Analyse der Rechtsnorm
stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+),
(3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor
Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse Satz 1: Die Definitionsrechtsnorm
ist ohne Probleme dem Sinn nach zu verstehen, genau aber erst dann, wenn
geklärt ist, wer zu welchen Dienst-, Sach- und Geldleistungen unter
welchen Bedingungen anspruchsberechtigt ist.
Interpretation-1: T+ Dienst-, Sach- und
Geldleistungen (Sozialleistungen), Dg
heißen (sind),
F
soziale Rechte. Es wird das Definiendum soziale Rechte mit weiteren
Begriffen charakterisiert. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt
werden:
RN33(SGB IV § 11 Satz 1 Interpretation-1)
= T+ => D(F).
Diskussion-1: Interpretation-1 liefert
keinen Deontor beim Tatbestand. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Ein vorangestelltes "Es
gilt" führt zum gewünschten Ergebnis mit der Rechtsnormformel
RN01(SGB
I § 11 Satz 1) Interpretation-2) = Dg(T+) => De(F)
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) ist ohne Sinnverzerrung möglich. Die Umformulierung
ist also annehmbar.
. Analyse Satz 2:
2Die persönliche und erzieherische Hilfe gehört zu den Dienstleistungen.
Auch hier liegt eine einfache Definitionsrechtsnorm vor, die ohne Probleme
zu verstehen ist. Sie legt fest, dass persönliche und erzieherische
Hilfe (T+) zu den Dienstleistungen (F) gehört (D).
Interpretation-1: T persönliche und
erzieherische Hilfe, Dg gehört zu, F den
Dienstleistungen. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt
werden:
RN33(SGB IV § 11 Satz 2 Interpretation-1)
= T+ => D(F)
Diskussion-1: Interpretation-1 liefert
keinen Deontor beim Tatbestand. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Ein vorangestelltes "Es
gilt" führt zum gewünschten Ergebnis mit der Rechtsnormformel
RN01(SGB
I § 11 Satz 2) Interpretation-2) = Dg(T+) => De(F).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) ist ohne Sinnverzerrung möglich. Die Umformulierung
ist also annehmbar.
_
BauGB § 1 Aufgabe,
Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung
(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung
der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs
vorzubereiten und zu leiten.
Zur Analyse der Rechtsnorm
stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+),
(3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor
Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse: Die Definitionsrechtsnorm
ist ohne Probleme dem Sinn nach zu verstehen. Es wird die Aufgabe der Bauleitplanung§
erklärt.
Interpretation-1: T+ Bauleitplanung§,
Dg hat die Aufgabe, F die bauliche und sonstige Nutzung§
der Grundstücke§ in der Gemeinde§
nach Maßgabe§ dieses Gesetzbuchs§
vorzubereiten§ und zu leiten§.
Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt werden
RN33(BauGB
§ 1 Interpretation-1) = T+ => D(F). Anmerkung: In Interpretation-1
wurden die Rechtsbegriffe mit dem Index "§" gekennzeichnet.
Diskussion-1: Interpretation-1 liefert keinen
Deontor beim Tatbestand. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2: Ein vorangestelltes "Es
gilt" führt zum gewünschten Ergebnis mit der Rechtsnormformel
RN01(BauGB
§ 1) Interpretation-2) = Dg(T+) => De(F).
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur
Form D(T+) => D(F) ist ohne Sinnverzerrung möglich. Die Umformulierung
ist also annehmbar.
_
BauGB § 10 (1) Die
Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung.
Zur Analyse der Rechtsnorm
stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+),
(3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor
Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse: Diese einfache Rechtsnorm
ist auf den ersten Blick ohne Probleme dem Sinne nach zu verstehen, obwohl
der kurze Satz mit nur sieben Worten 4 Rechtsbegriffe (Gemeinde§,
beschließt§, Bebauungsplan§, Satzung§)
enthält, die für ein gründlicheres Verständnis geklärt
sein müssen. Bei genauerer Betrachtung gibt es einige Fragen. Denn
was ist hier Tatbestand T, Erfüllung T+, Deontor D und die Rechtsfolge?
Der Sinn der Rechtsnorm ist wohl: WENN ein BEBAUUNGSPLAN GÜLTIG sein
SOLL, DANN MUSS er von der GEMEINDE als SATZUNG BESCHLOSSEN werden. Aber
das steht so nicht in der Rechtsnorm, das interpretiere ich hinein, insbesondere
"gültig". Damit gibt es nun mehrere Möglichkeiten an Rechtsnormdarstellung
mit den entsprechenden Rechtsnormformeln.
Interpretation-1:
- T Die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung, D = ?, F = ? Dies führt zur lückenhaften und damit ungültigen Rechtsnormformel: RN40(BauGB § 10 Interpretation-1) = T+.
- Ein Bebauungsplan heißt nur dann Bebauungsplan, wenn er von Gemeinde als Satzung beschlossen wurde. T+ Die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung, Dg heißt, F Bebauungsplan. Dies führt zur Rechtsnormformel: RN33(BauGB § 10 Interpretation-2) = T+ => Dg(F)
- Ein Bebauungsplan ist nur dann gültig, wenn er von Gemeinde als Satzung beschlossen wurde. T+ Die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung, Dg gebietet, F Bebauungsplan ist gültig. Dies führt zur Rechtsnormformel: RN33(BauGB § 10 Interpretation-3) = T+ => Dg(F)
Interpretation-4: Ein vorangestelltes "Es gilt" on Interpretation-3 führt zum gewünschten Ergebnis mit der gewünschten Rechtsnormformel RN01(BauGB § 10 Interpretation-4) = Dg(T+) => Dg(F)
Ergebnis: Eine geeignete Umformulierung zur Form D(T+) => D(F) ist möglich. Die Umformulierung ist also annehmbar.
_
StVG § 2 Fahrerlaubnis und Führerschein (1) 1Wer auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug führt, bedarf der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) der zuständigen Behörde (Fahrerlaubnisbehörde). 2Die Fahrerlaubnis wird in bestimmten Klassen erteilt. 3Sie ist durch eine amtliche Bescheinigung (Führerschein) nachzuweisen. 4Nach näherer Bestimmung durch Rechtsverordnung auf Grund des § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und x kann die Gültigkeitsdauer der Führerscheine festgelegt werden.
Zur Analyse der Rechtsnorm stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse Satz 1: Satz 1 ist ohne Problem zu verstehen.
Interpretation-Satz 1: T Wer auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug führt, Dg bedarf, F der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) der zuständigen Behörde (Fahrerlaubnisbehörde). Dies führt zur Rechtsnormformel: RN33(StVG § 2 Satz 1) = T+ => Dg(F)
Analyse Satz 2: Satz 2 ist als bloße Erläuterung ohne Probleme zu verstehen.
Satz 2 Interpretation-1: T Die Fahrerlaubnis Dg wird F in bestimmten Klassen erteilt. Dies führt zur Rechtsnormformel: RN33(StVG § 2 Satz 2 Interpretation 1) = T+ => Dg(F)
Diskussion-Satz 2: Der fehlende Deontor beim Tatbestand T+ kann ohne Sinnverzerrung durch ein vorangestelltes "Es gilt" erzielt werden.
Satz 2 Interpretation-2-: RN01(StVG § 2 Satz 2 Interpretation-2) = Dg(T+) => Dg(F).
Analyse Satz 3: 3Sie ist durch eine amtliche Bescheinigung (Führerschein) nachzuweisen. Satz 3 ist als einfaches Gebot ohne Probleme zu verstehen:
Satz 3 Interpretation-1-: T Sie, Dgist, F durch eine amtliche Bescheinigung (Führerschein) nachzuweisen. Dies führt zur Rechtsnormformel: RN33(StVG § 2 Satz 3 Interpretation-1) = T+ => Dg(F)
Diskussion Satz 3: Der fehlende Deontor beim Tatbestand T+ kann ohne Sinnverzerrung durch ein vorangestelltes "Es gilt" hergestellt werden, so dass dann die gewünschte Rechtsnormformel resultiert:
Satz 3 Interpretation-2-: RN01(StVG § 3 Satz 3 Interpretation-2) = Dg(T+) => Dg(F).
Analyse Satz 4: 4Nach näherer Bestimmung durch Rechtsverordnung auf Grund des § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und x kann die Gültigkeitsdauer der Führerscheine festgelegt werden.
Satz 4 kann nur verstanden werden, wenn man die Informationen in den Verweisen kennt. Aber was genau ist hier Tatbestand, Erfüllung des Tatbestandes, Deontor beim Tatbestand, Rechtsfolge und Deontor bei der Rechtsfolge?
Satz 4 Interpretation: Der wesentliche Kern dieser Rechtsnorm Satz 4 ist, dass Gültigkeitsdauern der Fahrerlaubnisse festgelegt werden können und WENN, DANN aber im Rahmen einer Rechtsverordnung. Das führt zu folgender Darstellung der Rechtsnormstruktur: De(T+ Gültigkeitsdauer für Fahrerlaubnis), Dg geboten (F nach näherer Bestimmung durch Rechtsverordnung) mit folgender Rechtsnormformel: RN01(StVG § 2 Satz 4) = De(T+) => Dg(F)
Verweise- in-Satz-4:
§ 6 (1) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen über
1. die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr, insbesondere über
- b) den Inhalt der Fahrerlaubnisklassen nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2 und der besonderen Erlaubnis nach § 2 Abs.
3, die Gültigkeitsdauer der Fahrerlaubnis der Klassen C und D, ihrer
Unterklassen und Anhängerklassen, die Gültigkeitsdauer der Führerscheine
und der besonderen Erlaubnis nach § 2 Abs. 3 sowie Auflagen und Beschränkungen
zur Fahrerlaubnis und der besonderen Erlaubnis nach § 2 Abs. 3,
x) den Inhalt und die Gültigkeit bisher erteilter Fahrerlaubnisse, den Umtausch von Führerscheinen, deren Muster nicht mehr ausgefertigt werden, sowie die Neuausstellung von Führerscheinen, deren Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, und die Regelungen des Besitzstandes im Falle des Umtausches oder der Neuausstellung,
Drohnen-Verordnung Ein Überblick über die wichtigsten Regeln [Quelle Online Ohne Datum, Abruf 20.05.19]
Im Flyer des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wird vorab erklärend ausgeführt: "Drohnen bieten ein großes Potenzial – privat wie gewerblich. Immer mehr Menschen nutzen sie. Je mehr Drohnen aufsteigen, desto größer wird die Gefahr von Kollisionen, Abstürzen oder Unfällen. Für die Nutzung von Drohnen sind deshalb klare Regeln nötig. Um der Technologie Drohne Chancen zu eröffnen und gleichzeitig die Sicherheit im Luftraum deutlich zu erhöhen, haben wir eine Regelung auf den Weg gebracht. Neben der Sicherheit verbessern wir damit auch den Schutz der Privatsphäre." Dieser Einführungstest ist ohne Probleme zu verstehen.
"Verboten ist
- Jegliche Behinderung oder Gefährdung,
- der Betrieb von Drohnen oder Modellflugzeugen in und über sensiblen Bereichen wie Einsatzorten von Polizei und Rettungskräften, Menschenansammlungen, Hauptverkehrswegen, An- und Abflugbereichen von Flugplätzen,
- der Betrieb einer Drohne oder eines Modellflugzeugs mit einem Gewicht von mehr als 0,25 Kilogramm über Wohngrundstücken. Das Gleiche gilt, wenn das Flugobjekt (unabhängig von seinem Gewicht) in der Lage ist, optische, akustische oder Funksignale zu empfangen, zu übertragen oder aufzuzeichnen."
Zur Analyse der Rechtsnorm stellen wir die 6 Grundfragen: (1) Tatbestand (T), (2) Erfüllung (T+), (3) Deontor beim Tatbestand (D), (4) WENN-SO Verknüpfung, (5) Deontor Rechtsfolge, (6) Rechtsfolge.
Analyse-Verbot Nr. 1: Verboten ist Jegliche Behinderung oder Gefährdung. Das volle Verständnis von Verbot Nr. 1 setzt voraus, dass die Rechtsbegriffe Behinderung§ oder Gefährdung§ geklärt sind. Nicht ausdrücklich erwähnt, aber offensichtlich gemeint, "Jegliche Behinderung oder Gefährdung," durch Drohnen.
Interpretation-Verbot Nr.1: T+ Behinderung§ oder Gefährdung§ durch Drohnen, Dvist verboten. Dies kann in der Rechtsnormformel RN08(Drohnen-Verordnung-Verbot Nr. 1) = Dv(T+) ausgedrückt werden.
Diskussion: Eine Rechtsfolge ist nicht angegeben. Man darf vermuten, dass die Rechtsfolge in Sanktionen bestehen kann. Das steht aber nicht da.
Analyse-Verbot-Nr. 2: Verboten ist der Betrieb von Drohnen oder Modellflugzeugen in und über sensiblen Bereichen wie Einsatzorten von Polizei und Rettungskräften, Menschenansammlungen, Hauptverkehrswegen, An- und Abflugbereichen von Flugplätzen.
Interpretation-Verbot-Nr. 2: T+ der Betrieb von Drohnen oder Modellflugzeugen in und über sensiblen Bereichen wie Einsatzorten von Polizei und Rettungskräften, Menschenansammlungen, Hauptverkehrswegen, An- und Abflugbereichen von Flugplätzen, Dvist verboten. RN08(Drohnen-Verordnung-Verbot Nr. 2) = Dv(T+)
Diskussion Interpretation Verbot-2: Eine Rechtsfolge ist nicht angegeben. Man darf vermuten, dass die Rechtsfolge F in Sanktionen bestehen kann (De). Das steht aber nicht da.
Analyse-Verbot-Nr. 3: Verboten ist der Betrieb einer Drohne oder eines Modellflugzeugs mit einem Gewicht von mehr als 0,25 Kilogramm über Wohngrundstücken. Das Gleiche gilt, wenn das Flugobjekt (unabhängig von seinem Gewicht) in der Lage ist, optische, akustische oder Funksignale zu empfangen, zu übertragen oder aufzuzeichnen.
Interpretation-3: T+ der Betrieb einer Drohne oder eines Modellflugzeugs mit einem Gewicht von mehr als 0,25 Kilogramm über Wohngrundstücken. Das Gleiche gilt, wenn das Flugobjekt (unabhängig von seinem Gewicht) in der Lage ist, optische, akustische oder Funksignale zu empfangen, zu übertragen oder aufzuzeichnen, Dvist verboten. RN08(Drohnen-Verordnung-Verbot Nr. 3) = Dv(T+)
Diskussion Interpretation Verbot-2: Eine Rechtsfolge ist nicht angegeben. Man darf vermuten, dass die Rechtsfolge F in Sanktionen bestehen kann (De). Das steht aber nicht da.
_
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
"Art. 4 DSGVO Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:
- personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;
- „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;
- ...
Analyse-Nr. 1: Es wird der wichtige Rechtsbegriff, das Definiendum "personenbezogene Daten§" durch eine Reihe von Definientia erklärt. Es handelt sich um eine Definitionsrechtsnorm, was aber strukturell für die Rechtsnormformel nichts bedeutet.
Interpretation-1 Nr. 1: T+ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, Dgheißen F personenbezogene Daten. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt werden: RN33(Art. 4 DSGVO, Nr. 1 Interpretation-1) = T+ => Dg(F)
Diskussion: Interpretation-1 liefert keinen Deontor beim Tatbestand. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2 Nr. 1: Ein vorangestelltes "Es gilt" führt zum gewünschten Ergebnis mit der Rechtsnormformel RN01(Art. 4 DSGVO, Nr. 1 Interpretation-2) = Dg(T+) => Dg(F)
Analyse-Nr. 2: Es wird
der wichtige Rechtsbegriff , das Definiendum
"Verarbeitung§" durch eine Reihe von Definientia
erklärt. Es handelt sich um eine Definitionsnorm.
Interpretation-1 Nr. 2: T+
jeden
mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung,
die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung,
die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form
der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung,
das Löschen oder die Vernichtung; Dgheißt,
F Verarbeitung. Dies kann durch folgende Rechtsnormformel ausgedrückt
werden:
RN33(Art. 4 DSGVO, Nr. 2 Interpretation-1)
= T+ => Dg(F)
Diskussion: Interpretation-1 zu Nr.2 liefert
keinen Deontor beim Tatbestand. Lässt sich das durch geeignete Umformulierung
so berichtigen, dass der Sinn erhalten bleibt?
Interpretation-2 Nr. 2: Ein vorangestelltes
"Es gilt" führt zum gewünschten Ergebnis mit der Rechtsnormformel
RN01(Art.
4 DSGVO, Nr. 2 Interpretation-2) = Dg(T+) => Dg(F)