(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=30.06.2002 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 04.02.20
Impressum: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel
Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen * Mail:_sekretariat@sgipt.org__Zitierung & Copyright_
Kritik
an der sog. Neural-Science (Neuro-Science)
am
Beispiel Joseph LeDoux:
Das
Netz der Gefühle. Wie Emotionen entstehen
Eine
Auseinandersetzung in 10 Teilen von Rudolf Sponsel, Erlangen:
Teil
1 * Teil
2 * Teil 3 * Teil 4 * Teil 5 * Teil 6
* Teil 7 * Teil 8 * Teil 9 * Teil 10 *
- Inhaltverzeichnis und Aufbau des Buches
- Vorbemerkung: Die Probleme der Terminologie und Perspektiven
- Zum persönlichen Forschungsweg des Autors
- Erstes Thema Falsches Postulat: Primat der Repräsentation im Gehirn
- Zweites Thema: Ähnlichkeiten bei Tier und Mensch durch die Evolution hinweg
- Drittes Thema: Primat des Unbewußten
- Viertes Thema: Welches System ruft einen Gefühlskomplex hervor?
- Fünftes Thema: Tierversuche angeblich notwendig
- Sechstes Thema: Vergleich von Bewußtseinsinhalten
- Siebtes Thema: Emotionen stoßen uns angeblich zu
- Emotionen werden zu Motivatoren
- Emotionen Teil eines funktionellen Ganzen
- Ausblick auf die einzelnen Kapitel: Wie macht man eine Psychologie ohne Psychologie: der alte Fehler der Bahavioristen und der PsychoanalytikerInnen im neuen Gewand
Inhaltverzeichnis und Aufbau des Buches
LeDoux, Joseph
(dt. 2001 [1998], engl. 1996). Das Netz der Gefühle. Wie Emotionen
entstehen. München: dtv.
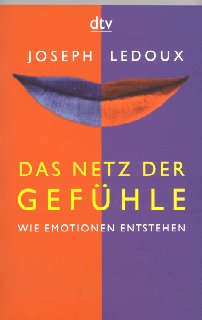 |
|
Vorbemerkung: Die Probleme der Terminologie und Perspektiven
Die Naturwissenschaften
stehen in dem Ruf, sog. exakte Wissenschaft zu repräsentieren
und zu betreiben. Tatsächlich können alle psychischen Erscheinungen
auch aus verschiedenen
Perspektiven (Welten)
betrachtet werden. Es fragt sich aber, ob außerpsychologische Perspektiven
jemals und grundsätzlich betrachtet exakter sein können als die
Psychologie. Denn jede - und daher auch jede andere wissenschaftliche -
Perspektive psychischer Phänomene setzt eine Beschreibung, Definitionen
und Sprache über die
psychischen Phänomene voraus. Man könnte auch sagen:
Psychologie
ist die Voraussetzungs- und Grundlagen Sprache für alle wissenschaftlichen,
auch anders- wissenschaftlich perspektivischen Untersuchungen psychischer
Erscheinungen, auch wenn sie noch nicht so entwickelt ist, wie das zu wünschen
wäre.
 |
Will man über psychische Phänomene wissenschaftlich kommunizieren, so braucht man klare Beschreibungen, Operationalisierungen, Definitionen, also eine Sprache, Methoden und Techniken, wie diese psychischen Phänomene festgestellt und "gemessen" werden können. Da das Erleben, die Psyche und ihre Repräsentationen nicht direkt beobachtbar sind, ergeben sich hier eine Reihe von Problemen. |
| Seltsamerweise werden diese Probleme von den nicht-psychologischen Wissenschaften, die sich mit psychischen Sachverhalten beschäftigen, nur ganz selten wahrgenommen und kritisch problematisiert. Manche NaturwissenschaftlerInnen wirken diesbezüglich sogar völlig unwissenschaftlich naiv und zeigen keinerlei Problembewußtsein. Manche scheinen gar zu meinen, je weniger man von der Psychologie, Psychopathologie, Psychotherapie und ihrer Geschichte weiß, desto besser wird es gelingen, eine Psychologie ohne Psychologie aufzubauen. Dies blüht uns anscheinend mit diesem Buch, wie die folgenden Ein- und Hinführungen zeigen. |
Zum
persönlichen Forschungsweg des Autors
| "Nach dem Diplom kam ich zu dem Schluß,
daß die für die Erforschung des menschlichen Gehirns verfügbaren
Techniken zu begrenzt seien; durch die Untersuchung von Menschen würde
ich die neurale Grundlage der Emotion niemals begreifen können. So
entschloß ich mich, Versuchstiere, und zwar Ratten, zu untersuchen,
um dem Gehirn seine emotionalen Geheimnisse zu entlocken. Die Split-Brain-Beobachtungen
hatten mich zwar auf dieses Thema gebracht, doch es waren die Tierversuche,
die meine Auffassung vom emotionalen Gehirn geformt haben.
Dieses Buch wird Ihnen vermitteln, was ich durch Forschung und Überlegung über die Hirnmechanismen der Emotion herausgefunden habe. Es beschreibt auf wissenschaftliche Weise, was Emotionen sind, wie sie im Gehirn funktionieren und warum sie einen so großen Einfluß auf unser Leben haben." |
|
| "Was die Natur der Emotionen angeht, werden einige Themen auftauchen und immer wieder vorkommen. Einige werden mit dem übereinstimmen, was Ihnen die Intuition über die Emotionen sagt; andere werden Ihnen unglaublich, wenn nicht sogar befremdlich erscheinen. Ich bin jedoch überzeugt, daß sie alle wohlbegründet sind in Tatsachen, die im Gehirn zu finden sind oder zumindest in Hypothesen, die von solchen Tatsachen inspiriert wurden, und ich hoffe, daß Sie mir bis zum Ende folgen werden." |
Erstes
Thema Falsches Postulat: Primat der Repräsentation im Gehirn
| "Erstes Thema: Die für die Analyse einer psychischen Funktion angemessene Ebene ist die Ebene, auf der diese Funktion im Gehirn repräsentiert ist. Das führt zu einer Schlußfolgerung, die sich auf den ersten Blick bizarr ausnimmt: daß das Wort »Emotion« nicht etwas bezeichnet, das der Geist bzw. das Gehirn tatsächlich hat oder tut.'° »Emotion« ist bloß ein Etikett, eine praktische Sprachregelung, um über Aspekte des Gehirns und seines Geistes zu reden. In vielen psychologischen Lehrbüchern wird der Geist in funktionale Teile untergliedert, zum Beispiel Wahrnehmung, Gedächtnis und Emotion. Das ist sinnvoll, um die Information in größere Forschungsbereiche aufzugliedern, bezieht sich aber nicht auf reale Funktionen. So weist das Gehirn kein System auf, das sich mit Wahrnehmung befaßt. Das Wort »Wahrnehmung« bezeichnet [18] ganz allgemein, was sich in einigen abgegrenzten neuralen Systemen abspielt - wir sehen, hören und riechen die Welt mit unserem visuellen, auditorischen und olfaktorischen System. Die einzelnen Systeme entwickelten sich, um unterschiedliche Probleme, vor denen ein Tier steht, zu lösen. So werden auch die verschiedenen Klassen von Emotionen von eigenen neuralen Systemen vermittelt, die sich aus je eigenen Gründen entwickelt haben. Um uns einer Gefahr zu erwehren, benutzen wir ein anderes System als etwa bei der Fortpflanzung, und die mit der Aktivierung dieser Systeme entstehenden Gefühle - Angst bzw. sexuelle Lust - haben keinen gemeinsamen Ursprung. So etwas wie ein »Emotions«-Vermögen gibt es nicht, und es gibt kein Hirnsystem, das sich mit dieser Phantomfunktion befaßt. Wenn wir die verschiedenen Phänomene verstehen wollen, für die wir den Ausdruck »Emotion« benutzen, müssen wir uns auf bestimmte Klassen von Emotionen beschränken. Wir sollten Feststellungen über eine bestimmte Emotion nicht mit Feststellungen über andere Emotionen, die mit dieser nichts zu tun haben, in einen Topf werfen. Leider ist das in Psychologie und Hirnforschung bisher die Regel." |
Das Postulat ist zwar sprachlich verständlich, wird aber offenbar keiner Begründung für bedürftig gehalten. Woher hat der Autor diese Erleuchtung? |
Zweites
Thema: Ähnlichkeiten bei Tier und Mensch durch die Evolution hinweg
| "Zweites Thema: Die Hirnsysteme, die emotionale Verhaltensweisen erzeugen, haben sich über zahlreiche Stadien der Evolutionsgeschichte hinweg weitgehend erhalten. Alle Tiere, die Menschen eingeschlossen, müssen bestimmte Bedingungen erfüllen und ihrem biologischen Imperativ folgen, um ihre Gene an ihre Nachkommen weiterzugeben. Zumindest müssen sie Nahrung und Deckung (oder Obdach) finden, sich vor Körperverletzungen hüten und sich fortpflanzen. Dies gilt für Insekten und Würmer ebenso wie für Fische, Frösche, Ratten und Menschen. Jede dieser Tiergruppen hat neurale Systeme, die diese Verhaltensziele verwirklichen. Und innerhalb der Tiergruppen, die ein Rückgrat und ein Gehirn besitzen (Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säuger, darunter der Mensch), weisen bestimmte emotionale Verhaltenssysteme - etwa die für furchtsames, sexuelles oder Fütterungsverhalten - offenbar über alle Arten hinweg eine recht ähnliche neurale Organisation auf. Das heißt nicht, daß alle Gehirne sich gleichen. Es bedeutet aber, daß wir, um zu verstehen, was es heißt, ein Mensch zu sein, erkennen müssen, worin wir anderen Tieren gleichen und worin wir uns von ihnen unterscheiden." [19] |
Was sollen denn "emotionale Verhaltensweisen" sein?Verhalten ist in der Psychologie Verhalten und Emotionen sind Emotionen. Meint LeDoux den Ausdruck von Emotionen im Verhalten oder meint er Verhalten, das durch Emotionen ausgelöst wird? Die "wissenschaftliche" Sprache von LeDoux ist ausgesprochen ungenau, ein Potpurri-Quiz der verschiedenen Welten und Perspektiven, die der Autor offenbar nicht unterscheiden mag. So stellen wir uns strenge und Naturwissenschaft nicht vor. Und das ist auch weder in Mathematik, noch in der Physik oder in der Chemie üblich. Diese Wissenschaften verdanken ihren Erfolg sogar wesentlich ihren klaren und genauen operationalen Definitions- und Methoden- Vereinbarungen. |
Drittes
Thema: Primat des Unbewußten
| "Drittes Thema: Funktionieren diese Systeme bei einem Tier, das außerdem die Fähigkeit bewußter Wahrnehmung besitzt, dann kommt es zu bewußten emotionalen Empfindungen. Das ist beim Menschen eindeutig der Fall, doch ob andere Tiere diese Fähigkeit haben, weiß niemand. Darüber, welche Tiere Bewußtsein haben und welche nicht, mache ich keine Aussage. Ich behaupte lediglich, daß, wenn eines dieser evolutionär alten Systeme (wie das System, das bei Gefahr Abwehrverhalten auslöst) in einem mit Bewußtsein begabten Gehirn arbeitet, emotionale Empfindungen (wie Furcht) das Ergebnis sind. In allen übrigen Fällen gilt: Das Gehirn verwirklicht seine Verhaltensziele ohne Beteiligung des Bewußtseins. Dies ist im gesamten Tierreich eher die Regel als die Ausnahme. Wenn wir nicht auf bewußte Empfindungen angewiesen sind, um das, was man emotionales Verhalten nennen kann, bei Tieren zu erklären, dann sind wir auch nicht auf sie angewiesen, um dieses Verhalten beim Menschen zu erklären. Emotionale Reaktionen werden überwiegend unbewußt erzeugt. Freud hat, als er das Bewußtsein als die Spitze des Seelen-Eisbergs bezeichnete, genau ins Schwarze getroffen." |
Oben hieß es noch, daß das Gehirn keine Wahrnehmung kennt. Jetzt gibt es sogar schon unbewußte und bewußte Wahrnehmung. Ja, wo kommt denn die auf einmal her? |
Viertes
Thema: Welches System ruft einen Gefühlskomplex hervor ?
| "Das vierte Thema ergibt sich aus dem
dritten. Die bewußten Empfindungen, an denen wir unsere Emotionen
erkennen und deretwegen wir sie lieben (oder hassen), sind für die
wissenschaftliche Erforschung der Emotionen falsche Spuren, die ins Abseits
führen. Das muß man erst einmal schlucken. Was ist eine Emotion
schließlich anderes als eine bewußte Empfindung? Läßt
man die subjektive Tönung der Angst fort, so bleibt von einem gefährlichen
Erlebnis nicht mehr viel übrig. Ich möchte Sie indes davon zu
überzeugen versuchen, daß dies eine falsche Vorstellung ist,
daß ein emotionales Erlebnis sehr viel mehr umfaßt als das,
was dem (menschlichen) Geist bewußt wird. Angstgefühle zum Beispiel
treten als Teil der Gesamtreaktion auf Gefahr auf; sie sind für die
Reaktion nicht mehr und nicht weniger bedeutend als die Verhaltens- und
die physiologischen Reaktionen, die gleichzeitig auftreten, wie Zittern,
Flucht, Schwitzen und Herzklopfen. Was wir aufzuklären haben, ist
nicht so sehr der bewußte Angstzustand, sind nicht die damit verbundenen
Reaktionen, sondern es ist das System, das die Gefahr überhaupt erst
entdeckt. Sowohl die Angstgefühle als auch das Herzklopfen sind Folgen
der Aktivität dieses Systems, das seine Aufgabe erfüllt, ohne
daß wir uns dessen bewußt werden, ja bevor [20]
wir überhaupt wissen, daß wir in Gefahr sind. Das System, das Gefahr entdeckt, ist der Mechanismus, der der Angst zugrunde liegt, und die verhaltensmäßigen, physiologischen und bewußten Manifestationen sind die sichtbaren Reaktionen, die das System einleitet. Das soll nicht heißen, daß Gefühle unwichtig wären. Es bedeutet aber, daß wir tiefer schürfen müssen, wenn wir Gefühle verstehen wollen." |
Auch beim vierten Thema geht es terminologisch wirr und bunt durcheinander. Wieso sollte eine Emotion immer eine bewußte Empfindung sein? Wieso sollte man Angst als gefährliches Erlebnis bezeichnen? Die Bewertung eines Geschehens als Gefahr ruft das Angstgefühl hervor. Angst ist doch kein "gefährliches Erlebnis". Angst heißt vielmehr die emotionale Erlebnisreaktion auf eine wahrgenommene Gefahr. |
Fünftes
Thema: Tierversuche angeblich notwendig.
| "Fünftens: Wenn emotionale Empfindungen und emotionale Reaktionen tatsächlich Folgen sind, die durch die Aktivität eines beiden zugrundeliegenden Systems ausgelöst werden, dann können wir die objektiv meßbaren emotionalen Reaktionen benutzen, um den zugrundeliegenden Mechanismus zu erforschen und damit das System zu beleuchten, das für die Erzeugung der bewußten Empfindungen zuallererst verantwortlich ist. Und da das die emotionalen Reaktionen auslösende Hirnsystem bei Tieren und Menschen ähnlich ist, kommt man, wenn man untersucht, wie das Gehirn diese Reaktionen bei Tieren steuert, einen entscheidenden Schritt voran im Verständnis der Mechanismen, die beim Menschen emotionale Empfindungen hervorrufen. Die Untersuchung von Versuchstieren ist daher sowohl sinnvoll als auch notwendig, wenn wir die Funktionsweise von Emotionen im menschlichen Gehirn verstehen wollen. Die Emotionen im menschlichen Gehirn zu verstehen ist ohne Zweifel ein wichtiges Bestreben, denn die meisten psychischen Störungen sind emotionale Störungen." |
Oben, im Zweiten Thema, hieß es: "Es bedeutet aber, daß wir, um zu verstehen, was es heißt, ein Mensch zu sein, erkennen müssen, worin wir anderen Tieren gleichen und worin wir uns von ihnen unterscheiden." |
Sechstes
Thema: Vergleich von Bewußtseinsinhalten.
| "Sechstens: In einem gewissen Sinne unterscheiden sich bewußte Empfindungen wie das Gefühl der Angst, des Zorns, der Verliebtheit oder des Ekels nicht von anderen Bewußtseinszuständen, etwa dem Bewußtsein, daß der rundliche, rötliche Gegenstand vor Ihnen ein Apfel ist, daß der Satz, den Sie soeben hörten, in einer bestimmten Fremdsprache gesprochen wurde oder daß Sie gerade ein bisher unlösbares mathematisches Problem gelöst haben. Bewußtseinszustände treten auf, wenn das System, das für Bewußtheit verantwortlich ist, der Aktivität gewahr wird, die in unbewußten Verarbeitungssystemen vor sich geht. Der Unterschied zwischen dem Zustand, Angst zu haben, und dem Zustand, etwas Rotes wahrzunehmen, liegt nicht in dem System, welches den bewußten Inhalt (Angst bzw. Röte) repräsentiert, sondern er liegt in [21] den Systemen, welche die Eingaben für das Bewußtseinssystem liefern. Es gibt nur einen Bewußtseinsmechanismus, aber er kann von trivialen Tatsachen oder auch von hochgradig aufgeladenen Emotionen ausgefüllt werden. Emotionen können unschwer triviale Ereignisse aus dem Bewußtsein verstoßen, während es nichtemotionalen Ereignissen (wie zum Beispiel Gedanken) nicht so leichtfällt, Emotionen zu verdrängen; der Wunsch, ein Angstzustand oder eine Depression möge vergehen, reicht gewöhnlich nicht aus." |
Nun ja, wenn das heißen soll, alle Bewußtsinhalte gleichen sich darin, daß sie Bewußtseins- Inhalte sind, so ist das wohl schon analytisch (tautologisch) wahr. Dennoch liegen natürlich Erlebniswelten zwischen einer harmlosen Wahrnehmung eines Apfels und einem heftigen Gefühl von Angst. Gewahrwerden ist eben nicht Gewahrwerden, sondern ein Gewahrwerden eines Gefühls bedeutet zugleich ein qualitativ besonderes Erleben. Im Prinzip gibt es ja nur zwei Haupterlebnisklassen: affektives Erleben und mentales Gewahrwerden. |
Siebtes
Thema: Emotionen stoßen uns angeblich zu.
Emotionen
werden zu Motivatoren
| "Schließlich werden Emotionen, sobald sie auftreten, zu mächtigen Motivatoren künftigen Verhaltens. Sie bestimmen ebenso den Kurs des Handelns von einem Moment zum nächsten, wie sie die Segel für langfristige Ziele setzen. Aber unsere Emotionen können uns auch in Schwierigkeiten bringen. Wenn aus Ängstlichkeit Angst wird, das Begehren der Gier weicht oder Ärger zu Zorn wird, Zorn zu Haß, Freundschaft zu Neid, Liebe zu Hörigkeit oder Lust zu Sucht, dann beginnen unsere Emotionen, uns zu schaden. Psychische Gesundheit bewahrt man sich durch emotionale Hygiene, und in psychischen Problemen äußert sich vielfach ein Zusammen [22] bruch der emotionalen Ordnung. Emotionen können sowohl nützliche als auch pathologische Folgen haben." | Den Zusammenhang Emotion und Motivation
sehe ich auch so. Die Gleichsetzung Emotion und Motivation macht aber keinen
Sinn. Emotionen sind der Signalgeber für motivationale Zustände,
aber sie sind nicht das Motiv selbst. Liebe ist auch viel mehr als eine
Emotion: sie ist eine Haltung. Und erst recht ist Sucht keine Emotion,
sondern ein zwanghaftes Begehren und Verlangen. Emotionale Hygiene würde
bedeuten, daß man seine Emotionalität lenken und ökonomisch
verwalten kann, was im Siebten Thema gerade für als sehr schwach und
nur begrenzt möglich dargelegt wurde. Was stimmt nun?
Eine sinnvolle Forschungshypothese scheint mir, motivations-spezifische und meta- motivationale Emotionen anzunehmen, ein schwieriges Gebiet. |
Emotionen
Teil eines funktionellen Ganzen
| "Als emotionale Wesen, die wir sind, verstehen wir Emotionen als bewußte Erlebnisse. Wenn wir jedoch beginnen, den Emotionen im Gehirn nachzuforschen, erkennen wir, daß die bewußten emotionalen Erlebnisse nur ein Teil und nicht unbedingt die zentrale Funktion der Systeme sind, welche sie erzeugen. Die Liebe oder die Angst, die wir bewußt erleben, wird dadurch nicht weniger real und nicht weniger wichtig. Nur müssen wir, wenn wir verstehen wollen, woher unsere emotionalen Erlebnisse kommen, einen anderen Weg einschlagen, um ihnen auf die Spur zu kommen. Für den Liebenden ist das einzig Wichtige an der Liebe das Gefühl. Wenn man jedoch zu verstehen sucht, was ein Gefühl ist, warum es auftritt, woher es kommt und warum manche es leichter geben und erhalten als andere, dann kann es passieren, daß das Ganze gar nicht viel mit dem Gefühl der Liebe zu tun hat." | Zum Verständnis von Seele und Geist spielen die Emotionen unbestreitbar eine wichtig Rolle und müssen als Teil und Funktion des Ganzen gesehen werden. Das ist aber keine Neuheit und sicher keine Erkenntnis, zu der es der Neuro- Scientologischen Ansatzes bedurft hätte. Das läßt sich ja bereits bei James 1890 oder Lehmann 1892 bzw. 1914 und auch bei den Neueren nachlesen; PsychotherapeutInnen war dies wohl schon immer klar, explizit wurde es von dem Eklektiker Albert Ellis in seiner rational- emotiven Therapie formuliert, deren Prinzip im Grunde schon die Stoiker kannten (nicht die Tatsachen sind schlimm, sondern wie wir sie bewerten). Wiederum fällt auf, daß LeDoux allzu leicht und locker, Thesen und Behauptungen aufstellt, die weder ein terminologisches Problem- noch ein wissenschaftliches Geschichts- Bewußtsein erkennen lassen. |
Ausblick
auf die einzelnen Kapitel
Wie
macht man eine Psychologie ohne Psychologie: der alte Fehler der Behavioristen
und der PsychoanalytikerInnen
| "[2] Wir werden auf
unserer Reise in das emotionale Gehirn viele verschiedene Wege einschlagen.
Ausgehen wollen wir von der seltsamen Tatsache, daß die Erforschung
der Emotion lange von der Kognitionswissenschaft ignoriert wurde, der bedeutendsten
wissenschaftlichen Fachrichtung, die sich heute mit der Natur des Geistes
befaßt (2. Kapitel). [3] Die Kognitionswissenschaft
faßt den Geist wie einen Computer auf, und sie hat sich von jeher
mehr dafür interessiert, wie Menschen und Maschinen logische Probleme
lösen oder Schach spielen, als dafür, warum wir manchmal fröhlich
und manchmal traurig sind. Anschließend werden wir sehen, daß
dieser Mangel auf unglückliche Weise behoben wurde - indem man die
Emotionen zu kalten kognitiven Prozessen umdefinierte und sie dabei ihrer
leidenschaftlichen Seiten beraubte (3. Kapitel). [4] Gleichzeitig
war die Kognitionswissenschaft jedoch sehr erfolgreich, und sie hat einen
Rahmen bereitgestellt, der, richtig genutzt, einen unendlich wertvollen
Ansatz liefert, um sowohl dem emotionalen als auch dem kognitiven Geist
nachzuspüren. Eine der bedeutendsten Einsichten, die dieser Ansatz
ermöglicht, besteht darin, daß sowohl die Kognition als auch
die Emotion unbewußt zu operieren scheint und nur das Ergebnis der
kognitiven bzw. emotionalen Verarbeitung ins Bewußtsein tritt und
unseren bewußten Geist ausfüllt, und das auch nur in einigen
Fällen.
Auf unserer Reise machen wir sodann halt im Gehirn, um nach dem [23] System zu suchen, aus dem unsere Emotionen entspringen (4. Kapitel). [5] Wir werden sehen, daß es nicht ein einzelnes Emotionssystem gibt, sondern eine Fülle von Emotionssystemen, die jeweils für einen eigenen funktionalen Zweck entwickelt wurden und je eigene Emotionen erzeugen (5. Kapitel). [6] Diese Systeme, die außerhalb des Bewußtseins operieren, stellen das emotionale Unbewußte dar. Danach fassen wir ein bestimmtes, ausgiebig erforschtes Emotionssystem ins Auge, das Angstsystem des Gehirns, und schauen, wie es organisiert ist (6. Kapitel). [7] Anschließend erörtern wir den Zusammenhang zwischen dem unbewußten emotionalen Gedächtnis und bewußten Erinnerungen an emotionale Erlebnisse (7. Kapitel). [8] Daraufhin betrachten wir das Versagen von Emotionssystemen, insbesondere des Angstsystems (8. Kapitel). [9] Wir sehen, wie Ängste, Phobien, Panikanfälle und posttraumatische Belastungsstörungen aus den Tiefen des unbewußten Wirkens des Angstsystems aufsteigen. Die Psychotherapie wird als ein Prozeß aufgefaßt, durch den der Neokortex lernt, auf evolutionär alte emotionale Systeme Einfluß zu nehmen (9. Kapitel). Ich schließe mit der auf Tendenzen in der Hirnevolution gründenden Hypothese, daß das Ringen zwischen Denken und Emotion letztlich beendet werden könnte, nicht dadurch, daß neokortikale Kognitionen über emotionale Systeme siegen, sondern durch eine harmonischere Integration von Vernunft und Leidenschaft im Gehirn - eine Entwicklung, die künftigen Menschen erlauben wird, ihre wahren Gefühle besser zu erkennen und sie im Alltag wirksamer zu nutzen. |
Ich kann darin eigentlich nichts
seltsames finden, da das Wort cognoscere
ja schon hinreichend und traditionsreich klar beschreibt, daß es
hier um Erkenntnis und nicht um Affekte geht.
Emotionen rechnet man auch nicht zum Geist gehörig, sondern zur Seele. Hier wird doch sehr deutlich, daß sich ein naiver und unprofessioneller Psychologe einem Thema zuwendet, von dem er offenbar auch noch stolz darauf ist, nichts zu verstehen. Er hält es offenbar für besonders wissenschaftlich, von Psychologie nichts zu verstehen, meint aber zugleich Bedeutsames nicht nur für die Wissenschaft sondern auch für das Leben herausfinden zu können, siehe etwa sein Erstes Thema: "In vielen psychologischen Lehrbüchern wird der Geist in funktionale Teile untergliedert, zum Beispiel Wahrnehmung, Gedächtnis und Emotion. Das ist sinnvoll, um die Information in größere Forschungsbereiche aufzugliedern, bezieht sich aber nicht auf reale Funktionen. So weist das Gehirn kein System auf, das sich mit Wahrnehmung befaßt." Wie man einen solchen Unsinn schreiben kann, mag seinerseits eine psychologische Analyse wert sein. Denn daß dem so ist, ergibt sich schon aus dem alltäglichen Erleben eines jeden Menschen, aus seinem Wahrnehmen, aus seinem Erinnern, aus seiner Gestimmtheit. Im Grunde bedeutet es den gleichen Fehler, den die Behavioristen und die PsychoanalytikerInnen und andere fixierten SchulenvertreterInnen machten. Die Behavioristen wollten eine Psychologie ohne Seele (!) begründen, weil sie dem Problem der Introspektion und der Komplexität des Seelisch- Geistigen nicht gewachsen waren. Und die PsychoanalytikerInnen, allen voran Freud, phantasierten völlig unbedarft und naiv drauf los und hielten ihre Phantasieprodukte und assoziativen Einfälle schon für die Wissenschaft, wobei sie - wie heute noch - Anfang und Ende verwechseln. Daß es verschiedene emotionale und andere seelisch- geistige Funktionseinheiten gibt, ist auch nicht neu und uraltes psychologisch- psychopathologisches Gemeinwissen. Dennoch gibt es so etwas wie Ganzheitserleben und ein Zusammenspiel der verschiedenen Systeme. Gerade das Phäomen der Gesamtbefindlichkeit, emotionalen Verfassung und Stimmung spricht für ein integriertes und integratives emotionales System. Originell ist die neuro-scientologische Interpretation der Psychotherapie: "Die Psychotherapie wird als ein Prozeß aufgefaßt, durch den der Neokortex lernt, auf evolutionär alte emotionale Systeme Einfluß zu nehmen" - was er andernorts als kaum möglich bezeichnet -, wobei aber vorerst dunkel bleibt, wieso es nur alte emotionale Systeme betreffen soll und nur diese. Hm, ich werde den Eindruck nicht los, daß sich einige Nicht-PsychologInnen, und hier wohl auch Neuro-Scientologen in der Rolle gefallen aus ihrem psychologischen, psychopathologischen und psychotherapeutischen Laienwissen heraus, bon-mot artige, geistvoll anmutende Sentenzen von sich zu geben. Wir dürfen also gespannt sein, ob der Autor hält, was er verspricht. |
Querverweise
- Allgemeine und Integrative Theorie der Gefühle (fühlen, spüren, empfinden, gestimmt-sein, befinden).
- Psychologie. Allgemeines und integratives Modell der Psyche
- Gefühle als Grundelemente des Psychischen. Ein Reader aus: Keller, Josef A. (1981).
- 12 Fragen an die Emotionspsychologie. Ein Reader von 1982 (CST-System)
- Bipolare Gefühls-Familien. fse_fam-Liste.
- Fühlen, spüren, empfinden, gestimmt-sein, befinden. fsegb-Liste
- Nur_fühlen
- Bewußtseins- und Bewußtheitsmodell in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie
- Theorie des Bewußtseins und seiner Zustände in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie
- Über Traurigkeit, Trauerarbeit und den Prozeß der Trauer
- Die Psychologische Grundfunktion und das Heilmittel Werten in der GIPT
- Heilmittel-Monographie: Wunsch und Wille. Heilmittel und Differentialdiagnose
- Differenziertes Erleben, fühlen, spüren, empfinden
- Die kurzfristig wunderbaren Wirkungen der Genuß- und Suchtmittel
Kognition (cognition) nach G. Strube in: Wörterbuch der Kognitionswissenschaft. Hrsg. von Strube, Gerhard in Zus.arbeit mit Barbara Becker/ Christian Freska/ Udo Hahn/ Klaus Opwis/ Günther Palm. Klett-Cotta, Stuttgart 1996.:
"K. bezeichnet den Gegenstand der > Kognitionswissenschaft (KW), der > Kognitionspsychologie sowie von Teilbereichen der Neurowissenschaften, der Lingustik, Philosophie, Informatik usw., wobei jede der mit K. befaßten Disziplinen ihren eigenen methodischen Zugang zu diesem Gegenstand hat: formale Analyse der Produkte kognitiver Prozesse (z. B. in der theoretischen > Linguistik), empirische Analyse der menschlichen K. im psychologischen > Experiment oder Entwurf und Realisierung technischer kognitiver Systeme in der > Künstlichen Intelligenz (KI).
I Begriff.
1. „K.", von lat. cognoscere bzw. griech. gignoskein (erkennen, wahrnehmen, wissen) abgeleitet, ist kein althergebrachter Fachbegriff. Er taucht in der Psychologie des 19. Jahrhunderts auf und bezeichnet dort, entsprechend der Orientierung der damaligen Psychologie als einer Lehre von den Erscheinungen des > Bewußtseins, z. B. bei Spencer, die Beziehungen der elementaren Bewußtseinsgegebenhenen (feelings) untereinander. In der modernen Psychologie wird K. in grundsätzlicher Gegenposition zum > Behaviorismus eingeführt, zunächst in den fünfziger Jahren in der Sozialpsychologie (am bekanntesten dien Theorie der kognitiven Dissonanz" von Festinger), danach in der (nach dem 1967 erschienenen, gleichnamigen Lehrbuch von Neisser) so genannten > kognitiven Psychologie (KP) (cognitive psychology).
In der KP faßt man unter dem Begriff K. diejenigen Funktionen zusammen, die das Wahrnehmen und Erkennen, das Enkodieren, Speichern und Erinnern sowie das Denken und Problemlösen, die motorische Steuerung und schließlich den Gebrauch der Sprache umfassen. Diese psychischen Prozesse entsprechen der ersten der drei facultates mentales (wörtlich: geistigen Vermögen, nämlich Erkenntnis, Gefühl und Wille in der Vermögenspsychologie des 19. Jh.); sie werden als die kognitiven Funktionen angesehen. Im Gegensatz zur Bewußtseinspsychologie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts hat die KP, der naturwissenschaftlichen Methode verbunden, das Thema Bewußtsein weitgehend ausgeklammert (> LeibSeele-Problem). Gegenüber dem Behaviorismus mit seinem charakteristischen Ziel, gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen beobachtbaren Reizen und gleichfalls beobachtbaren Reaktionen eines Organismus (Tier, Mensch) zu erforschen, hat die KP die Relevanz interner Zustände des Organismus in den Vordergrund gestellt. An der formalen > Informationstheorie, der > Kybernetik und der damals in schneller Entwicklung begriffenen > Automatentheorie orientiert, hatte die KP mit der Monographie Plans and the structure of behavior von Miller, Galanter und Pribram (1960) das Grundmodell des Menschen als eines informationsverarbeitenden Systems entwickelt. Diese neue Orientierung des psychologischen K.-Begriffs am Modell der Berechnung (nämlich einem > Automaten mit Eingabe = Reiz, Ausgabe= Reaktion und zusätzlich internen Zuständen), diente noch 15 Jahre später zur Grundlegung der KW als einer Disziplin, die Menschen, Tiere und auch technische Systeme (Computer) als kognitive Systeme untersucht und die von der Grundthese ausgeht, daß kognitive Prozesse identisch sind mit Berechnung." ... Noch viel mehr und Interessantes a.a.O. Beispiel Konstruktivismus siehe bitte hier.
__
Eine integrative Gefühlstheorie fordert im Grunde Birbaumer schon 1975, S. 237. Auch in der Zusammenfassung zum Thema Motivation, S. 196, schreibt er: "Motivationsmechnismen können nicht isoliert von anderen Verhaltenskategorien behandelt werden und sind daher nicht von Prozessen der Sensorik, Motorik, der Aufmerksamkeit und Aktivierung, des Lernens und der Emotionen trennbar. Aus der Gesamtheit des Verhaltens wird hier besonders der Aspekt der Erhöhung und Erniedrigung von Aufmerksamkeitswahrscheinlichkeiten bestimmter Verhaltensweisen angesichts physiologischer Mangelzustände hervorgehoben."
Sponsel, Rudolf (DAS). Kritik an der sog. Neural-Science (Neuro-Science): Das Netz der Gefühle. Wie Emotionen entstehen von Joseph LeDoux. Eine Auseinandersetzung in 10 Teilen. Teil 1. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/allpsy/fuehl/rez/ledoux/ledoux1.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
02.08.15 Linkfehler geprüft und korrigiert.