(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=13.08.2006 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 10.04.15
Impressum: Dipl.-Psych. Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel *
Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen * Mail: sekretariat@sgipt.org
Anfang Komorbidität_Überblick_Rel. Aktuelles_Rel. Beständiges_Titelblatt_ Konzept_Archiv_ Region_Service iec-verlag_ Zitierung & Copyright__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_
Willkommen ins unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Dokumentation, Evaluation, Qualitätssicherung, Epidemiologie, psychologische Testtheorie u.a., hier speziell zum Thema:
Komorbidität
Wort, Begriff, Bedeutung, Geschichte, Anwendung und Probleme
in Psychodiagnostik und Psychotherapie
von Rudolf Sponsel, Erlangen
Querverweise.
Man kann nicht nur Läuse und Flöhe in vielerlei Zusammenhängen
oder Bedeutungen haben
- es kann auch noch aus ganz anderen Gründen jucken und das
alles ist auch gar nicht neu.
Wort, Begriff und Begriffsumfeld Komorbidität
Komorbidität: Eine wenig ansprechende Wortschöpfung
aus Ko in der Bedeutung mit und Morbus,
die Krankheit. Komorbidität bedeutet also wörtlich
die Mit-Krankheit. Kurz: all das, was jemand an Krankheiten
oder Störungen mit Krankheitswert "hat". Über den Zusammenhang
der Störungen ist damit zunächst noch gar nichts gesagt. Der
einfachste und unkomplizierteste Komorbiditätsbegriff stellt daher
schlicht und einfach zunächst einmal ein bloßes Zusammentreffen
fest: S1 und S2 treten zusammen auf. Nachdem zwischen verschiedenen Störungen
sehr vielfältige, sowohl einfache als auch sehr komplexe und komplizierte
Verhältnisse bestehen können, gibt es entsprechend vielfältige,
von einfachen bis hin zu sehr komplexen und komplizierten Komorbiditätsbeziehungen.
Da gibt es Störungen, die haben nichts miteinander zu tun und beeinflussen
sich auch nicht (z.B. ein Tic und Desorganisiertheit), und es gibt welche,
die entstehen aus anderen und beeinflussen sich mehr oder minder.
Der Komorbiditätsbegriff gehört zum Themenfeld
Diagnostik,
Differential-Diagnostik,
Anamnese,
Epidemiologie,
und Krankheitslehre
(Nosologie und Ätiologie: bio-psycho-soziales
Krankheitsmodell). Bis zum Jahre 1991 wurde in
der ICD-9 Diagnostik eine führende Hauptdiagnose
vorgezogen, z.B. Depressives Syndrom bei Alkoholismus (Mombour
& Sartorius). Dann wurde man wieder realitätsnäher
und förderte auch gleichberechtigte Mehrfachdiagnosen. Im engen praktischen
Zusammenhang mit der Komorbiditätsfrage steht das Kausalitätsproblem.
("Henne/Ei" oder weder-noch?).
PraktikerInnen wußten schon immer um die Komorbidität
(nicht neu) und müssen sie natürlich
in der Behandlung notwendigerweise berücksichtigen. Jeder Mensch,
selbst der eineiige Zwilling, noch dazu in seiner Lebenssituation, ist
ein einmaliges Unikat, das einen individuellen Therapieplan verlangt, der
am besten experimentell-empirisch evaluiert
wird - daher haben epidemiologische Komorbiditätsstudien für
die Praxis wenig Relevanz.
Was ist nun der
Sinn und Zweck von Komorbiditätsbetrachtungen ?
Zunächst einmal können Diagnosen
sehr wichtig für Behandlungen sein. Um Behandlungen also möglichst
gut planen und durchführen zu können, ist es wichtig zu wissen,
was jemand "hat". Das war im Grunde schon immer so, das weiß jede
ÄrztIn und TherapeutIn und das ist daher auch keine
neue Einsicht. Neu ist allenfalls, dass dieses Phänomen einen
eigenen Namen bekommen hat und in den internationalen Diagnosesystemen
seit Anfang der 1990er Jahre ausdrücklich
mit dieser unglücklichen und schrecklich klingenden Wortschöpfung
"Komorbidität" berücksichtigt wird.
Die
richtige Idee im alten Ätiologiemodell der ICD
Zu vielen Grunderkrankungen können eine Vielzahl von Symptomen
gehören, die, sofern sie von der Grunderkrankung herrühren, nicht
als eigene (neudeutsch "komorbide") Störung betrachtet werden sollen.
Soweit, so vernünftig und sicher richtig. Ein Schizophrener, der Angst
hat, soll nicht Schizophrenie und eine Angststörung
gesondert und zusätzlich diagnostiziert und verschlüsselt bekommen,
sondern nur eine Schizophrenie,
zu der in dem betrachteten Fall die Angst gehören mag. Noch einsichtiger
mag es beim Wahn sein. Wenn jemand
eine Schizophrenie diagnostiziert bekommt, so wird man ihm nicht zusätzlich
eine Wahnerkrankung zuschreiben, weil Wahn oft zur Schizophrenie dazu gehört.
Schwieriger ist es mit Angst und Depression. Gehört die Angst zur
Depression dazu, entsteht sie aus ihr, oder ist im betrachteten Fall, die
Angst unabhängig und als eigene Störung anzusehen? Eine Phobie
(spezifische Furcht) könnte man formal auch als "Vermeidenszwang"
ansehen, aber das tut man nicht und die Phobie hat sich in der Diagnostik
als eigene Angstkategorie durchgesetzt. Anders betrachtet fallen Zwangsstörungen
auch mit Angst zusammen und können sogar als Beruhigungsrituale gegen
Angst und Unruhezustände interpretiert werden, der Zwang
ist dann sozusagen ein Verhaltensheilmittel.
Aber es kommen auch genügend Zwangsstörungen vor, wo die Angst
nicht
gefühlt wird. Es hat sich eingebürgert, die Zwangsstörungen
nach ihrem äußerlichen Leit- und Hauptsymptom zu benennen. Hierbei
darf man natürlich nicht übersehen, dass Zwänge wie viele
andere Symptome auch ganz unterschiedliche Entstehungsgeschichten haben
können so wie einem Syndrom
unterschiedliche Krankheiten zugrundeliegen können.
Die
Standardsituation der Differential-Diagnostik
und die Grundprobleme der Komorbidität
Das Grundproblem von Komorbiditätsbetrachtung versteht man am
besten, wenn man sich klar macht, womit sich (Differential-) DiagnostikerInnen
konfrontiert sehen, wenn sie versuchen, herauszufinden, was jemand hat.
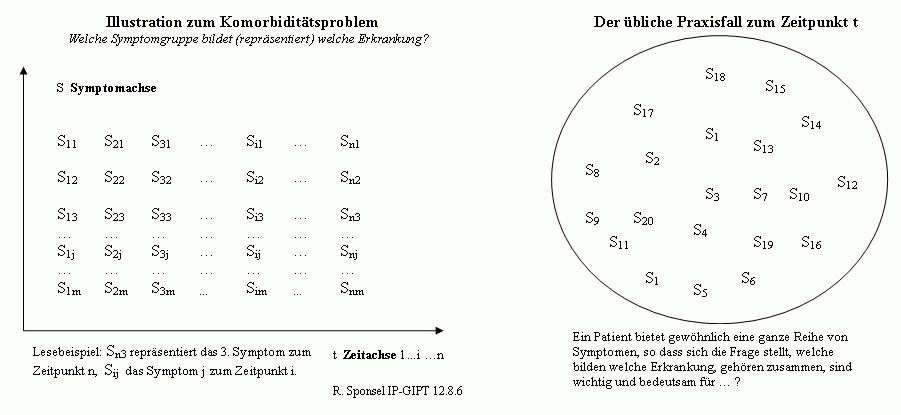
Bio-psycho-soziales Krankheitsmodell [Quelle]
Im allgemeinen Modell wird von einem Systemstörungsmodell
ausgegangen, bei dem wir folgende Entwicklungsstadien unterscheiden: 1)
Ursachen, Bedingungen und Auslöser der Störung. 2) die Bewertung
einer Störung als Krankheit. Zum Wesen der Krankheit definiert
man zweckmäßig eine - wichtige - (Funktions-) Störung (nach
Gustav von Bergmann [1878-1955] 1932). 3) unterschiedliche Auswirkungen
(lokale, zentrale, allgemeine, spezielle) der Störung. 4) Erfassen
und Informationsverarbeitung der Störung und 5) aus Wiederherstellungsprozeduren:
der Auseinandersetzung zwischen den Kräften der Störung und der
Heilung. Störungen können exogener (ausserhalb des Systems) oder
endogener (innerhalb des Systems) Natur sein. Störungen haben im allgemeinen
Ursachen, womit sich in der allgemeinen Krankheitslehre die Ätiologie
beschäftigt. Entwickelt sich eine Störung in der Zeit, wie meistens,
heißt dieser Vorgang Pathogenese. Unklar ist meist der Symptombegriff,
der eine dreifache modelltheoretische Bedeutung haben kann:
- es ist ein Zeichen der Störung (z. B. bestimmte Antigene im Körper; Angst);
- es ist ein Zeichen der Spontanreaktion auf die Störung (z. B. bestimmte Antikörper gegen die Antigene; Vermeiden);
- es ist ein Zeichen der Wiederherstellungsprozedur, also Ausdruck des "Kampfes" zwischen Krankheit und Heilungsvorgängen (z. B. Fieber; Ambivalenzkonflikt zwischen Vermeiden und Stellen).
Kausalitätsbeziehungen
verschiedener Symptome und Störungen [Quelle]
Das Ursachenproblem ist wissenschaftstheoretisch
problematisch aus zwei prinzipiellen und aus einem vermeidbaren Grund:
(1) Im Kausalitätskonzept gibt es streng betrachtet nur einen vielfach
verzweigten Baum von Ursachen. Jede ausgemachte Ursache kann prinzipiell
wiederum auf andere Ursachen zurückgeführt oder zumindest auf
andere zurückgeführt gedacht werden. Welche dieser vielen Ursachen
soll als die besondere ausgezeichnet werden (Watzlawicks
3. Axiom)? In der Wirklichkeit handelt es sich wohl meist um einen
Ursachenkomplex, ein Netzwerk von Bedingungen. (2) Man muss zwischen Bedingungen
(Rahmen- oder Randbedingungen), Anlässen oder Auslösern, Neben-
und Begleiterscheinungen unterscheiden, was häufig sehr schwierig
ist.

Praktische Anwendung und Veranschaulichung:
Das
Buch Eva -Ticket ins Paradies.
(3) Die psychischen Ereignisse können mehrperspektivisch betrachtet werden - wobei die psychologische Perspektive grundlegend und unverzichtbar ist -: z. B. physikalisch, biologisch, chemisch, physiologisch, neurologisch, internistisch, psychopharmakologisch, immunologisch, kybernetisch, psychologisch, sozial-ökonomisch, sozialpsychologisch, sozial-rechtlich und kommunikativ. Hinzu kommt, dass in der Computermetapher Hardware als körperlich und Software als psychisch die Realisation im "Betriebssystem Mensch" vielfach miteinander verflochten und vernetzt ist. Man kann es den biokybernetischen Ereignissen im Körper nicht unbedingt ansehen, ob sie "Hardware" oder "Software" repräsentieren. So finden wir häufig in den Mitteilungen und Büchern drei Ebenen durcheinander gehend: a) Perspektive (z. B. physikalisch, chemisch, biologisch, medizinisch, psychologisch, sozial), b) Hard- oder Software-Repräsentation, c) Ursache, Neben- und Begleiterscheinung oder Wirkung. Unbeschadet der Probleme, ist die konzeptionelle Vorsehung einer oder mehrerer Ursachen (Bäume oder Zweige) natürlich sinnvoll und vernünftig. Die Neigung mancher SystemikerInnen und VulgärkonstruktivistInnen, das Ursachenproblem herunterzuspielen oder gänzlich für überflüssig zu erklären, können wir in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie weder teilen noch akzeptieren, auch wenn es in vielen Fällen durchaus möglich ist, auch ohne genaue Kenntnis der Entstehungsgeschichte sinn- und wirkungsvoll therapeutisch zu handeln.
Komorbide Zusammenhänge
Zwischen einer Störung S1 und einer Störung S2 können
folgende Beziehungen bestehen: S1 und S2 können unabhängig voneinander
entstanden sein oder nicht. Sie können sich wechselseitig in ihrer
Entstehung gefördert haben oder aber S2 ist eine direkte Folge von
S1. Zwei Störungen S1 und S2 können sich verstärken, schwächen,
anderweitig beeinflussen oder gar verschmelzen und ein neues Syndrom S3
erzeugen.
Literatur (Auswahl): Siehe auch Lit-DiffDiag,
Historische Beispiele komorbider Denkweise:
- Friedreich, J. B. (1832). Allgemeine Diagnostik der psychischen Krankheiten. Würzburg: Strecker. [Zitat]
- Reil, J. C. (1803). Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen. Halle: Curt’sche Buchhandlung. [Zitat]
ICD, DSM u.a. Diagnosesysteme:
- Degkwitz, R.; Helmchen, H.; Kockott, G. & Mombour, W. (1980). Diagnoseschlüssel und Glossar psychiatrischer Krankheiten. Deutsche Ausgabe der internationalen Klassifikation der Krankheiten der WHO ICD (International Classification of Deseases), 9. Revision, Kapitel V. Im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde (DGPN). Fünfte Auflage, korrigiert nach der 9. Revision der ICD. Stand: Herbst 1979. Berlin: Springer.
- Dilling, H.; Mombour, W.; Schmidt, M. H. & Schulte-Markwort, E. (dt. 1991, engl. 1991). Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F) Klinisch-Diagnostische Leitlinien. Bern: Huber.
- Dilling, H.; Mombour, W.; Schmidt, M. H. & Schulte-Markwort, E. (dt. 1994, engl. 1993). Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F) Forschungskriterien. Bern: Huber.
- Dittmann, V., Dilling, H., Freyberger, H. H. (1992, Hg.). Psychiatrische Diagnostik nach ICD-10 - klinische Erfahrungen bei der Anwendung. Ergebnisse der ICD-10-Merkmalslistenstudie. Bern: Huber.
- DSM-III (dt. 1984, orig. 1980). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen. Deutsche Bearbeitung: K. Koehler & H. Saß, . Weinheim: Beltz.
- DSM-IV (dt. 1996, orig. 1994). Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen. Deutsche Bearbeitung: Henning Saß, Hans-Ulrich Wittchen, Michael Zaudig. Göttingen: Hogrefe.
- Dahlke, Björn (2004). Persönlichkeit als Risikofaktor? Zum Einfluss der Persönlichkeit auf das Suchtverhalten bei Personen mit Alkoholabhängigkeit. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor medicinae (Dr. med.) vorgelegt der Medizinischen Fakultät Charité der Humboldt-Universität zu Berlin [Download]
- Driessen, Martin (1999). Psychiatrische Komorbidität bei Alkoholismus und Verlauf der Abhängigkeit [PPT]
- Gouzoulis-Mayfrank, Euphrosyne (2003). Komorbidität Psychose und Sucht. Von den Grundlagen zur Praxis; mit Manual für psychoedukatives Training. Darmstadt: Steinkopff. [ISBN 3-7985-1376-7]
- Granderath, Daniela (2004). Epidemiologie psychischer Störungen im Allgemeinkrankenhaus: unter besonderer Berücksichtigung dysthymer, neurotischer, belastungsreaktiver, funktioneller, psychosomatischer und persönlichkeitsbedingter psychischer Störungen. Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik Fakultät: Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum DNB-Sachgruppe: Medizin Dokumentart: Dissertation. Hauptberichter: Herzog, Th. (Dr.). Zitierung: URN: urn:nbn:de:bsz:25-opus-12694. URL: https://freidok.ub.uni-freiburg.de/volltexte/1269/.
- Hegerl, Ulrich & Autor / Hrsg. Hoff, Paul (2003). Depressionsbehandlung unter komplizierenden Bedingungen. Komorbidität - Multimedikation - geriatrische Patienten. Bremen; Verlag UNI-MED-Verl. [ISBN 3-89599-459-6]
- Helmchen, Hanfried u. Möller, Hans-Jürgen (1999, Hrsg.) Psychiatrie für die Praxis, Bd. 29 Urban & Vogel. Aus dem Inhalt u.a.: Komorbidität von Depressionen.
- Klampfl, Karin Maria (2003). Komorbidität bei Kindern und Jugendlichen mit einer Zwangsstörung. Würzburg, Univ., Diss., 2004 [download]
- Kröger, Christoph (2002). Komorbidität und Prädiktoren für den Therapieerfolg bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Bamberg, Univ., Diss., 2002 (Download: 1,2,3,)
- Loew, Thomas (1999). Funktionelle Magen-Darm-Beschwerden. Klinische Studien zum Stellenwert von Komorbidität, Krankheitserleben und Krankheitsverhalten. Band / Reihe Beiträge zur Medizin, Medizinsoziologie und klinischen Psychologie; 13. Erlangen-Nürnberg, Univ., Habil.-Schr. (1997): Pfaffenweiler: Verlag Centaurus-Verl.-Ges. [ISBN 3-8255-0256-2]
- Moggi, Franz (2002). Titel Doppeldiagnosen Zusatz zum Titel Komorbidität psychischer Störungen und Sucht. Bern: Huber. [ISBN 3-456-83699-6]
- Paeßens, Daniela (2004). Komorbidität bei Studierenden: Eine empirische Analyse zu problematischem Substanzkonsum und psychischen Störungen im Studium. Diplomarbeit, Magisterarbeit. Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Köln. Zitierung: URN: urn:nbn:de:bsz:291-psydok-5317. URL: https://psydok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2005/531/
- Schneider, Gudrun (1995). Langzeitkatamnese zu Symptomatik, Krankheitsverlauf, Komorbidität, Krankheitsverhalten und Persönlichkeitsprofil bei 132 Patienten mit Irritablem-Darm-Syndrom. Ausgabe Maschinenschr. Umfang 83 Bl. Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 1995
- Schweiger, Ulrich; Peters, Achim & Sipos, Valerija (2003). Essstörungen. Stuttgart: Thieme. [U.a.: Management von Komorbidität mit weiteren psychischen Störungen, Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten, Fehlermöglichkeiten in der Behandlung von Essstörungen, Prävention von Essstörungen und Übergewicht.]
- Wittchen, Hans-Ulrich (2005). „Psychische Störungen in Deutschland und der EU“ Größenordnung und Belastung von Hans-Ulrich Wittchen, Professor der Klinischen Psychologie und Psychotherapie der Technischen Universität Dresden stellt am 1. Dezember 2005 anlässlich des 1. Deutschen Präventionskongresses die weltweit größte und umfassendste Bestandsaufnahme zur psychischen Gesundheit in Europa vor.
Links (Auswahl: beachte)
Geänderte URLs ohne eingerichtete Weiterleitung wurden entlinkt.
- WHO (ICD). * WHO: History of ICD (PDF). * WHO Search comorbity *
- Komorbiditätsbegriff: , Wikipedia. ,
- Google <Komorbidität psychischer Störungen>.
- Krankheit, Krankheitsbegriff, Krankheitsmodelle in der IP-GIPT.
- ICD-Online bei DIMDI.
- DIMDI: Verzeichnis von ICD-Ausgaben und anderen krankheits- und gesundheitsrelevanten Klassifikationen [Stand Februar 1997]: ICD-9.
Anmerkungen und Endnoten:
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
___
nicht neu. Es hat inzwischen den Anschein, als würde sich das Thema Komorbidität zu einer neuen (Wissenschafts-) Mode entwickeln. Und manche (Wissenschafts-) ModistInnen tun so als wäre die Erkenntnis, dass ein Mensch mehrere Störungen zugleich haben kann, etwas Neues. Tatsächlich dürfte kaum eine Erkenntnis älter sein als eben die, dass man eben auch Läuse und Flöhe haben kann. Die alten Psychodiagnostiker waren sicher nicht dümmer als die heutigen, und praktisch tätige KlinikerInnen haben schon immer den ganzen Menschen im wahrsten Sinne des Wortes gesehen. Und der ICD-9 bevorzugte zwar eine Hauptdiagnose, erlaubte aber vielfach auch Mehrfachdiagnosen ausdrücklich. Was ist also wirklich neu? Nun, neu ist, dass seit den 1970er Jahren erkannt wurde, dass es in der Psychodiagnostik mit der geringen Objektivität und Reliabilität nicht so weiter gehen kann. Dies führte zu dem grossen Aufschwung operationaler Psychodiagnosesysteme. Bereits Johann Christian Reil schrieb 1803 in seinem großen integrativen Wurf im § 13 (S. 123):

Auch J. B. Friedreich spricht in einer der frühesten psychodiagnostischen Monographien der Psychiatriegeschichte bereits 1832 in einem eigenen Kapitel, dem vierten, von der "Diagnostik der Complicationen der psychischen Krankheiten" auf S. 150 im Punkt 1: "Häufig kompliziert sich eine Seelenkrankheit mit einer anderen."
___
ausdrücklich. Bereits der ICD-9,
der in 1970er Jahren entwickelt wurde, sah die Möglichkeit, mehrere
Diagnosen zu vergeben, vor:
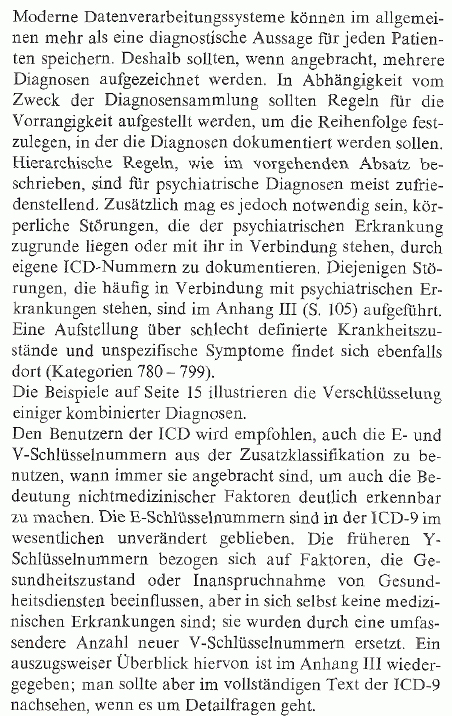
Quelle:Degkwitz, R. et al.
(1980), S. 14.
___
wenig Relevanz. Die meisten Komorbiditätsstudien
erheben, wie oft eine Störung S1 zusammen mit einer Störung S2,
S3, ... usw. vorkommt. Das hat für den konkreten Einzelfall nicht
die geringste Bedeutung. Zu dieser Beurteilung mag helfen, sich die extreme
kombinatorische Vielfalt zwischenmenschlicher Beziehungen zu vergegenwärtigen
(Beispiel 4-Personen-Familie).
Sehr ernüchternd können auch kritische faktorenanalytische Betrachtungen
sein, etwa die Kallinas (50-dimensionaler
Raum mit 1000-Billionen-Zellen) einleitend zum Münchner Symposion
Das
Unbehagen in der Faktorenanalyse.
___
Mombour & Sartorius
(1992).
Aktueller Stand bei der Entwicklung des Kapitels V. der ICD-10. In: Dittmann
et al. (1992). (S.18):

___
1991. In diesem Jahr wurde auch die "Homosexualität"
als Krankheit abgeschafft, Störung mit Krankheitswert. Das veranlasste
Watzlawick zu einem spöttisch-trefflichen Kommentar in seiner Arbeit
»Berufskrankheiten«
systemisch-konstruktivistischer Therapeuten (fett hervorgehoben
von RS): »Berufskrankheiten« ist hier natürlich ironisch
gemeint. Was ich in der ersten Hälfte anführen werde, sind die
typischen Kritiken, die wir von seiten unserer orthodoxeren Kollegen erhalten.
Grundsätzlich müssen wir uns darüber im klaren sein, daß
wir als klinisch ausgebildete Therapeuten nicht auch Epistemologen sind,
das heißt, daß wir nicht Fachleute m dem Bereich sind, der
sich mit dem Erwerb und mit dem "Wissen von Wissen überhaupt befaßt.
Da dem so ist, unterlaufen uns sehr leicht die banalsten Fehler, die eine
gewisse Ausbildung in Epistemologie uns möglicherweise ersparen würde.
Lassen Sie mich den meines Erachtens grundlegenden Fehler erwähnen,
der in unserem Feld immer wieder sein Unwesen treibt: die Tatsache, daß
wir kein allgemein akzeptiertes Kriterium der Normalität haben. Damit
beginnt die ganze Problematik.
Der Arzt ist in einer wesentlich besseren Situation, er hat eine einigermaßen
klare und wissenschaftlich unterbaute Idee des normalen Funktionierens
des menschlichen Körpers oder eines Organs. Da er das hat, ist es
für den Mediziner sinnvoll, dann von Pathologien zu sprechen, d. h.
von Abweichungen, von Störungen dieser Normalität. Wir Psychotherapeuten
glauben naiverweise, daß wir das auch haben. Nur wenn man zu untersuchen
beginnt, wer was für normal hält, kommt man in die größten
und zum Teil auch lächerlichsten Probleme hinein. Zum Beispiel gibt
es in Amerika das sogenannte DSM, Diagnostical and Statistic Manual.
Damit ist man jetzt bei der dritten überarbeiteten Version angelangt,
DSM-III-R. Das ist eine komplizierte, ausgeklügelte Auflistung aller
nur möglichen seelischen und geistigen Störungen, auch psychosomatischer
Art. Als man von DSM-II zu DSM-III überging, wurde aufgrund gesellschaftlichen
Drucks die Homose-[<87]xualität nicht mehr als Störung
aufgeführt. Man hat so mit einem Federstrich Millionen Menschen von
ihrer »Krankheit« geheilt. Einen solchen therapeutischen Erfolg
findet man wohl nur selten.
Freud war sich dieser Problematik bewußt und
postulierte das Kriterium der Arbeits- und Liebesfähigkeit. Auf den
ersten Blick scheint das ein recht praktisches Kriterium zu sein, da diese
zwei Aspekte der menschlichen Existenz meist beeinträchtigt sind.
Nur hat auch dieses Freudsche Kriterium seine Grenzen, es versagt in gewissen
Fällen. Demnach wäre auch Hitler normal gewesen: gearbeitet hat
er und geliebt hat er zumindest seine Schäferhündin, wenn nicht
gar Eva Braun. Andererseits versagt das Freudsche Kriterium gerade dort,
wo wir es mit den bekannten Verhaltensweisen besonders begabter Personen
zu tun haben. So ist man in unserem Feld seit etwa 30 Jahren dazu übergegangen,
die sogenannte »Wirklichkeitsanpassung« als das Kriterium der
menschlichen Normalität aufzufassen. Das scheint auf den ersten Blick
sehr praktisch, sehr vernünftig, sehr brauchbar. Es hat nur den entscheidenden
Fehler, daß es einem epistemologischen Irrtum erliegt, wie Gregory
Bateson das genannt haben würde. Es setzt naiverweise voraus, daß
es eine wirkliche Wirklichkeit gibt, deren sich die Normalen, vor allem
wir Therapeuten, klar bewußt sind, während unsere Klienten ein
verzerrtes Bild dieser Wirklichkeit haben. Was ist denn schon Wirklichkeit?
Na ja, das ist so, wie die Dinge wirklich sind. Aber das hängt ganz
davon ab, wie ich glaube, daß die Dinge wirklich sind oder sein sollten.
Philosophisch ist die Annahme einer solchen Wirklichkeit spätestens
seit Kant, Hume, Schopenhauer unhaltbar. Sie war es allerdings auch schon
in der Antike; schon Epiktet verwies im 1. Jahrhundert nach Christus darauf,
daß es nicht die Dinge sind, die uns beunruhigen, sondern
die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Man könnte sagen,
daß schon in der Gedankenwelt Epiktets eine sehr konstruktivistische
Grundhaltung gegeben ist.
Kommen wir zu den modernen Ansichten: Schopenhauer schreibt in seinem
Werk »Über den Willen in der Natur« (1912, S. 346), daß
die Teleologie, also die Annahme einer der Natur innewohnenden Ordnung
und Zweckmäßigkeit, erst vom Verstand in die Natur gebracht
wird, »der demnach ein Wunder anstaunt, das er selbst geschaffen
hat. ...»"
Quelle (S. 87f): Watzlawick, Paul
(1994). »Berufskrankheiten« systemisch-konstruktivistischer
Therapeuten. In: Schweitzer, Jochen; Retzer, Arnold & Fischer, Hans
Rudi (1994). Systemische Praxis und Postmoderne. Frankfurt: Suhrkamp.
Querverweis: Welten,
Konstruktivismus
und Vulgärkonstruktivismus.
___
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
tt.mm.jj
Standort: Komorbidität. Wort, Begriff, Bedeutung, Geschichte, Anwendung und Probleme.
*
Überblick Diagnostik und Differentialdiagnostik in der IP-GIPT.
- Was-Ist-Fragen in der Diagnostik. WIF-Fallstricke, Tücken und Probleme.
- Diagnostik, Komorbidität und das Problem der Differentialdiagnose
- Testtheorie der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie
- Krankheit, Symptom, Syndrom, Aufgabe der Heilkunde
- Bio-Psycho-Soziales Krankheitsmodell
- Norm, Wert, Abweichung (Deviation)
- Kausalitätsproblem
- Der Wissenschaftsbegriff und seine aktuelle Bedeutung
- Welten und die Konstruktion unterschiedlicher Wirklichkeiten in der GIPT.
- Iatrogenie - Krank durch Behandlung. Fehler, Behandlungsfehler, Kunstfehler. Ein kritischer Beitrag zur Epidemiologie des Gesundheitssystems, das selbst ein wichtiger Faktor für Krankheit und Tod ist.
- Allgemeine und integrative Epidemiologie.
- Übersicht - Psycho-Moden, psychische Epidemien, Epidemiologie und systemimmanente Kunstfehler.
- Potentielle Kunst-/ Fehler aus der Sicht der Allgemeinen und Integrativen Psychologischen Psychotherapie. Materialien zur Qualitätssicherung mit einer Literaturübersicht.
- Über potentielle Kunst- oder Behandlungsfehler in der Psychotherapie aus allgemeiner und integrativer Sicht. Vortrag auf der Ersten Fachtagung des IVS am Samstag den 27. Juli 2002. Festsaal, Klinikum am Europakanal. (Kunstfehler 2)
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Komorbidität site:www.sgipt.org * Diagnostik site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, R. (DAS). Komorbidität. Wort, Begriff, Bedeutung, Geschichte, Anwendung und Probleme in Psychodiagnostik und Psychotherapie. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/doceval/epidem/komorbid.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Service iec-verlag_ _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_
korrigiert: irs 14.08.06
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
10.04.15 Restlinkfehler beseitigt.
21.03.15 Linkfehler geprüft und korrigiert.