(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=01.07.2021 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: TT.MM.JJ
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_ Begriffsanalyse Plausibilität_Datenschutz_Rel. Aktuelles_Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:
Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskriterien...
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen * Methodik der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *
| Zusammenfassung - Abstract - Summary
Einführung und Wortfeld
Plausibilität in der deutschen Sprache. Wortgebrauch in Wissenschaft, Kultur und Leben Alltag.Untersuchungen zur Plausibilität Aus der Plausibilitätsforschungsliteratur Eigene Entwicklung von praktischen Prüfkriterien Wissenschaftlicher Apparat
|
Zusammenfassung - Abstract - Summary
Die Arbeit besteht aus 2 kleineren und 3 größeren Teilen:
- Zusammenfassung aufgrund der Ergebnisse Vorschläge zu Begriff und Verständnis von Plausibilität:
| Plausibel und Plausibilität gehören der Metasprache
an, sie beschreiben nicht Sachverhalte in der Welt, sondern wie die Aussagen
über diese Sachververhalte beurteilt werden.
Ein Sachverhalt erscheint den meisten umso plausibler, je mehr beleg- und prüfbare Gründe für ihn vorliegen. |
- Einführung und Erschließung der Thematik und Problematik zu Begriff und Verständnis von Plausibilität.
- Beispiele für den Wortgebrauch in Wissenschaft, Kultur und Leben
- Analyse der wissenschaftlichen Literatur zu zu Begriff und Verständnis von Plausibilität.
- Eigene empirische Untersuchung zu Begriff und Verständnis von Plausibilität.
Fragen:
Wir wird der Begriff plausibel / Plausibilität von den Menschen
gebraucht?
Wie kann man feststellen, wie der Begriff plausibel/ Plausibilität
von den Menschen gebraucht wird?
Welchen Sinn könnte es haben, den Begriff plausibel / Plausibilität
in seinem Bedeutungsgehalt zu normieren?
Worauf kommt es in Dialogen und Argumentationen an?
Wissenschaftstheoretische Begriffsanalyse plausibel und Plausibilität
Grundgerüst zur Erfassung, Beschreibung und Beurteilung der Beschreibungen
der Welten. Hier ist es zunächst sinnvoll, sich die verschiedenen
grundlegenden Wirklichkeits- und Sprachebenen zu vergegenwärtigen.
Das objektive Geschehen ist das, was sich ereignet und geschieht (EG) in
allen Referenzwelten. Die kleinste Einheit objektiven Geschehens kann man
als Elementar- oder atomare Tatsache bezeichnen. Zusammengesetzte atomare
Tatsachen und Beziehungen zwischen ihnen können als molekuare Tatsachen
bezeichnet werden. Und zusammengesetzte molekulare Tatsachen kann man als
Systeme bezeichnen.
Soweit dieses Geschehen sprachlich erfasst wird, wird nach allgemeinem
Verständnis meist in der Objektsprache (OS) geredet. Die Objektsprache
ist ein großer Teil der natürlichen Sprache. Redet man über
die Sprache, mit der über das Weltgeschehen gesprochen wird, so befindet
man sich nach allgemeinem Verständnis in der Metasprache (MS). Die
Metsprache spricht nicht über das Weltgeschehen, sondern über
die Sprache, die das Weltgeschehen beschreibt und wieder gibt.
Zur Begriffsanalyse liegen einige Hilfsmittel vor, die wir nun gleich
auf plausibel und Plausibilität anwenden. Plausibilität kann
man nicht direkt wahrnehmen und auf sie zeigen. Plausibilität ist
also kein konkretes Geschehen oder Ereignis und damit ein abstrakter Allgemeinbegriff.
Es bleibt die Frage, gehört Plausibilität zur Objekt- oder zur
Metasprache? Betrachtet wir als Beispiel die Aussage: Es ist plausibel,
dass vorüberziehende Wolken den Himmel verdunkeln. Im Naturgeschehen
findet sich keine Plausibilität, aber Wolken, die sich zwischen die
Sonne und der Erde schieben können, was man als plausibel beurteilen
kann. Die Wolken kann man als Filter ansehen. Verallgemeinert könnte
man sagen: Wird zwischen einer Lichtquelle und einem Wahrnehmungsort ein
Filter gebracht, so verliert die Lichtqueulle am Wahrnehmungsort Helligkeit,
es ist dunkler geworden. Die Beurteilung plausibel bedeutet hier nichts
anderes als ein Naturgesetz anerkennen. Aber sind Naturgesetze plausibel?
Sind sie nicht einfach? Man könnte sagen, Erklärung und Verständnis
der Verdunkelung des Himmels kann man als plausibel bezeichnen, d.h. die
Anwendung des Naturgesetzes zum Verstehen und Erklären der Verdunkelung
des Himmels ist plausibel. Plaubel oder Plausibilität sind wie wahr
oder Wahrheit metasprachliche Begriffe. Sie finden sich nicht im Weltgesehen,
aber in der Sprache, die das Weltgesehehn beschreibt.
Einführung
Der Plausibilitätsbegriff hat ein breites Spektrum an Bedeutungen.
Die Bedeutungsspannweite bewegt sich zwischen möglich und fast sicher
oder sehr wahrscheinlich, wobei in vielen Textstellen ein mehr oder weniger
an Plausibilität angenommen wird. Der ursprünglichen Bedeutung
nach bedeutet plausibel Beifall finden, auf Zustimmung stoßen. Ob
jemand einem Sachverhalt zustimmt, ihn also für plausibel hält,
hängt natürlich vom beurteilenden Subjekt ab, so dass es oft
individell sehr verschiedene Plausibilitätsburteilungen gibt, auch
abhängig von der Sprach- und Bildungssozialisation und der Informations-
und Interessensituation. Die Frage ist: gibt es interindividuelle Kriterin
für Plausibilität, also Kriterien worauf sich die meisten einigen
können, wenn sie ein Plausibilitätsurteil abgeben?
Wortfeld plausibel, Plausibilität:
- auf der Hand liegen, augenscheinlich, denkbar, einleuchtend, einsichtig,
ersichtlichh, erwartbar, erklärlich, erwiesenermaßen, evident,
gewöhnlich, glaubhaft, glaubwürdig, klar, homogen (Aussagepsychologie),
im Einklang mit dem gesunden Menschenverstand (GMV), logisch, möglich,
nachvollziehbar, natürlich, offenbar, offensichtlich, passend, realistisch,
richtig, schlüssig, selbstverständlich, sinnvoll, stichhaltig,
stimmig, trivial, üblich, widerspruchsfrei, Verflechtungskriterium
(Aussagepsychologie), vernünftig, verständlich, verträglich,
vielleicht, wahrscheinlich, wahr, für wahr halten, nicht zu bezweifeln,
zutreffen, einer Beurteilung zustimmen.
Dennoch gibt es in der Alltagskomnunikation kaum Probleme damit.
Überraschen mag, dass der Plausibilitätsbegriff auch in der Wissenschaft
so gebraucht wird, als sei klar, was plausibel oder Plausibilität
heißt. So musste ich ernüchtert feststellen, dass ich in fast
keinem
der gesichteten Werke eine kritische Erörterung oder gar Plausibilitätskriterien
gefunden habe, wie Plausibilität nun tatsächlich festgestellt
werden kann oder soll. Das soll im folgenden ausführlich dokumentiert
und kritisch kommentiert werden. Dabei wird immer eindringlich deutlich,
dass "Erklärungen" nur scheinbar solche sind. Im Regelfall greift
immer die geistes-, sozial- und kulturwissenschaftliche Unsitte, ein unklares
Wort durch nicht minder unklare andere Worte zu "erklären".
Hauptbedeutungsperspektiven
Objektiver Bezug
- Unabhängig von Menschen könnte es so sein
- Unabhängig von Menschen könnte es tatsächlich so sein
- Unabhängig von Menschen könnte es so sein, weil das schon so vorgekommen ist
- Unabhängig von Menschen könnte es so sein, weil das schon öfter so vorgekommen ist
- Unabhängig von Menschen ist das eine realistische Möglichkeit
- Unabhängig von Menschen ist das eine wahrscheinliche Möglichkeit
- so könnte es nach meiner Meinung sein
- so könnte es nach meiner Meinung tatsächlich sein
- so könnte es nach meiner Meinung sein, weil das schon so vorgekommen ist
- so könnte es nach meiner Meinung sein, weil das schon öfter so vorgekommen ist
- das ist nach meiner Meinung eine realistische Möglichkeit
- das ist nach meiner Meinung eine wahrscheinliche Möglichkeit
- so könnte es nach Meinung der Gruppe ... sein
- so könnte es nach Meinung der Gruppe ... tatsächlich sein
- so könnte es nach Meinung der Gruppe ... sein, weil das schon so vorgekommen ist
- so könnte es nach Meinung der Gruppe ... sein, weil das schon öfter so vorgekommen ist
- das ist nach Meinung der Gruppe ... eine realistische Möglichkeit
- das ist nach Meinung der Gruppe ... eine wahrscheinliche Möglichkeit
- stimmt nach allgemeiner Meinung, dass es so ist
- stimmt nach allgemeiner Meinung, dass es so sein könnte
- stimmt nach allgemeiner Meinung, dass es tatsächlich so ist
- stimmt nach allgemeiner Meinung, weil das schon so vorgekommen ist
- stimmt nach allgemeiner Meinung, weil das schon öfter so vorgekommen ist
- stimmt nach allgemeiner Meinung eine realistische Möglichkeit
- stimmt nach allgemeiner Meinung eine wahrscheinliche Möglichkeit
Realssprachliche und sprachnormative Perspektive
- Wie sollte ich das sehen?
- Wie sollten die das sehen?
- Wie sollten alle das sehen?
- Wie sollte man das objektiv sehen (unabhängig vom Mensch?eb, aber hinsichtlich welches Erkenntnissystems)
Klassifikation von Erkenntnissystemen
- Erfassen von Gegebenheiten, Sachverhalten (z.B. Überwachungsanlagen, Überwachsungskameras, Regelungsanlagen, Automaten, Maschinen. Kybernetik, Robotik, )
- Mikro und Makro
- Verarbeiten von Sachverhalten
- Verarbeiten von Beziehungen zwischen Sachverhalten
Wer findet in welcher Situation / Interessenlage was mit welchem Geltungsanspruch wie sehr plausibel mit welcher Begründung?
- Explorieren der Bedeutungen von Plausibilität über den Wortgebrauch
- Hauptbedeutungen (Bedeutungsklassen) aus der Wortgebrauchsexploration gewinnen
- Entwickeln von Feststellungsmethoden zu den Hauptbedeutungen, ob und wie viel Plausibilität gegeben ist unter Berücksichtigung der Rahmen- und Situationsparameter: wer findet in welcher Situation / Interessenlage was mit welchem Geltungsanspruch wie sehr plausibel mit welcher Begründung?
Prüfmethoden
Aus der Plausibilitätsforschungsliteratur
Eigene Entwicklung von praktischen Prüfkriterien
| Realisation H0 | Alternativen Hypoth | Stützende Sachverh.
3 Modi: unabh, abh, ? |
Mindernde Sachverh.
3 Modi: unabh, abh, ? |
Verursacher | |
| möglich unklar
möglich schon geschehen mehrmals geschehen oft geschehen |
H1
H2 ... ... Hn |
SSV1
SSV2 ... ... SSVn |
MSV1
MSV2 ... ... MSVn |
Motiv
Gelegenheit Fähigkeit
|
Handelt es sich um einen allgemein bekannten Sachverhalt, kann eine Bezugnahme plausibel genannt werden. Hier ist dann allerdings noch operational zu bestimmen, wie man feststellt, ob ein Sachverhalt ein allgemein bekannter ist. Der Kiosk macht unter der Woche um 7.00 Uhr auf. Jetzt ist es 8.00, also ist es plausibel dass er offen hat. Der allgemein bekannte Sachverhalt ist, dass Läden zu den ausgwiesenen Öffnungszeiten offen haben.
Handelt es sich um einen allgemein bekannten Sachverhalt des Alltagslebens, kann eine Bezugnahme plausibel genannt werden.
Alltagsschlüsse
Wenn etwas so und so ist, dann bedeutet das gewöhnlich ...
Wortgebrauch in Wissenschaft, Kultur und Leben
Plausibilität in der deutschen Sprache: Duden, Sprachbrockhaus, DWDS, Dornseiff,
Duden plausibel
Bedeutungen Plausibilität Duden (Abruf 26.06.2021): 1. Das Plausibelsein.
2. plausible, aber unbewiesene Vermutung. Kritik: die 1. Angabe ist tautologisch,
die zweite zirkulär.
Bedeutungen Plausibilitätsprüfung Duden (Abruf 26-06-2021):
Prüfung, bei der Daten untersucht werden, ob sie glaubwürdig,
plausibel sind
Bedeutungen Plausibilitätsanalyse (Abruf 26.06.2021): Prüfung,
bei der Daten untersucht werden, ob sie glaubwürdig, plausibel sind
Sprachbrockhaus (1951, S. 507)
"plausibel, einleuchtend, glaubhaft"
Duden Bedeutungswörterbuch (1970, S. 494)
"plausibel <Adj.): überzeugend; einleuchtend: seine Begründung
ist ganz p.; eine plaunsible Erklärung."
DWDS plausibel (Abruf 26.06.2021)
„umgangssprachlich einleuchtend, glaubhaft
Beispiele:
das ist ein plausibler Grund, eine plausible Erklärung, Begründung,
Antwort, Ausrede
was du sagst, ist, klingt (ganz) plausibel
das erscheint mir plausibel
?jmdm. etw. plausibel machen?jmdm. etw. begreiflich machen
Beispiele:
wie soll man ihr das nur plausibel machen?
Fritz Mengers macht ihnen plausibel, daß sie nur ein paar Kollegen
suchen [BredelVäter382]
zur Wiederholung des Versuchs: uns das Absurde plausibel zu machen
[BecherAuswahl5,194]
Thesaurus
Synonymgruppe
• augenfällig · begreiflich · eingängig ·
einleuchtend · einsichtig · einsichtsvoll · erklärlich
· ersichtlich · fassbar · fasslich · glaubhaft
· klar · nachvollziehbar · nachzuvollziehen ·
plausibel · schlüssig · sinnfällig · triftig
· verstehbar · verständlich · überzeugend
evident geh. · gut ugs. · intelligibel
fachspr., Philosophie · noetisch fachspr., griechisch, Philosophie
Synonymgruppe
• (durchaus) plausibel · leuchtet ein · logisch ·
nicht von der Hand zu weisen · überzeugend
• nachvollziehbar Hauptform · naheliegend
fig. · (da) passt eins zum anderen ugs., fig.
…
Verwendungsbeispiele für ›plausibel‹
Wer hat wem denn nun Märchen erzählt? frage ich mich und
reime mir eine halbwegs plausible Geschichte zusammen.
Noll, Ingrid: Ladylike, Zürich: Diogenes 2006, S. 138
Ein Kabinett muss ja nicht nur plausibel strukturiert, es muss auch
machtpolitisch ausbalanciert sein.
Der Tagesspiegel, 09.10.2002
Jedem gelingt es, sein Verhalten plausibel zu machen, und jeder, nicht
nur der Vater, entpuppt sich als Teil des Problems.
Süddeutsche Zeitung, 30.05.2000
Niemand hat bisher diese Frage auch nur einigermaßen plausibel
zu beantworten übernommen.
Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen
Geschichte - Erster Teil: Das Altertum, Berlin: Directmedia Publ. 2002
[1920], S. 6163
Es ist noch immer nicht plausibel gemacht, wie du das vorige Mal dazu
gekommen bist, zu lügen.
Friedländer, Hugo: Der Prozeß gegen den Bankier August Sternberg
wegen Sittlichkeitsverbrechen. In: ders., Interessante Kriminal-Prozesse,
Berlin: Directmedia Publ. 2001 [1910], S. 683“
Ende Zitierung DWDS
Dornseiff Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen
Im Sachregister werden die Wortgruppe 5-4 (wahrscheinlich), 13-46 (Beweis)
und 19.13 (Rechtfertigung) ausgewiesen. Man kann aber zudem noch 5.2 (Möglich)
5.6 (Gewiss) berücksichtigen.
Grimm'sches Wörterbuch
plausibel, adj., entlehnt aus franz. plausible, lat. plausibilis Aler
1540b: und fanden wir kinder die sache sehr plausibel. Göthe 24, 188;
wer die menschen betrügen will, musz vor allen dingen das absurde
plausibel machen. 56, 150.
Untersuchungen zur Plausibilität
Andere, Eigene.
Die Untersuchungen und Analysen zum Plausibilitätsbegriff können auch als Beispiele für den Gebrauch verwendet werden. Hier geht es jedoch in erster Linie um Merkmale, Charakteristiken, Definitionen, Kriterien und empirische Befunde zur Begrifflichkeit und der angewandten Methoden.
- [] Berres, Manfred (1984) Glaubens- und Plausibilitätsgrade : e. Beitr. zur Maß- und Integrationstheorie e. Beitr. zur Maß- und Integrationstheorie
- [] Böhnert, Martin & Reszke, Paul (2015): „Linguistisch-philosophische Untersuchungen zu Plausibilität
- [] Bohn, Irina/ Feuerhelm, Wolfgang & Hamburger, Franz (2000): Die Erzeugung von Plausibilität als Konstruktion von Wirklichkeit.
- [z] Connell, Louise & Keane, Mark T. (2006) A Model of Plausibility.
- [m] Handstein, Holger (2016) Jornalistikon
- [] Hannken-Illjes, Kati (2018) Einführung in die Theorie und Analyse der Argumentation.
- [z,SR, IV, KBsp] Kienpointner, Manfred (1992) Alltagslogik. Struktur und Funktion von Argumentationsmustern.Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog.
- [] Koch, Lutz. (2002) „Versuch über Plausibilität.“ In (193-204): Dörpinghaus,Andreas & Karl Helmer, Karl (). Rhetorik Argumentation Geltung. Würzburg: Königshausen & Neumann GmbH
- [] Kuhn-Rahloff, Clemens (2012) Realitätstreue, Natürlichkeit, Plausibilität : Perzeptive Beurteilungen in der Elektroakustik
- [] Müller, Stephan S. W. (2010) Theorien sozialer Evolution : Zur Plausibilität dar winistischer Erklärungen sozialen Wandels [VT]
- [] Schmidt-Scheele, Ricarda () 5 Empirical research: Methodology to study scenario plausibility. In () The Plausibility of Future Scenarios. De Gruyter (transcript).
- [] Schmidt-Scheele , Ricarda () The Plausibility of Future Scenarios. Summary of the book
- [] Schmidt-Scheele, Ricarda (2019) Applause for Scenarios?! An Explorative Study of 'Plausibility' as Assessment Criterion in Scenario Planning [Abruf 07.8.2021]
- [] Tuhrim, Stanley, Reggia, James & Goodall, Sharon (2007) An experimental study of criteria for hypothesis plausibility. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence Volume 3, 1991 - Issue 2, 129-144.
- [m] Weyh, Florian Felix (2021.04.01) Letztgültige Antworten in der Wissenschaft Was wissen wir wirklich?
Tuhrim, Stanley, Reggia, James & Goodall,
Sharon (2007) An experimental study of criteria for hypothesis plausibility.
Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence Volume
3, 1991 - Issue 2, 129-144.
"Abductive diagnostic problem-solving systems use causal relations
to infer plausible diagnostic hypotheses. An important but controversial
issue for such models is what characteristics should define the most plausible
hypotheses. While there are theoretical predictions relevant to this issue,
there are almost no empirical data on which to base rational decisions.
Accordingly, this study examines four different criteria of hypothesis
plausibility in diagnosing the site of brain damage in 100 medical patients.
The criteria examined are (1) naive minimal cardinality, (2) irredundancy,
(3) most probable (Bayesian), and (4) minimal cardinality when adjacency
relations are taken into account. Model performance when these different
hypothesis plausibility criteria are used confirms the previously predicted
inadequacy of minimal cardinality. It also indicates that irredundancy
(‘minimality’), the criterion most widely used in current AI models, is
not useful in this setting because of the large number of alternative,
implausible hypotheses it produces. The most interesting result is that
a modified minimal cardinality criterion produces the best hypotheses when
measured as the ratio of agreements with human experts per hypothesis generated.
In addition, comparing the results of this study to two previous rule-based
systems for a similar application indicates that abductive diagnostic systems
can be very powerful as application programs. These results, useful in
themselves, underscore the need for more systematic empirical studies of
abductive problem-solving models."
GÜ: "Abduktive diagnostische Problemlösungssysteme verwenden
kausale Zusammenhänge, um plausible diagnostische Hypothesen abzuleiten.
Eine wichtige, aber umstrittene Frage für solche Modelle ist, welche
Merkmale die plausibelsten Hypothesen definieren sollten. Zwar gibt es
zu diesem Thema relevante theoretische Vorhersagen, aber es gibt fast keine
empirischen Daten, auf die rationale Entscheidungen gestützt werden
könnten. Dementsprechend untersucht diese Studie vier verschiedene
Kriterien der Hypothesen-Plausibilität bei der Diagnose des Ortes
der Hirnschädigung bei 100 medizinischen Patienten. Die untersuchten
Kriterien sind (1) naive minimale Kardinalität, (2) Irredundanz, (3)
höchstwahrscheinlich (Bayesian) und (4) minimale Kardinalität
unter Berücksichtigung von Adjazenzbeziehungen. Die Modellleistung,
wenn diese verschiedenen Hypothesen-Plausibilitätskriterien verwendet
werden, bestätigt die zuvor vorhergesagte Unzulänglichkeit der
minimalen Kardinalität. Es weist auch darauf hin, dass Irredundanz
(„Minimalität“), das in aktuellen KI-Modellen am häufigsten verwendete
Kriterium, in diesem Kontext aufgrund der Vielzahl von alternativen, unplausiblen
Hypothesen nicht nützlich ist. Das interessanteste Ergebnis ist, dass
ein modifiziertes Minimalkardinalitätskriterium die besten Hypothesen
liefert, wenn es als Verhältnis der Übereinstimmungen mit menschlichen
Experten pro generierter Hypothese gemessen wird. Darüber hinaus zeigt
der Vergleich der Ergebnisse dieser Studie mit zwei früheren regelbasierten
Systemen für eine ähnliche Anwendung, dass abduktive Diagnosesysteme
als Anwendungsprogramme sehr leistungsfähig sein können. Diese
an sich nützlichen Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit systematischer
empirischer Studien zu abduktiven Problemlösungsmodellen."
Friedman, Charles P.; Gatti, Guido G.; Murphy, Gwendolyn
C.; Franz,Timothy M.; Fine, Paul L.; Heckerling, Paul S.; Miller, Thomas
M. (2002) Exploring the Boundaries of Plausibility: Empirical Study ofa
Key Problem in theDesign ofComputer-Based Clinical Simulations. AMIA 2002
Annual Symposium Proceedings, 275-279. Online.
"All clinical simulation designers face the problem
ofidentifying the plausible diagnostic and managementoptions to include
in their simulation models. This studyexplores the number ofplausible diagnoses
that existfor agiven case, and how many subjects must work up a casebefore
all plausible diagnoses are identified. Data derivefrom 144 residents andfaculty
physiciansfrom 3 medicalcenters, each of whom worked 9 diagnosticallychallenging
cases selectedfrom a set of36. Each subjectgenerated up to 6 diagnostic
hypothesesfor each case, andeach hypothesis was ratedfor plausibility by
a clinicianpanel. Ofthe 2091 diagnoses generated, 399 (19.1%/), anaverage
of1I per case, were consideredplausible by studycriteria. The distribution
ofplausibility ratings wasfoundto be statistically case dependent. Averaged
across cases,the final plausible diagnosis was generated by the 28thclinician
(sd = 8) who worked the case. The resultsillustrate the richness and diversity
of human cognitionand the challenges these pose for creation of realisticsimulations
in biomedical domains."
GÜ: "Alle Designer klinischer Simulationen stehen vor dem Problem,
die plausiblen Diagnose- und Managementoptionen zu identifizieren, die
in ihre Simulationsmodelle aufgenommen werden sollen. In dieser Studie
wird untersucht, wie viele plausible Diagnosen für einen bestimmten
Fall vorliegen und wie viele Probanden einen Fall bearbeiten müssen,
bevor alle plausiblen Diagnosen identifiziert werden. Die Daten stammen
von 144 Assistenzärzten und Fakultätsärzten aus 3 medizinischen
Zentren, die jeweils 9 diagnostisch schwierige Fälle bearbeiteten,
die aus einer Gruppe von 36 ausgewählt wurden. Jeder Proband generierte
für jeden Fall bis zu 6 diagnostische Hypothesen, und jede Hypothese
wurde von einem Klinikerpanel auf Plausibilität bewertet. Von den
2091 erstellten Diagnosen wurden 399 (19,1%/), durchschnittlich 1I pro
Fall, nach Studienkriterien als plausibel erachtet. Die Verteilung der
Plausibilitätsbewertungen erwies sich als statistisch fallabhängig.
Im Durchschnitt der Fälle wurde die endgültige plausible Diagnose
von dem 28. Arzt (sd = 8) erstellt, der den Fall bearbeitete. Die Ergebnisse
veranschaulichen den Reichtum und die Vielfalt der menschlichen Kognition
und die Herausforderungen, die diese für die Erstellung realistischer
Simulationen in biomedizinischen Bereichen darstellen."
Schmidt-Scheele, Ricarda (2002) 5 Empirical
research: Methodology to study scenario plausibility. In () The Plausibility
of Future Scenarios. De Gruyter (transcript). [Online
Abruf 07.08.25021]
"Studying scenario users’ plausibility judgments of a set of given
scenarios isat the centre of this research. Chapter 4 has reviewed theoretical
concepts ofplausibility across different academic disciplines and related
it to the contextof scenario planning. This has led to five research propositions
with nine hy-potheses, which are now operationalised and tested in an empirical
study.Still, even in the explored academic disciplines that offer more
nuanced con-ceptions of plausibility, empirical research on what plausibility
means andhow it is perceived is underrepresented. Experimental study designs
builda small exception in narrative and psychological research (Canter
et al 2003;Lombardi et al 2016b; Lombardi et al 2015; Lombardi et al 2014;
Lombardi &Sinatra 2013; Nahari et al 2010). Particularly, the approaches
from cognitiveand educational psychology offer detailed experimental classroom-sessionsto
analyse plausibility judgments in controlled circumstances. The theoreticalconcepts
have suggested that plausibility is very context-sensitive and mayvary
across different settings. To operationalise the propositions for scenariocontexts,
an experimental study design thereby constitutes a promising con-tribution.
In an experiment, the contexts under which plausibility judgmentsare made,
can be controlled and manipulated. This allows for ‘planned ob-servations’
of a number of variables that the theory suggests to be relevant(Fuchs-Heinritz
et al 1994:190). Furthermore, the present study can build onprevious attempts
to observe plausibility so that findings can be comparedand reflected against
insights from empirical research in narrative and psy-chology. For the
experiment, the propositions and hypotheses are operatio-nalised as summarised
below:"
GÜ: "Im Zentrum dieser Forschung steht die
Untersuchung der Plausibilitätseinschätzungen von Szenariobenutzern
zu einer Reihe von gegebenen Szenarien. Kapitel 4 hat die Theorie überprüft
disziplinübergreifende Plausibilitätskonzepte und bezogen sie
auf den Kontext der Szenarioplanung. Dies hat zu fünf Untersuchungen
geführt Thesen mit neun Hypothesen, die nun in einer empirischen Studie
operationalisiert und getestet werden Disziplinen, die differenziertere
Vorstellungen von Plausibilität bieten, empirische Forschung, was
Plausibilität bedeutet und wie sie wahrgenommen wird unterrepräsentiert.
Experimentelle Studiendesigns bilden eine kleine Ausnahme in der narrativen
und psychologischen Forschung (Canter et al. 2003; Lombardi et al 2016b;
Lombardi et al. 2015; Lombardi et al. 2014; Lombardi&Sinatra 2013;
Nahariet al 2010). Besonders die Ansätze von Kognitive und Pädagogische
Psychologie bieten detaillierte experimentelle Unterrichtseinheiten zur
Analyse von Plausibilitätsurteilen in kontrollierten Umstände.
Die theoretischen Konzepte legen nahe, dass Plausibilität sehr kontextsensitiv
ist und in verschiedenen Settings variieren kann. Zu die Aussagen für
Szenariokontexte operationalisieren, stellt ein experimentelles Studiendesign
dabei einen vielversprechenden Beitrag dar. In einem (n Experiments
können die Kontexte, in denen Plausibilitätsurteile gefällt
werden, kontrolliert und manipuliert werden. Dies ermöglicht „geplante“
Beobachtungen“ einer Reihe von Variablen, die die Theorie für relevant
hält (Fuchs-Heinritz et al. 1994: 190). Außerdem ist die Gegenwart
Studie kann auf früheren Versuchen aufbauen, Plausibilität zu
beobachten, so dass Ergebnisse verglichen und mit empirischen Erkenntnissen
reflektiert werden können Forschung in Erzählung und Psychologie.
Für das Experiment werden die Aussagen und Hypothesen wie folgt operationalisiert:
"
Schmidt-Scheele , Ricarda (2002) The Plausibility
of Future Scenarios. Summary of the book
"Summary of the bookPlausibility as a concept is omnipresent in the
scenario planning literature.Practitionersandresearchersregularlyconcludethattheirplanningprocesseshave
revealed ‘plausible scenarios’. The common position is that for scenarioplanning
exercises to create alternative future pathways, their selection can-not
be simply limited to the mostprobableones; neither does merepossibilityallow
for a meaningful collection of relevant and challenging scenarios. Me-thodological
reviews,therefore,name plausibility a key effectiveness criterionfor both
scenario construction and utilisation. This has practical consequen-ces:
Plausibility guides what kind of scenarios are generated and presentedandprescribeshowtoassessandconsiderscenariosfordecision-making.Yet,insights
into what scenario plausibility really means and how it is establishedand
assessed by different actors, including scenario users, is largely unexplo-red.The
book addresses this conceptual and empirical gap and analyses theconcept
from the perspective of prospective scenario users. The small groupof scholars
more recently involved in the concept has predominantly lookedat plausibility
from the angle of scenario construction: Here, plausibility isthoughttobeestablishedeitherbymethod-drivenprocesses,e.g.differenttech-niques
and procedures prescribe scenarios as plausible only when they are in-ternally
consistent, or throughactor-drivenprocesses, meaning that involvedstakeholders
interactively co-produce a common understanding of the scen-arios. Both
positions neglect that important scenario user groups i) are oftennot involved
in the actual construction process, ii) are confronted with mul-tiple,
contradicting scenarios in different formats, and iii) may consequentlyfollow
different mechanisms when assessing the plausibility of a scenario.Therefore,
in this book, the following research questions are pursued:How doscenario
users assess the plausibility of a scenario? What factors influence an
individu-al’s plausibility judgment? Do judgments differ across scenario
formats?"
GÜ: "Zusammenfassung des Buches Plausibilität
als Konzept ist in der Literatur zur Szenarioplanung allgegenwärtig.
Praktiker und Forscher kommen regelmäßig zu dem Schluss, dass
ihre Planungsprozesse „plausible Szenarien“ ergeben haben. Der gemeinsame
Standpunkt ist, dass für Szenarioplanungsübungen zur Schaffung
alternativer zukünftiger Pfade deren Auswahl nicht einfach auf die
wahrscheinlichsten beschränkt werden kann; Auch lässt die bloße
Möglichkeit keine sinnvolle Sammlung relevanter und herausfordernder
Szenarien zu. Methodische Reviews nennen daher Plausibilität ein zentrales
Wirksamkeitskriterium sowohl für die Szenariokonstruktion als auch
für die Nutzung. Dies hat praktische Konsequenzen: Plausibilitätsleitlinien,
welche Szenarien generiert und dargestellt werden, und geben Aufzeigen
zur Beurteilung und Betrachtung von Entscheidungsszenarien vor. Doch Einblicke,
was Szenarioplausibilität wirklich bedeutet und wie sie von verschiedenen
Akteuren, darunter auch Szenarionutzern, erstellt und bewertet wird, ist
noch weitgehend unerforscht Buch adressiert diese konzeptionelle und empirische
Lücke und analysiert das Konzept aus der Perspektive zukünftiger
Szenarionutzer. Der kleine Kreis von Wissenschaftlern, die sich in jüngerer
Zeit mit dem Konzept beschäftigt haben, hat die Plausibilität
vor allem unter dem Aspekt der Szenariokonstruktion betrachtet: Hier wird
Plausibilität entweder durch verfahrensgetriebene Prozesse hergestellt,
z. getriebene Prozesse, was bedeutet, dass beteiligte Stakeholder interaktiv
ein gemeinsames Verständnis der Szenarien koproduzieren. Beide Positionen
vernachlässigen, dass wichtige Szenarionutzergruppen i) häufig
nicht am eigentlichen Bauprozess beteiligt sind, ii) mit mehreren, widersprüchlichen
Szenarien in unterschiedlichen Formaten konfrontiert sind und iii) bei
der Plausibilisierung eines Szenarios folglich unterschiedliche Mechanismen
verfolgen können , wird in diesem Buch folgenden Forschungsfragen
nachgegangen: Wie beurteilen die Anwender von Szenarien die Plausibilität
eines Szenarios? Welche Faktoren beeinflussen die Plausibilitätsbeurteilung
einer Person? Unterscheiden sich die Urteile je nach Szenarioformat? "
Schmidt-Scheele, Ricarda (2019) Applause for Scenarios?! An Explorative
Study of 'Plausibility' as Assessment Criterion in Scenario Planning [Abruf
07.8.2021]
"Plausibility as a concept is omnipresent in the scenario research
literature. Also, practitioners regularly conclude that their planning
processes have revealed ‘plausible scenarios’. The common position is that
for scenario planning exercises to create alternative future pathways,
their selection cannot be simply limited to the most probable ones; neither
does mere possibility allow for a meaningful collection of relevant and
challenging scenarios. Methodological reviews therefore name plausibility
a key effectiveness criterion for both scenario construction and utilisation.
This has practical consequences: Plausibility guides what kind of scenarios
are generated and presented and prescribe how to assess and consider scenarios
for decision-making. Yet, insights into what scenario plausibility really
means and how it is established and assessed by different actors along
a scenario life path is largely unexplored. The present study addresses
this conceptual and empirical gap and analyses the concept from the perspective
of prospective scenario users."
GÜ: "Plausibilität als Konzept ist in
der Literatur der Szenarioforschung allgegenwärtig. Außerdem
kommen Praktiker regelmäßig zu dem Schluss, dass ihre Planung
Prozesse haben „plausible Szenarien“ aufgezeigt. Der gemeinsame Standpunkt
ist, dass für Szenarioplanungsübungen eine alternative Zukunft
geschaffen werden soll deren Auswahl nicht einfach auf die wahrscheinlichsten
beschränkt werden kann; auch lässt die bloße Möglichkeit
keine sinnvolle Sammlung zu relevanter und herausfordernder Szenarien.
Methodische Reviews benennen daher für beide Szenarien die Plausibilität
als zentrales Wirksamkeitskriterium Konstruktion und Nutzung. Dies hat
praktische Konsequenzen: Plausibilität leitet, welche Szenarien generiert
und dargestellt werden und beschreiben, wie Szenarien für die Entscheidungsfindung
zu bewerten und zu berücksichtigen sind. Aber Einblicke, was Szenario-Plausibilität
wirklich bedeutet und wie es ist von verschiedenen Akteuren
entlang eines Lebenswegs eines Szenarios etabliert und bewertet wird, ist
weitgehend unerforscht. Die vorliegende Studie befasst sich mit diesem
konzeptionellen und empirische Lücke und analysiert das Konzept aus
der Perspektive potenzieller Szenarionutzer."
Berres, Manfred (1984) Glaubens- und Plausibilitätsgrade : e. Beitr.
zur Maß- und Integrationstheorie e. Beitr. zur Maß- und Integrationstheorie
UB Erlangen 1 Mikrofiche 24x, Umfang: 85 Bl.;
Böhnert, Martin & Reszke, Paul (2015): „Linguistisch-philosophische Untersuchungen zu Plausibilität: Über kommunikative Grundmuster bei der Entstehung von wissenschaftlichen Tatsachen“ In: Engelschalt, Julia; Maibaum, Arne (Hg.), 2015, Auf der Suche nach den Tatsachen: Proceedings der 1. Tagung des Nachwuchsnetzwerks INSIST, S. 40-67. Permalink: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/45590
Bohn, Irina/ Feuerhelm, Wolfgang & Hamburger, Franz (2000): Die Erzeugung von Plausibilität als Konstruktion von Wirklichkeit. Eine Fallrekonstruktion. Zur Berichterstattung über Sinti und Roma, in: Kraimer, Klaus (Hrsg.): Die Fallrekonstruktion. Sinnverstehen in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 532-560. [Mehr. S.u.R.; Ztg.; Inh.-A.; Inh.; Krim.; Vor.]
Connell, Louise & Keane, Mark T. (2006) A Model of Plausibility.
Cognitive Science 30 (2006) 95–120). [Online]
"Abstrakt Plausibilität spielt bei vielen kognitiven Phänomenen
vom Verstehen bis zur Problemlösung eine entscheidende Rolle.. In
der Kognitionswissenschaft wird Plausibilität jedoch in der Regel
als operationalisierte Variable oder Metrik, anstatt für sich selbst
erklärt oder untersucht zu werden. Dieser Artikel beschreibt ein neues
kognitives Plausibilitätsmodell, das Plausibility Analysis Model (PAM),
das auf Modellierung des menschliches Plausibilitätsurteils abzielt.
Dieses Modell verwendet das Commonsense-Wissen der Konzeptkohärenz,
um den Plausibilitätsgrad eines Zielszenarios zu bestimmen. Im Wesentlichen
ist ein sehr plausibles Szenario, eines, das gut zum Vorwissen passt: mit
vielen verschiedenen Bestätigungsquellen, ohne komplizierte Erklärungen
und mit minimaler Vermutung. Über eine detaillierte Simulation empirischer
Plausibilitätsbefunde wird berichtet,
was eine enge Übereinstimmung zwischen dem Modell und menschlichen
Urteilen zeigt. Darüber hinaus teigt eine Sensitivitätsanalyse,
dass PAM in seinen Operationen robust ist.
Schlüsselwörter: Psychologie; Erkenntnis; Argumentation;
Plausibilität; Computersimulation; Symbolisch Berechnungsmodell" Plausibility
Analysis Model (PAM).
Handstein, Holger (2016) Plausibilität in Journalistikon
"Die Prüfung auf Plausibilität
kann anhand verschiedener Einzelkriterien erfolgen – etwa anhand der Übereinstimmung
eines von einer Quelle oder in einem journalistischen Beitrag behaupteten
Sachverhaltes auf Übereinstimmung mit Naturgesetzen, sozialen Normen
oder den Prinzipien der Logik. Erfüllt eine Information eines oder
mehrere dieser Kriterien nicht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es
sich um eine Falschaussage handelt.
Die Prüfung auf Plausibilität
kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden – zunächst im journalistischen
Arbeitsprozess als Teil der Recherche,
darüber hinaus aber auch während der Rezeption durch das journalistische
Publikum. Insbesondere für dieses ist die Prüfung auf Plausibilität
wichtig, da oftmals kein direkter Zugriff auf die Quellen besteht, die
einem Beitrag zugrunde liegen. Aufgrund dieses Zusammenhangs ist es für
Journalisten wichtig, nicht nur über plausible Informationen
zu verfügen, sondern die Plausibilität
dieser Informationen in ihren Beiträgen auch überzeugend zu vermitteln
– etwa durch einen stringenten inhaltlichen Aufbau von Texten.
Quelle Handstein, Holger (2016) Journalistikon (Abruf
1.7.21: https://journalistikon.de/plausibilitaet/)
- Kommentar:
[04PA/CC 4700 H245 zur Zeit keine Vormerkung möglich Handapparat / 04PA/HA Dr. Jungert]
Kienpointner, Manfred (1992) Alltagslogik.
Struktur und Funktion von Argumentationsmustern.
Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog.
Inhaltsverzeichnis:
I. Semantik und Plausibilität ..................................................
15
II. Typologie plausibler Muster
der Alltagsargumentation .... 166
Sachregister-Einträge: Plausibilität, plausibel 22, 47ff.,
92, 106ff„ 134, 138, 421
Zusammenfassung: "Ziel dieser Arbeit ist
eine umfassende Typologie von Mustern der Alltagsargumentation. Um die
zentralen Begriffe „Gültigkeit“ und „Plausibilität“ zu klären,
werden verschiedene logische und linguistische Ansätze diskutiert
(u. a. die intensionale Logik Carnaps, die Theorien der strukturellen Semantik
von Coseriu, Lyons und Katz, die Semantik möglicher Welten von Lewis,
die Stereotypensemantik von Putnam, die Relevanzlogik von Walton). Indem
schließlich die Gebrauchstheorie der Bedeutung des späten Wittgenstein
zugrundegelegt wird, ergibt sich als Summe dieser Diskussion, daß
jlie, Plausibilität von Alltagsargumentation letztlich auf den Gebrauchsregeln
für sprachliche Ausdrücke in eirier Sprechgemeinschaft beruht.
Daraus folgt ein gemäßigter Relativismus, was Probleme der Wahrheit
und Wahrscheinlichkeit betrifft.
Der Typologie wird als Prototyp elementarer'Muster
der Alltagsargumentation eine modifizierte Fassung des bekannten Toulmin-Schemas
zugrundegelegt. In der Tradition antiker, mittelalterlicher und neuzeitlicher
Typologien, insbesondere der aristotelischen Topik und der klassischen
zeitgenössischen Typologie von„ Perelrnan/Qlbrechts-Tyteca, werden
die einzelnen Argumentationsmuster nach den semantischen Relationen (topoi/loci)
klassifiziert, die den Übergang von den Prämissen zur Konklusion
rechtfertigen. Strengere Standards für Explizitheit und Abgrenzung
von (Sub)Klassen (im Anschluß an Schellens, Van Eemeren/Kruiger)
führen zum Ansatz von etwa 60 Klassen von Mustern, der. Alltagsargumentation.
Als empirische Basis wird ein Korpus von circa 300
Passagen argumentativer Texte verwendet. Die Beispiele stammen überwiegend
aus geschriebenem und gesprochenem Gegenwartsdeutsch; es werden jedoch
auch vereinzelt englische, französische und italienische Beispiele
gegeben, um die übereinzelsprachliche und interkulturelle Relevanz
der Typologie aufzuzeigen. In einem Ausblick werden Möglichkeiten
der praktischen Anwendung der Typologie erörtert (Sprachunterricht,
Sprach- und Kulturvergleich)."
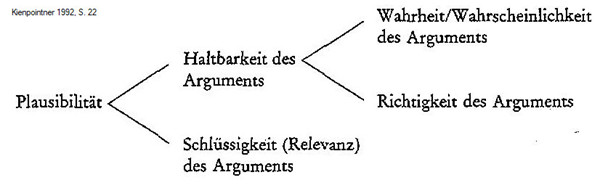
- Kommentar S.22: Die drei Bedingungskriterien für die Plausibiltät
- Haltbarkeit, Schlüssigkeit, Wahrheit/ Wahrscheinlichkieit - werden
nicht erklärt, so dass ein unklarer Begriff, Plausibilität, auf
weitere unklare Begriffe verschoben wird, eine typisch unwissenschaftliche
Praxis der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften.
Zusammenfassung Koch: Der Titel weist aus, dass es um Plausibilität geht. Im Text finden sich sozusagen plausibel ;-) 62 Fundstellen "plausib", wovon man allerdings die 5 Kopfzeilenüberschriften "Versuch über Plausibilität" abziehen sollte, dass inhaltlich 57 Fundstellen resultueren.
S. 193f: "Wenn man davon ausgeht, daß zwischen Pädagogik und Rhetorik eine gewisse Verwandtschaft besteht1, dann wird auch die Frage zu stellen sein, worin denn die Gültigkeit rhetorischer und pädagogischer Aussagen fundiert ist. Was beide „Disziplinen“ betrifft, so kann man häufig, wenn die Wertigkeit von Argumenten angedeutet werden soll, auf den Begriff der Plausibilität stoßen. Denn das Zwingende mathematischer Gewißheit fehlt sowohl der rhetorischen als auch der pädagogischen Argumentation, nicht aber das, was man im allgemeinen durch den Begriff der Plausibilität ausdrückt. Wohl werden Indizien, gute Gründe, Argumente pro et contra, Beweise und Widerlegungen auf beiden Seiten gebraucht, aber Gewißheit und Evidenz findet man in aller Regel nur in den mathematischen Disziplinen. Nur selten (oder vielleicht nie?) haben rhetorische und pädagogische Gründe die Dignität, ihre Gegengründe ins Reich des Unmöglichen verweisen und damit selbst so etwas wie logische Notwendigkeit beanspruchen zu können, aber sie vermögen doch mehr oder weniger, kaum oder überaus „plausibel“ zu sein. Von der „Verwendung plausibler Argumentationsmuster“, von „Plausibilitätspotenzialen“ oder von „Plausibilitätsressourcen“ spricht man in der rhetorischen Argumentationstheorie2 3, von „bedingten Plausibilitätsgewichten heterogener Argumente“ ist in der Theorie pädagogischen Argumentierens die Rede. Plausibilität, so kann man [>194] durchaus sagen, ist nicht nur ein traditioneller, sondern auch ein in den aktuellen Diskussionen geläufiger Begriff, um die Überzeugungskraft, den argumentativen Wert oder schlicht den „Wahrheitswert“ von Behauptungen und Meinungen zu charakterisieren. Auffällig ist indessen, daß dieser Begriff selbst so unbestimmt ist wie das, was er auszudrücken sucht. Jedenfalls trifft man dort, wo er verwendet wird, kaum auf Anstrengungen, sich seiner Bedeutung zu vergewissern. Nicht nur scheint er ein Begriff für Unbestimmtes zu sein, auch er selbst ist unbestimmt. In die einschlägigen philosophischen und wissenschafcstheoretischen Handbücher hat er sich noch nicht verirrt. Es scheint, als wüßte jeder, was er bedeuten soll. Auch scheint es, als ob jeder ihn zu gebrauchen befugt sei, darauf vertrauend, das Rechte zu treffen und von den anderen recht verstanden zu werden. So gewinnt man den Eindruck, daß es sich um einen Common-sense-Begriff handelt, d. h. um einen Begriff,; der sich an den sensus communis, an den „gemeinen“ und „gesunden“; Verstand richtet. Dafür spricht, daß Plausibilität, wörtlich übersetzt,.; soviel wie Beifalls Würdigkeit bedeutet (lat. plausus der Beifall). Wer an Plausibilität orientiert ist, strebt nach dem Beifall eines größeren Publikums, nach öffentlicher Zustimmung."
- Kommentar:
- Kommentar:
- Kommentar:
- Kommentar:
- Kommentar:
Kommentar:
Kuhn-Rahloff, Clemens .(2012) Realitätstreue,
Natürlichkeit, Plausibilität : Perzeptive Beurteilungen in
der Elektroakustik ; ein Beitrag zum Verständnis der "inneren Referenz"
am Beispiel der Plausibilität ausgewählter Wiedergabesysteme
[VT]
Müller, Stephan S. W. (2010) Theorien sozialer Evolution : Zur
Plausibilität dar winistischer Erklärungen sozialen Wandels [VT]
Letztgültige Antworten in der Wissenschaft Was wissen wir wirklich?
2012 wurde das Higgs-Teilchen nachgewiesen. Ist damit nun alles klar?
Mit Beweisen will die Wissenschaft ja die Welt erklären. Der Zusammenhang
von Ursache und Wirkung ist aber doch nicht immer eindeutig belegbar. Reicht
es nicht, wenn Dinge einfach nur plausibel
sind?
„Was ich unter Plausibilität verstehe,
das kann ich Ihnen natürlich sagen! Das Problem ist, dass Sie mich
gefragt haben, was für einen Wissenschaftler denn plausibel
ist? Und da bin ich so ein bisschen unsicher“, sagt Jörg Phil Friedrich.
„Wenn ich mir Beiträge anschaue, in denen der Begriff ´plausibel`
vorkommt, dann wird der Begriff selber nicht definiert“, ergänzt Martin
Böhnert.
Von
Quelle Weyh, Florian Felix (2021.04.01) Letztgültige
Antworten in der Wissenschaft Was wissen wir wirklich? (Abruf 01.07.2021):
https://www.deutschlandfunkkultur.de/letztgueltige-antworten-in-der-wissenschaft-was-wissen-wir.976.de.html?dram:article_id=495081
Kombinationsformen
Plausible Wahrheit
Wilfried Stroh: "Wie Griechen die Rhetorik erfunden haben
"Noch eine wichtige Lehre verdanken wir diesen ältesten Rhetorikern:
In der Rede komme es nicht auf die Wahrheit, sondern auf die Wahrscheinlichkeit
an. Das ist nicht ganz so unmoralisch, wie es scheint. Auch wer für
die Wahrheit streitet, kommt ja nicht darum herum, seine Behauptungen wahrscheinlich
zu machen. Erläutert wird das an einem berühmten Beispiel. Ein
schwacher, aber tapferer Mann, hat einen schwächeren, der aber feige
ist, verprügelt. Nun vor dem Richter darf der Verprügelte als
Kläger nicht die wenig plausible Wahrheit eingestehen, sondern muss
behaupten, der Beklagte habe kräftige Helfer gehabt. Das muss der
Angeklagte widerlegen und besonders darauf insistieren, wie unwahrscheinlich
es doch sei, dass gerade er dies einem Stärkeren angetan habe. Noch
feiner ist die Argumentation, wenn der Stärkere geprügelt hat.
Dann sagt er nämlich: Wie hätte gerade ich prügeln sollen,
wo ich doch sehen musste, dass angesichts meiner Stärke der Verdacht
auf mich fallen musste? Also, eben das, was die Tat wahrscheinlich macht,
macht sie unwahrscheinlich. Diese Art der Argumentumkehrung, die nicht
notwendig unmoralisch ist, bezeichnet Aristoteles mit der Formel „die schwächere
Rede zur stärkeren machen“."
Quelle: https://stroh.userweb.mwn.de/schriften/griechen_rhetorik.pdf
Im Einkauf liegt der Gewinn. Diese einfache aber plausible Wahrheit
trifft ebenso auf den Einkauf von Dienstleistungen zu. Trotz der steigenden
Bedeutung von Dienstleistungen als Einkaufsobjekt wird diesen in der wissenschaftlichen
Literatur eine geringe Aufmerksamkeit zuteil. Die Unternehmen haben die
Kostenpotenziale von Dienstleistungen als Einkaufsgut erkannt, jedoch fehlt
es an adäquaten Konzepten.
Quelle: https://www.tcw.de/publikationen/einkauf-von-dienstleistungen/typenspezifische-gestaltung-des-einkaufsprozesses-325
- Kommentar:
Die erniedrigende Wahrheit
13 | 02 | 2014 TEXT Eric Weigel
"Konfrontiert mit der Möglichkeit, Monogamie sei eine kulturelle
Lüge, erntet man allzu oft eine sonderbar trotzköpfige Empörung.
Dies ist der Moment, bei dem zwar auf rationaler Ebene eine plausible Wahrheit
deutlich wird, aber die mitschwingende Kulturverletzung so groß ist,
dass man etwas lieber „nicht wahr haben will“."
Die Intelligenz entscheidet, wie sich Wahrheit und
Plausibilität zueinander verhalten.
Wahrheit ist plausibel im Verständnis, im Unverständnis
unplausibel.
Ein Akt mangelnder Intelligenz, um nicht zu sagen
unübertroffener Dummheit, ist das Verkünden einer unplausiblen
Wahrheit (selbst nicht plausibel erklären/begründen/darlegen
könnend).
Häufig beobachtbares unplausibles Beispiel:
"Interpretation einer Erfahrung = individuelle Wahrheit".
Plausibel vorausgesetzt wird:
- Wahrheit ist plausibel im jeweiligen Bezug oder
Sachverhalt stets einzig, objektiv, absolut.
- Wahrheit ist unplausibel im jeweiligen Bezug oder
Sachverhalt stets individuell, subjektiv, relativ.
Daraus folgt:
- Unplausible Wahrheit ist wahr im Verständnis
von mangelnder Intelligenz.
- Plausible Wahrheit ist unwahr im Verständnis
von mangelnder Intelligenz.
- Unplausible Wahrheit ist Produkt von mangelnder
Intelligenz.
- Plausible Wahrheit ist Produkt von genügender
Intelligenz.
Mangelnde Intelligenz kann nur im Zusammenhang mit
Individualität beobachtet werden.
(Wahrheit ist unplausibel im jeweiligen Bezug oder
Sachverhalt stets individuell.)
Genügende Intelligenz ist unauffällig
bzw. unsichtbar bzw. nicht zu beobachten im Zusammenhang mit Individualität.
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.
Juli 2020
Quelle: https://www.esoterikforum.at/threads/wahrheit-und-plausibilitaet.233321/
- Kommentar:
Das Schemenhafte im Sucher eines Existenzialisten
"... Seine hybriden Bilder aus gemalten Figuren und abstrakten Objekten
auf Fotografien von Stadt-, Architektur-, Innenraum und Naturlandschaften
vermitteln keine plausible Wahrheit oder augenfällige Geschichte und
beruhen auch nicht auf technischen Tricks. ..."
Quelle: https://www.mathiasguentner.com/uploads/userfiles/files/K%C3%BCnstlertexte/Marc%20L%C3%BCders/Das%20Schemenhafte.pdf
Wenn der Terror zum Entertainment wird
"United 93, Hollywoods erster Film über den 11. September: Kein
Nationalepos, sondern scharfe Kritik an Militär und Regierung
.... Zwar ist der Regierungsbericht zum 11. September Grundlage für
das Filmskript für United 93, aber ob Passagiere tatsächlich
mit einem Servierwagen die Tür zum Cockpit rammten, ist Spekulation.
Genauso, ob tatsächlich der Kongress angesteuert werden sollte. Eine
plausible Wahrheit, wie Paul Greengras sie anstrebt, reicht den Hinterbliebenen
nicht. Sie wollen Fotorealismus - und eine Art Monopol auf die Erinnerungskultur.
Nichts davon werden sie erhalten. "
Quelle: Thomas Kleine-Brockhoff (ZEIT ONLINE);
https://www.zeit.de/2006/19/Wenn_der_Terror_zum_Entertainment_wird/komplettansicht
Plausibility im Angloamerikanischen
What is the meaning of plausibility?
adjective. having an appearance of truth or reason; seemingly worthy
of approval or acceptance; credible; believable: a plausible excuse; a
plausible plot. well-spoken and apparently, but often deceptively, worthy
of confidence or trust: a plausible commentator.
GÜ: "Adjektiv. einen Anschein von Wahrheit oder Vernunft haben;
scheinbar der Zustimmung oder Akzeptanz würdig; glaubwürdig;
glaubwürdig: eine plausible Entschuldigung; eine plausible Handlung.
gut gesprochen und scheinbar, aber oft täuschend, vertrauens- oder
vertrauenswürdig: ein plausibler Kommentator. "
Story schemes ideally model the way things tend to happen in the world.
4 We use the terms coherence and plausibility interchangeably: a story
is coherent if it adheres to (i.e. is anchored in) plausible common-sense
knowledge and being more coherent makes a story more plausible.
GÜ: Story-Schemata modellieren idealerweise die Art und Weise,
wie Dinge in der Welt passieren. 4 Wir verwenden die Begriffe Kohärenz
und Plausibilität synonym: Eine Geschichte ist kohärent, wenn
sie an plausiblem Common-Sense-Wissen festhält.
Quelle Abruf 10.08.2021: https://www.mvorganizing.org/what-is-the-meaning-of-plausibility/
Reazul H. Russel, Tianyi Gu, Marek Petrik () Robust Exploration with
Tight Bayesian Plausibility Sets. [PDF]
Abstract Optimism about the poorly understood states
and actions is the main driving force of exploration for many provably-efficient
rein-
forcement learning algorithms. We propose optimism in the face of sensible
value functions (OFVF)- a novel data-driven Bayesian
algorithm to constructing Plausibility sets for MDPs to explore robustly
minimizing the worst case exploration cost. The method
computes policies with tighter optimistic estimates for exploration
by introducing two new ideas. First, it is based on Bayesian
posterior distributions rather than distribution-free bounds. Second,
OFVF does not construct plausibility sets as simple confidence
intervals. Confidence intervals as plausibility sets are a sufficient
but not a necessary condition. OFVF uses the structure of the value
function to optimize the location and shape of the plausibility set
to guarantee upper bounds directly without necessarily enforcing
the requirement for the set to be a confidence interval. OFVF proceeds
in an episodic manner, where the duration of the episode
is fixed and known. Our algorithm is inherently Bayesian and can leverage
prior information. Our theoretical analysis shows the
robustness of OFVF, and the empirical results demonstrate its practical
promise.
GÜ: Abstrakt Optimismus hinsichtlich der schlecht
verstandenen Zustände und Handlungen ist die Hauptantriebskraft der
Erforschung für viele nachweislich effiziente Algorithmen zum Erzwingen
des Lernens. Wir schlagen Optimismus angesichts sinnvoller Wertfunktionen
(OFVF) vor – ein neuartiger datengesteuerter Bayesian Algorithmus zum Konstruieren
von Plausibilitätssätzen für MDPs zur robusten Minimierung
der Explorationskosten im schlimmsten Fall. Die Methode berechnet Richtlinien
mit strengeren optimistischen Schätzungen für die Exploration,
indem zwei neue Ideen eingeführt werden. Erstens basiert es auf Bayesian
Posterior-Verteilungen statt verteilungsfreie Grenzen. Zweitens konstruiert
OFVF keine Plausibilitätsmengen als einfaches Vertrauen Intervalle.
Konfidenzintervalle als Plausibilitätsmengen sind eine hinreichende,
aber keine notwendige Bedingung. OFVF verwendet die Struktur des Wertes
Funktion zur Optimierung der Lage und Form des Plausibilitätssatzes,
um Obergrenzen direkt zu garantieren, ohne sie unbedingt zu erzwingen die
Anforderung, dass die Menge ein Konfidenzintervall ist. OFVF verläuft
episodisch, wobei die Dauer der Episode
ist fest und bekannt. Unser Algorithmus ist von Natur aus Bayesian
und kann Vorinformationen nutzen. Unsere theoretische Analyse zeigt die
Robustheit von OFVF, und die empirischen Ergebnisse zeigen, dass es
in der Praxis vielversprechend ist.
Reasoning beyond predictive validity: the role of plausibility in decision-supporting
social simulation
Abstract:
Practical and philosophical arguments speak against predictability
in social systems, and consequently against the predictive validity of
social simulations. This deficit is tolerable for description, exploration,
and theory construction but serious for all kinds of decision support.
The value of plausibility, however, as the most obvious substitute for
predictive validity, is disputed for good reasons: it lacks the solid grounds
of objectivity. Hence, on the one hand, plausibility seems to be in contradiction
to scientific inquiry in general. On the other hand, plausibility is paramount
and ubiquitous in practical decision making. The article redefines plausibility
in order to render it more precise than colloquial usage. Based on the
experiences with military applications different lines of reasoning with
plausible trajectories based on computer simulation are analyzed. It is
argued that the rationale behind such reasoning is often substantially
stronger than a mere subjective expert opinion can be.
GÜ: Abstrakt:
Praktische und philosophische Argumente sprechen gegen die Vorhersagbarkeit
in sozialen Systemen und damit gegen die prädiktive Validität
sozialer Simulationen. Dieses Defizit ist für Beschreibung, Exploration
und Theoriebildung tolerierbar, aber gravierend für alle Arten der
Entscheidungsunterstützung. Der Wert der Plausibilität als naheliegendster
Ersatz für prädiktive Validität ist jedoch aus guten Gründen
umstritten: ihr fehlt die solide Grundlage der Objektivität. Einerseits
scheint Plausibilität also im Widerspruch zur wissenschaftlichen Untersuchung
im Allgemeinen zu stehen. Andererseits ist Plausibilität bei der praktischen
Entscheidungsfindung von größter Bedeutung und allgegenwärtig.
Der Artikel definiert Plausibilität neu, um sie präziser als
umgangssprachlich zu machen. Basierend auf den Erfahrungen mit militärischen
Anwendungen werden verschiedene Argumentationslinien mit plausiblen Trajektorien
basierend auf Computersimulationen analysiert. Es wird argumentiert, dass
die Begründung einer solchen Argumentation oft wesentlich stärker
ist, als es eine bloß subjektive Expertenmeinung sein kann.
Measuring the plausibility of explanatory hypotheses
Published online by Cambridge University Press: 04 February 2010
Generating plausible diagnostic hypotheses with self-processing causal
networks
JONATHAN WALD
, MARTIN FARACH
, MALLE TAGAMETS
& JAMES A. REGGIA
Abstract A recently proposed connectionist methodology
for diagnostic problem-solving is critically examined for its ability to
construct problem solutions. A sizeable causal network (56 manifestation
nodes, 26 disorder nodes, 384 causal links) served as the basis of experimental
simulations. Initial results were discouraging, with less than two-thirds
of simulations leading to stable solution states (equilibria). Examination
of these simulation results identified a critical period during simulations,
and analysis of the connectionist model's activation rule during this period
led to an understanding of the model's non-stable oscillatory behavior.
Slower decrease in the model's control parameter during the critical period
resulted in all simulations reaching a stable equilibrium with plausible
problem solutions. As a consequence of this work, it is possible to determine
more rationally a schedule for control parameter variation during problem
solving, and the way is now open for real-world experimental assessment
of this problem-solving method.
GÜ: Abstrakt Eine kürzlich vorgeschlagene
konnektionistische Methodik zur diagnostischen Problemlösung wird
kritisch auf ihre Fähigkeit hin untersucht, Problemlösungen zu
konstruieren. Als Grundlage für experimentelle Simulationen diente
ein umfangreiches Kausalnetzwerk (56 Manifestationsknoten, 26 Störungsknoten,
384 Kausalzusammenhänge). Die ersten Ergebnisse waren entmutigend,
da weniger als zwei Drittel der Simulationen zu stabilen Lösungszuständen
(Gleichgewichten) führten. Die Untersuchung dieser Simulationsergebnisse
identifizierte eine kritische Periode während der Simulationen, und
die Analyse der Aktivierungsregel des konnektionistischen Modells während
dieser Periode führte zu einem Verständnis des instabilen Schwingungsverhaltens
des Modells. Eine langsamere Abnahme der Steuerungsparameter des Modells
während der kritischen Phase führte dazu, dass alle Simulationen
ein stabiles Gleichgewicht mit plausiblen Problemlösungen erreichten.
Als Folge dieser Arbeit ist es möglich, einen Zeitplan für die
Variation von Kontrollparametern während der Problemlösung rationaler
zu bestimmen, und der Weg ist nun offen für eine reale experimentelle
Bewertung dieser Problemlösungsmethode.
Eigene Untersuchungen
Suche bei De Gruyter am 10.08.2021
Ergebnisse 10 von mehr als 10000 Einträgen für plausibility
Zugang
Alle zugänglichen Inhalte
Open Access und freier Zugang
Alle
Dokumenttyp
Artikel28934
Kapitel8965
Referenzeintrag533
Bibliographischer Eintrag453
Buch127
Datum
Älter29765
Letzte 5 Jahre9238
Letztes Jahr1687
Vorab veröffentlicht9
Fachgebiet
Linguistik und Semiotik10064
Theorien und Fachgebiete7018
Geschichte5741
Altertumswissenschaften4354
Philosophie4270
Wirtschaftswissenschaften4177
Sozialwissenschaften4147
Historische Epochen4005
Literaturwissenschaft3641
Theologie und Religion3637
Verlag
De Gruyter23629
De Gruyter Mouton6451
De Gruyter Oldenbourg3411
transcript1350
Princeton University Press534
De Gruyter Saur481
Cornell University Press353
Gütersloher Verlagshaus264
University of California Press222
Columbia University Press213
Sprache
Englisch25631
Deutsch14319
Französisch841
Spanisch414
Italienisch357
Portugiesisch31
Griechisch21
Latein15
Niederländisch8
Russisch8
Beispiele zur Plausibilitätsanalyse
Zu jedem Erkennen gehört eine erkennendes System und ein zu erkennender Sachverhalt. Was muss vorausgesetzt werden, damit ein Erkennen möglich ist? Unter welchen Umständen nennen wir ein Erkennen plausibel?
Herr A. am Freitag gewöhnlich zum Stamtisch. Heute Montag. Es ist plausibel, dass Herr heute nicht beim Stammtisch ist.
Ein Teil des Zimmers ist nicht tapeziert, schon gut ein Viertaljahr
lang.Aus dieser Tatsache lässt sich nicht schließen, welche
plausiblen Gründe es dafür geben könnte. Denn es gibt eine
ganze Reihe von Möglichkeiten, die überdies auch noch zusammenspielen
könnten.
Möglichkeiten: (1) Der Bewohner hatte keine Lust mehr. (2) Der
Bewohner hatte kein Geld für den Tapetenkauf. (3) Der Bewohner war
krank und konnte nicht so. (4) Die fehlende Tapete ist zur Zeit nicht lieferbar.
(5) Dem Bewohnen fehlen die Tapezierwerkzeuge Tisch, Leim, Einstreichpinsel
Bürste. Der Bewohner ist sich nicht sicher, ob ihm die Tapete dauerhaft
gefällt.
Man sieht gar keinen Mond am Nachthimmel.
Obwohl es früher Nachmittag ist, ist die Sonne nicht zu sehen.
Da steht ein Baum.
Diskussion: Die Plausibilitätsfrage stellt sich hier in der Regel
nicht. Die Ausage ist wahr oder falsch aber nicht plausibel oder unplausibel.
Das wird anders, wenn Zusatzinformation hinzukommt. Etwa Auf dem Mond steht
ein Baum. Oder Mitten in der Wüste steht ein Baum.
Dort ist ein Baum umgefallen.
Diskussion: Die Plausibilitätsfrage stellt sich hier in der Regel
nicht. Die Ausage ist wahr oder falsch aber nicht plausibel oder unplausibel.
Erst wenn es um Erklärungen geht, warum der Baum umgefallen ist, kommt
Plausibilität ins Spiel.
Es regnet seit Stunden.
Diskussion: Die Plausibilitätsfrage stellt sich hier in der Regel
nicht. Die Ausage ist wahr oder falsch aber nicht plausibel oder unplausibel.
Erst bei Zusatzinformationen kann sich die Plausibilitätsbeurteilung
ändern, wenn etwa bekannt wird, dass es sich um eine sehr trockene
Region in der Trockenzeit handelt. Erst wenn es um Erklärungen geht,
warum es seit Stunden regnet, kommt Plausibilität ins Spiel.
Die Autobahn ist gesperrt.
Es werden die Lichter eingeschaltet.
Beim Nachbarn wurde eingebrochen wobwohl er gut und mehrfach gesichert
ist.
Diskussion: Die Plausibilitätsfrage stellt sich hier in der Regel
nicht. Die Ausage ist wahr oder falsch aber nicht plausibel oder unplausibel.
Beim Nachbarn wurde anscheinend ohne Aufbruchspuren eingebrochen.
Diskussion: Hier mag man sich fragen: kann das sein, dass eingebrochen
wird ohne Aufbruchspuren? Die Plausibilitätsfrage passt zwar nicht
so recht. In einem ersten Impuls, mag man dies für unplausibel halten.
Mehr noch, wenn man bedenkt, dass die Polizei darauf besteht, dass es immer
Spuren gibt. Die Frage ist dann natürlich, wie nach Spuren gesucht
wurde.
Ergänzende Analyse und Darstellung der Fragebogensachverhalte
II. Jetzt geht es um die „Gretchenfrage“: wodurch kann etwas plausibel“
werden?
Plausibel bewegt sich zwischen möglich und fast sicher; sicher
und unmöglich gehören nicht dazu.
Prüfungshilfe: S: Was ist der Sachverhalt? P: Was soll plausibel sein? G: Warum soll es plausibel sein? Erläuterung: S: P: G:
01 Ein Sachverhalt ist eher plausibel, wenn es einen Grund für
ihn gibt, z.B.
die Straße ist nass, weil es geregnet hat. Erläuterung:
S: Beschaffenheit der
Straße. P: nasse Straße. G: Regen.
02 Ein Sachverhalt ist umso plausibler je mehr Gründe man für
ihn anführen
kann, er war der Täter, weil er die Gelegenheit, Fähigkeit
und ein Motiv hatte.
Erläuterung: S: Täterschaftsfrage. P: Zuordnung zu "er".
G: Gelegenheit,
Fähigkeit, Motiv.
03 Ein Sachverhalt ist umso plausibler je mehr unabhängige Gründe
es gibt,
sie mietete die Wohnung, weil Preis, Lage und Verkehrsanbindung passten.
Erläuterung: S: Wohnungsfrage. P: Mietentscheidung. G: Preis,
Lage und
Verkehrsanbindung
04 Damit ein Sachverhalt plausibel sein kann, muss er möglich sein,
z.B. beim Heimkommen den Lichtschalter betätigen. Erläuterung:
S: Lichtfrage. P: Licht anmachen. G: Lichtanlage muss funktionieren,
sonst geht Licht anmachen nicht.
05 Wenn der gleiche Sachverhalt schon einmal aufgetreten ist, ist er
eher
plausibel, z.B. das Auto sprang nicht an, weil die Elektrik gestört
war.
Erläuterung: S: Auto anlassen funktioniert nicht. P: Elektrik
gestört.
G: schon mal aufgetreten.
06 Tritt ein Sachverhalt mehrfach auf, macht es ihn plausibler, z.B.
das Auto sprang mehrfach nicht an, weil die Elektrik mehrfach gestört
war. Erläuterung: S: Auto anlassen funktioniert nicht. P: Elektrik
gestört.
G: schon öfter aufgetreten.
07 Tritt ein Sachverhalt oft auf, gibt es mehr Plausibilität für
sein Eintreten, z.B.
kündigt Gluckern baldigen Wasserrückfluss durch Rohrverstopfung
an.
Erläuterung: S: Gluckern. P: drohender Wasserrückfluss. G:
zunehmende
Verstopfung.
08 Wenn ein ähnlicher Sachverhalt schon einmal aufgetreten ist,
ist er eher
plausibel, z.B. etwas vor sich herschieben, weil es unangenehm ist.
Erläuterung: S: Unangenehmes. P: vor sich herschieben. G: schon
mal
vorgekommen.
09 Tritt ein Sachverhalt sehr selten auf, gibt es weniger Plausibilität
für sein
Ereignen, z.B. es ist dunkel geworden aber nicht wegen einer Sonnenfinsternis
Erläuterung: S: dunkel geworden. P: nicht wegen einer Sonnenfinsternis.
G: weil sehr seltenes Ereugnis. Plausibler: es wird Nacht, Sonne hinter
den
Wolken verschwunden, dunkle Wolken ziehen auf.
10 Wenn ein Sachverhalt den Naturgesetzen widerspricht, hat er keine
Plausibilität, z.B. Gegenstände fallen nach oben. Erläuterung:
S: Fallrichtung
P: nach oben fallen. G: widerspricht den Schwerkraftgesetzen.
11 Wenn ein Sachverhalt den allgemeinen Erfahrungen widerspricht hat
er
wenig Plausibilität, z.B. es ließ sie kalt, dass alle ihren
Geburtstag vergaßen.
Erläuterung: S: Geburtstag alle vergessen P: kalt lassen. G: widerspricht
den
allgemeinen Erfahrungen. Plausibel wäre Enttäuschung, Trauer.
12 Ein allgemein bekannter Sachverhalt des Alltagslebens ist plausibel,
z.B.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Erläuterung:
S: Resonanz, Reaktion. P: ähnlich der Aktion. G: allgemeine bekannte
Lebensregel wie Sozialbeziehungen funktionieren.
13 Je mehr Menschen unabhängig voneinander einen Sachverhalt für
plausibel
halten, desto plausibler ist er, z.B. wenn viele glauben, dass PolitikerInnen
sich
oft nicht an ihre Versprechen halten, wenn sie gewählt sind. Erläuterung:
S: Mehrheitsmeinung. P: nicht mehr an Versprechen halten nach der Wahl.
G: Erfahrungen mit PolitkerInnen.
14 Ein Sachverhalt A, der regelhaft mit einem anderen Sachverhalt B
verbunden ist, ist plausibler, wenn B eingetreten ist, z.B. dass man
Lohn
erhält, wenn man arbeitet. Erläuterung: S: Arbeiten. P:
Lohn erhalten
für arbeiten. G: regelhaft üblich.
15 Ein Sachverhalt A (Regenvorhersage), wird plausibler, wenn er regelhaft
mit mehreren anderen Sachverhalten B (Luftdruck), C (Feuchtigkeit),
D (Wind),
E (Bewölkung), … verbunden ist. Erläuterung: S: Regenvorhersage.
P: regelhafter
Zusammenhang. G: durch Berücksichtigung mehrerer Regenvorhersagekriterien.
Weniger plausible Methoden: schnuppern, einfach so meinen.
16 Wahrscheinliches ist plausibler, z.B. dass man auf Eis eher ausrutscht
als auf trockenem Boden. Erläuterung: S: sich auf Eis gegenüber
trockenem
Boden bewegen. P: größere Ausrutschgefahr. G: Lebenserfahrung.
17 Vernünftiges ist plausibler, z.B. ist es bei belebtem Verkehr
vernünftig,
an der roten Ampel zu halten. Erläuterung: S: Verhalten bei belebtem
Verkehr an der roten Ampel P: halten. G: weil es vernünftig
ist, wenn
jemandem etwas an seiner Unversehrtheit liegt.
18 Plausibel ist, was der gesunde Menschenverstand dafür hält,
z.B.
Schul- und Ausbildung, Arbeit und Fleiß sind meist eine gute
Grundlage
für Wohlstand. Erläuterung: S: Schul- und Ausbildung, Arbeit
und Fleiß.
P: meist eine gute Grundlage für Wohlstand. G: GMV ist dieser
Meinung.
*** Neu / weitere:
19 Plausibel ist ein Sachverhalt, wenn er von einer anerkannten Autorität
mitgeteilt wird, der deutsche Wetterdienst gibt eine Sturmwarnung heraus.
Erläuterung: S: Sturm P: Warnung. G: Expertenbefund.
Theorie der guten Gründe
Psychologie der Überzeugung
Wann überzeugt uns etwas?
"Plausibel" als überflüssiges Füllsel
Bleibt eine Äußerung verständlich, wenn man das Wort
"plausibel" / "Plausibilität" entfernt, hat es keine wirkliche Bedeutung
und kann als Füllsel angesehen werden, das keine weitere kognitive
Aufmerksamkeit verlangt.
Gedanken
Was gehört zur Plausibilität?
Eine gewisse Unsicherheit
Eine realistische (nicht theworetische) Möglichkeit
Muss es etwas schon einmal gegeben haben, damit es plausible beurteilt
werden darf?
Plausibilitätskriterien und Prüfmethoden
"Die Prüfung auf Plausibilität kann anhand verschiedener Einzelkriterien
erfolgen – etwa anhand der Übereinstimmung eines von einer Quelle
oder in einem journalistischen Beitrag behaupteten Sachverhaltes auf Übereinstimmung
mit Naturgesetzen, sozialen Normen oder den Prinzipien der Logik. Erfüllt
eine Information eines oder mehrere dieser Kriterien nicht, steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Falschaussage handelt."
Quelle Jornalistikon (Abruf 1.7.21: https://journalistikon.de/plausibilitaet/)
| Realisation H0 | Alternativen Hypoth | Stützende Sachverh. | Mindernde Sachverh. | Verursacher | |
| möglich unklar
möglich schon geschehen mehrmals geschehen oft geschehen |
H1
H2 ... ... Hn |
SSV1
SSV2 ... ... SSVn |
MSV1
MSV2 ... ... MSVn |
Motiv
Gelegenheit Fähigkeit
|
PK01 Ein Sachverhalt ist eher plausibel, wenn es einen [guten] Grund
für ihn gibt. Standard-Beispiel BPK-:
PK02 Ein Sachverhalt ist eher umso plausibler je mehr [gute] Gründe
man für ihn anführen kann. Standard-Beispiel BPK-02:
PK03 Ein Sachverhalt ist umso plausibler je mehr unabhängige [gute]
Gründe man für ihn anführen kann. Standard-Beispiel BPK-03:
PK04 Damit ein Sachverhalt plausibel sein kann, muss er möglich
sein können. Möglichkeit ist eine notwendige Bedingung für
Plausibilität. Standard-Beispiel BPK-04:
PK05 Wenn der gleiche ein Sachverhalt schon einmal aufgetreten ist,
gibt es eine Elementarplausibilität. Standard-Beispiel BPK-05:
PK06 Wenn ein sehr ähnlicher Sachverhalt schon einmal aufgetreten
ist, gibt es eine Ähnlichkeitsplausibilität. Standard-Beispiel
BPK-06:
PK07 Tritt ein Sachverhalt mehrfach auf, gibt es mehr Elementarplausibilität.
Standard-Beispiel BPK-07:
PK08 Tritt ein Sachverhalt oft auf, gibt es mehr Plausibilität
für sein Eingetreten sein. Standard-Beispiel BPK-08:
PK09 Tritt ein Sachverhalt sehr selten auf, gibt es weniger Plausibilität
für sein Eingetreten sein. Standard-Beispiel BPK-09:
PK10 Wenn ein Sachverhalt den Naturgesetzen widerspricht, hat er keine
Plausibilität. Standard-Beispiel BPK-10:
PK11 Wenn ein Sachverhalt den allgemeinen Erfahrungen widerspricht
hat er wenig Plausibilität. Standard-Beispiel BPK-11 :
PK12 Ein allgemein bekannter Sachverhalt des Alltagslebens hat eine
gewisse Alltagsplausibilität. Standard-Beispiel BPK-12:
PK13 Je mehr Menschen unabhängig voneinander einen Sachverhalt
für plausibel halten, desto stärkere Plausibilität bringt
er mit (Mehrheitsplausibilität). Standard-Beispiel BPK-13:
PK14 Ein Sachverhalt S1, der regelhaft mit einem anderen Sachverhalt
S2 verbunden ist, ist plausibler, wenn S2 eingetreten ist. Standard-Beispiel
BPK-14:
PK15 Ein Sachverhalt S1, der regelhaft mit mehreren anderen Sachverhalt
S2, S3, ... verbunden ist, ist plausibler, wenn S2, S3, ... eingetreten
sind. Standard-Beispiel BPK-14:
Damit ein Sachverhalt plausibel sein kann, muss
Damit ein Sachverhalt plausibel sein kann, muss
Handelt es sich um einen allgemein bekannten Sachverhalt, kann eine
Bezugnahme plausibel genannt werden. Hier ist dann allerdings noch operational
zu bestimmen, wie man feststellt, ob ein Sachverhalt ein allgemein bekannter
ist. Der Kiosk macht unter der Woche um 7.00 Uhr auf. Jetzt ist es 8.00,
also ist es plausibel dass er offen hat. Der allgemein bekannte Sachverhalt
ist, dass Läden zu den ausgwiesenen Öffnungszeiten offen haben.
Alltagsschlüsse
Wenn etwas so und so ist, dann bedeutet das gewöhnlich ...
Geschichten
P. ist im Wiesengrund. In einem Busch biegen sich die Zweige und es
raschelt. Ein leichter Wind ist zu spüren. Wie plausibel ist es, dass
sich die Zweige biegen, weil
- ein Vogel die Zweige zum Biegen bringt, wodurch es raschelt.
- der leichte Wind die Zweige zum verbiegen bringt
- ein Vogel und der leichte Wind bringen die Zweige zum Biegen und rascheln
- weder ein Vogel noch der Wind haben etwas mit dem Biegen der Zweige un dem Rascheln zu tun
plausibel, weil ich das schon erlebt habe
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Argument, Grund, Indiz, Beweis, Begründung, Erklärung, Bestätigung,
Rechtfertigung.
Möglich und plausibel
"Was ist der Unterschied zwischen möglich und plausibel und wann
sollte ich sie verwenden?
Posted on Januar 29, 2021 by admin"
https://juttadolle.com/was-ist-der-unterschied-zwischen-moeglich-und-plausibel-und-wann-sollte-ich-sie-verwenden/
Eine unmögliche Tatsache ist ein Widerspruch. Das Gedicht Christian
Morgensterns (1910) "Die unmögliche Tatsache" löst diesen Widerspruch
mit den zwei berühmten letzten Zeilen: "Weil, so schließt er
messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf." Die Tatsache wird
ent-tatsacht, indem sie für unmöglich erklärt wird. Allerdings
bleibt der sprachliche Widerspruch bestehen. Dabei enthält das Gedicht
weitere Widersprüche. Aus überfahren folgt nicht unbedingt tot
sein, was auch zum Ausdruck gebracht wird: ""Wie wahr, spricht, sich erhebend
und entschlossen weiterlebend". Es geht dann um die möglichen Ursachen
für das Überfahren: falsche Polizeivorschrift, Missachtung der
Gesetze? Schlielich kommt er im letzten Vers zu der Deutung: "Und er kommt
zu dem Ergebnis, Nur ein Traum war das Erlebnis, Weil, so schließ
er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf." Die Botschaft lautet:
Was nicht sein darf, kann sich nicht ereignen, daher kann das Erleben nicht
die Wirklichkeit wiedergeben, sondern einen Traum. Rein psychologische
könnte es natürlich auch eine Phantasie oder eine Halluzination
sein.
Plausibilität in der Musik
Paukenschlag: plausibel zum a) Wachrütteln, b) Auftakt, c) Schluss,
d) .....
Schönbergs Tonleiter nicht plausibel in Bezug auf "unser" (westliches
Harmonieempfinden
Plausibel zum Anlass Trauermusik zur Beerdigung, Hochzeitsmarsch zur
Heirat, "Träumerei" zur Träumerei, Eon Prosit ... zur Kirchweih
Dramatische Entwicklung: leiser- lauter, schneller ....
Literatur (Auswahl)
- Berk, Ulrich (1979) Konstruktive Argumentationstheorie. Stuttgart-Bad Cannstatt: tfrommann-holzboog.
- Berres, Manfred (1984) Glaubens- und Plausibilitätsgrade : e. Beitr. zur Maß- und Integrationstheorie e. Beitr. zur Maß- und Integrationstheorie
- Böhnert, Martin & Reszke, Paul (): „Linguistisch-philosophische Untersuchungen zu Plausibilität: Über kommunikative Grundmuster bei der Entstehung von wissenschaftlichen Tatsachen“ In: Engelschalt, Julia; Maibaum, Arne (Hg.), 2015, Auf der Suche nach den Tatsachen: Proceedings der 1. Tagung des Nachwuchsnetzwerks INSIST, S. 40-67. Permalink: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/45590
- Bohn, Irina/ Feuerhelm, Wolfgang & Hamburger, Franz (2000): Die Erzeugung von Plausibilität als Konstruktion von Wirklichkeit. Eine Fallrekonstruktion. Zur Berichterstattung über Sinti und Roma, in: Kraimer, Klaus (Hrsg.): Die Fallrekonstruktion. Sinnverstehen in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 532-560. [Mehr. S.u.R.; Ztg.; Inh.-A.; Inh.; Krim.; Vor.]
- Hannken-Illjes, Kati (2018) Einführung in die Theorie und Analyse der Argumentation. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Koch, Lutz (2002) „Versuch über Plausibilität.“ In: Rhetorik Argumentation Geltung, von Andreas Dörpinghaus und Karl Helmer. Würzburg: Könighausen & Neumann, 2002, 193-204.
- Klärner, Holger. Der Schluß auf die beste Erklärung. Berlin: de Gruyter, 2003.
- Kuhn-Rahloff, Clemens .(2012) Realitätstreue, Natürlichkeit, Plausibilität : Perzeptive Beurteilungen in der Elektroakustik ; ein Beitrag zum Verständnis der "inneren Referenz" am Beispiel der Plausibilität ausgewählter Wiedergabesysteme [VT]
- Kienpointner, Manfred (1992) Alltagslogik. Struktur und Funktion von Argumenta-tionsmustern.Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog.
- Plausibility Analysis Model (PAM): Collins/Michalski 1989 > Connell/Keane (2000; 2004; 2006; Cognitive Science 30 (2006) 95–120). [Online] "Abstrakt Plausibilität spielt bei vielen kognitiven Phänomenen vom Verstehen bis zur Problemlösung eine entscheidende Rolle.. In der Kognitionswissenschaft wird Plausibilität jedoch in der Regel als operationalisierte Variable oder Metrik, anstatt für sich selbst erklärt oder untersucht zu werden. Dieser Artikel beschreibt ein neues kognitives Plausibilitätsmodell, das Plausibility Analysis Model (PAM), das auf Modellierung des menschliches Plausibilitätsurteils abzielt. Dieses Modell verwendet das Commonsense-Wissen der Konzeptkohärenz, um den Plausibilitätsgrad eines Zielszenarios zu bestimmen. Im Wesentlichen ist ein sehr plausibles Szenario, eines, das gut zum Vorwissen passt: mit vielen verschiedenen Bestätigungsquellen, ohne komplizierte Erklärungen und mit minimaler Vermutung. Über eine detaillierte Simulation empirischer Plausibilitätsbefunde wird berichtet,
UB Erlangen 1 Mikrofiche 24x, Umfang: 85 Bl.;
Hannken-Illjes, Kati (2018) Einführung in die Theorie und Analyse der Argumentation. Tübingen: Narr Francke Attempto.
[04PA/CC 4700 H245 zur Zeit keine Vormerkung möglich Handapparat / 04PA/HA Dr. Jungert]
[04PA/CC 4700 H245 zur Zeit keine Vormerkung möglich Handapparat / 04PA/HA Dr. Jungert]
Müller, Stephan S. W. (2010) Theorien sozialer Evolution : Zur Plausibilität dar winistischer Erklärungen sozialen Wandels [VT]
was eine enge Übereinstimmung zwischen dem Modell und menschlichen Urteilen zeigt. Darüber hinaus teigt eine Sensitivitätsanalyse, dass PAM in seinen Operationen robust ist.
Schlüsselwörter: Psychologie; Erkenntnis; Argumentation; Plausibilität; Computersimulation; Symbolisch Berechnungsmodell "
Abstract: Plausibility has been implicated as playing a critical role in many cognitive phenomena from comprehension to problem solving. Yet, across cognitive science, plausibility is usually treated as an operationalized variable or metric rather than being explained or studied in itself. This article describes a new cognitive model of plausibility, the Plausibility Analysis Model (PAM), which is aimed at modeling human plausibility judgment. This model uses commonsense knowledge of concept–coherence to determine the degree of plausibility of a target scenario. In essence, a highly plausible scenario is one that fits prior knowledge well: with many different sources of corroboration, without complexity of explanation, and with minimal conjecture. A detailed simulation of empirical plausibility findings is reported, which shows a close correspondence between the model and human judgments. In addition, a sensitivity analysis demonstrates that PAM is robust in its operations.
Der Plausibilität wird bei vielen kognitiven Phänomenen - vom Verstehen bis zum Problemlösen - eine entscheidende Rolle zugeschrieben. Doch in der gesamten Kognitionswissenschaft wird Plausibilität jedoch in der Regel als eine operationalisierte Variable oder Metrik behandelt, anstatt als solche erklärt oder untersucht zu werden. Dieser Artikel beschreibt ein neues kognitives Modell der Plausibilität, das Plausibilitätsanalyse-Modell (PAM), das darauf abzielt, das menschliche Plausibilitätsurteil zu modellieren. Dieses Modell nutzt das Wissen um die Konzeptkohärenz, um den Grad der Plausibilität eines Zielszenarios zu bestimmen. Im Wesentlichen ist ein hoch plausibles Szenario eines, das gut zum Vorwissen passt: mit vielen verschiedenen Bestätigungsquellen, ohne komplexe Erklärungen und mit minimalen Konjekturen. Es wird über eine detaillierte Simulation empirischer Plausibilitätsergebnisse berichtet, die eine enge Übereinstimmung zwischen dem Modell und menschlichen Einschätzungen zeigt. Darüber hinaus zeigt eine Sensitivitätsanalyse, dass PAM in seinen Operationen robust ist.
Plausibility has been used in theoretical and computational models across
a wide variety of fields, such as reasoning (Collins & Michalski, 1989),
conceptual combination (Costello & Keane, 2000; Lynott, Tagalakis,
& Keane, 2004), and computational linguistics (Lapata, McDonald, &
Keller, 1999). However, there is little consensus regarding the definition
and use of plausibility, and in many cases, plausibility is simply implemented
as an operationalised metric. For example, Collins and Michalski (1989)
discussed plausible reasoning, but by this they merely meant reasoning
based on inferences supported by prior experience; they did not characterize
plausibility judgments per se. On the other hand, Friedman and Halpern
(Friedman & Halpern, 1996; Halpern, 2001; see also, Shafer, 1976) created
what they termed plausibility measures, but this is not intended to be
a model of human plausibility judgment. Rather, the measures constitute
amathematical metric of uncertainty for use in fuzzy logic, of limited
utility in modeling the psychology of plausibility.
Die Plausibilität wurde in theoretischen und
computergestützten Modellen in einer Vielzahl von Bereichen verwendet,
wie z.B. Argumentation (Collins & Michalski, 1989), konzeptionelle
Kombination (Costello & Keane, 2000; Lynott, Tagalakis, & Keane,
2004), und Computerlinguistik (Lapata, Mc-
Donald, & Keller, 1999). Es besteht jedoch wenig Konsens über
die Definition und Verwendung von Plausibilität, und in vielen Fällen
wird Plausibilität einfach als eine operationalisierte Metrik eingesetzt.
Collins und Michalski (1989) erörterten zum Beispiel plausibles Denken,
meinten damit aber lediglich
Sie meinten damit jedoch lediglich Schlussfolgerungen, die sich auf
frühere Erfahrungen stützen; sie charakterisierten nicht Plausibilitätsurteile
als solche. Auf der anderen Seite haben Friedman und Halpern (Friedman
& Halpern, 1996; Halpern, 2001; siehe auch Shafer, 1976) haben so genannte
Plausibilitätsmaße Maße, die jedoch nicht als Modell für
menschliche Plausibilitätsurteile gedacht sind. Vielmehr stellen die
Maße eine mathematische Metrik der Unsicherheit zur Verwendung in
der Fuzzy-Logik, die für die Modellierung für die Modellierung
der Psychologie der Plausibilität.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Links (Auswahl: beachte)
Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Internetseite
Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren, geben wir nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia, DER SPIEGEL)
__
Abduktion "Abduktion ist ein erkenntnistheoretischer Begriff, der im Wesentlichen von dem US-amerikanischen Philosophen und Logiker Charles Sanders Peirce in die wissenschaftliche Debatte eingeführt wurde. „Abduktion ist der Vorgang, in dem eine erklärende Hypothese gebildet wird“." (Wikipedia Abruf 07.08.2021)
Englische Suchworte: plausible, plausibility,
Standort: Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskrterien
*
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen * Methodik der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *
Definieren und Definition * Wissenschaftliches Arbeiten * Zitieren in der Wissenschaft *
Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Wissenschaft site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, R. (DAS). Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskrterien. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Plausib/BA_plausib.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_ Begriffsanalyse Plausibilität__Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_
rs: 1. Rechtschreibprüfung 28.09.21
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
28.09.21 Erste Grundversion ins Netz - wird ausgebaut.
07.08.21 Als eigene Seite angelegt.
01.07.21 Mit der Recherche und Materialsammlung begonnen.