(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=01.07.2021 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: TT.MM.JJ
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_ Begriffsanalyse Plausibilität Religion_Datenschutz_Rel. Aktuelles_Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:
Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskriterien in Religion, Theologie und Esoterik
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
Haupt- und Verteilerseite Begriffsnanalysen
Plausibilität.
Empirische Studie zu Begriff und Verständnis
von Plausibilität.
Haupt- und Verteilerseite
Begriffsanalysen * Methodik
der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *
| Zusammenfassung - Abstract - Summary
Wissenschaftlicher Apparat
|
Zusammenfassung - Abstract - Summary
Religion, Theologie, Grenzwissenschaften und Esoterkik
book: Tradition und Redaktion im Matthäusevangelium
Buch Erfordert eine Authentifizierung
Tradition und Redaktion im Matthäusevangelium
Formale und inhaltliche Charakteristika matthäischer Redaktionspraxis
Band 245 der Reihe Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche
Wissenschaft
Heiko Wojtkowiak 2021
Obwohl in den letzten zwei Jahrzehnten sowohl die Theologie des Matthäusevangeliums
als auch dessen Verhältnis zu seinen Quellen, dem Markusevangelium
und der Logienquelle, verstärkt Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion
waren, fehlt bisher eine Untersuchung, welche die matthäische Redaktionspraxis
umfassend in den Blick nimmt.
Heiko Wojtkowiaks Studie füllt dieses Desiderat, indem sie umfänglich
die formalen und inhaltlichen Redaktionscharakteristika des Evangelisten
Matthäus darlegt. Hierzu erfolgt eine Untersuchung von dessen redaktionellen
Umgang mit dem Markusevangelium und den in der Regel der Logienquelle zugewiesenen
Texten. Dabei werden zwei weitergehende Fragen besonders berücksichtigt:
1) Lässt sich eine besondere Nähe zu einer dieser beiden Quellen
nachweisen? 2) Erscheint eine direkte Abhängigkeit vom Lukasevangelium
(ergänzend oder alternativ zur Annahme einer Abhängigkeit von
der Logienquelle) plausibel?
Die Studie bietet hiermit eine Grundlage sowohl für die weitere
Untersuchung der matthäischen Theologie als auch für die in der
Forschung neu auflebende Diskussion um die synoptische Frage.
Wojtkowiak, Heiko. Tradition und Redaktion im Matthäusevangelium,
Berlin, Boston: De Gruyter, 2021. https://doi.org/10.1515/9783110703757
Ambivalente Prognostiken
Berliner Theologische Zeitschrift
Marco Frenschkowski 13. Juli 2021
…Aber in gewissen Fällen lassen sie sich eben doch auf plausible
Beobachtungen herunterbrechen, auch wenn uns statistische Analyseinstrumente
nur selten für antike Überzeugungswelten zugänglich sind.…
Abstract
Zusammenfassung Die an Jesus gerichtete Forderung nach einem Himmelszeichen
interagiert mit antiken Reflexionen über die Ambivalenz und auch Fragwürdigkeit
irdischer mantischer Zeichen, die als Kommunikation aus der Welt Gottes
oder der Götter gedeutet werden können, aber eben auch mehrdeutig
bleiben. Das Thema wird in den Evangelien (schon Mk und Q) in zwei Mustern
tradiert: als Verweigerung Jesu gegenüber den Fragenden wie auch als
eschatologisches Rätselwort Jesu (Jona-Zeichen), das vermutlich von
Anfang an eine österlich-eschatologische Bedeutung hatte. Die Studie
skizziert, wie am Thema des Himmelszeichens im Gegenüber zur antiken
Mantik eine Zeichentheologie entsteht, die in Jesus selbst eine Disambiguierung
göttlicher Kommunikation erkennt.
Frenschkowski, Marco. "Ambivalente Prognostiken" Berliner Theologische
Zeitschrift, vol. 38, no. 1, 2021, pp. 115-137. https://doi.org/10.1515/bthz-2021-0008
Existential Care in a Modern Society: Pastoral Care Consultations in
Local Communities in Norway
International Journal of Practical Theology
Lars Johan Danbolt, Hetty Zock, Anne Austad, Anne Hege Grung, Hans
Stifoss-Hanssen 12. Juni 2021
…Religion is for many persons a plausible network in civil society
with sometimes strong tradition-based bonds to families as well as professional
relationships with public systems like school and health-care…
GÜ: "Religion ist für viele Menschen ein plausibles Netzwerk
in der Zivilgesellschaft mit zum Teil starken Traditionsverbundenheit zu
Familie sowie Beruf Beziehungen zu öffentlichen Systemen wie Schule
und Gesundheitswesen "
Abstract
Data from a recent survey on pastoral care consultations (PCC) in Norway
(N=408) is presented, showing that PCC is a service priests and deacons
provide for people in the municipality, independent of faith affiliation.
The most common PCC themes regarded mental and social distress, such as
grief, conflicts, and loneliness. Furthermore, illness-related themes were
prominent, and a specter of religious and moral issues. We discuss the
results in the context of ongoing changes and reforms in both church and
health care, and point at possible health promoting dimensions of PCC as
existential assistance in the space between personal network support and
public health care.
Danbolt, Lars Johan, Zock, Hetty, Austad, Anne, Grung, Anne Hege and
Stifoss-Hanssen, Hans. "Existential Care in a Modern Society: Pastoral
Care Consultations in Local Communities in Norway" International Journal
of Practical Theology, vol. 25, no. 1, 2021, pp. 20-39. https://doi.org/10.1515/ijpt-2020-0027
Wahrheitsnähe, Wahrheitsferne – Überlegungen zum Verhältnis
von Religionen und Wahrheit
Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie
Eberhard Martin Pausch 10. Juni 2021
…Da Verständigung aber faktisch möglich ist, wenn sie auch
nicht immer gelingt, ist die gegenteilige Annahme sehr viel plausibler,
nämlich, dass die verschiedenen Wahrheiten miteinander in Einklang
stehen…
Abstract
Zusammenfassung Die Hauptthese dieses Artikels ist inspiriert von Lessings
Werk „Nathan der Weise“: Die monotheistischen Religionen – was auch immer
sie sonst sein mögen – sind soziale Systeme. Als solche können
sie weder wahr noch falsch sein. Dennoch beinhalten sie Propositionen und
Wirklichkeitsverständnisse, die für sich Wahrheit beanspruchen.
Deren Verifikation ist aber unter irdischen Bedingungen nicht möglich.
Als Menschen können wir nur nach Wahrheit suchen und darauf hoffen,
dass Gott uns in die Wahrheit führt. Daher muss das Verhältnis
von Religion und Wahrheit in Modellen der Partizipation und der Approximation
gedacht werden. Abzulehnen sind hingegen Modelle wie Dogmatismus, Skeptizismus,
Pluralismus, Indifferentismus und Egalismus.
Pausch, Eberhard Martin. "Wahrheitsnähe, Wahrheitsferne – Überlegungen
zum Verhältnis von Religionen und Wahrheit" Neue Zeitschrift für
Systematische Theologie und Religionsphilosophie, vol. 63, no. 2, 2021,
pp. 145-162. https://doi.org/10.1515/nzsth-2021-0009
Religion nach der Aufklärung
Paragrana
Wolfgang Reinhard 17. Juli 2021
…biblisch belegte Erwartung der Naherwartung des Erlösers erwies
sich als Irrtum der frühen Christen, die Kindheitsgeschichte Jesu
samt jungfräulicher Geburt Mariens als fehlerhaft oder konnte mindestens
plausibler…
Abstract
Dieser Beitrag zeichnet die Umdeutung von Religion und Transzendenz
seit der Aufklärung nach und zeigt den damit verbundenen Macht- wie
Plausibilitätsverlust des Christentums. Zwar gehört die Religion
anthropologisch zum Menschen, jedoch ist sie seit der Aufklärung auf
dem Rückzug. Dieser generelle Weg kann als Weg weg von der institutionalisierten
Religion hin zur religiösen Praxis gezeichnet werden: Orthopraxie
statt Orthodoxie. So wurde einerseits der Wahrheitsanspruch der (christlichen)
Religion delegitimiert und somit unplausibel, als auch die Vorstellung
Gottes, also der Transzendenz, immer immanenter und wirkungsloser wurde.
„Erscheinung des Herrn“ [!] 2019, Saarbrücken 19.03.2019
Reinhard, Wolfgang. "Religion nach der Aufklärung" Paragrana,
vol. 30, no. 1, 2021, pp. 43-55. https://doi.org/10.1515/para-2021-0004
„Alles ist in Gott“ – Überlegungen zur bestimmenden theologischen
Denkform des Corpus Hermeticum
Philologus
Benedikt Krämer 15. Juni 2021
…The reflections that follow aim to make it plausible that the defining
form of theological thought in the Corpus Hermeticum can be classified
as panentheism.…
Abstract
Given the Corpus Hermeticum ’s history of formation, it has prompted
the attempt to separate layers or groups of writings within the collection
of treatises. This process of division, which was for the most part undertaken
on criteria of content (dualism, pantheism, etc.), has been viewed rather
negatively by the more recent research, on grounds of method. Given the
discovery of numerous doctrinal contents that remain constant across different
treatises, increased efforts are being made to reconstruct the Corpus ’s
moments of unity. The present paper aims, in this spirit, to provide a
more precise identification of the overarching forms of theological thought
in the Hermetic writings. The reflections that follow aim to make it plausible
that the defining form of theological thought in the Corpus Hermeticum
can be classified as panentheism. In addition, the distinctive form of
this influential theological paradigm in the Hermetic writings will be
considered.
Krämer, Benedikt. "„Alles ist in Gott“ – Überlegungen zur
bestimmenden theologischen Denkform des Corpus Hermeticum" Philologus,
vol. 165, no. 1, 2021, pp. 37-57. https://doi.org/10.1515/phil-2020-0126
How Numerous and How Busy were Late-Antique Presbyters?
Zeitschrift für Antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity
Robert Wi?niewski 10. Juli 2021
…XVI.Liber Pontificalis 53,12 (263,10–11 D.).Admittedly, the numbers of ordinations given by the Liber Pontificalis are notoriously problematic, but those which come from the sixth century are consistent and plausible…
Abstract
This article seeks to count late-antique clergy and assess their workload. It estimates the number of clerics, and particularly presbyters, in Christian communities of various sizes, and investigates how and why the ratio of clerics to laypersons changed over time. First, by examining the situation in the city of Rome, it demonstrates that the growth in the ranks of the presbyters from the third to the fifth century was slow, and argues that this resulted from the competing interests of the bishops, lay congregation, rich donors, and above all the middle clergy. It is the last group who were reluctant to raise their number as this had a negative impact on their income. The results of this phenomenon can also be seen in other big sees of Christendom, in which, in Late Antiquity, there was one presbyter per several thousand laypersons. Interestingly, in smaller towns, this ratio was significantly lower, and in the countryside, it remained in the lower hundreds. Second, this article shows how the changing ratio of clerics to laypersons affected the level of professionalization of the former. In the big cities, the ecclesiastical duties of presbyters who served in a growing community were getting heavier. This turned the presbyters into full-time religious ministers, at the same time making them even more dependent on ecclesiastical income. In the towns and villages, however, the pattern was different. In the places in which one presbyter served a very small community, his job was less time-consuming but also brought him less income. In consequence, rural presbyters had to support their families through craft work, commerce, or farming, and they had time for this.
Wisniewski, Robert. "How Numerous and How Busy were Late-Antique Presbyters?" Zeitschrift für Antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity, vol. 25, no. 1, 2021, pp. 3-37. https://doi.org/10.1515/zac-2021-0011
5. Religion und Gewalt: Guatemala
Die Taufe des Leviathan
Heinrich Wilhelm Schäfer 2021
…Im Blick auf die politischen Entscheidungen dieser großen, ethnisch definierten Bevölkerungsgruppe lassen sich nicht einmal plausible Vermutungen anstellen wie dies bei der Polarität zwischen weißen Management-Organisationen…
Politik steht zunehmend unter dem Einfluss von Religion, insbesondere in Nord- und Südamerika. Führer der evangelikal-pfingstlichen Bewegung verschaffen sich dort immer mehr politische Macht und bilden eine religiöse Rechte. Aus dem Leiden an sozialer Ungleichheit formen sie ein rückschrittliches Wählerpotenzial und durchlöchern die Grenze zwischen Religion und säkularer Politik. Dagegen positionieren sich religiöse Graswurzelbewegungen, die die Erfahrungen sozialer Ungleichheit in ethischen Protest umleiten. Heinrich Wilhelm Schäfer analysiert diese religiös-politischen Kämpfe um gesellschaftliche Macht und Laizität in den Amerikas und diskutiert die Möglichkeiten eines post-säkularen Dialogs.
Schäfer, Heinrich Wilhelm. "5. Religion und Gewalt: Guatemala". Die Taufe des Leviathan, Ithaca, NY: Bielefeld University Press, transcript, 2021, pp. 287-384. https://doi.org/10.36019/9783839457269-006
Kapitel 7 — Enabling Religion: Befähigung durch Religion
Religion und Disability
Ramona Jelinek-Menke 2021
…Eine?plausible?Erklärung?wäre,?dass?er?meint,?dass?die?Dörfler?nicht?»die?andere?Seite«?beschrieben,?wenn?sie?direkt? danach?gefragt?würden?(»ich?kann?die?jetzt?nicht?{direkt?fragen}«),?sondern?dass?solche…
Wie beeinflussen Religionen die soziale Stellung von Personen? Ramona Jelinek-Menke führt das Konzept der »Dis/ability« aus den Disability Studies erstmals in die deutschsprachige Religionswissenschaft ein und macht es für Analysen der Interdependenz zwischen Religion und Inklusion nutzbar. Gleichzeitig zeigt sie, wie unter dem Eindruck von Marginalisierung religiöse Vorstellungen, Praktiken und Institutionen gestaltet werden. Damit erschließt sich nicht nur ein neues Forschungsfeld für die Religionswissenschaft, sondern es wird auch die Aufmerksamkeit auf eine sozialwissenschaftlich und gesellschaftlich unterrepräsentierte Gruppe gelenkt.
Jelinek-Menke, Ramona. "Kapitel 7 — Enabling Religion: Befähigung durch Religion". Religion und Disability, Bielefeld: transcript Verlag, 2021, pp. 141-230. https://doi.org/10.1515/9783839456217-009
What Is Esotericism? Does It Exist? How Can It Be Understood?
Occult Roots of Religious Studies
Yves Mühlematter, Helmut Zander 2021
…That being said, in view of the lack of research, my considerations are currently only plausible conjectures on a possible accumulation of features in certain contexts.…
The historiographers of religious studies have written the history of this discipline primarily as a rationalization of ideological, most prominently theological and phenomenological ideas: first through the establishment of comparative, philological and sociological methods and secondly through the demand for intentional neutrality. This interpretation caused important roots in occult-esoteric traditions to be repressed.
This process of “purification” (Latour) is not to be equated with the origin of the academic studies. De facto, the elimination of idealistic theories took time and only happened later. One example concerning the early entanglement is Tibetology, where many researchers and respected chair holders were influenced by theosophical ideas or were even members of the Theosophical Society. Similarly, the emergence of comparatistics cannot be understood without taking into account perennialist ideas of esoteric provenance, which hold that all religions have a common origin.
In this perspective, it is not only the history of religious studies which must be revisited, but also the partial shaping of religious studies by these traditions, insofar as it saw itself as a counter-model to occult ideas.
Zander, Helmut. "What Is Esotericism? Does It Exist? How Can It Be Understood?". Occult Roots of Religious Studies, edited by Yves Mühlematter and Helmut Zander, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2021, pp. 14-43. https://doi.org/10.1515/9783110664270-002
Warum es plausibel ist, an Gott zu glauben
von Antje Schrupp 9. Juli 2019
Man kann die Existenz Gottes nicht beweisen, man kann sie auch nicht
widerlegen. Aber kann man Argumente finden, warum es zumindest plausibel
ist, von der Existenz einer übernatürlichen Entität auszugehen,
die man „Gott“ nennen kann? Der Philosoph Jörg Phil Friedrich meint:
Ja!
Jörg Phil Friedrich glaubt selbst nicht an Gott. Er ist in einer
atheistischen Umgebung aufgewachsen, hat sich aber als Philosoph logisch-argumentativ
mit der Frage beschäftigt, ob an dem, was Religionen über Gott
sagen, etwas wahr sein könnte. Und anders als der atheistische Mainstream
ist er zu der Auffassung gekommen, dass es nicht nur möglich ist,
sondern sogar plausibel.
Es geht ihm also nicht um die Ebene des Glaubens,
sondern um Logik und eine vernünftige Annäherung an die Welt.
Der Frage, ob es plausibel ist, von einer Existenz
Gottes auszugehen, nähert sich das Buch in vier durchargumentierten
Abschnitten:
Im ersten Abschnitt geht es um die Frage, was genau
„Existenz“ eigentlich ist, im zweiten (längsten) geht um die Beziehung
zwischen Menschen und Gott, im dritten um Gott als Schöpfer der Welt
und im (kurzen) vierten Abschnitt um die Frage, was Gott nicht ist. Oder
besser: Was man über Gott nicht aus rationalen, vernünftigen
Gründen sagen kann.
Die Argumentationsketten lesen sich teilweise wie
logische Knobelaufgaben. Wenn, dann und so weiter. Damit es nicht allzu
theoretisch-abstrakt wird, werden die Gedankengänge in Form von Alltagsproblemen
und Dialogen zwischen den imaginären Personen Alice und Bob anschaulich
gemacht.
Im ersten Abschnitt – was genau es eigentlich bedeutet,
wenn wir sagen, dass etwas „existiert“ – geht es dem Autor noch gar nicht
um Gott, der Teil ist sozusagen zum Aufwärmen. In Abschnitt zwei vertritt
Friedrich die Auffassung, dass es im menschlichen Geist selbst Hinweise
für die Plausibilität Gottes gebe,
zum Beispiel das moralische Gewissen. Allerdings kann man fragen, ob solche
„Resonanzen“ tatsächlich als Hinweise auf eine Existenz Gottes interpretiert
werden müssen, oder ob sie nicht auch kulturimmanent zu erklären
sind.
Abschnitt drei kann man als den Höhepunkt des
Buches verstehen, denn hier geht es um die Plausibilität eines Schöpfergottes:
Ist die Welt aus sich heraus und rein zufällig entstanden oder gibt
es eine schöpferische Quelle, die man „Gott“ nennen kann? Friedrich
kommt hier, anders als der gängige Atheismus, zu einem „Ja“ als Antwort.
Der vierte Abschnitt beschreibt schließlich
in Kürze, was ein plausibler Gott nicht
kann, zum Beispiel Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod begründen,
oder Hoffnung auf Vergebung der Sünden. Hier ist dann auch der größte
Abstand zwischen Friedrichs Argumenten und einer Glaubenswahrheit. Denn,
mal ehrlich: Wozu braucht man Gott dann?
Das Buch ist eine interessante Lektüre für
alle, die von den üblichen „religionskritischen“ Argumenten, die sich
meist nicht besonders viel Mühe geben, theologisches Denken überhaupt
zu verstehen, gelangweilt sind. Für gläubige Menschen kann das
Buch eine Bestätigung sein, wenn sie sehen, dass Gottesglaube auch
mit logischen Schlussfolgerungen nicht einfach als dumm und zurückgeblieben
abgetan werden kann.
Das wird sie allerdings vermutlich nicht in ihrem
Glauben bestärken – auch Jörg Friedrich lässt sich von seinen
eigenen Argumenten nämlich nicht beeindrucken und glaubt persönlich
weiterhin nicht an Gott.
Quelle (Abruf 01.07.2021) https://www.efo-magazin.de/magazin/gott-glauben/warum-es-plausibel-ist-gott-zu-glauben/
- Kommentar:
Lexikon des Buddhismus
Bei großer Unübersichtlichkeit der Überlieferungsgeschichte
scheint es auf dem 3. K. von P??aliputra um die Qualifikation des ? arhats
gegangen zu sein. Anstoß hatten 5 Thesen erregt, die die Heiligkeit
des arhats in Frage stellten. Die Autorschaft dieser Thesen scheint letztlich
nicht mehr zu klären sein: Mah?deva oder ein Bhadra. Mit einiger Plausibilität
wird man bei unterschiedlichen Zeitangaben in den Quellen das 2. Jh. nach
dem Tod des Buddha annehmen dürfen. In den P-Quellen (Dpv u. Mhv)
geht es um Abweisung von »Ketzern« (Skt t?rthika), durch deren
Einfluß mönchische Disziplin u. Gebräuche niedergegangen
seien. Mit der P-Tradition verbunden ist Moggalaputta, ein Mah?thera, der
das K. geleitet habe. Möglicherweise ist ? A?oka mit diesem K. verbunden.
Einer unsicheren Tradition nach sei das 4. K. von König Kani?ka einberufen
worden. Die Datierung ist umstritten; es fand vermutlich eher im 2. Jh.
n. Chr. statt. Das 5. K. wurde 1871 von König Mindon (1853-78) von
Birma nach Mandalay einberufen. Der revidierte Text der kanonischen Überlieferung
wurde in 729 Marmortafeln graviert u. in der Kuthodaw-Pagode in Mandalay
aufgestellt. Das bisher letzte buddh. K., das 6., 1954-56 in der künstlichen
Höhle Mah?p?s??aguh? bei Rangun zusammengetreten, diente der autoritativen
Edition der P-Schriften. Es wird nur von den Therav?dins als K. gezählt
(? Therav?da).
? L.: J. Przyluski: Le concile de R?jag?ha. Introduction à l'histoire
du canon et des sectes bouddhiques, 3 Tle., Paris 1926-28; M. Hofinger:
Etude sur le concile de Vai??l?, T'oung Pao XL (1951), 239-296; E. Frauwallner:
Die buddh. K., ZMDG 102 (1952), 240-261; E. Waldschmidt: Zum ersten buddh.
Konzil in R?jag?ha. Skt-Bruchstücke aus dem kanon. Bericht der Sarv?stiv?dins,
Asiatica, Fs. F. Weller, 1954, 817-828; A. Bareau:
[Lexikon des Buddhismus: Konzile. Lexikon des Buddhismus, S. 650
(vgl. LdBdh Bd. 1, S. 244 ff.) (c) Verlag Herder
https://www.digitale-bibliothek.de/band48.htm ]
2. Geglücktes Manöver Luther's, seine Unentbehrlichkeit
dem Kurfürsten plausibel zu machen
Dokumenttyp:
Kapitel
Erschienen in:
"Los von Rom" : Geburtsgeschichte der Los-von-Rom-Bewegung im 16. Jahrhundert
Erschienen:
1902
[DDB]
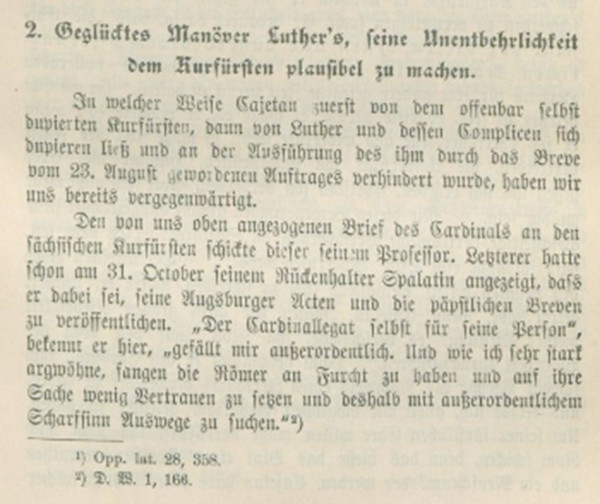
Valenta, Peter () Utopischer Glaube und Plausibilität [GB]
Links (Auswahl: beachte)
Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Internetseite
Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren, geben wir nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia, DER SPIEGEL)
__
Standort: Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskrterien in Religion, Theologie und Esoterik
*
Haupt- und Verteilerseite Begriffsnanalysen Plausibilität.
Empirische Studie zu Begriff und Verständnis von Plausibilität.
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen * Methodik der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *
Definieren und Definition * Wissenschaftliches Arbeiten * Zitieren in der Wissenschaft *
Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Wissenschaft site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, R. (DAS). Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskrterien in Religion, Theologie und Esoterik. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Plausib/BApl_Religion.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_ Begriffsanalyse Plausibilität Religion__Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_
noch nicht end-korrigiert
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
07.08.21 Als eigene Seite angelegt.
01.07.21 Mit der Recherche und Materialsammlung begonnen.