(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=07.08.2021 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: TT.MM.JJ
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_ Begriffsanalyse Plausibilität in Sprach- & Kommunikationswissenschaften_Datenschutz_Rel. Aktuelles_Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:
Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskriterien in Sprachwissenschaft, Linguistik, Literaturwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Journalistik, Rhetorik.
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
Haupt- und Verteilerseite Begriffsnanalysen
Plausibilität.
Empirische Studie zu Begriff und Verständnis
von Plausibilität.
Haupt- und Verteilerseite
Begriffsanalysen * Methodik
der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *
| Zusammenfassung - Abstract - Summary
Wissenschaftlicher Apparat
|
Zusammenfassung - Abstract - Summary
Zu dieser Seite gehören auch thematisch Einträge in Lexika, Wörtbüchern und Enzyklopädien.
Plausibilität in der deutschen Sprache: Duden, Sprachbrockhaus, DWDS, Dornseiff,
Duden plausibel
Bedeutungen Plausibilität Duden (Abruf 26.06.2021): 1. Das Plausibelsein.
2. plausible, aber unbewiesene Vermutung. Kritik: die 1. Angabe ist tautologisch,
die zweite zirkulär.
Bedeutungen Plausibilitätsprüfung Duden (Abruf 26-06-2021):
Prüfung, bei der Daten untersucht werden, ob sie glaubwürdig,
plausibel sind
Bedeutungen Plausibilitätsanalyse (Abruf 26.06.2021): Prüfung,
bei der Daten untersucht werden, ob sie glaubwürdig, plausibel sind
Sprachbrockhaus (1951, S. 507)
"plausibel, einleuchtend, glaubhaft"
Duden Bedeutungswörterbuch (1970, S. 494)
"plausibel <Adj.): überzeugend; einleuchtend: seine Begründung
ist ganz p.; eine plaunsible Erklärung."
DWDS plausibel (Abruf 26.06.2021)
„umgangssprachlich einleuchtend, glaubhaft
Beispiele:
das ist ein plausibler Grund, eine plausible Erklärung, Begründung,
Antwort, Ausrede
was du sagst, ist, klingt (ganz) plausibel
das erscheint mir plausibel
?jmdm. etw. plausibel machen?jmdm. etw. begreiflich machen
Beispiele:
wie soll man ihr das nur plausibel machen?
Fritz Mengers macht ihnen plausibel, daß sie nur ein paar Kollegen
suchen [BredelVäter382]
zur Wiederholung des Versuchs: uns das Absurde plausibel zu machen
[BecherAuswahl5,194]
Thesaurus
Synonymgruppe
• augenfällig · begreiflich · eingängig ·
einleuchtend · einsichtig · einsichtsvoll · erklärlich
· ersichtlich · fassbar · fasslich · glaubhaft
· klar · nachvollziehbar · nachzuvollziehen ·
plausibel · schlüssig · sinnfällig · triftig
· verstehbar · verständlich · überzeugend
evident geh. · gut ugs. · intelligibel
fachspr., Philosophie · noetisch fachspr., griechisch, Philosophie
Synonymgruppe
• (durchaus) plausibel · leuchtet ein · logisch ·
nicht von der Hand zu weisen · überzeugend
• nachvollziehbar Hauptform · naheliegend
fig. · (da) passt eins zum anderen ugs., fig.
…
Verwendungsbeispiele für ›plausibel‹
Wer hat wem denn nun Märchen erzählt? frage ich mich und
reime mir eine halbwegs plausible Geschichte zusammen.
Noll, Ingrid: Ladylike, Zürich: Diogenes 2006, S. 138
Ein Kabinett muss ja nicht nur plausibel strukturiert, es muss auch
machtpolitisch ausbalanciert sein.
Der Tagesspiegel, 09.10.2002
Jedem gelingt es, sein Verhalten plausibel zu machen, und jeder, nicht
nur der Vater, entpuppt sich als Teil des Problems.
Süddeutsche Zeitung, 30.05.2000
Niemand hat bisher diese Frage auch nur einigermaßen plausibel
zu beantworten übernommen.
Delbrück, Hans: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen
Geschichte - Erster Teil: Das Altertum, Berlin: Directmedia Publ. 2002
[1920], S. 6163
Es ist noch immer nicht plausibel gemacht, wie du das vorige Mal dazu
gekommen bist, zu lügen.
Friedländer, Hugo: Der Prozeß gegen den Bankier August Sternberg
wegen Sittlichkeitsverbrechen. In: ders., Interessante Kriminal-Prozesse,
Berlin: Directmedia Publ. 2001 [1910], S. 683“
Ende Zitierung DWDS
Dornseiff Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen
Im Sachregister werden die Wortgruppe 5-4 (wahrscheinlich), 13-46 (Beweis) und 19.13 (Rechtfertigung) ausgewiesen. Man kann aber zudem noch 5.2 (Möglich) 5.6 (Gewiss) berücksichtigen.
Grimm'sches Wörterbuch
plausibel, adj., entlehnt aus franz. plausible, lat. plausibilis Aler 1540b: und fanden wir kinder die sache sehr plausibel. Göthe 24, 188; wer die menschen betrügen will, musz vor allen dingen das absurde plausibel machen. 56, 150.
Kommunikation
Sulzmann, Dennis (29.5.14) Verschwörungstheorien: Wirklichkeit
ist Ansichtssache
"Davon abgesehen: Man muss sich im Klaren sein, dass Verschwörungen
alltäglich sind. Es gibt sie ständig und überall. Daraus
beziehen die Theorien ihre grundsätzliche Plausibilität. Die
Anhänger dieser Theorien können sagen: Seht ihr, da ist eine
echte Verschwörung, also könnte meine Behauptung auch stimmen."
Quelle (Abruf 15.01.22): https://carta.info/verschwoerungstheorien-wirklichkeit-ist-ansichtssache/
Rhetorik
Die Rhetorik hat eine große Tradition in der Antike, wurde im Zuge der technisch-naturwissenschaftlichen Revolition, dem Aufkommen der Logistik und der Wissenschaftstheorie, Empirismus, Logizismus, logischem Empirismus, verdrängt und erlebt aber seit Perelman, Toulmin, Rescher und anderen seit einem halben Jahrhundert eine Renaissance. Formale Logik ist nicht alles, es bedarf erweiterter, realistscherer und anwendungsfreundlicher Modelle. Ein bibliographisches Zeichen hierfür mag die Herausgabe des 11bändigen Historischen Wörterbuchs der Rhetorik (Projektbeginn 1982) durch den Niemeyer Verlages 1992 sein (Online DeGruyter 2013).
Steudel-Günther, Andrea. "Plausibilität". Historisches Wörterbuch
der Rhetorik Online, edited by Gert Ueding. Berlin, Boston: De Gruyter,
2013. https://www.degruyter.com/document/database/HWRO/entry/hwro.6.plausibilitaet/html.
Accessed 2021-07-01.
Plausibilität im Historischen Wörterbuch
der Rhetorik (HWR)
Obwohl das HWR das Thema ausführlich darstellt, fehlt es doch
an einer Definition:
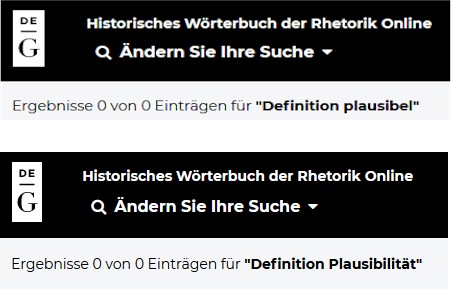
Abruf 26.10.2021
HWR-110 Registerband
Plausibilität 6, 1282
-> Argumentation (1, 914)
-> Beweis, Beweismittel (1, 1528)
-> Endoxa (2, 1134)
-> Enthymem (2,1197)
-> Glaubwürdige, das (3, 993)
-> Indiz (4, 333)
-> Logik (5, 414)
-> Publikum (7, 452)
-> Topik (9, 605)
-> Wahrscheinlichkeit, Wahrheit (9, 1285)
Argument 1, 889
-> Argumentatio (1, 904)
-> Argumentation (1, 914)
-> Beweis, Beweismittel (1, 1528
-> Enthymem (2, 1197)
-> Epicheirem (2, 1251)
-> Folgerung (3, 383)
-> Logik (5, 414)
-> Probatio (7, 123)
-> Ratiocinatio (7, 595)
-> Refutatio (7, 1109)
-> Schluß (8, 509)
-> Sorites (8, 1027)
-> Syllogismus (9, 269)
-> Topik (9, 605)
-> Wesensargument (9, 1362)
Plausibilität (engl. plausibility; frz. plausibilit6; ital.
plausibilita) A. [HWR1] <P.> ist das Kennzeichen
von etwas, das einleuchtet, verständlich oder begreifbar, glaubhaft
und wahrscheinlich ist. [HWR2] Plausible Urteile
sind relative Urteile, deren Relativität sich in drei Merkmalen zeigt:
Sie sind intersubjektiv, probabilistisch und überholbar. Das lateinische
[HWR3] plaudere meint in seiner ursprünglichen
Bedeutung <klatschen, schlagen> und findet sich u.a. bei CICERO in der
Bedeutung von <Beifall spenden, seine Huldigung darbieten>. [HWR4]
[1] Plausibilis, beifallswürdig, einleuchtend,
bezeichnet Darbietungen, die den Zuschauern oder Hörern gefallen.
[HWR5] <P.> ist stets mit dem gemeinsamen
Urteil des jeweiligen Auditoriums verbunden. Ein Argument ist für
ein Auditorium [HWR6] plausibel, wenn
dasselbe Auditorium in einem ähnlichen Fall dem Argument bereits zugestimmt
hat. [2] Dieser Bezug auf vergleichbare Fälle in der Vergangenheit
bildet den locus ab auctoritate, der Glaubwürdigkeit an Autoritäten
bindet und Normierungs- und Beweiskraft erhält. Das Verständnis
der antiken Rhetorik, [HWR7] <P.> als etwas
Überzeugendes zu fassen, wird bis zu DIDEROT und D'ALEMBERT tradiert:
«terme relatif ä l'acquiescement, au consentement, ä la
croyance que nous donnons ä quelque chose» (Bezeichnung, bezogen
auf die Zustimmung, auf das Einverständnis, auf den Glauben, den wir
einer Sache entgegenbringen). [HWR8] [3] Plausible
Urteile sind überzeugende Urteile, die vor dem Hintergrund eines sozial
hergestellten Konsenses von Meinungen gebildet werden. Diese Auffassung
eines Rekurses auf den Konsens überwindet den [>1283] Erkenntnisbezug
auf Wahrheit und absolutes Wissen bei PLATON. [4] Durch den Cartesianismus
und den modernen Positivismus ist ein Bedeutungswandel eingetreten: [HWR9]
P.
wird als Eigenschaft von Thesen verstanden - in zunehmendem Maße
wird auf den Hörer verzichtet. [5] Eine Argumentation, die nur [HWR10]
<plausibel> ist, ist nicht zwingend; sie
gilt nur vorläufig und hat ein weit geringeres Ansehen als eine logische
Beweisführung: Ein [HWR11] Plausibilitätsurteil
ist falsifizierbar und durch Wissensfortschritt überholbar.
I. Antike. Wesentlich für die
Bestimmung der [HWR12] <P.> ist die zentrale
Bedeutung des Syllogismus als eine Prämissen-Conclusio-Argumentation
bei ARISTOTELES. [6] Der Syllogismus umfaßt nicht nur den stringenten
und notwendigen Schluß, den apodiktischen Syllogismus, wie in den
<Ersten Analytiken>, sondern auch die [HWR13] plausiblen
und
mehr oder weniger wahrscheinlichen dialektischen und rhetorischen Schlußfolgerungen
der <Topiken> mit gemeinhin zugestandenen Prämissen bzw. mit nicht
stringenten Folgerungen. Dialektische und rhetorische Syllogismen haben
nur endoxale, meinungsmäßig zugestandene Prämissen, die
in der Regel auch das wahrscheinliche, Eix.65, eikös, zum Ausdruck
bringen. [7] "Evöcet, ändoxa sind Meinungen, die Reputation haben
[8], glaubwürdige Ansichten, die auf einem Konsens der meisten oder
der Autoritäten beruhen. Das lateinische Äquivalent probabile
bei BOETHIUS, das mit <ehrenwert> und <anerkannt> übersetzt
werden kann, hebt den moralischen und sozialen Bezug der menschlichen Meinung
hervor. [9] Dieser Ausgangskonsens, ein Ausdruck des gesunden Menschenverstandes
[10], bildet die Geltungsnorm der opinio communis, an der sich die dialektische
Argumentation zu orientieren hat. [11] Das endoxon kann funktional [12]
als nrdavöv, pithanön, als das, was Überzeugung bei dem
anderen schafft, bestimmt werden. [13] Das Enthymem, das die [HWR14] P.
einer Behauptung erweisen soll, ist durch seine integralen Bestandteile
endoxon und eikos eigenständiges Überzeugungsmittel (itiotig,
pistis). [14] Eikris meint nicht Wahrscheinlichkeit im Sinne einer relativen
Häufung, sondern ist etwas, das meistens so geschieht und damit meinungsabhängig
ist. [15] Im dialektischen Übungsgespräch wird Folgerichtigkeit
unabhängig von der Wahrheit der Prämissen erstrebt. Als Kriterium
für die Zulassung der Prämissen gelten die mittels dialektischer
Topoi aufgesuchten weithin anerkannten Sätze, die normativ gefaßt
sind. Das Enthymem als Kernstück des rhetorischen Überzeugen
beruht auf Prämissen, die aus den e'ndoxa geschöpft werden. Der
in der generischen Prämisse als endoxal angenommene Sachverhaltszusammenhang
ist nur möglicherweise wahr. [HWR15] <P.>
kann somit als enthymemische Zusammenschau von endoxon und eikös gefaßt
werden. Enthymeme aus dem Wahrscheinlichen [16] und Enthymeme aus dem nicht-notwendigen
Zeichen stützen sich auf [HWR16] plausible
Prämissen. Im eikös-Enthymem, dem Enthymem aus dem Wahrscheinlichen,
dient ein mit Wahrscheinlichkeit geltender allgemeiner Satz als Oberprämisse,
während im Indizien-Enthymem, dem Enthymem aus dem Zeichen, aus einem
Indiz auf das Vorliegen eines Sachverhalts geschlossen wird. [17] Geeignete
Prämissen zur Aufstellung der Enthymeme gewinnt man aus den Topoi
des jeweiligen Fachgebiets. Diese besonderen Topoi, die Meinungen über
Sachverhaltszusammenhänge darstellen, sind allgemein zugestandene
[HWR17] Plausibilitätsannahmen über
Wirklichkeit und sind von allgemeinen Topoi zu unterscheiden, die [HWR18]
plausible
Schlußregeln darstellen und damit den Übergang [>] von den Prämissen
auf die Konklusion legitimieren. Dieser formale Toposbegriff ist vom locus
communis später bei CICERO abzugrenzen, der als fertiges, allgemeines
Argument verstanden wird. [18] Das materiale Konzept findet sich auch im
<Commonplace Book> der Renaissance [19] und im 20. Jh. als schematisierte
Ausdrucksform, die literarisch allgemein verwendet wird. [20] In der lateinischen
Rhetorik werden die Beweismittel probationes genannt. [21] OUINTILIAN betont,
daß ein Teil der probationes nur wahrscheinlich ist. [22] Eine probatio
schließt vom (Nicht-)Vorliegen eines Sachverhalts p mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit auf das (Nicht-) Vorliegen eines Sachverhalts q. Unterschieden
werden verschiedene Glaubwürdigkeitsgrade. [23] Für sehr wahrscheinlich
gilt z.B., daß nicht der Schwache den Starken, sondern der Starke
den Schwachen verprügelt. Dieses auf KORAX zurückgehende Argument
ist hingegen ein Beispiel für geringere Glaubwürdigkeit: Es ist
unwahrscheinlich, daß ein kräftiger Angeklagter die ihm angelastete
Tat begangen hat, da er damit der allgemeinen Meinung entsprochen hätte.
[24]
II. Mittelalter, Humanismus, Barock. Mit
seinen <Introductiones in Logicam> entwirft WILLIAM OF SHERWOOD eine
Reduktion topischer Argumente auf Syllogismen und untersucht damit Argumentation
nicht mehr unter dem Gesichtspunkt der Evidenz und P., sondern allein im
Hinblick auf logische Stringenz. [25] Für die Terministen wie Sherwood
und PETRUS HISPANUS erhält topische Argumentation ihre Geltung dadurch,
daß eine Rückführung auf einen Syllogismus durch Hinzufügung
der fehlenden Prämisse möglich ist. Diese Abwertung der topischen
Logik durch die Scholastik wird von R. AGRICOLA zurückgenommen, der
die Tradition der rhetorischen Dialektik und Topik wieder aufnimmt. In
seinen 1515 erschienenen <De inventione dialectica libri tres> bestimmt
Agricola einen Topos als Anweisung, mit der etwas als wahrscheinlich und
glaubwürdig erschlossen werden kann. [26] Diese Anweisung dient der
Aufdekkung einer spezifischen Ordnungsstruktur, die einen Sachverhalt
darstellt. Zur argumentativen Abstützung einer These greift man auf
Topoi zurück, um ein passendes Argument zu finden. Argumente haben
einen bloß wahrscheinlichen und [HWR19] plausiblen
Charakter, wenn auf die Topoi des Ähnlichen oder der Wirkursache [27]
zurückgegriffen wird. Überzeugungskraft erhält eine Argumentation
durch die jeweilige Kommunikationssituation, insbesondere durch den Einbezug
des möglichen Hörerverhaltens. [28] Der bei Agricola entwickelte
Begriff des Topos als Kennzeichen, das die Ordnung der Welt anzeigt, ist
material gefaßt. Diese Reduktion des Toposbegriffs auf den manifesten
locus communis, auf eine schematisierte Ausdrucksform, steht in deutlichem
Gegensatz zum formalen Charakter des allgemeinen Topos der griechischen
Rhetorik, der allgemeine Argumentationsprinzipien bzw. [HWR20] plausible
Schlußregeln umschreibt.
III. 18. und 19. Jh. In seiner 1709 verfaßten
Inauguralrede <De nostri temporis studiorum ratione> hebt G. Vico den
Stellenwert der rhetorisch-topischen Methode gegenüber dem Cartesianismus
hervor. Nach Vico vermittelt die rhetorische Topik, für die Wahrscheinlichkeit
(verisimilitudo) grundlegend ist und die einen Sachverhalt
von mehreren Seiten betrachtet, Klugheit und schult Phantasie und Gedächtnis.
Da diese der Wahrheit ähnliche Wahrscheinlichkeit die Grundlage für
die Herausbildung
des sensus communis darstellt und dieser die Norm [>] (regula) der
Beredsamkeit bildet [29], läßt sich ein enger Zusammenhang mit
dem endoxon herstellen
W. 20. Jahrhundert. Unter Rückgriff auf die rhetorischtopische
Tradition wenden sich TH. VIEHWEG und CH. PERELMAN gegen den kritischen
Rationalismus, nach dessen Selbstverständnis sachgerechtes und logisches
Denken ohne Sprache und ohne Rückgriff auf [HWR21] Plausibilitätsannahmen
des Alltagsverstandes möglich ist. Zentrales Anliegen Viehwegs ist
die Verknüpfung von Topik und Jurisprudenz und der Nachweis der topischen
Struktur der gegenwärtigen Zivilistik. [30] Während Viehweg Topik
allgemein als Problemlösungsverfahren bestimmt, gibt Perelman als
Entscheidungskriterium «l'accord de l'auditoire universel»
(Zustimmung der universalen Öffentlichkeit) an. Die Begründung
einer These ist [HWR22] plausibel, wenn sie
darauf angelegt ist, den vernünftig denkenden Menschen zu überzeugen.
[31] Die Anpassung des Redners an das universale Auditorium gelingt über
die Anknüpfung an ein gemeinsames Bezugssystem, an gemeinsame Wertvorstellungen,
die die Rede grundieren und auf diese Weise die Zustimmung der Zuhörer
ermöglichen. [32]
Anmerkungen:
1R. Klotz: Hwtb. der lat. Sprache (1963) 803. - 2 Arist.
Rhet. H,12 1398 b 21 ff. - 3 Diderot Encycl. unter : <plausible, plausibilit6>.
- 4 K. Oehler: Der Consensus omnium als Kriterium der
Wahrheit in der antiken Philos. und der Patristik., in:
Antike und Abendland 10 (1961) 105; P. v. Moos: Introduction ä une
histoire de l'endoxon, in: Ch. Plantin: Lieux communs, topoi,
stereotypes (Paris 1993) 5. - 5 Brockhaus-Wahrig: Dt.
Wtb., Bd. 5 (1983) 153. - 60. Primavesi: Die aristotelische Topik (1996)
24. - 7 Aristoteles, Analytica priora II, 27, 70 a 3. - 8 Arist
Top. I, 1, 100b 21-23. -9 v. Moos [4] 9. -10 P. v. Moos:
Die angesehene Meinung. Stud. zum endoxon im MA II, in: Th. Schirren, G.
Ueding (Hg.): Topik und Rhet. (2000) 148. - 11 Oehler [4]
106. - 12v. Moos [4] 9. - 13 Arist. Rhet. I, 1355 a 4-7.
- 14J. Sprute: Die Enthymemtheorie der aristotelischen Rhet. (1982) 66.
-15 ebd. 75f. -16 Arist. Rhet. I, 1357a 27ff. und II, 1402b 15.
- 17Aristoteles, Analytica priora II, 27 70a 7-9. -18
W. Veit: Toposforschung, in: M.L. Bämer (Hg.): Toposforschung (1973)
183. - 19 H.F. Plett: Rhet. der Gemeinplätze, in: Schirren [10]
225ff. - 20 Curtius 79. - 21 Quint. V, 10, 8. - 22 ebd.
V, 10, 12. - 23 ebd. V, 10, 16. - 24 vgl. Sprute [14] 113f. -25 William
of Sherwood, Introductiones, hg. u. übers. v. H. Brands u. C. Kann
(1994) 88. - 26 Agricola 20; vgl. E. Eggs: Art. <Logik>,
in HWRh 5, Sp. 414ff. - 27Agricola 87ff. - 28 ebd. 209. - 29 Vico Stud.
III, 26f., 75. - 30Th. Viehweg: Topik und Jurisprudenz (51974) 97,
105, 109. - 31 Perelman, 41. - 32 ebd. 154.
Literaturhinweise:
C. Prantl: Gesch. der Logik im Abendlande, Bd. I-IV (1855-70,
ND 1997). - A. Faust: Die Dialektik R. Agricolas. Ein Beitr. zur Charakteristik
des dt. Humanismus, in: AGPh 34 (1922) 118-
135. - E. Kapp: Der Ursprung der Logik bei den Griechen
(1965). - W.A. de Pater: Les Topiques d'Aristote et la dialectique platonicienne
(Fribourg 1965). - L. Fischer: Curtius, die
Topik und der Argumenter, in: Sprache im technischen
Zeitalter 42 (1972) 114-143. - W. Bayer: P. und juristische Argumentation
(1975). -N. Horn: Topik in der rechtstheoretischen Diskussion,
in: D. Breuer, H. Schanze (Hg.): Topik (1981) 57-64.
A. Steudel-Günther
[Querweise] -> Argumentation -> Beweis -> Endoxa -> Enthymem
-> Glaubwürdigkeit -> Indiz Logik -> Publikum -› Topik -> Wahrheit,
Wahrscheinlichkeit
Auswertung des Wortgebrauchs "plausib" im HWR
- Kommentar-HWR1: "Plausibilität ist das Kennzeichen von etwas, das einleuchtet, verständlich oder begreifbar, glaubhaft und wahrscheinlich ist." Das ist eine treffliche Beschreibung, die den Gebrauch gut wiedergibt, wie auch meine empirische Pilotstudie belegt. Aber bei genauer Betrachtung werden hier einige Begriffsschiebebahnhöfe eingerichtet. Es wird an dieser Stelle beschrieben, umschrieben, charakterisiert, aber nicht erklärt und begründet.
- Kommentar-HWR2: "Plausible Urteile sind relative Urteile, deren Relativität sich in drei Merkmalen zeigt: Sie sind intersubjektiv, probabilistisch und überholbar."
- Kommentar-HWR3: Berichtet die ursprüngliche lateinische Bedeutung von plaudere.
- Kommentar-HWR4: Berichtet die ursprüngliche lateinische Bedeutung von plausibilis.
- Kommentar-HWR5: Plausibilität sei stets mit dem gemeinsamen Urteil des jeweiligen Auditoriums verbunden
- Kommentar-HWR6: Ähnlichkeitskriterium: "Ein Argument ist für ein Auditorium plausibel, wenn dasselbe Auditorium in einem ähnlichen Fall dem Argument bereits zugestimmt hat."
- Kommentar-HWR7:
- Kommentar-HWR8:
- Kommentar-HWR9:
- Kommentar-HWR10:
- Kommentar-HWR11:
- Kommentar-HWR12:
- Kommentar-HWR13:
- Kommentar-HWR14:
- Kommentar-HWR15:
- Kommentar-HWR16:
- Kommentar-HWR17:
- Kommentar-HWR18:
- Kommentar-HWR19:
- Kommentar-HWR20:
- Kommentar-HWR21:
- Kommentar-HWR22:
Literaturwissenschaft
"Der Ausdruck ‚plausibel‘ wird nicht allein
in mündlicher Fachkommunikation, sondern auch in literaturwissenschaftlichen
Meta-Texten zur Beurteilung von Interpretationen verwendet, vor allem in
Rezensionen, Forschungsberichten undim Fußnotenapparat literarhistorischer
Beiträge. Wenn man die Häufigkeit zugrundelegt, mit der der Ausdruck‚plausibel‘in
diesen Texten eingesetzt wird,und davon ausgehend folgert, dass das ihm
entsprechende Kriterium zur Einschätzung von Interpretationen ebenso
weit verbreitet ist, dann liegt es naheanzunehmen, dass das Prädikat‚plausibel‘die
Bedingung der breiten Akzeptanzim Fach erfüllen kann, die etwa für
‚wahr‘oder ‚rational‘ ebenso wenig gegeben ist wie für ‚anregend‘oder
‚interessant‘. Jedoch finden sich in der literaturwissenschaftlichen Forschung
kaum Klärungen des Ausdrucks und des Kriteriums,7 wofür es mindestens
zwei Erklärungen gibt: Es könnte sein, dass der Begriff ‚Plausibilität‘zu
den praxeologisch beschreibbaren Selbstverständlichkeiten desFaches
gehört, über die ein stillschweigender Konsens besteht. ‚Plausibel‘als
Attribut einer Interpretation hätte dann vielleicht den Status von‚genau‘als
Attribut des professionellen Lesens: Was es heißt, dass man als Literaturwissenschaftler‚genau
lesen‘solle, wird in erster Linie durch Einübung vermittelt, Einführungen
ins Fach aber enthalten kaum explizite Anleitungen zum genauen Lesen. In
eben diesem Sinne könnte man den Ausdruck 'plausibel‘
auffassen: als ein gewissermaßen mit Praxiswissen aufgeladenes Attribut,
dessen korrekte Ver[>486]wendung Literaturwissenschaftler im Laufe ihrer
disziplinären Sozialisation erlernt haben und das sie mehr oder weniger
gleich, auf jeden Fall aber ähnlich bestimmen würden, wenn sie
denn jemand dazu aufforderte. Es könnte aber auchsein, dass die Verwendung
desselben Ausdrucks bestehende Differenzen ver-deckt und Literaturwissenschaftler
unter einer‚plausiblen Interpretation‘ tatsächlich sehr Unterschiedliches
verstehen. Der Ausdruck ‚plausibel‘ hätte
dann vorallem den positiven Effekt, Begründungsdebatten zu ersparen,
und ein Konsensbestünde gegebenenfalls allein in der Gewissheit, dass
als Kriterium zur Beurteilung von Interpretationstexten ein weniger rigides
oder weniger voraussetzungsvolles Konzept benötigt werde als Wahrheit.8"
Quelle: Winko, Simone. „Zur Plausibilität
als Beurteilungskriterium literaturwissenschaftlicher
Interpretationen.“ In: Theorien, Methoden und Praktiken
des Interpretierens, von Andrea Albrecht, Lutz Dannenberg, Olav Krämer
und Carlos Spoerhase. Berlin/Boston: De Gruyter, 2015, 483-512.
- Kommentar:
Zieglgänsberger, Sabina (2020) Die Welt plausibel erzählen: Metamorphose und Entwicklung im literarischen Werk Christoph Ransmayrs (Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft, Band 104). Lang.
"Im literarischen Werk Christoph Ransmayrs ist die Metamorphose als Motiv, Formstruktur und Metapher durchgehend präsent. Sie ist der rote Faden, der sich durch das Oeuvre zieht, und alle Texte in ihrer gemeinsamen Aussage im Kern zusammenhält. Die Verwandlung als zentrale Bildfigur in den Texten, die alle damit verbundenen Themenbereiche eint und so ein in sich geschlossenes Gesamtbild der fiktionalen Wirklichkeit entwirft, ist nicht nur aufgrund ihrer bereits in Mythos und Mythologie angelegten Implikationsmöglichkeiten für Ransmayr attraktiv, sondern auch aufgrund ihrer Offenheit zur Naturwissenschaft. Insbesondere Ransmayrs Orientierung an szientifischen Inhalten und Sprachmodi spiegelt die in seiner Poetik geforderte Ausrichtung auf eine literarische Abbildung der Wirklichkeit, die stets der Plausibilität verpflichtet sein soll."
- Kommentar:
Brecht Notizbücher Einführung in die Edition
Quelle: https://www.brecht-notizbuecher.de/content/uploads/einfuehrung-in-die-nba.pdf
Zusammenfassung:
[1] S. 30: Dokumentenfolgen und Entstehungsgeschichten sind selten exakt, manchmal mehr oder weniger plausibel und oft auch gar nicht zu (re)konstruieren; vieles gehört neben- und nacheinander zu mehreren Komplexen und Projekten, deren sich überlappende, verzahnende oder ausfransende Grenzen oft unklar sind; anderes ist ›freischwebendes‹ Einzelstück, das hier und dort oder auch nirgends einzuordnen ist;62
[2] S. 39: "Was die Wissenschaftlichkeit einer Ausgabe betrifft, so ist ihre allgemeine Form wohl unbestritten. Wie aber ihre jeweilige Angemessenheit an ihren Gegenstand aussehen soll, ist keineswegs von vornherein klar, und eine Ausgabe, an der man sich orientieren könnte, liegt nicht vor. Die Sache muß erst in ihrer Eigenart verstanden sein, bevor eine sachgerechte Ausgabe konzipiert werden kann. Betrachten wir also die Notizbücher Brechts, bevor wir daraus die konkreten Editionskriterien entwickeln. Zugleich werden dadurch die vorangestellten Grundsätze plausibler werden."
[3] S.46: Die Chronologie ist hier das plausibelste, informativste und am ehesten realisierbare Ordnungskriterium.
[4] S.48: Hier muß, solange ein Autor nicht nachgewiesen ist, offenbleiben, ob es sich um zitierten Fremd- oder ironisierenden Eigentext handelt. Schließlich das weite Feld der Plagiate, Parodien und Bearbeitungen wie (9) die Gassenhauer-Persiflage in NB 24, 60r-61r, deren Vorlage nur mit wechselnder Plausibilität auszumachen ist und deren ›Brecht-Anteil‹ schwankt. So stammt die Zeile verlassen verlassen zu 100 % aus dem Kärntner Lied op. 4 von Thomas Koschat; der Kontext macht sie aber auch zu einem (virtuellen) Brecht-›Text‹, selbst wenn die Art der intendierten Bearbeitung am Wortlaut überhaupt noch nicht deutlich wird.
[5] S. 51: Das betrifft zunächst ihre äußere Grenze. Wo beginnt und wo endet eine Eintragung? Man betrachte (12) NB 24, 21r.1-3:
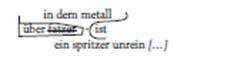
Auf der Seite stand zunächst nur ein Wort und ein Punkt mit Tinte: »fatzer .«. Die vorangehende Seite 20r wurde mit gleicher Tinte im gleichen Schriftduktus beschrieben; durchaus plausibel, daß Wort und Punkt (wohl ein Ansatz für ein weiteres Wort), als sie eingetragen wurden, zu diesen Fatzer-Notaten gehörten. Das Wort wurde aber später mit Bleistift gestrichen, als der Rest von Bl. 21r beschrieben wurde ? vielleicht ein Hinweis, daß diese ›Aphorismen‹ zum Zeitpunkt ihrer Eintragung gerade nicht zum Fatzer-Projekt gehören sollten. In einem dritten Schritt dann wurden vor »fatzer« mit Bleistift ein »über« eingefügt und die beiden Worte eingerahmt.
[6] S.52: Das mag weniger plausibel erscheinen, auch weil Brecht schon in der Grundschicht der Eintragung, anscheinend schon für eine spätere Ergänzung, eine Leerzeile ließ. Auszuschließen ist es nicht und macht die Struktur des Textes uneinholbar doppeldeutig
[7] S.55: Sie können nicht als definite und definierbare Texte wiedergegeben werden, sondern nur als für jede Seite, jeden Schreibzusammenhang, jeden Satz, jedes Wort, jedes Zeichen in verschiedenen Graden plausible Befunde.
[8] S.63: Das Voranstellen des Titels (?) »Vorspiel« (neben »Amudsen« das einzige großgeschriebene Wort der Seite; eine der vielen Informationen, die bei ›Normalisierung‹ der Rechtschreibung verloren gehen ? ebenso wie Brechts ungenaue Kenntnis des Namens ›Amundsen‹) mag noch plausibel und vertretbar sein. Das Nicht-Ernstnehmen des horizontalen Striches, der den »Schnitt« graphisch vormacht, ist ein grober, aber schlichter (korrigierbarer) Fehler,
[9] S.68: (39) Ein weiterer Fall, wo erst die Kommentarrecherche auf die plausibelste Lesart führt, ist der in vieler Hinsicht extraordinäre und einen langen Atem verlangende Satz zur ›Zertrümmerung der Person‹ in NB 25, 79r-80r:
[10] S.69: ... Die Situation (Verkauf) und die Wortwahl (›einbringen‹)
scheinen die Verwandtschaft der beiden Stellen zu belegen, womit dann die
Wendung an eine Frau statt einen Herrn plausibler wird. Im Grunde aber
ist hier vieles offen: Autorschaft, Textstatus, Textzugehörigkeit
und (damit) Entzifferung.
[11] S.70: (42) Und nicht nur Werk und Biographie Brechts. Daß
es in NB 24, 79v nicht z. B. »Geselschaft der feinde Neue Graußler
¾«, sondern »Geselschaft der freunde Neue Graupen 3/4«
heißt, wird erst plausibel, wenn man weiß, daß in der
Neuen Graupenstraße 3-4 in Breslau der Sitz der Gesellschaft der
Freunde war, also der Society of Friends oder auch Quäker. Erst das
Breslauer Adreßbuch erschließt Brechts Notizbuch. Pointiert
gesagt: Jeder einzelne Buchstabe in einem beliebigen Brecht-Dokument wird
erst vor dem Hintergrund aller
Buchstaben überhaupt lesbar.
[12] S.71: ... früheren Archivzählungen (»Notizbuch 18« / »alte Notizbücher -H-«),99 Brechtschen Zählungen (»1«-»9« / »Heft 1«-»Heft 2«), erster Textzeile (Notizbuch ›auch bei hegel …‹), materialen Gegebenheiten (CELKA-Block 5 / Efalin-Heft 3), vermutetem Verwendungszeitraum (Notizbuch 1927-29) etc. wären allesamt weniger plausibel und praktikabel.
[13] S.85: Dennoch werden diese für deutsche Handschrift charakteristischen Graphen den heutigen Lese- und Satzgepflogenheiten lateinischer Druckschrift und der jeweiligen semantischsyntaktischen Plausibilität im Kontext angepaßt
[14] S.90: ... Wo zur vorgeschlagenen Entzifferung alternative Lesarten möglich sind und einen annähernd gleich plausiblen Sinn ergeben, werden sie hier angeführt.
[15] S.93: ... Sie müssen vielmehr markiert und damit nachvollziehbar und kontrollierbar gemacht werden. Zudem können sie für Einordnung und Verständnis einer Notiz wichtige Hinweise liefern: Deutungsvorschläge, die der Leser in seiner Weiterarbeit am Text sieben, aufgreifen, ergänzen oder verwerfen mag, wie es ihm plausibel erscheint.
[16] S.94: ... Darüber sind [>94] immer nur und bestenfalls
Plausibilitäts- und Wahrscheinlichkeitsurteile, nie
Gewißheiten zu erreichen.
[17 S.? ] "- In Brechts Handschrift sind einzelne Buchstaben oft nicht
identifizierbar und nur durch das Wortbild (die ›Gestalt‹) und den vermuteten
Sinn des Kontexts wahrscheinlich oder plausibel
zu machen"
Quelle: http://textkritik.de/brecht/index.htm
Kommentar
Die Illusionen der Paranoiker
Die Moderne und das Krimigenre sind eng miteinander verknüpft. In Luc Boltanskis Studie „Rätsel und Komplotte“ ist davon aber wenig zu spüren
Von Walter Delabar
"Das lässt sich an Boltanskis Studie recht genau sehen: Deren Schräglage ergibt sich nämlich daraus, dass Boltanski für den Krimi-Teil ein denkwürdiges Verständnis von moderner Gesellschaft präsentiert, während er für den Thriller das Paradigma Paranoia vor allem von einer wissenschaftlichen, speziell soziologischen Wahrnehmung und Beschreibung von Gesellschaft abzugrenzen versucht. Dabei werden dann angemessene und nicht-angemessene Wahrnehmungen unterschieden, allerdings nicht entwickelt am Erfolg der Wahrnehmung, sondern an deren Plausibilität. Das aber reicht als Unterscheidungskriterium nicht aus, solange dahinter die Vorstellung regiert, eine angemessene Wahrnehmung müsse sich nicht mit den sprachlichen Zeichen und Bedeutungen abgeben. Boltanski glaubt nämlich in der Tat, dass sich nur für den Paranoiker „die Welt“ „als ein Komplex aus Zeichen“ darstellt, „die dekodiert werden müssen“, während die wissenschaftliche, mithin die soziologische Wahrnehmung sich an der Realität selbst abarbeitet. Das klingt existenzialistisch motiviert – zeichentheoretisch jedoch ist das Anlass immerhin für grundsätzliche Fragezeichen hinter Boltanskis Prämissen. Denn welche Welt bestünde nicht aus Zeichen, die erfolgreich interpretiert werden müssen, damit Handeln möglich ist? "
Quelle (Abruf 15.01.22): https://literaturkritik.de/id/19305
,Strong readings‘, Paranoia und Kittlers Habilitationsverfahren Prolegomena
einer Fallstudie
Von Claudia LiebrandRSS-Newsfeed neuer Artikel von Claudia Liebrand
"Natürlich ist Kaisers Einschätzung zuzustimmen. Kittlers
Lektüren der Kanontexte, die er in den „Aufschreibesystemen“ behandelt,
sind luzide, sophisticated, von brillanter Intelligenz, tun den Texten
aber, wenn auch nicht immer, so doch nicht nur gelegentlich – wie sagt
Kaiser – in „ihrer immanenten Komposition“ Unrecht. Wie man Kittlers Lektüren
einschätzt, hängt ab von den Kriterien, mit denen man interpretative
Zugriffe evaluiert – ins Spiel gebracht sei eine Kriterienliste, wie sie
kürzlich formuliert worden ist: „Wahrheit, Plausibilität,
Wahrscheinlichkeit, Interessantheit, Wichtigkeit, Fruchtbarkeit, Neuheit,
Kohärenz, Maximierung ästhetischer Bildung oder ästhetischer
Wertschätzung, Anschlussfähigkeit an Theorien und Forschungsgeschichte
oder für zukünftige Interpretationen“[18].
Was Kittlers in unserem Sinne paranoische, ‚starke Lektüre‘ für
sich in Anschlag bringen kann, wäre – geht man von dieser Kriterienliste
aus – Interessantheit, Fruchtbarkeit, Neuheit, Grundlegung einer technikzentrierten
Medientheorie (im Anschluss an Virilio und McLuhan, denen Kittler sehr
viel verdankt, auch wenn er das nicht immer hinreichend deutlich herausstellt),
Grundlegung einer materialen Geschichtsphilosophie, sicher auch Anschlussmöglichkeiten
für weitere Auseinandersetzungen mit den in den Blick genommenen Texten.
Auch Kriterien wie Kohärenz und Plausibilität
lassen sich dem Kittler’schen Zugriff nicht absprechen: Kohärenz
und Plausibilität werden allerdings auch
erzielt durch tendenziöse, punktuelle Behandlung des Textmaterials.
"
Quelle (Abruf 15.01.22): https://literaturkritik.de/id/17782
Sprachwissenschaft
Hier gibt es Überschneidungen zur Literatur-, aber auch anderen Fachwissenschaften
Japanisch
(Eigenbez. Nihongo) Die Herkunft des J. ist umstritten, obwohl typolog. Ähnlichkeiten auf eine Verwandtschaft mit dem ? Koreanischen hinweisen. Durch neuere Forschungen haben Hypothesen einer gemischten Herkunft aus altaischen und austrones. Quellen mit zusätzl. dravid. Einflüssen an Plausibilität gewonnen. Das Sprachgebiet umfaßt den ganzen j. Archipel mit 124 Mio. Sprechern (1992) und vereinzelte Sprachinseln von Migranten in Hawaii und den Amerikas; Karte
[Lexikon Sprache: Japanisch. Metzler Lexikon Sprache, S. 4462
(vgl. MLSpr, S. 322) (c) J.B. Metzler Verlag http://www.digitale-bibliothek.de/band34.htm]
Diskursanalyse
Strauss, Lina (2018) Eine Diskursanalyse. Berlin: Metzler (Springer Nature)
Suchwort „plausib“ viele Treffer.
Textanalyse
Felder, Ekkehard (2009, Hrsg.) Sprache. Berlin: Springer.
Suchwort „plausib“ 22 Fundstellen
Suchwort „Plausibilität“ 10 Fundstellen
Suchwort Plausibilitätskriterien 1 Fundstelle, S. 36
S.22: „Der Beitrag verfolgt in erster Linie ein methodisches Interesse, das heißt, es soll ein Beschreibungsinstrumentarium für die Analyse von Texten (vgl.umfassend dazu Brinker/Antos/Heinemann/Sager (Hg.) 2000/2001, insbesondere Scherner 2000 und Rolf 2000 sowie Hausendorf/ Kesselheim 2008 und Janich 2008) in Mediendiskursen in Ansätzen skizziert und an Einzelbeispielen plausibilisiert werden.“
S. 24: „Ausdrucksseitig manifestieren sich die Spuren des Denkens auf
folgenden linguistisch beschreibbaren Ebenen: Lexeme,17 Syntagmen18 bzw.Kollokationen19
bzw. idiomatische Wendungen20 oder Phraseologismen21, Sätze und
Texte (inkl. Bilder, siehe dazu Stöckl 2004, Sachs-Hombach 2006).
Aus diesemmateriell
Sichtbaren werdenRückschlüsse auf Inhaltsseitiges gezogen
bzw. Hypothesen gebildet, deren Plausibilität über ihre Durchschlagkraft
entscheiden.“
S.36: „… Die Plausibilitätskriterien freilich werden häufig nur impliziert und nicht explizit ausgeführt. …“
S. 38f: „In diesem Kontext muss noch die Problematik von Einzelsatzanalysen
angesprochen werden (wie sie hier soeben nur ansatzweise angedeutet wurde).
Sie dienen der Plausibilisierung der Untersuchungsmethoden und der
Verdeutlichung ihrer Relevanz. Sie beanspruchen, Perspektiven und Tendenzen
in einzelnen Aussagen transparent zu machen. Es geht damit aber nicht
die Behauptung einher, der ganze Mediendiskurs habe diese Einfärbung
erfahren.
Diemeisten perspektivierten oder tendenziösen Darstellungen werden
im Gesamtdiskurs relativiert, nicht aber unbedingt in den von uns präferierten
Einzelmedien, die wir zu rezipieren gewohnt sind. Entscheidend sind
dabei 28Drei Kategorien sind in unserem Zusammenhang besonders einschlägig:
Nomen Acti (von
einem Verb abgeleitetes Substantiv, das das Ergebnis eines Geschehens
bezeichnet – Bruch zu brechen); Nomen Actionis (von einem Verb abgeleitetes
Substantiv, das ein Geschehen bezeichnet – Schlaf zu schlafen); Nomen Agentis
(von einemVerb abgeleitetes Substantiv, das das handelnde Subjekt/Agens
eines Geschehens bezeichnet – Läufer zu laufen).
S. 39 Sprache – das Tor zurWelt - die Wissensrahmen, die durch vielfältigen
sprachlichen Input beeinflusst werden. Schließlich sind im Wissensrahmen
sowohl über den Kotext (also den rein textimmanenten Kontext) als
auch über den Kontext (auch außertextueller
Kontext in Form von Weltwissen) die nicht explizierten und referierten
Leerstellen (Slots) der Ereigniskonzeptualisierung zu füllen.
Je nach „Füllung“
findet die Konzeptualisierung spezifisch perspektiviert statt. Einschlägig
wird
das Verfahren dann, wenn sich diskursv handlungsleitende Konzepte eruieren
lassen.Diese können selbstredend nicht über Einzelsatzanalysen
ermittelt
werden.“
S. 42: „Solche Phänomene findet man häufig in Diskursen: Es
gibt Formulierungen,
die – aus welchen Gründen auch immer – sich der wörtlichen
oder
paraphrasierenden Wiederaufnahme erfreuen und mitunter von ersten Adhoc-
Bildungen über Habitualisierung und Konventionalisierung zum stereotypenMuster
avancieren können.Auch dem Sprachanalytiker fehlen mitunter
plausible Erklärungen, warum bestimmten Verbindungen eine solch
hochfrequente
Karriere beschieden ist, andereWendungen (denen man ein ähnliches
Potential zuschreibt) eine solche Verwendungsfreude jedoch nicht erfahren.
Die soziale Stellung und die Macht des Akteurs, hier des Bundeskanzlers
der
Bundesrepublik Deutschland, ist selbstredend ein wichtiger Faktor,mitnichten
aber ein hinreichender.“
Quante, M. & Schweikhard, David. P. (2016, Hrsg.) Marx-Handbuch.
Leben, Werk, Wirkung. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
Suchwort „plausib“ viele Treffer:
S. 17: „… Die Vermutung, Lassalle hätte innerhalb der Arbeiterbewegung
zu einem ernsthaften Konkurrenten für Marx werden können, hat
angesichts seiner Popularität einige Plausibilität (vgl. Berlin
1996, 152 ff.).“
S. 38: „Danach widmet sich Marx einer These Bauers, die er für
inkonsistent hält. Marx zufolge ist es möglich, dass Juden im
politischen Staat emanzipiert werden können und also Menschenrechte
bekommen. Bauer bestreitet diese Möglichkeit. Das ist laut Marx aber
offensichtlich unplausibel (I, 2, 155–162 / 1, 361–370): Marx geht
viele Rechtstexte durch, anhand derer die Bauer-These als deutlich zu erkennender
Unsinn entlarvt wird.“
Literatur (Auswahl)
Links (Auswahl: beachte)
Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Enzyklopädie der Philosophie und Wissenschaftstheorie
Argument
In der Enzyklopädie der Philosophie und Wissenschaftstheorie hat Argument keinen eigenen Eintrag, nur logisches Argument als Platzhalter für beliebige Objekte. Im Artikel Argumentation wird Argument als ein Schritt in einer Argumentation bezeichnet:
"Argumentation, Bezeichnung für eine Rede mit dem Ziel, die Zustimmung oder den Widerspruch wirklicher oder fiktiver Gesprächspartner zu einer i Aussage oder Norm (>für< bzw. >gegen< deren Wahrheit bzw. Gültigkeit (iGeltung) dann argumentiert wird) durch den schrittweisen und lückenlosen Rückgang auf bereits ge[>]meinsam anerkannte Aussagen bzw. Normen zu erreichen. Jede im Verlauf einer solchen Rede erreichte Zustimmung zu einer weiteren Aussage oder Norm (über die Ausgangssätze hinaus) kennzeichnet einen Schritt der A.; die einzelnen Schritte heißen die für (bzw. gegen) die zur Diskussion gestellte Aussage bzw. Norm vorgebrachten [EPWt1] >Argumente<. Geht in einer A. jedem [EPWt2] Argument genau ein anderes unmittelbar voraus und macht jedes [EPWt3] Argument vom Ergebnis des ihm unmittelbar vorhergehenden Gebrauch, so liegt eine >A.skette< vor. Kann niemand, der den Ausgangssätzen (Aussagen oder Normen) einer A. zugestimmt hat, irgendeinem ihrer Schritte die Zustimmung verweigern, ohne mindestens einer von ihm schon akzeptierten Aussage oder Norm zu widersprechen, so heißt die betreffende A. >schlüssig<. Eine schlüssige A. für eine Aussage bzw. Norm heißt eine t>Begründung< derselben, im Falle der Aussagen auch ein t>Beweis<.
A.en sind Gegenstand der tArgumentationstheorie, die in der Antike und erneut in der tRenaissance und im tHumanismus zur tRhetorik gerechnet wurde und deren Probleme insbes. bei Aristoteles in der tTopik eingehende Behandlung finden. Während schon hier die Analyse >sophistischer< (tSophistik) Scheinargumentationen breiteren Raum einnimmt, wird die A.slehre in der Spätscholastik noch einmal ausdrücklich als Theorie der richtigen oder schlüssigen A. verstanden und als solche in Lehrbüchern der Logik dargestellt. Erst die parlamentarische Rhetorik des 18. und 19. Jhs. läßt die Disziplin der Rhetorik von einer A.slehre zu einer Sammlung von Anweisungen zur erfolgreichen überredung des Hörers oder Lesers durch den Sprecher oder Autor auch oder gerade entgegen widerstreitenden schlüssigen überlegungen und damit zur >bloßen Rhetorik< im heutigen schlechten Sinne degenerieren. Dieser Sinn wird, in der Absicht auf praktische Anwendungen oder zumindest auf die Analyse faktisch häufiger Diskussionssituationen, auch in der >neuen Rhetorik< mit ihrem starken Interesse an der juristischen A. weitgehend beibehalten. Auf theoretischer Ebene sind von hier ausgehend sowohl Regeln des Obergangs von akzeptierten Aussagen bzw. Normen zu unter ihrer Voraussetzung ebenfalls akzeptablen weiteren Aussagen bzw. Normen (S. Toulmin) als auch die Bedingungen vernünftiger >Beratung, in der per definitionem Argumente die Entscheidungsbasis bilden (J. Habermas, P. Lorenzen, O. Schwemmer), untersucht worden."
__
Grund
Grund (engI. reason), philosophischer Terminus. In seiner systematisch wesentlichen Hauptbedeutung bezieht sich die Rede vom G. auf iAussagen im engeren Sinne (Tatsachenbehauptungen) und auf praktische Orientierungen (z.B. Zweckangaben, Handlungsregeln), und zwar dann, wenn sie in iArgumentationen zur iBegründung bzw. iRechtfertigung anderer Aussagen oder Vorschläge angeführt werden. Dabei können sowohl Aussagen als G.e für Handlungsvorschläge als auch praktische Orientierungen als G.e für Aussagen auftreten. Die erste Möglichkeit besteht etwa dann, wenn ein bedingter Handlungsvorschlag, in einer bestimmten Situation Bestimmtes zu tun, oder eine bedingte Zwecksetzung, in einer bestimmten Situation ein bestimmtes Situationsmerkmal herbeizuführen oder zu erhalten, bereits vereinbart sind. In diesem Falle läßt sich nämlich eine Aussage über die vorliegende Situation, die das Eintreten der in der vereinbarten Handlungsregel bzw. Zwecksetzung genannten Bedingung impliziert, als G. dafür anführen, entsprechend der dann maßgebenden Aufforderung zu verfahren. So läßt sich z. B. die Feststellung, daß es regnet, als G. für die Mitnahme eines Regenschirms anführen, wenn die Handlungsregel, sich bei Regen mit einem Schirm (und nicht z. B. nur mit einem Mantel) zu schützen, unterstellt werden kann. Ein Beispiel für den zweiten Fall ist das Vorbringen methodischer Normen im Disput darüber, ob eine Aussage methodisch zulässig gewonnen wurde. - Allgemeiner wird gelegentlich die aus einer Reihe von G.en im genannten Sinne geordnet aufgebaute >Grundlage< eines Vorschlages oder einer Aussage (oder eines ganzen Systems solcher Orientierungen) als G. bezeichnet. Vor allem in der Philosophie wird der Ausdruck >G.< ferner eingeschränkt auf die ersten und allgemeinen Schritte im Rahmen eines methodischen Aufbaus der Wissenschaften bzw. auf grundlegende Einsichten in die Basis der gesamten Lebenspraxis verwendet. Synonyme Ausdrücke sind dann häufig >Prinzip<, >Wesen< (,Wesensgrund<).
In einem zweiten Sinne tritt der Terminus ,G.< synonym mit> Ursache< auf, so etwa, wenn man sagt, die Tatsache, daß es in Strömen regnet, sei der G. dafür, daß ein Ankömmling durchnäßt ist. Daß G.e im zuerst genannten Sinne von iUrsachen wohl unterschieden werden sollten, ist vor allem für die Wissenschaft vom Menschen und von der Gesellschaft von Bedeutung. Behavioristische Ausrichtungen (tBehaviorismus) dieser Wissenschaften gehen nämlich häufig darauf zurück, daß gründeorientiertes Handeln als ursachenbedingtes Verhalten (iVerhalten (sich verhalten)) mißverstanden wird. Die vielfältige Verwendung des Ausdrucks >G.< in der Sprache der Philosophie ist bereits in dem relativ breiten Bedeutungsspektrum der zugehörigen Aristotelischen Termini apX11 und alrfa (Met. Ll1.l012b32-2.1014a25) angelegt. Aristoteles bestimmt als G. (apX11) eines Dinges (iArche) alles, was die Grundlage für dessen Existenz, Entstehung oder Erkenntnis bildet. Entsprechend ist dann später von Seins-, Werdens- und Erkenntnisgründen bzw. von Real- und Erkenntnisgründen die Rede. Unter den apxaiwerden von Aristoteles als alrfat (später zumeist mit i,causae< oder j>Ursachen< übersetzt) ausgezeichnet: der >Stoff< (iHyle), aus dem ein Ding besteht (causa materialis), die ihm aufgeprägte i,Form< (causa formalis), die ein Phänomen >bewirkende Ursache< (causa efficiens) und der ,Zweck< bzw. das >Ziel< eines Dinges oder Vorganges (causa finalis). Die Aristotelische Lehre von den vier >Ursachen< ist einer der klassischen Gegenstände der abendländischen Metaphy[]sik geworden und hat insbes. in der scholastischen Philosophie und Theologie (iScholastik) zu weiteren subtilen Differenzierungen Anlaß gegeben. Bei G. W. Leibniz wird der Satz vom G. (iGrund, Satz vom) zu einem fundamentalen Prinzip der Philosophie.
__
Internetseite
Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren, geben wir nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia, DER SPIEGEL)
__
Standort: Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskrterien in Sprachwissenschaft, Linguistik, Literaturwissenschaft, Kommunikationstheorie, Journalistik, Rhetorik
*
Haupt- und Verteilerseite Begriffsnanalysen Plausibilität.
Empirische Studie zu Begriff und Verständnis von Plausibilität.
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen * Methodik der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *
Definieren und Definition * Wissenschaftliches Arbeiten * Zitieren in der Wissenschaft *
Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Wissenschaft site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, R. (DAS). Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskrterien in Sprachwissenschaft, Linguistik, Kommunikationswissenschaft, Journalistik, Rhetorik. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Plausib/BApl_SprLingKom.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_ Begriffsanalyse Plausibilität in Sprach- & Kommunikationswissenschaften__Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_
noch nicht end-korrigiert
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
07.08.21 Als eigene Seite angelegt.
01.07.21 Mit der Recherche und Materialsammlung begonnen.