(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=28.09.2021 Internet Erstausgabe, letzte Änderung: 18.04.22
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_ Begriffsanalyse Plausibilität in der Philosophie_Datenschutz_Rel. Aktuelles_Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_Service iec-verlag___ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT1, Abteilung Wissenschaft, Bereich Sprache und Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema:
Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskriterien in der Philosophie.
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen Plausibilität.
Empirische Studie zu Begriff und Verständnis
von Plausibilität.
Haupt- und Verteilerseite
Begriffsanalysen * Methodik
der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *
Zusammenfassung - Abstract - Summary
Viele PhilosophInnen gebrauchen "plausibel" / "Plausibilität, aber sie erklären und begründen nicht, was plausibel oder Plausibilität ausmacht, wie man zu der Beurteilung "plausibel / Plausibilität" gelangen kann (z.B. Hintze, Janich, Müller, Quine, Tetens). Im Wörterbuch der philosophischen Begriffe von Rudolf Eisler (1904) gibt es keinen Eintrag "Plausibilität" und auch nicht in der modernen Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, 2.A., O-P. Auch nicht in Austeda, Franz (1962) Wörterbuch der Philosophie. Berlin: Humboldt; nicht in Schmid, Heinrich & Schischkoff, Georgi (1961) Philosophisches Wörterbuch. Stuttgart: Kröner und nicht in Hoffmeister, Johannes (1955) Wörterbuch der Philosophie. 2.A. Hamburg: Meiner. Anscheinend halten die PhilosophInnen plausibel für nicht einen erklärungs- und begründungsbedürftigen Grundbegriff. Ausführlich wird Plausibilität aber im Historischen Wörterbuch der Rhetorik besprochen, das andernorts präsentiert wird..
Begriffsgeschichtlich erscheint mir bemerkenswert, dass Berkeley bereits 1710 in seinem Treatise concerning the Principles of Human Knowledge den Ausdruck "plausible" zwei mal als quantitativen Begriff gebraucht, obwohl das Wort "plausible" erst um 1650 in Frankreich aufgebracht worden sein soll (eine franz. Quelle aus 1691 hier).
Zusammenfassung des Gebrauchs in der Philosophie der bislang erfassten AutorInnen:
- Berkeley 1710:
- Berkeley-1: Unmittelbare Sinnliche Erfahrungserkenntnis steht über der Plausibilität. Die Formulierung "wie plausibel dieselbben auch seien" zeigt bereits eine quantitative Auffassung 1710.
- Berkeley-2: Auch die zweite Fundstelle ist ein Beleg für die frühe quantitative Aufassung ("most plausible") der Plausibilität.
- Friedmann: Plausibilität wird nicht erklärt, sondern in allen 7 Gebrauchsbeispielen als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger Grundbegriff gebraucht.
- Göhmann 2011: 16 Fundstellen. noch nicht ausgewertet.
- Grajner 2019: 142 Fundstellen, noch nicht ausgewertet.
- Eduard von Hartmann gegen Lange: Plausibilität wird gebraucht, aber nicht erklärt oder begründet.
- Hegel Plausibel wird von Hegel in allen 4 Fällen nicht näher erläutert oder begründet, auch nicht durch eine Anmerkung oder Fußnote. Hegel setzt anscheinend voraus, dass plausibel verständlich und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichtig ist.
- [Heg1]: allgemein plausibel als allgemein bekannt und verständlich.
- [Heg2]: plausibel als verständlich.
- [Heg3]: "so plausibel" enthält eine gewisse Quantität. Der Tenor ist: etwas kann sehr plausibel erscheinen, ohne es wirklich zu sein.
- [Heg4]: Tenor: einen Übergang verständlich machen ist zu wenig, Plausibilität genügt hier nicht.
- Hintze 1998: Suchwort "plausib" vier Treffer. Der Begriff wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweise mittels Fußnote oder Anmerkung. Daraus ergibt sich plausibel ;-) dass der Begrif anscheinend nicht für erklärungs- und begründungsbedürftig gehalten wird.
- Janich 2001 Zusammenfassung Janich (2001, 2014): Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält Janich plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff. (7 Fundstellen) und Neuauflage 2014 (8 Fundstellen):
- PJ2001-S.58: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Das Beispiel überzeugt nicht, ist nicht plausibel ;-). Es handelt sich um eine empirische Unmöglichkeit. So auch im entsprechenden KommentarPJ2014-S.35.
- PJ2001-70: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Aber der Kontext legt nahe, dass Plausibilität als glaubwürdig betrachtet wird. So auch im entsprechenden KommentarPJ2014-50
- PJ2014-100: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Dem Kontext kann man entnehmen, dass Beispiele aus dem Alltag die Plausibilität fördern. Die Stelle fehlt in der 1. Auflage.
- PJ2001-S.104: Plausibel weil anschaulich? So auch im entsprechendenKommentarPJ2014-S.108.
- PJ2001-S.133 Gewisse Plausibilität wird nicht erklärt, aber die Formulierung impliziert eine quantitative oder partikuläre Bedeutung. So auch im entsprechenden KommentarPJ2014-S.133
- PJ2001-S.162 Plausibel wird nicht erklärt, aber dem Zusammenhang nach mit methodisch gleichgesetzt. So auch im entsprechenden KommentarPJ2014-S.162.
- PJ2001-S.186a: Plausibel als verträglich mit zeitlicher Abfolge? So auch im entsprechenden KommentarPJ2014-S.206a.
- PJ2001-S.186b: Schein-Plausibilität durch den Anschein persönlichen Erlebens? So auch im entsprechenden PJ2014-S.206b.
- Kutschera 1975. Zusammenfassung Kutschera 1975: Plausibel wird nicht erklärt oder begründet, auch nicht durch Querverweise, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis und damit wahrscheinlich als nicht erklärungs- und begründungspflichtiger Grundbegriff betrachtet.
- Ku1975-S.35: Im Superlativ "plausibelsten" steckt ein quantitatives Kriterium.
- Ku1975-S.119 (Quine Zitat): Ein ziemlich dunkle Aussage "in einem plausiblen Sinne von Äquivalenz, und sei er auch noch so unbestimmt", wobei sowohl offen bleibt, was plausibel bedeuten soll als auch was "in einem plausiblen Sinne von Äquivalenz" bedeuten soll.
- Ku1975-S.305: Im "höchst plausibel" steckt ein quantitatives Kriterium.
- Ku1975-S.308: Im "mindestens" steckt ein quantitatives Kriterium.
- Zusammenfassung J.S. Mill: Plausibel wird nicht erklärt oder begründet, sondern so verwendet, als sei der Begriff jedermann klar und damit weder erklärungs- noch begründungspflichtig.
- Kommentar-MJS01: "sehr plausibel" bedeutet eine quantitativen Plausibilitätsbegriff.
- Kommentar-MJS02: plausibel im Sinne von verständlich.
- Kommentar-MJS03: so plausibel dies indessen aussieht, hält es doch genauer Prüfung nicht stand. Der Anschein von starker Plausibilität genügt nicht, womit ein quantitativer Plausibilitätsbegriff vertreten wird, der im Kieselsteinbeispiel einer genaueren Prüfung. Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.
- Kommentar-MJS04: plausibel wird hier auf begreiflich zurückgeführt und zu natürlich in Beziehung gesetzt..
- Kommentar-MJS05: Durch Einbildungskraft ersonnene Gesetze (Beispiel Descartes Wirbel) sind nicht so plausibel wie solche, die durch Analogie an bekannte Naturgesetze (Beispiel Newtons Centralkraftgesetz) anschließen. Damit formuliert Mill ein Plausibilitätskriterium. Auch hier wird ein quantitativer Plausibilitätsbegriff (nicht so plausibel) zu Grunde gelegt.
- Kommentar-MJS06: Um eine Lehre plausibel machen kann darf sie nicht augenfälligen Tatsachen widersprechen..
- Kommentar-MJS07: Manches kann auf den ersten Blick plausibel erscheinen ... darin schwingt mit, dass der Anschein kritischer Prüfung nicht standhalten wird. Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.
- Kommentar-MJS08: "so sehr plausibel" drückt einen quantitativen Plausibilitätsbegriff aus. Die Plausibilität wird auf eine einleuchtende Prämisse zurückgeführt.
- Kommentar-MJS09: Eine plausible Ansicht (Beispiel Vicos Kreistheorie) hält strenger Prüfung nicht stand. Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.
- Kommentar-MJS10: "ganz plausibel erscheint" spricht für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff. Die gute Herrschaft verpuffte ohne positive Wirkung auf das Volk. Damit bringt Mill ein Wirkungskriterium für Plausibilität ins Spiel.
- Zusammenfassung Müller: Aus den Beispielen OMS.S.3, OMS.S.4, OMS.S.7, OMS.S.8, OMS.S.9, OMS.S.11, OMS.S.14a, OMS.S.14b, OMS.S.20, OMS.S.22, OMS.S.23b ergibt sich, dass plausibel / Plausibilität nicht erklärt und das Plausibilitätsurteil nicht begründet wird, woraus man annehmen darf, dass das auch nicht für nötig erachtet wird. Eine quantitative Aufassung wird ersichtlich in: OMS.S.4, OMS.S.14b. Plausibles darf nicht widersprüchlich oder falsch sein und was mehr umfasst ist plausibler:
- OMS.S.2: Die Erklärung für unplausibel ergibt sich aus dem Kontext: Was heillos widersprüchlich ist, ist nicht plausibel.
- OMS.S.14b: Nicht ganz Unplausibel nicht erklärt. "Nicht ganz unplausibel" spricht für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff. Dem Zusammenhang nach: unplausibel weil falsch.
- OMS.S.20: Unplausibel wird nicht erklärt. Aus dem Zusammenhang: was viel umfasst ist eher plausibel.
- Zusammenfassung Quine: Plausibel wird in den drei Fundstellen weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält Quine plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.
- Kommentar-Rorty1993-S.243: Plausibilität wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung, sondern anscheinend als nicht weiter erklärungs- oder begründungsbedürftiger Grundbegriff angenommen.
- Zusammenfassung-Schmidt. In dem grundlegenden und interessanten Werk habe ich drei Fundstellen für "Plausibilität" und "plausibel" gefunden. Der Begriff wird nicht erklärt und in seiner Bedeutung begründet. Aus der ersten Textsstelle S. 59 ergibt sich, dass es nach Schmidt eine unmittelbare und damit auch eine mittelbare (plausibel ;-)?) Plausibilität gibt. Die zweite Fundstelle ergibt: Plausibilität durch empirische Befunde des Lernens geltend gemacht. Also Gründe für Plausibilität durch empirische Befunde. Auch der Dritten kann man dies entnehmen: Plausibilität durch empirische Befunde der Gestalttheorie geltend gemacht. Also Gründe für Plausibilität durch empirische Befunde.
- Zusammenfassung-Simmel: Aus den drei Fundstellen geht hervor, dass Simmel Plausibilität bzw. eine "gewisse Plausibilität" nicht erklärt und begründet.
- Zusammenfassung SpohnMR: Die beiden Fundstellen belegen: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält SpohnMR plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.
- Zusammenfassung Handbuch der Pragmatik 2: Suchwort "plausib" vier Treffer: 42, 60, 182, 280 und einen Sachregistereintrag (ungewöhnlich).
- HBP-2-S.42 Die erste Fundstelle S. 42 weist auf einen quantitativen Plausibilitätsbegriff hin.
- HBP-2-S.60: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält der Autor plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.
- HBP-2-S.182: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält der Autor plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.
- Kommentar-HBP-2-S.280 "Am plausibelsten" spricht für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff. Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält der Autor plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.
- Zusammenfassung Tetens (2006): Tetens verwendet den Plausibilitätsbegriff wenigstens 7 mal, aber er erklärt ihn nicht, ein interessanter Befund für ein philosophisches Argumentationsbuch. Anscheinend ist Plausibilität für Tetens ein allgemein verständlicher Grundbegriff, den man nicht erklären muss oder vielleicht auch gar nicht erklären kann.
- Zusammenfassung Wikipedia zu Albert: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält Wikipedia (2005/2006, S. 14856) plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.
Lexika, Wörterbücher, Enzyklopädien
Eisler (1904) Wörterbuch der philosophischen Begriffe:
kein Eintrag "Plausibilität".
Mittelstraß () Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie,
2.A., O-P: kein Eintrag "Plausibilität".
Auch nicht in Austeda, Franz (1962) Wörterbuch der Philosophie.
Berlin: Humboldt: kein Eintrag "Plausibilität".
Schmid, Heinrich
& Schischkoff, Georgi (1961) Philosophisches Wörterbuch. Stuttgart:
Kröner: kein Eintrag "Plausibilität".
Hoffmeister,
Johannes (1955) Wörterbuch der Philosophie. 2.A. Hamburg: Meiner
kein Eintrag "Plausibilität".
Berkeley, George (1685-1753) Treatise concerning the Principles of Human Knowledge (1710)
Vorbemerkung: Dafür, dass der Begriff erst um 1650 in Frankreich aufkam (>Quelle 1691), ist Bischof Berkeley mit seinem Werk 1710 mit dem Wort "plausibel" zeitlich sehr aktuell mit seinem Gebrauch. Eine erste deutsche Übersetzung von Berkeles Hauptwerk erschien erst 1869 durch Überweg. Um sicher zu gehen, dass es nicht um eine Übersetzungsbesonderheit handelt, habe ich noch einmal die Originalversion auf englisch eingesehen. Aber auch hier findet sich der Ausdruck: [B1e] "XL. But say what we can, some one perhaps may be apt to reply, he will still believe his Senses, and never suffer any Arguments, how plausible soever, to prevail over the Certainty of them. ....". Bei dieser Gelegenheit fand ich einen weiteren Gebrauch von plausibel, den das Suchergebnis der Digitalen Bibliothek nicht ausgewiesen hat: "XCV. The same absurd Principle, by mingling it self with the Articles of our Faith, hath occasioned no small Difficulties to Christians. For Example, about the Resurrection, how many Scruples and Objections have been raised by Socinians and others? [B2e] But do not the mostplausible of them depend on the supposition, that a Body is denominated the same, with regard not to the Form or that which is perceived by Sense, but the material Substance which remains the same under several Forms? Nachdem der Funstellenort "XCV" klar ausgewiesen war, war es dann leicht, auch in der deutschen Übersetzung die Stelle zu finden.
[B1] "XL. Vielleicht aber erwidert Jemand, was wir
auch immer sagen mögen, er wolle seinen Sinnen glauben und nicht zugeben,
dass Argumente irgend welcher Art, wie plausibel
dieselben auch seien, mehr gelten als die sinnliche Gewissheit. Dem sei
so, behauptet, so sehr ihr mögt, die Zuverlässigkeit der Sinne,
wir sind ganz damit einverstanden. Das, was ich sehe, höre und fühle,
existirt, d.h. es wird durch mich percipirt; daran zweifle ich ebenso wenig
wie an meinem eigenen Sein. Aber ich sehe nicht, wie das Zeugniss des Sinnes
als ein Beweis der Existenz eines Dinges angeführt werden kann, welches
nicht durch den Sinn percipirt wird. Wir wollen nicht, dass irgend Jemand
ein Zweifler werde und seinen Sinnen misstraue, wir gestehen denselben
im Gegentheil alle denkbare Kraft und Zuverlässigkeit zu; auch giebt
es keine Principien, welche dem Skepticismus mehr widerstritten als die
von uns dargelegten, wie hernach klar gezeigt werden wird.
[Berkeley: Abhandlungen über die Principien der menschlichen Erkenntnis.
DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 5032
(vgl. Berkeley-Erk., S. 41) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-Berkeley-1: Unmittelbare Sinnliche Erfahrungserkenntnis
steht über der Plausibilität. Die Formulierung "wie plausibel
dieselbben auch seien" zeigt bereits eine quantitative Auffassung 1710.
[B2] XCV. Das nämliche
ungereimte Princip hat, indem er sich mit den Artikeln unsers Glaubens
mischte, Christen nicht geringe Schwierigkeiten verursacht. Wie viele Zweifel
und Einwürfe sind nicht z.B. in Betreff der Wiederauferstehung von
Socinianern und Anderen erhoben worden! Aber hängen nicht die plausibelsten
derselben von der Voraussetzung ab, dass ein Körper der nämliche
genannt werde nicht in Betracht seiner Form oder dessen, was durch die
Sinne percipirt wird, sondern der materiellen Substanz, welche unter mancherlei
Formen die nämliche bleibe? Wird diese materielle Substanz hinweggenommen,
um deren Identität der ganze Streit sich dreht, und wird unter Körper
verstanden, was jede schlichte gewöhnliche Person unter diesem Worte
versteht, nämlich das unmittelbar Gesehene und Gefühlte, was
nur eine Verbindung von sinnlichen Eigenschaften ist, so reduciren sich
jene unbeantwortbaren Einwürfe auf nichts.
[Berkeley: Abhandlungen über die Principien der menschlichen Erkenntnis.
DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 5084
(vgl. Berkeley-Erk., S. 72) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-Berkeley-2: Auch die zweite Fundstelle
ist ein Beleg für die frühe quantitative Aufassung ("most plausible")
der Plausibilität.
Friedmann Anfangs- und Begründungsproblem der Erlanger Schule
Quelle: Friedmann, Johannes (1981) Kritik konstruktivistischer Vernunft. Zum Anfangs- und Begründungsproblem bei der Erlanger Schule. München: Fink.
Zusammenfassung Friedmann: Plausibilität wird nicht erklärt, sondern in allen 7 Gebrauchsbeispielen als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger Grundbegriff gebraucht.
[1JF] S.18f: "In der gegenwärtigen (nichtkonstruktivistischen)
Wissenschaftstheorie finden sich jedoch kaum systematische Bemühungen
um zureichende Anfangsbegründungen, und in der Wissenschaftspraxis
werden Begründungsversuche konkreter einzelwissenschaftlicher Anfänge
allenfalls im Rahmen zielorientier-[>19]ter Nützlichkeitserwägungen
oder propädeutischer Plausibilitätsbetrachtungen
unternommen. Diese Lage der Dinge wird häufig auf die negative Beurteilung
der prinzipiellen Möglichkeiten zureichender Begründung zurückgeführt,
die vor allem durch POPPERs wissenschaftslogische (und partiell auf HUME
zurückgehende) Überlegungen bekannt geworden ist' ; in dem von
POPPERs sozialwissenschaftlich engagierten Mitstreiter ALBERT formulierten
„Münchhausen-Trilemma" hat diese Beurteilung ihren meistzitierten
Niederschlag gefunden."
KommentarJF18: Plausibilität wird nicht erklärt,
sondern als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger
Grundbegriff gebraucht.
[2JF] S.30: "(ii) Oder man argumentiert schon vor Vollzug „erster" Schritte
für deren Eignung, namentlich, um Interessenten von der richtigen
Wahl zu überzeugen; es liegt auf der Hand, daß eine solche Argumentation
unter den erwähnten Prämissen allenfalls unsystematisch und im
Rahmen einer „ad-hominem-Plausibilität"
erfolgen wird."
KommentarJF30: Plausibilität wird nicht erklärt,
sondern als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger
Grundbegriff gebraucht.
[3JF] S.78 FN2: "Eine plausible Möglichkeit
hängt mit den Opponentenregeln zusammen: eventuell wird die Frage
aufgetaucht sein, warum denn nicht auch die Opponentenregeln sukzessive
liberalisiert worden sind — und sei es nur, um die „lebenspraktische" Symmetrie
zwischen beiden Dialogpartnern wiederherzustellen. Der Grund hierfür
scheint nun schlicht der zu sein, daß andernfalls nicht einmal das
Nachgewiesene garantiert werden könnte: nämlich, daß die
konstruktiv logisch-wahren Formeln automatisch auch klassisch logisch-wahr
sind. Diese Einsicht hat aber offenbar wenig mit dem gesteckten Begründungsziel
gemein."
KommentarJF78: Plausibilität wird nicht erklärt,
sondern als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger
Grundbegriff gebraucht.
[4JF] S.78f: "(1) Wie die betreffenden Definitionen demonstrieren, läßt
sich klassische Logik ebenfalls dialogisch rekonstruieren; damit steht
die Konkurrenz zunächst [>79]remis. Und es ist nicht günstig,
allgemeine Plausibilitätsbetrachtungen
wie etwa die von der „Natürlichkeit"' intuitionistischer Regeln anzustellen.
..."
KommentarJH78f: Plausibilität wird nicht erklrät,
sondern als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger
Grundbegriff gebraucht.
[5JF] S.84: "Erst die Einbringung einer weiteren Hypothese leistet den
gesuchten Zusammenhang. HINST macht den plausiblen
Vorschlag, hierfür die konstniktive Adjunktionsbedingung zu verwenden:"
KommentarJH84: Plausibilität wird nicht erklärt,
sondern als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger
Grundbegriff gebraucht.
[6JF] S.108f: "Nach Konstitution der sprachlichen Grundbausteine führte
ein nicht immer [>] plausibler Weg zur Etablierung
des illokutionären Behauptungsaktes und schuf so die Voraussetzung
für die Vermittlung konstruktivistischer Logik; durch bestimmte Verbindungsweisen
elementarer zu komplexen Aussagen konnten logische Konstanten konstruiert
werden, deren Verwendung über Regeln für dialogische Streitgespräche
um das Zutreffen behaupteter Aussagen festgelegt waren.
KommentarJH108f: Plausibilität wird nicht erklärt,
sondern als allgemeinverständlicher, nicht erklärungs- und begründungspflichtiger
Grundbegriff gebraucht.
[7JF] S.144f: "Dies scheint nun in der Tat die einzig plausible Hypothese: denn wie anders könnte dem Erlanger Schulkind auf methodisch gesicherte Weise die Bedeutung von „wirkliches Bedürfnis" vermittelt werden als wieder dadurch, daß der Er-[>145]langer Lehrer (auf letztlich autoritäre Weise) exemplarisch bestimmt, was Beispiel und was Gegenbeispiel für den in Rede stehenden Prädikator sein soll. Damit lautet die Frage indes nicht länger:
- Ist B als ein wirkliches Bedürfnis zu werten?
- Ist B für die kompetenten Sprecher der ethischen Sprache S mit
den Einführungssituationen für den terminus technicus „wirkliches
Bedürfnis" kompatibel?"
Göhmann, Dirk (2011) DER UTILITARISMUS JOHN STUART MILLS Eine biographische Rekonstruktion der Theorie und Praxis des Utilitarismus bei Mill, Inaugural-Dissertation
16 Fundstellen:
Quelle: https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-24489/G%C3%B6hmann%2C%20Dirk%20-%20Der%20Utilitarismus%20John%20Stuart%20Mills.pdf
Grajner, Martin & Melchior, Guido (2019,
Hrsg.) Handbuch Erkenntnistheorie. Berlin: Metzler-Springer.
Suchwort „plausib“ 142 Treffer.
Suchwort "Plausibilitätskriterien" keine Treffer.
Eduard von Hartmann (1842-1906) gegen Lange [DigBib]
A17 S. 43 Z. 9 v. u. Es sind von verschiedenen Seiten gegen diese Argumentation mittelst Wahrscheinlichkeitsrechnung Bedenken erhoben worden, welche jedoch meistens einen zu grossen Mangel an Verständniss verrathen, als dass es lohnen könnte, sich mit denselben näher zu beschäftigen, und welche sämmtlich nicht auf denjenigen Punkt eingehen, welchen ich schon oben (S. 40 Anm.) als denjenigen bezeichnet habe, an welchem die concrete Anwendbarkeit des fraglichen Argumentationsverfahrens am leichtesten scheitern kann. Nur einen Gegner will ich hier erwähnen, theils weil seine falschen Einwände eine gewisse Plausibilität besitzen, theils weil er mich auf die Nothwendigkeit einer Ergänzung meiner Argumentation für schwer begreifende oder übelwollende Leser aufmerksam gemacht hat, welche ich als überflüssig dem Verständniss des Lesers selbst überlassen zu können geglaubt hatte. Albert Lange bestreitet in seiner »Geschichte des Materialismus« (2. Aufl. Bd. II, S. 280-283 u. 307-309) die Anwendbarkeit des ganzen Schlussverfahrens auf Probleme der Natur, insofern es sich um Rückschlüsse aus den Erscheinungen auf ihre Ursachen handelt und zwar aus dem Grunde, weil die Wirklichkeit, als ein Specialfall aus sehr vielen Möglichkeiten a priori stets als äusserst unwahrscheinlich erscheinen müsse, was aber ihrer Wirklichkeit keinen Abbruch thue, da der Wahrscheinlichkeitsbruch gar nichts als den Grad unsrer subjectiven Ungewissheit bedeute (S. 282 Z. 15-11 v. u., 283 Z. 3-6 v. o.). Er stützt diese Ablehnung darauf, dass die ganze Wahrscheinlichkeitslehre eine Abstraction von den wirkenden Ursachen sei, die wir eben nicht kennen, während uns gewisse allgemeine Bedingungen bekannt seien, die wir unserer Rechnung zu Grunde legen (282 Z. 11-7 v. u.). Wäre die letztere Behauptung richtig, so wäre gegen die vorangestellte Folgerung aus derselben nichts einzuwenden; in der That bedarf dieselbe aber einer bedeutenden Modification. Wären nämlich die mitwirkenden Ursachen, von denen man abstrahirt, schlechthin unbekannt in jeder Beziehung, so würde von der Aufstellung einer Wahrscheinlichkeit überhaupt gar nicht die Rede sein können; die Wahrscheinlichkeitsrechnung wird vielmehr erst möglich unter der Voraussetzung, dass die mitwirkenden Ursachen, von denen abstrahirt wird, zufällige Ursachen seien. Unter zufälligen Ursachen im Sinne der Wahrscheinlichkeitsrechnung sind aber solche zu verstehen, welche zu dem Zustandekommen der fraglichen Erscheinung nicht in dieser Gestalt unerlässlich sind, daher auch nicht constant bei demselben angetroffen werden, sondern derartig wechseln, dass ihr Einfluss sich in um so höherem Grade compensirt, je öfter der Vorgang sich wiederholt. Der Ansatz, den die Wahrscheinlichkeitsrechnung macht, beruht auf der Voraussetzung einer vollständigen Compensation der zufälligen mitwirkenden Ursachen in unendlich vielen Wiederholungen. Solche zufällige Ursachen sind z.B. in der unorganischen Natur die Ursachen, welche das Fallen des Würfels auf diese oder jene Seite bedingen, in der organischen Natur diejenigen, welche die monströsen und gehemmten Bildungsgänge veranlassen.
Nur indem Lange diese Grundvoraussetzung der Wahrscheinlichkeitsrechnung ausser Acht lässt, kann er die Zulässigkeit eines Rückschlusses von wahrgenommenen Wirkungen auf die Beschaffenheit der Ursachen leugnen. Wenn ich z.B. an ein rouge et noir- Spiel herantrete, in welchem ich 20 Mal hintereinander rouge fallen sehe, so ist freilich kein Zweifel, dass dieses Ereigniss durch blosse Combination zufälliger Ursachen hervorgerufen sein kann; aber so wenig diese Möglichkeit zu bezweifeln ist, so wird doch die ausserordentlich geringe Wahrscheinlichkeit derselben mir das Recht geben, auch die andere Möglichkeit in's Auge zu fassen, dass eine constante Ursache vorhanden sei, welche das rouge begünstigt. Lange wird gewiss denjenigen keines falschen Schlusses zeihen, welcher Bedenken trägt, sein Geld an ein solches Spiel zu riskiren, weil der Verdacht (d.h. der Wahrscheinlichkeitsschluss) nahe gelegt ist, dass das Spiel betrügerisch eingerichtet sei, obwohl immer die Möglichkeit zugestanden bleibt, dass dieser Verdacht irrthümlich sein könne. Wenn aber Lange die Berechtigung eines solchen Rückschlusses einräumt, so kann er dieselbe für meine Beispiele nicht versagen, er müsste denn a priori zu beweisen im Stande sein, dass die Classe von constanten Ursachen, welche ich supponire, unmöglich sei. Auf letztere, freilich jedes Beweises entbehrende Behauptung läuft in der That sein Einwand heraus; nicht das Schlussverfahren kann er von Rechtswegen antasten, sondern nur die Zulässigkeit des hypothetischen Zieles, auf welches dasselbe Anwendung findet, sucht er von dem vorurtheilsvollen Standpunkt einer materialistisch-mechanischen Weltanschauung aus zu bestreiten. Aus dem Gesichtspunkt der Wahrscheinlichkeitsrechnung wäre ein solches Verfahren nur dann statthaft, wenn der mechanischen Weltanschauung, welche die Zuflucht zu metaphysischen Principien (nicht etwa bloss zu mythologischen persönlichen Geistern) verbietet, von vornherein eine so ungeheure Wahrscheinlichkeit gesichert wäre, dass auch die Gegeninstanzen von grösster Wahrscheinlichkeit jene Wahrscheinlichkeit nicht zu erschüttern vermöchten. Wäre dies der Fall, so wäre freilich, wie Lange meint, alle Philosophie und Metaphysik unmöglich; ob dem aber so sei, soll eben durch meine Untersuchung erst ausgemacht werden und gilt mir vorläufig als ein unwissenschaftliches Vorurtheil, als eine blosse petitio principii, deren Unwahrheit sich je länger je mehr herausstellen wird.
Lange sucht seinen Protest gegen das Zurückgreifen auf metaphysische Principien durch ein Gleichniss zu bekräftigen, indem er behauptet, nach der gleichen Methode könne man bei häufiger Wiederkehr der günstigen Chance im Glücksspiel die Mitwirkung einer Fortuna oder eines spiritus familiaris mit gleicher Wahrscheinlichkeit beweisen. Zunächst fehlt hier die von mir in meiner Erörterung vorausgesetzte Elimination constanter materieller Ursachen; d.h. es müsste vor solchem Rückschluss auf eine Fortuna eine genaue Untersuchung vorhergehen, ob die Würfel oder die Einrichtung des rouge et noir-Spiels nicht mit Fehlern behaftet ist, welche als constante Ursache
[Hartmann: Philosophie des Unbewußten. Philosophie von Platon bis Nietzsche, S. 59506 (vgl. Hartmann-Unbew. Bd. 1, S. 442 ff.)
https://www.digitale-bibliothek.de/band2.htm ]
Kommentar-Hartmann: Plausibilität wird gebraucht, aber nicht erklärt oder begründet.
Hegel (1770-1831)
[Heg1] Es ist noch die unmittelbare Verbindung anzumerken, in welcher die Erhebung über die hundert Taler und die endlichen Dinge überhaupt mit dem ontologischen Beweise und der angeführten Kantischen Kritik desselben steht. Diese Kritik hat sich durch ihr populäres Beispiel allgemein plausibel gemacht; wer weiß nicht, daß hundert wirkliche Taler verschieden sind von hundert bloß möglichen Talern? daß sie einen Unterschied in meinem Vermögenszustand ausmachen? Weil sich so an den hundert Talern diese Verschiedenheit hervortut, so ist der Begriff, d.h. die Inhaltsbestimmtheit als leere Möglichkeit, und das Sein verschieden voneinander; also ist auch Gottes Begriff von seinem Sein verschieden, und sowenig ich aus der Möglichkeit der hundert Taler ihre Wirklichkeit herausbringen kann, ebensowenig kann ich aus dem Begriffe Gottes seine Existenz »herausklauben«; aus diesem Herausklauben aber der Existenz Gottes aus seinem Begriffe soll der ontologische Beweis bestehen.
Quelle: [Hegel: Wissenschaft der Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 13157
(vgl. Hegel-W Bd. 5, S. 91-92) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm ]
Kommentar-[Heg1]: allgemein plausibel als allgemein bekannt und verständlich. Plausibel wird hierbei nicht näher erläutert oder begründet, auch nicht durch eine Anmerkung oder Fußnote. Hegel setzt anscheinend voraus, dass plausibel verständlich und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichtig ist.
[Heg2] Es wird für einen
Triumph der Wissenschaft ausgegeben, durch den bloßen Kalkül
über die Erfahrung hinaus Gesetze, d. i. Sätze der Existenz,
die keine Existenz haben, zu finden. Aber in der ersteren noch naiven Zeit
des Infinitesimalkalküls sollte von jenen Bestimmungen und Sätzen,
in geometrischen Verzeichnungen vorgestellt, ein reeller Sinn für
sich angegeben und plausibel gemacht und sie
in solchem Sinne zum Beweise von den Hauptsätzen, um die es zu tun
war, angewendet werden (man sehe den Newtonschen Beweis von seinem Fundamentalsatze
der Theorie der Gravitation in den Philosophiae naturalis principia mathematica,
lib, I, Sect. II, Prop. I. verglichen mit Schuberts Astronomie, erste Ausg.,
Bd. III, § 20, wo zugestanden wird, daß es sich nicht genau
so, d. i. in dem Punkte, welcher der Nerv des Beweises ist, sich nicht
so verhalte, wie Newton annimmt).
Quelle: [Hegel: Wissenschaft der Logik. DB Sonderband:
100 Werke der Philosophie, S. 13515
(vgl. Hegel-W Bd. 5, S. 320) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-[Heg2]: plausibel als verständlich.
Plausibel wird hierbei nicht näher erläutert oder begründet,
auch nicht durch eine Anmerkung oder Fußnote. Hegel setzt anscheinend
voraus, dass plausibel verständlich und nicht weiter erklärungs-
oder begründungspflichtig ist.
[Heg3] Ein Hauptgesichtspunkt
der kritischen Philosophie ist, daß, ehe daran gegangen werde, Gott,
das Wesen der Dinge usf. zu erkennen, das Erkenntnisvermögen selbst
vorher zu untersuchen sei, ob es solches zu leisten fähig sei; man
müsse das Instrument vorher kennenlernen, ehe man die Arbeit unternehme,
die vermittels desselben zustande kommen soll; wenn es unzureichend sei,
würde sonst alle Mühe vergebens verschwendet sein. – Dieser Gedanke
hat
so plausibel geschienen, daß er die größte
Bewunderung und Zustimmung erweckt und das Erkennen aus seinem Interesse
für die Gegen-[] stände und dem Geschäfte mit denselben
auf sich selbst, auf das Formelle, zurückgeführt hat. Will man
sich jedoch nicht mit Worten täuschen, so ist leicht zu sehen, daß
wohl andere Instrumente sich auf sonstige Weise etwa untersuchen und beurteilen
lassen als durch das Vornehmen der eigentümlichen Arbeit, der sie
bestimmt sind. Aber die Untersuchung des Erkennens kann nicht anders als
erkennend geschehen; bei diesem sogenannten Werkzeuge heißt dasselbe
untersuchen nichts anderes, als es erkennen. Erkennen wollen aber, ehe
man erkenne, ist ebenso ungereimt als der weise Vorsatz jenes Scholastikus,
schwimmen zu lernen, ehe er sich ins Wasser wage.
Quelle: [Hegel: Enzyklopädie der philosophischen
Wissenschaften im Grundrisse. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie,
S. 14693
(vgl. Hegel-W Bd. 8, S. 53-54) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-[Heg3]: "so plausibel" enthält eine
gewisse Quantität. Der Tenor ist: etwas kann sehr plausibel erscheinen,
ohne es wirklich zu sein. Plausibel wird hierbei nicht näher erläutert
oder begründet, auch nicht durch eine Anmerkung oder Fußnote.
Hegel setzt anscheinend voraus, dass plausibel verständlich und nicht
weiter erklärungs- oder begründungspflichtig ist.
[Heg4] Diese Realisierung des
Begriffs, in welcher das Allgemeine diese eine in sich zurückgegangene
Totalität ist, deren Unterschiede ebenso diese Totalität sind
und die durch Aufheben der Vermittlung als unmittelbare Einheit sich bestimmt
hat, ist das Objekt.
So fremdartig auf den ersten Anblick dieser Übergang
vom Subjekt, vom Begriff überhaupt und näher vom Schlüsse
– besonders wenn man nur den Verstandesschluß und das Schließen
als ein Tun des Bewußtseins vor sich hat – in das Objekt scheinen
mag, so kann es zugleich nicht darum zu tun sein, der Vorstellung diesen
Übergang plausibel machen zu wollen. Es
kann nur daran erinnert werden, ob unsere gewöhnliche Vorstellung
von dem, was Objekt genannt wird, ungefähr dem entspricht, was hier
die Bestimmung des Objekts ausmacht. Unter Objekt aber pflegt man nicht
bloß ein abstraktes Seiendes oder existierendes Ding oder ein Wirkliches
überhaupt zu verstehen, sondern ein konkretes, in sich vollständiges
Selbständiges; diese Vollständigkeit ist die Totalität des
Begriffs.
Quelle: [Hegel: Enzyklopädie der philosophischen
Wissenschaften im Grundrisse. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie,
S. 14954
(vgl. Hegel-W Bd. 8, S. 345-346) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-[Heg4]: Tenor: einen Übergang
verständlich machen ist zu wenig, Plausibilität genügt hier
nicht. Plausibel wird hierbei nicht näher erläutert oder begründet,
auch nicht durch eine Anmerkung oder Fußnote. Hegel setzt anscheinend
voraus, dass plausibel verständlich und nicht weiter erklärungs-
oder begründungspflichtig ist.
Hintze, Henning (1998). Nominalismus. Primat der ersten Substanz versus Ontologie der Prädikation. Freiburg: Alber.
Suchwort "plausib" vier Treffer. Der Begriff wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweise mittels Fußnote oder Anmerkung. Daraus ergibt sich plausibel ;-) dass der Begrif anscheinend nicht für erklärungs- und begründungsbedürftig gehalten wird.
[Hi1] S. 100: "Wären nicht Sachverhalte, wenn ein Korrelat zu Sätzen gesucht wird, eine sinnvolle Ergänzung zu einer reinen Ding-Ontologie? Dies erscheint um so plausibler, wenn man an Sätze mit verbalem Prädikat denkt, deren Verben prozessualen Charakter haben."
[Hi2] S. 144: "Die Argumentation gegen die prima fade plausiblere substitutionelle Deutung der Quantifikation fällt sehr differenziert aus, will man mögliche Modifikationen oder Einschränkungen der Quineschen These vorwegnehmend widerlegen. "
[Hi3] S. 303: "Betrachtet man nominalistische Systeme als auf der formalen Ebene in den platonistischen Systemen enthalten, so können Platonisten keine plausible ontologische Kritik mehr an ihnen vorbringen, da diese immer auch ihre eigenen Systeme träfe. "
[Hi4] S. 310: "Goodmans technische Lösungen sind relativ umfänglich,
aber sehr plausibel und verständlich.
Goodman bewertet letztlich Basen oder Spezifikationen derselben nach der
Zahl ihrer Prädikate, nach deren Stellenzahl und deren Eigenschaften
wie Symmetrie, Transitivität
und Reflexivität. Letztere Differenzierungen sind erforderlich,
weil die Definition der Komplexitätsbewertung schrittweise- induktiv
nach der
Stellenzahl der Prädikate auf plausible
Weise erweitert wird. Prädikate lassen sich dabei mittels Junktoren
in solche von bestimmten Eigenschaften wie den oben genannten zerlegen.
Diese kann man dann wiederum durch Prädikate mit geringerer Stellenzahl
ersetzen, für die auf die Definition aus dem vorigen Schritt zurückgegriffen
wird. "
Plausibilität bei Peter Janich
Vorbemerkung zu den beiden Auflagen mit unterschiedlichen Titeln, S. XVI: "Das vorliegende Buch [2014] ist aus einer umfassenden Bearbeitung des vergriffenen Buches „Logisch-pragmatische Propädeutik. Ein Grundkurs im philosophischen Reflektieren" (Weilerswist 2001) hervorgegangen. Weggefallen ist das umfangreiche Vorwort, das die Entstehung des ersten Buches einerseits im Verhältnis zu konkurrierenden Lehrbüchern und philosophischen Richtungen, andererseits im Blick auf die Lehrsituation in der Marburger Philosophie beschrieb. Ebenfalls weggefallen ist ein Nachwort (»Zum Stand der Dinge"), in dem Fragen zur Verortung des vorliegenden Ansatzes beantwortet und Gründe für die Lehrbuchform (ohne Fußnoten und Literaturverzeichnis) vorgetragen wurden.
Hinzugekommen sind, neben einer sorgfältigen Überarbeitung des erhaltenen Textes, zwei systematische Textstücke, nämlich ein Exkurs zur rationalen Hermeneutik, und eine Erweiterung der Sprachphilosophie um die Klasse der performativen Sprechhandlungen des Zuschreibens. Die Forschungen und Publikationen des Autors zu den Bereichen Hirnforschung und Tierphilosophie
haben ergeben, dass die pragmatische Form des kommunikativen Ansatzes, der schon für die »Logisch-pragmatische Propädeutik" leitend war, generell eine eminent wichtige Rolle für die Sprachform menschlicher Kultur gegenüber den natürlichen Bedingungen spielt, die durch Neurophysiologie und Evolutionsbiologie erforscht werden.
Damit hat sich eine Verschiebung des Schwerpunktes für das ganze Buch ergeben: Sprachphilosophie wurde, wie schon im Vorgängerbuch, nicht als Selbstzweck betrieben, hat hier aber als unverzichtbare Hilfe die Rolle der Leitdisziplin übernommen für die von Sprache getragenen Bereiche des Alltagslebens in bestimmten, kultürlich geprägten historischen Verhältnissen - mit erheblichen Folgen für die Wissenschaften, allen voran die Naturwissenschaften, die sich dem Menschen zuwenden, und für die Philosophie als Wissenschafts- und Kulturkritik. Insofern ist die Sprache unter der Perspektive methodischer Ordnung ein prototypischer Gegenstand für eine Einführung in philosophische Reflexion: immer bleibt die klassische Frage „Was ist der Mensch?", herausgefordert durch die Ergebnisse moderner Naturwissenschaften, der leitende Gesichtspunkt für eine Lehre von der methodischen Sprachkritik, die sich nicht mit den heute modischen Relativieren und Bekenntnissen zu zahlreichen Post-Strömungen zufrieden gibt, sondern explizit Verfahren anbietet, deren sich jeder bedienen kann, der seine eigene Begrifflichkeit klären und beherrschen sowie die
der Anderen verstehen möchte."
Ein Vergleich der Plausibilitätsfundstellen ermöglicht eine Beurteilung inwieweit sich der Gebrauch von Plausibilität bei Janich verändert hat oder gleich geblieben ist.
Zusammenfassung Janich (2001, 2014): Plausibel wird weder erklärt
noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote
oder Anmerkung. Anscheinend hält Janich plausibel für einen allgemein
verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten
Grundbegriff. (7 Fundstellen) und Neuauflage 2014 (8 Fundstellen):
| Janich, Peter (2001), Logisch-pragmatische Propädeutik. Ein Grundkurs
im philosophischen Reflektieren. Velbrück Weilerswist: Wissenschaft.
7 Fundstellen "plausib": 58, 70, 104, 133, 162, 186a, 186b |
Janich, Peter (2014) Sprache und Methode. Eine Einführung in philosophische
Reflexion. Tübingen: Francke (UTB).
8 Fundstellen "plausib": 35, 50, 100, 108, 148, 179, 206a, 206b |
| PJ2001-S.58: "Unter Handlungstheoretikern ist eine Debatte geführt
worden, ob Unterlassungen selbst Handlungen seien. Dafür spricht immerhin,
daß wir zu Unterlassungen auffordern können, daß Unterlassungen
ge- oder mißlingen können bzw. Erfolg und Mißerfolg haben
können, also wichtige Charakteristika des Handelns aufweisen. Dafür
spricht auch, daß wir üblicherweise Unterlassungen (bis hinein
in die Gesetzgebung zur unterlassenen Hilfeleistung) als Schuld oder Verdienst
bewerten. Andererseits gibt es einen plausiblen
Wortsinn von ,Unterlassen<, dem zufolge zum Beispiel jemand, der eine
Leiter hinaufsteigt, es gleichzeitig unterläßt, die Leiter hinabzusteigen.
Hier heißt Unterlassen einfach, daß ein bestimmtes, beschriebenes
Handlungsschema nicht aktualisiert wird. In diesem Gebrauch wäre es
abwegig, das Unterlassen einer Handlung selbst eine Handlung zu nennen.
Insofern braucht zur Streitfrage, ob UNTERLASSUNGEN selbst Handlungen sind,
keine abschließende Entscheidung getroffen zu werden. Ersichtlich
gibt es nämlich zwei verschiedene Verwendungsweisen bzw. Anwendungs-
bereiche des Wortes >Unterlassens für die in einem Falle Unterlassen
ein Handeln, im anderen Falle kein Handeln ist."
KommentarPJ2001-S.58: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Das Beispiel überzeugt nicht, ist nicht plausibel ;-). Es handelt sich um eine empirische Unmöglichkeit. |
PJ2014-S.35: "Unter Handlungstheoretikern ist eine Debatte geführt
worden, ob Unterlassungen selbst Handlungen seien. Dafür spricht immerhin,
dass wir zu Unterlassungen wie zu Handlungen auffordern können, dass
Unterlassungen ge- oder misslingen können bzw. Erfolg und Misserfolg
haben können, also wichtige Charakteristika des Handelns aufweisen.
Dafür spricht auch, dass wir üblicherweise Unterlassungen (bis
hinein in die Gesetzgebung zur unterlassenen Hilfeleistung) als Schuld
oder Verdienst bewerten. Andererseits gibt es auch einen plausiblen
Wortsinn von ‚Unterlassen', wonach z. B. jemand, der eine Leiter hinaufsteigt,
es gleichzeitig unterlässt, die Leiter hinabzusteigen. Hier heißt
Unterlassen einfach, dass ein bestimmtes, beschriebenes Handlungsschema
nicht aktualisiert wird. In diesem Gebrauch wäre es abwegig, das Unterlassen
einer Handlung selbst eine Handlung zu nennen. Insofern braucht zur Streitfrage,
ob UNTERLASSUNGEN selbst Handlungen sind, keine abschließende Entscheidung
getroffen zu werden. Ersichtlich gibt es nämlich zwei verschiedene
Verwendungsweisen bzw. Anwendungs- bereiche des Wortes ‚Unterlassen', für
die in einem Falle Unterlassen ein Handeln, im anderen Falle kein Handeln
ist.
KommentarPJ2014-S.35: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Das Beispiel überzeugt nicht, ist nicht plausibel ;-). Es handelt sich um eine empirische Unmöglichkeit. |
| PJ2001-S.70: "Aber schon viel elementarere Beispiele, sozusagen ohne
Vorgriff auf die Wissenschaften, sind aus dem alltäglichen Sprechen
vertraut: Wer zum Beispiel eine kleine Geschichte erzählt, kann durch
Vertauschung der erzählten Ereignisse und Handlungsschritte jede Glaubwürdigkeit
und Plausibilität der Erzählung aufs
Spiel setzen. Wer behauptet, die Ankunft liege vor der Abreise, die Kinder
seien vor den Eltern geboren und die Früchte vor der Blüte geerntet
worden, verfehlt in diesem Sinne die glaubwürdige Reihenfolge."
KommentarPJ2001-70: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Aber der Kontext legt nahe, dass Plausibilität als glaubwürdig betrachtet wird. |
PJ2014-S.50: "Aber schon viel elementarere Beispiele, sozusagen ohne
Vorgriff auf die Wissenschaften, sind aus dem alltäglichen Sprechen
vertraut: Wer z.B. eine kleine Geschichte erzählt, kann durch Vertauschung
der erzählten Ereignisse und Handlungsschritte jede Glaubwürdigkeit
und Plausibilität der Erzählung aufs
Spiel setzen. Wer behauptet, die Ankunft liege vor der Abreise, die Kinder
seien vor den Eltern geboren und die Früchte vor der Blüte geerntet
worden, verfehlt in diesem Sinne die glaubwürdige Reihenfolge und
damit die Glaubwürdigkeit der ganzen Erzählung."
KommentarPJ2014-50: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. |
| PJ2014-S.100: "Harmlose Alltagsbeispiele machen plausibel,
dass man das Beschreiben zuschreiben und das Zuschreiben beschreiben kann,
wie auch das Beschreiben des Beschreibens und das Zuschreiben des Zuschreibens
schon im Alltag durchaus geläufig sind. Alle diese Fälle sind
nicht überraschend, da Beschreiben wie Zuschreiben Handlungen sind,
die in der Tat generell sowohl beschrieben als auch einem Akteur zugeschrieben
werden können."
KommentarPJ2014-100: Plausibel wird gebraucht aber nicht erklärt. Dem Kontext kann man entnehmen, dass Beispiele aus dem Alltag die Plausibilität fördern. |
|
| PJ2001-S.104: "Da diese Entwicklung hier weder dargestellt noch philosophisch
diskutiert werden kann, muß ein simples Beispiel genügen: Auch
der mathematische und philosophische Laie vermag zum Beispiel mit dem geometrischen
Axiom, wonach durch zwei verschiedene Punkte genau eine Gerade bestimmt
sei, eine anschauliche Verständlichkeit zu verbinden. Ein formalistischer
Umgang mit diesem anschaulich plausiblen Axiom
(Grundsatz) würde lauten, nach der Bedeutung der Wörter >Punkt<,
>Gerade< und >bestimmt< (oder >liegen auf<) nicht mehr zu fragen
und nur noch die Form dieser Aussage zu behandeln, wonach durch zwei verschiedene
Gegenstände der Sorte P genau ein Gegenstand der Sorte g in
der Beziehung z (für »zusammenfallen, inzidieren, liegen auf«)
stünden. Und selbstverständlich ergibt dann auch die Frage keinen
Sinn mehr, welche Geltung eine solche Aussageform besäße, was
es also mit der Anschaulichkeit, der »Notwendigkeit« im Sinne
einer anschaulich nicht anzugebenden Alternative usw. auf sich habe. Kurz,
Formalismus heißt demnach die Auffassung, anschauliche geometrische
Theorien (und dann auch alle anderen Theorien) nur noch als Forme/systeme
zu betrachten und zu behandeln."
KommentarPJ2001-S.104: Plausibel weil anschaulich? |
PJ2014-S.108: "Da diese Entwicklung hier weder dargestellt noch philosophisch
diskutiert werden kann, muss ein simples Beispiel genügen: Auch der
mathematische und philosophische Laie vermag z. B. mit dem geometrischen
Axiom, wonach durch zwei verschiedene Punkte genau eine Gerade bestimmt
sei, eine anschauliche Verständlichkeit zu verbinden. Ein formalistischer
Umgang mit diesem anschaulich
plausiblen Axiom (Grundsatz) würde lauten, nach der Bedeutung der Wörter ,Punkt`, 'Gerade` und ‚bestimmt` (oder ‚liegen auf') nicht mehr zu fragen und nur noch die Form dieser Aussage zu behandeln, wonach durch zwei verschiedene Gegenstände der Sorte P genau ein Gegenstand der Sorte g in der Beziehung z (für »zusammenfallen, inzidieren, liegen auf") stünden. Und selbstverständlich ergibt dann auch die Frage keinen Sinn mehr, welche Geltung eine solche Aussageform besäße, was es also mit der Anschaulichkeit, der „Notwendigkeit" im Sinne einer anschaulich nicht verfügbaren Alternative usw. auf sich habe. Kurz, Formalismus heißt demnach die Auffassung, anschauliche geometrische Theorien (und dann auch alle anderen Theorien) nur noch als Formelsysteme zu betrachten und zu behandeln." KommentarPJ2014-S.108: Plausibel weil anschaulich? |
| S. 133: "Der Abstraktor >Zahl< hat keine arithmetischen
(also auch keine »mathematischen«) Eigenschaften. Diesem Unterschied
im Umgang mit Zahlwörtern und dem Wort >Zahl< selbst wird man dadurch
gerecht, daß man die Gegenstände der Zahlwörter, die man
(wie in den angege- benen Beispielen) prädizieren kann, als abstrakte
Gegenstände oder kurz als Abstrakta bezeichnet. Demnach sind »die
Zahl 2« und »die einzige gerade Primzahl« : ebenso abstrakte
Gegenstände wie »das Zweifache von 2«. Abstrakta sind
damit die durch das Abstraktions- verfahren »erzeugten« Gegenstände.
Sie sind das Ergebnis der Handlung des Abstrahierens. Entsprechend hat
es eine gewisse Plausibilität, das als
konkret zu bezeichnen, wovon bei dieser Handlung ausgegangen wurde; in
unserem Falle waren dies entweder die Zahlwörter oder die Zählzeichen
(Ziffern). Das Verhältnis der Konkreta und Abstrakta wird dann auch
gern mit den folgenden Formulierungen zum Ausdruck gebracht: Die (konkreten
Gegenstände) »Zahlwörter« bzw. »Zählzeichen«
stellen (die abstrakten Gegenstände) Zahlen dar - oder auch: sie repräsentieren
Zahlen."
KommentarPJ2001-S.133 Gewisse Plausibilität wird nicht erklärt, aber die Formulierung impliziert eine quantitative oder partikuläre Bedeutung. |
S. 148: "Der Abstraktor Zahl' hat keine arithmetischen
(also auch keine »mathematischen") Eigenschaften. Diesem Unterschied
im Umgang mit Zahlwörtern und dem Wort Zahl` selbst wird man dadurch
gerecht, dass man die Gegenstände der Zahlwörter, die man (wie
in den angegebenen Beispielen) prädizieren kann, als abstrakte-Gegenstände
oder kurz als Abstrakta bezeichnet. Demnach sind »die Zahl 2" und
„die einzige gerade Primzahl" ebenso abstrakte Gegenstände wie »das
Zweifache von 2". Abstrakta sind damit die durch das Abstraktionsver[>]
fahren „erzeugten" Gegenstände. Sie sind das Ergebnis der Handlung
des Abstrahierens. Entsprechend hat es eine gewisse Plausibilität,
das als konkret zu bezeichnen, wovon bei dieser Handlung ausgegangen wurde;
in unserem Falle waren dies entweder die Zahlwörter oder die Zählzeichen
(Ziffern). Das Verhältnis der Konkreta und Abstrakta wird dann auch
gern durch die folgenden Formulierungen zum Ausdruck gebracht: Die (konkreten
Gegenstände) »Zahlwörter" bzw. „Zählzeichen" stellen
(die abstrakten Gegenstände) Zahlen dar - oder auch: sie repräsentieren
Zahlen."
KommentarPJ2014-S.133 Gewisse Plausibilität wird nicht erklärt, aber die Formulierung impliziert eine quantitative oder partikuläre Bedeutung. |
| PJ2001-S.162: "Noch nicht erwähnt wurden alltägliche
Entscheidungen, wonach etwas aus logischen Gründen sein muß
oder nicht sein kann. Die Scherzfrage, wer die Löcher in den Käse
gebohrt hat, das berühmte Henne-Ei-Problem und die Streiche der Bürger
von Schilda sind alltägliche Beispiele dafür, daß unsere
Einschätzungen nach wahr und falsch von logischen oder plausiblen
(methodischen) Möglichkeiten und Zwängen abhängen. Wolke
man dies einem erkenntnistheoretischen Realismus zur Lösung aufgeben,
müßten sogar die Gesetze der Logik, ja die methodische Ordnung
poietischer Handlungen (wie beim Bohren der Löcher in den Käse)
menschenunabhängig »existieren«. Tatsächlich ist
auch diese Meinung historisch schon vertreten worden, bleibt aber eine
ungeheure Zumutung für jeden, der die Vielfalt logischer Gesetze und
Regeln als menschliche Konstruktionen für bestimmte Zwecke erkennt
bzw. die Vielfalt zweckrationaler Lösungsstrategien für technische
und poietische Aufgaben bedenkt. (Der Ausweg, mit dem Programm eines Logischen
Empirismus nur bei den empirischen Wissensbeständen Realitätsbezug,
bei den logischen aber einen Bezug zu menschlichen Sprachregelungen anzunehmen,
wurde schon als unzureichend ausgewiesen; vgl. 5.147 f.)."
KommentarPJ2001-S.162 Plausibel wird nicht erklärt, aber dem Zusammenhang nach mit methodisch gleichgesetzt. |
PJ2014-S.179: "Noch nicht erwähnt sind alltägliche Entscheidungen,
wonach etwas aus logischen Gründen sein muss oder nicht sein kann.
Die Scherzfrage, wer die Löcher in den Käse gebohrt hat, das
berühmte Henne-Ei-Problem und die Streiche der Bürger von Schilda
sind alltägliche Beispiele dafür, dass unsere Einschätzungen
nach wahr und falsch von logischen oder plausiblen
(methodischen) Möglichkeiten und Zwängen abhängen. Wollte
man dies einem erkenntnistheoretischen Realismus zur Lösung aufgeben,
müssten sogar die Gesetze der Logik, ja die methodische Ordnung poietischer
Handlungen (wie beim Bohren der Löcher in den Käse) menschenunabhängig
»existieren". Tatsächlich ist auch diese Meinung historisch
schon vertreten worden, bleibt
aber eine ungeheure Zumutung für jeden, der die Vielfalt logischer Gesetze und Regeln als menschliche Konstruktionen für bestimmte Zwecke erkennt bzw. die Vielfalt zweckrationaler Lösungsstrategien für technische und poietische Aufgaben bedenkt. (Der Ausweg, mit dem Programm eines Logischen Empirismus nur bei den empirischen Wissensbeständen Realitätsbezug, bei den logischen aber einen Bezug zu menschlichen Sprachregelungen anzunehmen, wurde schon bei der Besprechung des Ideationsverfahrens als unzureichend ausgewiesen.)" KommentarPJ2014-S.162 Plausibel wird nicht erklärt, aber dem Zusammenhang nach mit methodisch gleichgesetzt. |
| PJ2001-S.186a: "Nicht nur Popularisierungen von
Theorien über die Entstehung des Weltalls oder des Sonnensystems,
über die Entstehung des Lebens auf der Erde und seine Entwicklung
zum heutigen Zustand, auch wissenschaftliche Literatur stellt das Naturgeschehen
in der chronologisch »richtigen« Weise seines Objektes dar.
Die
Plausibilität des rekonstruierten
Geschehens liegt ja an seiner zeitlichen Abfolge, nach der wir ursächliche
Zusammenhänge annehmen.
KommentarPJ2001-S.186a: Plausibel als verträglich mit zeitlicher Abfolge? |
PJ2014-S.206a: "Nicht nur Popularisierungen von Theorien über
die Entstehung des Weltalls oder des Sonnensystems, über die Entstehung
des Lebens auf der Erde und seine Entwicklung zum heutigen Zustand, auch
wissenschaftliche Literatur stellt das Naturgeschehen in der chronologisch
„richtigen" Weise seines Objektes dar. Die Plausibilität
des rekonstruierten Geschehens liegt ja an seiner zeitlichen Abfolge, nach
der wir ursächliche Zusammenhänge annehmen.
KommentarPJ2014-S.206a: Plausibel als verträglich mit zeitlicher Abfolge? |
| PJ2001-S.186b: "Dies führt aber zu einer Form der
Naturgeschichtsschreibung, die so tut, als wären die Naturgeschichtler
mit persönlichem Erleben dabeigewesen. Das heißt, hier borgt
sich die wissenschaftliche Naturgeschichtsschreibung vom alltäglichen
Erzählen eigener Erlebnisse eine Plausibilität,
die sie nicht hat und auch im besten Falle niemals erreichen kann.""
KommentarPJ2001-S.186b: Schein-Plausibilität durch den Anschein persönlichen Erlebens? |
PJ2014-S.206b: "Dies führt aber zu einer Form der Natur- geschichtsschreibung,
als wären die Naturgeschichtler höchstpersönlich dabei gewesen.
Das heißt, hier borgt sich die wissenschaftliche Naturgeschichtsschreibung
vom alltäglichen Erzählen eigener Erlebnisse eine Plausibilität, die sie nicht hat und auch im besten Falle niemals erreichen kann." KommentarPJ2014-S.206b: Schein-Plausibilität durch den Anschein persönlichen Erlebens? |
Kutschera
Sprachphilosophie 1975 [Online]: Drei eigene Fundstellen und ein Zitat
von Quine.
Zusammenfassung Kutschera 1975: Plausibel wird nicht erklärt oder
begründet, auch nicht durch Querverweise, Fußnote, Anmerkung
oder Literaturhinweis und damit wahrscheinlich als nicht erklärungs-
und begründungspflichtiger Grundbegriff betrachtet.
- Ku1975-S.35 "Mit diesem Argument entfällt aber die wichtigste
Begründung für eine nicht-konventionalistische Auffassung der
Bedeutungen, und der Konventionalismus wird dann zur plausibelsten
Position.14"
Kommentar-Ku1975-S.35: Im Superlativ "plausibelsten" steckt ein quantitatives Kriterium.
Ku1975-S.305 Das ist schon deswegen höchst plausibel,
weil man für häufige Unterscheidungen aus ökonomischen Gründen
einfache Ausdrucksformen bilden würde.
Kommentar-Ku1975-S.305: Im "höchst plausibel"
steckt ein quantitatives Kriterium.
Ku1975-S.308 "Hier differenzieren aber sowohl Humboldt wie auch Whorf,
wie wir oben gesehen haben: Die These, daß ein Volk irgendwoher eine
Sprache annimmt, die dann seine typischen Erfahrungs-, Handlungsund Lebensformen
bestimmt, wird weder von ihnen vertreten, noch wäre sie im mindesten
plausibel."
Kommentar-Ku1975-S.308: Im "mindestens" steckt ein
quantitatives Kriterium.
Quine Zitat > Quine.
Mill, John Stuart (1806-1873) 1843: A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of the Principles of Evidence, and the Methods of Scientific Investigation.
Zusammenfassung J.S. Mill: Plausibel wird nicht erklärt oder begründet, sondern so verwendet, als sei der Begriff jedermann klar und damit weder erklärungs- noch begründungspflichtig.
- Kommentar-MJS01: "sehr plausibel" bedeutet eine quantitativen Plausibilitätsbegriff.
- Kommentar-MJS02: plausibel im Sinne von verständlich.
- Kommentar-MJS03: so plausibel dies indessen aussieht, hält es doch genauer Prüfung nicht stand. Der Anschein von starker Plausibilität genügt nicht, womit ein quantitativer Plausibilitätsbegriff vertreten wird, der im Kieselsteinbeispiel einer genaueren Prüfung. Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.
- Kommentar-MJS04: plausibel wird hier auf begreiflich zurückgeführt und zu natürlich in Beziehung gesetzt..
- Kommentar-MJS05: Durch Einbildungskraft ersonnene Gesetze (Beispiel Descartes Wirbel) sind nicht so plausibel wie solche, die durch Analogie an bekannte Naturgesetze (Beispiel Newtons Centralkraftgesetz) anschließen. Damit formuliert Mill ein Plausibilitätskriterium. Auch hier wird ein quantitativer Plausibilitätsbegriff (nicht so plausibel) zu Grunde gelegt.
- Kommentar-MJS06: Um eine Lehre plausibel machen kann darf sie nicht augenfälligen Tatsachen widersprechen..
- Kommentar-MJS07: Manches kann auf den ersten Blick plausibel erscheinen ... darin schwingt mit, dass der Anschein kritischer Prüfung nicht standhalten wird. Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.
- Kommentar-MJS08: "so sehr plausibel" drückt einen quantitativen Plausibilitätsbegriff aus. Die Plausibilität wird auf eine einleuchtende Prämisse zurückgeführt.
- Kommentar-MJS09: Eine plausible Ansicht (Beispiel Vicos Kreistheorie) hält strenger Prüfung nicht stand. Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.
- Kommentar-MJS10: "ganz plausibel erscheint" spricht für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff. Die gute Herrschaft verpuffte ohne positive Wirkung auf das Volk. Damit bringt Mill ein Wirkungskriterium für Plausibilität ins Spiel.
[MJS1] §. 2. Diese Theorie versucht die
dem Falle anscheinend inwohnende Schwierigkeit dadurch zu lösen, dass
sie die Sätze der Arithmetik als bloss wörtliche, und ihre Processe
als blosse wörtliche Transformationen, als Substitutionen eines Ausdrucks
für den andern, hinstellt. Der Satz, Zwei und Eins sind gleich Drei,
ist nach diesen Philosophen nicht eine Wahrheit, nicht die Behauptung einer
wirklich existirenden Thatsache, sondern eine Definition des Wortes Drei;
eine Aussage, dass die Menschen übereingekommen sind, den Namen Drei
als ein Zeichen zu gebrauchen, das Zwei und Eins genau äquivalent
ist, um mit dem ersteren Namen zu benennen, was durch die letzteren nur
in einer plumpen Weise zu benennen ist. Nach dieser Lehre besteht der längste
Process in der Algebra nur aus aufeinanderfolgenden Aenderungen der Terminologie,
wodurch gleichwerthige Ausdrücke für einander substituirt werden;
aus einer Reihe von Uebersetzungen derselben Thatsache aus einer Sprache
in die andere, obgleich hierdurch nicht erklärt wird, wie nach einer
solchen Reihe Ton Uebersetzungen die Thatsache selbst verändert wird
(wie wenn wir einen neuen geometrischen Lehrsatz durch Algebra demonstriren),
eine Schwierigkeit, welche dieser Lehre verderblich wird.
Man muss anerkennen, dass in den Processen der Arithmetik
und Algebra Eigenthümlichkeiten liegen, welche die obige Theorie sehr
plausibel machen, und welche diese Wissenschaften ganz naturgemäss
zu Stützen des Nominalismus machten. Die Lehre, dass wir durch ein
kunstfertiges Handhaben der Sprache Thatsachen entdecken, verborgene Naturprocesse
enthüllen können, ist dem gesunden Menschenverstande so entgegen,
dass es schon einen Fortschritt in der Philosophie verlangt, um sie zu
glauben; die Menschen nehmen zu einem solchen paradoxen Glauben ihre Zuflucht,
um, wie sie denken, eine noch grössere Schwierigkeit zu vermeiden,
die der grosse Haufe nicht sieht. Was Viele verleitet hat, jenes Schliessen
nur für einem sprachlichen Process zu halten, war, dass keine andere
Theorie mit der Natur der Wissenschaft der Zahlen verträglich schien.
Denn wir [] hegen weiter keine Ideen, wenn wir die Symbole der Arithmetik
oder Algebra gebrauchen. Bei einem geometrischen Beweise haben wir, wenn
auch nicht auf dem Papier, so doch eine Figur in unserm Geiste; AB, AC
sind unserer Einbildungskraft als Linien gegenwärtig, die einander
schneiden, miteinander einen Winkel bilden und dergleichen; aber nicht
to a und b. Diese mögen Linien oder andere Grössen repräsentiren,
so Wird an diese Grössen niemals gedacht; in unserer Einbildung wird
nichts realisirt, als a und b. Die Ideen, welche sie bei einer besondern
Gelegenheit repräsentiren, werden von dem Anfange des Processes an,
wo die Prämissen Ton den Dingen in die Zeichen übersetzt werden,
bis zu dem Ende, wo der Schluss wieder rückwärts aus den Zeichen
in die Dinge übersetzt wird, also während des ganzen intermediären
Theiles des Processes, aus dem Geiste verbannt. Da also in dem Geiste des
Schliessenden nichts ist, als Symbole, was kann da unzulässiger erscheinen,
als die Behauptung, das Schliessen habe noch mit etwas Anderem zu schaffen
?
Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven
Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 29520
(vgl. Mill-Logik Bd. 1, S. 304-305) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-MJS01: "sehr plausibel" bedeutet eine
quantitativen Plausibilitätsbegriff.
[MJS2] Es ist noch ein anderer Umstand, der mehr noch als der obenerwähnte
die Vorstellung plausibel macht, es seien die
Sätze der Arithmetik und Algebra bloss wörtliche. Wenn sie nämlich
als Urtheile in Beziehung auf Dinge betrachtet werden, so scheinen sie
alle identische Urtheile zu sein. Die Behauptung, Zwei und Eins ist gleich
Drei, als eine Behauptung in Beziehung auf Gegenstände betrachtet,
wie z.B. »Zwei Kieselsteine und ein Kieselstein machen drei Kieselsteine«,
affirmirt nicht die Gleichheit zweier Sammlungen von Kieselsteinen, sondern
die absolute Identität. Sie affirmirt, dass, wenn wir einen Kieselstein
zu zwei Kieselsteinen legen, dieser Kieselsteine drei sind. Da also die
Gegenstände dieselben sind, und die blosse Behauptung, dass Gegenstände
»sie selbst sind«, bedeutungslos ist, so scheint es ganz natürlich,
dass man den Satz, Zwei und Eins sind gleich Drei, als die blosse Behauptung
der Identität der Bedeutung der zwei Namen betrachtet.
Kommentar-MJS02: plausibel im Sinne von verständlich.
[MJS3] So plausibel dies indessen
aussieht, so hält es doch eine genauere Prüfung nicht
aus. Der Ausdruck »Zwei Kieselsteine und ein Kieselstein« und
der Ausdruck »Drei Kieselsteine« stehen in der That für
dasselbe Aggregat von Gegenständen; sie stehen aber keineswegs für
dieselbe physikalische Thatsache. Es sind Namen von denselben Gegenständen,
aber von diesen [>] Gegenständen in zwei verschiedenen Zuständen;
obgleich sie dieselben Dinge bezeichnen, so ist doch ihre Mitbezeichnung
eine verschiedene. Drei Kieselsteine in zwei verschiedenen Theilen, und
drei Kieselsteine in einem Theil, machen nicht denselben Eindruck auf unsere
Sinne; und die Behauptung, dass dieselben Kieselsteine durch einen Wechsel
des Orts und der Anordnung entweder die eine oder die andere Reihe von
Sensationen hervorbringen können, ist, obgleich es ein sehr geläufiges
Urtheil ist, doch kein identisches. Es ist eine Wahrheit, die uns durch
frühe und beständige Erfahrung bekannt ist, eine inductive Wahrheit,
und solche Wahrheiten sind das Fundament der Wissenschaft der Zahlen. Die
Grundwahrheiten dieser Wissenschaft beruhen ganz auf sinnlichem Beweis;
sie werden dadurch bewiesen, dass unsere Augen oder Finger erfahren, dass
eine gegebene Zahl von Gegenständen, z B. zehn Bälle, durch Trennung
und Wiedervereinigung unseren Sinnen die verschiedenen Reihen von Zahlen
darbieten, deren Summe gleich zehn ist. Eine jede bessere Methode, Kinder
Arithmetik zu lehren, verfährt nach dieser Thatsache. Alle diejenigen,
welche beim Erlernen der Arithmetik auf den Geist des Kindes einwirken
wollen, alle diejenigen, welche Zahlen und nicht blosse Ziffern lehren
wollen, lehren gegenwärtig in der beschriebenen Weise mit Hülfe
des Sinnenbeweises.
Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven
Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 29525
(vgl. Mill-Logik Bd. 1, S. 307-308) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-MJS03: so plausibel dies indessen aussieht,
hält es doch genauer Prüfung nicht stand. Der Anschein von starker
Plausibilität genügt nicht, womit ein quantitativer Plausibilitätsbegriff
vertreten wird, der im Kieselsteinbeispiel einer genaueren Prüfung.
Plausibles muss nicht richtig oder wahr sein.
[MJS4] Dieselben Thatsachen in der geistigen Geschichte eines
Jeden, die bestimmen, was ihm begreiflich oder
unbegreiflich ist, bestimmen auch, welche [] von den verschiedenen Sequenzen
in der Natur ihm so natürlich und plausibel
erscheinen werden, dass es keines anderen Beweises ihrer Existenz bedarf,
um gleich unabhängig von der Erfahrung und Erklärung durch ihr
eigenes Licht ersichtlich zu werden.
Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven
Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 29697
(vgl. Mill-Logik Bd. 1, S. 422) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-MJS04: plausibel wird hier auf begreiflich
zurückgeführt und zu natürlich in Beziehung gesetzt..
[MJS5] Da eine Hypothese eine blosse Voraussetzung ist, so giebt es
für Hypothesen keine anderen Grenzen, als die Gesetze der menschlichen
Einbildungskraft, und wir können behufs der Erklärung einer Wirkung
eine Ursache von einer völlig unbekannten Art, und nach einem ganz
erdichteten Gesetze wirkend ersinnen. Aber da solche Hypothesen nicht
so plausibel sein würden, wie diejenigen, welche sich durch
Analogie an bekannte Naturgesetze anschliessen, und da sie überdies
dem Bedürfniss nicht abhelfen würden, wofür die willkürlichen
Hypothesen gewöhnlich erfunden werden, indem sie nämlich die
Einbildungskraft fähig machen sollen, sich ein dunkles Phänomen
in einem gewohnten Lichte vorzustellen: so giebt es in der Geschichte der
Wissenschaft wahrscheinlich keine Hypothese, worin zu gleicherzeit das
Agens [>] selbst und das Gesetz seiner Thätigkeit erdichtet waren.
Entweder besteht das Phänomen, welches man als die Ursache ansieht,
wirklich, aber das Gesetz, wonach es wirkt, ist ein bloss angenommenes,
oder die Ursache ist erdichtet, aber es ist vorausgesetzt, dass sie ihre
Wirkungen nach Gesetzen hervorbringt, die den Gesetzen irgend einer bekannten
Classe von Erscheinungen ähnlich sind. Ein Beispiel dieser Art bieten
die verschiedenen Voraussetzungen in Beziehung auf das Gesetz der Centralkraft
der Planeten, die der Entdeckung des wahren Gesetzes, wonach diese Kraft
im umgekehrten Verhältniss des Quadrates der Entfernung sich ändert,
vorausgingen. Das Gesetz wurde von Newton zuerst als eine Hypothese aufgestellt
und dadurch bestätigt, dass es deductiv zu Kepler's Gesetzen führte.
Hypothesen der zweiten Art waren die Wirbel Descartes', die zwar nur erdichtet
waren, von denen man aber annahm, dass sie den bekannten Gesetzen einer
rotirenden Bewegung gehorchten; oder die beiden rivalisirenden Hypothesen
über die Natur des Lichtes, wovon die eine das Phänomen einem
aus allen leuchtenden Körpern ausstrahlenden Fluidum, die andere (jetzt
fast allgemein angenommene) den schwingenden Bewegungen eines das ganze
Weltall durchdringenden Aethers zuschreibt. Bis auf die Erklärung,
welche einige von diesen Erscheinungen dadurch erhalten, ist die Existenz
keiner [>] dieser Fluida bewiesen; man nimmt aber an, dass sie ihre Wirkungen
nach bekannten Gesetzen hervorbringen, nämlich in dem ersten Falle
nach den gewöhnlichen Gesetzen einer fortwährenden Ortsveränderung,
in dem andern nach Gesetzen der Fortpflanzung einer schwingenden Bewegung
in den Theilchen eines elastischen Fluidums.
Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven
Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 29960
(vgl. Mill-Logik Bd. 2, S. 9-11) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-MJS05: Durch Einbildungskraft ersonnene
Gesetze (Beispiel Descartes Wirbel) sind nicht so plausibel wie solche,
die durch Analogie an bekannte Naturgesetze (Beispiel Newtons Centralkraftgesetz)
anschließen. Damit formuliert Mill ein Plausibilitätskriterium.
Auch hier wird ein quantitativer Plausibilitätsbegriff (nicht so plausibel)
zu Grunde gelegt.
[MJS6] Um diese Lehre plausibel zu
machen, war es natürlich erforderlich, dass die einzigen wohlthätigen
Handlungen, welche die Menschen im allgemeinen oft zu sehen und daher zu
preisen gewohnt waren, der Art waren, oder dass sie wenigstens, ohne augenfälligen
Tatsachen zu widersprechen, so angesehen werden konnten, als wären
sie das Resultat einer klugen Berücksichtigung des eigenen Interesses;
so dass das Wort in der gewöhnlichen Bedeutung nicht mehr mitbezeichnete
als auch in der Definition lag.
Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven
Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 30344
(vgl. Mill-Logik Bd. 2, S. 248) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-MJS06: Um eine Lehre plausibel machen
kann darf sie nicht augenfälligen Tatsachen widersprechen..
[MJS7] Man nehme z.B. die auf den ersten Blick so plausibel
scheinende gewöhnliche Vorstellung , dass die Industrie
durch verschwenderischen Aufwand ermuntert werde.
Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven
Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 30541
(vgl. Mill-Logik Bd. 2, S. 369-370) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-MJS07: Manches kann auf den ersten Blick
plausibel erscheinen ... darin schwingt mit, dass der Anschein kritischer
Prüfung nicht standhalten wird. Plausibles muss nicht richtig oder
wahr sein.
[MJS8] Als ein Beweis der jetzt nicht mehr populären Lehre von
der unendlichen Theilbarkeit der Materie [] wurde früher das Argument
angeführt, dass ein jeder noch so kleine Theil der Materie wenigstens
eine obere und eine untere Fläche haben müsse. Diejenigen, welche
dieses Argument gebrauchten, sahen nicht, dass es gerade den streitigen
Punkt voraussetzte, die Unmöglichkeit, zu einem Minimum von Dicke
zu gelangen; denn wenn es ein Minimum gäbe, so wäre seine obere
und untere Fläche natürlich einerlei; es würde selbst eine
Fläche sein und weiter nichts. Was das Argument so
sehr plausibel macht, ist, dass die Prämisse wirklich einleuchtender
erscheint, als der Schluss, obgleich sie in Wirklichkeit mit ihm identisch
ist. So wie das Urtheil ausgedrückt ist, appellirt es direct und in
concreter Sprache an die Unfähigkeit der menschlichen Einbildungskraft,
ein Minimum zu begreifen. In diesem Lichte betrachtet, wird es zu einem
Fall von dem aprioristischen Fehlschluss oder natürlichen Vorurtheil,
dass das, was man nicht begreifen kann, auch nicht existiren könne.
Ein jeder auf Confusion beruhende Schlussfehler wird (wie kaum nöthig
zu wiederholen), wenn er aufgeklärt wird, zu einem Fehlschluss von
irgend einer anderen Art, und man wird im allgemeinen finden, dass, wenn
deductive oder syllogistische Schlussfehler irre führen, meistens,
wie in diesem Falle, eine Fallacie von einer anderen Art hinter ihnen versteckt
ist, welche hauptsächlich daran Schuld ist, dass die Wortgaukelei,
welche [] das Aeussere oder den Kern dieser Art von Fehlschluss bildet,
unentdeckt vorbeigeht.
Euler's Algebra, ein Buch von sonst grossem Verdienst,
aber bis zum Ueberfliessen voll von logischen Irrthümern in Betreff
des Fundaments der Wissenschaft, enthält das folgende Argument als
einen Beweis, dass minus durch minus vervielfacht plus giebt, eine Lehre,
die das Opprobrium aller blossen Mathematiker ist, und Ton deren wahrem
Beweis Euler keine Idee hatte. Er sagt, minus durch minus vervielfacht
kann nicht minus geben, denn minus multiplicirt mit plus giebt minus, und
minus durch minus kann nicht dasselbe Product geben wie minus durch plus
multiplicirt. Nun muss man fragen, warum minus durch minus multiplicirt
überhaupt ein Product geben muss? und warum, wenn es eines giebt,
das Product nicht dasselbe sein kann, wie das von minus durch plus? Denn
dies würde auf den ersten Blick nicht absurder erscheinen, als dass
minus durch minus dasselbe giebt, wie plus durch plus, der Satz, dem Euler
den Vorzug vor jenem giebt. Die Prämisse bedarf des Beweises eben
so sehr Wie der Schluss; auch kann sie nur durch jene umfassende Ansicht
von der Natur der Multiplication und der algebraischen Operationen im allgemeinen
bewiesen werden, welche auch einen weit besseren Beweis der mysteriösen
Lehre, welche sich Euler hier zu demonstriren be-[] müht, an die Hand
geben würde.
Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven
Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 30635
(vgl. Mill-Logik Bd. 2, S. 426-427) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-MJS08: "so sehr plausibel" drückt
einen quantitativen Plausibilitätsbegriff aus. Die Plausibilität
wird auf eine einleuchtende Prämisse zurückgeführt.
[MJS9] Einer von den ersten Denkern, welche
sich die Succession der geschichtlichen Ereignisse festen Gesetzen unterworfen
dachten und durch eine analytische Prüfung der Geschichte diese Gesetze
zu entdecken suchten, Vico, der berühmte Verfasser der Scienza Nuova,
war der ersteren Meinung. Er glaubte, die Erscheinungen der menschlichen
Gesellschaft bewegten sich in einem Kreise; sie gingen periodisch durch
dieselbe Reihe von Veränderungen hindurch, Obgleich es nicht an Umständen
fehlte, welche diese Ansicht plausibel machten,
so hielt sie doch eine strenge Prüfung nicht aus, und diejenigen,
welche Vico in derartigen Betrachtungen folgten, haben allgemein die Idee
einer Trajectorie oder eines Fortschritts anstatt einer geschlossenen Bahn
oder eines Cyclus angenommen.
Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven
Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 30814
(vgl. Mill-Logik Bd. 2, S. 536) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-MJS09: Eine plausible Ansicht (Beispiel
Vicos Kreistheorie) hält strenger Prüfung nicht stand. Plausibles
muss nicht richtig oder wahr sein.
[MJS10] Diesem Beispiele von Männern wollen
wir ein Beispiel von Regierungen beifügen. Die verhältnissmässig
aufgeklärte Herrschaft, welche Spanien während eines grossen
Theiles des achtzehnten Jahrhunderts genoss, verbesserte nicht die Grundfehler
des spanischen Volkes, und es ging in Folge hiervon so vieles von dem vielen
Guten, was diese Herrschaft temporär vollbrachte, mit ihr unter, dass
die Behauptung, sie habe keine bleibende Wirkung gehabt, ganz
plausibel erscheint.
Quelle: [Mill: System der deduktiven und induktiven
Logik. DB Sonderband: 100 Werke der Philosophie, S. 30872
(vgl. Mill-Logik Bd. 2, S. 571) https://www.digitale-bibliothek.de/habenmuss_philosophie.htm
]
Kommentar-MJS10: "ganz plausibel erscheint"
spricht für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff. Die gute
Herrschaft verpuffte ohne positive Wirkung auf das Volk. Damit bringt Mill
ein Wirkungskriterium für Plausibilität ins Spiel.
Olaf Müller John Stuart Mills Argument für den Utilitarismus Ein plausibler Weg zwischen Metaphysik und Nihilismus?
Quelle in Uwe Meixner / Albert Newen (eds): Geschichte der Ethik: Jahrbuch 6 für Philosopiegeschichte und Logische Analyse. (Paderborn:
Mentis 2003), pp. 167-191]. Online: https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/14131/23wZGJEfVx7Ck.pdf?sequence=1
Suchwort "plausib" 30 Treffer.
Zusammenfassung Müller: Aus den Beispielen OMS.S.3, OMS.S.4, OMS.S.7, OMS.S.8, OMS.S.9, OMS.S.11, OMS.S.14a, OMS.S.14b, OMS.S.20, OMS.S.22, OMS.S.23b ergibt sich, dass plausibel / Plausibilität nicht erklärt und das Plausibilitätsurteil nicht begründet wird, woraus man annehmen darf, dass das auch nicht für nötig erachtet wird. Eine quantitative Aufassung wird ersichtlich in: OMS.S.4, OMS.S.14b. Plausibles darf nicht widersprüchlich oder falsch sein und was mehr umfasst ist plausibler:
- OMS.S.2: Die Erklärung für unplausibel ergibt sich aus dem Kontext: Was heillos widersprüchlich ist, ist nicht plausibel.
- OMS.S.14b: Nicht ganz Unplausibel nicht erklärt. "Nicht ganz unplausibel" spricht für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff. Dem Zusammenhang nach: unplausibel weil falsch.
- OMS.S.20: Unplausibel wird nicht erklärt. Aus dem Zusammenhang: was viel umfasst ist eher plausibel.
OMS.2: "Prominente Kritiker Mills wie
Moore und Bradley beantworten solche Fragen unerschrocken mit
Ja. Dieser vernichtenden Interpretation beabsichtige ich entgegenzutreten.
Sie ist nicht nur
unplausibel, weil sie Mill
einen Denkfehler zuschreibt, der schlimmer kaum sein könnte.
Sie ist auch deshalb unplausibel, weil
sich in ihrem Lichte der gesamte Gedankengang Mills in heillose Widersprüche
verwickelt; das werde ich – nach Vorüberlegungen zur Methode
meiner Interpretation (Abschnitt II) – im
übernächsten Abschnitt III auseinandersetzen. "
- KommentarOMS.S.2: Die Erklärung für unplausibel ergibt
sich aus dem Kontext: Was heillos widersprüchlich ist, ist nicht plausibel.
OMS.3: "Wie wir sehen werden, wählt Mill
mit dieser (keineswegs vollständig wertfreien) Voraussetzung
einen plausiblen (wenn auch
nicht zwingenden) Mittelweg zwischen einem Nihilismus der Werte und
deren metaphysischer Überhöhung."
- KommentarOMS.S.3: Plausibel nicht erklärt.
OMS.4: "Die deutschen Übersetzer
haben sich nicht getraut, Mills Bitte
nachzukommen.6 Wir werden etwas mutiger sein und versuchen,
das Argument so umzuformulieren, dass es plausibler
wird. Gravierende Eingriffe in den Wortlaut sind meiner Ansicht nach nicht
nötig. Es wird genügen, die Reihenfolge der Sätze aus Mills
Passage umzustellen. "
- KommentarOMS.S.4: plausibler werden können bedeutet einen quantitativen
Plausibilitätsbegriff.
OMS.7: "Einerseits würde sie seinen
Gedankengang in einen zwingenden Beweis verwandeln –
doch Mill sagt mehrmals, dass er keinen Beweis im üblichen Sinn des
Wortes vorbringen möchte. Statt seine argumentativen Karten zu überreizen,
beansprucht er in aller Bescheidenheit, die Sache des Utilitarismus
plausibel
zu machen; er besteht nur darauf, dass die Entscheidung
für den Utilitarismus nicht einfach der Willkür anheimzustellen
sei.13"
- KommentarOMS.S.7: Plausibel nicht erklärt.
OMS.8: "[1] Der einzelne strebt nach seinem eigenen
Glück. [-1] Also ist das Glück des einzelnen erstrebenswert.15Meiner
Ansicht nach hat Mill mit guten Gründen auf diesen Schnell-Schluss
verzichtet. Das ergibt sich zumindest aus dem Testverfahren
zur Ausschaltung unplausibler Interpretationen,
das wir eingangs (im Abschnitt II) entwickelt haben."
- KommentarOMS.S.8: Unplausibel nicht erklärt.
OMS.9: "Wir brauchen uns hier nicht den Kopf
darüber zu zerbrechen, inwiefern das Argument beim Schweinefutter
plausibel
ist und warum es sich nicht in ein paralleles Argument über das Vergnügen
der Schweine verwandeln lässt"
- KommentarOMS.S.9: Plausibel nicht erklärt.
OMS.11: "Zweitens würde eine
wertende Interpretation der Behauptung [2] nicht gut zum parallelen
Strang aus Mills Gedankengang passen, den
wir eingangs erwähnt und schon mehrmals herangezogen
haben, um unplausible Interpretationen
auszuschalten. "
- KommentarOMS.S.11: Unplausibel nicht erklärt.
OMS.14a: "Dass es sich so
verhält, sagt Mill zwar nicht in
der Passage, um die es uns hier zu
tun ist. Aber erstens sagt er etwas sehr ähnliches an anderen Stellen
in unserem Kapitel (dazu gleich). Und zweitens kann er ohne diese zusätzliche
Voraussetzung unter keinen Umständen zum Ziel
kommen. Ohne diese Voraussetzung wäre der
Utilitarismus ganz unplausibel.
Denn wenn das Streben nach Glück, entgegen der zusätzlichen
Voraussetzung, ein Nullsummenspiel wäre, d.h. wenn jeder Glücksgewinn
des einen notwendig mit einem gleich großen
Glücksverlust des andern einherginge, wenn
also die Summe des gesamten Glücks
immer konstant bliebe: dann wäre es
unmöglich, das allgemeine Glück zu mehren, und die utilitaristische
Doktrin liefe ins Leere. "
- KommentarOMS.S.14a: Unplausibel nicht erklärt.
OMS.14b: "Damit haben wir eine
versteckte Voraussetzung in Mills Gedankengang
entdeckt – eine Voraussetzung, die allerdings nicht ganzunplausibel
ist: (A) Das Streben nach Glück ist kein Nullsummenspiel;
Menschen sind so konstituiert, dass sie
Glück aus der Beförderung des Glücks
anderer ziehen können. Dass Mill eine derartige psychologische
Behauptung für richtig hält, steht
außer Zweifel.23"
- KommentarOMS.S.14b: Nicht ganz Unplausibel nicht erklärt. "Nicht
ganz unplausibel" spricht für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff.
Dem Zusammenhang nach: unplausibel weil falsch.
OMS.20: "Ob Mills hedonistische
Psychologie universell gültig ist und wirklich alle
Menschen aus allen Zeiten und Kulturen erfasst, kann ich hier nicht erörtern.
(Sie ist weniger unplausibel,
als auf den ersten Blick scheinen mag, wenn man bedenkt, dass Mill einen
Begriff des Glücks verficht, der recht viel umfasst,
z.B. die Tugend). "
- KommentarOMS.S.20: Unplausibel wird nicht erklärt. Aus dem Zusammenhang:
was viel umfasst ist eher plausibel.
OMS.22: "Wie wir gesehen haben, will Mill empirisch
herausgefunden haben, dass die Menschen letztlich nach
nichts anderem streben als nach Glück.
Ob diese psychologische Behauptung (samt weiterer
psychologischer Annahmen, die Mill machen muss) überzogen
sind, konnten wir hier nicht erörtern. Aber wir haben versucht, Mills
Weg von diesen Annahmen in die Moral plausibel
zu machen. "
- KommentarOMS.S.22a: Plausibel wird nicht erklärt. Aus dem
Zusammenhang ergibt sich, dass die gesamte Arbeit als Beispiel für
plausibel machen für Mills Weg von seinen Annahmen bis in seine Moral
betrachtet werden kann.
OMS.23ab: "Zudem bedrängen uns weit mehr
moralische Fragen als die Frage nach dem richtigen Tun. Selbst wenn Mills
Gedankengang aus unserer Passage plausibel
sein sollte, führt von dort kein plausibler
Weg zu den überzogenen Ansprüchen der Utilitaristen, alle Fragen
der Moral im Griff zu haben. Zum Glück nicht! "
- KommentarOMS.S.23b: Plausibel wird nicht erklärt.
Neuser, Wolfgang (1995) Natur und Begriff. Zur Theoriekonstitution und Begriffsgeschichte von Newton bis Hegel. 2. Auflage. Wiesbaden: Springer.
Suchwort „plausib“ viele Treffer, „Plausibilitätskriterien“ keinen Treffer. Noch nicht ausgewertet.
Pörksen, Bernhard (2011, Hrsg.). Schlüsselwerke des Konstruktivismus. Wiesbaden Springer Fachmedien.
Suchwort „plausib“ 17 Fundstellen. Noch nicht ausgewertet.
Quine
Zusammenfassung Quine: Plausibel wird in den drei Fundstellen weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält Quine plausibel für einen allgemein verständlich und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.
In Quine (dt. 1980) In Wort und
Gegenstand kein Eintrag im SR.
- S. 51: "Gelangt der Wissenschaftler etwa in der
Dynamik zu Gesetzen, die keinen bestimmten Bezugsrahmen gegenüber
anderen, die sich relativ zu ihm in Bewegung befinden, auszeichnen, so
geht er ohne Aufenthalt dazu über, den Begriff der absoluten Ruhe
und folglich auch den einer absoluten Raumstelle als unhaltbar zu betrachten.
Diese Ablehnung ist nicht, wie man vielleicht annehmen möchte, eine
Ablehnung des empirisch Undefinierbaren - empirisch einwandfreie Definitionen
der Ruhe lassen sich ohne weiteres geben, indem man irgendeinen der verschiedenen
spezifizierbaren Bezugsrahmen willkürlich auswählt. Die Ablehnung
ist vielmehr eine Ablehnung des Unbegründeten. Dank der unscharfen
Grenzen des Einfachheitsgedankens läßt sich dieses Prinzip jedoch
plausibel
auch unter die Forderung der Einfachheit subsumieren."
Kommentar-Qui1980-S.51: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung.
- Qui1980-S.60 Kutschera Zitat S.119
Quine aus Word and Object, p.27 "The infinite totality of sentences
of any given speaker's language can be so permuted or mapped into itself,
that (a) the totality of the speaker's dispositions to verbal behavior
remains invariant, and yet (b) the mapping is no mere correlation of sentences
with equivalent sentences, in any plausible
sense however loose.39"
Die Aussage findet sich in der deutschen Übersetzung auf S. 60: "... Die Gesamtheit der Sätze der Sprache eines Sprechers läßt sich so permutieren bzw. auf sich selbst abbilden, daß (a) die Gesamtheit der Dispositionen des Sprechers zu verbalem Verhalten unverändert bleibt und daß (b) die Abbildung dennoch keine bloße Konelation von Sätzen mit äquivalenten Sätzen ist (in einem plausiblen Sinne von Äquivalenz, und sei er auch noch so unbestimmt).
Kommentar-Qui1980-S.60: Ein ziemlich dunkle Aussage "in einem plausiblen Sinne von Äquivalenz, und sei er auch noch so unbestimmt", wobei sowohl offen bleibt, was plausibel bedeuten soll als auch was "in einem plausiblen Sinne von Äquivalenz" bedeuten soll. Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung.
Quine (1975) Das Sprechen über Gegenstände.
In (7-41) Ontologische Relativität und andere Schriften
- S. 18: "Ein anderes plausibles Mißverständnis
ist das folgende: »Apfel« als kontinuativer Term könnte
nur auf Apfelmaterial zutreffen, das in einzelnen Äpfeln verteilt
ist, während »Äpfel« noch wie zuletzt vorgeschlagen
auftritt. Statt daß das eine dem anderen untergeordnet wäre,
würden sich dann »Äpfel« und »Apfel«
gegenseitig ausschließen."
Kommentar-Qui1975-S.18: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung.
Rorty, Richard (1970 engl.) Unkorrigierbarkeit als das Merkmal des Mentalen. In (243-260) Bieri, Peter (1993, Hrsg.) Analytische Philosophie des Geistes. Bodenheim: Athenäum.
Rorty1993-S.243: "Wenn wir jedoch zu Meinungen, Emotionen, Wünschen, Zwecken und Ähnlichem kommen, besteht keine Versuchung mehr, sie als Episoden statt als Dispositionen aufzufassen. Hier hat Ryles Grundgedanke — daß die Rede über diese Dinge eine Rede über Verhaltenserwartungen ist — große intuitive Plausibilität. Das Problem besteht bei diesen Fällen vielmehr darin, daß der Versuch zu scheitern scheint, solche Ausdrücke wie “Er will Y” oder “Er beabsichtigt, A zu tun“ in Sätze über körperliche Bewegungen zu übersetzen."
Kommentar-Rorty1993-S.243: Plausibilität wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung, sondern anscheinend als nicht weiter erklärungs- oder begründungsbedürftiger Grundbegriff angenommen.
Schmidt Bedeutung und Begriff
Zusammenfassung-Schmidt. In dem grundlegenden und interessanten Werk habe ich drei Fundstellen für "Plausibilität" und "plausibel" gefunden. Der Begriff wird nicht erklärt und in seiner Bedeutung begründet. Aus der ersten Textsstelle S. 59 ergibt sich, dass es nach Schmidt eine unmittelbare und damit auch eine mittelbare (plausibel ;-)?) Plausibilität gibt. Die zweite Fundstelle ergibt: Plausibilität durch empirische Befunde des Lernens geltend gemacht. Also Gründe für Plausibilität durch empirische Befunde. Auch der Dritten kann man dies entnehmen: Plausibilität durch empirische Befunde der Gestalttheorie geltend gemacht. Also Gründe für Plausibilität durch empirische Befunde.
Schmidt-1 "Der Eindruck
unmittelbarer Plausibilität, den die Theorie einer absolut-objektiven
Realität als Subjekt-absolute Vorgegebenheit erweckt, entsteht vielleicht
durch eine stillschweigende, unbeobachtete Extrapolation, die etwa so beschrieben
werden kann: Bei dem Versuch, sich in Geschichten zurechtzufinden, erweist
es sich als unumgänglich, bewährte Grenzziehungen, d.h. geordnete
Fest-Stellungen von Dingen und Relationen festzuhalten, da sie sich für
gewisse Typen von Geschichten und Geschichtenselegaten bewährt haben.
Im Verlauf von Kommunikation, Lehre und Tradition werden sie weitergegeben,
verfestigen sich und verdecken ihren Ursprung aus der Perspektiven- oder
Geschichtenbedingtheit. Wenn über einen langen Zeitraum hinweg keine
Geschichte eintritt, die diese Grenzziehungen in Frage stellt (in denen
man mit den gemachten Fixierungen nicht mehr auskommt), entsteht der Eindruck,
man habe nun ganz unab-hängig von jeweils individuellen Geschichten
die ,wahre Wirklichkeit“ in den Griff bekommen, die man nun gleichsam von
vornherein, von außen, in alle neuen Geschichten mit einbringen und
dort erfolgreich anwenden kann. (Das Verhältnis von klassischer Mechanik,
Relativitätstheorie und Quantenmechanik kann hier schon als Gegenbeispiel
genügen.)"
Quelle S. 59: Schmidt, Siegfried J. (1969) Bedeutung
und Begriff. Braunschweig:Vieweg. [GB]
- Kommentar-Schmidt1969-S.59: Aus der Wendung ergibt sich, dass es auch
eine mittelbare Plausibilität geben sollte (ist das "plausibel"? ;-)
https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-24489/G%C3%B6hmann%2C%20Dirk%20-%20Der%20Utilitarismus%20John%20Stuart%20Mills.pdf
Schmidt-2 Ganzheitsraster plausibel
"3.3. Aus diesen Erörterungen läßt sich folgern, daß
ein Wort nur dadurch, daß es in einem größeren, mehrfach
strukturierten Zusammenhang eine Funktionsstelle besitzt, eine Bedeutung,
d.h. eine Leistungsbedeutung/ intersubjektive Relevanz erhält (cf.
Verf. 1966), und auch in dieser Hinsicht in isolierter Stellung als Lexem
nur ein Selegat darstellt.
Diese Interpretation wird plausibel durch
die Beobachtung, daß ein Sprecher das Vokabular seiner Sprache nicht
Stück für Stück lernt und in der Erinnerung speichert, sondern
daß er Bedeutungsgewebe als Ganze, als Vorkommensrahmen für
einzelne Elemente oder sinnvolle Koordinatensysteme kennenlernt und von
daher weiß, welche Einzelelemente in diesen Rahmen gehören.
Damit wird die Speicherkapazität des menschlichen Gehirns enorm gesteigert,
da sozusagen nur Raster (=Redundanzbildungsanwei- sungen) erinnert werden
müssen, die Rasterelemente aber dann ad hoc eingeordnet (hineinerkannt)
werden."
Quelle S. 99: Schmidt, Siegfried J. (1969) Bedeutung
und Begriff. Braunschweig:Vieweg.
Kommentar-Schmidt1969-S99: Plausibilität durch empirische Befunde
des Lernens geltend gemacht. Also Gründe für Plausibilität
durch empirische Befunde.
Schmidt-3 Gestalttheorie hat plausibel
gemacht
"Nach Auskunft der Psychologen (Hörmann, Lenneberg) gehört
die Fähigkeit, Gleichheiten und Ähnlichkeiten zu erkennen, zu
den wichtigsten Fähigkeiten jedes Organismus. Die Wahrnehmungspsychologie
seit der Gestalttheorie hat plausibel gemacht,
daß in der Wahrnehmung durchgängig eine Tendenz zur Gestaltbildung
oder Konstantisierung wirksam ist, m.a.W. eine Klassifikationstendenz.
In der Entwicklungspsychologie wird betont, daß ein Kind nur dann
Sprache erlernt, wenn es gelernt hat, gleiche Lautäußerungen
als gleich zu erkennen, indem es kriteriale (kategoriebestimmende) und
rauschende („noisy“) Attribute zu unterscheiden und beim eigenen Lautproduzieren
zu verwenden lernt. (So Brown, zit. Hörmann, 1967, S. 299). Dieser
lautlichen Konstantisierung entspricht nach Brown auch die sog. Referenzkategorie:
Eine Reihe verschiedener Netz-hautbilder wird zu einer Klasse zusammengefaßt,
in die all das eingeordnet wird, was gewisse flexible Grenzen der Erscheinungsweise
nicht wesentlich überschreitet. (Diese Klassenbildung im Nervensystem
läßt sich durch informationspsychologische Versuche einwandfrei
bestätigen; cf. G. Färber, mündl. Mitteilung.)"
Quelle S. 156: Schmidt, Siegfried J. (1969) Bedeutung
und Begriff. Braunschweig:Vieweg.
Kommentar-Schmidt1969-156: Plausibilität durch empirische Befunde
der Gestalttheorie geltend gemacht. Also Gründe für Plausibilität
durch empirische Befunde.
Schwemmer (2011) Das Ereignis der Form.
Schw2011-S.118: "... Dabei ist es bemerkenswert, dass Hegel, in dem man den Stammvater solcher Beschreibungen von sich selbst organisierenden Systemen sehen kann, die Plausibilität dieser seiner Beschreibungen immer wieder an Lebensphänomenen, vor allem am Kreislauf des Lebens, in dem sich verschiedene Formen des Lebendigen ausbilden — vom Samen zur Pflanze, zur Blüte und zum neuen Samen, zum Verwelken und Verwesen —, zu erweisen sucht. ..."
Kommentar-Schw2011-S.118: Plausibilität wird Hegels Idee sich selbst organisierende System im Kreislauf des Lebens zuerkannt. Plausibilität wird hier offenbar als nicht erklärungs- und begründungspflichtiger, weil allgemeinverständlich Grundbegriff betrachtet. Anmerkung: C. C. E. Schmid formuliert bereits 1791 in seiner empirischen Psychologie S. 425: „Der menschliche Leib ist also drittens ein organisirtes und sich selbst organisirendes Wesen, wie jedes andere Thier und die Pflanze.“ Da war Hegel 21 Jahre jung, aber er hat 1788/89 das Studium der evang. Theologie und Philosophie in Tübingen aufgenommen (1790 Magister der Philosophie).
Seebaß, Gottfried (1981) Das Problem von Sprache und Denken. Frankfurt: Suhrkamp.
S. 108: "Bisher haben wir das, was wir >Sprache< und >Denken< nennen ausschließlich formal bestimmt. Konkrete Antworten auf die Frage nach ihrem Zusammenhang können wir aber nur gewinnen, wenn wir die beiden zentralen Termini unserer These inhaltlich weiter spezifizieren. Darauf vor allem bezieht sich die oft getroffene Feststellung in der Literatur, daß das Problem von Sprache und Denken im Grundsatz gelöst wäre, wenn man darüber Klarheit besäße, was unter >Sprache< und »Denkern zu verstehen ist?6 Für den Sprachbereich folgt dies bereits aus dem Sinn der Problemstellung Herders und Humboldts, die ja letztlich das Wesen der Sprache betrifft (S. 89). Aber auch der Bereich des Denkens ist unmittelbar berührt. Wenn man, wie es die anthropologische Zielsetzung des Gesamtprogramms fordert, Aussagen über spezifisch menschliche Denkleistungen machen will, kann man nicht unspezifiziert über »das Denken« als (möglicherweise) wesentlich sprachliche Leistung reden, ganz davon abgesehen, daß eine derart pauschale Abhängigkeitsbehauptung ohnehin wenig plausibel wäre. Angegeben werden muß vielmehr, welche besondere Art des Denkens im Einzelfall vorliegt. Der unspezifizierte Terminus »Denkern, der in [B 3.1] und [B 3.2] auftritt, darf darum nur die Funktion einer Variablen haben, die durch unbestimmt viele speziellere Termini zu ersetzen ist, und der Bereich, der damit abgedeckt wird, muß sich, um eine spätere sinnvolle Untersuchung auch von [A] zu ermöglichen, auf die Gesamtheit denkbarer menschlicher, tierischer oder maschineller Intelligenzleistungen erstrecken.97
Kommentar-Seeb: "wenig plausibel" spricht für eine quantitative Aufassung, wobei plausibel als nicht erklärungs- oder begründungspflichtiger Begriff, den jedermann versteht, verwendet wird.
Querverweise: Denken und Sprechen, Definition denken.
Simmel, Georg
Zusammenfassung-Simmel: Aus den drei Fundstellen geht hervor, dass Simmel Plausibilität bzw. eine "gewisse Plausibilität" nicht erklärt und begründet.
Simmel-1 Gewisse Plausibilität (PlausGS),
eine
Wendung Simmels in Hauptprobleme der Philosophie
"Es gibt nun, wie mir scheint, nur einen einzigen Begriff, der mit
einer gewissen Plausibilität (PlausGS)
all jene Bestimmungen der »Substanz« in sich vereinigt: eben
der Begriff des Seins. Dieser vor allem kann dazu verführen, aus ihm
als bloßem Begriff die Realität als Gegenstand zu folgern: das
Sein allein scheint dasjenige zu sein, dessen Nicht-Sein ein logischer
Widerspruch wäre, das nicht als nicht-seiend gedacht werden kann.
Hier liegt der Drehpunkt dieses ganzen Typus von Seins-Philosophien: die
Verwechslung des Seins als abstrakten Begriffes mit dem Sein als der Gesamtheit
der seienden Dinge. Es ist schon richtig, daß das Sein nicht das
Nicht-Sein sein kann, oder: daß das Seiende, wenn es ist, wenn es
unter den Begriff des Seins gehört, nicht zugleich nicht-sein kann
– gerade wie ein Ding, wenn es schwarz ist, nicht zugleich nicht-schwarz
sein kann. Es liegt aber gar kein logischer Widerspruch darin, daß
das schwarze Ding überhaupt weggedacht werde, und ebensowenig also
darin, daß die seienden Dinge überhaupt weggedacht werden. Wenn
man einem Objekt eine gewisse Bestimmung zuspricht, so kann man sie ihm
freilich nicht zugleich absprechen, ohne gegen die Logik zu verstoßen;
spricht man sie ihm aber von vornherein ab, so ist die Voraussetzung des
Widerspruchs beseitigt.
Quelle: https://www.projekt-gutenberg.org/simmel/haupphil/chap003.html
Kommentar-Simmel-1: Plausibilität wird hier
quantitativ verwendet, wenn auch nicht erklärt und begründet.
Simmel-2 Beweis und Gegenbeweis mit gleicher Plausibilität (in der Philosophie des Geldes)
… Behält man diese relative Selbständigkeit des Lebens im Auge, mit der die objektiv gewordenen Kulturgebilde, der Niederschlag der geschichtlichen Elementarbewegungen, den Subjekten gegenüberstehen, so dürfte die Frage nach dem Fortschritt in der Geschichte viel von ihrer Ratlosigkeit verlieren. Daß sich Beweis und Gegenbeweis mit gleicher Plausibilität an jede Beantwortung derselben knüpfen läßt, liegt vielleicht oft daran, daß beide gar nicht denselben Gegenstand haben. So kann man z.B. mit demselben Recht den Fortschritt wie die Unveränderlichkeit in der sittlichen Verfassung behaupten, wenn man einmal auf die festgewordenen Prinzipien, die Organisationen, die in das Bewußtsein der Gesamtheit aufgestiegenen Imperative hinsieht, das andere Mal auf das Verhältnis der Einzelpersonen zu diesen objektiven Idealen, die Zulänglichkeit oder Unzulänglichkeit, mit der sich das Subjekt in sittlicher Hinsicht benimmt. Fortschritte und Stagnation können so unmittelbar nebeneinander liegen, und zwar nicht nur in verschiedenen Provinzen des geschichtlichen Lebens, sondern in einer und derselben, je nachdem man die Evolution der Subjekte oder die der Gebilde ins Auge faßt, die zwar aus den Beiträgen der Individuen entstanden sind, aber ein eigenes, ob ...
Quelle: [Simmel: Philosophie des Geldes. Philosophie von Platon bis Nietzsche, S. 62666
(vgl. Simmel-Phil., S. 525 ff.) https://www.digitale-bibliothek.de/band2.htm ]
Kommentar-Simmel-2: Eine ungewöhnliche Idee, dass sich Beweis und Gegenbeweis mit gleicher Plausibilität ergeben können. Beweis und Gegenbeweis kann es in der Wissenschaft nicht geben. Wenn etwas bewiesen ist, dann muss der Gegenbeweis falsch sein und umgekehrt.
Simmel-3 Kant unterschobene Plausibilität
der Sache
… Hiezu nun verfiel er [Kant] auf die Tafel der Urtheile, aus welcher
er, so gut es gehn wollte, die Kategorientafel bildete, als die Lehre von
zwölf reinen Begriffen a priori, welche die Bedingung unsers Denkens
eben der Dinge seyn sollten, deren Anschauung durch die zwei Formen der
Sinnlichkeit a priori bedingt ist: symmetrisch entsprach also jetzt der
reinen Sinnlichkeit ein reiner Verstand. Danach nun gerieth er auf noch
eine Betrachtung, die ihm ein Mittel darbot, die Plausibilität
der Sache zu erhöhen, mittelst der Annahme des Schematismus der reinen
Verstandesbegriffe, wodurch aber gerade der ihm selbst unbewußte
Hergang seines Verfahrens sich am deutlichsten verräth. Indem er nämlich
darauf ausgieng, für jede empirische Funktion des Erkenntnißvermögens
eine analoge apriorische zu finden, bemerkte er, daß zwischen unserm
empirischen Anschauen und unserm empirischen, in abstrakten nichtanschaulichen
Begriffen vollzogenem Denken noch eine Vermittelung, wenn auch nicht immer,
doch sehr häufig Statt findet, indem wir nämlich dann und wann
vom abstrakten Denken auf das Anschauen zurückzugehn versuchen; aber
bloß ...
[Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. Philosophie von
Platon bis Nietzsche, S. 63982
(vgl. Schopenhauer-ZA Bd. 2, S. 551 ff.) https://www.digitale-bibliothek.de/band2.htm
]
Kommentar-Simmel-3: Auch hier wird die Kant unterschobene
Plausibilität nicht erklärt.
Specht (1990) in der Einführung zu Bernard de Mandeville (1670-1733).
Quelle: Specht, Rainer (1990) Einführung zu Bernard de Mandeville
"Über den Ursprung von Tugend und Zivilsation". In (285-286) Specht,
Rainer (1990. Hrsg.) Rationalismus. Geschichte der Philosophie in Text
und Darstellung. Stuttgart: Reclam.
SpechtS.285 "... Nach Mandeville ist der Mensch
von Natur aus nicht altruistisch, sondern strikt egoistisch. Er strebte
ursprünglich — wie alle frei lebenden Tiere - allein nach Befriedigung
seiner Bedürfnisse. Damit er zur Zivilisation geeignet wurde, flößten
ihm kluge Männer die Überzeugung ein, die Unterdrückung
der Begierden und die Besorgung des Wohles anderer sei für ihn besser
als Lustbefriedigung. Diese Behauptung wurde durch die Erfindung der ideellen
Prämie Ehre und der ideellen Strafe Verachtung plausibel
gemacht. Dadurch erlangten die Ehrgeizigen den Vorteil, daß die Gutgläubigen
sich leichter regieren lassen. Die gegenläufige Meinung, die Entstehung
von Tugend hänge nicht von geschickter Indoktrination, sondern von
den Religionen ab, ist nachweislich falsch. Denn Ägypter, Griechen
und Römer hatten lächerliche Religionen, obgleich bei ihnen Wissenschaft
und Tugend blühten. ..."
Kommentar-SpechtS.285: Plausibel, hier im
Sinne von verständlich, wird nicht erklärt oder begründet,
sondern als allgemeinverständlich angenommen.
Eine Einführung in die Erkenntnistheorie Vorlesung von Wolfgang Spohn im SS 1995 Skriptum ausgearbeitet von Martin Rechenauer
Zusammenfassung SpohnMR: Die beiden Fundstellen belegen: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält SpohnMR plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.
SpohnMR-S.7: „Warum diese Fixierung auf Überzeugungen? Überzeugungen
sind wichtig für Wesen der Art, wie wir es sind. Wir sind Wesen mit
Interessen, Zielen und Absichten. Unsere Überzeugungen über die
Beschaffenheit der Welt sind wichtige Vermittlungsfaktoren, wenn wir uns
in dieser Welt betätigen und unsere Ziele erreichen wollen. Die Annahme
scheint plausibel, daß wir unsere Ziele
desto besser in die Tat umsetzen können, je mehr unsere Überzeugungen
über die Welt der Wahrheit entsprechen. Das betrifft sowohl die Wahrheit
unserer Überzeugungen über die Umstände in der Welt, unter
denen wir handeln wollen, als auch die über die Zweck-Mittel-Relationen,
die wir veranschlagen.“
KommentarSpohnMR-S.7: Plausibel scheinen.
Daraus ergibt sich: was plausibel scheint, muss noch nicht plausibel sein.
Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch
Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend
hält SpohnMR plausibel für einen allgemein verständlichen
und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.
SpohnMR-S. 26: „Doch schon Platon hatte Vorbehalte gegen die Ansicht,
man hätte mit der er-wähnten Analyse bereits hinreichende Bedingungen.
Er läßt Sokrates die Geschichte von einem Advokaten erzählen,
der vor Gericht die Richter mit einer gut vorgetragenen Rede von der Wahrheit
einer Aussage überzeugt, die zufälligerweise auch wahr ist. Aber
es ist zweifelhaft, ob die Richter dann über Wissen verfügen
(cf. Theaitetos,201b/c). Noch klarere Fälle treten auf, wenn man Antworten
errät. Man fragt mich, wie viele Fischotter in Deutschland in freier
Wildbahn leben. Ich sage, daß es 350 sind. Zufällig stimmt die
Zahl (hoffentlich sind es überhaupt noch so viele!). Habe ich damit
gewußt, wie viele Fischotter es in Deutschland in freier Wildbahn
noch gibt? Es scheint höchst unplausibel,
dies zu bejahen.“
KommentarSpohnMR-S.26: Aus "höchst unplausibel"
ergibt sich ein quantitativer Plausibilitätsbegriff. lausibel wird
weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis,
Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält SpohnMR plausibel für
einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder
begründungspflichten Grundbegriff.
Stachowiak (1987, Hrsg.) Handbuch der Pragmatik 2
Zusammenfassung Handbuch der Pragmatik 2: Suchwort "plausib" vier Treffer: 42, 60, 182, 280 und einen Sachregistereintrag (ungewöhnlich).
- HBP-2-S.42 Die erste Fundstelle S. 42 weist auf einen quantitativen Plausibilitätsbegriff hin.
- HBP-2-S.60: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält der Autor plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.
- HBP-2-S.182: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält der Autor plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.
- Kommentar-HBP-2-S.280 "Am plausibelsten" spricht für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff. Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält der Autor plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.
HBP-2-S.42
"I will not repeat here recent detailed discussion of Whewell's form of hypotheticodeductivism. 3 Briefly, the elements of Whewell's theory of induction are as follows. Induction begins by superimposition of an idea on the body of data to be explained (Whewell says "colligated"). The first step in an induction is thus not inferential, but an act of conceptual interpretation. The ideas initiating an induction are selected after "explication" in discussions of scientists. Whewell's discussion of the selection criteria for a new idea leaves the concept of a colligation rather vague, but I think he had in mind at least a minimal notion of selection of kinds of ideas having high plausibility indices because of prior success in initiating inductions. For example, in Novum Organon Renovatum he insists that ideas must [>be appropriately quantifiable — well colligated sets of data can be measured in various ways. To see a set of facts as quantifiable is to see them in an "new light", is to understand more than the sum of the data."
HBP-2-S.42 Die erste Fundstelle S. 42 weist auf einen quantitativen Plausibilitätsbegriff hin.
HBP-2-S.60
1.1 Ursprünge und Motive des Konventionalismus
Seit der Antike schon wurde gesehen, daß hinter vielen Normen,
denen wir uns tagtäglich fügen, keine andere Rechtfertigung steht
als eine stillschweigende Übereinkunft, so zu verfahren. Wer sie getroffen
und wann, liegt meistens und für immer im Dunkel. Daß es sich
gleichwohl um schlichte Konventionen und nicht um gottgewollte oder naturgegebene
Satzung handelt, bleibt jedoch das
plausible
Verständnis
solcher Normen. Durch den Gebrauch werden sie beibehalten. Vieles in Sitte
und Brauchtum wie in unserem Umgang miteinander wird als Frage der Konvention
betrachtet, auch wenn es durch die Gewohnheit schon zu einer „zweiten Natur"
geworden ist.
Kommntar-HBP-2-S.60: Plausibel wird weder erklärt
noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote
oder Anmerkung. Anscheinend hält der Autor plausibel für einen
allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten
Grundbegriff.
HBP-2-S.182
"2.3 Scientific Validity, and the Limits of Kuhn's Paradigm
The most dramatic moment in the relationship between a sociology of
knowledge and a theory of scientific knowledge came about twenty years
ago. It was during that period that the work of Thomas Kuhn appeared, providing
a theoretical framework to a pragmatic vision of science as an everyday
activity govemed by a series of paradigms, or universally recognized scientific
achievements or standards that for a time provides model problems and solutions
to a community of practitioners.
39 While Kuhn himself restricted his findings to the physical sciences,
others such as Feyerabend, Horowitz, and Barber quickly extended this sort
of analysis to cover the social and behavioral sciences. It became evident
that the authority of science rests largely with the scientific comunity
itself, rather than any set of truth-generating presuppositions. Further
the criteria of a paradigm, while subject to firm notions of truth, plausibility
and motivation, still remain sufficiently ubiquitous so that the place
of sociology of knowledge in the placement of a theory of knowledge remains
quite firmly etched and widely accepted."
Kommentar-HBP-2-S.182: Plausibel wird weder erklärt
noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote
oder Anmerkung. Anscheinend hält der Autor plausibel für einen
allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten
Grundbegriff.
HBP-2-S.280
"1.2 Bedeutung = Bedeutung (Gebrauch) in Sprachspielen Am plausibelsten
erscheint diese neue Sehweise, wenn man sich einfache (und noch nicht zu
einer Sprache im engeren Sinne zu rechnende) kommunikative Zeichen ansieht.
Z. B. können Dinge von der Form „—÷" die Bedeutung einer Richtungsangabe
haben. Woran liegt das? Wittgensteins Antwort: Allein daran, daß
wir (es gelernt haben) diese Dinge in gewissen Umständen eben so (zu)
verwenden. Kinder etwa, die an einer sogenannten Schnitzeljagd mitmachen
möchten, bekommen beigebracht, daß sie, wenn sie ans Ziel kommen
wollen, in der Richtung weiter suchen müssen, in die die Pfeilspitze
zeigt — und nicht das Pfeilende, obwohl auch eine solche Spielpraxis genauso
gut funktionieren würde. Die Bedeutung des Zeichens ist nichts weiter
als die Art und Weise seiner Verwendung in der Praxis des Spiels."
Kommentar-HBP-2-S.280 "Am plausibelsten" spricht
für einen quantitativen Plausibilitätsbegriff. Plausibel wird
weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis,
Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält der Autor plausibel
für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs-
oder begründungspflichten Grundbegriff.
HBP 2 (1987), S. 462
Sachregister: "Plausibility 182"
Tetens, Holm (2006) Philosophisches Argumentieren. Eine Einführung. 2. A. München: becks'sche Reihe
Zusammenfassung Tetens(2006): Tetens verwendet den Plausibilitätsbegriff wenigstens 7 mal, aber er erklärt ihn nicht, ein interessanter Befund für ein philosophisches Argumentationsbuch. Anscheinend ist Plausibilität für Tetens ein allgemein verständlicher Grundbegriff, den man nicht erklären muss oder vielleicht auch gar nicht erklären kann.
Textfundstellen: S. 35, 148, 172, 173, 174, 231, 262.
S.35: "So formuliert erscheint die Rede von 'Schlüssen' nicht
unplausibel."
S.148: "Das Argument ist nicht unplausibel.
Doch schlüssig ist es nur in einer ausführlicheren Version:"
S.172: "4. Die kausale Wechselwirkung zwischen materiellen Körpern
und Seele ist unmöglich; die Erklärung durch die ständigen
Eingriffe eines Deus ex machina ist unplausibel."
S.173: "4. Die direkte kausale Wechselwirkung zwischen materiellen
Körpern und Seele ist unmöglich; die Erklärung durch die
ständigen Eingriffe eines Deus ex machina ist unplausibel."
S.174: "2. Die kausale Wechselwirkung zwischen materiellen Körpern
und Seele ist unmöglich; die Erklärung durch die ständigen
Eingriffe eines Deus ex machina ist unplausibel."
S. 231: "Die Kontroverse zwischen den Churchlands und Searle ist aufschlussreich.
Im Kern ist der Einwand der Churchlands denkbar einfach. Für sie ist
die Prämisse von Searle «Syntax an sich ist weder konstitutiv
noch hinreichend für Semantik» falsch und erscheint nur wegen
des gegenwärtig mangelhaften technischen Niveaus der Computertechnik
plausibel.
"
S. 261f: "Wenn Zahlen außerhalb von Raum und Zeit existieren,
warum soll es dann nicht Gott und die Seele außerhalb von Raum und
Zeit geben? Wie oft haben Philosophen andere nicht-empirische Gegenstände
mit Verweis [] auf die Zahlen zu plausibilisieren
versucht."
Wikipedia zum Kritizismus des Hans Albert ist ein plausibler Ansatz, um zu einer möglichst klaren und möglichst widerspruchsfreien Beschreibung unserer menschlichen Erkenntnissituation und "Wissensmöglichkeit" zu gelangen. Aber in keinem Fall möchte er eine absolute Wahrheit verkünden, die frei von Irrtümern und Fehlern ist.
[Enzyklopädie: Albert, Hans. DB Sonderband: Wikipedia 2005/2006, S. 14856]
Kommentar Wikipedia zu Albert: Plausibel wird weder erklärt noch begründet, auch nicht durch Querverweis, Literaturhinweis, Fußnote oder Anmerkung. Anscheinend hält Wikipedia (2005/2006, S. 14856) plausibel für einen allgemein verständlichen und nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichten Grundbegriff.
Wohlrapp, Harald (2021) Der
Begriff des Arguments. 3. überarbeitete Auflage. Darmstadt: WBG.
Zusammenfassung Wohlrapp. Die zwei inhaltlichen Textstellen der Neuauflage,
die mir nicht vorliegt, wurden freundlicherweise vom Autor zur Verfügung
gestellt (danke). Insgesamt gibt es im Neuwerk nach Angaben des Autors
ca. 22 Fundstellen. Die zwei übermittelten inhaltlichen habe ich ausgewertet:
- Kommentar-Wohlrapp-S. 23: Hier nennt der Autor zwei Kriterien: "'irgendwie' Einleuchtendes" und die relative Häufigkeit, was sich durch die Ergebnisse der Pilotstudie belegen lässt. Die Interpretation einleuchtend ist Spitzenreiter bei den Merkmalen für Plausibilität (01). Und auch bei den Gründen spielt die Häufigkeit (35, 36, 37) eine bedeutsame Rolle.
- Kommentar-Wohlrapp-S. 413: Plausibilität in der Umgangssprache wird als subjektivierte Wahrscheinlichkeit interpretiert, was man durch meine Pilotstudie auch als empirisch belegt ansehen kann. Bei den Gründen "Wahrscheinliches ist plausibler" (46), sind es fast 85%, die das so sehen. Weniger klar ist das Ergebnis, wenn nur nach dem Merkmal gefragt wird (05), da gibt es deutlich drei Meinungs-Fraktionen.
S. 23: "Dem Wissen gegenüber bzw. ihm entgegengesetzt ist die
„Meinung“ (Doxa). Bei Platon war die Meinung ziemlich verachtet, weil sie
als Resultat der schlichten sinnlichen Wahrnehmung angesehen wurde und
diese Sinneswahrnehmung bekanntlich nicht immer zuverlässig ist. Aristoteles
räumt ihr etwas mehr Kredit ein, er scheint manchmal eine epistemologische
Perspektive einzunehmen, in der dann Wissen ein besonders abgesichertes
Meinen, aber doch ein Meinen ist. Dennoch ist klar, dass die einfache ungebildete
Meinung dem Wissen entgegensteht.
Meinungen sind nicht wahr, sondern sie sind u. U. „wahrscheinlich“
(eikos). Dieser Begriff ist, wie sich zeigen wird, der für unsere
Bemühungen interessanteste in den aristotelischen Theorien zur Argumentation.
Heute wird mit diesem Wort etwas durchaus Verwaschenes angesprochen, eine
Mischung aus Plausibilität (etwas „irgendwie“
Einleuchtendes) und relativer Häufigkeit (z. B. bei der Regenwahrscheinlichkeit).
Im griechischen Denken des 4. Jahrhunderts v. Chr. bedeutet Wahrscheinlichkeit
so etwas wie Wahrheitsähnlichkeit. Sie ist gegeben, wenn etwas einen
bestimmten Anschein hat. Ein Apfel ist wahrscheinlich reif, wenn er reif
aussieht, ein Schüler hat wahrscheinlich gelernt, wenn er eine erste
richtige Antwort gegeben hat. Angesichts des Wahrscheinlichen ist immer
die Frage angebracht, ob es auch so ist, wie es zu sein scheint. Dabei
kann sich herausstellen, dass es bloßer Schein war, aber das muss
durchaus nicht sein."
Kommentar-Wohlrapp-S. 23: Hier nennt der Autor zwei
Kriterien: "'irgendwie' Einleuchtendes" und die relative Häufigkeit,
was sich die Ergebnisse der Pilotstudie belegen lässt. Die Interpretation
einleuchtend ist Spitzenreiter bei den Merkmalen für Plausibilität
(01). Und auch bei den Gründen
spielt die Häufigkeit (35,
36,
37)
eine bedeutsame Rolle.
S. 413: "Manche Menschen unterziehen sich einer prophylaktischen Entfernung
wichtiger Organe, weil ihnen in der genetischen Beratung eine 60 % Wahrscheinlichkeit,
eine Krebserkrankung zu bekommen, mitgeteilt worden ist. Andere finden
bei den gleichen Zahlenwerten, die 40 % Aussicht, gesund zu bleiben, sei
Grund genug, ohne Operation weiter zu leben. Zu dieser subjektivierten
Version der Wahrscheinlichkeit gibt es unter dem Titel „Subjektive Wahrscheinlichkeit“
formale Systeme, die zur Grundlage haben, dass Menschen bereit sind, im
Hinblick auf ein kognitiv-emotionales Amalgam von theoretischen Hinweisen
und Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühlen, ihren Einschätzungen
einen quantifizierten Grad zuzuschreibenFN25. Solche Zahlenwerte sind mit
großer Vorsicht zu genießen. Nach Stabilität und Transitivität
wird besser nicht gefragt. In der Umgangssprache heißt die subjektivierte
Wahrscheinlichkeit auch „Plausibilität“.
Damit verbinden sich im Allgemeinen keine weiteren theoretischen Ambitionen.
Es wird hingenommen, dass manche Leute „plausibel“
finden, was für andere befremdlich oder abwegig ist."
Kommentar-Wohlrapp-S. 413: Plausibilität in
der Umgangssprache wird als subjektivierte Wahrscheinlichkeit interpretiert,
was man durch meine Pilotstudie auch als empirisch belegt ansehen kann.
Bei den Gründen "Wahrscheinliches ist plausibler" (46),
sind es fast 85%, die das so sehen. Weniger klar ist das Ergebnis,
wenn nur nach dem Merkmal gefragt wird (05),
da gibt es deutlich drei Meinungs-Fraktionen.
Literatur im Text.
Links (Auswahl: beachte)
https://portail.atilf.fr/encyclopedie/
https://enzyklothek.de/
Glossar, Anmerkungen und Fußnoten > Eigener wissenschaftlicher Standort.
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Internetseite
Um die häufige und lästige Fehlermeldung 404 zu minimieren, geben wir nur noch Links von Quellen an, die in den letzten Jahrzehnten eine hohe Stabilität ihrer URL-Adressen gezeigt haben (z.B. Wikipedia, DER SPIEGEL)
__
Dictionaire universel, contenant generalement tous les mots françois tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences & des arts; ... Recueilli & compilé par feu messire Antoine Furetiere, Tome Second.
Antoine Furetière Jan. 1691
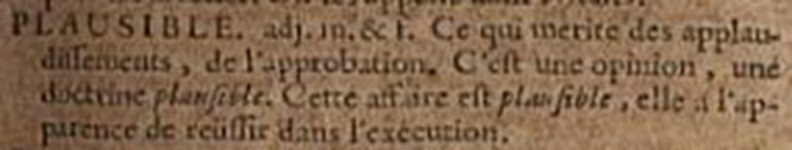
PLAUSIBLE. adj. in. & F. Ce qui merite des applaudissements, de
l'approbation. C'est une opinion, une doctrine plausible. Cette
affaire est plausible, elle a l'apparance de réüssir
dans l'exécution.
PLAUSIBEL. adj. in. & F. Das, was Beifall, Zustimmung verdient.
Das ist eine Meinung, eine plausible Doktrin. Dieser Fall ist plausibel,
und hat den Anschein, dass er in der Ausführung erfolgreich ist.
Quelle: https://play.google.com/store/books/details?id=CDcLRTUQkL8C&rdid=book-CDcLRTUQkL8C&rdot=1
https://play.google.com/books/reader?id=CDcLRTUQkL8C&pg=GBS.PP1&hl=de
Standort: Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskriterien in der Philosophie
*
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen Plausibilität.
Empirische Studie zu Begriff und Verständnis von Plausibilität.
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen * Methodik der Begriffsanalysen nach Wittgenstein *
Definieren und Definition * Wissenschaftliches Arbeiten * Zitieren in der Wissenschaft *
Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Wissenschaft site: www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, R. (DAS). Begriffsanalyse plausibel, Plausibilität, Plausibilitätskriterien. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wisms/sprache/BegrAna/Plausib/BApl_Philos.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_ Begriffsanalyse Plausibilität in der Philosophie__Datenschutz_Rel. Aktuelles _Überblick_Überblick Wissenschaft _Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service iec-verlag__Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_ Mail: sekretariat@sgipt.org_
kontrolliert: irs 14.10.2021:Schwemmer-Nachtrag gelesen / irs: 2. Rechtschreibprüfung 28.09.2021 / rs 1. Rechtschreibprüfung 28.09.2021
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
14.11.21 Specht in der Einführung zu Bernard de Mandeville * Schwemmer.
28.10.21 Wohlrapp eingeordnet. * Seebaß eingeordnet. * Hinweis zum Historischen Wörterbuch der Rhetorik.
24.10.21 Alphabetisch sortiert. Ergänzung Berkeley 1710, Hegel, John Stuart Mill. Ackermann in Medien verlegt.
16.10.21 Ergänzung Kutschera (1975) Sprachphilosophie.
14.10.21 Friedmann Anfangs- und Begründungsproblem der Erlanger Schule.
29.09.21 Seiten-Fundstellen Nachtrag bei Schmidt und zwei neue Beispielbelege: Ganzheitsraster, Gestalttheorie. Alle drei Fundstellen kommentiert und Zusammenhassung vorangestellt. Simmel 1,2,3 kommentiert. Ackermann kommentiert.
28.09.21 Vorläufiger Abschluss und erste Grundversion ins Netz gestellt.
07.08.21 Als eigene Seite angelegt.
01.07.21 Mit der Recherche und Materialsammlung begonnen.