(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=02.01.2013 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 27.01.20
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org__Zitierung & Copyright_
Anfang_Vertrauen und misstrauen _Datenschutz_Überblick_Rel. Aktuelles_Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service-iec-verlag__ Wichtige Hinweise Links u. Heilmittel
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Heilmittel-Lehre & Heilmittel-Monographien, und hier speziell zum:
J-Heilmittel
vertrauen und J-Heilmittel misstrauen
(glauben und zweifeln)
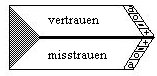
Übersicht Heilmittellehre und
Heilmittel-Monographien *
Literaturhinweis
Symbolik
Heilmittelgraphik *
Terminologie
und Kennzeichnungen.
von Rudolf Sponsel, Erlangen
Abstract
- Zusammenfassung - Summary
Vertrauen und Vertrauensfähigkeit sind ein hohes Gut, aber natürlich
auch Kritikvermögen und Skepsis. Die Bedeutung des Vertrauens und
Misstrauens ist für das gesellschaftliche Zusammenleben, persönliche
Befinden und die Selbstverwirklichung kaum zu überschätzen. Psychotherapeutisch
betrachtet sind Vertrauen und Misstrauen wichtige persönliche und
sozialpsychologische Heilmittel. Blindes oder naives Vertrauen kann ebenso
falsch oder schädlich sein wie übertriebenes oder chronisches
Misstrauen, dessen Extrem bis hin zum wahnhaften Argwohn gehen kann - wie
es Wilhelm Busch in "Die Nachbarskinder"
trefflich auf den Punkt bringt:
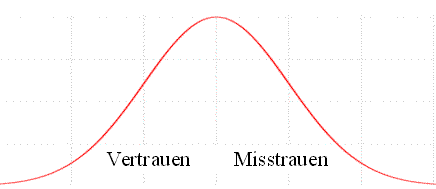 |
Wer andern gar zu wenig traut,
hat Angst an allen Ecken; wer gar zu viel auf andre baut, erwacht mit Schrecken. Es trennt sie nur ein leichter Zaun,
Wilhelm Busch, Die Nachbarskinder |
Begriffsfeld: vertrauen, glauben, blind vertrauen,
naives vertrauen, kritisches vertrauen, arglos, Vertrauensvorschuss, Treu
und Glauben, sich verlassen auf, annehmen, voraussetzen, vertragsfähig;
Vertrauen in ..., Vertrauen zu ...., Urvertrauen, Grundvertrauen.
Gegenbegriffe: argwöhnen, misstrauen,
nicht über den Weg trauen, zweifeln, kritisch, überkritisch,
skeptisch, ungläubig, distanziert, vorsichtig, vorläufig.
Anwendungsfelder sind das ganze Leben: Alltag,
Liebe, Freundschaft, Beziehungen, Geschäfte, Abmachungen, Beratung,
Psychotherapie, Heilkunde, Justiz, Behörden, Technik (Funktionsfähigkeit
und Zuverlässigkeit), Wissenschaft, Religion (Gottvertrauen), ...
Das psychologische Fundament des Vertrauens ist das Glauben - im allgemeinen psychologischen Sinne. Vieles müssen wir glauben, weil wir nicht wissen können, z.B. alles, was in der Zukunft geschehen wird. Dort, wo man gar nicht wissen kann, vielleicht sogar grundsätzlich nicht, muss man zwangsläufig glauben, so oder so, ob man will oder nicht. Das gilt überwiegend auch für das Reich der Werte, Ethik und Moral, die weltanschaulichen, metaphysischen und religiösen Fragen.
Definitionskerne
Glauben, Vertrauen, Erwartung, Wissen
| Glauben heißt, einen Sachverhalt für so oder so (> subjektive Gewissheitsgrade) wahr, falsch oder (un-) wahrscheinlich zu halten, ohne es zu wissen. Vertrauen ist ebenso eine Form oder Variante des allgemeinen psychologischen Glaubens wie die Erwartung, das Rechnen mit .... Wer weiß, muss nicht glauben. |
Vertrauen
ist praktisch nützlich bis notwendig (> Luhmann)
Manches könnte man aber auch prinzipiell wissen, aber man verzichtet
oft aus praktischen Gründen auf Kontrollen und Prüfungen, etwa
wenn man in einem Gasthaus etwas bestellt, trinkt oder isst. Im allgemeinen
wird man keinen Lebensmittelchemiker dabei haben, der die Sachen untersucht
und frei gibt. Und selbst wenn: dann müsste man diesem glauben. Das
ist die Situation mit Fachkundigen oder Vertragspartnern. So glaubt oder
vertraut man im Alltag vielen Menschen oder Institutionen weil es aus praktischen
Gründen sinnvoll ist oder nicht anders geht.
| Der berühmteste Logiker des 20. Jahrhunderts, Kurt Gödel, ist durch seinem Vergiftungswahn gestorben (verhungert): weil er nicht glauben konnte, dass sein Essen unvergiftet war. Er vertraute nicht. |
Wir sehen an diesem tragischen Beispiel zweierlei: erstens Logik hilft nicht gegen Wahn, und zweitens, es gibt Vertrauensstörungen von Krankheitswert: die Paranoia in beide Richtungen: z.B. ist im Größenwahn die eigene Bedeutung mit maßlosem Vertrauen ausgestattet, im Minderwertigkeits-, Verfolgungs- oder Vernichtungswahn wird die eigene Macht, Kraft und Stärke nicht mehr erkannt, stattdessen Ohnmacht bis zum totalen Ausgeliefertsein erlebt und fremde Mächte völlig überhöht erlebt..
Misstrauen
ist praktisch nützlich bis notwendig
Wir leben schon immer in einer Welt, in der viel gelogen, frisiert,
geschönt, getäuscht, getrickst, betrogen wird. Nichts ist so
normal und verbreitet wie Lügen, Betrügen, tricksen, frisieren,
Verstellen und Theaterspielen.
Wir alle spielen Theater, so nannte
der Soziologe Goffman ein (berühmtes) Buch. Betrug und die Lüge
sind die ewigen Blockbuster und Evergreens erfolgreichen Sozialverhaltens
(> Hochstapler).
Es gibt sogar eine ganze Industrie, die sich berufsmäßig um
professionelles Lügen kümmert: die Werbung. Aber auch die Institution
Politik betreibt Lügen, Tricksen, Täuschen ganz professionell,
es gehört zum Grundrepertoire der Politik, wie Machiavelli
bereits abschließend trefflich erkannte. Und das relativ neue Medium
Use- und Internet erscheint derzeit besonders geeignet zum Täuschen,
Tricksen, Vormachen, Verstellen und Lügen, dass sich die Balken biegen.
Hier darf jeder anonym die Sau raus lassen und sich austoben, wie es ihm
gefällt:
Baal
ist überall. Selbst in der Wissenschaft
sind Lug und Trug an der Tagesordnung (bis hin zu wissenschaftlichen
Wahnsystemen). So gesehen, ist ein gesundes Misstrauen "lebensnotwendig".
Aber zu viel davon kann auch das Leben vergällen und sich sogar zu
einer psychischen Erkrankung steigern: der Paranoia oder Wahnerkrankung
in vielfältigen Formen und Varianten. Nicht zu vergessen, die traditionellen
Seelenjäger und Heilsbringer, die Propheten, Abgesandten Gottes, Religionsstifter,
Missionare, Bonzen, Pfarrer, Mullahs, Rabbis und ihre Geschwister und Brüder,
deren "göttliche" - besser teuflische - Wirkungen eine Blutspur
in der menschlichen Geschichte hervorbrachte und immer noch hervorbringt,
wie sie schlimmer kaum denkbar ist. Bei Auserwählten
(2) ist also grundsätzlich
Misstrauen geboten.
Dem Spannungsfeld vertrauen und misstrauen, glauben und zweifeln kann man im Allgemeinen nicht entgehen und das ist wohl meist auch gut so. Übertreibt man in die eine oder andere Richtung, weil innere Beweggründe danach verlangen, kann es kritisch werden.
Anwendungsbereiche
Glauben und
vertrauen in der Heilkunde
In der Heilkunde spielt vertrauen eine überragende Rolle. Vertrauen
oder glauben sind mächtige Heilmittel, wie das z.B. Frank
in seinem berühmten Buch über das Heilen hervorragend dargelegt
hat. Der Placebo-Effekt beruht ausschließlich auf dem Vertrauen oder
Glauben und bestätigt damit die überragende Bedeutung von vertrauen
und glauben in der Heilkunde. Im Buch von Bitter - Magie und Wunder in
der Heilkunde - wurde sogar ein Beispiel bemüht, wie falscher Glaube
sogar zum Tode führen kann (wobei nicht ganz sicher ist, ob es sich
dabei nicht um eine "urban legend"
handelt).
Vertrauen
in der forensischen Psychiatrie: nicht vorgesehen
Obwohl Menschen sich vollständig und extrem riskant in der forensischen
Begutachtungssituation ausliefern, prüfen die allerwenigsten, ob ein
solch extrem riskanter Vertrauensvorschuss überhaupt gerechtfertigt
ist. Viele wissen auch gar nicht, wie sie das prüfen könnten.
Und die forensische Psychiatrie weiß es selbst offenbar auch nicht.
Sie vermeidet und unterdrückt das Thema - ein denkbar schlechtes Zeichen
(siehe Faksimile-Beleg). Diese Situation hat mich zu einem paradoxen "bon
mot" veranlasst: "Wer der forensischen Psychiatrie und ihren RichterInnen
einfach so vertraut, sollte sich auf seinen Geisteszustand untersuchen
lassen."

_
Empirie
alltäglichen Glaubens und Vertrauens
Tagtäglich finden Milliarden von Handlungen statt, die "nur" auf
glauben oder vertrauen beruhen. Vieles wird auch implizit und nicht bewusst
geglaubt oder angenommen. Wir vertrauen im Allgemeinen weit mehr als wir
vordergründig von uns meinen.
Psychologie
der Vertrauensentwicklung und des Vertrauensaufbaus
In glauben und vertrauen fließen mehrere Faktoren ein: Wünsche,
Interessen, Bedürfnisse, Wissen, Erfahrung, Gewohnheiten, Situationserfordernisse.
Die Vertrauenzuweisung ist ein komplexer, intuitiver Vorgang, die Wahrnehmung
einer Ganzheit im Sinne der Gestaltpsychologen. Bei Erstbegegnungen kommt
es hierbei zum sog. ersten Eindruck. Die Vertrauensbildung ist dann ein
fortlaufender Prozeß wechselseitiger Signalverarbeitung. Vertrauensbildung
ist im Fluß mit ständiger Veränderungs- und Entwicklungsmöglichkeit.
Die einzelnen Signale oder Einheiten von ihnen können sich auch widersprechen,
nicht zu einander passen. Dann entsteht ein Problem kognitiver Dissonanz
und ihrer Bewältigung.
Ein realistisches Modell könnte etwa so aussehen: Ein Sender oder Objekt O mit dem Hintergrund HO sendet in einer Situation SO Reize RO, die von einem Empfänger E mit dem Hintergrund HE in der Situation SE verarbeitet RE werden.

Exkurs: subjektive
Gewissheitsgrade
Stufen und Grade der Gewissheit
9 Absolute subjektive Gewissheit, die nicht zu erschüttern
ist (Wahngewissheit)
8 Subjektive Gewissheit
7 Subjektiv sicheres Wissen
6 Subjektives Wissen
5 subjektiv überzeugt
4 subjektiv fast überzeugt
3 so und so für wahr oder falsch halten
2 so und so glauben, vermuten oder annehmen
1 unsicher, zweifelnd, ob etwas so oder so ist
0 sehr unsicher und zweifelnd, ob etwas so oder so ist
Vertrauen und glauben in Beratung, Coaching und Psychotherapie
Vertrauen oder Glauben sind reflexiv, d.h. sie können von bewusstseinsfähigen Subjekten auf sich selber angewendet werden. Vertraue ich mir selbst, glaube ich an meine Fähigkeiten und Möglichkeiten, vertraue ich meinen Fähigkeiten zur Abgrenzung, Nein sagen, Selbstbestimmung (Selbstbehauptung), habe ich genügend Vertrauen in meine Werte (Selbstwertgefühl), glaube ich daran, mich genügend sicher da oder dort bewegen zu können? Kenne ich mich, weiß ich um meine Stärken und Schwächen (Selbstbewusstsein)?
Habe ich genügend Vertrauen in die Kompetenz
der PsychotherapeutIn? Merke ich, dass sie mich respektiert und so annimmt,
wie ich (derzeit) bin? Jede Psychotherapie hat zwei Aspekte oder Dimensionen:
die persönliche Arbeitsbeziehung und die sachliche, problemorientierte
Arbeitsbeziehung. Im Allgemeinen gilt, dass eine tragfähige persönliche
Beziehung Grundlage einer prognostisch günstigen Problemlösungsarbeit
ist. Daher wurde früher in den humanistischen Gruppentherapien
zu Recht nach der Regel verfahren: persönliche Beziehungsprobleme
haben Vorrang.
Psychologische Theorie des Vertrauens in der Alltagspraxis
Definitionsversuche vertrauen
Es gibt viele Definitionen oder Definitionsversuche. Die meisten sind
unbefriedigend und weder wissenschaftlich noch praktisch brauchbar, weil
sie nur einzelne Aspekte hervorheben oder gar falsch sind, wenn sie mit
sachfremden - z.B. moralischen - Kategorien (Nr. 1: Schottlaender) vermengt
werden. Petermann (1985, S. 12f) hat in seiner Monographie Psychologie
des Vertrauens einige Kennzeichnungen und Kriterien zusammengestellt: "
- Vertrauen resultiert aus bisheriger Erfahrung und der Hoffnung auf das Gute im Menschen (SCHOTTLAENDER, 1957).
- Vertrauen reduziert die Komplexität menschlichen Handelns und gibt Sicherheit (LUHMANN, 1973).
- Vertrauen hängt von frühkindlichen Erfahrungen, vor allem von der Qualität der Mutter-Kind-Beziehung ab. Unnötige Versagungen, Drohungen und persönliche Unzuverlässigkeit verhindern Vertrauen (ERIKSON, 1963).
- Vertrauen basiert auf der Erwartung einer Person oder einer Gruppe, sich auf ein mündlich oder schriftlich gegebenes Versprechen einer anderen Person bzw. Gruppe verlassen zu können (ROTTER, 1967; 1971).
- Zwischenmenschliches Vertrauen bewirkt, daß man sich in einer riskanten Situation auf Informationen einer anderen Person über schwer abschätzbare Tatbestände und deren Konsequenzen verläßt (SCHLENKER et al, 1973). [<12]
- Vertrauen ist der Glaube, daß der andere für dich irgendwann das tut, was du für ihn getan hast (JACKSON, 1980).
- Vertrauensvolles Handeln weist Verhaltensweisen auf, die (a) die eigene Verwundbarkeit steigern, (b) gegenüber einer Person erfolgen, die nicht der persönlichen Kontrolle unterliegt und (c) in einer Situation gewählt werden, in der der Schaden, den man erleidet, größer ist als der Nutzen, den man aus dem Verhalten ziehen kann (DEUTSCH, 1962).
- Vertrauen zwischen zwei Menschen läßt sich an verbalen und motorischen Indikatoren feststellen; solche sind häufige Hier- und-jetzt-Äußerungen, selbstexplorative Äußerungen, Wunsch nach und Verstärkung von selbstexplorativen Äußerungen, Bitte um bzw. Erteilen von Feedback, Bitte um Hilfe bei einem Problem, spontane unaufgeforderte Beteiligung und wechselseitiges Verstärken (KRUMBOLTZ & POTTER, 1980).
- Vertrauen zeigt sich in der Bereitschaft, über Themen zu sprechen, die potentiell Abwertung und Zurückweisung hervorrufen können, für den Klienten also ein Risiko darstellen (JOHNSON & MATROSS, 1977).
Die wichtigsten gemeinsamen Merkmale der Definitionen faßt
SCHLENKER et al. (1973) in einem Satz zusammen (siehe Definition 5). Wesentlich
im Verständnis von Vertrauen ist:
- der Aspekt der Ungewißheit,
- das Vorhandensein eines Risikos,
- die mangelnde Beeinflussung des Schicksals (freiwilliger oder erzwungener Kontrollverzicht) und
- die Zeitperspektive (= auf die Zukunft ausgerichtet).
Ein wichtiger, allerdings nur in der Definition von LUHMANN ausdrücklich
hervortretender Aspekt, bezieht sich noch auf die Verknüpfung von
Vertrauen und Selbstvertrauen. LUHMANN (1973, S. 77) argumentiert, »daß
Menschen vertrauensbereit sind, wenn sie über innere Sicherheit verfügen,
wenn ihnen eine Art Selbstsicherheit innewohnt, die sie befähigt,
etwaigen Vertrauensenttäuschungen mit Fassung entgegenzusehen ...«
In diesem Kontext wäre Selbstvertrauen eine vertrauensfördernde
Bedingung — eine Überlegung, die wir in Kapitel 7 vertiefen.
Vertrauensdefinitionen konkretisieren sich auf dem Hintergrund der
unterschiedlichen Anwendungsgebiete. ... [<13]"
___
Luhmann
zur alltäglichen Notwendigkeit von Vertrauen: "Vertrauen im weitesten
Sinne eines Zutrauens zu eigenen Erwartungen ist ein elementarer Tatbestand
des sozialen Lebens. Der Mensch hat zwar in vielen Situationen die Wahl,
ob er in bestimmten Hinsichten Vertrauen schenken will oder nicht. Ohne
jegliches Vertrauen aber könnte er morgens sein Bett nicht verlassen.
Unbestimmte Angst, lähmendes Entsetzen befielen ihn. Nicht einmal
ein bestimmtes Mißtrauen könnte er formulieren und zur Grundlage
defensiver Vorkehrungen machen; denn das würde voraussetzen, daß
er in anderen Hinsichten vertraut. Alles wäre möglich. Solch
eine unvermittelte Konfrontierung mit der äußersten Komplexität
der Welt hält kein Mensch aus.
Diesen Ausgangspunkt kann man als unbezweifelbares Faktum als „Natur"
der Welt bzw. des Menschen feststellen und würde damit etwas Wahres
aussagen [FN1]. Alltäglich vertraut man in dieser Selbstverständlichkeit.
Zutrauen in jenem fundierenden Sinne ist für das tägliche Leben
Komponente seines Horizontes, Wesensmerkmal der Welt, aber nicht intendiertes
(und damit variierbares) Erlebnisthema." (1989, S.1 )
Aufbau von Vertrauen
Zusammenfassung Petermann
(1985, S.125):
"Der Aufbau von Vertrauen wird durch Sicherheitssignale erleichtert,
die in verschiedenen Phasen der menschlichen Entwicklung vom Kleinstkind
bis zum Greis unterschiedliche Formen annehmen können. Gleich ist
jedoch die Funktion solcher Signale: Sie verringern soziale Angst und geben
Orientierung - auch Orientierung darüber, wann und wem man Vertrauen
schenken kann! Auf diesem Hintergrund lassen sich die meisten Ausführungen
der vorangegangenen Kapitel einordnen, was es uns auch ermöglicht,
den Prozeß des Aufbaus und Verlustes von Vertrauen in diesem Kapitel
zu strukturieren. Es lassen sich für Vertrauensaufbau und -verlust
jeweils drei Phasen angeben. Sie beziehen sich auf (1) die Qualität
zwischenmenschlicher Kommunikation, (2) das Vorliegen beziehungsweise den
Abbau bedrohlicher Handlungen und (3) den gezielten Einsatz von vertrauenshemmenden
oder -fördernden Handlungen. Vertrauen wird damit als aktiver
Prozeß aufgefaßt, der entscheidend vom Ausmaß des empfundenen
eigenen Kompetenzgefühls (= Selbstvertrauen) abhängt.
Kapitel 7 ging auch auf die Bedingungen ein, die Vertrauen behindern oder
gar zerstören.
Kapitel 8 möchte die Überlegungen zum
Vertrauensaufbau zu konkreten therapeutischen Handlungsrichtlinien verdichten.
Hierzu wird, wie im Kapitel 5, auf den therapeutischen Umgang mit Kindern
eingegangen."
Prototypische Vertrauenssituationen
Kennt man sein Gegenüber wenig, hat man keine oder kaum Erfahrung
miteinander, ist Vertrauen um so nötiger, aber auch schwieriger und
unsicherer. Erfahrung, Information, Wissen kann vertrauen oder misstrauen
fördern, je nachdem, welche Erfahrungen gemacht wurden, welche Informationen
vorliegen oder welches Wissen vorhanden ist.
Vertrauensexperimente
Gefangenendilemma (Experiment), Fallversuch (Gruppendynamik), etwas
verleihen (Alltag).
Ökonomische
Aspekte des Vertrauens
Vertrauen ermöglicht schnelles Handeln und ist insofern sehr ökonomisch.
Man braucht keine aufwändigen Sicherungsmethoden oder Kontrollen und
Prüfungen. Wer nicht hinter jedem Busch einen Räuber wähnt,
lebt angenehmer und leichter, spart Achtsamkeits- und Sicherungsenergie
- kann aber natürlich auch hereinfallen.
Materialien und Aussagen zum Vertrauen ..." []
Vertrauensvorschuss für einfach
auszusprechende Namen [idw news673368, 24.04.17]
"Bereits unser Name beeinflusst, wie sehr das Gegenüber uns vertraut
Kölner Psychologen zeigen in einem ökonomischen Spielexperiment,
dass leicht auszusprechende Namen ein „gutes Gefühl“ vermitteln und
Vertrauen in riskanten Situationen ad hoc befördern. Der Spielername
beeinflusste im Experiment die Höhe des Geldbetrags, den die Mitspieler
ihrem unbekannten Gegenüber anzuvertrauen bereit waren.
Um sich vor dem Risiko eines Betrugs zu schützen,
entscheiden wir intuitiv über die Vertrauenswürdigkeit einer
Person. Dass diese Entscheidung nicht allein auf situativen Erfahrungswerten
basiert, sondern bereits der Name der Person unsere Vertrauensbereitschaft
beeinflusst, konnten Dr. Michael Zürn und Juniorprofessor Dr. Sascha
Topolinski vom Social Cognition Center Cologne (SoCCCo) der Universität
zu Köln in einem Spielexperiment nachweisen. Die Studie wurde unter
dem Titel „When trust comes easy: Articulatory fluency increases transfers
in the trust game“ im Journal of Economic Psychology veröffentlicht.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ökonomischen
Spiels konnten ihr Geld vermehren, indem sie es einem zweiten, unbekannten
Spieler anvertrauten. Für diese virtuellen Mitspieler generierten
die Wissenschaftler zuvor Namen, die entweder leicht oder schwierig auszusprechen
waren, wie zum Beispiel Fleming oder Tverdokhleb. Trotz des gegebenen gleich
hohen Betrugsrisikos vertrauten die Spieler ihrem virtuellen Mitspieler
ungefähr zehn Prozent mehr Geld an, wenn dessen Name einfach auszusprechen
war.
„Im Experiment konnten wir sehen, dass leicht auszusprechende
Namen mental sozusagen ‚flüssiger‘ verarbeitet werden. Das dadurch
entstehende reibungslos ‚gute Gefühl‘ fördert das Vertrauen in
unser Gegenüber, ohne dass wir uns dessen unmittelbar bewusst sind“,
erklärt Michael Zürn. ...
Zürn, M., & Topolinski, S. (2017). When
trust comes easy: Articulatory fluency increases transfers in the Trust
Game. Journal of Economic Psychology. DOI: http://doi.org/10.1016/j.joep.2017.02.016
..."
Sprüche, Redensarten und Sentenzen zum Vertrauen
- Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Lenin, Reden.
- Vor dem, welchem ich vertraue, hüte mich Gott. Vor dem, welchem ich nicht vertraue, werde ich mich selbst hüten. Aus Italien.
- Es ist ein Narr, der an die Hand gelobet und Bürge wird für seinen Nächsten. Sprüche Salomos 17, 18
- Vertraue keinem Freunde, du ihn denn erkannt in der Not! Jesus Sirach 6,7
- Wer andern gar zu wenig traut, / hat Angst an allen Ecken; / wer gar zu viel auf andre baut, / erwacht mit Schrecken. / Es trennt sie nur ein leichter Zaun die beiden Sorgengründer: Zuwenig und zuviel Vertraun sind Nachbarskinder. Wilhelm Busch, Die Nachbarskinder
- Vertrauen wird dadurch erschöpft, daß es in Anspruch genommen wird. (Galilei). Nach Brecht, Leben des Galilei 7
- Halte es mit jedermann freundlich, vertraue aber unter Tausenden kaum einem. Jesus Sirach 6, 6
- Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat. Matthias Claudius
Sprüche,
Redensarten und Sentenzen zum Misstrauen
- Wer dich betrügt, ist nahe bei dir. Aus Uganda
- Niemand glaube seinem Nächsten, niemand verlasse sich auf einen Freund; bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinen Armen schläft. Micha 7, 5
- Ist Zutraun blind, sieht Argwohn leicht zuviel. (Priester). Grillparzer, Des Meeres und der Liebe Wellen IV
- Schon wenn man niemanden für schlechter hält als sich selbst - reicht's nicht zum Mißtrauen? Hans Kasper, Expedition nach innen, Ich empfehle Mißtrauen
- Was der Bauer nicht kennt, das ißt er nicht. Sprichwort
- Immer zu mißtrauen, ist ein Irrtum, wie immer zu trauen. (Magus). Goethe, Lila II
- Fürchte den am meisten, der dir verwandt ist. Aus Kenia
- Wer in sich selbst nicht das Gefühl für Würde findet, sondern sie in der Meinung anderer suchen muß, der liest stets in den Augen anderer Menschen, wie jemand, der falsche Haare trägt, in jeden Spiegel sieht, ob sich auch nicht etwas verschoben habe. Moltke, an seine Frau
- Laß Argwohn, willst du nicht in Angst / und Kummer schweben / denn Furcht und Argwohn sind ein / steter Tod im Leben. Opitz, Distichen
- Wachsamkeit ist die Tugend des Lasters. Karl Julius Weber, Demokritos IV, 8
- Das Mißtraun ist die schwarze Sucht der Seele, / und alles, auch das Schuldlosreine, zieht / fürs kranke Aug' die Tracht der Hölle an. (Silvester) Kleist, Die Familie Schroffenstein I, 2
- Pfui, Argwohn, Spürhund von des Teufels Meute! (Ottokar). Grillparzer, König Ottokars Glück und Ende II
- Argwohn wiegt in der reinsten Sphäre sich wie in dem lichten Himmelsblau die Krähe. Shakespeare, Sonette
- O, hättest du vom Menschen besser stets gedacht, du hättest besser auch gehandelt, Fluchwürd'ger Argwohn! (Max). Schiller, Wallensteins Tod II, 7.
ALLBUS-Studie zum Vertrauen in Institutionen.
"Einstellungen zu Politik und Wirtschaft: Politische Partizipation;
Parteipräferenz; Vertrauen in öffentliche Einrichtungen und Organisationen
(Gesundheitswesen, Bundesverfassungsgericht, Bundestag, Kirche, Justiz,
Fernsehen, Zeitungswesen, Universitäten, Bundesregierung, Polizei,
Parteien); Wahrscheinlichkeiten, diverse Parteien zu wählen; politisches
Interesse; Postmaterialismus (Wichtigkeit von Ruhe und Ordnung, Bürgereinfluss,
Inflationsbekämpfung und freier Meinungsäußerung); Selbsteinstufung
auf einem Links-Rechts-Kontinuum; politische Unterstützung (Demokratiezufriedenheit
in Deutschland); Beurteilung der derzeitigen und zukünftigen Wirtschaftslage
in Deutschland; Beurteilung der eigenen derzeitigen und zukünftigen
wirtschaftlichen Situation." [GESIS]
- http://www.gesis.org/das-institut/kompetenzzentren/fdz-allbus/
ALLBUS: http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Bev%C3%B6lkerungsumfrage_der_Sozialwissenschaften
Wolff, Hans-Georg & Bacher, Johannes () zitieren die Korrelationsmatrix S. 364:.
9: Interkorrelationsmatrix von 11 Items zum Vertrauen in Institutionen
[Interne Quelle: EigDat\E-Books\Statistik\Allbus]
Verlust
des Vertrauens in der Finanzkrise
"Der Kern der Krise Vertrauen. Ohne Vertrauen wäre Gesellschaft
nicht möglich, weil sonst die Schrittfolge des Alltags nicht in Gang
käme. Leider ist es vielfach verloren gegangen: Etwa zwischen Banken,
zwischen Wirtschaft und Politik und zwischen Politik und Wähler. ...
" [faz
23.12.12]
Vertrauen in die Messtechnik
"Zusammenfassung. Das Vertrauen in unsere heutige physikalisch-technische
Messtechnik ist sehr groß. Heinz-Dieter Haustein (2001, S. 3) Autor
des Buches „Weltchronik des Messens“, nennt uns moderne Menschen „Homo
mensurans“. Aus psychologischer Sicht verständlich, denn die Quantifizierung
bringt Sicherheit in eine Welt, die aus vielen Umgebungsvariablen besteht.
Wir scheinen vom Messen besessen, so seine Vermutung. Der insgesamt gewaltige
Messfortschritt ist nicht nur in der Technik beheimatet, sondern verändert
auch rapide unseren gesamten beruflichen und privaten Alltag. Insbesondere
die Mikroelektronik und die Lasertechnik haben die physikalische Messpräzision
revolutioniert, die Anwendung in vielen Bereichen enorm ausgeweitet, die
komplexen Messprozesse beschleunigt und mit der Möglichkeit zur Massenproduktion
die Kosten reduziert. Spätestens mit dem Siegeszug des Qualitätsmanagements
mit seinen Hunderten von DIN-Normen, hat das Messen auch den beruflichen
Alltag fest im Griff." [Online]
Vertrauen in
der Verhaltenstherapie
Kanfer 2012, S.197: "Eine Verhaltensanalyse im eigentlichen Sinn wird
aus unserer Sicht erst dann durchführbar, wenn die wichtigsten therapeutischen
Grundvoraussetzungen (z. B. kooperative Therapeut-Klient-Beziehung, Arbeitsorientierung
oder Änderungsmotivation) geschaffen sind. Viele Informationen, die
zur Erstellung eines adäquaten funktionalen Bedingungsmodells notwendig
sind, können erst dann vom Klienten erwartet werden, wenn er hinreichendes
Vertrauen zum Therapeuten entwickelt hat und außerdem motiviert ist,
bestimmte Aspekte seines Lebens zu ändern. Somit sind und bleiben
die Schwerpunkte der vorherigen 7 Phasen 1 und 2 von elementarer Bedeutung
für das weitere Vorgehen."
Vertrauen
in der Wirtschaftspsychologie
Moser Wirtschaftspsychologie 3: Vertrauen 50, 73, 75, 76, 361,
362, 373. Vertrauenswürdigkeit 72, 82
Einfluss
von Vertrauen auf ökonomische Entscheidungen
"Mit einer ungewöhnlichen Methode wiesen Kosfeld, Heinrichs, Zak,
Fischbacher und Fehr (2005) den Einfluss von Vertrauen bei ökonomischen
Entscheidungen nach: Sie zeigten, dass das Hormon Oxytocin Vertrauen in
unsere Mitmenschen weckt. Hierzu führten sie in der Schweiz ein ökonomisches
Vertrauensexperiment durch: Teilnehmern wurde entweder die Rolle eines
Investors oder eines Treuhänders zugewiesen. Die Investoren verfügten
zu Beginn des Versuchs jeweils über 12 Franken. Sie hatten die Möglichkeit,
dem Treuhänder 0, 4, 8 oder 12 Franken zu übergeben, woraufhin
der Betrag verdreifacht wurde. Im Idealfall besaß der Treuhänder
somit am Ende 48 Franken. Den Gewinn konnte dieser entweder mit dem Investor
teilen oder unfairerweise für sich selbst behalten. Sich dessen bewusst,
musste der Investor zu Beginn des Experiments auf das Wohlwollen des anderen
vertrauen. In der Experimentalgruppe inhalierten die Teilnehmer zuvor über
ein im Handel erhältliches Nasenspray das Bindungshormon Oxytocin.
Während in dieser Gruppe 45% der Probanden ihrem Gegenüber stark
vertrauten und entsprechend den größten Geldbetrag überwiesen,
taten dies in der Kontrollgruppe ohne Oxytocin nur 21%."
Überreden und
Glaubwürdigkeit
5 Persuasion durch Glaubwürdigkeit von Florian Becker,
Lutz von Rosenstiel, Matthias Spörrle in Moser Wirtschaftspsychologie
3
S.72: "Glaubwürdigkeit bedeutet, dass dem Sender
die Fähigkeit und Motivation zugeschrieben wird, wahrheitsgetreu zu
kommunizieren (vgl. Fill, 2002, S. 36). Dementsprechend wird Glaubwürdigkeit
in der Literatur überwiegend als das Produkt aus wahrgenommener Kompetenz
(»expertise«, expertness«) und Vertrauenswürdigkeit
(»reliability«, »trustworthiness«) des Senders
angesehen (vgl. Berlo, Lemert & Mertz, 1969; Mowen, Wiener & Joag,
1987). Angemerkt sei an dieser Stelle, dass das Konzept der Glaubwürdigkeit
insbesondere in faktoranalytischen Studien mitunter mit weiteren Dimensionen
versehen wurde (z. B. Dynamik), die sich jedoch nicht einheitlich durchgesetzt
haben (vgl. Pornpitakpan, 2004). Glaubwürdigkeit ist somit eine von
mehreren Eigenschaften einer Kommunikationsquelle, die Persuasion beeinflussen
können, und setzt sich aus den Dimensionen Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit
zusammen."
S. 73: "Zu bedenken ist hierbei, dass mit einem
manipulativen Verhalten die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen meist
langfristig erodiert werden. In wirtschaftlichen, politischen oder anderen
zwischenmenschlichen Kontexten hat dies dann verheerende Konsequenzen für
die langfristige Beziehung. Oder, wie der Volksmund sagt: »Wer einmal
lügt, dem glaubt man nicht.« So fiel es beispielsweise der Regierung
Bush wesentlich schwerer, die UN gegen den Iran und sein Atomprogramm zu
mobilisieren, als dies noch bei Saddam Hussein und dem Angriff auf den
Irak der Fall war. Außenminister Powells im Nachhinein immer unglaubwürdiger
erscheinender Auftritt bei den UN hat offensichtlich nicht nur ihn viel
politisches Kapital und Glaubwürdigkeit gekostet.
Es lässt sich also festhalten: Wenn es um langfristige
Beziehungen geht, sind Glaubwürdigkeit und offene Manipulation meist
antagonistisch. Wird die Manipulation erkannt, ist die Vertrauenswürdigkeit
und damit die Glaubwürdigkeit nicht mehr gegeben."
9 Marketinginstrumente – psychologisch betrachtet von Georg Felser in
Moser Wirtschaftspsychologie 3
S. 165: "Dennoch dürfte ein Unterschied bestehen zwischen dem
»gerissenen« und auf seinen kurzfristigen Vorteil bedachten
Anwender psychologischer Verkaufstricks und dem Verkäufer, der es
versteht, Vertrauen und eine langfristige Beziehung aufzubauen. Swan, Bowers
und Richardson (1999) stellten in einer Metaanalyse zusammen, von welchen
Merkmalen es abhängt, ob Kunden einem Verkäufer vertrauen. Danach
haben z. B. Sachverstand und Kompetenz eines Verkäufers einen starken
Einfluss auf seine Vertrauenswürdigkeit. Interessanterweise sind aber
diese zentralen Verkäufermerkmale nicht die stärksten Determinanten
der Vertrauenswürdigkeit: Wichtiger noch als der Sachverstand erscheint
in den Befunden von Swan et al. (1999) ein Merkmalskomplex, den sie mit
den Begriffen Gutmütigkeit, Fairness und Wohlwollen des Verkäufers
umschreiben. Konsumenten unterstellen diese Merkmale, wenn sie den Eindruck
haben, der Verkäufer verfolge nicht ausschließlich eigene Interessen.
Wird dagegen im Verkaufsgespräch deutlich, dass der Händler z.
B. auf eine Provision hofft, löst dies Reaktanz aus und die Wahrscheinlichkeit
eines erfolgreichen Verkaufs sinkt (z. B. Wicklund, Slattum & Solomon,
1970). Im Grunde ist jede deutlich sichtbare Beeinflussungsabsicht des
Verkäufers dem Vertrauen und dem Beeinflussungserfolg abträglich."
S. 166f: "Sympathie hat bekanntermaßen starke Einflüsse auf die Bereitschaft zur Kooperation (z. B. Cialdini, 2001) und offenbar auch auf das Vertrauen dem Verkäufer ge-[>167]genüber (Swan et al., 1999). Von den wichtigsten Determinanten der Sympathie sind Ähnlichkeit und physische Attraktivität am besten untersucht. Reingen und Kernan (1993) belegen in einer Serie von Experimenten, dass Kunden physisch attraktive Verkäufer nicht nur als geschickter und vertrauenswürdiger wahrnehmen, sondern auch eher auf ihre Vorschläge eingehen und sich bereitwilliger von ihnen beeinflussen lassen."
Vertrauen Grundlage
des Geldwertes
11 Finanzpsychologie von Stefan Schulz-Hardt, Frank Vogelgesang,
Andreas Mojzisch in Moser Wirtschaftspsychologie 3
S. 195: "Die Vielfalt seiner ökonomischen Funktionen und symbolischen
Bedeutungen lassen Geld zu einem generalisierten Sekundärverstärker
werden, mit dem sehr verschiedene Bedürfnisse und Motive befriedigt
werden können. Als Tauschmittel funktioniert Geld nicht aufgrund seines
Gebrauchs- oder Materialwerts, sondern aufgrund der allgemeinen Anerkennung
des Wertversprechens, für das es steht (Schmölders, 1966). Mit
Anerkennung des Wertversprechens ist das Vertrauen darauf gemeint, »daß
das Geld, das man jetzt einnimmt, auch zu dem gleichen Werte wieder auszugeben
ist« (Simmel, 1922, S. 164–165, zitiert nach Schmölders, 1966,
S. 144). Das Wertversprechen kann beispielsweise durch die Inflation untergraben
werden. Bleibt das Vertrauen in das Geld davon aber weitgehend unberührt,
so verweist uns dies auf ein interessantes und zentrales Phänomen
der Geldpsychologie, nämlich die häufig zu konstatierende Divergenz
zwischen Geldwert und dessen Wahrnehmung."
Self
Fulfilling prophecy und Inflationsparadox durch Vertrauensverlust der Geldwertes
S. 195: "Das Vertrauen der Bürger in ihr Geld bzw. das Misstrauen
bezüglich seiner Entwertung hat harte ökonomische Konsequenzen:
Wer in die Kaufkraft vertraut, wird eher disponieren. Wer hingegen mit
Preissteigerungen rechnet, wird sein Geld möglichst rasch in Produkte
umsetzen. Eine daraus resultierende Nachfragesteigerung aber treibt die
Preise tatsächlich in die Höhe, und zwar nicht wegen eines aus
Inflation resultierenden realen, sondern allein aufgrund eines antizipierten
Wertverlusts."
Diepgen:
Vertrauen in die Umsetzung der Deutschen Einheit
Respekt Mangelware? – Anmerkungen zur Psychologie auf dem Weg zur deutschen
Einheit EBERHARD DIEPGEN, Kanzlei Thümmel, Schütze und Partner
- Die Kehrseite des wachsenden Stolzes und des Vertrauens in das Grundgesetz war der Rückzug auf die Bundesrepublik und ein wachsendes „BRD-Bewusstsein“. (Diepgen S. 19)
- Mein Vertrauen in die Demoskopie ist nicht grenzenlos. (Diepgen S. 22)
- 20 Jahre nach dem Mauerfall kann man aber immer mehr auf eine nachwachsende Lehrerschaft und auch den Oppositionsgeist der jungen Generation vertrauen. (Diepgen S. 24)
- Das Vertrauen in die Demokratie entwickelte sich nach ersten euphorischen Anfängen in der breiten Bevölkerung immer auch in Zusammenhang mit der konkreten sozialen Lage. (Diepgen S. 25)
- In das Auf und Ab der Wirtschaftskurve passt sich die Kurve des Demokratievertrauens der Ostdeutschen ein. (Diepgen S. 26)
Literatur (Auswahl) > für Literaturhinweise immer offen (Mail).
Literaturhinweis: In Sponsel, R. (1995) werden S. 193 - 200 die meisten potentiellen psychologischen Heilmittel (neudeutsch: Heilwirkfaktoren) gelistet und ca. 180 - das sind längst nicht alle - in der Literatur beschriebenen Heilmittel S. 387 - 404 dokumentiert. Überblick Sponsel 1995.
- Austrin, U.R. & Boever, P.M. (1977) Interpersonal trust and severity of delinquent behavior. Psychological Reports, 40, 1075-1078.
- Beard, M.T. (1982) Life events, method of coping, and interpersonal trust: implications for nursing actions. Issues in Mental Health Nursing, 4, 25-49.
- Bierhoff, H. W. (1983) Vertrauen und soziale Interaktion. In: G. Lüer (Hrsg.): Bericht über den 33. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Mainz 1982. Band 2. Göttingen: Hogrefe.
- Bierhoff, H.W. & Buck, E. (1984) Vertrauen und soziale Interaktion: Alltägliche Bedeutung des Vertrauens. Marburg: Berichte aus dem Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität Marburg, Nr. 83.
- Boss, R. W. (1978) Trust and managerial problem solving revisited. Group and Organization Studies, 3, 331-342.
- Boszormenyi-Nagy, I. & Krasner, B.R. (1980) Trust-based therapy: A contextual approach. The American Journal of Psychiatry, 137, 767-775.
- Brickman, P., Becker, L.J. & Castle, S. (1979) Making trust easier and harder through two forms of sequential interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 15-521.
- Bridges, J.S. & Schoeninger, D.W. (1977) Interpersonal trust behavior as related to subjective certainty and outcome value. Psychological Reports, 41, 677-678.
- Brückerhoff, A. (1982) Vertrauen - Versuch einer phänomenologisch-idiographischen Näherung an ein Konstrukt, Münster: Unveröffentlichte Dissertation.
- Bude, Heinz (2010). Vertrauen. Die Bedeutung von Vertrauensformen für das soziale Kapital unserer Gesellschaft. Bad Homburg v.d. Höhe: Herbert-Quandt-Stiftung.
- Cash, Th.F., Stack, J J. & Luna, G.C. (1975) Convergent and discriminant behavioral aspects of interpersonal trust. Psychological Reports, 37, 983-986.
- Caterinicchio, R.P. (1979) Testing plausible path models of interpersonal trust in patient-physican treatment relationships. Social Science and Medicine, 13 A, 81-99.
- Chun, K. & Campbell, I.B. (1974) Dimensionality of the Rotter Interpersonal Trust Scale. Psychological Reports, 35, 1059-1070.
- Conviser, R.H. (1973) Toward a theory of interpersonal trust. Pacific Sociological Review, 16, 377-399.
- Cook, J. & Wall, T. (1980) New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal need-nonfulfilment. Journal of Occupational Psychology, 53, 39—52.
- Corazzini, I.G. (1977) Trust as a complex multi-dimensional construct. Psychological Reports, 40, 75-80.
- Deutsch, M. (1958) Trust and suspicion. Journal of Conflict Resolution, 2, 265-279.
- Deutsch, M. (1960) Trust, trustworthiness, and the F-Scale. Journal of Abnormal and Social Psychology, 61, 138-140.
- Deutsch, M. (1962) Cooperation and trust: Some theoretical notes. In: M.R. Jones (Ed.): Nebraska Symposiums on Motivation. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Deutsch, M. (1976) Konfliktregelung. Konstruktive und destruktive Prozesse. München: Reinhardt.
- Distefano, M.K., Pryer, M.W. & Garrison, J.L. (1981) Clients' satisfaction and interpersonal trust among hospitalized psychiatric patients. Psychological Reports, 49, 420-422.
- Doherty, W.J. & Ryder, R.G. (1979) Locus of control, interpersonal trust, and assertive behavior among newlyweds. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 2212-2220.
- Driscoll, I. (1978) Trust and participation in organizational decision-making as predictors of satisfaction. Academy of Management Journal, 21, 44-56.
- Ellison, C. W. & Firestone, I.J. (1974) Development of interpersonal trust as a function of self-esteem, target status, and target style. Journal of Personality and Social Psychology, 29, 655 - 663.
- Essen, Karsten (2011, Hrsg.). Vertrauen und das soziale Kapital unserer Gesellschaft. Freiburg iB: Herder. [IV]
- Esser, M. (1983) Kontaktaufnahme und Kontaktgestaltung als Situationen des Vertrauensaufbaus bei Kindern. Bonn: Unveröffentlichte Diplomarbeit.
- Esser, M. & Petermann, F. (1985) Vertrauensfördernde Variablen in Kind-Erwachsenen-Interaktionen. Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie, 33, 20-29.
- Falzett, W.C. (1981) Matched vs. unmatched primary representational systems and their relationship to perceived trustworthiness in a counseling analogue. Journal of Counseling Psychology, 28, 305-308.
- Frey, Christel (2012). Erfolgsfaktor Vertrauen. Wege zu einer Vertrauenskultur im Unternehmen. Wiesbaden: Gabler.
- Friedrich Ebert Stiftung Forum Berlin (2011, Hrsg.). Denkwerkstatt „Politik und Vertrauen“. Report 01 Die Rolle von Vertrauen in Politik, Wirtschaft und sozialen Netzwerken. [PDF] Report 2 Transparenz und Vertrauen, Authentizität und Führung Dezember 2011. Dokumentation des 2. und 3. Werkstattgespräches [PDF] Report 3 Vertrauen durch mehr Beteiligung Vertrauen in Europa Juni 2012. Dokumentation des 4. und 5. Werkstattgespräches [PDF]
- Frings, Cornelia (2010). Soziales Vertrauen. Eine Integration der soziologischen und der ökonomischen Vertrauenstheorie. Wiesbaden: VS [VT-UB]
- Garske, I.P. (1976) Personality and generalized expectancies for interpersonal trust. Psychological Reports, 39, 649-650.
- Gibb, J.R. (1972) Das Vertrauensklima. In: L.P. Bradford, J.R. Gibb & K.D. Benne (1972, Hrsg.): Grupentraining. Stuttgart: Klett.
- Giffin, K. (1967) The contribution of studies of source credibility to a theory of interpersonal trust in the communication process. Psychological Bulletin, 68, 104-120.
- Goldstein, A. P. (1977) Möglichkeiten zur Verbesserung von Beziehungen. In: F. H. Kanfer & A.P. Goldstein (1977, Hrsg.): Möglichkeiten der Verhaltensänderung. München: Urban & Schwarzenberg.
- Grünthal, M. (1984) Entwicklung eines Beobachtungsverfahrens zur Erfassung von Vertrauen. Bonn: Projektbericht. ?
- Grünthal, M. (1984) Entwicklung eines Beobachtungsverfahrens zur Erfassung von Vertrauen. Bonn: Projektbericht. ?
- Gurtman, M.B. & Lion, C. (1982) Interpersonal trust and perceptual vigilance for trustworthiness descriptors. Journal of Research in Personality, 16, 108-117.
- Hake, D.F. & Schmid, T.L. (1981) Acquisition and maintenance of trusting behavior. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 35, 109-124.
- Hamsher, I.H., Geller, J.D. & Rotter, J.B. (1968) Interpersonal trust, internal-external control and the Warren Commission Report. Journal of Personlity and Social Psychology, 9, 210-215.
- Hartmann, Martin (2001). Vertrauen: die Grundlage des sozialen Zusammenhalts. Frankfurt aM: Campus.
- Haynes, R.B., Taylor, D.W. & Sackett, D.L. (1982) Compliance Handbuch. München: Oldenbourg.
- Heckhausen, H. (1980) Motivation und Handeln. Berlin: Springer.
- Heilman, M.E. (1974) Threats and promises: Reputational consequences and transfer of credibility. Journal of Experimental Social Psychology, 10, 310-324.
- Henrich, G., De Jong, R., Mai, N. & Revenstorf, D. (1979) Aspekte des therapeutischen Klimas - Entwicklung eines Fragebogens. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 8, 41-55.
- Hill, D.B. (1981) Attitude generalization and the measurement of trust in American leadership. Political Behavior, 3, 257-270.
- Hilgenberg, Kurt (2012). "Was Vertrauen schafft". OrganisationsEntwicklung. 31(1), 16-17.
- Hochreich, D.J. (1973) A children's scale to measure interpersonal trust. Developmental Psychology, 9, 141.
- Hochreich, D.J. & Rotter, J.B. (1970) Have college students become less trusting? Journal of Personality and Social Psychology, 15, 211-214.
- Höhn, E. (1968) Vertrauen und Mißtrauen in der Schule. In: J. Schwartländer, R. Landmann & W. Loch (Hrsg.): Verstehen und Vertrauen. Stuttgart: Klett.
- Holzheu, Harry (2010). Vertrauen gewinnen. Empathie und Offenheit in der Führungs- und Verkaufskommunikation. Berlin, Springer. [VT-UB]
- House, J.S. & Wolf, S. (1978) Effects of urban residence on interpersonal trust and helping behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 36, 1029-1043.
- Hurst-Wagner, Melanie Sarah (2011). Urteilstendenzen beim Erkennen von Wahrheit und Täuschung: Einflussfaktoren und Folgen. Kumulative Dissertation. Universität Bern, Philosophisch-Humanwissenschaftliche Fakultät..
- Imber, S. (1973) Relationship of trust. to academic performance. Journal of Personality and Social Psychology, 28, 145-150.
- Jackson, D.D. (1980) Familienregeln: Das eheliche Quid pro Quo. In: P: Watzlawick & J.M. Weakland (1980, Hrsg.): Interaktion. Bern: Huber.
- Johnson, D.W. & Johnson, P.P. (1975) Joining together: Group theory and group skills. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Johnson, D.W. & Matross, R.P. (1977) Interpersonal influence in psychotherapy: A social psychological view. In: A.S. Gurman & A.M. Razin (1977, Eds.): Effective psychotherapy. New York: Pergamon.
- Johnson, D.W. & Noonan, M.P. (1972) Effects of acceptance and reciprociation of self-disclosure on the development of trust. Journal of Counseling Psychology, 19,411—416.
- Johnson-George, C. & Swap, W.C. (1982) Measurement of specific interpersonal trust: Construction and validation of a scale to assess trust in a specific other. Journal of Personality and Social Psychology, 43, 1306-1317.
- Jones, E.E. & Davis, K.E. (1965). From acts to dispositions: The attributionäl process in person perception. In: L. Berkowitz 1965, (Ed.): Advances in experimental social psychology. Vol. 2. New York: Academic Press.
- Katz, H.A. & Rotter, J.B. (1969). Interpersonal trust scores of students and their parents. Child Development, 40, 657-661.
- Kee, H.W. & Knox, R.E. (1970) Conceptual and methodological considerations in the study of trust and suspicion. Journal of Conflict Resolution, 14, 357-365.
- Kelly, G.A. (1970a) A brief introduction to personal construct psychology. In: D. Bannister (1970, Ed.): Perspectives in personal construct theory. London: Academic Press.
- Kelly, G.A. (1970b). Behavior is an experiment. In: D. Bannister (1970, Ed.): Perspectives in personal construct theory. London: Academic Press.
- Kelley, H.H. & Stahelsky, A. (1970) Social interaction as a basis of cooperators' beliefs about each other. Journal of Personality and Social Psychology, 16, 66-91.
- Krampen, G., Viebig, J. & Walter, W. (1982) Entwicklung einer Skala zur Erfassung dreier Aspekte von sozialem Vertrauen. Diagnostica, 28, 242—247.
- Krause, Diana E. (2010). Macht und Vertrauen in Innovationsprozessen. Ein empirischer Beitrag zu einer Theorie der Führung. Wiesbaden: Gabler [VT-UB]
- Krumboltz, J.D. & Potter, B. (1980) Verhaltenstherapeutische Techniken für die Entwicklung von Vertrauen, Kohäsion und Zielorientierung in Gruppen. In: K. Grawe (1980, Hrsg.). Verhaltenstherapie in Gruppen. München: Urban & Schwarzenberg.
- Lacy, W.B. (1978). Assumptions of human nature, and initial expectations and behavior as mediators of sex effects in prisoner's dilemma research. Journal of Conflict Resolution, 22, 269-281.
- Lamm, H. (1975). Analyse des Verhaltens. Stuttgart: Enke.
- Levinger, G. & Snoek, I.D. (1977). Attraktion in Beziehungen. Eine neue Perspektive in der Erforschung zwischenmenschlicher Anziehung. In: G. Mikula & W. Stroebe (1977, Hrsg.): Sympathie, Freundschaft und Ehe. Bern : Huber.
- Lindskold, S. (1978). Trust development, the GRIT proposal, and the effects of conciliatory acts on conflict and cooperation. Psychological Bulletin, 85, 772-793.
- Lindskold, S. & Collins, M.G. (1978) Inducing cooperation by group and individuals. Applying Osgood's GRIT strategy. Journal of Conflict Resolution, 22; 679-690.
- Linggi, Dominik (2011). Vertrauen in China. Ein kritischer Beitrag zur kulturvergleichenden Sozialforschung. Wiesbaden: VS/ Springer.
- Loomis, J.L. (1959) Communication, the development of trust, and cooperative behavior. Human Relations, 12, 305-315.
- Luhmann, N. (1989) Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Stuttgart: Enke
- Manz, W. (1980) Gefangen im Gefangenendilemma? Zur Sozialpsychologie der experimentellen Spiele. In: W. Bungard (1980, Hrsg.): Die gute Versuchsperson denkt nicht. Artefakte in der Sozialpsychologie. München: Urban & Schwarzenberg.
- Maiwald, G. & Fiedler, P.A. (1980) Die therapeutische Funktion kooperativer Sprachformen. Ansätze zu einer sprachtheoretischen Analyse therapeutischer Kommunikation. In: P.A. Fiedler (1980, Hrsg.): Psychotherapieziel Selbstbehandlung. Grundlagen kooperativer Psychotherapie. Weinheim: Edition Psychologie.
- Mc Allister, H.A. (1980) Self-disclosure and liking Effects of senders and receivers. Journal of Personality, 48, 409-418.
- Mc Conkie, M. & Golembiewski, R.T. (1975) The centrality of trust in group processes. In: C.L. Cooper (1975, Ed.) Theories of group processes. New York: Wiley.
- MC Donald, P.A., Kessel, V. & Fuller, J.B. (1972) Self-disclosure and two kinds of trust. Psychological Reports, 30, 143-146.
- Mellinger, G. (1956) Interpersonal trust as a factor in communication. Journal of Abnormal and Social Psychology, 52, 304-309.
- Minsel, W.-R. (1977) Zur Frage einer Theorienbildung über dyadisches psychotherapeutisches Handeln. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 25, 231-245.
- Mogy, R.B. & Pruitt, D.G. (1974) Effects of a threatener's enforcement costs on threat credibility and compliance. Journal of Personality and Social Psychology, 29, 173-180.
- Möller, Heidi (2012). Vertrauen in Organisationen. Riskante Vorleistung oder hoffnungsvolle Erwartung? Wiesbaden: Springer VS. [VT-UB]
- Müller, G.F. (1980) Interpersonales Konfliktverhalten. Vergleich und experimentelle Untersuchung zweier Erklärungsmodelle. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 11, 168-180.
- Narowki, C. (1974). Vertrauen. Begriffsanalyse und Operationalisierungsversuche. Tübingen: Dissertation.
- Paul, M.F. (1982) Power, leadership, and trust: Implications for counselors in terms of organizational change. The Personal and Guidance Journal, 60, 538-541.
- Pearce, W.B. (1974) Trust in interpersonal communication. Speech Monographs, 41, 236-244.
- Pereira, M.J. & Austrin, H.R. (1980) Interpersonal trust as a predictor of suggestibility. Psychological Reports, 47, 1031-1034.
- Perrez, M., Patry, J.-L. & Ischi, N. (1980) Verhaltenstheoretische Analyse der Erzieher-Kind-Interaktion im Feld unter Berücksichtigung mehrerer Interaktionspartner des Kindes. In: H. Lukesch, M. Perrez & K.A. Schneewind (1980, Hrsg.): Familiäre Sozialisation und Intervention. Bern: Huber.
- Petermann, F. & Rhode, E. (1983) Vertrauen und Vertrauensaufbau in der Kinderpsychotherapie. Zeitschrift für personenzentrierte Psychologie und Psychotherapie, 2, 235-246.
- Petermann, Franz (1985). Psychologie des Vertrauens. Salzburg: Müller.
- Peterreins, Hannes, Märtin, Doris, Beetz, Maud (2010). Fairness und Vertrauen in der Finanzberatung. Spielregeln für ein partnerschaftliches Miteinander von Kunden und Beratern. Wiesbaden: Gabler. [VT-UB]
- Petzold, Hilarion G. (2011). Ueber Vertrauen und Misstrauen. In (63-67): Petzold, Hilarion; Orth, Ilse & Sieper, Johanna (2011, Hrsg.). Gewissensarbeit, Weisheitstherapie, Geistiges Leben. Werte und Themen moderner Psychotherapie. Wien: Krammer
- Pruitt, D.G. (1981) Negotiation behavior. New York: Academic Press.
- Pruitt, D.G. & Kimmel, M.J. (1977) Twenty years of experimental gaming: Critique, synthesis, and suggestions for the future. Annual Review of Psychology, 28, 363—392.
- Pruitt, D.G. & Smith, D.L. (1981) Impression management in bargaining: Images of firmness and trustworthiness. In: J.T. Tedeschi (1981, Ed.): Impression management theory and social psychological research. New York: Academic Press.
- Pulheim, P., Karman, P. & Seidenstücker, G. (1978) Determinanten des Belohnungsaufschubs bei Vorschulkindern. Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie, 25, 136-152.
- Raunicher, Peter (2011). Die Ambivalenz des Vertrauens. Welche Bedeutung hat Vertrauen in organisationalen Veränderungsprozessen? Wiesbaden: Gabler. [VT-UB]
- Rotenberg, K.J. (1980) A promise kept, a promise broken: Developmental bases of trust. Child Development, 51, 614-617.
- Rothmeier, R.C. & Dixon, D.N. (1980) Trustworthiness and influence: A reexamination in an extended counseling analoque. Journal of Counseling Psychology, 27, 315-319.
- Rotter, J.B. (1967) A new scale for the measurement of interpersonal trust. Journal of Personality, 35, 651-665.
- Rotter, J.B. (1971) Generalized expectancies for interpersonal trust. American Psychologist, 26, 443-452.
- Rotter, J.B. (1980) Interpersonal trust, trustworthiness, and gullibility. American Psychologist, 35, 1-7.
- Rotton, J., Blake, B.F. & Heslin, R. (1977) Dogmatism, trust, and message acceptance. The Journal of Psychology, 96, 81-88.
- Sackett, G.P. (1979) The lag sequential analysis of contingency and cyclicity in behavioral interaction research. In: D.J. Osofsky (1979, Ed.): Handbook of infant development. New York: Wiley.
- Schäfer, A. (1980) Vertrauen. Eine Bestimmung am Beispiel des Lehrer-Schüler-Verhältnisses. Pädagogische Rundschau, 34, 723-743.
- Schilcher, Christian (2012). Vertrauen und Kooperation in der Arbeitswelt. Wiesbaden: Springer VS [VT-UB]
- Schill, T., Toves, C. & Ramanaiah, N. (1980) Interpersonal trust and coping with stress. Psychological Reports, 47, 1192.
- Schipper, Marc; Petermann, Franz (2012) Vertrauen. In (S. 85-101): Steinebach, Christoph; Jungo, Daniel & Zihlmann, Rene (2012, Hrsg.). Positive Psychologie in der Praxis. Anwendung in Psychotherapie, Beratung und Coaching. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union
- Schottlaender, R. (1957). Theorie des Vertrauens. Berlin: De Gruyter.
- Schwartländer, J. R. Landmann, R. & Loch, W. (1968, Hrsg.): Verstehen und Vertrauen. Stuttgart: Klett.
- Scott, C.L. (1980) Interpersonal trust: A comparison of attitudinal and situational factors. Human Relations, 33, 805-812.
- Scott, D. (1980) The causal relationship between trust and the assessed value of management by objectives. Journal of Management, 6, 57-175.
- Schweer, Martin K. W.; Thies, Barbara (2008). Vertrauen In (136-149): Auhagen, Ann Elisabeth (2008, Hrsg.). Positive Psychologie. Anleitung zum "besseren" Leben. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.
- Seiderer-Hartig, M. (1980) Beziehung und Interaktion in der Verhaltenstherapie: Theorie, Praxis, Fallbeispiele. München: Pfeiffer.
- Selman, R.L., Jaquette, D. & Lavin, D.R. (1977) Interpersonal awareness in children: Toward an integration of developmental and clinical child psychology. American Journal of Orthopsychiatry, 47,264-274.
- Seligman, M.E.P (1983) Erlernte Hilflosigkeit. Mit einem Nachwort von F. Petermann. München: Urban & Schwarzenberg.
- Sofsky, W. (1983) Die Ordnung sozialer Situationen. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Solomon, L. (1960) The influence of some types of power relationships and game strategies upon the development of interpersonal trust. Journal of Abnormal and Social Psychology, 61, 223—230.
- Stack, L.C. (1978) Trust. In: H. London & J. Exner (Eds.): Dimensions of Personality. New York: Wiley.
- Steymann, Gloria (2012). Vertrauen bei Mergers & Acquisitions. Analyse der Determinanten und Wirkungen am Beispiel der Privatisierung von Krankenhäusern. Wiesbaden: Springer Gabler. [VT-UB]
- Stiglbauer, Katrin (2011). Vertrauen als Input-/Output-Variable in elektronischen Verhandlungen. Eine empirische Untersuchung vertrauensfördernder Maßnahmen. Wiesbaden: Gabler. [VT-UB]
- Tedeschi, I.T. (1974) Attributions, liking, and power. In: T. Huston (1974, Ed.): Foundations of interpersonal attraction. New York: Academic Press.
- Terrel, F. & Barrett, R.K. (1979) Interpersonal trust among college students as a function of: race, sex, and socioeconomic class. Perceptual and Motor Skills, 48, 1194.
- Thomas, Alexander (2008). Vertrauen als soziales Kapital aus psychologischer Sicht . In (S. 19-32): Roth, Klaus (2008, Hrsg.). Sozialkapital - Vertrauen- Rechtssicherheit. Postsozialistische Gesellschaften und die Europaeische Union. Muenster. Freiburger Sozialanthropologische Studien, Band 19.
- Thorslund, C. (1976) Interpersonal trust. A review and examination of the concept. Göteborg Psychological Reports, 6, 1-21. Towbin, A. P. (1978) The confiding relationship: A new paradigma. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 15, 333-343.
- Walton, F.X. & Powers, R.L. (1984). Vertrauen und Verantwortung zwischen Kindern und Erwachsenen. München: Reinhardt.
- Wheeles, L.R. (1978) A follow-up study of the relationships among trust, disclosure, and interpersonal solidarity. Human Communciation Research, 4, 143—157.
- Winkler, Brigitte (2012). Traust du mir - trau ich dir. Wie entsteht Vertrauenswuerdigkeit?. OrganisationsEntwicklung 31(1), 4-31.
- Wright, T.L., Arbuthnot, J. & Silber, R. (1977) Interpersonal trust and attributions of source credibility: evaluations of a political figure in a crisis. Perceptual and Motor Skills, 44, 943-950.
- Wright, T.L. & Kirmani, A. (1977) Interpersonal trust, trustworthiness and shoplifting in High School. Psychological Reports, 41, 1165-1 166.
- Wright, Th.L. & Tedeschi, R.G. (1975) Factor analysis of the Interpersonal Trust Scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43, 430-477.
- Wrightsman, L.S. (1964) Measurement of philosophies of human nature. Psychological Reports, 1964, 14, 743-751.
- Wrightsman, L.S. (1966) Personality and attitudinal correlates of trusting and trustworthy behaviors in a two-person game. Journal of Personality and Social Psycholog), 4, 328—332.
- Wrightsman, L.S. (1974) Assumptions about human nature A social-psychological approach. Monterey, Cal.: Brooks/Cole.
- Zand, D.E. (1977) Vertrauen und Problemlösungsverhalten von Managern. In: H.E. Lück (1977, Hrsg.) Mitleid - Vertrauen - Verantwortung. Stuttgart: Klett..
- Zimmer, D. (1983). Sozialpsychologische Modelle zur Analyse und Gestaltung der therapeutischen Beziehung. In: D. Zimmer (1983, Hrsg.) Die therapeutische Beziehung. Weinheim: Edition Psychologie.
Dechene, Alice; Stahl, Christoph; Hansen, Jochim; Waenke, Michaela (2010). The truth about the truth: A meta-analytic review of the truth effect. Die Wahrheit über die Wahrheit: Ein metaanalytisches Review zum Wahrheitseffekt. Personality and Social Psychology Review. 14(2) 2010, 238-257.
Links (Auswahl: beachte)
Glossar,
Anmerkungen und Endnoten:
GIPT= General and Integrative
Psychotherapy,
internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
___
Baal
ist überall. Ein tolles Stück von Brecht, hervorragend dargestellt
und verfilmt von Faßbinder - leider nicht mit Akzeptanz der Brecht-Erben.
___
Terminologie. Mit
dem griechischen Buchstaben Theta J
(nach Jerapeia
(therapeia): Heilung) kennzeichnen wir Psychische Funktionen, wenn sie
Heilmittel oder Heilwirkfaktoren Qualität (Funktion) annehmen,
z. B. J
einsehen, J
zulassen unterdrückter Erinnerungen, J
stellen (konfrontieren), J
sich überwinden und
J
mutig sein,
J
differenzieren, J
entspannen, J
lernen, J
loslassen, J
beherrschen ...
Man vergegenwärtige
sich auch, daß viele Sachverhalte eine Doppelfunktion haben können:
Heilmittel
und
Störmittel ("Gift").
Möchte man von der Heilmittelfunktion absehen, kann man einfach die
Vorsilbe "Heil" weglassen und spricht dann ganz allgemein nurmehr vom "Mittel"
(zum Zweck). Ein Mittel zum Heilzweck wird sozusagen zum Heilmittel, wenn
das Mittel zur Begleitung, Linderung, Besserung oder Heilung von Störungen
mit Krankheitswert eingesetzt werden soll. Für Mittel zum Zweck fehlt
ein eigentliches griechisches Wort, so daß sich Begriff und Wort
des Werkzeuges organon
(organon) anbietet mit dem Nachteil, daß sich o
wenig vom lateinischen o unterscheidet, so daß wir aus typologischen
Gründen lieber in lautgestaltlicher Analogie den Buchstaben m
(Mü) wählen. Die Kennzeichnung m
loben
bedeutet also z.B., daß wir loben als Mittel kennzeichnen,
um einen Zweck zu erreichen zur Abgrenzung von loben als z.B. spontaner
Ausdruck von (freudiger) Anerkennung.
Und um deutlich zu machen, daß wir ein Wort
nicht alltagssprachlich, sondern im Rahmen einer psychologisch-psychotherapeutischen
Fachsprache verwenden, kennzeichnen wir das Wort mit dem griechischen Buchstaben
y
(Psi, mit dem das griechische Wort für Seele = yuch,
sprich: psyche, beginnt). Störungs Funktor. Begriffe, die eine
Störung repräsentieren sollen, kennzeichnen wir mit dem Anfangsbuchstaben
Tau (t) des griechischen Wortes für Störung
tarach
(tarach). Viel
Verwirrung gibt es in und um die Psychologie, weil viele ihrer Begriffe
zugleich Begriffe des Alltags und anderer Wissenschaften und damit meist
vielfache Homonyme
sind. Um diese babylonische Sprachverwirrung, die unökonomisch, unkommunikativ
und entwicklungsfeindlich ist, zu überwinden, ist u. a. das Programm
der Erlanger Konstruktivistischen Philosophie und Wissenschaftstheorie
entwickelt worden: Kamlah & Lorenzen (1967).
Zu einigen psychologischen Grundfunktionen siehe bitte: vorstellen.
Ausführlich
zur Terminologie.
- Querverweise
(Links) zum Terminologie-Problem in der Psychologie, Psychopathologie,
Psychodiagnostik und Psychotherapie:
- Über den Aufbau einer präzisen Wissenschaftssprache in Psychologie, Psychopathologie, Psychodiagnostik und Psychotherapie aus Allgemeiner und Integrativer Sicht.
- Grundzüge einer Idiographischen Wissenschaftstheorie.
- Introspektion, Bewußtseins- und Bewußtheitsmodell in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie.
- Beispiel Nur_empfinden_fühlen_spüren.
- Über den Aufbau einer präzisen Wissenschaftssprache in Psychologie, Psychopathologie, Psychodiagnostik und Psychotherapie.
- Überblick der Signaturen: Dokumentations- und Evaluationssystem Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
- Testtheorie der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie.
- Probleme der Differentialdiagnose und Komorbidität aus Sicht der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie.