Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT DAS=11.03.2002
Anfang Skepsis_Überblick_Rel. Aktuelles_Rel. Beständiges Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_Service-iec-verlag_ Mail: sekretariat@sgipt.org_Zitierung & Copyright_ in _ Wichtige Hinweise zu Links+Empfehlungen
Christoph Bördlein
Das sockenfressende Monster in
der Waschmaschine
Eine Einführung in das
skeptische Denken
Buchhinweis mit Leseproben von Rudolf Sponsel, Erlangen
Erstausgabe 11.3.2, Letztes Update TT.MM.JJ
Inhaltsverzeichnis * Leseprobe Symptomverschiebung * Skeptiker im Internet * Besprechung und Bewertung * Kleine Bibliothek skeptischen Denkens * Querverweise (Auswahl)
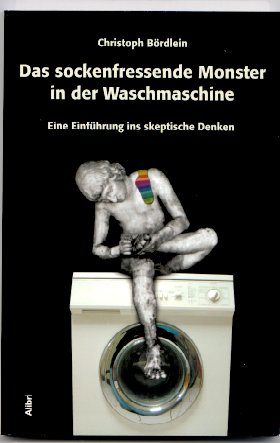 Bördlein, Christoph (2002). Das sockenfressende Monster in der Waschmaschine. Eine Einführung in das skeptische Denken. Aschaffenburg: Alibri. |
 |
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 7
1. Jeder kann sich mal irren 9
2. Wie prüft man Vermutungen? 12
- Widcrlegbarkeit 14
3. Wissenschaft als Methode zur Prüfung von
Behauptungen 19
- Der "kluge Hans" 20
4. Kritik an der Wissenschaft 24
4.1. Solipsismus und Pyrrhonische Skepsis 24
4.2. Landläufige Kritik an der Wissenschaft in Thesen
27
- "Wahrheit ist relativ" 28
- "Wir konstruieren uns verschiedene Realitäten" 29
- "Wissenschaft ist nur ein Überzeugungssystem neben anderen, gleichwertigen" 30
- "Was wir heute zu wissen glauben, kann sich schon morgen als gänzlich falsch erweisen" 35
- "Wissenschaft ist nur ein Instrument zum Machterhalt reicher, weißer Männer 38
- Hellingers Ordnung 40
Andere Methoden der Erkenntnisgewinnung 32
5. Außergewöhnliche Behauptungen
44
- Einige Kennzeichen außergewöhnlicher Behauptungen 46
- Para-, Pseudo- und Protowissenschaften 49
6. Wie prüft man außergewöhnliche
Behauptungen? 52
- Critical Thinking als Forschungsthema 52
- Quellen beurteilen 54
- Methoden der Datengewinnung 63
- Fallbeispiel: Uri Gellers Levitationsübung 71
- Argumentative Fallen 77
7. Möglichkeiten, sich zu täuschen
87
7. 1 Fehler der Validierung 87
- Falsch zählen 87
- Fallbeispiel: Der Einfluss des Mondes auf den Menschen 90
- Falsch beziehen: Auf sich beziehen 102
- Sie sind ... 102
- Falsch beziehen: Auf etwas, das man bereits zu wissen glaubt, beziehen 105
- Wasons Kartenwahlaufgabe 107
- Fallbeispiel: Wahrsager 113
- Fallbeispiel: Der Bibel-Code 127
- Fallbeispiel: Entführt von Außerirdischen 140
- Fallbeispiel: Verdrängte Erinnerungen 154
- Verdrängter Missbrauch 162
Was sich richtig anhört ist nicht notwendigerweise richtig 169
8. Was war noch mal mit der Socke? 181
Anhang:
A. Skeptische
Informationsquellen 184
B. Transkript V. Borgas 186
C. Literatur 190
Leseprobe Symptomverschiebung
"Fallbeispiel: Symptomverschiebung
I. Worum
geht es eigentlich?
Schnupfen, Kopfschmerzen, Fieber und Mattigkeit sind
Symptome einer Erkrankung, des grippalen Infekts. Einige dieser Symptome
können auch bei anderen Erkrankungen auftauchen, z.B. die Mattigkeit
bei Malaria. Daher wird der verantwortungsvolle Arzt nicht nur versuchen,
die Symptome zu lindern, sondern auch die dahinterstehende Krankheit zu
erkennen und wenn möglich zu behandeln. Nur das Fieber senken zu wollen,
könnte sich als fatal erweisen, wenn das Fieber nicht auf einen grippalen
Infekt, sondern eine weitaus schlimmere Erkrankung zurückzuführen
ist und einschneidendere Maßnahmen erfordern würde.
Die Auffassung, dass das Symptom nur Repräsentant einer Krankheit und nicht diese selbst ist, nennt man das 'medizinische Krankheitsmodell' und was physische Erkrankungen angeht, scheint es im Großen und Ganzen auch angemessen zu sein. Wie aber steht es mit 'psychischen Erkrankungen'?
Die 'Symptome' einer 'psychischen Erkrankung' sind ungewöhnliche Verhaltensweisen. Gedanken und Empfindungen [EN24]: Eine Person bekommt in Gegenwart eines bestimmten (an sich ungefährlichen) Objekts Herzrasen und schwitzt. Sie vermeidet dieses Objekt aktiv - wechselt z.B. die Straßenseite oder aber sie verlässt erst gar nicht das Haus, um dem Objekt auszuweichen. Sie hat unangenehme Empfindungen, wenn sie an das Objekt denkt. Diese und einige andere Verhaltensweisen gelten als die Symptome einer 'Phobie'. Eine Auffassung besagt nun, dass diese Symptome - die ungewöhnlichen Verhaltensweisen - nur der Ausdruck eines zugrundeliegenden innerpsychischen Konfliktes seien: Sie übertragen das medizinische Krankheitsmodell auf den Bereich des Psychischen. Symptome, so hat schon Freud behauptet, sind nicht zufällig, sie bedeuten etwas. Das Objekt, vor dem ein Phobiker ausweicht usw. spielt eine Rolle in einem verdeckt im Menschen stattfindenden Konflikt: Pferde, vor denen ein kleiner Junge (der 'kleine Hans' [EN25]) Angst hatte. standen für Freud [>174] (1909/ 1955) stellvertretend für den Vater des Jungen. In Wirklichkeit, so Freud, hatte der Junge also keine Angst vor Pferden, sondern vor seinem Vater (bei Freud ist das noch viel komplizierter, aber das erspare ich Ihnen mal). Die Angst vor Pferden ist nur ein Symptom der eigentlichen 'Krankheit', der Angst vor dem Vater. Zwischen dem Symptom und dem zugrundeliegenden Konflikt besteht eine mehr oder weniger feste Beziehung: Zum Beispiel ähnelt das Pferd dem Vater in gewisser Weise (für den kleinen Jungen sind beide übermächtig und stark). Eine ähnliche Relation ließe sich zwischen dem Vater und anderen Objekten (z.B. anderen großen Tieren) sicher auch herstellen. Von einigen Objekten behauptet man, sie würden in der Regel auf eine bestimmte Art von Konflikt hinweisen. Arachnophobie ist die übergroße Angst vor Spinnen. Einige Psychoanalytiker nehmen an, diese Phobie hinge mit Problemen in den persönlichen Beziehungen des Patienten zusammen. [EN26] Die vage Analogie, die zwischen dem Netz der Spinne und dem Netz der Beziehungen, in das man sich verstrickt, besteht, mag dabei eine Rolle spielen.
Eine andere Auffassung besagt, dass die 'Symptome' selbst die Krankheit seien (z.B. Eysenck, 1959). Die Angst vor Pferden ist nicht der Ausdruck von etwas anderem, sie ist, was sie ist, mehr nicht. Die letztendliche Ursache zu kennen, wie es das medizinische Krankheitsmodell zu können vorgibt, ist nach dieser Auffassung gar nicht notwendig: Vielleicht ist 'Hans' irgendwann einmal von einem Pferd getreten worden, vielleicht ist er einmal durch ein Pferd erschreckt worden, vielleicht hat er nur gesehen, wie jemand von einem Pferd erschreckt wurde. Das ist letztendlich unerheblich: Es gilt (im Prinzip), die Angst vor Pferden zu beseitigen, mehr nicht. Gängige Methoden dieser als Verhaltenstherapie bekannten Auffassung sind z.B. die systematische Desensibilisierung. Hierbei wird der Patient nach und nach an die Vorstellung und die tatsächliche Anwesenheit des Objekts 'gewöhnt'. Oder die 'Gegenkonditionierung': Dabei wird dem Patienten beispielsweise gleichzeitig mit dem angstauslösenden Objekt ein angenehmes Objekt präsentiert. [EN27]
Aus der Sicht des medizinischen Krankheitsmodells ist diese Vorgehensweise ein grober Kunstfehler, ähnlich, wie wenn ein Arzt nur Tabletten gegen die Kopfschmerzen und das Fieber verschreibt, ohne sich um die dahinterstehende Infektion zu kümmern. Die Symptome, so die [>175] Befürchtung, verschwänden zwar vorübergehend, dafür aber kämen nach einer Weile andere Symptome, womöglich schlimmere wieder, die auf dieselbe Krankheit zurückzuführen seien. Wer dem kleinen Hans die Angst vor Pferden solcherart nur 'abgewöhne', der müsse damit rechnen, dass der Junge über kurz oder lang z.B. Angst vor einem anderen Objekt (das seinem Vater in irgendeiner Art und Weise gleicht) entwickle, z.B. vor Hunden. Das bezeichnet man als 'Symptomverschiebung': Wer nur das Symptom bekämpft der riskiert, dass die 'Krankheit' fortbesteht und andere, neue Symptome produziert. So die Befürchtung.
II. Was wird
behauptet?
Der Hintergrund der Befürchtung, es könne bei
einer reinen Therapie der Symptome, wie sie (im Prinzip) die Verhaltenstherapie
betreibt, zu einer Symptomverschiebung kommen, ist das Erklärungssystem
der Psychodynamik. Psychodynamische Theorien wie die Psychoanalyse betrachten
die Seele als eine Art Dampfmaschine, in der die Triebenergie das Verhalten
erzeugt. Demnach entstehen psychische Krankheiten durch umgelöste
innerpsychische Konflikte. Werden diese nicht angemessen verarbeitet, dann
bildet die Triebenergie, die in diesen Konflikten wirkt, Symptome aus:
Diese sind die oberflächlich beobachtbaren Anzeichen der Erkrankung.
Eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielt hier die 'Verdrängung'.
Freud selbst entwickelte für diesen Vorgang, bei dem unerwünschte
Triebregungen aus dem Bewusstsein verbannt werden, einmal folgenden Vergleich:
Die unerwünschten Triebregungen seien ein Gast, der sich unangemessen
benimmt. Wird dieser Gast vor die Tür gesetzt (die Triebregung aus
dem Bewusstsein verbannt), so wird er in einigen Fällen nicht einfach
abziehen, sondern vor dem Haus zu randalieren anfangen, Steine gegen die
Scheiben schmeißen und uns auf alle möglichen Arten stören.
Diese Störungen sind die Symptome. Es genügt nicht, einfach eine
Störung zu beseitigen, und z.B. die Fensterläden zu schließen,
denn der unerwünschte Gast wird dann an anderer Stelle anfangen, sich
bemerkbar zu machen (das ist die Symptomverschiebung). Vielmehr muss man
das Problem an der Wurzel fassen und z.B. mit dem Gast vereinbaren, unter
welchen Bedingungen er wieder ins Haus darf (die unerwünschte Triebregung
z.B. „sublimieren", d.h. in eine andere, erwünschte Form bringen)
bzw. den Gast endgültig vertreiben (die Triebregung noch einmal mit
bewusster Anstrengung von sich weisen). Soweit, stark vereinfacht, aber
im Prinzip richtig, die psychodynamische Erklärung für psychische
Krankheiten (vgl. Fallbeispiel: Verdrängte Erinnerungen, S.
154). [> 176]
Demgegenüber steht die verhaltenstherapeutische Krankheitslehre: Ihr zufolge sind die „Symptome" einer psychischen Krankheit falsch oder nicht gelernte Verhaltensweisen. Zum Beispiel hat der Phobiker gelernt, unnötigerweise vor dem phobischen Objekt Angst zu haben. Die Therapie besteht darin, ihm die angemessenen Verhaltensweisen beizubringen, also ihn z.B. zu lehren, vor dem Objekt keine Angst mehr zu haben.
Wenn nun [das psychodynamische Modell (ES) richtig wäre (H), dann müsste folgendes eintreten: Wenn eine Person, die bestimmte Symptome einer psychischen Erkrankung aufweist (IC), nur verhaltenstherapeutisch behandelt wird (AC)], dann sollten nach einer Weile andere Symptome einer psychischen Erkrankung an der Person auftreten (P).
III.
Welche Gründe werden angeboten, um die Behauptung zu stützen?
Bestimmte Personen (z.B. psychodynamisch arbeitende Therapeuten)
glauben an die Symptomverschiebung, weil sie an die Wahrhaftigkeit des
psychodynamischen Modells glauben. Es ist noch nicht einmal der Augenschein,
der sie im Glauben an die Gefahr der Symptomverschiebung bestärkt.
Denn sie selbst behandeln ihre Patienten ja psychodynamisch und erleben
somit Symptomverschiebung nie selbst. Allenfalls sehen sie Patienten, die
zuvor bei einem Verhaltenstherapeuten waren und nun mit neuen Symptomen
zu ihnen kommen. Um die Frage allgemein zu beantworten, könnte man
aber auch groß angelegte Studien hinzuziehen. In solchen Studien
wird der Langzeiterfolg von Verhaltenstherapien überprüft und
mit dem Langzeiterfolg der psychodynamischen Therapien verglichen.
IV.
Wie gut wird die Behauptung gestützt?
Geht das Ergebnis logisch aus den Ausgangsbedingungen
hervor?
Wenn das psychodynamische Modell richtig ist, dann ist
es in der Tat wahrscheinlich, dass es nicht genügt, die Symptome zu
behandeln. Insofern müssen wir diesen Punkt bejahen.
Wie wahrscheinlich ist das Ergebnis
unter der Voraussetzung, dass die Hypothese falsch ist?
Ist es wahrscheinlich, dass eine Person, die bereits
einmal Symptome einer psychischen Erkrankung aufwies, neue Symptome entwickelt,
nachdem die alten beseitigt wurden, auch wenn das psychodynamische Modell
nicht zutreffend ist? Ja, das ist wahrscheinlich. Manche Menschen leben
in Umständen, die das Entwickeln von Symptomen einer psychischen Er[>177]krankung
wahrscheinlich machen. Nehmen wir z.B. jemanden, der drogensüchtig
ist und in einem Umfeld lebt, in dem häufig Drogen konsumiert werden.
Dass eine solche Person, nachdem die Abhängigkeit von einem Stoff
beseitigt wurde, mit großer Wahrscheinlichkeit wieder mit dieser
oder einer anderen Droge in Kontakt kommt, und so erneut süchtig werden
kann, ist auch ohne psychodynamisches Modell wahrscheinlich. Daher versuchen
verantwortungsvolle Verhaltenstherapeuten auch, nicht nur die aktuelle
Sucht zu bekämpfen, sondern zugleich die Lebensumstände des Süchtigen
zu verändern.
War klar, welches Ergebnis als eine
Bestätigung genügt und welches nicht?
Nein, das war es - wie so oft in der Psychoanalyse -
eigentlich nicht: Was sind die anderen Symptome genau? Jeder von uns hat
in der einen oder anderen Form ab und an etwas, was man als Symptom einer
psychischen Erkrankung deuten könnte, z.B. depressive Verstimmungen.
Würde das genügen, oder müssten es Symptome mit klinischem
Krankheitswert sein? Müssen die Symptome von ähnlicher Art sein,
wie die zuvor behandelten ? Sollte also ein Phobiker, der verhaltenstherapeutisch
behandelt wird, danach wieder Angst vor anderen Objekten haben, um von
Symptomverschiebung sprechen zu können? Oder genügt es auch,
wenn er später die Symptome einer ganz anderen Erkrankung aufweist
(z.B. zwanghaftes Verhalten)? Wie groß darf der Zeitraum sein, der
zwischen der Behandlung und dem Auftauchen anderer Symptome liegt? Ein
paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre? - Man bedenke: Je größer
dieser Zeitraum, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ereignisse eintreten,
die den Patienten krank machen, ohne dass ein ursächlicher Zusammenhang
zur ersten Erkrankung besteht. Zudem müssen wir berücksichtigen,
dass eine Therapie aus vielerlei Gründen (die nichts mit dem zugrundeliegenden
Krankheitsmodell zu tun haben) scheitern kann, so dass ein Symptom nur
ansatzweise beseitigt wurde. Alles in allem: ein 'unklar gestelltes Problem'
(Perrez, 1978).
Wie
gut sind die angebotenen Belege (für sich)?
Da die Gültigkeit des psychodynamischen Modells
selbst zur Debatte steht, ist es gewiss nicht akzeptabel, dieses Modell
als Beleg für eine seiner Implikationen (die angenommene Symptomverschiebung)
heranzuziehen.
Wenn ein psychodynamisch arbeitender Therapeut einen Klienten aufnimmt, der zuvor von einem Verhaltenstherapeuten behandelt worden ist [>178] und nun andere Symptome zeigt, so ist dies ein lediglich anekdotischer Befund, der auf vielerlei Weise hinterfragt werden muss: Hat der Verhaltenstherapeut wirklich Verhaltenstherapie (im engeren Sinne) betrieben? Wurde die Behandlung vorzeitig abgebrochen'?
Am verlässlichsten sind auch hier die aus wissenschaftlichen Studien gewonnenen Daten: Wie sieht es also mit den Ergebnissen von sogenannten Therapie-Evaluationen aus'? Glücklicherweise müssen wir nicht Hunderte von Studien zur Wirksamkeit von Verhaltenstherapien im Vergleich zu psychodynamischen Therapien durchforsten. Es gibt ein recht umfassendes Werk, das die Ergebnisse solcher Studien zusammenfasst: Grawe, Donati und Bernauer (1994): Psychotherapie im Wandel. Und diesem Werk entnehmen wir, dass Verhaltenstherapien im Schnitt - auch langfristig - sogar eher effektiver sind als psychodynamische Verfahren. Zudem gibt es einige Studien, die speziell das Risiko einer Symptomverschiebung untersucht haben. Denn auch Verhaltenstherapeuten wollten wissen, ob am Ende doch 'was dran' ist. Die Vermutung, es könne zur Symptomverschiebung kommen, ist für verschiedenste Störungen bzw. (verhaltenstherapeutisch orientierte) Therapiearten durch Langzeitstudien widerlegt worden. So für die Partner-Therapie (Hallweg & Markinan, 1988), die Agoraphobie (Jansson & Öst, 1982), Zwangserkrankungen (Christensen, Hadzi-Pavlovic, Andrews & Mattick, 1987) und viele andere mehr. Vielmehr ist gut belegt, dass die Symptomverschiebung nicht auftritt (Kazdin & Wilson, 1978, Sloane et al., 1975). Die American Psychiatric Association stellte schon 1973 fest, dass die Analyse der Ergebnisse von Verhaltenstherapien keinerlei Hinweise auf die Existenz der Symptomverschiebung erbrachte. [EN28]
V.
Was wäre eine angemessene Bestätigung der Hypothese?
Die Hypothese müsste überhaupt erst einmal
klar formuliert werden. Dies ist bislang nicht geschehen [RS-Kritik]
Da dies so ist, kann in der Tat jedes und kein Resultat einer Verhaltenstherapie
als ein Fall von Symptomverschiebung betrachtet werden. Potentielle psychodynamische
Vorgänge im 'Inneren' von Menschen - die zudem unbewusst ablaufen
- sind nicht beobachtbar. Daher kann man einen eindeutigen Nachweis, dass
das Auftauchen anderer Symptome nach Beendigung einer Verhaltenstherapie
ein echter Fall [>179] von „Symptomverschiebung" ist, ohnehin nicht führen.
Insgesamt deutet das Ergebnis dieser Prüfung darauf hin, dass ein
solches Modell wie das psychodynamische in sich nicht prüfbar und
damit nicht wissenschaftlich ist. Was mittlerweile auch schon viele akademisch
arbeitende Psychologen eingesehen haben, aber noch viele Psychotherapeuten
nicht wissen wollen.
VI.
Warum wird die Behauptung von ihren Anhängern geglaubt?
Psychodynamisch arbeitende Therapeuten - die wohl vehementesten
Anhänger der These von der Symptomverschiebung - haben einen gutcn
Grund, dieses Risiko anzunehmen: Eine psychodynamisch orientierte Therapie
dauert in der Regel länger, kostet mehr und der Therapeut ist wesentlich
stärker beteiligt als in einer Verhaltenstherapie. Vor allem muss
man vor den Klienten und den Krankenkassen rechtfertigen, warum ein so
aufwändiges Verfahren sein muss. Wenn es späteren Erkrankungen
erfolgreich vorbeugt, dann ist es gerechtfertigt, so viel Zeit, Geld und
Arbeit zu investieren. Aus dieser Sichtweise heraus muss es die
Symptomverschiebung geben, denn sonst wäre die psychodynamische Therapie
überflüssig.
Zudem klingt das medizinische Krankheitsmodell, das der Hypothese von der Symptomverschiebung, zugrunde liegt, plausibel und vertraut: Als Patienten eines Arztes wollen wir auch, dass das Übel 'an der Wurzel gepackt' wird und nicht nur an Symptomen 'herumgedoktert' wird. Doch nichts garantiert uns, dass, was für physische Erkrankungen gilt, auch für abweichendes Verhalten und Erleben gilt.
Tatsächlich gibt es Misserfolge in der Verhaltenstherapie. Jedoch trifft dies ebenso auf andere Therapien zu. Einige dieser Misserfolge mögen oberflächlich betrachtet wie Symptomverschiebung aussehen: Das Symptom oder ein anderes kehrt nach einiger Zeit wieder. Jedoch ist dies der einzige Hinweis und es gibt einige weit sparsamere Erklärungen für dieses Ereignis als die Symptomverschiebung (die die Akzeptanz des psychodynamischen Modells voraussetzt). Gutwillig könnte man die Symptomverschiebung 'als Spezialfall verschiedener Arten von Misserfolgen in der Therapie' (Jacobi, 1999, S. 58) betrachten. Als allgemeines Phänomen ist sie jedoch so gut wie widerlegt. [RS-Kritik]
Literaturtipp: Wenn Sie sich für eine umfassendere Darstellung der Debatte um die Symptomverschiebung interessieren, dann ist die Aufsatzsammlung von Perrez und Otto (1978) eine noch heute maßgebliche Quelle: Perrez, M. & Otto, J. (Hrsg.). (1978). Symptomverschiebung Eine Kontroverse zwischen Psychoanalyse und Verhaltenstherapie. Ein Reader. Salzburg: O. Müller. [>180]
Zuletzt übt die psychodynamische Krankheitslehre auf ein bestimmtes Klientel eine große Faszination aus: Für manchen ist es einfach interessanter und schmeichelhafter, wenn seine Probleme auf unbewältigte Krisen und Kindheitstraumen zurückgeführt werden, als wenn er erfährt, dass er einfach etwas falsch 'gelernt' hat. Psychoanalyse lässt uns uns selbst tiefer und interessanter finden als die Verhaltenstherapie. Denn wenn schon 'krank' sein, so könnte sich der Patient sagen, dann bitte an einer wirklich interessanten Krankheit."
Endnoten und Anmerkungen Leseprobe Symptomverschiebung
[ENxx ist Endnotennummer im Buch, RS = Rudolf Sponsel Anmerkung]
[EN24] Man kann auch das Denken als
Verhalten betrachten. Verhalten ist alles, was ein Mensch tut. Und 'denken'
ist etwas, das man tut.
[EN25] Freud hat den Jungen, der
als 'kleiner Hans' Psychologiegeschichte schrieb und den er angeblich 'behandelt'
hat, in der Tat nur ein einziges Mal gesehen - und auch da nicht zwecks
Behandlung. Vielmehr behandelte der Vater den Jungen selbst nach Freuds
Anweisungen.
[EN26] Nach einer persönlichen
Mitteilung von Christoph J. Stengel.
[EN27] Diese Hinweise bitte nicht
zur Eigentherapie verwenden! In der Tat ist es doch etwas komplizierter,
als ich es hier darstelle.
[EN28] 'Carefull analyses
of thc results of ... behaviour therapy methods, with a wide variety of
problems have ... failed to reveal any evidence for symptom substitution'
(S. 54).
[RS-178]
Links zum kritischen und skeptischen Denken
| Die Zeitschrift Skeptiker:
https://www.gwup.org/skeptiker/
Alibri-Verlag: https://www.sterneck.net/alive/alibri/ GWUP - Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e.V.: https://www.gwup.org/ Die GWUP ist ein wegen Förderung der Volksbildung als gemeinnützig anerkannter Verein, in dem sich über 600 Wissenschaftler und wissenschaftlich Interessierte für Aufklärung und kritisches Denken, für sorgfältige Untersuchungen parawissenschaftlicher Behauptungen und die Popularisierung von wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen einsetzen. |
 |
Besprechung und Bewertung
Einführung in den Problemkreis Skepsis: Denken und erkennen und vor allem kritisch denken und richtig erkennen ist ein schwieriges Geschäft und voller Fallstricke. Nepper, Bauern- und Rattenfänger (Sekten hier) wie ManipulatorInnen sind allgegenwärtig, wollen Besitz ergreifen von unserer Seele, unserem Geist, unserem Körper, unseren Fähig- und Tüchtigkeiten, meist jedoch vor allem auch von unserem Portemonnaie. Wer hat "recht"?, wer bestimmt und kann sich durchsetzen? - das war schon ein großes Thema bei den Sophisten im alten Griechenland, schon immer natürlich in der Politik - schonungslos dargelegt von Machiavelli - drastisch verwirklicht in der vielgerühmten Marktwirtschaft und ihrer rücksichtslosen Profitgier und Werbung. Doch auch in der Wissenschaft geht es entsprechend zu. Auch dort ist längst nicht alles Gold, was glänzt: Effekthascherei, Datenfrisieren bis hin zum Betrug sind wahrscheinlich viel häufiger als man gemeinhin annehmen möchte. Auch hier gibt es üble Politik, Ränkespiele und Machtkämpfe, die weder mit Anstand und Moral, noch mit Erkenntnisstreben und Wissenschaft viel zu tun haben. Max Planck formulierte 1948 sehr trefflich: "Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, daß ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, daß ihre Gegner allmählich aussterben und daß die heranwachsende Generation von vorneherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist." (Zitiert nach Kannengießer, L. & Kröber, G. (1974, S. 122)).
Die Wahrheit hat viele Feinde. Die wichtigsten sind der Irrtum, Glauben und die Interessen. Doch ist die Wahrheit eigentlich immer ertrebenswert? Sind nicht manche Lügen oder Irrtümer viel angenehmer, heilsamer, ja manchmal sogar nötig, um das Schicksal zu ertragen? Mit dieser Frage und dem Problemkreis wie auch mit den metaphysischen Bedürfnissen der Menschen und ihrem Verlangen nach Sinn und Sinngebung beschäftigt sich der Autor nicht. Wir wollen diesen Aspekt daher nur erwähnen und nicht weiter verfolgen.
Das Büchlein birgt viele nützliche Analysen, Anregungen und Empfehlungen, ja es enthält sogar eine kleine Bibliothek skeptischen Denkens.
Wissenschaft als Methode zur Prüfung von Behauptungen. Ein Highlight des Buches ist z.B. die Darstellung der Analyse des "rechnenden" Pferdes, das in die Literatur als der "kluge Hans" einging. Eindrucksvoll wird dargelegt, was ein Psychologiestudent 1907 drauf hatte: eine Glanzleistung skeptischen Denkens und methodologisch- psychologischen Scharfsinns. Die Analyse des klugen Hans zeigt zugleich, wie subtil z.B. in Psychotherapien Einfluß vonstatten gehen kann und wahrscheinlich auch vonstatten geht. Leider lassen die meisten akademischen und anglo- amerikanisch orientierten Psychotherapie- ForscherInnen das Format und Niveau eines Oskar Pfungst vermissen. So gesehen ist dieses kurze Kapitel gerade auch für PsychotherapeutInnen sehr lehrreich und äußerst interessant.
Sehr überzeugt hat mich auch die Kritik am Relativismus und (Vulgär)- Konstruktivismus. In diesem Kontext werden auch andere Methoden der Erkenntnisgewinnung kritisch, aber z.T. unzureichend bzw. einseitig erörtert: Erfahrung, Intuition, Verstehen; Visionen, Träume und Offenbarungen. Das Verstehen von fremden Ichen, so der Titel einer Arbeit von Theodor Lipps von 1907, einer Blüteperiode der aufstrebenden akademischen Psychologie, zeigt ja auch die Bedeutung des Problems Verstehen eines fremden Iches. In diesem Zusammenhang werden auch Psychogurus wie z.B. Hellinger [hier dokumentiert] kritisch unter die Lupe genommen.
Kapitel 5 widmet sich dem äußerst wichtigen Thema der außergewöhnlichen Behauptungen und setzt im 6. Kapitel das Thema mit der verdienstvollen Frage fort: Wie prüft man außergewöhnliche Behauptungen? Hierbei wird dann der skeptische Leitfaden entwickelt, der auch als sinniges Lesezeichen dem Buch beiliegt. In diesem Zusammenhang werden auch kurz und prägnant die Methoden der Datengewinnung erörtert: Anekdotische Evidenz und Augenzeugenberichte, Fallstudien, Deskriptive Studien und das Experiment. Ein weiteres Highlight wird in der skeptischen Analyse von Uri Gellers Levitationsübung geboten, auf die der skeptische Leitfaden erfolgreich entlarvend angewendet wird. Es folgt eine Checkliste argumentativer Fallen aus dem Waffenarsenal rhetorischer, rabulistischer und sophistischer Tricks: Eine falsche Fährte legen, Ad Populum (Alle ...), Appellieren an Traditionen, Autoritätsbeweise, Falsches Dilemma, In-Frage-Stellen, Falsche Analogien, Post hoc ergo propter hoc (danach, also deswegen), Ad Hominem (gegen die Person, statt Argument), Kein Rauch ohne Feuer (Semper aliquid haeret = Es bleibt immer etwas hängen), Slippery Slope (verwischen von Unterschieden), Voreilige Schlußfolgerungen, Vorwurf des Irrtums, Appell ans Mitgefühl, Appell an die Eitelkeit, Zirkuläre Argumentation, Non sequitur (es folgt nicht, also falsche Kausalitätszuschreibung), Strohmann (Pappkameraden aufbauen, um ihn sodann nieder zu machen), Argumentum ad ignorantiam (Nichtwissen als Argument) und schließlich: Das unmöglich Wissbare wissen.
Auch das 7. Kapitel ist sehr wichtig, weil es täuschen und irren in fünf Hauptabschnitten zum Gegenstand hat, wenngleich das Fallbeispiel Der Einfluss des Mondes auf den Menschen nicht ganz überzeugt, weil es wichtigere empirische und kritische Arbeiten aus dem Kontext Astrologie, Astronomie und der Meteorologie (z.B. Eysenck, Gauquelin, Sachs) nicht berücksichtigt. Praktisch und sehr lehrreich ist aber die ausführliche Anwendung des skeptischen Leitfadens auf die Frage des Einflusses des Mondes. Die Erörterung und das Beispiel sog. Barnum-Texte (Meehl 1956) zeigen z.B., weshalb Horoskop- Deutungen so angenommen werden. Es folgen Analysen der Bestätigungstendenz (confirmation bias), des primacy effects (Einfluß erster Informationen) und der belief persistence (Vorurteile, Vorannahmen). Es folgt ein weiteres Highlight in der Anwendung des skeptischen Leitfadens auf die berühmte Wahrsagerin Margarita S., die in einer Untersuchung von Crider (1944) immerhin eine Trefferquote von 96% erzielen konnte. Sehr lehrreich ist auch der Abschnitt über Wahrscheinlichkeiten. U.a. wird die lehrreiche Aufgabe gestellt: Wie groß muß eine Gruppe sein, damit mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit zwei Personen am gleichen Tag Geburtstag haben? Und noch interessanter für HeilberuflerInnen ist die folgende Aufgabe: Angenommen, ein Test weist eine Krankheit mit 79% nach. Sie haben ein positives Testergebnis. Die Häufigkeit dieser Erkankung ist in der Bevölkerungsgruppe, der Sie angehören, 1%. Schätzen Sie bitte: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß Sie wirklich diese Krankheit haben? Es folgt die skeptische Analyse der Bibel-Code Aufgabe, danach die Wahrnehmungstäuschungen mit einem Fallbeispiel zur Frage der Entführung durch Außerirdische. Sehr wichtig für PsychologInnen, PsychopathologInnen, ForensikerInnen und PsychotherapeutInnen ist der Abschnitt über Erinnerungsfehler, die am Fallbeispiel Verdrängte Erinnerungen kritisch erörtert werden unter ausführlicher Anwendung des skeptischen Leitfadens. Das Kapitel endet mit der hier ausgeführten Leseprobe zur Frage der:
Symptomverschiebung. Diese Ausarbeitung habe ich als Leseprobe aufgenommen, weil sie für PsychotherapeutInnen besonders interessant und wichtig ist, wenngleich ich der Ausarbeitung argumentativ nicht zu folgen vermag. Zunächst wird ausgiebig argumentiert, daß es nach den vorliegenden Daten keine Symptomverschiebung geben solle, gegen Ende wird behauptet, daß die Hypothese der Symptomverschiebung gar nicht klar formuliert sei. Wenn die Hypothese bislang nicht angemessen und klar formuliert wurde, dann läßt sich bislang auch keine Folgerung zu Gunsten oder zu Ungunsten der Symptomverschiebungshypothese schlüssig und begründet ziehen. Die Argumentation ist in sich widersprüchlich. Intra- und interpsychische - wie sie vor allem von systemischen BeziehungstherapeutInnen entdeckt und berichtet werden - Modelle von Symptomverschiebung sind m.E. ohne große Probleme konstruierbar und im Prinzip auch therapieschul- unabhängig. Zwar ist richtig, daß die Psychoanalyse und analytische Psychotherapie weitgehend als Phantasieprodukte und nicht als Wissenschaft betrachtet werden können. Aber das Konzept der Symptomverschiebung beruht weitgehend auf Beobachtung und Erfahrung - z.B. Symptomfluktuation bei Borderlinestörungen - und ist von tiefenpsychologischen oder medizinischen Modellen unabhängig. Hierzu auch in der IP-GIPT: [Keine Kontrolle von Symptomverschiebungen], [Symptomverschiebungen]. Sehr bekannt und häufig zeigt sich Symptomverschiebung beim Rauchen aufgeben, das oft mit einer Zunahme des Körpergewichts einhergeht. Aus der Familientherapie ist der sog. Indexpatient bekannt. Die erfolgreiche Therapie einer sog. IndexpatientIn kann dazu führen, daß ein anderes Mitglied des Familiensystems nun zur SymptomträgerIn und IndexpatientIn wird.
Das Buch schließt mit einem informativen Anhang zu skeptischen Informationsquellen. Kein Zweifel: ein informatives, nützliches und wichtiges Büchlein angesichts der Nepper und Bauernfänger moderner - auch szientistischer - Esoterik, Auserwählter, Vulgärkonstruktivisten und medialer Dumpfbackenkultur.
Kleine Bibliothek skeptischen Denkens
nach Christian Bördlein (Auswahl, hier alphabetisch)
sexuellen Mißbrauchs. Hamburg: Klein.
Querverweise (Auswahl)
- Metaphysik, Glaube, Sekten, Esoterik u.ä. in der IP-GIPT
- Auserwählt und Auserwählt-Syndrome (Psychologische und psychopathologische Analyse oder Über ein gefährliches Fundamentalismus-Axiom potentiell paranoider Selbstüberhebung in Religionen (z.B. bei Juden, Christen und Moslems) und Weltanschauungen)
- W. Toman: Keine Auferstehung? Nur endloser Tiefschlaf?
- Wissenschaft und Wissenschaftskritik (Szientismus) in der IP-GIPT
- Über das prä-galileische Chaos-Syndrom in Medizin, Psychologie und vor allem in der Konfessions-Psychotherapie
- Metaanalytische szientistische Spiele
- Kritik der Handhabung der Faktorenanalyse
- Multivariate Korrelationsmatrizenspiele
- Glosse: Das Spiel der PsychometrikerInnen
- Grawes Vergleichsmethoden
- Kritik der Psychoanalyse
- Was ist ein Beweis - Wann ist ein Aggressor überführt?
- Grundzüge einer idiographischen Wissenschaftstheorie
Sponsel, Rudolf (DAS). Buchhinweis mit Leseproben: Bördlein, Christoph (2002). Das sockenfressende Monster in der Waschmaschine. Eine Einführung in das skeptische Denken. Skeptiker im Internet. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/kritik/kritdenk/monster.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erfragen. In Streitfällen gilt der Gerichtsstand Erlangen als akzeptiert.
Ende Skepsis_Überblick_Rel. Aktuelles_Rel. Beständiges _Titelblatt_Konzept_Archiv_Region_ Service-iec-verlag_ Mail: sekretariat@sgipt.org__ in _ Wichtige Hinweise zu Links+Empfehlungen
kontrolliert: irs 09.03.02