(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=20.05.2013 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 08.12.2019
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail: sekretariat@sgipt.org_ Zitierung & Copyright
Anfang_Mindestanforderungen Prognose-Gutachten_Datenschutz_ Überblick_ Rel. Aktuelles_ Rel. Beständiges _ Titelblatt_ Konzeption_ Archiv_ Region_ Service_iec-verlag _ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Mindestanforderungen für
forensische Prognosegutachten
und ihre Einhaltung bei Gustl F.
Mollath
durch den Nürnberger, Bayreuther,
Berliner und Ulmer Gutachter
Aktuelles
Zu:
Potentielle Fehler in forensisch psychiatrischen
Gutachten, Beschlüssen und Urteilen der Maßregeljustiz
Eine methodenkritische Untersuchung illustriert
an einigen Fällen u. a. am Fall Gustl
F. Mollath
mit einem Katalog
der potentiellen forensischen Gutachtenfehler sowie einiger Richter-Fehler.
von Rudolf
Sponsel, Erlangen
_
Abstract - Zusammenfassung - Summary
Aktuelles
"Recht und Psychiatrie 36. Jahrgang, 2018, 3: Schwerpunktheft:
Qualitätssicherung und Mindestanforderungen bei Prognosegutachten.
Entwicklung der Mindestanforderungen Zwar wurden von Justiz, forensischer Psychiatrie und Psychologie Mindestanforderungen für Prognosegutachten formuliert (Boetticher et al. 2006, 2009; Dahle 2005, 2007; Kröber 2010; Nedopil 1996, 2005; Rasch 1986, 1999, Rasch & Konrad 2004; ), aber die Veröffentlichung der Regeln scheint nur proklamatorischen und Alibifunktions-Charakter zu haben, weil sich die wenigsten forensischen PsychiaterInnen daran halten, auch nicht die crème de la crème Gutachter (O-Ton Dr. Merk). Das heißt, die Kumpanei der Ignoranz verbindlicher Regeln zwischen Unterbringungsjustiz und forensischer Psychiatrie funktioniert bestens. Das zeigt sich besonders eindrucksvoll im Fall Gustl F. Mollath. Was hier die Gutachter (Nürnberg, Bayreuth, Berlin und Ulm) und die damit befassten Richter geleistet haben, geht längst nicht mehr auf die sprichwörtliche Kuhhaut, dazu bedürfte es schon einiger Elephantenherden.
Rechtliche
Grundlagen: Voraussetzungen des § 63 StGB (Unterbringung)
Die notwendigen Voraussetzungen des § 63 StGB finden sich in (S.
88ff):
- Schreiber, Hans-Ludwig & Rosenau, Henning (2004) Die Voraussetzungen
der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB.
In (88-92) Venzlaff, Ulrich & Foerster, Klaus (2004, Hrsg.; 4.A.).
Psychiatrische Begutachtung. Ein praktisches Handbuch für Ärzte
und Juristen. München: Elsevier (Urban & Fischer).
In Kap. 5.5.2 Die Voraussetzungen der Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus nach § 63 StGB werden abgehandelt:
Schuldunfähigkeit und
verminderte Schuldfähigkeit (S. 88)
Die rechtswidrige Tat als
Anlass (S. 89)
Der Zustand des Täters
bei der Anlasstat (S. 89)
Die Gefährlichkeitsprognose
(S. 89)
- Erhebliche Straftaten (S. 89)
- Wahrscheinlichkeit weiterer Taten (S. 90)
- Intuitive Prognose (S. 90)
- Klinische oder empirische Individualprognose (S. 90)
- Statistische Prognose (S. 91)
- Gefährdung der Allgemeinheit (S. 91)
- Kausalzusammenhang (S. 91)
Von besonderer Wichtigkeit für die Aufgaben des Gutachters
ist hier, dass der Zustand des Täters bei den Anlasstaten nicht nur
zu erforschen ist, sondern auch der Kausalzusammenhang zwischen Störung
und Taten aufzuzeigen ist. Weiter muss gezeigt werden, dass eine Allgemeingefährlichkeit
durch weiterhin zu erwartende erhebliche Straftaten vorliegt.
Zusammenfassende
Signierungs-Übersicht der Mindestanforderungsergebnisse des Nbg.,
Bay., Berl., Ulmer Gutachters.
Vorbemerkung: Prognosekriterien sind immer dann wichtig, wenn es um
Beweisfragen zum § 63 (Unterbringung) oder § 67e (alljährliche
Stellungnahmen zur Unterbringung) StGB geht. Hierbei sind die Voraussetzungen,
wie oben mitgeteilt, sehr wichtig. Daher spielt das Mainkofener Geschäftsfähigkeits-
und Betreuungsgutachten hier auch keine Rolle, wenn es auch sehr wichtig
ist zur Frage des Wahns und der darauf gegründeten Gefährlichkeit.
Haupt-Ergebnis in Worten
Es sind vier Kriterienbereiche mit insgesamt 11+8+1+8 = 28
Hauptkriterien ohne die 4 Differenzierungen bei den
Quellen (I.1.5a -d) und ohne die 3 Differenzierungen (III 3.3a bis c),
mit den Differenzierungen sind es 35. Das ergibt also einen
Wertebereich von -35 (-28) bis +35 (+28). Die Bewertungen in einem Kriterium
reichen von -1 bis +1. Der Nürnberger Gutachter erhält -22,
der Bayreuther -26, der Berliner -27.5 und der Ulmer Gutachter
-13.5.
Falls meine Bewertungen angemessen sind, ist das ein katastrophales Ergebnis
für die Prognosegutachtengüte der vier Mollath-Gutachter, auch
wenn der Ulmer Gutachter nur ungefähr halb so schlecht abschneidet
wie die anderen, wobei man sich durchaus fragen kann, ob das die persönliche
Untersuchung und Exploration ausmacht.
Anmerkung nur für methodisch Versierte und
Interessierte: Die Korrelationen und die Eigenwertanalysen
zeigen, dass die Korrelationsmatrizen fast-kollinear sind und das fast-kollineare
Subsystem durch den Nürnberger, Bayreuther und Berliner Gutachter
gestiftet wird, und zwar unabhängig davon, ob die Eigenwertanalysen
mit den Korrelationsmatrizen aus 35 oder 28 Kriterienscores gerechnet wurden.
So gesehen bilden die drei genannten Gutachter ein eigenes System.
Zu den Signierungen:
- + erfüllt, - nicht erfüllt, 0 teilweise erfüllt, teilweise
nicht erfüllt, 0 unklar.
++- mehr erfüllt als nicht = 0.5, --+ mehr nicht erfüllt als erfüllt = -0.5
?- teilweise unklar, teilweise nicht erfüllt
Eine angemessene zahlenmäßige Signierung ("Scorierung")
erlaubte eine multivariate Analyse:
- 1 erfüllt, -1 nicht erfüllt, 0 teilweise erfüllt, teilweise
nicht erfüllt, 0 unklar.
0.5 mehr erfüllt als nicht, -0.5 mehr nicht erfüllt als erfüllt.
-.5 teilweise unklar, teilweise nicht erfüllt
"MAPG" = Mindest Anforderungen Prognose
Gutachten
| Prognose Kriterium
Beachte: Rechtskräftiges Urteil vom 13.2.2007 (blau unterlegt Summe der Bereiches) |
22.4.04 |
25.07.05 |
27.06.08 |
12.2.11 |
| Summe nach differenzierter Gewichtung |
|
|
|
|
| Summe über alle 4 Bereiche und 35 Kriterien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [MAPG-I-Formelle Mängel] |
|
|
|
|
| [MAPG-I-1.1 Auftraggeber, Fragestellung] | + (1) | + (1) | + (1) | + (1) |
| [MAPG-I-1.2 Ort, Zeit, Umfang] | ? (0.5) | +- (0) | +- (0) | ++- (0.5) |
| [MAPG-I-1.3 Aufklärung] | ?- (-0.5) | ?- (-0.5) | ?- (-0.5) | ?- (-0.5) |
| [MAPG-I-1.4 Doku] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | - (-1) |
| [MAPG-I-1.5 Quellen insgesamt] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | ++- (0.5) |
| [MAPG-I-1.5a Quelle Akten] | ? (0) | +-- (-0.5) | +-- (-0.5) | +- (0) |
| [MAPG-I-1.5b Quelle SubjDarstProband] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | +-- (-0.5) |
| [MAPG-I-1.5c Quelle Beob&Untersuchung] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | +- (0) |
| [MAPG-I-1.5d Quelle Zusätze] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | - (-1) |
| [MAPG-I-1.6 DiffDarlInterprKommInformBef] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | + (1) |
| [MAPG-I-1.7 TrennSicherMeinVermutg] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | ? (0) |
| [MAPG-I-1.8 OffUnklarhProbleme] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | +- (0) |
| [MAPG-I-1.9 GetrAusweisBeteil] | entfällt (0) | +- (0) | +-- (-0.5) | +-- (-0.5) |
| [MAPG-I-1.10 Zitat] | entfällt (0) | entfällt (0) | entfällt (0) | + (1) |
| [MAPG-I-1.11 KlarÜbersichtlGliederung] | ? (0) | - (-1) | - (-1) | + (1) |
| [MAPG-II-InformatGewinnung] |
|
|
|
|
| [MAPG-II-1.1 UmfassAktenstudium] | +- (0) | +-- (-0.5) | +-- (-0.5) | +-- (-0.5) |
| [MAPG-II-1.2 AdäqUntBeding] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | + (1) |
| [MAPG-II-1.3 AngUntDauer] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | +-- (-0.5) |
| [MAPG-II-1.4 MehrdimUnt] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | - (-1) |
| [MAPG-II-1.5 UmfErheb] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | - (-1) |
| [MAPG-II-1.6 BeobBeschr] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | +- (0) |
| [MAPG-II-1.7 PrüfRisiko] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | - (-1) |
| [MAPG-II-1.8 IndikatTestPsyDiag] | +- (0) | +- (0) | +- (0) | - (-1) |
| [MAPG-II-2 DiagDiffDiag] |
|
|
|
|
| [MAPG-II-3 MA-AbfassgGA] |
|
|
|
|
| [MAPG-II-3.1 KonkretGAfrage] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | - (-1) |
| [MAPG-II-3.2 AnalIndivDelinq] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | - (-1) |
| [MAPG-II-3.3 MehrdimBiogrAnal Gesamt] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | - (-1) |
| [MAPG-II-3.3a MehrdimBiogrAnal] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | - (-1) |
| [MAPG-II-3.3b MehrdimBiogrAnal] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | - (-1) |
| [MAPG-II-3.3c MehrdimBiogrAnal] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | - (-1) |
| [MAPG-II-3.4 AbglEmpWisRückfallRisiko] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | - (-1) |
| [MAPG-II-3.5 DarstPersEntw] | - (-1) | - (-1) | - (-1) | +--(-0.5) |
| [MAPG-II-3.6 AuseinVorGA] | 0 (0) | - (-1) | - (-1) | - (-1) |
| [MAPG-II-3.7 ProgRückfallRisiko] | 0 (0) | +-- (-0.5) | - (-1) | +--(-0.5) |
| [MAPG-II-3.8 ProgGrenzenRiskManag] | 0 (0) | 0 (0) | +-- (-0.5) | +-- (-0.5) |
[Ende Abstract]
Analyse der Prognosegutachtenqualität der vier Mollath Gutachter nach den Mindestanforderungen für Prognosegutachten
Vorbemerkung:
Rechtskraft, Anlasstatsachen
und Interlokut
Im Folgenden werden die vier Prognose-Gutachten(teile) des Nürnberger,
Bayreuther, Berliner und Ulmer Gutachters nach den 28 Kriterien der Mindestanforderungen
für Prognose-Gutachten bewertet und vergleichend nebeneinander gestellt.
Hierbei ist zu beachten, dass die Rechtskraft des Urteils erst seit dem
13.2.2007 (BGH Ablehnung der Revision) gilt und damit für den Berliner
und Ulmer Gutachter als Anlasstatsache rechtlich bindend war, nicht aber
für den Nürnberger und Bayreuther Gutachter, obwohl sie sich
so verhielten. Das Problem der Anlasstatsachen
(Interlokut) ist vom deutschen Rechtswesen
nie angemessen und ordentlich gelöst worden und geht in aller Regel
zu Lasten der ProbandInnen und der ordentlich arbeitenden Sachverständigen.
"C. Katalog der formellen
und inhaltlichen Mindestanforderungen für kriminalprognostische Gutachten
Quelle: Boetticher, Kröber, Müller-Isberner,
Böhm, Müller-Metz, Wolf: Mindestanforderungen für Prognosegutachten.
NStZ 2006 Heft 10, 537- [PDF1,
]
I. Formelle Mindestanforderungen an ein Prognosegutachten [MAPG-I]
Für ein fachgerechtes kriminalprognostisches Gutachten gelten die Prinzipien, die generell für die wissenschaftlich fundierte Begutachtung im Einzelfall zu berücksichtigen sind. Die unter I. genannten Mindestanforderungen für ein handwerklich ordentliches Gutachten sind daher weitestgehend identisch mit den Kriterien, die in den Mindestanforderungen für Schuldfähigkeitsgutachten FN12 genannt wurden. Sie werden hier nochmals genannt, um die Übereinstimmung zu betonen und zugleich Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Gesamtkatalogs zu sichern. Zudem werden nachfolgend einige Kriterien im Hinblick auf die kriminalprognostische Begutachtungssituation erläutert.
Kriminalprognostische Gutachten setzen eine einschlägige Erfahrung
in der Exploration von Straffälligen, Kompetenz im eigenen psychiatrischen,
psychologischen oder sexualmedizinischen Fachgebiet sowie gediegene kriminologische
Kenntnisse voraus."
|
rechtskräftiges Urteil vom 13.2.2007 |
22.4.2004 |
25.07.2005 |
27.06.2008 |
12.2.2011 |
| I. Formelle Kriterien
_ _ _ _ _ |
Nicht persönlich expl/untersucht
In HV erlebt. _ f _ _ |
Nicht persönlich expl/untersucht; "beobachten" lassen. Nur kurze persönl. Begegnungen. | Nicht persönlich expl/untersucht. Ganz kurze persönl.
Begegnung _ |
Unvollständig persönlich expl./ untersucht 30.11.10
_ _ |
| I.1.1 Nennung von Auftraggeber und Fragestellung, ggf. Präzisierung
Die Präzisierung ist dann erforderlich, wenn aus Sicht des Sachverständigen der Auftrag für das Gutachten nicht eindeutig ist. Zur weiteren Abklärung der Beweisfrage ist beim Auftraggeber rückzufragen. |
|
|
|
|
| I.1.2 Darlegung von Ort, Zeit und Umfang der Untersuchung
_ |
_ _ |
nicht genau_ _ |
_ |
Einzelheiten nein Falsches Datum |
| I.1.3 Dokumentation der Aufklärung |
|
|
|
|
| I.1.4 Darlegung der Verwendung besonderer Untersuchungs- und Dokumentationsmethoden (z.B. Videoaufzeichnung, Tonbandaufzeichnung, Beobachtung durch anderes Personal, Einschaltung von Dolmetschern) | Parapsychopatho- logische Fähigkei- ten und Progno- semethodik nicht ausgewiesen | Parapsychopatho- logische Fähigkei- ten und Progno- semethodik nicht ausgewiesen | Parapsychopatho- logische Fähigkei- ten und Progno- semethodik nicht ausgewiesen | Untersuchungs- methodik unzu- länglich begrün- det, Prognoseme- thodik nicht ausgewiesen |
| I.1.5 Exakte Angabe und getrennte Wiedergabe der Erkenntnisquellen.
Der Sachverständige hat zu begründen, wenn die Erschließung weiterer Informationsquellen notwendig ist. Zusätzlich zu medizinischen und psychologischen Untersuchungsverfahren können z.B. die Einholung fremdanamnestischer Angaben von signifikanten Dritten (z.B. Partnerinnen) zur Gewinnung von Informationen über den sozialen Empfangsraum oder das Sexualleben des Probanden erforderlich werden. Während medizinische und psychologische Untersuchungsverfahren von ihm selbst durchgeführt oder veranlasst werden können, sind Zeugenvernehmungen (sog. Fremdanamnese) durch den Sachverständigen nicht unproblematisch; es ist hier allemal in enger Absprache mit dem Auftraggeber vorzugehen (vgl. zu den Einzelheiten B.II.4). |
|
|
|
|
| I.1.5a) Akten
_ _ |
unklar, globale Referenz "Akten" | teilweise, unzulänglich
_ |
teilweise, unzu- länglich, globale
Ref. "Akten" |
teilweise, unzulänglich
_ |
| I.1.5b) Subjektive Darstellung des Probanden
_ _ |
Nicht persönlich expl/untersucht,
unzulänglich |
Nicht persönlich expl/untersucht,
unzulänglich |
Nicht persönlich expl/untersucht,
unzulänglich |
reglementiert u.
unzulänglich |
| I.1.5c) Beobachtung und Untersuchung
_ _ _ |
Beobachtung unergiebig für die Beweisfrage SF
Keine eigene Untersuchg/ Expl. |
Beobachtung unergiebig für die Beweisfrage SF
Keine eigene Untersuchg/ Expl. |
Beobachtung unergiebig für die Beweisfrage SF
Keine eigene Untersuchg/ Expl. |
|
| I.1.5d) Zusätzlich durchgeführte Untersuchungen (z.B. bildgebende Verfahren, psychologische Zusatzuntersuchung, Fremdanamnese) | Nein, Fremd- anamnese unkritisch | Nein, Fremd- anamnese unkritisch | Nein, Fremd- anamnese unkritisch | Nein, Fremd- anamnese unkritisch |
| I.1.6 Kenntlichmachen der interpretierenden und kommentierenden
Äußerungen und deren Trennung von der Wiedergabe der Informationen
und Befunde
_ |
Datenarme Befunde nicht begründet, extrem gering informativ | Befunde nicht mit ausreichend Daten begründet, unklar, amorphe Darstellung | Datenarme Vorbefunde nicht kritisch überprüft, unklare, amorphe Darstellung |
|
| I.1.7 Trennung von gesichertem medizinischem (psychiatrischem, psychopathologischem) sowie psychologischem und kriminologischem Wissen und subjektiver Meinung oder Vermutungen des Gutachters | Nein
_ _ _ |
Nein
_ _ _ |
Nein
_ _ _ |
in relevanten Bereichen unklar
_ |
| I.1.8 Offenlegung von Unklarheiten und Schwierigkeiten und den daraus abzuleitenden Konsequenzen, ggf. rechtzeitige Mitteilung an den Auftraggeber über weiteren Aufklärungsbedarf. | Nein
_ _ |
Nein
_ _ |
Nein
_ _ |
Teilweise, unzulänglich.
_ |
| I.1.9 Kenntlichmachen der Aufgaben- und Verantwortungs- bereiche
der beteiligten Gutachter und Mitarbeiter
_ _ _ _ |
entfällt
_ _ _ _ _ _ |
nur teilw., oft ungenau (Station.) sowie verschiede- ne Zeitperspekti- ven (Tatzeiten, Gegenwart, Zu- kunftsprognose) unzulänglich bearbeitet | verschiedene Zeitperspektiven (Tatzeiten, Gegen- wart,
Zukunftspro- gnose) unzu- länglich bearbeitet.
_ _ |
verschiedene Zeitperspektiven (Tatzeiten, Gegen- wart,
Zukunftspro- gnose) unzuläng-
lich bearbeitet. _ _ |
| I.1.10 Bei Verwendung wissenschaftlicher Literatur Beachtung
der üblichen Zitierpraxis
Unnötig ist das Auflisten von gängigen Lehrbüchern oder Diagnosemanualen am Schluss eines Gutachtens. Mit Fundstelle belegt werden sollte spezielle Literatur, aus der im Gutachten zitiert wird, um bestimmte wissenschaftliche Sachverhalte zu verdeutlichen. |
keine wiss. Lit. verwendet bzw. ausgewiesen
_ _ _ _ |
keine wiss. Lit. verwendet bzw. ausgewiesen
_ _ _ _ |
keine wiss. Lit. verwendet bzw. ausgewiesen
_ _ _ _ |
_ _ _ _ _ |
| I.1.11 Klare und übersichtliche Gliederung |
|
|
|
|
"Abschnitt II beleuchtet die Notwendigkeiten bei der Durchführung der Begutachtung, der Erschließung der schriftlich dokumentierten Informationen und der Untersuchung des Probanden selbst. Ziel dieser Informationserschließung ist es, ein möglichst exaktes, durch Fakten gut begründetes Bild der Person des Probanden, seiner Lebens- und Delinquenzgeschichte, der in seinen Taten zutage getretenen Gefährlichkeit und seiner seitherigen Entwicklung zu gewinnen. Ohne die Rekonstruktion der Persönlichkeitsproblematik, der Lebens- und Delinquenzgeschichte fehlt einer in die Zukunft gerichteten Risikoeinschätzung das entscheidende Fundament.
Es ist nicht ausreichend, sich allein auf die Angaben des Probanden
oder das Vollstreckungsheft zu stützen, zumal sich das Gutachten aus
dem Erkenntnisverfahren nicht darin befindet; in der Regel ist also die
Einsichtnahme in die Verfahrensakten erforderlich, zudem sind Vorstrafakten,
Krankenakten oder Gefangenen-Personalakten bedeutsam. Für eine problemorientierte
Exploration des Probanden ist es unerlässlich, dass der Sachverständige
über ein sicheres Faktenwissen über die Ereignisse in der Vergangenheit
verfügt, aber auch über Zeugenaussagen und frühere Einlassungen
des Probanden. Der Sachverständige hat ggf. eigenständig die
relevanten Akten anzufordern."
|
rechtskräftiges Urteil vom 13.2.2007 (BGH) Diese Spalte enthält Zitierungen der Mindestanforderungen.... [PDF1] |
22.4.2004 |
25.7.2005 |
27.06.2008 |
12.2.2011 |
| II.1 Mindestanforderungen bei der Informationsgewinnung
_ |
rechtskräftiges
Urteil lag nicht vor |
rechtskräftiges Urteil lag
nicht vor |
rechtskräftiges
Urteil lag vor _ |
rechtskräftiges Urteil lag vor
_ |
| II.1.1 Umfassendes Aktenstudium (Sachakten,
Vorstrafakten, Gefangenenpersonalakten, Maßregelvollzugsakten) Zur
Rekonstruktion der Ausgangsproblematik sind die Sachakten des zu Grunde
liegenden Verfahrens und ggf. die Akten zu früheren relevanten Strafverfahren
wichtig. Für die Rekonstruktion des Verlaufs seit der Verurteilung
sind die Stellungnahmen der Haftanstalten und Maßregeleinrichtungen
(im Vollstreckungsheft) sowie die Anstaltsakten grundlegend. Zur Einsichtnahme
in diese Akten vgl. B.II.4).
Die wesentlichen, beurteilungsrelevanten Ergebnisse der Aktenauswertung sind im Gutachten schriftlich darzustellen, so dass das Gutachten aus sich heraus verständlich [>543] und auch in seinen Schlussfolgerungen nachvollziehbar wird. |
Aktengrundlage
und die Auswahl der Daten unklar. Insbesondere wurde der Duraplus-Hefter nicht angemes- sen erfasst und beurteilt. Validität nicht
|
Aktenquellen ausgewiesen,
aber nicht die Auswahl der Daten. Insbeson- dere wurde der Duraplus-Hefter nicht angemes- sen erfasst und beurteilt. Validität nicht
|
Aktenquellen ausgewiesen,
aber nicht die Auswahl der Daten. Insbesondere wurde der Duraplus-Hefter nicht angemes- sen erfasst und beurteilt. Validität nicht
|
Aktenquellen ausgewiesen,
aber nicht die Auswahl der Daten. Insbesondere wurde der Duraplus-Hefter nicht angemes- sen erfasst und beurteilt. Validität nicht
|
| II.1.2 Adäquate Untersuchungsbedingungen
Die Exploration sollte unter fachlich akzeptablen Bedingungen durchgeführt werden, bei denen ein diskretes, ungestörtes und konzentriertes Arbeiten möglich ist. _ _ |
Nein. Keine
Vertrauensbasis hergestellt. Nicht pers. expl./ untersucht. |
Nein. Keine
Vertrauensbasis hergestellt. Nicht pers. expl./ untersucht. |
Nein. Keine
Vertrauensbasis hergestellt. Nicht pers. expl./ untersucht. _ |
Ja, im Rahmen
der Möglich- keiten. _ _ _ |
| II.1.3 Angemessene Untersuchungsdauer unter Berücksichtigung
des Schwierigkeitsgrads, ggf. an mehreren Tagen.
Die Exploration ist für den Probanden möglicherweise für Jahre die letzte Chance, seine Person und seine Sicht der Dinge darzustellen. Dafür sollte ihm angemessen Raum gegeben werden. Bei begrenzten Fragestellungen oder bei ausführlichen vorangegangenen Begutachtungen kann ein einziger Untersuchungstermin ausreichend sein. Bei komplexen Fragestellungen und einem bislang unbekannten Probanden wird der Sachverständige schon wegen der Fülle der zu besprechenden Themen (siehe II.1.5) meist mehrere Termine wahrnehmen müssen. |
Keine Vertrauens- basis hergestellt. Nicht
pers. expl./ und untersucht.
Also keinerlei "angemessene" Untersuchungs-
|
Keine Ver-
trauensbasis her- gestellt. Nicht
pers. expl./ und untersucht. Also keinerlei "angemessene" Untersuchungs-
|
Keine Vertrauens- basis hergestellt. Nicht pers. expl./
und untersucht.
Also keinerlei "angemessene" Untersuchungs-
|
Nein, für die Schwierigkeit
zu wenig Zeit aufgewendet, mindestens zwei Tage hätten hier angesetzt werden müssen. _ _ _ _ _ _ _ |
| II.1.4 Mehrdimensionale Untersuchung
a) Entwicklung und gegenwärtiges Bild der Persönlichkeit b) Krankheits- und Störungsanamnese c) Analyse der Delinquenzgeschichte und des Tatbildes. Unter „mehrdimensionaler Untersuchung" ist zu verstehen, dass themenbezogene 3 elementare Bereiche exploriert werden: Person - Krankheit - Delinquenz. Eine Reduktion auf nur 2 oder eines dieser Themen macht das Gutachten insuffizient. Die 3 Bereiche sind im individuellen Lebensverlauf zeitlich und sachlich verzahnt, was im Gespräch oft ein chronologisches Vorgehen nahe legt. Wenn die Prognosebegutachtung die erste forensische Begutachtung des Probanden ist, sollte man sich hinsichtlich der zu erhebenden Informationen an den „Mindestanforderungen für die Schuldfähigkeitsbegutachtung" orientieren. Dies betrifft insbesondere die delikt- und diagnosespezifische Exploration. _ |
a) Nein
b) Nein c) Nein Wenn schon nicht persönl. exploriert und untersucht
|
a) Nein
b) einseitig, un- kritisch, unzulänglich (Datenarmut) c) gar nicht Wenn schon nicht persönl. exploriert und untersucht wurde, wären besondere und aufwändige Informations- beschaffungs- maßnahmen zwingend erforderlich gewesen. _ __ |
a) Nein
b) einseitig, un- kritisch, unzulänglich (Datenarmut) c) gar nicht Wenn schon nicht
|
a) Nein
b) einseitig, un- kritisch, unzulänglich (Datenarmut) c) gar nicht Obwohl der GA
|
II.1.5 Umfassende Erhebung der dafür relevanten
Informationen. Hierzu gehören insbesondere: Herkunftsfamilie,
Ersatzfamilie, Kindheit (Kindergartenalter, Grundschulalter), Schule/Ausbildung/Beruf,
finanzielle Situation, Erkrankungen (allgemein/psychiatrisch), Suchtmittel,
Sexualität, Partnerschaften, Freizeitgestaltung, Lebenszeit-Delinquenz
(evtl. Benennung spezifischer Tatphänomene sowie Progredienz, Gewaltbereitschaft,
Tatmotive etc.), ggf. Vollzugs- und Therapieverlauf, soziale Bezüge,
Lebenseinstellungen, Selbsteinschätzung, Umgang mit Konflikten, Zukunftsperspektive.
Ausführliche Exploration insbesondere in Bezug auf die Lebenszeitdelinquenz
(Delikteinsicht, Opferempathie, Veränderungsprozesse seit letztem
Delikt, Einschätzung von zukünftigen Risiken und deren Management)
Informativ ist eine Wiedergabe der Äußerungen im Gutachten, aus der die Gesprächs- und Argumentationshaltung des Probanden deutlich wird. Die möglichst getreue Dokumentation von Kernaussagen erleichtert es, sie einem späteren Vergleich zugänglich zu machen. |
Nein. Keine Ver- trauensbasis her- gestellt.
Nicht per. expl./untersucht.
Einseitige und unkritische Übernahme der Fremdanamnesen. Das biografische und sachliche Duraplus-Hefter- Material wurde nicht angemessen ausgewählt, ausgeschöpft, dargestellt, unzulänglich und falsch beurteilt. Die Lebenszeit- Delinquenz wurde ignoriert. Auch die Tatmotive wurden nicht erörtert. Lebenseinstellung, Selbsteinschät- zung, Umgang mit Konflikten, Delikteinsicht, Veränderungs- aspekte wurden nicht erörtert. Alternativhypo-
|
Nein. Keine Ver- trauensbasis her- gestellt. Nicht per.
expl./untersucht.
Einseitige und unkritische Übernahme der Fremdanamnesen. Das biografische und sachliche Duraplus-Hefter- Material wurde nicht angemessen ausgewählt, ausgeschöpft, dargestellt, unzulänglich und falsch beurteilt. Die Lebenszeit- Delinquenz wurde ignoriert. Auch die Tatmotive wurden nicht erörtert. Lebenseinstellung, Selbsteinschät- zung, Umgang mit Konflikten, Delikteinsicht, Veränderungs- aspekte wurden nicht erörtert. Alternativhypo-
|
Nein. Keine Ver-
trauensbasis her- gestellt. Nicht per. expl./untersucht.
Einseitige und unkritische Übernahme der Fremdanamnesen. Das biografische und sachliche Duraplus-Hefter- Material wurde nicht angemessen ausgewählt, ausgeschöpft, dargestellt, unzulänglich und falsch beurteilt. Die Lebenszeit- Delinquenz wurde ignoriert. Auch die Tatmotive wurden nicht erörtert. Lebenseinstellung, Selbsteinschät- zung, Umgang mit Konflikten, Delikteinsicht, Veränderungs- aspekte wurden nicht erörtert. Keine eigene
|
Nein, was die Tatzeiträume
und den Wahn (falsche SKID II Anwendung) im Hinblick auf die Tatvorwürfe, die Entwicklung, aktuelle Be- deutung und Zukunftsprog- nose betrifft. Widersprüchliche Verarbeitung der Informationen. Das biografische und sachliche Duraplus-Hefter- Material
wurde nicht angemes- sen ausgewählt,
Die Lebenszeit- Delinquenz wurde ignoriert. Auch die Tatmotive wurden nicht erörtert. Mollath wurde in seinen Anliegen reglementiert. _
|
| II.1.6 Beobachtung des Verhaltens während der Exploration, psychischer Befund, ausführliche Persönlichkeitsbeschreibung. Unverzichtbar im Gutachten ist eine ausführliche und anschauliche Beschreibung des psychischen Ist-Zustandes des Probanden. Der Sachverständige soll das Interaktionsverhalten, die Selbstdarstellungsweisen, die emotionalen Reaktionsweisen, den Denkstil des Probanden in der Untersuchungssituation wahrnehmen, beschreiben und (persönlichkeits-)diagnostisch zuordnen. Es ist also wichtig, sich bald nach den Gesprächen nochmals alle Wahrnehmungen zu vergegenwärtigen und sie sprachlich zu fassen. Bei einem zweiten Untersuchungsgespräch können erste Eindrücke überprüft und eventuell korrigiert werden. Der „Psychische Befund" ist durch die Wiedergabe testpsychologischer Ergebnisse nicht ersetzbar (s. II.1.8). | Beobachtung le- diglich während der
HV am 22.4.4. Keine persönliche Exploration und Untersuchung. Nur
Mutmaßun- gen und eine
ungeeignete Emp- fehlung Ein- weisung zur Beobachtung, aus der keine Befindlichkeit zu den Tatvorhalten gefolgert werden können. _ _ |
Beobachtung ist keine geeignete Methode, Infor- mation
über Befindlichkeiten
zu lange zurück- liegenden Tat- zeiten bereit zu stellen. Befunde unklar, nicht aus Daten nachvollziehbar abgeleitet. Ex- treme Datenarmut. Befundmanipula- tion: Textmontage. Keine pers. Expl. _ _ |
Auf die für ein Prognose- Gutachten "unverzichtbare
Beschreibung des psychischen Ist-Zustandes des Probanden" wurde verzichtet
wie auf die Erzeugung einer tragfähigen Vertrauensbasis,
um eine persönl. Expl. und Untersuchung zu ermöglichen.
_ _ _ |
Zwar wurde persönlich exploriert und untersucht,
aber eine ausführliche und anschauliche Beschreibung des psychischen
Ist-Zustandes
des Probanden", die als "unver- zichtbar" bewertet werden, fand keinen eigenen Abschnitt. _ _ _ _ |
| II.1.7 Überprüfung des Vorhandenseins empirisch gesicherter, kriminologischer und psychiatrischer Risikovariablen, ggf. unter Anwendung geeigneter standardisierter Prognoseinstrumente. Die Informationen aus Aktenstudium und Exploration können mit erfahrungswissen- schaftlich fundierten, standardisierten Instrumenten zur Risikoeinschätzung erfasst und partiell bewertet werden. Diese Instrumente sind zunächst hilfreiche Checklisten, um zu prüfen, ob die Exploration all jene Bereiche erfasst hat, die in vielen Fällen kriminologisch relevant sind. Sie erfassen besonders wichtige und besonders häufige Risikofaktoren. Ein Ende der Entwicklung neuer standardisierter Verfahren ist nicht abzusehen. Insofern ist die Festlegung auf ein bestimmtes Verfahren weder sinnvoll noch notwendig. Das benutzte Verfahren hat aber bereits aus ethischen Gründen vier methodische Mindestanforderungen zu erfüllen: Es muss standardisiert sein, es muss ein Manual zur Erläuterung von Vorgehen, Items und Auswertung existieren, es müssen Daten zur Reliabilität und Validität des Instruments vorliegen. Der Sachverständige muss darin ausgebildet und imstande sein, dieses Verfahren kompetent anzuwenden. Er muss ein korrektes, den Operationalisierungen entsprechendes Verständnis der Items und der Skalierung haben. Prognoseinstrumente ersetzen die hermeneutische oder hypothesengeleitete Individualprognose nicht, helfen aber, empirisches Wissen für die Prognose nutzbar zu machen und die internationalen Prognosestandards einzuhalten. | Eine "Überprü- fung des Vorhan-
denseins empi- risch gesicherter, kriminologischer und psychiatri- scher
Risikova- riablen, ggf. unter Anwendung ge- eigneter standar- disierter
Prognose- instrumente" erfolgte nicht. Infolgedessen konnte auch nicht
befolgt werden:
"Das benutzte Verfahren hat aber bereits aus ethi- schen Gründen vier methodische Mindestanforde- rungen zu erfüllen." Eine "hypothesen-
|
Eine "Überprü- fung des Vorhan-
denseins empi- risch gesicherter, kriminologischer und psychiatri- scher
Risikova- riablen, ggf. unter Anwendung ge- eigneter standar- disierter
Prognose- instrumente" erfolgte nicht. Infolgedessen konnte auch nicht
befolgt werden:
"Das benutzte Verfahren hat aber bereits aus ethi- schen Gründen vier methodische Mindestanforde- rungen zu erfüllen." Eine "hypothesen-
|
Eine "Überprü- fung des Vorhan- denseins empi-
risch gesicherter, kriminologischer und psychiatri- scher Risikova- riablen,
ggf. unter Anwendung ge- eigneter standar- disierter Prognose- instrumente"
erfolgte nicht. Infolgedessen konnte auch nicht befolgt werden:
"Das benutzte Verfahren hat aber bereits aus ethi- schen Gründen vier methodische Mindestanforde- rungen zu erfüllen." Eine "hypothesen-
|
Eine "Überprü- fung des Vorhan- denseins empi-
risch gesicherter, kriminologischer und psychiatri- scher Risikova- riablen,
ggf. unter Anwendung ge- eigneter standar- disierter Prognose- instrumente"
erfolgte nicht. Infolgedessen konnte auch nicht befolgt werden:
"Das benutzte Verfahren hat aber bereits aus ethi- schen Gründen vier methodische Mindestanforde- rungen zu erfüllen. Eine "hypothesen-
|
| II.1.8 - Indikationsgeleitete Durchführung testpsychologischer
Diagnostik unter Beachtung der Validitätsprobleme, die sich aus der
forensischen Situation ergeben.
- Indikationsgeleitete Durchführung geeigneter anderer Zusatzuntersuchungen Testpsychologische Untersuchungen können, wenn sie Antworten auf nachvollziehbare Fragen liefern, nützlich sein, ebenso die Zweitsicht des Probanden durch einen Psychologen. Für Prognosegutachten sind die Eignung und die Validität psychologischer Tests von besonderer Bedeutung und müssen im Gutachten dargelegt werden. Entscheidende, gar objektive Hinweise zur Prognose sind aus testpsychologischen Aktualbefunden nicht ableitbar, insbesondere nicht durch den Abgleich mit testpsychologischen Befunddaten aus dem Erkenntnisverfahren, bei dem sich der Proband in einer ganz anderen psychischen Situation befand. [>542] Andere Zusatzuntersuchungen, z.B. mit bildgebenden Verfahren, sind sehr selten erforderlich und am ehesten angebracht, wenn es eine zwischenzeitlich eingetretene Erkrankung weiter abzuklären gilt (Alkoholfolgeschäden, Unfallschäden). Allein Forschungsinteresse kann solche Zusatzuntersuchungen im Rahmen der Begutachtung nicht begründen. |
Testpsycholo-
gische Untersu- chungen wurden nicht durchge- führt und konn- ten mangels persönlicher Exploration und Untersuchung auch gar nicht durchgeführt werden. Deshalb hätten aber alle anderen Erkenntnisquellen bestmöglich genutzt werden müssen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Testpsycholo-
gische Untersu- chungen wurden nicht durchge- führt und konn- ten mangels persönlicher Exploration und Untersuchung auch gar nicht durchgeführt werden. Dadurch hätten aber alle anderen Erkenntnisquellen bestmöglich genutzt werden müssen.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Testpsycholo-
gische Untersu- chungen wurden nicht durchge- führt und konn- ten mangels persönlicher Exploration und Untersuchung auch gar nicht durchgeführt werden. Dadurch hätten aber alle anderen Erkenntnisquellen bestmöglich genutzt werden müssen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Fasst man den SKID II als testpsycholo-
gische Untersu- chungen auf, so hätten Angaben zu den Güte- kriterien erfolgen müssen. Da das SKID II Ergebnis als Momentauf- nahme vom Un- tersuchungstag anzusehen ist, fehlen Angaben zur Verwertbarkeit für die Prognose. Die fehlende testpsychologi- sche Diagnostik
|
|
rechtskräftiges Urteil vom 13.2.2007 (BGH) Diese Spalte enthält Zitierungen der Mindestanforderungen.... [PDF1] |
22.4.2004 |
25.07.2005 |
27.06.2008 |
12.2.2011 |
| II.2 Diagnose und Differentialdiagnose
Die Erhebung der Informationen wird abgeschlossen mit der Benennung einer möglichst genauen Diagnose (orientiert gegenwärtig an ICD-10 oder DSM-IV-TR), sofern ein forensisch-psychiatrisch zu beschreibender Sachverhalt vorliegt. An dieser Stelle sind auch differentialdiagnostische Optionen zu benennen. Die eingehende Diskussion der Diagnose und der ihr in diesem Fall zu Grunde liegenden Sachverhalte sowie der Differentialdiagnose erfolgt dann hier oder im Rahmen der Beurteilung. Anmerkung RS: Zur Diagnosesicherheit gibt es einen wichtigen BGH-Beschluss. |
Eine genaue Diagnose wird nicht gestellt und schon gar nicht begründet.
Stattdessen werden Vermu- tungen
geäußert.
_ _ _ _ _ _ _ |
Die Erörterungen zur Diagnostik und ihrer Zuord-
nung zu den 4 Eingangsmerk- malen enthalten
13 Unsicherheiten, die nicht die vom BGH verlangte Sicherheit erfüllen. Sie werden sämtlich nicht kausal zu Daten während der Tatzeitpunkte in Beziehung gesetzt _ _ _ |
Die Mutmaßungs- Diagnosen werden nicht differenziert
(Tatzeitraum, Ent- wicklung, Aktuell, Zukunft) nicht kritisch reflektiert
und einfach übernommen, obwohl ein fundiertes Gut-
achten zur Ge- schäftsfähigkeit aus Mainkofen vorliegt, das
we- der eine Psychose noch einen Wahn erkennen kann.
_ _ |
Die Diagnosen zu den Tatzeiträumen werden nicht aufgeklärt. SKID I wird nicht ge- macht, obwohl nö- tig. SKID II. wird gemacht, obwohl nicht notwendig, aber nicht kon- sequent inter- pretiert (keine Wahnzeichen). Insgesamt unzu- länglich und wi- dersprüchlich, auch bei der Allgemeingefähr- lichkeit. |
|
rechtskräftiges Urteil vom 13.2.2007 (BGH) Diese Spalte enthält Zitierungen der Mindestanforderungen.... [PDF1] |
22.4.2004 |
25.07.2005 |
27.06.2008 |
12.2.2011 |
| II.3 Mindestanforderungen bei Abfassung des Gutachtens
Bei diesen von der interdisziplinären Arbeitsgruppe erstellten Mindestanforderungen handelt es sich um Prüfschritte, nach denen der forensische Prognosegutachter gedanklich arbeitet. Für die Verfahrensbeteiligten muss überprüfbar sein, auf welchem Weg und auf welcher wissenschaftlichen Grundlage der Sachverständige zu den von ihm gefundenen Ergebnissen gelangt ist. Die vom Sachverständigen im Einzelfall gewählte Vorgehensweise ist abhängig von der speziellen Beurteilungsproblematik, dem Gewicht des zu beurteilenden Delikts, der Gefahr weiterer erheblicher Straftaten und der sich daraus ableitenden Intensität der Begutachtung. Bei Mehrfachbegutachtungen ist zu beachten, dass es keine schlichte Fortschreibung bisheriger Stellungnahmen geben sollte. _ _ |
Der Weg im ein- zelnen bleibt völlig unklar. Kenntnis
der Akten (wel- cher?) und der persönliche Ein- druck in der HV. Eine persönliche Untersuchung und Exploration wird nicht für notwendig befun- den. Eine quellen- kritische Rezep- tion ist nirgendwo ersichtlich. Die Unsicherheit wird durch die Empfeh- lung zur verfas- sungswidrigen Einweisung belegt. |
Die amorphe
Struktur des GA ohne angemes- sene Gliederung erlaubt keinerlei Nachvollziehbar-
keit "auf welchem Weg und auf welcher wissen- schaftlichen Grundlage der
Sachverständige zu den von ihm gefundenen Er- gebnissen gelangt ist."
Selbst ein Fachmann muss erhebliche Zeit aufwenden, um
die Struktur des GA zu ergründen. Progredienz- sprung. |
Die Empfehlung "Bei Mehrfach- begutachtungen ist zu beachten,
dass es keine schlichte Fort- schreibung bis- heriger Stellung- nahmen
geben sollte" wird igno- riert.
Die Auswahl der für wesentlich erachteten Sach- verhalte bleibt im Dunkeln wie auch das gesamte lo- gisch-methodo- logische Konzept des Beweisfragen- komplexes. |
Die Gliederung
des Gutachtens erleichtert die Nachvollziehbar- keit. Aber, es fällt u.a. auf, dass nor- male und übliche Wege nicht ge- gangen werden, obwohl sie mög- lich gewesen wä- ren: Auf klärung der Befindlichkei- ten zu den Tatzeit- punkten, Zusam- menhang Wahn und Tatvorwürfe, stagnierende - und ohnehin frag- würdige - Progre- dienz und Wahn- entwicklung. |
| II.3.1 Konkretisierung der Gutachtenfrage aus sachverständiger
Sicht, z.B. Rückfall nach Entlassung, Missbrauch einer Lockerung
Zu Beginn der gutachterlichen Schlussfolgerungen ist es sinnvoll, den Kern des Begutachtungsauftrags nochmals zu benennen und die dafür wichtigen Gesichtspunkte zu konkretisieren. Sicherlich macht es einen Unterschied, ob es um Entlassung oder aber Lockerungen geht, ob um die Begehung neuer Straftaten oder Flucht. Es gibt je nach Fragestellung und Fallgestaltung (Deliktsart, psychische Krankheit, Alter etc.) mehr oder weniger umfangreiche erfahrungswissenschaftliche Kriterien. Allemal aber geht es dann im ersten Schritt darum, aus der Rekonstruktion der Vorgeschichte die basale Problematik des Probanden zu analysieren. |
Mündlich, HV.
Obwohl eine unnütze und verfassungs- widrige Ein- weisung zur Beobachtung - wohl auf Grund der extrem dürfti- gen Datenlage empfohlen wird, versteigt sich der GA zu schwerwie- genden Mutma- ßungsdiagnosen. Keine Rekon- struktion. |
Die Empfehlung
"Zu Beginn der gutachterlichen Schlussfolgerun- gen ist es sinn- voll, den Kern des Begutachtungs- auftrags nochmals zu benennen und die dafür wichti- gen Gesichts- punkte zu kon- kretisieren." wird nicht beachtet. Rekonstruktion der Vorgeschichte unzulänglich. |
Die Empfehlung
"Zu Beginn der gutachterlichen Schlussfolgerun- gen ist es sinn- voll, den Kern des Begutachtungs- auftrags nochmals zu benennen und die dafür wichti- gen Gesichts- punkte zu kon- kretisieren." wird nicht beachtet. Rekonstruktion der Vorgeschichte unzulänglich. |
Erfahrungswissen- schaftliche Krite-
rien spezifiziert nach Deliktart und psychischer Krankheit werden nicht erörtert. Der gesamte Zeit- raum (Vor- Entwicklung, Tatzeiträume, Maßregelzeit, Zukunft) in Bezug auf die "basale Problematik" wird nicht aufgeschlüs- selt. |
| II.3.2 Analyse der individuellen Delinquenz, ihrer Hintergründe
und Ursachen (Verhaltensmuster, Einstellungen, Werthaltungen, Motivationen)
Anhand der gewonnenen Erkenntnisse ist als erste Teilaufgabe die Frage zu klären, worin bei dieser Person ihre "in den Taten zutage getretene Gefährlichkeit" besteht, was bei dieser Person die allgemeinen und besonderen Gründe ihrer Straffälligkeit sind. Es geht dabei um die Erfassung der verhaltenswirksamen Einstellungen, Werthaltungen, Motive, Intentionen, emotional-affektiver Reaktionsweisen sowie eingeschliffener Verhaltensmuster. Ausgangspunkt jeder Prognose ist es, die bisherige delinquente Entwicklung dieses Menschen nachzuzeichnen und aufzuklären. Dies umfasst die Rekonstruktion von Biographie und Delinquenzgeschichte und ggf. Krankheitsgeschichte, von Tatablauf und Tathintergründen des Anlassdelikts sowie weiterer bedeutsamer Taten. Auf diese Weise soll eine ganz individuelle Theorie generiert werden, aus welchen Gründen gerade diese Person bislang straffällig geworden ist, was ggf. ihre Straffälligkeit aufrechterhalten und ausgeweitet hat. |
Der elementaren Forderung nach Aufklärung der individuellen Delinquenz wird nicht nachgegan- gen, insbesondere nicht "in den Ta- ten zutage getre- tene Gefährlich- keit", "...die Re- konstruktion von Biographie und Delinquenzge- schichte und ggf. Krankheitsge- schichte, von Tatablauf und Tathintergründen des Anlassdelikts sowie weiterer bedeutsamer Taten." wird nicht geleistet. | Der elementaren Forderung nach Aufklärung der individuellen Delinquenz wird nicht nachgegan- gen, insbesondere nicht "in den Ta- ten zutage getre- tene Gefährlich- keit", "...die Re- konstruktion von Biographie und Delinquenzge- schichte und ggf. Krankheitsge- schichte, von Tatablauf und Tathintergründen des Anlassdelikts sowie weiterer bedeutsamer Taten." wird nicht geleistet. | Der elementaren Forderung nach Aufklärung der individuellen Delinquenz wird nicht nachgegan- gen, insbesondere nicht "in den Ta- ten zutage getre- tene Gefährlich- keit", "...die Re- konstruktion von Biographie und Delinquenzge- schichte und ggf. Krankheitsge- schichte, von Tatablauf und Tathintergründen des Anlassdelikts sowie weiterer bedeutsamer Taten." wird nicht geleistet. | Der elementaren Forderung nach Aufklärung der individuellen
Delinquenz wird
nicht nachgegan- gen, insbesondere nicht "in den Ta- ten zutage getre- tene Gefährlich- keit", "...die Re- konstruktion von Biographie und Delinquenzge- schichte und ggf. Krankheitsge- schichte, von Tatablauf und Tathintergründen des Anlassdelikts sowie weiterer bedeutsamer Taten." wird nicht geleistet. |
| II.3.3 Mehrdimensionale biografisch fundierte Analyse unter
Berücksichtigung der individuellen Risikofaktoren. Auf Grund der
Analyse dieser 3 Dimensionen soll vor dem Hintergrund empirischen Wissens
eine individuelle Theorie generiert werden, wodurch die Straffälligkeit
dieser Person bislang gefördert wurde. Es geht um die persönlichen
und situativen Bedingungsfaktoren der Straftaten und ihre zeitliche Stabilität.
Dabei können die situativen Faktoren hochspezifisch und unwiederholbar
oder aber überdauernd oder allgegenwärtig sein. Es ist also nicht
nur zu erörtern, worin die in den bisherigen Taten zutage getretene
Gefährlichkeit dieser Persönlichkeit bestanden hat, sondern auch,
wie stabil und dauerhaft die der Rückfallgefahr zu Grunde liegenden
Faktoren sind. Hierzu bedarf es der Darlegung der empirischen Erkenntnis
über die jeweiligen Risikofaktoren.
Anhaltspunkte und grobe Risikoeinschätzungen können dazu die standardisierten Instrumente liefern (vgl. oben II.1.7). Unter Bezugnahme auf deren Ergebnisse oder auch das kriminologische und forensisch-psychiatrische Erfahrungswissen ist eine grobe Zuordnung des Falles zu Risikogruppen möglich (in der Regel in Form einer Dreiteilung: hohes - mittleres - niedriges Risiko). Auf dieser Ebene klärbar sind am ehesten Fälle mit gruppenstatistisch belegtem sehr hohem oder sehr niedrigem Risiko. Entscheidend ist aber die Rekonstruktion der Gefährlichkeit und des Rückfallrisikos im Einzelfall, das von dem der Bezugsgruppe erheblich abweichen kann. _
|
Eine "Mehrdimen- sionale biogra- fisch fundierte Analyse
unter Berücksichtigung der individuellen Risikofaktoren" wird nicht
gelei- stet. Es wird nicht einmal das vor- liegende Dura- plus-Material
ausgeschöpft.
Es wird auch keine individuelle Theo- rie entwickelt. Auf die Hilfe standar- disierter Instru- mente hätte man- gels Vertrauens- basis, persönlicher Untersuchung und Exploration nicht gänzlich verzichtet werden müssen. Dabei geht auch die Rekonstruktion der Gefährlichkeit und zeitliche Stabilität völlig unter. Im übrigen hätten zu dem Auftragzeitpunkt auch Alternativ- hypothesen berücksichtigt werden müssen _ |
Eine "Mehrdimen- sionale biogra- fisch fundierte Analyse
unter Berücksichtigung der individuellen Risikofaktoren" wird nicht
gelei- stet. Es wird nicht einmal das vor- liegende Dura- plus-Material
ausgeschöpft.
Es wird auch keine individuelle Theo- rie entwickelt. Auf die Hilfe standar- disierter Instru- mente hätte man- gels Vertrauens- basis, persönlicher Untersuchung und Exploration nicht gänzlich verzichtet werden müssen. Dabei geht auch die Rekonstruktion der Gefährlichkeit und zeitliche Stabilität völlig unter. Im übrigen hätten zu dem Auftragzeitpunkt auch Alternativ- hypothesen berücksichtigt werden müssen _ _ |
Eine "Mehrdimen- sionale biogra- fisch fundierte Analyse
unter Berücksichtigung der individuellen Risikofaktoren" wird nicht
gelei- stet. Es wird nicht einmal das vor- liegende Dura- plus-Material
ausgeschöpft.
Es wird auch keine individuelle Theo- rie entwickelt, was bei einem viel- veröffentlichen- den Professor besonders verwundert. Auf die Hilfe standar- disierter Instru- mente hätte man- gels Vertrauens- basis, persönlicher Untersuchung und Exploration nicht gänzlich verzichtet werden müssen. Dabei geht auch die Rekonstruktion der Gefährlichkeit und zeitliche Stabilität völlig unter. _ _ _ |
Eine "Mehrdimen- sionale biogra- fisch fundierte Analyse
unter Berücksichtigung der individuellen Risikofaktoren" wird nicht
gelei- stet. Es wird nicht einmal das vor- liegende Dura- plus-Material
ausgeschöpft.
Es wird auch keine individuelle Delin- quenz-Theorie entwickelt. Auf die Hilfe standardisierter Instrumente wur- de - bis
auf den unzulänglich angewandten
Widerspruch zwischen Daten- lage und Gefähr- lichkeitsurteil. Im mündlichen GA zeigte sich unzu- längliches Wissen hinsichtlich der Gefährlichkeits- anforderungen. |
| II 3.3 a) deliktspezifisch
Hierher gehört die möglichst genaue Rekonstruktion von Tatablauf und Tathintergründen beim Anlassdelikt sowie bei weiteren bedeutsamen Taten. Die Analyse der Dynamik, die den Anlasstaten zu Grunde lag, ergibt sich aus der speziellen Delinquenzanamnese. |
Deliktspezifische und genaue Re- konstruktionen des Tatablaufs
wie auch die Delinquenzanam- nese fehlen voll- ständig _ |
Deliktspezifische und genaue Re- konstruktionen
des Tatablaufs
wie auch die Delinquenzanam- nese fehlen voll- ständig _ |
Deliktspezifische und genaue Re- konstruktionen des Tatablaufs
wie auch die Delinquenzanam- nese fehlen voll- ständig _ |
Deliktspezifische und genaue Re- konstruktionen des Tatablaufs
wie auch die Delinquenzanam- nese fehlen voll- ständig _ |
| II 3.3 b) krankheits- oder störungsspezifisch
Hier ist zu erläutern, ob und in welcher Ausprägung psychische Störungen, sexuelle Paraphilien oder sonstige Krankheiten aufgetreten sind und wie sie sich auf delinquentes Verhalten ausgewirkt haben. |
Der Zusammen- hang, also die ei- gentliche Beweis- frage zur Schuld- fähigkeit wird nicht erläutert. | Der Zusammen- hang, also die ei- gentliche Beweis- frage zur Schuld- fähigkeit wird nicht erläutert. | Der Zusammen- hang, also die ei- gentliche Beweis- frage zur Schuld- fähigkeit wird nicht erläutert. | Der Zusammen- hang, also die ei- gentliche Beweis- frage zur Schuld- fähigkeit wird nicht erläutert. |
| II 3.3 c) persönlichkeitsspezifisch
Ebenso sind die Persönlichkeitsentwicklung und ihre Bedeutung für kriminelles Verhalten (oder ggf. deren protektive Wirkung) zu überprüfen. _ RS Anmerkung: protektiv heißt hier vorbeugende, vor Rückfällen schützende Wirkung. _ _ |
"die Persönlich- keitsentwicklung und ihre Bedeu- tung für krimi- nelles Verhalten" wurden nicht er- örtert, insbeson- dere auch nicht die protektiven Faktoren Gerech- tigkeits- und Friedenswerte. | "die Persönlich- keitsentwicklung und ihre Bedeu-
tung für krimi- nelles Verhalten" wurden nicht er- örtert, insbeson-
dere auch nicht
die protektiven Faktoren Gerech- tigkeits- und Friedenswerte. |
"die Persönlich- keitsentwicklung und ihre Bedeu-
tung für krimi- nelles Verhalten" wurden nicht er- örtert, insbeson-
dere auch nicht
die protektiven Faktoren Gerech- tigkeits- und Friedenswerte. |
"die Persönlich- keitsentwicklung und ihre Bedeu-
tung für krimi- nelles Verhalten" wurden nicht er- örtert, insbeson-
dere auch nicht
die protektiven Faktoren Gerech- tigkeits- und Friedenswerte. |
| II.3.4 Abgleich mit dem empirischen Wissen über das
Rückfallrisiko möglichst vergleichbarer Tätergruppen
(Aufzeigen von Überstimmungen und Unterschieden)
Der sorgfältig abgeklärte Einzelfall sollte sodann darauf hin geprüft werden, ob er als typisch in eine bekannte Tätergruppe passt, zu der man die wesentlichen Rückfalldaten kennt („Basisraten"). Es gibt einige Tätergruppen (z.B. bei Sexualdelikten, Raubdelikten, Verkehrsdelikten, Drogendelikten), bei denen es bekannte Rückfallquoten gibt, zumindest unspezifische Daten über erneute Bestrafung, manchmal auch Daten zu spezifischer Rückfälligkeit (mit dem gleichen Delikt). In der Regel interessiert den Sachverständigen nicht nur ein Rückfall mit dem gleichen Delikt, sondern mit jedem schweren Delikt. Die gruppenstatistischen Rückfallquoten in sehr vielen Deliktsbereichen liegen im Spektrum von 20 bis 50%. Je mehr Variablen gleichzeitig berücksichtigt werden sollen (z.B. Deliktart, Intelligenz, kultureller Hintergrund, psychische Krankheit oder Substanzmissbrauch), desto seltener gibt es eine passende Vergleichsgruppe mit bekannter [> 545] Basisrate der Rückfälligkeit. Es geht also hier noch nicht um die Entscheidung im Einzelfall, sondern wie im vorangehenden Punkt um eine Verortung des Einzelfalls im kriminologischen Erfahrungsraum. Einen Probanden mit einem gruppenstatistisch niedrigen Rückfallrisiko (z.B. sozial gut eingebundener, sonst nicht straffälliger Ersttäter, nicht gewaltsamer sexueller Missbrauch der 13jährigen Tochter der Partnerin, nicht pädophil, Basisrate unter 10% Rückfallrisiko) wird man vor diesem kriminologischen Erfahrungshintergrund anders diskutieren als einen Probanden, dessen Merkmale gruppenstatistisch auf eine sehr hohe Rückfallwahrscheinlichkeit verweisen. _ |
Aus dem verfas-
sungswidrigen
Einweisungsbe- schluss zur Be- obachtung ergibt sich, dass im Zeitraum HV 22.4.4 der "dringende Tatverdacht" be- stand, die in der Anklageschrift genannten Taten am 12.08.2001, 31.05.2002, 23.11.2002 und die im Strafbefehl genannte Tat am 16.05.2003 began- gen zu haben. Eine differenzierte oder gar hypothe- sengeleitete Be- trachtung erfolgte so wenig wie ein "Abgleich mit dem empirischen Wissen über das Rückfallrisiko möglichst ver- gleichbarer Täter- gruppen". Der Zu- sammenhang zwischen Tatvor- würfen und straf- baren Handlun- gen scheint kei- nerlei Rolle ge- spielt zu haben. |
Ein "Abgleich mit dem empirischen Wissen über das
Rückfallrisiko möglichst ver- gleichbarer Täter- gruppen"
erfolgte nicht.
Basisraten und bekannte Rück- fallquoten wurden gar nicht thema- tisiert. Die vier Delikt- Vorhalte (1) Schlagen, würgen, beißen im Erre- gungszustand 12.8.1, (2) Frei- heitsberaubung 31.5.2, (3) Sach- beschädigung 14.1.5 und (4) Reifenstechen zwischen 18.1.5 bis 1.2.5 wurden auch gar nicht differenziert, ob- wohl vier Delikt- arten nach den Vorwürfen zu unterscheiden wären. (4) scheint erst auf Nachfrage bereit- gestellt worden zu sein. _ |
Ein "Abgleich mit dem empirischen Wissen über das
Rückfallrisiko möglichst ver- gleichbarer Täter- gruppen"
erfolgte nicht.
Basisraten und bekannte Rück- fallquoten wurden gar nicht thema- tisiert. Die vier Delikt- Vorhalte (1) Schlagen, würgen, beißen im Erre- gungszustand 12.8.1, (2) Frei- heitsberaubung 31.5.2, (3) Sach- beschädigung 14.1.5 und (4) Reifenstechen zwischen 18.1.5 bis 1.2.5 wurden auch gar nicht differenziert, ob- wohl vier Delikt- arten nach den Vorwürfen zu unterscheiden wären. _ _ _ _ |
Ein "Abgleich mit dem empirischen Wissen über das
Rückfallrisiko möglichst ver- gleichbarer Täter- gruppen"
erfolgte nicht.
Basisraten und bekannte Rück- fallquoten wurden gar nicht thema- tisiert. Die vier Delikt- Vorhalte (1) Schlagen, wür- gen, beißen im Erregungszu- stand 12.8.1, (2) Freiheitsberau- bung 31.5.2, (3) Sachbeschädi- gung 14.1.5 und (4) Reifenstechen zwischen 18.1.5 bis 1.2.5 wurden auch gar nicht differenziert, ob- wohl vier Delikt- arten nach den Vorwürfen zu unterscheiden wären. _ _ _ _ |
| II.3.5 Darstellung der Persönlichkeitsentwicklung des
Probanden seit der Anlasstat unter besonderer Berücksichtigung der
Risikofaktoren, der protektiven Faktoren, des Behandlungsverlaufs und der
Angemessenheit (Geeignetheit) der angewandten therapeutischen Verfahren
Die 2. Teilaufgabe besteht in der Klärung der Frage, wie der Verlauf seit der Anlasstat aussieht und zu bewerten ist. Die Prüfung der relevanten Entwicklungen in der Zeit seit der Tat erlaubt weitere Aussagen über die Persönlichkeit des Probanden, über mögliche Veränderungsprozesse und sein Veränderungspotential. Sie dient zugleich in gewissem Umfang einer Überprüfung der Theorie über die Persönlichkeitsentwicklung und die Handlungsbereitschaften bis zur Tat. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Risikopotentialen dieser Person und ihrer Veränderbarkeit sowie der Verstärkung protektiver Faktoren. Zu diskutieren ist, wodurch Änderungen bedingt sein mögen, und welche Ressourcen und Möglichkeiten, aber auch Grenzen dabei sichtbar werden. In vielen Fällen ist dies verknüpft mit einer sachkundigen Therapieverlaufs-Beurteilung. Dabei ist nicht nur zu betrachten, was der Proband geleistet hat, sondern auch, ob die angebotenen oder durchgeführten Therapien überhaupt geeignet waren, ihn zu fördern und Delinquenzrisiken zu mindern. Entscheidend ist, ob in der Exploration und im Vollzugsverlauf sichtbar wird, dass die Behandlung gewirkt hat. Es geht nicht um irgendwelche Veränderungen oder sozial erwünschte Fortschritte, sondern um die Abklärung, welche Risikofaktoren deutlich abgeschwächt und welche unverändert sind, ob und welche protektiven Faktoren aufgebaut wurden. Das Gutachten soll aufzeigen, woran man dies konkret erkennen kann. |
Die erste behaup- tete Anlasstat mit "dringendem
Tat- verdacht" soll am 18.8.2001 gewesen sein. Das münd- liche GA
wurde in der HV am 22.4.4 erstattet. Die Entwicklung der
2 Jahre und 8 Monate wurde nach den Aus- führungen im Einweisungsbe- schluss nicht erörtert. Zwar verweigerte Mollath eine persönliche Untersuchung und Exploration, aber auch das Duraplus-Material wurde so wenig ernsthaft und fair berücksichtigt wie Fremdanamnesen von Mollath-Ken- nern oder zwin- gend erforderliche Alternativhypo- thesen. _ _ _ _ _ _ |
Mollath wird seit seiner Internie- rung nur in einer
Art Beugehaft verwahrt und nicht behandelt.
Er hält sich von Anfang für ge- sund und die Forensik hat keine Möglichkeit ge- funden, eine Ver- trauensbasis her- zustellen, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Man will nicht auf ihn eingehen, sondern man will ihn bre- chen. Bayreuth bescheinigt ihm daher regelmäßig, unverändert an seinem "Wahn" festzuhalten, also keinerlei "Ein- sicht" zu zeigen, und deshalb un- vermindert an- haltend allgemein- gefährlich zu sein. Eine sorgfältige "Dastellung der Persönlichkeitsent- wicklung des Pro- banden seit der Anlasstat" findet nicht statt. _ |
Der Berliner Gut- achter kann nur nach Aktenlage, den
Beobachtun- gen und Ein- drücken der Bayreuther Foren- sik nach der
Pfle- gedokumentation. Obwohl er einer der ganz wenigen ist, der sich in
seinen Veröffent- lichungen mit dem Phänomen Ver- neinen der
Tat und der Bedeutung dieser Leugnung für die Prognose auseinandersetzt
und hierbei sogar zu einem positiven Ergebnis kommt ("Leugnen
der Tat kann aber nicht von vornherein als absolutes Hin- dernis für
Locke- rungen, bedingte Entlassung und günstige Krimi- nalprognose
an- gesehen werden.") spielt dieses zentrale Thema im Fall Mollath in seinem
Gutachten gar keine Rolle.
_ |
Der Ulmer Gut-
achter arbei- tete eine ganze Reihe positiver Entwicklungen heraus, die er am Ende überhaupt nicht nachvoll- ziehbar ins Gegen- teil verkehrt, ob- wohl er wie die Forensik selbst feststellt in Bezug auf die "Locke- rungskonferenz vom 02.11.2010 habe man keine von ihm aus- gehende Allge- meingefähr- dung gesehen und keine Flucht- gefahr." Das Problem der Verhätnismäßigkeit wurde auch nicht thematisiert, obwohl höchst- richterlich klar ist, dass die Maßstäbe mit der Dauer der Unterbringung steigen. _ _ _ _ _ _ |
| II.3.6 Auseinandersetzung mit Vorgutachten
Vorgutachter können zur gleichen Schlussfolgerung gekommen sein wie das gegenwärtige Gutachten, sie können aber auch davon abweichen. Mit beidem muss sich der Sachverständige auseinandersetzen. Auch die von den Vorgutachten erhobenen Informationen sind ggf. erneut zu gewichten und ggf. auf ihre Validität zu überprüfen. Abweichende Einschätzungen müssen argumentativ begründet, tatsächliche oder scheinbare Widersprüche geklärt werden. [Kritische Anmerkung II.3.6] _ |
Es lagen zwar kei- ne Gutachten im engeren Sinne vor, aber ärztliche Stellungnahmen: Dr. Reichel (Sohn) vom 14.08.2001 sowie Dr. Krach vom 18.09.2003, die nicht kritisch hinterfragt werden. | Eine kritische Prü- fung der Vorgut- achten und
der Stellungnahmen auf ihre Validität ist nicht ersicht- lich.
_ _ _ _ _ |
Eine kritische Prü- fung der Vorgut- achten und
der Stellungnahmen auf ihre Validität ist nicht ersicht- lich.
_ _ _ _ _ |
Eine kritische Prü- fung der Vorgut- achten und
der Stellungnahmen auf ihre Validität ist nicht ersicht- lich.
_ _ _ _ _ |
| II.3.7 Prognostische Einschätzung des künftigen
Verhaltens und des Rückfallrisikos bzw. des Lockerungsmissbrauchs
unter besonderer Berücksichtigung des sozialen Empfangsraums, der
Steuerungsmöglichkeiten in der Nachsorge und der zu erwartenden belastenden
und stabilisierenden Faktoren (z.B. Arbeit, Partnerschaft)
Die Abklärung der künftigen Lebensperspektiven eines Probanden und des „sozialen Empfangsraums" sind ein weiterer entscheidender Aspekt der Prognosebeurteilung: Dies betrifft nicht nur die subjektiven Zukunftsperspektiven, wie individuelle Wünsche hinsichtlich Arbeit, Partnerschaft, Sexualität, Sport, Freizeit, Kontakte zur Verwandtschaft, zu früheren Freunden und Bekannten, sondern mehr noch die objektiven: Welche Möglichkeiten wird er im Fall einer Entlassung haben hinsichtlich Wohnen, Arbeiten, finanzieller Absicherung, persönlichen Beziehungen, Freizeitaktivitäten, gesundheitlicher Betreuung etc.? Aus der Zusammenführung von individueller Analyse der ursprünglichen Gefährlichkeit, der seitherigen Entwicklung gerade der Risikofaktoren, des erreichten Standes und der objektiven wie subjektiven Zukunftsperspektiven ergibt sich dann die Rückfallprognose, also die Beantwortung der Frage, ob die Gefahr besteht, dass die ursprüngliche Gefährlichkeit in relevantem Umfang fortbesteht. Es ist dies aber eine graduierende Einschätzung der fortbestehenden Risiken. Die Methode besteht darin, die bisherigen Entwicklungslinien, deren Bedeutsamkeit, Stabilität und Bewegungsrichtung sorgsam geprüft wurden, entsprechend ihren analysierten individuellen Gesetzmäßigkeiten in die Zukunft fortzuschreiben. |
Die Frage einer Entlassungs-, Lockerungs- oder Zukunftsprognose
stellt sich hier noch nicht.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Die Prognose wird rundherum negativ bewertet.
Zu den alljährli- chen Stellungnah- men nach § 67e: In der "Locke- rungskonferenz vom 02.11.2010 habe man keine von ihm ausge- hende Allgemein- gefährdung ge- sehen und keine Fluchtgefahr." Der soziale "Emp- fangsraum" mit den vielfältigen Möglichkeiten des Unterstützerkreises durch seine Be- reitstellung von Wohnung, Arbeit, finanzielle Über- brückungshilfen, Beratung, Kontakt, Kommunikation, Orientierungs-, Begleitungs- und Anpassungshil- fen nahezu jeder Art wurden in den alljährlichen Stel- lungnahmen nicht thematisiert oder positiv bewertet. |
Die negative Prognose wird nicht angemessen begründet,
son- dern übernommen und einfach fort- geschrieben. Eine eigene kritische
Abwägung erfolgt nicht.
Der soziale "Emp- fangsraum" mit den vielfältigen
Möglichkeiten des Unterstützerkreises durch seine Be- reitstellung
von Wohnung, Arbeit, finanzielle Über- brückungshilfen, Beratung,
Kontakt, Kommunikation, Orientierungs-, Begleitungs- und Anpassungs-
hilfen nahezu jeder Art wurden nicht thematisiert oder positiv bewertet.
|
In der "Locke- rungskonferenz
vom 02.11.2010 habe man keine von ihm ausge- hende Allgemein- gefährdung
ge- sehen und keine Fluchtgefahr."
Der soziale "Emp- fangsraum" mit den vielfältigen
Möglichkeiten des Unterstützerkrei-
|
| II.3.8 Eingrenzung der Umstände, für welche die
Prognose gelten soll, und Aufzeigen der Maßnahmen, durch welche die
Prognose abgesichert oder verbessert werden kann (Risikomanagement)
Im Fall von Lockerungen läuft die abschließende Antwort auf eine gestufte Risikobewertung hinaus: Wie hoch ist unter welchen Rahmenbedingungen das Risiko eines Lockerungsmissbrauchs, und welche Verstöße sind dann schlimmstenfalls zu erwarten? Im Falle der sog. bedingten Entlassung geht es im Prinzip um eine Ja-Nein-Entscheidung, die das Gericht zu treffen hat und für die das Gutachten erstellt wird: Ist die Gefährlichkeit hinreichend gemindert, so dass im Falle einer Entlassung ein vertretbar niedriges Rückfallrisiko besteht, oder nicht? Das individuelle Rückfallrisiko ist aber modifizierbar durch stützende und kontrollierende Rahmenbedingungen. Eine wesentliche Aufgabe eines Prognosegutachtens ist also die Prüfung und Erörterung der Rahmenbedingungen, unter denen Tendenzen zu einem Rückfall rechtzeitig erkannt, erste Schritte auf diesem Weg verhindert werden können und weitergehende Kriseninterventionen möglich sind. Der Gutachter muss prüfen, ob solche institutionellen Möglichkeiten existieren und ob der Proband für ein solches Setting geeignet ist. Der soziale Empfangsraum - betreute Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten, tagesstrukturierende und psychagogische Maßnahmen, kontrollierte Pharmakotherapie, forensische Fachambulanzen, psychiatrische und psychotherapeutische Weiterbehandlung, gesetzliche Betreuung und die Leistungsfähigkeit des familiären Umfeldes - muss realistisch beurteilt und auf einen zeitlichen Rahmen bezogen werden. Es ist aber auch zu überlegen, welche Situation nach dem Ablauf befristeter Maßnahmen für den Probanden zu erwarten ist." |
Die Frage der Ein- grenzung der Umstände usw.
stellt sich hier noch nicht.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Die Frage der Ein- grenzung der Umstände usw.
stellt sich hier noch nicht, erst in den alljährlichen Stellungnahmen
nach § 67e StGB, wo sie jeweils mit der stereotypen Formel, es habe
sich nicht verän- dert, nicht nach- vollziehbar ver- neint werden.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
Zum Schluss, S. 30f wird wider- sprüchlich und nicht
nachvollzieh- bar ausgeführt: "Zusammen-
fassend ist also festzustellen, dass die in den Taten zutage getretene Gefährlichkeit des Untergebrachten nach wie vor unvermindert ist, da seine Krankheit nicht abgeklungen ist ... In seinem Alltags- verhalten scheint Herr Mollath al- lerdings nicht be- sonders gefährlich zu sein, so dass die Überlegung der Klinik ein- leuchtet, ihn in ein regional zustän- diges Krankenhaus des Maßregelvoll- zuges zu verle- gen." Der soziale Emp- fangsraum wurde,
wie unter II.3.7 schon ausgeführt, gar nicht berück- sichtigt.
|
Obwohl die Ge- fährlichkeit nicht mehr in dem Maße
vorliegt wie einst (In der "Locke- rungskonferenz
vom 02.11.2010 habe man keine von ihm ausge- hende Allgemein- gefährdung
ge- sehen und keine Fluchtgefahr.") werden keine Erwägungen zu
stützenden oder kontrollierenden Rahmenbedin- gungen angestellt.
Der soziale Emp- fangsraum wurde,
wie unter II.3.7 schon ausgeführt, gar nicht berück- sichtigt.
|
Quelle: Boetticher, Kröber, Müller-Isberner, Böhm, Müller-Metz, Wolf: Mindestanforderungen für Prognosegutachten. NStZ 2006 Heft 10, 537- [PDF1, ]
Zum Problem
Gruppenstatistische Kennwerte und Einzelfall bei Prognosen
Hier werden Probleme des einzelfallstatistischen Schließens angesprochen,
die in vielen Prognosegutachten völlig untergehen. Zur Einstimmung
in das Problemfeld ein paar Beispiele.
a) Wenn 17% einer Gruppe Grippe haben, hat dann
ein zufällig herausgegriffenes Gruppenmitglied mit 0.17 Wahrscheinlichkeit
Grippe? Natürlich nicht, denn die 17% sind ein relatives Häufigkeitsmaß
für die Gruppe und nicht für ein Element dieser Gruppe.
b) Sind 2 von 6 Kugeln weiß, so ist die Wahrscheinlichkeit
bei einer Zufallsziehung, eine weiße zu erwischen 2/6. Aber ist nun
die Wahrscheinlichkeit einer Kugel, weiß zu sein, 2/6? Eine gezogene
Kugel wird weiß sein oder nicht. Es gibt keine 2/6 weiße Kugel.
c) Die Wahrscheinlichkeit bei einem 6-schüssigen
Revolver, von dem eine Kammer geladen ist, beträgt nach Rotation der
Trommel 1/6. Beträgt nun beim Abdrücken die Wahrscheinlichkeit,
dass die Kammer mit der Kugel erwischt wird, 1/6? Drückt man ab, gibt
es genau zwei Möglichkeiten: es wird geschossen oder nicht. Es wird
nicht 1/6 geschossen.
d) in einer Stichprobe befinden sich zwei Hochintelligente
(IQ 130), ein durchschnittlich Intelligenter (IQ 100) und ein Minderbegabter
(IQ 80). Bei zufälliger und gleichwahrscheinlicher Ziehung ist die
Wahrscheinlichkeit für jeden 1/4 gezogen zu werden. Wie hoch ist der
IQ eines gleichwahrscheinlich zufällig gezogenen? 110 etwa? Das wäre
ein Wert, der sich gar nicht in der Stichprobe befindet.
e) Das Lebensversicherungsrisiko für einen
nun 45jährigen Mann in Deutschland sei z.B. 34 Jahre bis zum Tod im
statistischen Mittel. Nachdem die Versicherung viele versichert, hat sie
das Einzelfall-Problem nicht.
f) Manche Spieler stellen Wahrscheinlichkeitsüberlegungen
für Spielereignisse an und treffen ihre Einzelfallentscheidung danach,
z.B., ob man beim Doppeln im Backgammon mitmacht oder nicht oder im Skat,
wie die Buben verteilt sind, ob sie beim 17+4 noch eine Karte nehmen oder
nicht ....
Allgemein kann man sagen: Das gruppenstatistische oder
theoretische Risiko ist als Kennwert eine Eigenschaft der Gruppe und nicht
eines seiner Elemente. Fasst man aus der Gruppe der 7 Zahlen 1, 2, 3, 4,
7, 9, 10 die geraden zusammen, so erhält man die Menge {2, 4,10} Diese
Menge ist nun selbst nicht gerade, sie ist auch nicht ungerade. Denn die
Eigenschaften der Elemente gelten nicht für die Menge, jedenfalls
eher selten. Und umgekehrt: die Mächtigkeit der Menge {2, 4, 10} ist
drei, aber die Mächtigkeit von 2, 4 oder 10 ist nicht drei.
Nimmt man allerdings drei Holzklötzchen und fügt diese zusammen,
so kann man sagen, dass das Zusammengefügte auch aus Holz ist. Menge
oder Zusammenfassung und Ganzes oder Zusammengefügtes sind also meist
Unterschiedliches und nicht gleich. Betrachtet man eine Kernfamilie mit
Mutter, Vater und zwei Kindern, so besteht diese Kernfamilie aus vier Elementen.
Die Eigenschaften der Kernfamilie können nicht einfach auf ihre Elemente
und umgekehrt übertragen werden.
Wie ist das nun mit einer Gruppe von, sagen wir,
Gewaltstraftätern mit mindestens einer Verurteilung nicht unter zwei
Jahren, die auf Bewährung vorzeitig entlassen wurden? Nehmen wir an,
diese Gruppe besteht aus 100 Mitgliedern und sie wird 5 Jahre nach Entlassung
nachuntersucht, wie viele Rückfälle es in diesen 5 Jahren gab.
Nehmen wir weiter an, das war bei 17% der Fall, 83% wurden in diesem Zeitraum
also nicht als rückfällig erfasst. Darf man nun sagen, ein beliebig
herausgegriffener aus dieser Gruppe hatte eine Wahrscheinlichkeit von .17,
rückfällig geworden zu sein? Und darf man nun von jedem neuen
Straftäter mit mindestens einer Verurteilung nicht unter zwei Jahren
bei dem die Frage der vorzeitigen Entlassung auf Bewährung ansteht,
annehmen, dass seine Rückfallwahrscheinlichkeit bei 0.17 oder
17% liegt?
Dieser Schluss wird im Alltag, aber auch in der
Wissenschaft ständig angewendet. Einige versuchen diesen Fehlschluss
durch eindrucksvolle Analogien zu "begründen", so etwa Grove und Meehl
(1996) mit ihrer russischen Roulette-Analogie von, die ich im Folgenden
genauer analysieren möchte.
Analyse
der Analogie (Metapher) von Grove und Meehl (1996, pdf)
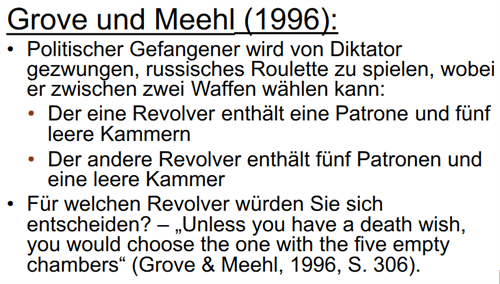
Sekundär-Quelle: Prof. Dr. Martin Rettenberger "Kriminalprognose ..."
Auf den ersten Blick scheint das ein hübsches Beispiel, in
dem sich alle vernünftigen und nicht lebensmüden Menschen klar
für Alternative 1 mit fünf leeren Kammern entscheiden. Es fragt
sich aber, was hat dieses Beispiel mit der Situation einer RichterIn zu
tun, die einen Einzelfall - raus auf Bewährung oder nicht - zu entscheiden
hat? Das soll im Folgenden näher untersucht werden. Schauen wir uns
das Beispiel in verallgemeinerter Form etwas genauer an:
|
Punktwert |
scheinlichkeit |
Rückfall |
|
chance |
Risiko |
i weiße von 6 Kugeln |
Chance weiß |
hungs-Chance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Man sieht, dass das russische Roulette Beispiel dem Urnen-Modell (Laplace) entspricht. Die i weißen Kugeln entsprechen den freien Kammern. Die Überlebenschance bei vier freien Kammern ist bei einem sechsschüssigen Revolver 4/6 und die Ziehungschance bei 2 weißen von 6 Kugeln ist 2/6.
Wer ist wer und welche
Vergleiche sind nach diesen drei Beispielen möglich?
Man kann zwischen den Zeilen vergleichen und innerhalb
einer Zeile. Klar ist, dass RichterIn und Politischer Gefangener in der
Analogie gleich zu setzen sind. Dann stellt sich die Frage, welchen Vergleich
- zwischen den Zeilen oder innerhalb einer
Zeile - repräsentiert die Analogie?
(1) Zwischen den Zeilen heißt, es werden die verschiedenen
Rückfall- und Nicht-Rückfallwahrscheinlichkeiten - analog Überlebenschancen
und Todesrisiken bzw. Ziehungschance und Nicht-Ziehungs-Chance - für
die Gruppen nach unterschiedlichen Punktwerten verglichen.
(2) Innerhalb einer Zeile heißt, es wird die Rückfallwahrscheinlichkeit
mit der Nicht-Rückfallwahrscheinlichkeit (Überlebenschance und
Todesrisiko; Ziehung und Nichtziehung) in einer Gruppe bei einem bestimmten
Punktwert verglichen.
Was
heißt das nun für die Entscheidungssituation der RichterIn?
Die RichterIn muss verschiedene Probleme "lösen", wenn ihr ein
Rückfallwahrscheinlichkeits-Punktwert von einem Sachverständigen
präsentiert wird, nämlich:
- Das grundsätzliche
Validitätsproblem
- PE Persönlicher Eindruck, den der Kandidat in der Verhandlung macht.
- RR Rückfallrisiko, das sich für seine Fallgruppe ergibt.
- BU Beurteilungen, z.B. der Strafanstalt, wie er sich geführt hat.
- DF Positive Veränderungen der Delinquenzfaktoren nach individueller Delinquenztheorie.
- SE Qualität des sozialen Empfangsraumes (z.B. Bezugspersonen, Wohnung, Arbeit).
- X (sonstige ).
Die RichterIn muss zunächst entscheiden, ob sie die Anwendung des Wahrscheinlichkeitsmodells gruppenstatistischer Kennwerte auf den jeweiligen Einzelfall akzeptieren will, also die Risikowerteinordnung des Einzelfalls in die Gruppe. Falls sie das tut, anerkennt sie damit, dass ein geringerer Punktwert in der Norm- und Vergleichsgruppe auch ein geringeres Risiko für ihren aktuellen - neu hinzukommenden - Einzelfall bedeutet.
Das Subsumtionsproblem
Wenn die Grundsatzentscheidung gefallen ist, stellt sich die Frage,
gehört der Kandidat überhaupt zu der Gruppe, für die das
Instrument evaluiert
(bewertet) wurde? Jedes Individuum und damit auch jeder Straftäter
lässt sich allgemein durch m-Merkmale kennzeichnen. Von diesen m Merkmalen
seien k < m die Kriterienmerkmale der Norm- und Vergleichsstichprobe.
Anmerkung-1 Man setzt bei diesen statistischen Schlussformen
- gewöhnlich ohne jede Begründung - voraus, dass die restlichen
Merkmale r = m-k keine Rolle spielen, d.h. also die getroffene Auswahl
an Kriterien relevant ist - ein Problem, auf das ich nur hingewiesen, das
aber hier nicht weiter erörtert und problematisiert wird.
Anmerkung-2 Zusätzlich gibt es das Problem
der Gültigkeit nach längerer Zeit. Im Allgemeinen sind die Risikolisten
vor Jahren oder gar vor Jahrzehnten erstellt worden, so dass fraglich ist,
ob zwischenzeitlich nicht solche Veränderungen eingetreten sind, die
eine Subsumtion nicht mehr - hinreichend sicher - tragen.
Das Risikowert-Problem
Wenn die RichterIn die Validitäts- und Subsumtionsfrage bejaht
hat, muss sie sich als nächstes entscheiden, ob der vorliegende Risiko-Punktwert
für die Entlassung auf Bewährung ein zu berücksichtigender
Faktor ist oder nicht. Das wird sie umso eher tun, je geringer das Rückfallrisiko
ausgeprägt ist. Aber wie passt diese Entscheidungssituation zur Analogie
russisches Roulette? Nehmen wir an, das Rückfallrisiko beträgt
2/6 gegenüber der Nicht-Rückfallrate von 4/6. Ist nun gemeint,
2/6 entspricht zwei Kammern geladen und 4/6 nicht geladen, und er wählt
den kleineren Wert? Die Entscheidungsfrage ist ja: gehört dieser Kandidat
zu den 2/6, die rückfällig werden oder zu den 4/6, die nicht
rückfällig werden? Bei dieser Frage hilft ihm die Analogie des
russischen Roulette-Beispiels nicht.
Das Gesamtentscheidungsproblem
("Gesamtschau")
Rückfallrisikowerte sind für Entscheidungen in der Praxis,
ob auf Bewährung entlassen wird, meist nicht das einzige Kriterium,
wenn es überhaupt den Stellenwert, den manche Prognoseforscher gerne
sähen, einnimmt. Tatsächlich spielen in der richterlichen Praxis
vernünftigerweise mehrere Faktoren eine Rolle, wie es auch Recht und
Gesetz, die forensische Prognoseforschung oder die Mindestanforderungen
für Prognosegutachten nahelegen. Die Entscheidung zur Bewährung
(EzB) wird im Regelfall abhängen von:
Dieses 6-Faktoren-Modell kann man z.B. in folgender Formel verdichten:
EzB
= f (PE, RR, BU, DF, SE, X).
Zur Methodik der aktuarisch-statistischen Methode im Überblicksverlauf
Die aktuarisch-statistische Methode in der forensischen Prognostik geht wie folgt vor und hat dabei folgende Probleme zu lösen:
- Es werden - am Anfang heuristisch - Kriterien in den Biographien von Straftätern gesucht, die sich zur Rückfallprognose vermutlich (Hypothese) eignen, was sich überprüfen lässt.
- Diesen Kriterien werden, je nachdem ob oder wie sehr sie erfüllt sind, Zahlenwerte zugeordnet (scoriert), z.B. 0 wenn das Kriterium nicht erfüllt ist oder 1, wenn es erfüllt ist bzw. eine höhere Zahl, wenn dem Kriterium ein besonderes Gewicht beigemessen wird, z.B. die Anzahl der Vorstrafen. Hierbei ist die Polung der Sachverhalte zu beachten. Solche Gewichte können auch erst nach Erhebung der Daten statistisch errechnet werden, z.B. mit Hilfe einer Diskriminanzanalyse.
- Aus den den Kriterien zugeordneten Zahlenwerten wird meist die Summe gebildet (Summenscore > Summen-Score-Funktion), wobei ein höherer Zahlenwert einem höheren Rückfallrisiko entsprechen soll.
- Nun vergleicht man bei einer Gruppe von Straftätern z.B. 3, 5, 10 oder n Jahre nach der Entlassung, wie viele von diesen rückfällig wurden und schaut zugleich, wie viele bei diesem und jenen Summenwert (Summenscore) rückfällig wurden.
- In der späteren Anwendung auf neue, nicht in der ursprünglichen Stichprobe enthaltenen Fälle, müssen zwei Probleme gelöst werden: (1) das Subsumtionsproblem: kann der zu entscheidende Fall in eine vorliegende Norm- und Vergleichsstichprobe eingeordnet werden?
- Falls die Subsumtionsfrage positiv beantwortet werden kann, dass der Einzelfall zu dieser Risikogruppe gehört, stellt sich schließlich (2) die Grundsatzfrage: Wie lässt sich begründen, dass der gruppenstatistische Kennwert der Norm- und Vergleichsstichprobe auf den Einzelfallkennwert angewendet werden darf, also warum sollte er für ihn gelten?
Anmerkung: Die aktuarische-statistische Methode
ist sehr ökonmosch, wenn sie einmal ausgegearbeitet und evaluiert
wurde.
Verneinen der Tatvorwürfe
Abstreiten, verneinen oder leugnen der Tatvorwürfe komplizieren je nach Verfahrensverlauf und -fortschritt die Beurteilung. Schon deshalb, weil unklar ist, ob bzw. in welcher Weise die Tatvorwürfe der Anklage oder in noch nicht rechtskräftigen Urteilen als Anknüpfungstatsachen verwendet werden dürfen, sollen, müssen oder nicht. Solche Unklarheiten sind mit einem menschenrechtsverpflichteten Recht nicht vereinbar (> Schuld- bzw. Tatinterlokut).
13.01.15 Inzwischen haben die forensischen Forschungsergebnisse von Endres (2014) den überraschenden Befund zu Tage gefördert, dass Leugnen der Tat bei Straftätern in der Sozialtherapie keine Auswirkungen auf die Rückfallgefährdung hat.
Zu dem Problemkreis verneinen der Tatvorwürfe und ihrer Bedeutung äußert sich Kröber 2006 und 2010:
Leugnen
der Tat in der prognostischen Begutachtung nach Kröber,
H-L (2010).
S.32: „Zusammenfassung Der Auseinandersetzung eines Verurteilten mit
der eigenen Straftat wird seitens der Justiz und vieler Gutachter ein großes
kriminalprognostisches Gewicht beigemessen. Dabei haben vermutlich andere
Einflussfaktoren wie allgemeine Dissozialität, die Struktur des sozialen
Empfangsraumes, aber auch personale Kernkompetenzen des Verurteilten eine
größere Bedeutung für die Legalbewährung. Die eigene
Stellungnahme zur Tat kann allerdings ein wichtiger Knotenpunkt sein, aus
der sich die Einstellungen und Lebensanschauungen eines Verurteilten erkennen
lassen. Insofern kann sie ein wichtiges Lernfeld sein zur kognitiven Umstrukturierung.
Allerdings ist die Tatbearbeitung nicht die einzige Möglichkeit, und
auch Tatleugnung muss kein zwingendes Hindernis für Lockerungen und
Entlassung sein. Es kommt darauf an, ob die Tatleugnung verdeutlicht, dass
der Insasse Straftaten als seine Privatangelegenheit verhandelt und einer
normativen Erörterung entzieht, oder ob in der Verleugnung primär
Scham und ein letztlich prosoziales Konzept deutlich werden.“
Bedeutung
Leugnung der Tat für die Prognose nach Kröber
(2006) im HBFP3
S. 119f: "Leugnen der Tat kann aber nicht von vorneherein als absolutes
Hindernis für Lockerungen, bedingte Entlassung und günstige Kriminalprognose
angesehen werden. Zum einen kann es für Probanden unabhängig
von der Tatbearbeitung gute Gründe geben, nicht mehr straffällig
zu werden: Wenn es sich einfach nicht mehr rechnet, weil der Ertrag zu
gering und das Entdeckungsrisiko zu groß geworden ist (z. B. Räuber,
Betrüger). Zum anderen kann das Leugnen in Einzelfällen eben
auch Ausdruck einer massiven Scham sein, die impliziert, dass der Täter
künftighin alles meiden will, was ihn wieder in die Nähe einer
Tatsituation bringen könnte. Es sind dies oft Täter, die andere,
weniger beschämende Taten zu gestehen stets bereit waren, die sich
aber dieses spezielle Versagen nicht verzeihen können und es nach
außen nicht eingestehen können. Wenn allerdings bei dieser Form
des Leugnens ein ganzer Bereich, z.B. eine deviante Sexualität, global
der therapeutischen Bearbeitung oder zumindest der diagnostischen Überprüfung
entzogen wird, wenn also z. B. alle Gewaltdelikte mit sexueller Motivation
verleugnet werden, muss festgehalten werden, dass ein virulenter Risikobereich
offenbar unbearbeitet geblieben ist und vor einer Auseinandersetzung bewahrt
wird; dies ist prognostisch ungut. Der Gutachter soll allerdings
nicht beurteilen, ob aus dem Gefangenen nun ein anständiger, gar sympathischer
Mensch geworden ist. Auch ein unsympathischer und in seiner Persönlichkeitsartung
weiterhin problematischer Mensch mag strafrechtlich eine gute Prognose
haben."
Kritische Anmerkung: Obwohl Kröber das Problem als einer der wenigen in seinen Veröffentlichungen anspricht, hat das doch keinerlei Folgen für sein Gutachten. Auch hier bestätigt sich wieder, dass Kröber zwar informative Veröffentlichungen (z.B. auch) bringt, aber, zumindest im Fall Mollath, ohne jede praktische Bedeutung und Konsequenz.
Dauer der Unterbringung
Maier Münchener Kommentar zum StGB § 67 Reihenfolge der Vollstreckung , 1. Auflage 2005, § 67d Dauer der Unterbringung:
"bb) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Randnummer 21 Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
beherrscht Anordnung und Fortdauer der Unterbringung. [FN55]
Die daraus abzuleitende Notwendigkeit, Sicherungsbelange der Allgemeinheit
und Freiheitsanspruch des Untergebrachten im Einzelfall gegen einander
abzuwägen und die Gefährdung der Allgemeinheit zur Dauer des
erlittenen Freiheitsentzugs in Beziehung zu setzen, [FN56]
verändert in der Konsequenz bei langdauerndem Freiheitsentzug die
Anforderungen an das die Fortdauer rechtfertigende Risiko. [FN57]
Je länger die Unterbringung andauert, umso strenger werden die Voraussetzungen
für die Verhältnismäßigkeit des Freiheitsentzugs nach
Bedeutung und Wahrscheinlichkeit
der drohenden Taten. [FN58] In die Abwägung
auch die Behandlungsfähigkeit einfließen zu lassen, [FN59]
erscheint bei sowohl sichernden wie bessernden Maßregeln nicht unproblematisch.
Strafrahmen der verwirklichten oder drohenden Delikte geben wegen ihrer
schuldbezogenen Funktion kaum einen geeigneten Anhalt der für welches
Risiko hinzunehmenden Unterbringungsdauer. [FN60]."
Randnummer 22 In der Rechtsprechungspraxis wirkt sich die Risikoverschiebung nach langdauerndem Freiheitsentzug [FN61] im Bereich geringerer oder mittlerer Kriminalität, namentlich von Eigentums- und Vermögensdelikten [FN62] aus. Das Erfordernis, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerade auch bei Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus in die Prüfung der „Aussetzungsreife" der Maßregel [FN63] einzubeziehen, wird durch den neu geschaffenen Abs. 6 nicht aufgehoben. Im Einzelfall kann eine Aussetzung, aber auch eine Erledigung der Unterbringung geboten sein (vgl. Rn 31 f). Für die Sicherungsverwahrung ist dem Grundsatz mit den Anforderungen an eine mehr als zehnjährige Unterbringung (Abs. 3) wohl weitgehend [FN64] Rechnung getragen.
Fussnoten Rn 21-22
FN55 BVerfG (Fn 39) BVerfGE 70, 297
(311); OLG Celle v. 4. 4. 1989 – 1 Ws 65/89, NStZ 1989, 491.
FN56 BVerfG (Fn 39) BVerfGE 70, 297
(311 f.).
FN57 SK/Horn Rn 12; NK/Böllinger
Rn 33; ebenso schon LK/Horstkotte, 10. Aufl., Rn 59; Anwendungsbeispiele:
KG (Fn 32); OLG Koblenz (Fn 5); OLG Nürnberg (Fn 32).
FN58 BVerfG (Fn 39) BVerfGE 70, 297
(315) = NJW 1986, 767 (770); neuerdings BVerfG (Fn 1) NJW 2004, 739 (742).
FN59 BVerfG (Fn 39) BVerfGE 70, 297
(318) = NJW 1986, 767 (770); BVerfG v. 10. 10. 2003 (Fn 53), NStZ-RR 2004,
76 (78); vgl. auch Kruis StV 1998, 94 (97); skeptisch LK/Horstkotte, 10.
Aufl., Rn 54.
FN60 Anders LK/Horstkotte, 10. Aufl.,
Rn 64; NK/Böllinger Rn 6; Streng, FS Lampe, 2003, S. 628 mwN; Dessecker,
Gefährlichkeit und Verhältnismäßigkeit, 2004, S. 356
ff.; erwägend BVerfG (Fn 39) BVerfGE 70, 297 (316) = NJW 1986, 767
(770); BVerfG v. 6. 4. 1995 – 2 BvR 1087/94 (Fn 53); OLG Karlsruhe (Fn
39); wie hier relativierend Theyssen (Fn 53) S. 407 (422).
FN61 BVerfG (Fn 39): 9 Jahre; BVerfG
v. 27. 6. 1992 – 2 BvR 436/92 (Fn 53): 9 Jahre; BVerfG v. 6. 4. 1995 –
2 BvR 1087/94 (Fn 53): 24 Jahre; OLG Celle (Fn 40): 18 Jahre; OLG Celle
(Fn 55): 10 Jahre; OLG Karlsruhe (Fn 39): 13 Jahre; OLG Karlsruhe v. 18.
12. 1998 – 2 Ws 295/98, StV 2000, 268 (269): 8 Jahre.
FN62 BVerfG (Fn 39); OLG Karlsruhe
(Fn 39 und 61); vgl. andererseits OLG Hamburg v. 15. 11. 1999 – 3 Ws 10/99
(zu Recht Fortdauer der Unterbringung bei Gefahr der Zerstörung unersetzlicher
Kunstschätze).
FN63 BVerfG (Fn 39) BVerfGE 70, 297
(312); BVerfG v. 10. 10. 2003 (Fn 53).
FN64 Vgl. BVerfG (Fn 1) NJW 2004,
739 (742); vgl. aber OLG Karlsruhe (Fn 61): Erledigungserklärung bei
einem schwer herzkranken 64-jährigen Einbrecher, der insgesamt bereits
20 Jahre Freiheitsstrafe verbüßt hatte, nach über 8 Jahren
Sicherungsverwahrung.
c) Beurteilungsfaktoren.
Randnummer 23 In die Prognosebeurteilung fließen naturgemäß
sämtliche Faktoren ein, die auch schon bei der Anordnung (§ 63
Rn 43, § 64 Rn 47, § 66 Rn 132, 137 ff.) und bei der Aussetzungsentscheidung
gem. § 67 b (Rn 14–19) zu beachten sind. Besondere Bedeutung erlangt
der therapeutische Erfolg, [FN65] der nicht mit
guter Führung verwechselt werden darf, [FN66]
insbesondere auch nicht bei Sexualstraftätern. [FN67]
Leugnen einer Tat begründet als solches keine negative Prognose [FN68].
Fehlt es deshalb an einer Aufarbeitung der Tat, bleibt die Prognose aber
ggf. durch die im Urteil festgestellte(n) Tat(en) negativ dominiert. [FN69]
Dies setzt allerdings voraus, dass sich auch nicht aus anderen Umständen,
die mit längerer Vollzugsdauer an Bedeutung gewinnen, wie dem Vollzugsverhalten,
der Persönlichkeitsentwicklung oder einem veränderten sozialen
Empfangsraum, [FN70] eine günstige Prognose
herleiten lässt. [FN71] Die Bewährung unter
Vollzugslockerungen dürfte häufig eine notwendige Voraussetzung
der Aussetzungsentscheidung sein. [FN72] Bei
der prognostischen Bewertung sind ggf. aber die unterschiedlichen Anforderungen
der Bewährung unter Lockerungsbedingungen gegenüber der Bewährung
in Freiheit zu beachten. [FN73] Das gilt generell
für die Relevanz des Vollzugsverhaltens, auch des negativen. [FN74]
Soll die ausreichend günstige Prognose insbesondere mit dem Instrumentarium
der Nachbetreuung begründet werden, kommt deren Qualität und
Intensität besondere Bedeutung zu. zur Fussnote [FN75]
Fussnoten Rn 23
FN65 Vgl. schon OLG Köln v. 16.
10. 1970 – 2 Ws 724/70, MDR 1971, 154; Lackner/Kühl Rn 4; Tröndle/Fischer
Rn 6 b; LK/Horstkotte, 10. Aufl., Rn 36; zur Therapieverweigerung vgl.
auch KG v. 7. 5. 2001 – 1 AR 43/01–5 Ws 23/01.
FN66 Vgl. OLG Celle v. 21. 4. 1970
– 1 Ws 78/70, NJW 1970, 1200; Nedopil NStZ 2002, 344 (349); Lackner/Kühl
Rn 4; Tröndle/Fischer Rn 6 b.
FN67 Vgl. hierzu Tröndle/Fischer
Rn 6 b.
FN68 Vgl. (zu § 57) BVerfG v.
22. 3. 1998 – 2 BvR 77/97, NJW 1998, 2202 (2204); OLG Saarbrücken
v. 17. 8. 1998 – 1 Ws 155/98, NJW 1999, 438 (439); OLG Koblenz v. 6. 8.
1997 – 1 Ws 155/98, NStZ-RR 1998, 9; OLG Frankfurt aM v. 11. 3. 1999 –
3 Ws 218/99, NStZ-RR 1999, 346 (347); OLG Hamm v. 12. 2. 1988 – 2 Ws 26/88,
StV 1988, 348; ausführlich zu unterschiedlichen Leugnungskonstellationen
und deren prognostischer Bedeutung Bock/Schneider NStZ 2003, 337 (340).
FN69 Deutlich OLG Frankfurt aM (Fn
68); KG (Fn 52).
FN70 Vgl. BVerfG v. 24. 10. 1999 –
2 BvR 1538/99, NJW 2000, 502 (zu § 57); OLG Frankfurt aM (Fn 40);
zu den genannten Faktoren zuletzt BVerfG v. 10. 2. 2004 – 2 BvR 834/02
u. 1588/02, NJW 2004, 750 (754); ausführlich Müller-Metz StV
2003, 42 (50).
FN71 Vgl. OLG Saarbrücken (Fn
68); OLG Koblenz (Fn 68); KG v. 29. 11. 2001 – 1 AR 1196/01 – 5 Ws 646/01
(insbes. zum Verlust eines durch Übung erworbenen kriminellen Hangs
während langjähriger Sicherungsverwahrung).
FN72 BVerfG (Fn 68) NJW 1998, 2202
(2203); BVerfG (Fn 1) NJW 2004, 739 (744); OLG Koblenz (Fn 68); OLG Frankfurt
aM (Fn 40), NStZ-RR 2001, 311 (312, zu Ausnahmen: 313); KG (Fn 71); Nedopil
NStZ 2002, 344 (349); Streng (Fn 60) S. 627. Zum Urlaub als „Vorstufe?
der Entlassung auch OLG Hamm v. 15. 4. 1987 – 2 Ws 191/87, StV 1988, 115
(116), m. krit. Anm. Pollähne (zur Gefahr der Ersetzung gebotener
Aussetzung durch bloße Beurlaubung).
FN73 Anschaulich OLG Frankfurt aM
(Fn 40) NStZ-RR 2001, 311 (315); Frisch ZStW 102 (1990), 707 (776 ff.).
FN74 Vgl. BVerfG (Fn 70) NJW 2004,
750 (758 f.); Calliess ZfStrVo 2004, 135 (137).
FN75 KG v. 4. 1. 2001 – 1 AR 1529/00
– 5 Ws 825/00; LG Marburg v. 28. 3. 2000 – StVK 185/00, R & P 2000,
205; ausführlich abwägend zu den Möglichkeiten der Einwirkung
durch Betreuung und Medikamentation OLG Koblenz (Fn 5); zu vormundschaftlich
veranlasster Unterbringung vgl. bereits OLG Düsseldorf v. 26. 3. 1979
– 5 Ws 28/79, JMBlNW 1979, 167; vgl. auch § 67 b Rn 16.
Literatur und Links (Auswahl)
- Boetticher, Axel; Kröber, Hans-Ludwig; Müller-Isberner, Rüdiger; Böhm, Klaus M.; Müller-Metz, Reinhard & Wolf, Thomas (2006): Mindestanforderungen für Prognosegutachten. NStZ, 537-545. [PDF]
- Dahle, Klaus- Peter (2005). Psychologische Kriminalprognose. Wege zu einer integrativen Methodik für die Beurteilung der Rückfallwahrscheinlichkeit bei Strafgefangenen. In: Lösel, Friedrich; Rehn, Gerhard & Walter, Michael: (2005, Hrsg.). Studien und Materialien zum Straf- und Maßregelvollzug", Band 23.
- Dahle, K.-P. (2006). Grundlagen und Methoden der Kriminalprognose. In H.-L. Kröber, D. Dölling, N. Leygraf & H. Saß (Hrsg.), Handbuch der forensischen Psychiatrie; Band 3, Psychiatrische Kriminalprognose und Kriminaltherapie (S.1-67). Stuttgart: Steinkopff.
- Dahle, K.-P. (2007). Methodische Grundlagen der Kriminalprognose. Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie, 1, 101-110 [Zusammenfassung]
- Gretenkord, L. (2001). Empirisch fundierte Prognosestellung im Maßregelvollzug nach § 63 StGB - EFP-63. Bonn: Deutscher Psychologen Verlag. [Online]
- Gretenkord, Lutz (Abruf 17.6.12 ): Empirisch fundierte Prognosestellung im Maßregelvollzug nach § 63 StGB (EFP-63).
- Köller, Norbert; Nissen, Kai; Rieß, Michael & Sadorf, Erwin (2004) Probabilistische Schlussfolgerungen in Schriftgutachten. Zur Begründung und Vereinheitlichung von Wahrscheinlichkeitsaussagen im Sachverständigengutachten. München: Luchterhand & Bundeskriminalamt (BKA).
- König, Andrej (2010) Der Nutzen standardisierter Risikoprognoseinstrumente für Einzelfallentscheidungen in der forensischen Praxis. Recht und Psychiatrie (R&P), 28, 67-73.
- Konrad, Norbert (2010). Schlechtachten trotz Einhaltung der »Mindestanforderungen an Prognosegutachten« Recht und Psychiatrie, 28,1,.
- Kröber, Hans-Ludwig (1999). Gang und Gesichtspunkte der kriminalprognostischen psychiatrischen Begutachtung. NStZ, 593.
- Kröber, H.-L.; Dölling, D.; Leygraf, N. & Saß, H. (2006, Hrsg.). Handbuch der Forensischen Psychiatrie. Band 3 Psychiatrische Kriminalprognose und Kriminaltherapie. Berlin: Steinkopff (Springer).
- Müller, Henning-Ernst (2011) „Oberflächlich charmant”, tendenziell gefährlich? - Die Psychopathy-Checklist Revised (PCL-R) von Robert Hare NStZ 2011, 665. Sie auch Vortrag zum 3. Tag der Rechtspsychologie am 17.11.2012 in Bonn: PDF-Download.
- Nedopil, Norbert (1996). Forensische Psychiatrie. Klinik, Begutachtung, Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht. Unter Mitarbeit von Dittmann, V.; Freisleder, F.-J. & Haller, R. Stuttgart: Thieme.
- Nedopil N.; Groß, Gregor; Hollweg, Matthias; Stadtland, Cornelis; Stübner, Susanne & Wolf, Thomas. (2005). Prognosen in der forensischen Psychiatrie - ein Handbuch für die Praxis. Lengerich: Pabst Science Publisher.
- Nedopil, N. (2008). Schuldfähigkeitsbeurteilung und forensisch-psychiatrische Risikoeinschätzung bei Persönlichkeitsstörungen. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 56, 89-100.
- Nedopil N, Stadtland C. (2006). Rückfallforschung und Prognosen in der Forensischen Psychiatrie. Werkstattschriften für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie. 13: 7-27.
- Nedopil, N. (2007). Das Problem der falsch Positiven: Haben wir unsere prognostische Kompetenz seit 1966 verbessert? In F. Lösel, D. Bender & J.-M. Jehle (Hrsg.), Kriminologie und wissensbasierte Kriminalpolitik. Entwicklungs- und Evaluationsforschung (S. 541 - 550). Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg. [GB]
- Nedopil N, Stadtland C. (2006). Methodenprobleme der forensisch-psychopathologischen Prognosebeurteilung. In Schneider F. (Hrsg.), Entwicklungen in der Psychiatrie (S. 361-374). Heidelberg: Springer.
- Nedopil, N. (2009). Psychopathy und die Rückfallprognose für Gewalttaten. Neuropsychiatrie, 23(S1), 34 - 41.
- Pollähne, Helmut (2011). Kriminalprognostik: Untersuchungen Im Spannungsfeld zwischen Sicherheitsrecht und Rechtssicherheit. Berlin: DeGruyter. [Amaz] [GB]
- Rehn, Gerhard; Wischka, Bernd; Lösel, Friedrich & Walter, Michael (2001, Hrsg.) Behandlung "gefährlicher Straftäter". Grundlagen, Konzepte, Ergebnisse. 2.A. Hervolzheim: Centaurus.
- Rettenberger, Martin & Franqué, Fritjof von (2013, Hrsg.) Handbuch kriminalprognostischer Verfahren. Göttingen: Hogrefe.
- Rieger, M., Stadtland, C., Freisleder, F.J. & Nedopil, N. (2009). Psychiatrische Beurteilung des Gewaltrisikos im Jugendalter. Der Nervenarzt, 80(3), 295-304.
- Riegl, Maximilian (2007). Die Qualität forensischer Prognosegutachten bei Gewalt und Sexualstraftätern. Diplomarbeit eingereicht am Institut für Psychologie der Universität Freiburg.
- Tondorf, G. (2005). Die konkreten Mindestanforderungen in Psychogutachten. In (S. 135): Psychologische und psychiatrische Sachverständige im Strafverfahren: Verteidigung bei Schuldfähigkeits- und Prognosebeurteilung, 2. Aufl.. Heidelberg: C.F. Müller.[GB]
- Tondorf, G. & B. (2011) Psychologische und psychiatrische Sachverständige im Strafverfahren: Verteidigung bei Schuldfähigkeits- und Prognosebeurteilung. 3. neu bearb. A. Heidelberg: C.F. Müller.
- Volckart, Bernd (1997) Praxis der Kriminalprognose. Methodologie und Rechtsanwendung. München: Beck.
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
___
Stichworte: Anforderungen an Prognose Gutachten OLG Rostock * AUC * cut-off * Falsches Datum im Pfäfflin Gutachten * HCR-20 * HV * ILRV * Konrad zu Schlechtachten, die die Mindestanforderungen erfüllen * Kritische Anmerkung II.3.6 * Kröber zum Simmerl-GA * NPP * Objektivität, Reliabilität und Validität * Operationalisierung * PCL-R * ROC-Kurve * RRS * Sensitivität * Spezifität * Validitätskriterien der Prognostik * Wahrscheinlichkeitsbegriffe und Prognose * Zusammenfassung Dahle (2007) *
__
Anforderungen an das Prognosegutachten OLG Rostock: Beschluss vom 16.11.2011 - I Ws 287/11
"Überprüfung der Notwendigkeit des weiteren Maßregelvollzugs; hier: Anforderungen an das Prognosegutachten
3. Eine Entscheidung über die weitere Fortdauer der Unterbringung ist derzeit nicht möglich, da die Gutachten des externen Sachverständigen Dr. F. vom 15.08.2005 und 09.05.2008 nicht den Anforderungen an ein Prognosegutachten genügen. Gleiches gilt für die Stellungnahmen der Klinik.
a) Das schriftliche Gutachten Dr. F. vom 15.08.2005 umfasst 88 Seiten. Beauftragt wurde der Sachverständige durch Beschluss der Strafvollstreckungskammer vom 18.03.2005. In dem Beschluss wurde nicht nach einer Störung im Sinne der §§ 20, 21 StGB gefragt, sondern die Gefährlichkeitsprognose in den Vordergrund gestellt.
Der Sachverständige fasste auf den ersten 74 Seiten seines schriftlichen Gutachtens in den Gliederungspunkten I.-III. den Akteninhalt sowie die Exploration zusammen. Der Gliederungspunkt IV. ist mit „Beurteilung“ überschrieben, bis Seite 83 des Gutachtens fasste der Sachverständige dort aber wiederum nur die Ergebnisse der Vorbegutachtungen und der Exploration zusammen. Auf Seite 84 und 85 legte der Sachverständige sodann seine eigene diagnostische Einschätzung dar. Letztlich schloss sich der Sachverständige ohne transparente Begründung den früheren Feststellungen an und teilte mit, dass davon auszugehen sei, dass bei dem Untergebrachten eine gemischte Persönlichkeitsstörung mit schizoiden und abhängigen Anteilen sowie mit dekompensatorisch aktuellen perversen Reaktionen mit pädophilem und exhibitionistischem Gepräge vorliege. Ferner führte er aus, dass die in den Straftaten zutage getretenen Neigungen zu perversen Reaktionen mit exhibitionistisch-pädophilen Gepräge besonders problematisch seien, da impulshaft aus einer akuten Verstimmung heraus agiert werde ohne persönliche oder individuelle Beziehungen zum Opfer. Der Sachverständige erläuterte in keiner Weise seine Untersuchungsmethoden und die wissenschaftlichen Grundlage seiner Einschätzung. Eine nachvollziehbar auf wissenschaftliche Erkenntnisse oder wenigstens auf eigene praktische Erfahrungen gestützte konkrete Prognosebeurteilung gab er nicht ab, sondern führte nur weiter aus, dass gewisse Fortschritte im Rahmen der Therapie hätten erzielt werden können, ohne weitere Therapie und Erprobung eine Entlassung aber nicht empfohlen werden könne. Abschließend führte er zur statistischen Rückfallwahrscheinlichkeit aus, dass diese für den Untergebrachten nicht konkret eingeschätzt werden könne, da der Betroffene nicht eindeutig in eine Sexualstraftätergruppe eingeordnet werden könne.
Das Gutachten ist in dieser Form nur bedingt brauchbar, da die Methodik und deren wissenschaftliche Grundlage nicht erläutert wurden. Die Prognosebeurteilung ist zudem sehr vage gehalten. Klare Aussagen zu Art und Umfang der Einschränkung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Untergebrachten fehlen.
b) Das weitere Gutachten des Dr. F. vom 09.05.2008 leidet an ähnlichen Mängeln. Auf den ersten 43 von insgesamt 45 Seiten wurden der weitere Behandlungsverlauf, die erneute Exploration und die Stellungnahmen der Klinik dargestellt. Herausgearbeitet wurde, dass der Untergebrachte bei der neuerlichen Exploration angegeben habe, dass er bei der letzten Exploration 2005 bewusst falsche Angaben gemacht habe und zwar in Bezug auf sein impulsives Handeln und das Fehlen von sexuellen Fantasien. Der Sachverständige erläuterte aber nicht hinreichend deutlich, von welchen Angaben des Untergebrachten nun auszugehen sein wird und welche Konsequenzen dies ggf. für die Diagnose und die darauf aufbauende Risikobewertung haben könnte. Er stellte vielmehr nur vage fest, dass die neuen Angaben auf eine weiterhin bestehende problematische Persönlichkeitsverfassung hinweisen würden. Es würde sich die Tendenz bestätigen, manipulativ zu agieren, sich insbesondere in Bezug auf die sexuelle Problematik undurchsichtig zu äußern und sich nicht auf einen tiefergehenden therapeutischen Kontakt einzulassen. Die jetzt angegebene Motivation zu den Straftaten erscheine als ein Bestreben, diese zu bagatellisieren und oberflächig zu rationalisieren. Wie er zu diesem Ergebnis kam, erläuterte der Sachverständige nicht weiter, er diskutierte insbesondere nicht die vom Untergebrachten behaupteten Motive für die veränderten Angaben. Eine neuerliche Diagnose im Hinblick auf fortbestehende Persönlichkeitsstörungen und eine konkrete Einschätzung der Rückfallprognose gab der Sachverständige nicht ab. So erfolgte insbesondere keine Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Prognoseinstrumenten, etwa mit jenen der Stellungnahme des H.-Klinikums vom 07.06.2007.
c) In keinem der beiden Gutachten wurden die psychiatrischen Diagnosen nachvollziehbar erläutert. Es wurde nicht dargestellt, welche Voraussetzungen für die Diagnose der jeweiligen Persönlichkeitsstörungen nach dem Stand der Wissenschaft gegeben sein müssen, wie diese festgestellt werden können und welche konkreten Feststellungen die Diagnosen im Ergebnis tragen. Gleiches gilt für die Darstellung der Zusammenhänge zwischen den angeblich festgestellten Persönlichkeitsstörungen und der fortbestehenden Gefährlichkeit des Untergebrachten. Eine kritische Prüfung der gutachterlichen Schlussfolgerungen ist daher auf der Grundlage der schriftlichen Gutachten nicht möglich. Die Defizite der Gutachten wurden - ausgehend von den protokollierten Inhalten der Anhörungen - auch im Rahmen der mündlichen Anhörungen nicht beseitigt.".
__
AUC area under curve (Fläche unter der ROC-Kurve)
___
cut-off. [Komplement zum ProzentRANG] Alltägliche Bedeutung: größer als. Kritischer Grenzwert, für den z.B. Kennwerte wie falsch positiv berechnet werden.
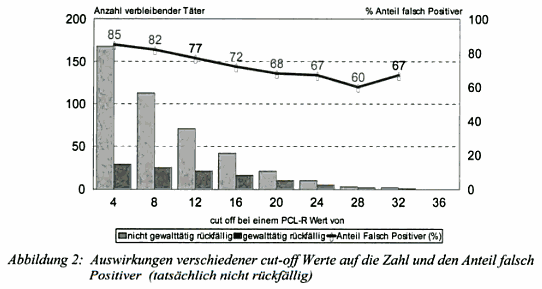 |
Nedopil, N. & Stadtland, C. (2007) Das Problem der falsch Positiven. Haben wir unsere prognostische Kompetenz seit 1966 verbessert? [GB] In (541-550): In (541-550): Lösel, Bender, Jehle (2007, Hrsg.) Kriminologie und wissensbasierte Kriminalpolitik. Entwicklungs- und Eva- luationsforschung. Godesberg: Forum. S. 541: "Die Zahl der fälschlich für so gefährlich gehaltenen Patienten, dass sie forensisch gesichert werden müssen, ist bei Betrachtung derartiger 'juristischer Experimente' erschreckend hoch. Sie lag in allen Untersuchungen zwischen 84% und 86%." Quelle: GB. oder (2005, 161) |
Beispiel aus Nedopil (2005, 2007). In der Abbildung 2 waren die cut-off Werte 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Darüber wurde der Prozentsatz falsch Positiver für den jeweiligen cut-off Wert eingetragen, also: 85% (zu cut-off > 4), 82% (zu cut-off > 8), 77% (zu cut-off > 12), 72% (zu cut-off > 16), 68% (zu cut-off > 20), 67% (zu cut-off > 24), 60% (zu cut-off > 28), 67% (zu cut-off > 32), > 36 blieb unbesetzt. Lesebeispiele: In der Strichprobe mit einem PCL-R Test-Wert von mehr als 28 Punkten sind 60% falsch positiv diagnostiziert, also als rückfällig, obwohl sie es nicht wurden. Mit anderen Worten: wählte man mehr als 28 Rohwertpunkte als kritischen Grenzwert, hätte man immer noch 60% falsche (falsch positiv) Prognosen. Hinzu kommt das gruppenstatistische Problem, dass man im Einzelfall natürlich nicht weiß, zu welchem Teil der Strichprobe der Einzelfall gehört. Der ganze Ansatz ist wissenschaftlicher Unsinn (forensische Para-Psychopathologie oder platte Kaffeesatzleserei), der allerdings von vielen, insbesondere den RichterInnen, meist nicht richtig verstanden wird.
Nedopil (2005, S.162) teilt mit, dass man in Europa mit einem Punktwert (cut-off) von mehr als 24 oder mehr als "Psychopath" gilt, in den USA erst mit mehr als 30 Punkten. An den Daten kann man sehen, dass die allermeisten Täter nach den mitgeteilten cut-offs gar keine "Psychopathen" wären. Wozu das Ganze also?
__
Falsches Datum im Pfäfflin Gutachten
Dr. Strate hierzu (PDF, S. 17, Fußnote 27): "Prof. Dr.Pfäfflins Gutachtensbasis hinsichtlich seiner Expertise vom 12.2.2010 war zwar breiter: "Das Gutachten stützt sich auf die ganztägige Untersuchung von Herrn M. am 30. 11.2010 im Besucherzimmer der Station FP6 im BKH Bayreuth (Aufenthalt dort von 10 bis 19 Uhr), die Durchsicht der Krankenakte, die Durchsicht der hergereichten drei Bände Vollstreckungshefte der StA Nürnberg Fürth und schließlich Rücksprachen mit der behandelnden Stationsärztin und dem zuständigen Oberarzt." (S. 2 des Gutachtens, Bl. 521 d.A.) Auch diesem Arzt standen die Strafakten mithin nicht zur Verfügung und besonderes Befremden ruft die Tatsache hervor, dass er auch das Datum seiner Exploration falsch angegeben hat: aus seiner Reisekostenabrechnung geht hervor, dass er am 28.11.2010 nach Bayreuth anreiste (am nächsten Tag fanden die Exploration nebst BKH Untersuchungen und das gesellige Beisammensein der Teilnehmer der von Dr. Leipziger organisierten Bayreuther Forensiktagung statt) und am 30.11.2010 abreiste. Er machte nur anteilige Kosten geltend, "da ich anschließend noch an der forensischen Tagung des BKH teilnahm" (Bl.583 f. d.A.). Sein Vortrag fand am 30.11.2010 statt, seine dem Einladenden Dr. Leipziger verpflichtete Exploration demzufolge am 29.11.2010. Befangener könnte ein Gutachter kaum sein."
__
HCR-20. H=historische (10 Anamnese Items), C 5 klinische Items und R 5 RisikoItems) ergibt insgesamt 20 Items.
Nedopil (2005, S.159) teilt hierzu mit: "In einer Reihe von Untersuchungen und einer Metaanalyse wurden die historischen Items (H) des HCR 20 als jene identifiziert, die zukünftige Gewalttaten und kriminelle Rückfälle bei psychisch Kranken am zuverlässigsten voraussagen konnten. Klinische Variablen erbrachten dagegen die geringste Treffsicherheit (Bonta et al., 1998; Harris & Rice, 1997; Tengstrom, 2001). Bei differenzierter Betrachtung erbrachte unsere Untersuchung ein davon abweichendes Ergebnis. Nur wenn alle Rückfälle (mit und ohne Gewalt) berichtet werden, war die Treffsicherheit der HCR-H-Variablen den klinischen und den Risikovariablen deutlich überlegen und sogar geringfügig höher als die Treffsicherheit des HCR-20-Gesamtscores. Betrachtet man aber ausschließlich die Gruppe der 32 Probanden, die mit Gewalttaten rückfällig wurden, nahmen die Risiko-Variablen des HCR 20 ebenso wie die klinischen Variablen an Gewicht zu. Die Treffsicherheit der Risiko-Variablen war diese Gruppe sogar leicht höher als die der historischen Variablen und wurde nur noch von der prädiktiven Validität des Gesamtinstruments überboten."
___
HV Hauptverhandlung.
__
ILRV. Integrierte Liste der Risikovariablen. (Ehlers 1985), Tabelle der 29 Items in vier Gruppen (A Ausgangsdelikt, B Anamnese, C Postdeliktische Persönlichkeitsentwicklung, D Sozialer Empfangsraum) bei Nedopil (2005, S. 126)
___
Konrad, Norbert (2010). Schlechtachten trotz Einhaltung der »Mindestanforderungen an Prognosegutachten« Recht und Psychiatrie, 28,1,.30-32. Der Autor führt S. 31 aus: "Mit einer Gesamtlänge von 243 Seiten enthält es 189 Seiten Aktenmaterial. Nach der über drei Seiten geführten Einleitung wird von Seite (künftig S.) 4 bis 59 wörtlich aus dem die Unterbringung gem. § 63 StGB anordnenden Urteil zitiert. Diese Darstellung entspricht nur scheinbar dem in den »Mindestanforderungen« verlangten »umfassenden Aktenstudium«. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit dieser Erkenntnisquelle ist jedoch dadurch nicht belegt. Wörtliches Zitieren ohne Begründung (z.B. zusammenfassende Darstellung der Diagnosen, Herausarbeitung eines kriminologisch relevanten Tatmusters, Herausdestillieren der vom erkennenden Gericht für die Annahme einer negativen Legalprognose entscheidenden Faktoren) und ohne verbindenden Kontext bedeutet letztlich die Wiederholung von bereits Bekannten und ist unter Verweis darauf, dass von dem Urteil Kenntnis genommen wurde, verzichtbar."
__
Kritische Anmerkung II.3.6
Warum nur Abweichungen und nicht auch Bestätigungen von den Vorergebnissen begründet werden müssen, ist mir unverständlich.
__
Kröber zum Simmerl-GA
S.20: "Das Gutachten Simmerl stützt sich insofern fast ausschließlich auf die Informationen zum rechtlichen Ablauf der bisherigen Betreuungsverfahren sowie auf die einmalige Exploration des Probanden am 21.09.2007 im BKA Straubing; es war dies immerhin die einzige psychiatrische Exploration des Probanden in den letzten Jahren." Anmerkung: Man beachte die Formulierung "die einmalige Exploration". Er selbst brachte es immerhin auf die keinmalige Exploration.
___
NPP Negative-Predictive-Power
___
Objektivität, Reliabilität und Validität
- Die drei wichtigsten testtheoretischen Kriterien, die man aber ganz
allgemein auf Datenerhebungsmethoden anwenden kann. Objektivität
heißt, dass ein Ergebnis (Befund, Diagnose) unabhängig vom Untersucher
bzw. Datenerheber gleich sein sollte. Reliabilität meint
die Genauigkeit der Erfassung. Und Validität schließlich
meint, dass die Datum für die Zuordnung richtig sein sollten (mehr
hier). Ein Validitätsproblem liegt vor, wenn ein Verfahren nicht
das feststellt, was es feststellen soll. Ein Reliabilitätsproblem
ist gegeben, wenn die Erfassung dessen, was festgestellt werden soll, ungenau
ist. Und ein Objektivitätsproblem liegt vor, wenn unterschiedliche
Ergebnisse herauskommen, wenn unterschiedliche Untersucher die Datenerhebung
betreiben. Früher hing die psychiatrische Diagnose oft davon ab, an
welchen Psychiater oder an welche Einrichtung man geriet, d.h. die Feststellungen
war sehr vom Untersucher oder der Einrichtung abhängig.
Exkurs: Es ist ein völlig falscher Satz der sog. „Klassischen Testtheorie“ (KKT), wenn sich dort bereits formal aus dem Ansatz ergibt, dass die Validität von der Reliabilität abhängt. Genau gilt dort: Die Wurzel aus dem Reliabilitätskoeffizienten ist eine obere Schranke für den Validitätskoeffizienten (> Rosenhan). Die richtige Relation muss umgekehrt lauten, dass ein Test überhaupt nur dann reliabel (genau) messen kann, wenn er überhaupt das Richtige misst, weil es ja wohl keinen Sinn macht, zwar sehr genau, aber das Falsche zu messen. Der zweite große Doppelfehler der KTT ist, dass die Reliabilität (Zuverlässigkeit) offenbar als Merkmal dem Test falsch zugeordnet wird, wobei der Einzelfall völlig untergeht.
Margraf (1994, S. 7, Mini-DIPS) berichtet: "Rosenhan (1973) ließ zwölf freiwillige Versuchspersonen ohne jegliche psychische Störungen in verschiedene psychiatrische Kliniken einweisen. Bei der Aufnahme sollten die Pseudopatienten lediglich ein Symptom berichten, ansonsten jedoch völlig zutreffende Angaben über sich und ihre Lebensumstände machen. Als Symptom wählte der Autor ein Verhalten aus, das noch nie in der Fachliteratur beschrieben worden war: Die Versuchspersonen sollten angeben, sie hörten Stimmen, die (in deutscher Übersetzung) "leer", "hohl" und "bums" sagten. Unmittelbar nach der Aufnahme berichteten die "Patienten" nicht mehr von diesem Symptom und verhielten sich auch ansonsten völlig normal. Trotzdem wurden alle Patienten als psychotisch diagnostiziert (elfmal als schizophren, einmal als manisch-depressiv). Es lag also ein außerordentlich hohes Ausmaß an diagnostischer Übereinstimmung vor. Dennoch waren alle Diagnosen falsch, sie besaßen also keine Validität."
Inzwischen sind Zweifel an der Studie geäußert geworden (22.6.2018, updated 2.11.2019 New York Post). Cahalan, Susannah (2019) The Great Pretender: The Undercover Mission That Changed Our Understanding of Madness. Hachette Nashville: Grand Central Publishing. Als Gedankenexperiment ist der Rosenhanversuch aber weiterhin geeignet, die Vailidtäts-Reliabilitsproblematik der "klassischen" Testtheorie deutlich zu machen.
Operationalisierung
- Operationalisierung. Ein Begriff kann als operationalisiert gelten,
wenn sein Inhalt durch wahrnehm- oder zählbare
Merkmale bestimmt werden kann. Viele Begriffe in der Psychologie, Psychopathologie,
in Gesetzen und in der Rechtswissenschaft sind nicht direkt beobachtbare
Konstruktionen des menschliches Geistes und bedürften daher der Operationalisierung.
Welcher ontologische Status
oder welche Form der Existenz ihnen zukommt, ist meist unklar.
Das Operationalisierungsproblem von Fähigkeiten. Ob einer etwas kann oder nicht, lässt sich im Prinzip leicht prüfen durch die Aufforderung, eine Fähigkeitsprobe abzulegen in der eine Aufgabe bearbeitet wird, z.B. die Rechenaufgabe 12 - 7 + 1 = ? Hierbei gibt es eine ganze Reihe richtiger Lösungen, z.B.: (1) die Hälfte des ersten Summanden, (2) 5 + 1, 7 - 1 oder (3) die, an die die meisten zuerst denken: 6. Will man prüfen, ob jemand rechtmäßige von unrechtmäßigen Handlungen unterscheiden gibt kann, gibt man z.B. 10 Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vor und lässt diese bearbeiten, etwa als einfacher Ja-Nein-Test oder als Begründungs- oder Erörterungsaufgabe, wenn tiefere Einblicke gewünscht werden. Doch wie will man herausbringen, ob jemand vor drei Monaten, am TT.MM.JJJJ um 13.48 Uhr als man einen Gegenstand (z.B. einen Fotoapparat) in seiner Tasche wiederfand, wusste, dass dieser Gegenstand nicht in seine Tasche hätte gelangen dürfen?
> Drei Beispiele Innere Unruhe, Angst, Depression (Quelle)
| Merkmal (latente Dimension) | Operationalisierung(en) |
| (a) Innere Unruhe | Ich bin innerlich unruhig und nervoes. |
| (b) Angst | Ich fuehle Angst. |
| (c) Depression | Nicht selten ist alles wie grau und tot und in mir ist nur Leere. |
PCL-R. Nedopil (2005, S. 100) führt sehr widersprüchlich aus: "Mit der Psychopathie-Checkliste hat Robert Hare ein Instrument geschaffen, das diesen Persönlichkeitstyp reliabel identifizieren soll. Wenngleich die Validität des Konstruktes „ Psychopathie" weiterhin umstritten bleibt (Cooke et al., 2004) hat sich die PCL-R als Prognoseinstrument in vielen Untersuchungen bewährt, weil sie einerseits gut operationalisierte Merkmalsdefinitionen hat und somit eine reliable und valide Datenerhebung ermöglicht, zum anderen aber auch einige klinisch relevante Charakteristika beschreibt, welche in der Realität - insbesondere der forensischen Psychiatrie und der Kriminologie - ihre Entsprechungen finden. ..." Im ersten Teil wird die Validität als "umstritten" bewertet, im zweiten Teil wird gesagt, eine reliable und valide Datenerhebung sei damit möglich. S. 103:
"Tabelle 6-1 : Merkmale in der revidierten Psychopathie-Checkliste (PCL-R)
- 1. Trickreich sprachgewandter Blender mit oberflächlichem
Charme
2. Erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl
3. Stimulationsbedürfnis (Erlebnishunger), ständiges Gefühl der Langeweile
4. Pathologisches Lügen (Pseudologie)
5. Betrügerisch-manipulatives Verhalten
6. Mangel an Gewissensbissen oder Schuldbewusstsein
7. Oberflächliche Gefühle
8. Gefühlskälte, Mangel an Empathie
9. Parasitärer Lebensstil
10. Unzureichende Verhaltenskontrolle
11. Promiskuität
12. Frühe Verhaltensauffälligkeiten
13. Fehlen von realistischen, langfristigen Zielen
14. Impulsivität
15. Verantwortungslosigkeit
16. Mangelnde Bereitschaft und Fähigkeit, Verantwortung für eigenes Handeln zu übernehmen
17. Viele kurzzeitige ehe(ähn)liche Beziehungen
18. Jugendkriminalität
19. Missachtung von Weisungen und Auflagen
20. Polytrope Kriminalität"
An dieser Stelle möchte ich auch auf einen klaren, informativen und kritischen Vortrag zur PCL von Prof. Dr. Henning-Ernst Müller hinweisen, den er am 3. Tag der Rechtspsychologie am 17.11.2012 in Bonn gehalten hat: PDF-Download. Auch hier: Müller: „Oberflächlich charmant”, tendenziell gefährlich? - Die Psychopathy-Checklist Revised (PCL-R) von Robert Hare NStZ 2011, 665
__
Nedopils (2005, S. 195) richtiger Grundansatz und Inkonsequenz "Um zu wissenschaftlich begründeten individuellen Risikoabschätzungen zu kommen, bedarf es einer wissenschaftlichen Theoriebildung und der Entwicklung von Hypothesen zur Genese der Delinquenz des zu begutachtenden Patienten (Pollock, 1990; Rubin, 1972)." Wenn das allerdings gelingt, braucht man das "allgemeine Wissen über Risikovariablen auch nicht mehr auf "den Einzelfall zu übertragen", weil man ja schon eine individuelle, auf den Einzelfall zugeschnittene Theorie der Genese der Delinquenz hat und weil das ohnehin methodologisch unzulässig ist. Hier ist Nedopil inkonsequent und macht Konzessionen an ein grundsätzlich methodologisch falsches Konzept.
60% Die falsch Positiven erreichen ihren niedrigsten Wert von 60% bei einem Grenzwert des PCL-R von 28. Im NN-Artikel wird aber die falsche Information transportiert, als sei 60% die allgemein falsche Positivrate. So weist S. 541 (GB) aus : "Die Zahl der fälschlich für so gefährlich gehaltenen Patienten, dass sie forensisch gesichert werden müssen, ist bei Betrachtung derartiger 'juristischer Experimente' erschreckend hoch. Sie lag in allen Untersuchungen zwischen 84% und 86%." Diese gruppenstatistischen Werte nutzen aber für den Einzelfall nichts, wie Nedopil in seinem Buch (2005, S. 195) ja selbst einräumt: "Wie schon in Kapitel 4.3 dargestellt, kann die individuelle Risikoeinschätzung nicht direkt aus den Daten abgeleitet werden, welche bei Gruppenuntersuchungen gewonnen wurden."
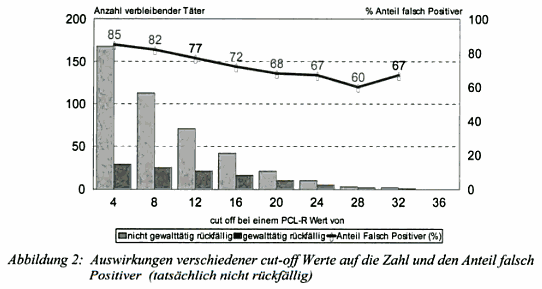 |
Nedopil, N. & Stadtland, C. (2007) Das Problem der falsch Positiven. Haben wir unsere prognostische Kompetenz seit 1966 verbessert? [GB] In (541-550): In (541-550): Lösel, Bender, Jehle (2007, Hrsg.) Kriminologie und wissensbasierte Kriminalpolitik. Entwicklungs- und Eva- luationsforschung. Godesberg: Forum. S. 541: "Die Zahl der fälschlich für so gefährlich gehaltenen Patienten, dass sie forensisch gesichert werden müssen, ist bei Betrachtung derartiger 'juristischer Experimente' erschreckend hoch. Sie lag in allen Untersuchungen zwischen 84% und 86%." Quelle: GB. oder (2005, 161) |
PPP Positive-Predictive-Power.
___
ROC-Kurve. Receiver Operating Characteristics im Zusammenhang mit Rückfallprognosen (Nedopil, S. 55-56):

Anmerkung: PCL bedeutet Psychopathie
Check Liste (von Hare).
___
RRS Rückfallrisiko
(Checkliste) bei Sexualstraftätern für verschiedene Arten, z.B.
RRS-VE Vergewaltigung).
__
Sensitivität Richtig positiv
rückfällig Diagnostizierte im Verhältnis zu allen Rückfälligen
___
Spezifität Richtig nicht
rückfällig Diagnostizierte im Verhältnis zu allen Nicht-Rückfälligen.
___
Validitätskriterien
der Prognostik. [Quelle]
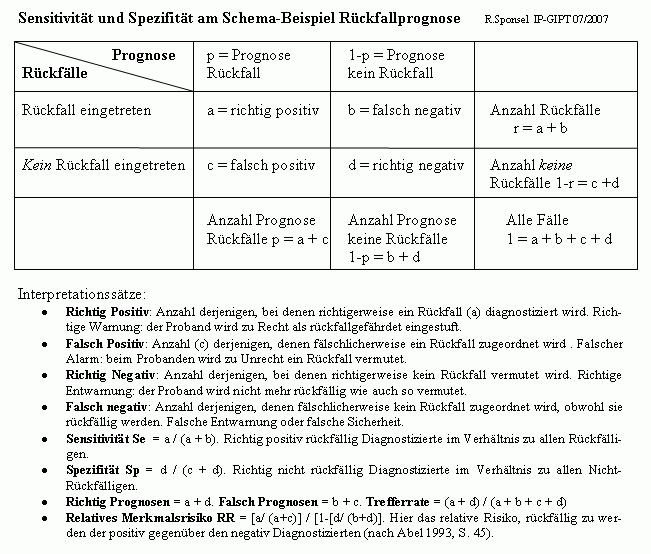
__
Wahrscheinlichkeitsbegriffe
und Prognose
Das mit der Wahrscheinlichkeit ist „objektiv“, für fast alle Gutachter
schwierig und im notorisch unklaren Rechtswesen ohnehin. Man denke nur
an die unsinnige Formel „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“,
die nirgendwo ausreichend erklärt, geschweige denn normiert wird.
Zu den verschiedenen Wahrscheinlichkeitsbegriffen, die z.T. in der Literatur
unterschiedlich benannt werden:
- W1 Subjektives Dafürhalten (glauben, meinen, Überzeugungs- oder Gewissheitsgrade) in den Hauptvarianten:
- W1a) einfach so, aus dem Bauch heraus (Methode Mollath Gutachter Nbg, Bay, Berlin, Ulm)
- W1b) auf mehr oder minder nachvollziehbare Gründe gestützt. Transparenz durch Anwendung des Bayes-Theorems. Anwendbar (auch gefordert z.B. von Köller et al., 2004) in der Forensik, aber schwierig.
- W2: Häufigkeit als Grenzwertschätzung durch lange Ereignisreihen begründet. In der forensischen Prognostik im Einzelfall nicht anwendbar, weil man keine langen Reihen des Einzelfalles hat und wenn man sie hätte, sie gewöhnlich nicht vergleichbar wären.
- W3: Verteilungswahrscheinlichkeit: durch ein mathematisches Modell begründet, z.B. klassischer Ansatz Anzahl der günstigen Fälle dividiert durch Anzahl der möglichen Fälle (die dann als gleichwahrscheinlich angenommen werden, wodurch man in ein Basis-Zirkularitätsproblem rutscht). Kommt für die forensische Prognostik selten in Frage, in anderen Bereichen schon (z.B. genetischer Fingerabdruck, Vaterschaft).
- W4 Modellwahrscheinlichkeit (kausale Wahrscheinlichkeit): durch eine Theorie und ein Modell begründet (Wettervorhersage), z.B. durch eine individuelle Delinquenztheorie. In der forensischen Prognostik m.E. DIE gebotene Methode der Wahl. Das ist im wesentlichen auch die Position der besseren Gutachter, z.B. Nedopil: "Um zu wissenschaftlich begründeten individuellen Risikoabschätzungen zu kommen, bedarf es einer wissenschaftlichen Theoriebildung und der Entwicklung von Hypothesen zur Genese der Delinquenz des zu begutachtenden Patienten (Pollock, 1990; Rubin, 1972)." Sie kann auch mit 1b verknüpft werden und erreichte damit höchstes angewandtes wissenschaftliches Niveau (W4-W1b).
- W5: Erfahrungswahrscheinlichkeit: durch Erfahrung begründet (> Kausalität und Korrelation, Induktive Logik [Carnap/ Stegmüller],) Interpretation: Bestätigungsgrad von Hypothesen. Prototyp naturwissenschaftliche Gesetze und Regelhaftigkeiten.
- Wx: Sonstiger Wahrscheinlichkeitsbegriff (Rest- und Auffangkategorie)
Drei Anmerkungen: (I) die schwierigen Prognoseprobleme erfordern
grundlegende und meist aufwändige Einarbeitung in die Problematik.
II. (2) und (3) meinen Wahrscheinlichkeit im engeren mathematischen Sinne,
(4) und (5) sind ganz anderen, empirischen Typs. Und (1) spielt in beide
Bereiche hinein. III. Wer also von Wahrscheinlichkeit spricht, sollte
genau sagen, welche er meint. Damit wäre schon viel gewonnen.
__
Zusammenfassung
Dahle (2007) " Zusammenfassung
Gesetzestexte sehen bei bestimmten strafrechtlichen
Entscheidungen die Unterstützung des Richters durch Prognosegutachter
vor. Ihre Aufgabe ist es, die Rechtsentscheidung in ihren prognostischen
Aspekten auf eine rationale, wissenschaftlich fundierte Grundlage zu stellen.
Methodisch lassen sich dabei wissenschaftlich fundierte Prognosen auf unterschiedlichen
Wegen erstellen. Der eine Weg beruht auf empirisch gesicherten Erfahrungen
über die Rückfälligkeit von Tätern und über die
die Rückfallwahrscheinlichkeit beeinflussenden Tat- und Tätermerkmale.
Prognosemethoden nach diesem Modell bemühen sich, diese Erfahrungen
auch für individualprognostische Zwecke nutzbar zu machen. Der andere
Weg führt über eine systematische retrospektive Analyse der individuellen
Ursachen der bisherigen Delinquenz des Täters und schreibt diese individuellen
Bezüge prognostisch fort. Prognosemethoden nach diesem Modell bemühen
sich vor allem, den erforderlichen Urteilsbildungsprozess zu systematisieren
und eine hinreichende Beurteilungsgrundlage zu gewährleisten. Der
vorliegende Beitrag stellt beide Ansätze in ihren methodischen Grundzügen
und wissenschaftlichen Bewährungen vor und diskutiert ihre jeweiligen
Vorzüge und Begrenzungen im Kontext der Mindestanforderungen für
Prognosegutachten im Strafrecht." [SL]
__
Standort: Mindestanforderungen Prognose-Gutachten.
*
Überblick Forensische Psychologie.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Forensische Psychologie site: www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Rudolf Sponsel (DAS). Mindestanforderungen für forensische Prognosegutachten und ihre Einhaltung bei Gustl F. Mollath durch den Nürnberger, Bayreuther, Berliner und Ulmer Gutachter zu Potentielle Fehler in forensisch psychiatrischen Gutachten, Beschlüssen und Urteilen der Maßregeljustiz. Eine methodenkritische Untersuchung illustriert an einigen Fällen u. a. am Fall Gustl F. Mollath mit einem Katalog der potentiellen forensischen Gutachtenfehler sowie einiger Richter-Fehler. Erlangen IP-GIPT: https://www.sgipt.org/forpsy/NFPMRG/MS-Prog.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert: irs 19.05.2013
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
08.12.2019 Zweifel am Rosenhanversuch vermerkt.
13.08.2018 Aktuelles vorangestellt.
17.03.2015 Linkfehler geprüft (keinen gefunden), Lit-Erg.
13.01.2015 Die Forschungsergebnisse von Endres zur Frage Verneinung der der Tatvorwürfe.
13.09.2013 Falsches Datum im Pfäfflin Gutachten.
25.05.2013 Anforderungen an Prognose Gutachten OLG Rostock.