(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=08.09.2022 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 11.09.22
Impressum: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel
Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen Mail: sekretariat@sgipt_ Zitierung & Copyright
Anfang Evidenz bei Norbert Bischof 2009 und 1966_Datenschutz_Übersicht_ Relativ Beständiges_ Relativ Aktuelles_Titelblatt_ Konzeption_Archiv_
Region_ Service_iec-verlag_ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und integrative Psychotherapie, Abteilung Forschung, Bereich Begriffsanalysen und hier speziell zum Thema :
Evidenz in Norbert Bischofs Psychologie
(2009)
und im Handbuch
der Psychologie (1966)
|
welche ihre Gedanken untereinander austauschen wollen, etwas voneinander verstehen; denn wie könnte denn, wenn dies nicht stattfindet, ein gegenseitiger Gedankenaustausch (...) möglich sein? Es muß also jedes Wort (...) bekannt sein und etwas, und zwar eins und nicht mehreres, bezeichnen; hat es mehrere Bedeutungen, so muß man erklären, in welcher von diesen man das Wort gebraucht. ..." Aus: Aristoteles (384-322) Metaphysik.
11. Buch, 5 Kap., S. 244
|
| Leider verstehen viele Philosophen, Juristen, Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaftler auch nach 2300 Jahren Aristoteles immer noch nicht, wie Wissenschaft elementar funktionieren muss: Wer wichtige Begriffe gebraucht, muss sie beim ersten Gebrauch (Grundregeln Begriffe) klar und verständlich erklären und vor allem auch referenzieren können, sonst bleibt alles Schwall und Rauch (sch^3-Syndrom). Wer über irgendeinen Sachverhalt etwas sagen und herausfinden will, der muss zunächst erklären, wie er diesen Sachverhalt begrifflich fasst, auch wenn dies manchmal nicht einfach ist. Wer also über Gewissheit etwas sagen und herausfinden will, der muss zunächst erklären, was er unter "Gewissheit" verstehen will. Das ist zwar nicht einfach, aber wenn die Philosophie eine Wissenschaft wäre und und die PhilosophInnen Aristoteles ernst nehmen würden, dann hätten sie das in ihrer 2300jährigen Geschichte längst zustande bringen müssen. Im übrigen sind informative Prädikationen mit Beispielen und Gegenbeispielen immer möglich, wenn keine vollständige oder richtige Definition gelingt (Beispiel Gewissheit und Evidenz). Begriffsbasis Damit werden all die Begriffe bezeichnet, die zum Verständnis oder zur Erklärung eines Begriffes wichtig sind. Bloße Nennungen oder Erwähnungen sind keine Lösung, sondern eröffenen lediglich Begriffsverschiebebahnhöfe. Die Erklärung der Begriffsbasis soll einerseits das Anfangs- problem praktisch-pragmatisch und andererseits das Begriffsverschiebebahnhofsproblem lösen. |
Evidenz in Norbert Bischofs Psychologie (2009)
Bischof, Norbert (2009) Psychologie. Ein Grundkurs für Anspruchsvolle. 2. durchgesehene Auflage. Stuttgart. Kohlhammer.
Aufgrund sehr spannender und beeindruckender Vorträge beim Symposion des Turms der Sinne [2012, 2013, ] habe ich mir Bischofs Psychologie gekauft und immer wieder mal darin mit Gewinn gelesen. Es ist ein Lehrbuch der besonderen Art, und deshalb habe ich es auch für die Analyse des Evidenzbegriffs mit ausgewählt, um auch einen modernen Psychologen und zugleich einen Pionier der 4. Generation nach Wundt zu berücksichtigen.
Zusammenfassung-Bischof (2009):
Sachregistereinträge Evidenz: 24, 38, 88, 91f, 110, 134-136, 568.
Die Sachregistereinträge führen zu insgesamt 18 Fundstellen.
Von den 18 Fundstellen sind 5 "Evidenzgefühl", was nahelegt, dass
Bischofs Evidenzbegriff eine deutliche bis starke Gefühlskomponente
enthält. Der Evidenzbegriff selbst wird nicht eigens erklärt,
auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis.
Das könnte man so deuten, dass Bischof den Evidenzbegriff für
allgemeinverständlich und nicht weiter erklärungs- oder begründungsbedürftig
hält, was ich aber nicht glaube. S.91 gebraucht den Begriffsverschiebebahnhof
"einleuchtend". Es gäbe falsche Evidenzen (S. 91) und Evidenzgrade
(S. 136, S. 568), die leider nicht näher ausgeführt werden. Evidenz
sei nicht zuverlässiger als ein Schwangerschaftstest (S. 91). Nachdem
der Evidenbegriff für "unerlässlich" (S.134) befunden wird, wäre
es umso nötiger gewesen, ihn genau zu erklären oder sogar zu
definieren (>Sponsel). Eine besondere
Bedeutung nimmt der Brunswik zugeschriebene Begriff der Veridikalität
(S. 91) ein, dem es nach meinem Verständnis auch an differentieller
Klarheit fehlt.
Im Detail kommentiert:
- Kommentar-1-S.24: Evidenzgefühl wird nicht erklärt - auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis - , sondern anscheinend als allgemein verständlicher, nicht weiter erklärungs- oder begründungsbedürftiger Grundbegriff angesehen.
- Kommentar-2-S.38: Bischof behauptet ein tiefes menschliches Evidenzgefühl, das er nicht weiter erklärt oder belegt, auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis.
- Kommentar-3-S.88: unmittelbar evident wird nicht erklärt - auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis - , sondern anscheinend als allgemein verständlicher, nicht weiter erklärungs- oder begründungsbedürftiger Grundbegriff angesehen.
- Kommentar-4-S.91-1: Die Bedeutung von evident in diesem Zusammenhang bleibt unklar. Falls es für ernst zu nehmende Phänomene verwendet werden soll, werden zwei neue Begriffsverschiebebahnhöfe eingerichtet: Phänomen, ernst nehmen; unklar bleibt auch, von wessen "Eindruck" gesprochen wird. Es fehlt auch eine Quellenangabe zu BRUNSWIK (> Fehlerhafter Zitierstil), nach Bischof dem Begriffsschöpfer von "veridikal".
- Kommentar-5-S.91-2: Hier erhält evident ein Definitionsmerkmal, nämlich "Wirklichkeit im vierten Sinne": ernst zu nehmen.
- Kommentar-6-S.91-3: Evidenzen können falsch sein, hier wären Kriterien (über die beiden Beispiele hinaus), wie man richtige von falschen unterscheiden kann, hilfreich gewesen, sei es direkt, Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis mit genauer Fundstelle.
- Kommentar-8-S.91-4: Bischof weist unter Berufung auf Metzger noch einmal eindringlich auf den Unterschied zwischen Evidenz und Veridikalität hin.
- Kommentar-4-S.91-5: evident wird mit "einleuchtend" beschrieben und damit ein neuer Begriffsverschiebebahnhof eingerichtet.
- Kommentar-9-S.110: Den fundamentalen Unterschied von evident und veridikal kann ich nicht nachvollziehen, im Gegenteil, gerade das Veridikale ist für die meisten Wahrnehmenden doch evident.
- Kommentar-10-S.134: Wenn Evidenz unerläßlich befunden wird, wäre es gut zu wissen, was genau darunter zu verstehen ist.
- Kommentar-11-S.135-1: Der Hinweis auf Kant führt zum Verständnis von Evidenz nicht weiter.
- Kommentar-12-S.135-2: Ja: "Deshalb kann die Wissenschaft darüber zwar objektiv zutreffende Aussagen machen, aber diese werden uns nicht mehr anschaulich evident."
- Kommentar-13-S.135-3: Hier - Makro-, Mikro-, Mesokosmos - wäre ein konkretes Beispiel hilfreich gewesen.
- Kommentar-14-S.135-4: wie vorher.
- Kommentar-15-S.136-1: Bischof erläutert nicht, wie er zu den postulierten Graden der Evidenz kommt und wie man sie bestimmt.
- Kommentar-16-S.136-2: Bischof postuliert, dass Begriffskombinationen, deren Einzelbegriffe sich ausschließen, als Kombination nicht evident sein können. Obwohl mir Bischofs Behauptung intuitiv einleuchtet, sehe ich das für ein Modell der Komplementarität nicht zwingend.
- Kommentar-17-S.136-3: Auch spricht Bischof zum 5. Mal von Evidenzgefühlen, was nahelegt, dass sein Evidenzbegriff deutlich bis stark vom Gefühl geprägt ist.
- Kommentar-18-S.568: Die Formulierung "minderer Qualität" spricht für eine quantitative Auffassung von Evidenz, ohne dass Bischof dies näher erklärt. Es ist sicher gut vertretbar zu sagen: etwas ist evident oder nicht, ein Dazwischen gibt es nicht.
- Anmerkung: "Begriff" hat keinen Eintrag im Sachregister. Demnach scheint die wissenschaftliche Handhabung von Begriffen nicht darstellenswert zu sein.
Ende der Zusammenfassung.
1-S.24: "... Kein Zweifel also: Die Intuition mag ein wertvolles Hilfsmittel
für den Praktiker sein; aber wenn sie sich als unfehlbar aufdrängt,
dann übernimmt sie sich. Sie kann genauso irren wie das rationale
Denken, ist dabei aber weniger kontrollierbar als dieses, und dazu noch
durch das begleitende Evidenzgefühl viel
leichtfertiger in ihrer Siegesgewissheit."
Kommentar-1-S.24: Evidenzgefühl wird nicht
erklärt - auch nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder
Literaturhinweis - , sondern anscheinend als allgemein verständlicher,
nicht weiter erklärungs- oder begründungsbedürftiger Grundbegriff
angesehen.
2-S.38: "Der Mensch sieht sich seit Beginn des abendländischen Denkens als Bewohner zweier Welten. Diese Philosophie heißt Dualismus. Sie entspringt offenbar einem tiefen menschlichen Evidenzgefühl und wurde daher in der Geistesgeschichte mehrfach formuliert."
- Kommentar-2-S.38: Bischof behauptet ein tiefes menschliches Evidenzgefühl,
das er nicht weiter erklärt oder belegt, auch nicht durch Querverweis,
Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis.
3-S.88: "Worin liegt der Unterschied zwischen einer Erscheinung,
die als Wahrnehmung, und einer solchen, die als Vorstellung
erlebt wird? Beide sind »Repräsentationen« im Sinne der
ersten, weiteren Bestimmung des Begriffs. Aber nur Vorstellungen werden
auch als Repräsentationen erlebt! Die Produkte unseres Wahrnehmungssystems
sind
zwar eine Abbildung, erscheinen aber als die Wirklichkeit selbst.
Wahrnehmungsinhalte treten phänomenologisch mit dem Anspruch auf,
aus eigener Kraft da zu sein, sie gebärden sich als öffentlich,
als etwas, womit wir und andere uns auseinanderzusetzen haben, ob wir wollen
oder nicht. Wir müssen sie uns nicht vergegenwärtigen,
sondern wir treffen sie an. Dass hinter ihnen noch eine Transzendenz
liegt, die durch sie nur repräsentiert wird, können wir höchstens
abstrakt denken, aber es wird uns nicht unmittelbar
evident."
- Kommentar-3-S.88: unmittelbar evident wird nicht erklärt - auch
nicht durch Querverweis, Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis
- , sondern anscheinend als allgemein verständlicher, nicht weiter
erklärungs- oder begründungsbedürftiger Grundbegriff angesehen.
4-S.91f: "4.2.1 Evidenz und
Veridikalität
Bis jetzt war von »Wirklichkeit« die Rede; jetzt ist es
an der Zeit, sich der »Wahrheit« zuzuwenden. Wie lässt
sie sich in unser Schema einordnen?
Die subjektunabhängige Welt, an die wir uns anpassen müssen,
um in ihr zu überleben, haben wir »objektiv« genannt;
ihr steht die phänomenale Welt des jeweiligen Subjekts gegenüber.
Es erscheint plausibel, den Begriff »Wahrheit« für den
Fall zu reservieren, dass die beiden Welten übereinstimmen.
In diesem Sinne hatte schon THOMAS VON AQUIN veritas
als adaequatio intellectus et rei definiert, als Übereinstimmung
der Einsicht mit dem Sachverhalt.
In der Psychologie findet sich zur Kennzeichnung dieser Beziehung zuweilen
der von Egon BRUNSWIK vorgeschlagene Terminus veridikal.
Er wird von Autoren bevorzugt, die nicht einfach von »wahr«
reden wollen, weil sie fürchten, man könnte sie für epistemologisch
naiv halten. Allerdings drücken sich die meisten dann doch auch wieder
davor, dieses Kunstwort präzise zu definieren. Wir werden im nächsten
Kapitel sehen, wie schwierig das ist. [>92]
Für den Moment genügt es, einer naheliegenden Verwechslung
vorzubeugen. Wir haben soeben von der Wirklichkeit im vierten Sinn gesprochen,
vom Eindruck, das betreffende Phänomen sei ernst zu nehmen. Auch dieser
Eindruck kann gemeint sein, wenn in der erkenntnistheoretischen Diskussion
von »Wahrheit« die Rede ist. Besser ist indessen, dafür
den Terminus evident zu reservieren.
- Kommentar-4-S.92-1: Die Bedeutung von evident in diesem Zusammenhang
bleibt unklar. Falls es für ein "ernst zu nehmendes Phänomen"
verwendet werden soll, werden zwei neue Begriffsverschiebebahnhöfe
eingerichtet: Phänomen, ernst nehmen; unklar bleibt auch, von wessen
"Eindruck" gesprochen wird. Es fehlt auch eine Quellenangabe zu BRUNSWIK
(> fehlerhafte Zitierweise), nach
Bischof dem Begriffsschöpfer von "veridikal".
5-S.92-2: "»Evident«
ist also die epistemologische Übersetzung für den phänomenologischen
Begriff »Wirklichkeit im
vierten Sinn«. Sie bezeichnet eine vom kognitiven Apparat abgegebene
Veridikalitäts-Garantie.
Diese Garantie ist freilich ihrerseits nicht unfehlbar. Sie ist nicht verlässlicher
als ein Schwangerschaftstest.
- Kommentar-5-S.92-2: Hier erhält evident ein Definitionsmerkmal,
nämlich "Wirklichkeit im vierten Sinne": ernst zu nehmen."
6-S.92-3: "Der Eindruck der Untreue der Desdemona war dem Othello
evident,
aber er war gleichwohl nicht
veridikal. Die
meisten Tragödien auf der Bühne und im wirklichen Leben beruhen
auf falschen Evidenzen. Wie bereits
John Kerry im Wahlkampf gegen George W. Bush zutreffend, wenn auch vergeblich
feststellte: »You can be certain - and wrong!«"
- Kommentar-6-S.92-3: Evidenzen können falsch sein, hier wären
Kriterien (über die beiden Beispiele hinaus), wie man richtige von
falschen unterscheiden kann, hilfreich gewesen, sei es direkt, Querverweis,
Fußnote, Anmerkung oder Literaturhinweis mit genauer Fundstelle.
7-S.92-4: "Es ist daher eine wesentliche Maxime der Wissenschaft,
dass man zwischen Evidenz und Veridikalität
unterscheiden muss. Das hat wiederum METZGER gültig formuliert:
| »Das Verstehen wird aus einem unverbindlichen Spielen mit Möglichkeiten der Deutung zu strenger Wissenschaft erst in dem Augenblick, wo der Nachdenkende den Unterschied zwischen einleuchtend und wahr in seiner Tragweite erfasst und infolgedessen die Notwendigkeit einsieht und das Bedürfnis empfindet, jede - auch jede eigene - Vermutung auf ihre (logische und faktische) Stichhaltigkeit zu prüfen.« |
- Kommentar-7-S.92-4: Bischof weist unter Berufung auf Metzger noch einmal
eindringlich auf den Unterschied zwischen Evidenz und Veridikalität
hin.
8-S92-5: "Offenkundig entsprechen die Ausdrücke »einleuchtend«
und »wahr« dabei dem, was wir »evident«
und »veridikal« genannt haben."
- Kommentar-8-S.92-5: evident wird mit "einleuchtend" beschrieben und
damit ein neuer Begriffsverschiebebahnhof
eingerichtet.
9-S.110: "Da im Folgenden eine kritisch-realistische Position zugrunde
gelegt wird, sollte man die Differenzierung des Begriffs wirklich
in die vier Bedeutungsaspekte »objektiv«, »unvermittelt«,
»angetroffen« und »ernst zu nehmen«, vor allem
aber den fundamentalen Unterschied von »evident«
und »veridikal« durchdacht und verstanden haben."
- Kommentar-9-S.110: Den fundamentalen Unterschied von evident
und veridikal kann ich nicht nachvollziehen, im Gegenteil, gerade
das Veridikale ist für die meisten Wahrnehmenden doch evident.
10-S.134: "Nicht Objektivität, wohl allerdings Evidenz
ist hier unerlässlich; daher müssen diese Fiktionen den unerbittlichen
Anspruch erheben, von allen geglaubt zu werden, daher werden Ketzer und
Ungläubige zu einer unerträglichen Gefahr für die Gemeinschaft,
die sich somit leicht davon überzeugen lässt, dass sie auf den
Scheiterhaufen gehören. ..."
- Kommentar-10-S.134: Wenn Evidenz unerläßlich befunden wird,
wäre es gut zu wissen, was genau darunter zu verstehen ist.
11-S.135-1: "KANT hatte die Entkoppelung von Evidenz
und Objektivität auf die Spitze getrieben. Die evolutionäre Erkenntnistheorie
hat diese Kluft überbrückt, aber keineswegs geschlossen. Auch
sie hütet sich davor, dem unreflektiert Einleuchtenden naiv zu vertrauen.
Wenn Veridikalität das Ergebnis eines Selektionsprozesses ist, der
dem Erkenntnisapparat im Laufe der Phylogenese seine Funktionstüchtigkeit
angezüchtet hat, so schließt das ein, dass sich dieser Apparat
an Dimensionen der Wirklichkeit, die wir nicht verstehen müssen, um
zu überleben, auch nicht anzupassen brauchte."
- Kommentar-11-S.135-1: Der Hinweis auf Kant führt zum Verständnis
von Evidenz nicht weiter.
12-S.135-2: "Das Doppelspalt-Experiment liefert einen
Beleg dafür, und es gibt genügend weitere. Unser natürliches
Bewegungstempo liegt beispielsweise deutlich unterhalb der Lichtgeschwindigkeit;
daraus folgt, dass Effekte, wie sie die Relativitätstheorie beschreibt,
auf unsere Wahrnehmungskategorien keinerlei Selektionsdruck ausgeübt
haben. Deshalb kann die Wissenschaft darüber zwar objektiv zutreffende
Aussagen machen, aber diese werden uns nicht mehr anschaulich evident."
- Kommentar-12-S.135-2: Ja: "Deshalb kann die Wissenschaft darüber
zwar objektiv zutreffende Aussagen machen, aber diese werden uns nicht
mehr anschaulich evident."
13-S.135-3: "Aus dem Gegenstandsfeld der Physik sind es der Makrokosmos
im Weltall und der Mikrokosmos der Atome, bei deren Erkenntnis uns
die begleitenden Evidenzgefühle
mehr stören als nützen, weil sie uns oft genug das objektiv Richtige
als absurd und paradox zu verleiden trachten. Hinreichend verlässlich
ist unsere intuitive Physik nur im Bereich dazwischen, den Gerhard VOLLMER,
einer der namhaften Vertreter der evolutionären Erkenntnistheorie,
als »Mesokosmos«, als Kosmos mittlerer Größenordnung,
zu bezeichnen vorgeschlagen hat FN9."
- Kommentar-13-S.135-3: Hier stellt Bischof unter Berufung auf VOLLMER
fest, dass unsere Evidenzen auf den Mesokosmos beschränkt sind.
14-S.135-4: "Nun ist diese Terminologie aber insofern nicht sehr erhellend, als sie sich nur nach dem an sich nebensächlichen Größenmaßstab, nicht aber eigentlich nach epistemologischen Kriterien richtet. Eine bessere Einteilung würde sich an der Zuverlässigkeit der begleitenden Evidenzgefühle orientieren.
»Makro-« und »Mikrokosmos« zu unterscheiden bringt da wenig; sie sind insofern äquivalent, als Evidenzgefühle bei beiden nicht als Wegweiser zur Objektivität taugen. Wir können sie daher unter einem gemeinsamen Oberbegriff zusammenfassen, wofür sich die Bezeichnung Metakosmos anbietet."
- Kommentar-14-S.135-4: wie vorher.
15-S.135-5: "Der Metakosmos schließt nicht nur die Welt des Riesengroßen und Winzigkleinen ein, sondern überhaupt alle Problemfelder, an die sich unsere kognitiven Kompetenzen phylogenetisch nicht anzupassen hatten. Man erkennt ihn in der Regel daran, dass er sich nur komplementär beschreiben lässt, also mithilfe von Begriffen, die einander anschaulich ausschließen und daher nicht als Kombination evident werden können. Die Komplementarität von Welle und Korpuskel ist das prominenteste Beispiel; aber auch der psychophysische Zusammenhang gehört hierher, was besonders an der Komplementarität von Determination und Freiheit spürbar wird."
- Kommentar-15-S.135-5: Bischof postuliert, dass Begriffskombinationen,
deren Einzelbegriffe sich ausschließen, als Kombination nicht evident
sein können. Obwohl mir Bischofs Behauptung intuitiv einleuchtet (denk-evident
ist), sehe ich das für ein Modell der Komplementarität nicht
zwingend. (Quelle):
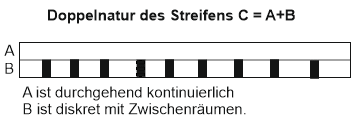 |
Die eine Hälfte des Streifens C ist kontinuierlich, nämlich A, während der Teil B diskret mit Zwischen- räumen ist. Betrachtet man vom Streifen nur A, wird man sagen, er ist kontinuierlich. Betrachtet man nur B, wird man sagen, er ist diskret. Aber C ist beides, wenn man beide Streifen A und B betrachtet. |
16-S.136-1: "Abb. 5.22 Orthokosmos (objektiv), Parakosmos
(veridikal, aber nicht objektiv), Metakosmos (nicht veridikal). Alle drei
unterscheiden sich nicht im Grad ihrer Evidenz"
- Kommentar-16-S.136-1: Bischof erläutert nicht, wie er zu den postulierten
Graden der Evidenz kommt und wie man sie bestimmt.
17-S.136-2: "Es ist die Tragik der Philosophie, dass ihr
nach dem Exodus der empirischen Wissenschaften letztlich nur noch gewisse
Regionen des Metakosmos als kognitives Betätigungsfeld geblieben sind,
weshalb man bei manchen ihrer Vertreter den Eindruck gewinnt, sie betrachteten
es als alleinige Aufgabe ihrer Wissenschaft, wohlklingende Akkorde aus
Evidenzgefühlen
zu komponieren, bei denen von vornherein auf jeden Versuch einer Verankerung
an Veridikalität verzichtet wird. Auch die empirische Forschung
dringt in den Metakosmos vor; aber sie ist keineswegs dazu bereit allem
Glauben zu schenken, was einleuchtend klingt. Entsprechend dem METZGER-Zitat
in Abschnitt 4.2.1 hat sie gelernt, strengere, formale Kriterien einzufordern,
bevor sie eine These, mit gleichwohl nie gänzlich unterdrücktem
Misstrauen, vorläufig akzeptiert. Hier liegen das Geburtsfeld und
der Legitimationsbereich der eleatischen Haltung der Naturwissenschaften.
Und hier wird man wohl auch die Wurzel der notorischen Unfruchtbarkeit
der meisten »interdisziplinären« Debatten zwischen Forschern
und Philosophen zu suchen haben."
- Kommentar-17-S.136-2: Auch spricht Bischof zum 5. Mal von Evidenzgefühlen,
was nahelegt, dass sein Evidenzbegriff deutlich bis stark vom Gefühl
geprägt ist.
18-S.568: "Wo aber die Veridikalität sich nicht aus eigener
Kraft Gehör zu verschaffen vermag, dort bilden sich automatisch kognitive
Muster minderer Qualität, die einleuchten, weil sie den denkästhetischen
Bequemlichkeiten des kollektiven Evidenzerlebens
oberflächlich entgegen-kommen oder dem Selbstschätzungsbedürfnis
der Gruppe und ihrer Wortführer schmeicheln. Wo in der Physik erst
die nicht-euklidische Geometrie den Anforderungen effizienter Naturbeschreibung
genügt, geben wir uns schon mit Kurt LEWINS »Topologie«
zufrieden. Tiefer zu bohren lohnt sich nicht; es würde ja doch keiner
verstehen."
- Kommentar-18-S.568: Die Formulierung "minderer Qualität" spricht
für eine quantitative Auffassung von Evidenz, ohne dass Bischof dies
näher erklärt. Es ist sicher gut vertretbar zu sagen: etwas ist
evident oder nicht, ein Dazwischen gibt es nicht.
Anmerkung: "Gewissheit" hat im Sachregister keinen Eintrag.
__
Evidenz im Handbuch der Psychologie (1966)
Metzger, W. & Erke, H. (1966) Handbuch der Psychologie I. Der Aufbau der Erkennens, 1. Halbband: Wahrnehmung und Bewußtsein. Göttingen: Hogrefe.
Zusammenfassung-Bischof-HB-1966:
Die beiden Sachregistereinträge : Evidenz 316, 319 beziehen sich auf
das Kapitel 10 Psychophysik der Raumwahrnehmung, Abschnitt 4. Funktionale
und evidente phänomenal-räumliche Bezugssysteme und Abschnitt
5.
Physikalische und phänomenale Raumstruktur von Norbert Bischof.
Die Seiten 316-319 enthalten 25 Fundstellen zum Suchtext "eviden". Durchsucht
man das gesamte Kapitel 10 von Norbert Bischof im Handbuch mit dem Suchtext
"eviden", werden 45 Treffer erzielt. Die ersten 2 Treffer betreffen Einträge
im Inhaltsverzeichnis, so dass noch 43 Treffer im Text mit 3 in Fußnoten
übrig bleiben. Ich habe mir die ersten 17 Fundstellen näher angesehen
und gehe davon aus, was in diesen ersten 17 Fundstellen begrifflich nicht
geklärt wurde, wird auch in den weiteren Fundstellen nicht geklärt
werden.
Fazit: Bischof (1966) erklärt in den ersten 17 Fundstellen
nicht, was er unter Evidenz und unter Graden der Evidenz versteht, wie
man das feststellen und referenzieren kann.
- "phänomenale 1Evidenz". Bei der ersten Erwähnung in der Fußnote S.310 "phänomenale Evidenz" hätte nach den begrifflichen Grundregeln rein formal die phänomenale Evidenz erläutert gehört, wenigstens mit Querverweis, Anmerkung oder Literaturhinweis
- 2evidente wird in der Überschrift so erwähnt, das ich davon ausging, dass in diesem Abschnitt eine Klärung und Erklärung folgt.
- „Unterscheidung von funktionalen“ und 3„evidenten“: Die Unterscheidung ird zwar festgestellt, aber nicht erklärt auch nicht mit einem Beispiel.
- 4evidenten Beziehungen: Hier richtet Bischof "mit anschaulicher Selbstverständlichkeit" einen Begriffsverschiebebahnhof ein; die Passage ist insgesamt unverständlich ("aus dem Wesen der Partner folgen")
- 5„evidentes Bezugssystem“: Es bleibt allgemein abstrakt
- Der logische Gegenbegriff zur 6Evidenz ist die 7'Nicht-Evidenz': Das ust zwar nachvollziehbar, hilft aber hinsichtlich einer Erklärung auch nicht weiter.
- unterschiedliche Grade der anschaulichen 8Evidenz: Hier führt Bischung die anschauliche Evidenz ein, ohne sie zu erklären und außerdem unterschiedliche Grade dieser, auch ohne zu erklären, wie man zu diesen kommt, sie ermitteln kann und wodurch sie begründet sind. Es fehlen durchgängig Beispiele.
- Dichotomie 9"evident“ und „funktional“ nicht disjunktiv: So wenig wie evident erklärt wird, so ist auch mit dem Begriff funktional, wobei Dichotomie nicht zu disjunktiv passt.
- objektiv und 10evident: Hier behauptet Bischof, ohne zu begründen oder zu belegen, auch nicht mit Beispiel, dass objektiv und evident zusammen gehen können.
- objektiv und 11nicht-evident: Das gleiche gilt für objektiv und nicht-evident, auch nicht begründet, belegt oder durch ein Beispiel verständlich gemacht. .
- funktionale und 12nicht-evidente: Am Beispiel leeres und befülltes Zimmer wird der Zusamenhang nicht klar.
- funktionale und 13evidente: Auch hier wird die Evidenz nicht geklärt - wie auch nicht das funktionale.
- 14„evidente“ und die funktionale Struktur: Ankündigung einer weiter gesonderten Betrachtung, weil sich Betrachtungsaspekte ausschlössen ohne weitere Erklärung.
- 15nicht-evidente auf 16evidente Kausalität: Bischof führt hier nicht-evidente bzw. evidente Kausalität ein und behauptet, ohne Beispiel, nicht-evidente auf evidente Kausalitätzurückzuführen.
- 17evidenten Paradigma: Bischof behauptet in dieser Fußnote ein evidentes Paradigma am allgemeinen Beispiel eines makroskopischen Stoßes ohne nähere Erklärung oder Begründung.
Erste 17 Fundstellenbelege im HB-Kontext
Ich habe mir die ersten 17 Fundstellen näher angesehen und gehe
davon aus, was in den ersten 17 Fundstellen begrifflich nicht geklärt
wurde, wir es aucfh in den weiteren Fundstellen nicht.
S.310: Fußnote zu Linschoten mit Bezug zu Husserl, darin "phänomenale 1Evidenz".
S.316f: "4. Funktionale und 2evidente
phänomenal-räumliche Bezugssysteme
Ein Versuch, das in den beiden letzten Paragraphen
umrissene terminologische Dilemma aufzulösen, wird im wesentlichen
auf der durch Wertheimer (1912) begründeten, von Duncker (1929) und
Koffka (1936) ausgebauten und in systematischer Verdichtung bei Metzger
(1954) zu einem vorläufigen Abschluß gebrachten gestalttheoretischen
Lehre von den phänomenalen Bezugssystemen aufzubauen haben.
Wir sind aus Raumgründen gezwungen, speziell die Darlegungen bei Metzger
(l. c., Kap. 4) nachfolgend als bekannt vorauszusetzen, und beschränken
uns hier im Anschluß an Kleint (1940) lediglich auf die Einführung
einer bei Metzger zwar angelegten FN19), aber nicht deutlich herausgearbeiteten
Zusatzterminologie, nämlich der Unterscheidung von „funktionalen“
und 3„evidenten“ Beziehungen
im Wahrnehmungsraum (vgl. dazu ausführlich o. S. 30 ff,) FN20)."
"Die logische Schwierigkeit des sogleich zu erläuternden
Begriffspaares liegt darin, daß seine Definition ein doppeltes Einteilungsprinzip
verwendet. Wir verstehen nämlich unter 4evidenten
Beziehungen zwischen Phänomenen solche, die mit anschaulicher
Selbstverständlichkeit aus dem Wesen der Partner folgen und als qualitativ
spezifische Beziehungserlebnisse selbst Phänomen sind.
Wir bezeichnen demgemäß, wo immer Eigenschaften oder Zustände
anschaulicher Objekte als wesenhaft „abhängig von“, „verankert an“,
„bezogen auf“ oder „orientiert an“ anderen phänomenalen Gegebenheiten
erlebt werden, diese letzteren als 5„evidentes
Bezugssystem“ für jene. Der logische Gegenbegriff zur
6Evidenz
ist die 7'Nicht-Evidenz'
(oder, wie es in der gestalttheoretischen Literatur häufig heißt,
die „Unscheinbarkeit“) von Beziehungen oder Bezugssystemen, welche
im reinen Fall dort vorliegt, wo nicht Zusammenhangserlebnisse, sondern
nur Zusammenhänge zwischen Erlebnissen — in Form wesenhaft unverstandener
und (außer in eigens zu ihrer Untersuchung herbeigeführten Experimentalsituationen)
oft auch unbemerkt bleibender Wenn-Dann-Beziehungen — nachweisbar sind.
Da es unterschiedliche Grade der anschaulichen 8Evidenz
gibt, sind zwischen den beiden eben gekennzeichneten Extremfällen
Übergangsformen (s. u. S. 319) möglich. — Der Begriff des funktionalen
Bezugssystems liegt auf einer ganz anderen Ebene. Formuliert man nach Art
von Gleichung (4) (s. o. S. 42) die distale Korrelation zwischen einer
transphänomenalen Objektvariablen und deren anschaulichem Korrelat,
so werden in diese Gleichung im allgemeinen Parameter (wie etwa die Entfernung
vom Auge, die Struktur des Hintergrundes, ferner innerorganismische Faktoren
wie Aufmerksamkeit, Motivation usw.) eingehen und demgemäß die
Art der Repräsentation mitbestimmen, welche im transphänomenalen
Wirkungsfeld nicht auf die wahrzunehmende Objektvariable selbst, sondern
nur auf die ihr zugeordneten Signale außerhalb oder innerhalb
des Organismus Einfluß nehmen. Da sich [>317] nun auch diese Parameter
ihrerseits wenigstens zum Teil in der Wahrnehmungswelt abbilden, kommen
auf diese Weise Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Erlebnisinhalten
zustande, denen transphänomenal keinerlei Interaktion der Objektkorrelate
unmittelbar miteinander entsprechen. Solche Beziehungen zwischen Phänomenen
) nun nennen wir „funktional“. Als Gegenbegriff erscheint hier der des
„objektiven“ (oder genauer „objektiv bedingten“) Phänomenzusammenhanges,
d. h. eines Zusammenhanges, der durch Interaktionen der Objekte selbst
und nicht erst der Signale auf dem Übertragungsweg fundiert ist. Zwischen
funktionalen und objektiven Beziehungen gibt es keine gleitenden Übergänge.
Wegen der Verschiedenheit der Einteilungsgesichtspunkte
ist die Dichotomie 9"evident“
und „funktional“ nicht disjunktiv. Es gibt in der Wahrnehmungswelt Beziehungen,
die objektiv und 10evident
sind wie z. B. der anschaulich-kausale Zusammenhang zwischen dem Fortrollen
einer Billardkugel und dem zuvor erfolgten Anstoß mit dem Queue.
Es gibt Beziehungen, die objektiv und 11nicht-evident
sind wie etwa die wahrgenommene Ausdehnung eines Stabes bei Erwärmung
oder die gegenseitige Anziehung zweier magnetischer Metallstücke FN22).
Es gibt funktionale und 12nicht-evidente
Zusammenhänge wie etwa die anschauliche Vergrößerung eines
zuvor leeren Zimmers bei Einrichtung mit Möbeln und Teppich. Und es
gibt schließlich auch funktionale und 13evidente
Beziehungen wie etwa die anziehende oder abstoßende Wirkung eines
sympathischen bzw. unsympathischen Menschen. Wenn wir nachfolgend also
die 14„evidente“ und
die „funktionale“ Struktur des Wahrnehmungsraumes gesondert abhandeln,
so nicht, weil die jeweiligen Betrachtungsgegenstände, sondern vielmehr,
weil die Betrachtungsaspekte einander ausschließen FN23): Im ersteren
Fall versetzen wir uns „in“ die Position des naiv wahrnehmenden Subjektes
und fragen nach den erlebten Gesetzlichkeiten, in denen diesem die Struktur
seiner Erfahrungswirklichkeit „Raum“ verständlich wird;
im letzteren stellen wir uns „außerhalb“ des Subjektes und kennzeichnen
die psychologischen Gesetze, nach denen der Bewußtseinsinhalt
„Raum" sich aufbaut."
Fußnoten Bischof Handbuch
316-19) So etwa in der Trennung von „Realsystemen“ und
„abstrakten Qualitätssystemen“ (l. c., S. 132).
316-20) Kleint (1940, S. 36) unterscheidet wörtlich
zwischen „funktionalen“ und „phänomenalen“ Beziehungen; zur Vermeidung
von Mißverständnissen dürfte es sich jedoch empfehlen,
den letzteren Ausdruck als Oberbegriff zu reservieren."
317-21) Soweit funktional Einfluß nehmende Parameter
selbst keinerlei anschauliches Korrelat besitzen, können im Interesse
geschlossener Beschreibung quasi-phänomenale Hilfsbegriffe eingeführt
werden (vgl. o. S. 38).
317-22) Beobachtungen dieses Zusammenhangstyps dürften
übrigens den Anstoß zur Ausgliederung des physikalischen Weltbildes
gegeben haben, dessen Aufgabe jedenfalls in den Anfängen nicht allein
darin bestand, das Naturgeschehen voraussagbar zu machen, sondern auch
darin, durch Zuordnung geeigneter Modellvorstellungen 15nicht-evidente
auf 16evidente Kausalität
zurückzuführen; vgl. etwa die kinetische Wärmetheorie, die
den Effekt der Ausdehnung erwärmter Materie aus dem 17evidenten
Paradigma des makroskopischen Stoßes verstehbar (nicht nur „erklärbar“!)
werden läßt.
317-23) „Außen“ und „Innen“ im fünften
Sinn, vgl. o. S. 38ff.
Links (Auswahl: beachte)
- Homepage: https://www.bischof.com
Glossar, Anmerkungen und Endnoten: Wissenschaftlicher und weltanschaulicher Standort.
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
assertorische-Evidenz
assertorisch:=etwas behaupten. Evidenz:=Offenkundigkeit, Offensichtlichkeit, Augenscheinlichkeit (im Angloamerikanischen eine ganz andere Bedeutung, nämlich: belegt, begründet, beweisorientiert).
__
Epimeleia:=Aufmerksamkeit und Sorge für ein gutes Leben.
__
performative-utterances (Austin)
Sprechhandlungen, die nicht nur sachlich etwas mitteilen, sondern auf eine Wirkung und Veränderung abzielen. [W.engl]
__
Schwangerschaftstest
__
Veridikalität
__
Wirklichkeit im vierten Sinn
Bischof unterscheidet verschiedene Wirklichkeiten:
4.1.1 Erster Sinn von »Wirklichkeit«: Das Objektive 85
4.1.2 Zweiter Sinn von »Wirklichkeit«: Das Unvermittelte 86
4.1.3 Dritter Sinn von »Wirklichkeit«: Das Angetroffene 87
4.1.4 Vierter Sinn von »Wirklichkeit«: Das Ernstzunehmende 90
"Leider können wir die Liste der unterschiedlichen Verwendungen des Wirklichkeitsbegriffs immer noch nicht abschließen. Wenigstens eine vierte und letzte Dimension ist in jedem Fall noch zu berücksichtigen. Sie wird durch den Cartoon in Abbildung 4.3 illustriert.
Die Szene lenkt unser Augenmerk auf die Tatsache, dass wir nicht alles Angetroffene gleich ernst nehmen. Und das mit gutem Grund. Die zentralnervöse Repräsentation der Umwelt basiert ja auf einem Prozess der Signalübertragung. Dieser aber kann aus »technischen« Gründen gar nicht ohne Informationsverlust ablaufen. Den Weg vom Objekt zum Sinnesorgan blockieren teilweise Hindernisse, und der Nachrichtenfluss wird von Störungen verfälscht.
Das ist der Grund, warum das Gehirn die am Sinnesorgan eintreffenden Reiznachrichten nicht nur weiterleiten darf, sondern auch verarbeiten muss: Es gilt zunächst, Ausfälle zu ergänzen und Fehler zu korrigieren. Wir werden später Beispiele dafür kennenlernen. Wie ingeniös solche Verarbeitungsleistungen aber auch immer konstruiert sein mögen, sie bleiben doch weit davon entfernt unfehlbar zu sein. Und das Gehirn »weiß« auch gewissermaßen selbst, dass es nur mit Wasser kochen kann."
__
Querverweise
Standort: Evidenz bei Norbert Bischof 2009 und 1966.
*
Begriffsanalyse Gewissheit * Fragebogen-Pilot-Studie Begriffsanalyse Gewissheit *
Haupt- und Verteilerseite Begriffsanalysen. *Textanalysen und Sprachkritik * Definition Begriff. * Das A und O: Referenzieren *Begriffsverschiebebahnhöfe*Wissenschaftsglossar*Operationalisieren*Definition und definieren *Beweis und beweisen in Wissenschaft und Leben *Beweis und beweisen im Alltag. *Beweis und beweisen in den Psychowissenschaften*BA Gesunder Menschenverstand*
Überblick Arbeiten zur Theorie, Definitionslehre, Methodologie, Meßproblematik, Statistik und Wissenschaftstheorie besonders in Psychologie, Psychotherapie und Psychotherapieforschung.
*