(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=26.05.2005 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 05.05.17
Impressum: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel
Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen * Mail:_sekretariat@sgipt.org_
Attraktiv und Attraktivität
Psychologie, Sozialpsychologie,
Psychopathologie, Soziologie.
aus allgemeiner und integrativer Sicht
von Rudolf Sponsel, Erlangen
Überblick
Abstract - Zusammenfassung.
I. Grundlagen:
Psychologie und Sozialpsychologie der Attraktvität.
- Beispiele zum Einstieg.
- Begriff.
- Wissenschaftstheoretische Unterscheidung bei Attraktivitätsbekundungen, die Aussagen oder Werurteile sein können.
- Relativität und Subjektivität der Attraktivität.
- Merkmalsspezifikation.
- Attraktivitätsurteile werden von vielerlei Faktoren beeinflußt.
- Arten und Vielfalt von Attraktivitäten.
- Die systematische Stellung der Attraktivität in der Psychologie.
- Wortgeschichte.
- Anwendung und Gebrauch des Attraktivitätsbegriffs - Beispiele aus dem Netz.
III. Soziologie und Kulturanthropologie der Attraktvität.
IV. Erforschung der Attraktivität (Reaktion und Urteil).
- Abstract - Zusammenfassung Attraktivitätsforschung.
- Ähnlichkeitshypothese ("Gleich und gleich gesellt sich gern").
- Aronsons Summary 1969.
- Balance-Theorie (Heider).
- Durchschnittshypothese (Langlois & Roggman, 1990).
- Einfluss der Symmetrie (Thornhill & Gangestad, 1993).
- Equity-Theorie intimer Sozialbeziehungen (Mini-Max Theorie).
- Ergänzungshypothese ("Gegensätze ziehen sich an").
- Theorie der Merkmalsausprägungen (Cunningham, 1986).
- Streets erste Befragung 1898 zu Ähnlichkeit und Komplementarität.
- Attraktivität ist eine positive Wertigkeit.
- Psychologie des ersten Eindrucks (Geleitwort von Oswald Kroh, 1937).
- Der erste Eindruck an sich (Eckstein 1937, S. 54-56).
- Theorien und Determinanten der zwischenmenschlichen Anziehung. Aus Mikula, G. & Stroebe W. (1991).
- Kulturvergleichende Beziehungsforschung (Asendorpf & Banse (2000).
Links (Auswahl).
Querverweise.
Abstract - Zusammenfassung. Attraktivität ist keine Eigenschaft, sondern ein Beziehungsprodukt und eine Wirkungs-Aussage oder Werturteil, jenachdem wie es ausgedrückt wird. Grundlegend sind zwei Aspekte zu unterscheiden: die Position als Subjekt der Attraktivitätswertung (ich finde ..., "ich" in der Rolle des A.) und die Positon als Objekt der Attraktivitätsbewertung durch andere (andere finden mich ..., "andere" in der Rolle des A.). Das Attraktivitätstätsurteil ist subjektiv, relativ und wandelbar. Es gibt potentiell unendliche Attraktivitäten, die von vielen sozio-kulurellen und individuellen Faktoren abhängen. Theoretisches Attraktivitätsmaß (subjektiv, relativ): Häufigkeit und Stärke, mit der ein Merkmal bzw. eine Merkmalskombination positiv bewertet wird. Effektives Attraktivitätsmaß (subjektiv, relativ): die "MAZOKA", die man in die Zueignung attraktiver Merkmale investiert. Der Attraktivitätsbegriff durchdringt oder berührt die meisten Disziplinen der Psychologie (allgemeine, soziale, differentielle und Entwicklung). Es gibt eine ganze Reihe von Theorien, Modellen, empirischen und experimentellen Untersuchungen zu den Paradigmen der Attraktionsforschung. Für den westlichen Kulturraum erklärt nach wie vor Aronsons Summary 1969 am meisten. Wenig empirisch erforscht - wozu psychoanalytische Assoziationsphantasien natürlich nicht zählen - sind nicht-bewußte Hintergrundbedingungen, die Rolle von Sehnsüchten, Illusionen, Wünschen und Träumen. (Zusammenfassung einiger Forschungsergebnisse hier).
I. Grundlagen: Psychologie und Sozialpsychologie der Attraktvität.
Beispiele zum Einstieg. (1) Das Haus hat eine attraktive Lage. (2) B hat eine attraktive Figur. (3) B. kann ein sehr attraktiv sein. (4) Das ist ein attraktives Angebot. (5) B ist ein häßlicher Kerl. (6) Diese Rolle scheint sehr attraktiv zu sein. (7) Das ist ein Scheißjob. (8) Sie legt großen Wert auf ihre Attraktivität. (9) Der gefällt mir aber gar nicht. (10). Am liebsten mache ich Urlaub in den Bergen (See, Ausland, da oder dort). [Beispiele zur Verwendung im Netz]
Begriff. (Wortgeschichte) Attraktion heißt Anziehung, Attraktivität bedeutet demnach die Anziehung, die „etwas“ für jemand hat. A. Das Adjektiv „attraktiv“ bedeutet dann anziehend „sein“, wobei in dieser sprachlichen Ausdrucksweise der Beziehungsgesichtspunkt verschwindet, so daß bei Sprachnaiven der Eindruck entstehen könnte, „attraktiv“ sei eine Eigenschaft. Aber „attraktiv“ ist keine Eigenschaft, wie Form, Farbe, Größe, Masse oder Gewicht, die unabhängig von einem Beurteiler besteht. „Attraktiv“ ist nicht etwas, das in den Sachverhalten, Menschen oder Ereignisse steckt oder ihnen anhaftet, sondern die Wertung mehr oder oder minder „attraktiv“ kommt nur zustande, wenn ein Subjekt einem Objekt gegenübertritt und die Wirkung dieses Objektes auf Erleben erfährt und zum Ausdruck bringen kann.
Abb.: Grundmodell Attraktivitäts-Wirkungen

Tatsächlich handelt es sich also um ein relatives und im allgemeinen auch subjektives Werturteil. Es liegt nämlich immer eine mindestens zweistellige Relation derart vor: A wertet: B „ist“ attraktiv. Genau heißt das natürlich: B „ist“ für A. attraktiv. In dem „ist attraktiv“ steckt meist auch noch eine Verallgemeinerung (Generalisierung), die, im Einzelfall genauer betrachtet, so auch nicht unbedingt stimmt.
Wissenschaftstheoretische
Unterscheidung bei Attraktivitätsbekundungen, die Aussagen oder Werurteile
sein können. Aussagen sind
Behauptungen über Sachverhalte, die wahr oder falschsein
können. Das gilt nicht für Werturteile. "Das ist
schön", ist ein Werturteil.
Hingegen kann "Das finde ich schön" eine Aussage sein,
die wahr ist, wenn es stimmt,
daß ich "das" tatsächlich schön finde. "Schön" ist
hierbei eine ästhetische Kategorie. B. ist
attraktiv, ist ein Werturteil.
A. findet B. attraktiv, ist
eine Aussage, denn der Satz A. findet B. attraktiv kann wahr oder falsch
sein.
Im Grunde gilt dieser Formulierungsfallstrick für alle Werturteile.
Wertungen sind Aussagen (A.
findet B. attraktiv), wenn sie auf ein Subjekt bezogen werden, von dem
untersucht werden kann, ob die Wertung für dieses Subjekt - oder eine
Gruppe von Subjekten - richtig ist. Wertungen sind Werturteile, wenn sie
objektivistisch formuliert werden (B. istschön,
B. istattraktiv, B.
ist
ein guter Mensch, B. hat
einen schlechten Charakter u.s.w.).
Siehe auch: Das Werturteil
*
Beweis
und Beweisen in Wissenschaft und Leben * Welten
* Aussagepsychologie *
Relativität und Subjektivität der Attraktivität. Was für den einen attraktiv „ist“, mag einen anderen kalt lassen oder sogar eine negative Wirkung hervorrufen und als unattraktiv erscheinen. „Attraktiv“ ist ein ein Geschmacksurteil, ein solches ist subjektiv und unterliegt auch einem mehr oder minder stärkerem Wandel, wie man z.B. an der Mode, der Kulturen, Epochen und Völker sehen sehen kann. Im Barock galten andere Schönheitsideale als in der Antike oder im 20. Jahrhundert. Für einen Eskimo, Andenbewohner, Trapper in Australien oder Taxifahrer in Berlin kann ein und dasselbe „Objekt“ von ganz unterschiedlicher Attraktivität sein. Für Ludwig XIV. und einem geknechteten Bauern unter Katharina II. hat ein Zentner Kartoffeln ganz unterschiedliche Attraktivität. Und so hat etwa ein Apfel für jemand, der gerade Appetit auf einen solchen hat, eine gewisse Attraktivität. Ein Rettungsring hat für jemand, der gerade bei Seenot um sein Leben kämpft, eine höhere Attraktivität als ein Koffer mit Geld, der ihn am Ergreifen des Rettungrings hindert. In einer solche Situation mag ein Mensch auch ein neues Verhältnis zu Gott bekommen, das, der Not entronnen, sich auch wieder ganz schnell verändern kann. Ein paar Schluck Wasser können bei Durst in der Wüste eine sehr hohe Attraktvität erlangen. Und Geld kann sehr wichtig sein, wenn man damit sein Leben retten kann, etwa um eine Flucht zu bezahlen. Für besitzt Geld eine hohe Attraktivität, weil damit materieller Wohlstand möglich ist und gesellschaftliche Anerkennung einhergeht. Auch Macht kann sehr attraktive Wirkungen hervorrufen, vergegenwärtigt man sich etwa, wie viele mächtige Herrscher, z.T. ja regelrechte Antimenschen, wie z.B. Hitler, von Frauen umjubelt und „angebetet“ wurden.
Merkmalsspezifikation. Oft ist etwas Spezielles gemeint, das Äußere (z.B. ein Lächeln, Alter, eine Geste, die Frisur, die Kleidung, die Figur, Bewegung, Gesichtsausausdruck) oder das Innere (z.B. Wesensart, Einstellung, Bildung, Herkunft, Tüchtigkeit) manchmal aber auch der Gesamteindruck, den man von jemand hat. Urlaubsorte werben mit einer attraktiven Lage, einem attraktiven Klima, mit attraktiven Serviceleistungen usw. Finanzdienstleiter werben mit attraktiven Zinsen, Universitäten mit einem attraktiven Ruf. Berufe werden ebenso als attraktiv bezeichnet wie Gehälter oder Extras (z.B. Gewinnbeteiligungen, Prämien, besondere Sozialleistungen wie etwa ein firmeneigene Kinderkrippe, Sporthalle, Bibliothek usw.; siehe bitte unten: Beispiele aus dem Netz).
Attraktivitätsurteile werden von vielerlei Faktoren beeinflußt: (1) von der Befindlichkeit und (2) der Verfassung des Beurteilenden und von der „Beschaffung“ des Beurteilungsobjektes, (3) von der Situation S und (4) von den verschiedenen Zeitpunkten oder Zeiträumen T (Kultur, Zeitgeist, Milieu, Entwicklungsphase im Leben). Ein Attraktivitäts-Urteil kann auf eine bestimmte Situation bezogen oder situations- oder zeitübergreifend übergreifend verallgemeinert gemeint sein. Urteilt z.B. jemand: „er ist ein attraktiver Mensch“, so ist ein solches Werurteil durch folgende drei Verallgemeinerungsmerkmale charakterisiert: a) Gesamteindruck, b) situationsübergreifend und c) über eine längere Dauer. In diesem Fall ist das Attraktivitätsurteil kaum noch verallgemeinerbar. Eine ganz wichtige Rahmen- und Hintergrundrolle für das Attraktivitätsurteil spielen Kultur, Zeitgeist, Milieu, Erziehung, Lebenserfahrungen und hierbei besonders die Bindungs-, Beziehungs- und Liebeserfahrungen.
Arten und Vielfalt von Attraktivitäten. Wie viele Attraktivitäten gibt es? Praktisch unendlich viele, könnte man sagen. Das rührt von der praktisch unendlichen Manigfaltigkeit der Kombinationen von Befindlichkeiten, Beschaffenheiten der Beurteiler und Beurteilungsobjekten und von den unterschiedlichen Situationen und Zeiten. Im zwischenmenschlichen Bereich dürften folgende Merkmale oder Beschaffenheiten von besonderem Interesse sein:
Abb.: Attraktoren im zwischenmenschlichen Bereich
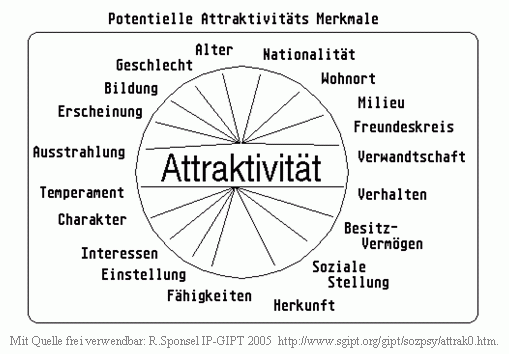
Graphikspende aus Sponsel 1995, S. 249.
Die systematische Stellung der Attraktivität in der Psychologie. Attraktivität ist ein weitreichender und vielschichtiger Begriff, der fast die gesamte Psychologie durchdringt: Entwicklungspsychologie (Herkunft, Sozialisation, Bindung, Bildung, Erfahrungen, Entwicklungsabschnitt), Allgemeine Psychologie (Wahrnehmung, Gefühl, Motivation, Phantasie), Sozialpsychologie (Einstellung, Erwartung, Vorurteil, Kommunikation, Beziehungshaltung), Differentielle Psychologie der Persönlichkeit (Anlage, Begabungen, Fähigkeiten und Tüchtigkeiten, Bewußtheit und Abwehr, Werte, Ideale, Wesen, Typus, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Soziale Kompetenz). Nicht übersehen werden darf auch, daß es wichtige Beziehungen zu anderen Fachgebieten gibt, wie z.B. Biologie (Evolution/ Selektion, Anlage), Soziologie und Kulturanthropologie, Anthropologie, Psychopathologie (Psychiatrie)
Wortgeschichte. Im Etymologie Duden
(1963, S. 41) wird zu "attraktiv" ausgeführt: "anziehend, hübsch,
elegant" (heute meist in Fügungen (heute meist in Fügungen wie
'eine attraktive Frau'). Es erscheint im 18. Jahrhundert mit der allgemeinen
Bedeutung 'anziehend' und beruht auf gleichbedeutend frz. attractif <
spätlateinisch attractivus."
Im Bedeutungswörterbuch des Duden (1970, S.
64) wird ausgeführt: "attraktiv (Adj.): a) anziehend durch besondere
Vorteile oder Gegegbenheiten; einen Anreiz bietend; der Dienst in der
Verwaltung ist noch immer attraktiv. b) anziehend auf Grund eines ansprechenden
Äußeren; hübsch und voller Reiz: eine attraktive Frau."
Das
Grimmsche
Wörterbuch führt weder "Attraktion", "Attraktivität"
oder "attraktiv" auf.
Im 2. Bd. des Brockhaus
von 1894 gibt es einen Eintrag "Attraktion", in dem auf "Anziehung" verwiesen
wird. Unter Dort, im 1. Bd., steht: "Anziehung oder Attraktion nennt man
die Kraftm vermögen deren die kleinsten Teilchen der Körper sich
zu nähern und in gegenseitiger Nähe oder Berührung sich
festzuhalten streben. Newton (1682) hat zuerst eine solche allgemeine Anziehung
zur Erklärung der Weltkörper angenommen und die Schwere (s.d.)
als einen besonderen Fall derselben betrachtet. Diese Ansicht schien den
meisten Zeitgenossen (Leibniz, Huyghens), die an eine Fernwirkung der Massen
nicht glauben konnten, unannehmbar, wurde auch noch von Faraday bekämpft.
Es fehlt nicht an Versuchen, die Fernwirkung auf Vermittelung des Mediums
(Äthers, s.d.) zurückzuführen, das den Raum zwischen den
sich anziehenden Massen ausfüllt. - Vgl. Kant, Metaphysische Anfangsgründe
der Naturwissenschaft (Lpz. 1786) ..." Also selbst 1894 wurde Attraktion
noch rein physikalisch gedeutet.
Selbst ein halbes Jahrhundert später, im Brockhaus
von 1952 verweist der Eintrag "Attraktion" auf "Anziehung" und dortt heißt
es: "Anziehung, Attraktion, Physik: -> Kraft." Sowohl der
erste Ergänzungsband 1958 noch der zweite 1963 enthalten einen Eintrag
zu "Attraktivität" oder "attraktiv". Der zweite (Bd. 14) Ergänzungsband
enthält einen Eintrag "Attractants [engl. ...] Lockstoffe ...".
Im großen farbigen Volkslexikikon
in 12 Bdn. des BI, Mannheim (1981) wird ausgeführt: "Attraktion:
[lat.] Anziehung, Anziehungskraft; Glanznummer, Zugstück, Schlager.
In der Sprachwissenschaft:
Angleichung im Bereich der Lautung, der Bedeutung, der Form und der Syntax,
bes. die Angleichung eines Kasus an den anderen und die Angleichung von
Tempus und Modus eines untergeordneten Satzes an den übergeordnete.
"attraktiv [lat.] anziehend, gutaussehend,
elegant."
Ergebnis Wortgeschichte:
Der psychologische und zwischenmenschliche Attraktivitätsbegriff ist
ein Kind des 20. Jahrhunderts.
Anwendung und Gebrauch des Attraktivitätsbegriffs - Beispiele aus dem Netz
Fett-kursive Hevorhebungen von RS.
Alphabetisch nach Stichworten geordnet. Die [Werbe-] Beispiele sind keine
Empfehlungen. Die Beständigkeit der Links ist unsicher und wird nicht
gepflegt, die Linkadresse dient als Quellenbeleg. Aus der Aufnahme darf
nicht gefolgert werden, daß Verwendungsweise und Gebrauch des Attraktiv/
Attraktivitätsbegriffs von uns für sinnvoll betrachtet wird.
- Andernach-attraktiv-Info.
- Arbeitgeber-Attraktivität ist steuerbar. "Das Tool Cockpit Arbeitgeber-Attraktivität, bestehend aus CD-Rom und Begleitbuch, unterstützt die Unternehmen bei der Planung, Durchführung und Auswertung von Attraktivitätsbefragungen bei Mitarbeitern und externen Kennern des Unternehmens."
- Arbeitsmarktchancen. diktion (Werbung): "Wenn alle anderen Voraussetzungen gleich sind, bekommt der Kandidat mit dem besseren Äußeren den Job.
- Assoziationen der Blaster-User zum Stichwort ... Attraktiv. [Quelle]
- Attraktivitäts-Selbstbewertung im Internet.
- Auslands-BAföG > Polen.
- Aussehen, gutes. diktion (Werbung): "Gutes Aussehen ist das beste Rezept. Verschaffen Sie sich einen -vielleicht auch ein bisschen unfairen- Vorteil gegenüber der Konkurrenz, indem Sie an der Verbesserung Ihrer äußerlichen Erscheinung arbeiten. Das gilt für Sie genauso wie für Ihre Produkte und Ihren Webauftritt. Gutes Aussehen ist ein unerläßlicher Schlüssel zum Erfolg - im beruflichen wie auch im privaten Leben. Für Ihre physische Erscheinung gibt es Image-Berater, für Ihren Webauftritt gibt es uns, diktion.de. Für Sie wird es auf jeden Fall immer eine lohnende Investition sein."
- Belarus. Wie kann Belarus attraktiv für Touristen werden? "[ naviny.by ] Ein weiteres Projekt der belarussischen Führung zielt auf die Entwicklung des Tourismus in der Republik Belarus ab."
- Biogas. "Biogasnutzung auch für Ökolandbau attraktiv. bmu: "Pressearchiv Nr. 164/04. Berlin, 07.06.2004.
- Brandenburg: Ein attraktiver Standort für Investoren - insbesondere bei höherwertigen Investitionen. Quelle.
- Brauchen. diktion (Werbung): "Brauchen wir Attraktivität? Eine schwaches Selbstimage bewirkt niedrige Produktivität. Ich bin sicher, dass Sie aus eigener Erfahrung wissen, wie wahr dies ist. Erinnern Sie sich an einen Tag, an dem Sie sich besonders attraktiv fühlten - erinnern Sie sich daran, wie die Menschen positiv auf Sie reagierten, wie machtvoll Sie sich gefühlt haben, wie produktiv Sie aus diesem Grund wurden? Und erinnern Sie sich an einen anderen Tag, an dem Sie besonders unattraktiv aussahen - wie gleichgültig reagierte man auf Sie, wie machtlos fühlten Sie sich, und wie unproduktiv wurden Sie?
- Bauchtanz: Aktiv und attraktiv durch Bauchtanz.
- Bauen: Attraktiv bauen mit kleinem Budget.
- Bundesländer, neue > Neue Bundesländer.
- Diesel: Sparen.de: "Kostenvergleich: Diesel nicht nur für Kilometerfresser attraktiv.
- Digital attraktiv bleiben. "Seit Anfang des Monats ist Monique Kieffer endgültig Direktorin der vor allem mit ihren Schwierigkeiten in die Schlagzeilen geratenen Nationalbibliothek.
- Doppelte Staatsbürgerschaft für Tschechen: radio.cz: Doppelte Staatsbürgerschaft für Tschechen immer noch attraktiv
- Ehrenamt: Wadsack, Ronald (2003). Ehrenamt attraktiv gestalten. Freiburg: Haufe. "In dem praxisnahen Ratgeber zeigt der Herausgeber wie das Ehrenamt eine Attraktion für den einzelnen Mitarbeiter wird, der die Ergebnisse seines Handelns erlebt. Und es zeigt wie Ehrenamt eine Attraktion für die Organisation darstellt, die die Arbeitsmöglichkeit anbietet. Das Buch beschränkt sich dabei nicht auf die Anwerbung von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Es geht auch um Organisation, Führung und Zusammenarbeit. ..."
- Emanzipation: Emanzipiert und attraktiv. Aus dem Interview: "In einem anderen Beitrag in der ZEIT stellt die Autorin Jana Hensel folgende These auf: 'Der Erfolg der Emanzipation ist ein Märchen. In Zeitschriften und Büchern für Frauen wird ein Rollenverständnis von vorgestern propagiert. Der Mann steht immer noch im Zentrum allen weiblichen Begehrens.'
- Eros (Asteroid): Telepolis: Eros ist überraschend attraktiv. "Neues von Eros. In der neuen Ausgabe von Nature setzen sich insgesamt über 40 US-Wissenschaftler in 3 Artikeln mit den Erkenntnissen über Eros auseinander, die durch die NEAR- Shoemaker- Mission gewonnen wurden. Eros erweist sich als sehr viel komplexer als angenommen. ... "
- Erscheinung. diktion (Werbung): "Ihre Website ist o.k. - aber wie attraktiv sind Sie? Autor: Christo Börner. "Geben wir es ruhig zu: Die physische Erscheinung eines Menschen, gutes Aussehen also, ist für viele unserer Entscheidungen ein wichtiger Faktor - von der Einstellung eines neuen Angestellten bis zur Wahl eines Geschäftspartners und natürlich unseres romantischen Partners. Auch wenn wir unsere Empfänglichkeit für Schönheit eher abstreiten, beweisen zahlreiche Studien doch, dass schöne Menschen erhebliche Vorteile haben. ... " ... " Sowohl online als auch offline ist eine positive Erscheinung von äußerster Wichtigkeit. In der enormen Konkurrenz im World Wide Web müssen Anbieter ihren Auftritt ästhetisch auf Hochglanz polieren, um sich von der Menge abzuheben. Viele Konkurrenzprodukte sind funktionell äquivalent, weshalb sie die konkurrenzfähige Aufwertung durch eine gepflegte Online-Erscheinung unbedingt brauchen. Die Wichtigkeit der äußeren Erscheinung eines Menschen ist weitläufig anerkannt. ... "
- Evelyn (Serie). Attraktiv mit Evelyn (Serie WDR).
- Familie ist attraktiv: Familienpolitik ist Politik für die große Mehrheit der Menschen; denn für die meisten ist und bleibt Familie die gewünschte Lebensform. Familie ist in Deutschland ein gesellschaftliches Zukunftsthema.
- Festplatten: Attraktiv und mobil: Externe Festplatten von Maxtor und Seagate. [Quelle]
- Folio. Für Investoren attraktiv.
- Forschung und Frauen. Was macht die Forschung so wenig attraktiv für Frauen? [Quelle]
- Frauen und Forschung > Forschung und Frauen.
- Fruchtbarkeitszyklus und Attraktivität. "Was Frauen attraktiv macht von Thomas Német. Die Eine hat es und die andere eben nicht, oder sie haben es alle, einmal im Monat. Die Frau, die wo sie geht und steht mit ihrer Schönheit alle Blicke auf sich zieht, hat vielleicht etwas Verborgenes. Nach neuesten Forschungsergebnissen finden Männer und Frauen ein Frauengesicht am attraktivsten, wenn Frau auf dem Höhepunkt ihres Fruchtbarkeits-Zyklus ist."
- Geriatrie ist attraktiv. "Zwar findet die Geriatrie in der Nähe des Lebensendes statt, und zu ihren zentralen Aufgaben gehört auch die empfindsame und umsichtige Begleitung vor dem Sterben, aber sie ist dennoch ein sehr lebendiges und vielfältiges, sogar dynamisches Gebiet. Dies betrifft besonders folgende Merkmale: ..." [Quelle]
- Hartz IV: mdr: Hartz IV. SPD will Minijobs nicht zu attraktiv machen. Die SPD will den Zuverdienst für Arbeitslosengeld-II-Empfänger neu regeln.
- Harz: anhaltweb: Neues aus Sachsen Anhalt. Tourismus. Harz weiter attraktiv.
- Hecken: Bettina Rehm (). Hecken, Zäune und Mauern einfach & attraktiv.
- Hochschulen: Attraktivität von Hochschulen.
- Hochschullehrerberuf: Zur Attraktivität des Hochschullehrerberufes (49. Hochschulverbandstag 1999).
- Hormone > Wechseljahre; Macho
- Hormone: Wissenschaft.de: News. 20.12.2003 - Psychologie. Hormone machen Machos attraktiv. "In bestimmten Zyklusphasen denken auch Frauen nur an das Eine Während ihrer fruchtbaren Tage finden Frauen Männer mit Macho-Gehabe attraktiver als sensible, ruhige Männer. Diese Vorliebe gilt allerdings nur für kurze Affären oder One-Night-Stands. Für längere Partnerschaften bevorzugen Frauen eher den zuverlässigen Typ. Diesen Zusammenhang beschreiben amerikanische Wissenschaftler nach psychologischen Tests mit mehr als 230 jungen Frauen in der Fachzeitschrift Psychological Science (Bd. 15, Nr. 3)."
- Immobilien-Investments: Handelsblatt: Immobilien-Investments bleiben für Investoren weiterhin attraktiv.
- "Internationale Attraktivität. Hamburg will sich als pulsierende Metropole mit internationaler Ausstrahlung im Wettbewerb mit anderen Metropolen behaupten. Die internationale Attraktivität und das internationale Marketing sind heute entscheidend für eine erfolgreiche Wachstumsstrategie.
- IT. IT-Jobs sind attraktiv. "Die IT-Branche übt weiterhin eine große Faszination auf Arbeitssuchende aus: In einer Umfrage nannten 40 Prozent das IT- und Internet-Business als attraktivstes Arbeitsumfeld." [Quelle]
- Jeder. beauty-ratgeber: Attraktiv sein kann jeder. Ebenso wie Schönheit ist Attraktivität schwer zu definieren. Eigentlich bedeutet Attraktivität nur zwischenmenschliche Anziehung. Für die Stärke und Dauer der Attraktivität ist nicht nur die körperliche Schönheit sondern auch die Persönlichkeit, die Einstellungen, Wertvorstellungen, Selbstbewusstsein und die soziale Stellung des einzelnen Menschen bedeutend. Attraktivität entsteht im Auge des Betrachters. Attraktivität ist die Summe unserer Erscheinung und umfasst auch Persönlichkeit, Mimik, Gestik, Motorik und Stimme.
- Juristen: derStandard: Juristen müssen wieder attraktiv für die Wirtschaft werden"
- Kauflust bei attraktiven VerkäuferInnen.. diktion (Werbung): "... Sehr oft werden Geschäftspartner, Verkäufer, Lieferanten oder Kaufleute aufgrund ihres Aussehens statt ihrer Substanz gewählt. Menschen sind eher geneigt, von gut aussehenden Verkäufern zu kaufen. ... "
- Küche attraktiv. [Quelle]
- Landwirtschaft: Die neue Landwirtschaft - innovativ und attraktiv [Quelle]
- Macho-Hormone > Hormone
- Macintosh. Der Mac-Dienstag: "Günstig und attraktiv. Einmal lesen, alles wissen. Wichtig u.a. heute: Neue iMacs und eMacs, ein weiteres Sicherheitsupdate für Mac OS 10.3.9 sowie die Leistung von Tiger im Vergleich zu Panther."
- Mannheimer Innenstadt: Attraktivität der Mannheimer Innenstadt. In ausgewählten Aspekten wurde untersucht, wie attraktiv die Innenstadt Mannheims in ihrem Aufenthaltswert, ihrer Erreichbarkeit und baulichen Gestaltung sowie ihrem Einkaufs- und Gastronomieangebot ist. Wie Abbildung 4 erkennen lässt, steht die öffentliche Sicherheit in der Wichtigkeitsplatzierung an erster Stelle; 78,1% der Befragten halten sie für sehr wichtig. Darauf folgen Bäume und Grünflächen, die Erreichbarkeit der Innenstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Sauberkeit der Gehwege sowie die Attraktivität der Fußgängerzonen. Dagegen sind die Aspekte eines geringen Verkehrsaufkommens und des Parkplatzangebots nur 36% bzw. 42% der Befragten sehr wichtig.
- Mauern > Hecken.
- Milchkontingente: Confoederatio Helvetia: Handel mit Milchkontingenten ist attraktiv. "PRESSEMITTEILUNG / Bern, 14.3.2001
- Mini-Jobs > Hartz IV.
- Museen: bildungsklick: Kultur Druckversion. Studien / Umfragen. Museen bleiben attraktiv. Wiesbaden, 12.04.2005, 08:33.
- Neue Bundesländer. Positionen/Hintergrundinformationen der UVB vom 16.05.2002: Wie attraktiv sind die neuen Bundesländer?"
- Optionsscheine. "Volatilität. Geringe Kursschwankungen machen Optionsscheine attraktiv. " FAZ. 12. Januar 2004
- Personalmeldungen: Attraktiv: Personalmeldungen aus Greifswald. (Quelle]
- Polen - Attraktiv durch Auslands-BAföG. [Quelle]
- Produktivität und Attraktivität: diktion (Werbung): "Eine Studie der Universität von Michigan hat jetzt den Einfluss der subjektiv empfundenen Attraktivität auf die Produktivität bewiesen. Die Sozialpsychologin Barbara L. Fredrickson fand unter 350 Männern und Frauen heraus, dass unattraktives Befinden eine verminderte geistige Leistung hervorbringt, insbesondere dann, wenn es um anspruchsvolle Aufgaben wie z. B. fortgeschrittene Mathematik geht.
- Rauchen. Die Attraktivität des Rauchens.
- Radtouren: "Attraktivität und Komfort: Attraktive Radrouten werden oft abseits der großen Straßen geführt. Ihr Verlauf ist für Ortsfremde und Menschen, die die Stadt bisher vor allem vom Auto oder von öffentlichen Verkehrsmitteln aus kennen gelernt haben, zuweilen nicht so einfach nachzuvollziehen. Deshalb ist eine gute, deutlich sichtbare und auch aus der Distanz leicht lesbare Wegweisung wichtig, um direkt und sicher ans Ziel zu gelangen. Postkartengroße und abgelegen angebrachte Schildchen sind zumindest bei Richtungswechseln ungenügend. Schließlich ist nicht jeder, der aufs Radl steigt, zum Pfadfinder geboren."
- Rheinfall nicht mehr attraktiv? "Neuhausen am Rheinfall - Der grösste Wasserfall Europas kämpft mit den Besucherzahlen. Dank einem neuen Informationszentrum sollen Touristen nun länger am Rhein verweilen. (bsk/sda).
- Schweizerisches Innovationssystem: Leistung und Attraktivität des schweizerischen Innovationssystems.
- SMS: golem: SMS-Studie - Kurzmitteilungen auch bei Älteren attraktiv. Dritte Mobinet-Studie über Handys, Internet und M-Commerce.
- Sportspiele attraktiv & sicher vermitteln."Aus dem Vorwort: "Die Sportspiele liegen in der Gunst unserer Schülerinnen und Schüler ganz oben. Leider trifft dies für die Großen Spiele auch bei der Liste der am stärksten von Unfällen im Schulsport betroffenen Sportarten zu. Eine umfassende Sicherheitsförderung im Sportunterricht setzt auf eine konstruktive Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen. Schülerwünsche aufgreifen und Sicherheit fördern heißt für uns Sportspiele attraktiv & sicher vermitteln."
- Staatsbürgerschaft Doppelte > Doppelte Staatsbürgerschaft
- Stabsfunktion. FAZ. "Vergütung aktuell Hohes Grundgehalt macht Stabsfunktionen attraktiv. 06. Mai 2005 Einsteiger in Stabsfunktionen können in deutschen Unternehmen mit attraktiven Gehältern rechnen. Zwischen 41000 und 46000 Euro verdienen Nachwuchskräfte in Abteilungen wie Marketing, Personal und Finanzen jährlich im Durchschnitt. Zu diesen Grundgehältern kommen jedoch eher geringe variable Vergütungsbestandteile, wie eine Untersuchung der Unternehmensberatung Towers Perrin ergab. ..."
- Studiengebühren: Pro-Physik: Attraktiv durch Gebühren? "Nach Ansicht von Baden-Württembergs Wissenschaftsminister Peter Frankenberg (CDU) machen Gebühren das Studium für Einkommensschwache attraktiv."
- Studieren in Nordrhein-Westfalen: mwf.nrw: Zahl der Studienanfänger im Sommersemester 2003 nahezu unverändert. Studieren in Nordrhein-Westfalen bleibt weiterhin attraktiv.
- Tagungsstandort Deutschland. Die Welt: Attraktiv wie nie: Tagungsstandort Deutschland. Berlin offeriert für Tagungsgäste die neue CongressCard. Was sie umfaßt und was andere Städte bieten.
- Telekom. ftd. "Das Kapital: Vergleichsweise ist die Telekom ziemlich attraktiv. Dass die Telekom mit den Q1-Zahlen nur die schlimmsten Vorbehalte ausräumte, war dann doch nicht genug. Weitere Themen in diesem Kapital: Wal-Mart und japanische Fusionen."
- Tourenwagen Masters. DTMattraktiv wie nie. Do 14 Apr, 11:45 Uhr. Hockenheim (dpa) - Die Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) ist vor der sechsten Saison seit ihrem Comeback 2000 so attraktiv wie nie.
- Verpackung, attraktive. diktion (Werbung): "... Und es ist bekannterweise nicht immer das beste Produkt, was sich verkaufen lässt, es ist öfter das mit der besten Verpackung."
- Wechseljahre: Bücher.de: Kleine-Gunk , Bernd ( ). Attraktiv und fit durch die Wechseljahre. Trias.
- Weißrußland > Belarus.
- Welt gewinnen: Hoffnungslos attraktiv? "„Nur drei Gruppen hätten eine wirkliche Strategie, die Welt zu gewinnen“, schreibt der Missionswissenschaftler Bill Wagner, früher Wiesbaden, jetzt Prof am Golden Gate Theological Seminary in San Francisco in seinem neuesten Buch „How Islam plans to Change the World“.
- Wissenschaft: Attraktivität der Wissenschaft in Deutschland verbessern - enormes Potential nutzen. Forum Innovation der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
- Wohnort: "Wohnort-Attraktivität ein einzigartiges Service - der USP für Ihre Projekt-Website!"
- Zäune > Hecken.
- Ziergehölze- attraktiv übers ganze Jahr. [Quelle]

Stichworte: Abhängigkeit, dependente Persönlichkeitsstörung, Devianz (z.B. abweichende sexuelle Vorlieben), Dysmorphophobien, Eßstörungen, Hörigkeit; Schlankheitssucht, Schönheitskulte, Übertreibungen.
III.
Soziologie und Kulturanthropologie der Attraktvität.
(In Arbeit)
Stichworte: Ästhetik, Schönheitsbegriff, Werte im Verlauf der Zeiten, Geschichte und Kulturen.
Abstract - Zusammenfassung
Attraktivitätsforschung.
Aufgrund der ungeheuren Vielfalt der Attraktivität und der Faktoren,
die sie beeinflussen, ist eine einheitliche Theorie nicht so schnell zu
erwarten. Es gibt viele theoretische Ansätze und Modelle und eine
ausgeprägte empirische und experimentelle Forschung. Zum Teil überschneiden
sich die verschiedenen Theorien und Modelle (Stichworte: Ähnlichkeitshypothese,
Aronsons Summary 1969, Balance-Theorie, Durchschnittshypothese, Einfluss
der Symmetrie, Equity-Theorie, Ergänzungshypothese, Theorie der Merkmalsausprägungen).
Die
Forschungsparadigma lauten: (1) Wie kommt es, daß A. B. attraktiv
findet? (2) Durch was wird die Attraktivitätsbewertung aufrecht erhalten
bzw. verändert? (3) Wie läßt sich die Attraktivität
beeinflussen (erzeugen, erhalten, verstärken, vertiefen, vermindern,
verlieren)?
Ähnlichkeitshypothese
("Gleich und gleich gesellt sich gern") [Textzitat
zu Street 1898]
Nach Mikula & Stroebe 1977, S. 77f schon von Street 1898 zusammen
mit der Ergänzungs- bzw. Komplementaritätshypothese diskutiert.
Wienold (1972, S. 35) referiert einige empirische Untersuchungen und Modelle
zur Ähnlichkeitshypothese und nennt folgende "beweiskräftigen"
Arbeiten: Preston, Peltz, Mudd & Froscher 1952, Davitz 1955, Berkowitz
& Howard 1959, Burdick & Burnes 1958, Itzard 1960, Byrne 1961,
1964. Donn Byrne fand demnach eine fast lineare Beziehung zwischen
Attraktion (A) und Ähnlichkeit A = a + b *Y, wobei sich empirisch
die konkreten Werte ergaben: b = 5,44 und a = 6,62. Bei diesen Werten
ist zu berücksichtigen, daß die Skala der Attraktion von 2 -
14 und die Ähnlichkeit mit Werten zwischen 0 und 1 erfaßt wurde.
Wie kann man diese Werte nun interpretieren? Hierzu machen wir uns
am besten erst einmal eine Wertetabelle und vergegenwärtigen uns die
Zusammenhänge in einem Schaubild:
Abb. Zusammenhang Attraktion und Ähnlichkeit nach Byrne & Nelson 1965

_
Wichtig: Auch wenn die Ähnlichkeit 0 ist, erhält die Attraktion
bereits einen Wert von 6,620. Da nach der Skalierung das Maximum für
die Attraktion 12,060 (bei einer Ähnlichkeit von 1) beträgt,
liegt also bereits eine gut mittlere Attraktion bei 0 Ähnlichkeit,
also maximaler Ergänzung bzw. Komplementarität. Das ist inhaltlich
ein merkwürdiges und in sich widersprüchliches Ergebnis. Denn
es besagt einerseits, daß eine gut mittlere Attraktion (6,62 von12,060
Skalenpunkten aus der Spannweite 2-14) bereits bei 0, also minimalster
Ähnlichkeit vorliegt und andererseits, daß die Attraktion maximal
(=12,06) wird, wenn die Ähnlichkeit (=1) maximal ist, also ein extrem
narzißtisches Ergebnis: B ist für A maximal attraktiv, wenn
B, genau wie A sich selbst sieht, wahrgenommen wird. Dieses Ergebnis widerspricht
der Ergänzungshypothese ("Gegensätze
ziehen sich an"). Dieser Befund bedarf also weiterer kritischer Analyse.
Aronsons Summary 1969
Aronson (1969) hat sieben Faktoren zusammengestellt,
die in der Forschung der Sympathie-Beziehung als wichtig herausgefunden
wurden; es sind dies:
Wir mögen Menschen,
die:
a) uns nahe sind
b) ähnliche Ansichten
haben
c) uns selbst ähnlich
sind
d) Bedürfnisse
haben, die WIR befriedigen können und unsere Bedürfnisse befriedigen
e) über Fähigkeiten
und Kompetenzen verfügen
f) angenehm sind und
schöne Dinge tun
g) uns mögen
Zusammengefaßt könnte man diese Faktoren wie folgt beschreiben: Wir mögen Menschen, die uns maximale Befriedigung geben bei minimalem Aufwand und umgekehrt, in diesem Sinne also auch ein Ausdruck der Equity-Theorie (Mini-Max Prinzip des Kosten/ Nutzens).
Durchschnittshypothese (Langlois & Roggman, 1990) [Q,]
Einfluss der Symmetrie (Thornhill & Gangestad, 1993) [Q,]
Equity-Theorie intimer Sozialbeziehungen (Mini-Max Theorie; Walster et al. 1977 in Mikula & Stroebe 1977 ; Lit: Hassebrauck, M. 1980), S. 193f .
Variante der Sozialen Austauschtheorie (Thibaut & Kelly 1959) n. SQ: "Die Equity-Theorie von Walster, Berscheid und Walster (1973) ist eine Variante der sozialen Austauschtheorie (Thibaut & Kelly, 1959). Sie besagt im wesentlichen, dass die [<6] Zufriedenheit in zwischenmenschlichen Beziehungen davon abhängt, wie ausgewogen, gerecht oder fair sie wahrgenommen werden. Dies sollte für alle Sozialbeziehungen gelten, für Geschäftsbeziehungen genauso wie für Freundschafts- und Liebesbeziehungen (Walster, Walster & Berscheid, 1978). Überträgt man das Modell auf Paarbeziehungen, so geht es darum, ob das, was man in die Partnerschaft einbringt, durch das aufgewogen wird, was man durch die Partnerschaft bekommt, ob also der Input dem Outcome entspricht. Der Outcome berechnet sich aus Nutzen minus Kosten. Die Equity-Theorie besteht aus vier Thesen (Hatfield et al., 1984):
- Menschen versuchen, den Nutzen, den sie aus einer Beziehung ziehen zu maximieren und gleichzeitig die anfallenden Kosten zu minimieren.
- Gemeinschaften achten im Sinne der Maximierung des kollektiven Nutzens darauf, dass sich die einzelnen Mitglieder nicht egoistisch verhalten. Daher entwickeln sie Systeme der gerechten Verteilung von Belohnungen und Kosten. Mitglieder, die andere gerecht behandeln, werden belohnt, andere werden bestraft.
- Wenn Menschen sich in unausgewogenen Beziehungen befinden, fühlen sie sich unwohl. Je ungerechter die Beziehung, desto größer der erlebte Stress.
- Menschen, die sich in einer ungerechten Beziehung befinden, versuchen die Ausgewogenheit wiederherzustellen, um damit den Stress abzubauen. Je größer die Unausgewogenheit, umso stärker die Bemühungen um Ausgleich."
Ergänzungshypothese
("Gegensätze ziehen sich an") [Textzitat
zu Street 1898]
Theorie der Komplementarität, Gegenstück zur Ähnlichkeitshypothese
(s.o.).
Theorie der Merkmalsausprägungen (Cunningham, 1986) [Q,]
Kleiner Reader - Textzitate
Streets
erste Befragung 1898 zu Ähnlichkeit und Komplementarität
nach Mikula & Stroebe 1977, S. 77f. aus Kapitel 3: Ähnlichkeit
und Komplementarität [FN1] der Bedürfnisse
als Kriterien der Partnerwahl: Zwei spezielle Hypothesen
Attraktivität ist eine positive Wertigkeit
Aus "II. Das Konstrukt interpersonale Attraktion", S. 15:
"Wie schon die einleitend dargebotene Auswahl einschlägiger umgangssprachlichcr
Ausdrücke erkennen läßt, gibt es verschiedene Formen der
zwischenmenschlichen Anziehung, die sich sowohl in ihrer Art als auch in
ihrer Intensitat wesentlich voneinander unterscheiden (vgl. auch NEWCOMB
1960). Trotz der bestehenden Unterschiede haben sie jedoch auch etwas gemeinsam:
sie betreffen alle eine auf einen anderen Menschen gerichtete Orientierung
oder Einstellung, die durch eine positive Wertigkeit charakterisiert ist.
Wie später noch ausführlicher gezeigt werden wird, ist die Ursache
für diese positive Wertigkeit darin zu sehen, daß der Andere,
der Partner, auf den die Orientierung gerichtet ist, mit einem als angenehm
oder belohnend empfundenen Zustand verknüpft ist, sei es weil er in
der Vergangenheit in einem derartigen Kontext erlebt wurde, oder sei es,
daß dieser Zustand aufgrund irgendwelcher Hinsveise auch nur erwartungsmäßig
vorweggenommen wird. Zusammenfassend können wir also sagen, daß
es sich bei der zwischenmenschlichen Anziehung um eine positive Einstellung
eines Individaums gegenüber einer Person handelt, deren Eigenschaften
und Handlungen fiir des Individuum Belohnungswert hat."
Wichtiger Hinweis: Wissenschaftstheoretische Unterscheidung bei Attraktivitätsbekundungen, die Aussagen oder Werurteile sein können.
Psychologie des ersten Eindrucks (Geleitwort von Oswald Kroh, 1937)
 |
Aus dem Geleitwort von Dr. Oswald Kroh, S. V.
"Der erste Eindruck, wie er im zwischenmenschlichen Verkehr gewonnen wird, stellt ein psychologisches Grundphänomen dar, denn er ist eine der wichtigsten, weil erkenntnisträchtigsten Gelegenheiten, in jeder Form unmittelbarer menschlicher Begegnung die natürlichen Mittel der Menschenerkenntnis anzusetzen, sie im ständigen Gebrauch zu schulen und für das zwischenmenschliche Verhalten bedeutsam werden zu lassen. Die ältere wissensohaftliche Psychologie, die ihre Grundphänomene ("Elemente") immer erst auf dem Wege einer Analyse gewann, mußte demgegenüber im ersten Eindruck zu allererst das Ergebnis eines Zusammenwirkens von Instinkten, Empfindungen, Wahrnehmungen, Vorstellungen, Assoziationen, Gefühlen, Aufmerksamkeitsakten, Einstellungen, Annahmen und Vergleichen sehen. |
| Jeder Versuch, dem eigentümlichen komplexen Wesen des ersten Eindrucks
gerecht zu werden, mußte daher für sie infolge der Vielfalt
der zu berücksichtigenden Gesichtspunkte und Probleme eine fast hoffnungslos
schwierige, weil unendlich detailreiche Aufgabe bleiben. Eine Aufgabe,
an die sie sich deshalb auch nirgends grundsätzlich heranwagte, wie
die Literatur erkennen läßt.
Für die Psychologie der Gegenwart hat der Sachverhalt "erster Eindruck" an seiner Komplexheit nichts eingebüßt. Vielmehr muß er heute analysierender Betrachtung noch komplexer erscheinen als früher, weil das Verständnis für die im ersten Eindruck wirkenden psychischen Erlebnisformen vorbewußter und prärationaler Art inzwischen erheblich gewachsen ist. Zugleich aber mußte der entwicklungspsychologische Aspekt, der im ersten Eindruck eine Urform zwischenmenschlichen Erkennens überhaupt vorfand, die Überzeugung hervorrufen und kräftigen, daß die höhere Komplexheit auch hier nur Begleiterscheinung einer größeren ursprünglichen Ganzheitlichkeit ist. M. a. W., daß jede Analyse, die auf seelische Elementarfunktionen älterer Scheidung zurückzugreifen sucht, dem Wesen des Phänomens nicht gerecht zu werden vermag. Diese Erkenntnis, vorbereitet und genährt [<V.] von der Ausdruckskunde unserer Tage, scheint zunächst einen exakten wissenschaftlichen Zugang zum Phänomen des ersten Eindrucks zu verschließen. Daß ein solcher Zugang gleichwohl möglich ist, beweist der Verf. mit der vorliegenden Schrift. ... " |
Der erste Eindruck an sich
(Eckstein
1937, S. 54-56)
(im Orginaltext gesperrt geschriebene Stellen hier kursiv)
| "Ergebnis dieses Abschnittes ist demnach,
daß der erste Eindruck ursprünglich und seinem Wesen entsprechend
auf das Auffallende, das Besondere, das Hervorstechende eingestellt
zu sein scheint. Damit ist eine Erkenntnis erhärtet worden, die schon
an-[<54]läßlich der inhaltlichen Betrachtung bei den Aussagen
über die körperliche Erscheinung aufgetaucht war. Was dort für
diese eine und die ihr verwandten Aussagengruppen herausgestellt worden
ist, kann also nun ruhig verallgemeinert und als Wesenszug des ersten Eindruckes
überhaupt angesehen werden.
Je mehr man sich die Niederschriften erster Eindrücke vergegenwärtigt und deren Inhalte vor sein inneres Auge stellt, desto mehr drängt sich einem ein Vergleichsbild auf. Es scheint beim ersten Eindruck von Menschen nicht anders zu sein, als wenn man zum erstenmal von einem bedeutenden Aussichtspunkt aus eine bisher nicht gekannte Landschaft vor sich sieht. Derjenige, der sich dabei um eine zeichnerische Festhaltung des Gesehenen bemüht, wird auf sein vor ihm liegendes Blatt gewißlich zuerst ganz bestimmte auffallende Punkte und Linienzüge skizzierend eintragen, um von ihnen aus dann zu einer genaueren Einzelbearbeitung weiterzuschreiten. Ist der Betrachter der Landschaft nicht Zeichner, dessen Auge zuerst einmal Formen sieht, sondern beispielsweise Geologe und Geograph, so wird der Inhalt der Beeindruckung durch dieselbe Landschaft sofort bestimmte Abwandlungen erfahren. Dem Geologen werden die vor ihm ausgebreiteten Landschaftsformen sogleich der "Ausdruck" einer bestimmten erdgeschichtlichen Entstehungsweise sein, und er wird ein entsprechendes tektonisches Gefüge vermuten. Der Geograph hingegen sieht schon auf den ersten Blick Zusammenhänge zwischen Klima, Bewachsung, Bewässerung, Besiedlung usw. Nicht allemal jedoch wird das innere Verständnis beim ersten Anblick schon gleichermaßen weitgehend sein können. Je neu- und fremdartiger der Landschaftscharakter ist, desto mehr müssen sich die Betrachter mit einer nur feststellenden Beschreibung etwa der folgenden Art begnügen: In dieser Richtung liegt ein eigentümlich geformter Berg, über dessen Entstehung und Beziehungen zur umgebenden Landschaft noch keine Klarheit besteht; dort breiten sich Waldgebiete aus, wo doch sonst Äcker und Wiesen sein könnten usw. Der erste Eindruck kann so zwar schon eine ganze Anzahl von Eigentümlichkeiten enthalten, ohne jedoch über ursächliche und Entstehungszusammenhänge oder über gewisse innere Bedingtheiten schon Klarheit zu haben. Vielleicht stellt er dann zwar Fragen, gibt aber noch keine Antworten. In manchen Fällen wieder wird sich der Betrachter in Ermangelung besonders hervorstechender Punkte unter Anlehnung an seinen eigenen erdkundlichen Kategorienschatz mit ganz allge-[<55]meinen Feststellungen begnügen: Wald- und Hochebene, fruchtbares Flachland, östlich bewaldet, westwärts besiedelt usw. Im ersten Eindruck von Menschen scheint sich dem aufnehmenden Bewußtsein in ähnlichen Formen besonderermaßen das Auffallende und Hervorstechende einzuprägen. Der Eindruck kann dabei u. U. über die bloße Aufreihung von mehr oder weniger äußerlich auffallenden Punkten nicht hinauskommen, während er sich in anderen Fällen von Anfang an schon auf offenbar wesentliche Stellen festlegt. Des öfteren aber kann es ihm auch schon gelingen, eine Skizze der inneren Zusammenhänge und des wesentlichen Kräfteverhältnisses aufzureißen. Wie in ihm das eine Mal allerlei Fragen und Probleme aufgegeben werden, so scheint er das andere Mal von vornherein schon zu wissen, worin das Besondere zu suchen sein dürfte. Nochmals kann also zusammenfassend festgestellt werden: es gehört zum Wesen des ersten Eindruckes, daß er sich in erster Linie an das hält, was auffällt, und aus dem Durchschnittsrahmen herausragt, seien dies nun besondere körperliche Formen und Proportionen, bestimmte Auffälligkeiten in Ausdruck und Gebaren, oder sei es das vermeintlich Hervorstehendste im innersten Gefüge und Wesen. Die Gesichtspunkte der Betrachtung können dabei verschiedene sein, gemeint aber ist immer und von jeder Seite aus das Besondere, welches als solches anscheinend in erster Linie beeindruckt und in die Augen fällt. Mit der soeben vorgenommenen Festlegung des ersten Eindruckes auf das "Auffallende" tut sich sofort nun die Frage auf, ob denn in diesem "Auffälligen" zugleich auch Wesentliches gesehen werden könne oder nicht. Ist der erste Blick nicht nur gebunden an Auffälligkeiten äußerer Art, von denen aus der Beeindruckte dann irrtümlicherweise auch auf innerliche Besonderheiten glaubt schließen zu können? Kann nämlich dem ersten Eindruck nachgewiesen werden, daß ihm der Durchgriff vom äußerlich Auffälligen hinein in das Innere nicht gelingt, so ist seine Auffassungsweise eine solche der Äußerlichkeit und der Oberflächlichkeit, der weitere Beachtung zu schenken nicht berechtigt ist. Ob dies Auffällige nun auch wirklich wesentlich ist, kann vom Bisherigen aus jedoch nicht entschieden werden. Dafür ist die Betrachtung der ersten Eindrücke selbst und unter sich nicht hinreichend. Wir müssen einen objektiven Maßstab an sie heranlegen. Erst an Hand eines solchen Maßstabes läßt sich dann feststellen, ob der erste Eindruck nur äußerlicher und oberflächlicher Art ist, oder ob er auch wesenhaft Bedeutsames enthält." |
Theorien und Determinanten der zwischenmenschlichen Anziehung
Aus Mikula, G. & Stroebe W. (1991). (1991, S. 75f)
 |
"1.5. Schlußfolgerungen und Implikationen
Die vier Arten von theoretischen Ansätzen, die in diesem Abschnitt dargestellt wurden, führen die Entwicklung zwischenmenschlicher Attraktion auf sehr unterschiedliche Ursachen zurück. In Abhängigkeit von der theoretischen Perspektive erklärt man die gegenüber einer anderen Person empfundene Anziehung durch positive Informationen über diese Person, die Befriedigung des Bedürfnisses nach Konsistenz, positive Verstärkungen durch den anderen oder befriedigende Interaktionen mit der anderen Person. Bei diesen Unterschieden in den Grundannahmen mag es verwundern, daß sich zwischen den dargestellten Theorien kaum Unterschiede in den empirischen Vorhersagen ergeben. |
| Wenn zum Beispiel p o sympathisch findet, weil
o
immer lacht, wenn p eine witzige Bemerkung macht, dann wäre
dieser Zusammenhang für alle Ansätze leicht erklärbar. Für
die Informationsverarbeitungsansätze wäre diese Reaktion eine
positive Information für p. Durch sein. Lachen zeigt o
nach Meinung von p, daß er Sinn für Humor hat und daß
er auch subtile Scherze versteht. Diese positiven Informationen sollten
die Bewertung von o durch p verbessern. Für die Gleichgewichtstheorien
impliziert das Lachen eine positive Gefühlsbeziehung zwischen o
und den witzigen Anmerkungen von p, während p mit den
von ihm erzählten Anekdoten eine positive Einheitsbeziehung verbindet.
Diese p-o-x-Triade wäre dann im Gleichgewicht,
wenn p eine positive Gefühlsbeziehung zu o entwickeln
würde. Nach den Konditionierungstheorien stellt die positive
Reaktion, die o auf die Witze von p zeigt, eine positive
Verstärkung dar, die bei o eine positive affektive Reaktion
hervorruft. Durch die Assoziation von o mit dieser Reaktion wird
diese auf o konditioniert. Für die Austauschtheorien stellt
das Gelächter von o für p ein positives Handlungsergebnis
dar, das dazu beitragen mag, daß seine Ergebnisse in dieser Interaktion
über seinem allgemeinen Vergleichsniveau zu liegen kommen.
Diese Übereinstimmung ist jedoch weniger überraschend, wenn man bedenkt, daß positive Verstärkungen oder Interaktionen in. der Regel auch positive Informationen implizieren. Umgekehrt erwartet man von jemand, über den man positive Informationen hat, daß er auch positive Verstärkungen vermittelt oder daß die Interaktion mit dieser Person zu überdurchschnittlich guten Ergebnissen führt. Lange Zeit galten aller- [<75] dings Befunde, die zeigten, daß Anziehung auch dann entstehen kann, wenn andere nur zufällig mit einer positiven Verstärkung assoziiert waren (z.B. Veitch & Griffitt, 1976), sowohl mit Informationsverarbeitungstheorien als auch mit austauschtheoretischen Ansätzen als unvereinbar (vgl. Stroebe, 1981). Dieser Widerspruch läßt sich aber inzwischen unter Anwendung von Verfügbarkeits- oder Priming-Theorien stimmungskongruenten Erinnerns lösen (z.B. Bower, 1981; Clark & Isen, 1982)." |
Kulturvergleichende
Beziehungsforschung (Asendorpf & Banse (2000, S. 264)
 |
"5.2 Kulturvergleichende Beziehungsforschung
Inzwischen gibt es sehr umfangreiche Daten über Kulturen im 20. Jahrhundert, die empirische Untersuchungen über Unterschiede in Beziehungsformen und ihren kulturellen Bedingungen erlauben. Viele dieser Daten sind in den Human Relations Area Files gesammelt, die über mehrere Klassifikationen erschließbar sind. Der Ethnographic Atlas (Murdock, 1967) enthält eine Übersicht über 863 Kulturen, das Standard Cross-Cultural Sample von Murdock und White (1969) eine für die Bestimmung von Korrelationen zwischen Kulturen gut geeignete Stichprobe von 60 nichtüberlappenden Kulturen. Die Outline of Cultural Materials (Murdock, Ford & Hudson, 1971) ist eine Klassifikation |
| von 79 dokumentierten kulturellen Inhalten, darunter die beziehungsrelevanten
Inhalte Interpersonal Relations, Marriage und Family. Durch Kreuzklassifikation
von Kulturen und Beziehungstypen lassen sich interkulturelle Unterschiede
empirisch untersuchen. So fanden z.B. Daly und Wilson (1983), daß
83% der Kulturen des Ethnographic Atlas Polygynie erlaubten (ein
Mann hat mehrere Ehefrauen). Polyandrie (eine Frau hat mehrere Ehemänner)
oder Polygynandrie (mehrere Frauen sind mit mehreren Männern
verheiratet) waren hingegen in nur 4 der Kulturen erlaubt (0.05%), und
in diesen war gleichzeitig auch Polygynie akzeptiert. Monogamie
(ein Mann und eine Frau pro Ehe) als ausschließliche Eheform war
also im 20. Jahrhundert keineswegs der Normalfall. Geschichtlich betrachtet
war es ebenso. Polygynie wurde nicht nur in allen islamischen Kulturen,
sondern auch im alten China und Indien sowie von den vorchristlichen europäischen
Stämmen praktiziert (Taylor, 1954).
... So untypisch wie das Polygamieverbot der christlichen Kulturen ist, so wenig allgemeingültig ist die neolokale Form des Zusammenwohnens des Ehepaares (sie wohnen nicht bei Verwandten der Frau oder des Mannes, sondern an einem neuen Ort). Verbreitet sind auch die patrilokale Form (die Verheirateten ziehen in den Haushalt der Eltern des Mannes) oder die matrilokale Form (sie ziehen in den Haushalt der Eltern der Frau).... " |
Anmerkung: Die Ausführungen der Autoren haben auch praktische Bedeutung für interkulturelle Beziehungen und Partnerschaften. S. 276 enthält hierzu 9 Ratschläge für den Umgang mit Angehörigen kollektivistischer Kulturen (nach den Autoren (S. 275 f) z.B. Honkkong, Singapur, Japan, Indien - im Gegensatz zu individualistischen Kulturen wie z.B. die USA).
Literatur (Auswahl). [Anregungen,
Hinweise, Kritik willkommen]
siehe auch Literatur-Listen Mode,
Bindung,
Gefühle,
Werte,
Es ist sehr schwierig, die relevante Attrakktivitätsliteratur zu erfassen,
weil viele andere psychologischen Disziplinen, Soziologie und auch Biologie,
eine Rolle spielen. Schwerpunktmäßig wird ein Teil der Attraktivitätsliteratur
im engeren Sinne erfaßt. Die Trivialliteratur der Attraktivität
ist meist an der Optimierung des eigenen Äußeren orientiert.
Das ist ist nicht unwichtig, aber doch recht einseitig, sollte aber trotzdem
erfaßt werden, weil sie für das Verständnis durchschnittlichen
Mesnchen und jeweiligen Zeitgeistes sehr wichtig ist. Man wundere sich
daher nicht, wenn hier z.B. auch "Brigitte" zitiert wird.
Literaturlisten / Buchbesprechungen (teilweise kommentiert) zum Thema Attraktivität
- Uni Regensburg beautycheck.: Buchtipps und Links.
- Uni Saarland Forschungsthemen: Physische Attraktivität.
- novafeel: Attraktivität.
- Homepage Prof. M. Hassebrauck.

_
- Amelang, Manfred; Ahrend, Hans-Joachim & Bierhoff, Hans Werner (1991, Hrsg.). Attraktion und Liebe. Formen und Grundlagen partnerschaftlicher Beziehungen. Göttingen: Hogrefe.
- Anders, Georg & Hartmann, Wolfgang (1996, Red.). Wirtschaftsfaktor Sport. Attraktivität von Sportarten für Sponsoren. Wirtschaftliche Wirkungen von Sportgroßveranstaltungen, Sport und Buch. Köln: Strauß.
- Argyle, Michael & Henderson, Monika (1986). Die Anatomie menschlicher Beziehungen. Spielregeln des Zusammenlebens. Paderborn: Junfermann.
- Bader, Irsis; Möller, Christa & Wittmann, Ingeborg (~1997). Schön sein, BRIGITTE Edition. Köln: Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH.
- Bernard I. (197 ,Ed.). Theories of attraction and love. New York: Springer.
- Bossi, Jeannette (1995). Augen-Blicke. Zur Psychologie des Flirts. Bern: Huber.
- Buhl, T. & Hassebrauck, M. (1995). Liebe in 3-D. Eine empirische Untersuchung zur Dreieckstheorie von Sternberg. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 26, 67-77.
- Bull , Ray & Rumsey, Nichola (1988). The social psychology of facial appearance. New York: Springer.
- Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses testet in 37 cultures, Bahavioral and Brain Scienes, 12, 1-47.
- Byrne, Donn (1971). The attraction paradigm. New York : Acad. Press.
- Cook, Mark (1979, Ed.). Love and attraction . International Conference on Love and Attraction 1977, Swansea. Oxford: Pergamon Press.
- Die Geschichte der Schönheit, zwei Teile (Video, Phönix 4.5.17)
- Duck, Steve (1977). Theory and practice in interpersonal attraction. London: Academic Press.
- Dujmic, B. Kann denn Schönheit Sünde sein ? Wien, Ueberreuter, o.J. Die vielen Wege zu längerer Jugend u. Attraktivität.
- Eckes, T. & Hassebrauck, M. (1993). Multimodale Analysen zur Wahrnehmung physischer Attraktivität. In M. Hassebrauck & R. Niketta (Hrsg.), Physische Attraktivität (S.95-121). Göttingen: Hogrefe.
- Ehring, Andrea (1997). Was Frauen an Männern mögen. Attraktivität und Power für den Mann,.München: Erd.
- Etcoff, Nancy (2001). Nur die Schönsten überleben. Die Ästhetik des Menschen.
- Freudenfeld, Elsbeth (o.J.). Liebesstile, Liebeskomponenten und Bedingungen für Glück und Trennung bei deutschen und mexikanischen Paaren - Eine kulturvergleichende Studie: http://w210.ub.uni-tuebingen.de/dbt/volltexte/2002/519/pdf/ELI-Diss-Endfassung.pdf.
- Grammer, Karl (1995). Signale der Liebe. Die biologischen Gesetze der Partnerschaft.
- Hassebrauck, M. (1980). Equity-Theorie und intimere Sozialbeziehungen. Darmstadt: Institut für Psychologie der Technischen Hochschule. Bericht Nr. 80-1.
- Hassebrauck, M. (1990). Über den Zusammenhang der Ähnlichkeit von Attitüden, Interessen und Persönlichkeitsmerkmalen und der Qualität heterosexueller Paarbeziehungen. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 21, 265-273.
- Hassebrauck, Manfred & Niketta, Rainer (1993, Hrsg.). Physische Attraktivität. Göttingen: Hogrefe.
- Hassebrauck, M. (1993). Die Beurteilung der physischen Attraktivität. In M. Hassebrauck & R. Niketta (Hrsg.), Physische Attraktivität (S. 29-59). Göttingen, Hogrefe.
- Hassebrauck, M. (1995). Physische Attraktivität - Ein Überblick über den Forschungsstand. In K. Pawlik (Hrsg). Bericht über den 39. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Hamburg, 1994 (S. 312-318). Göttingen: Hogrefe.
- Hassebrauck, M. (2000, 21. März). Das Maß aller Dinge: Wer ist schön? Bild der Wissenschaft: special "Leben, Liebe, Partnerschaft", 12-17.
- Hassebrauck, Manfred & Küpper, Beate (2002). Warum wir aufeinander fliegen. Die Gesetze der Partnerwahl.
- Hassebrauck, M. (2002). Physische Attraktivität – eine evolutionspsychologische Perspektive. In W. Fritsch-Rößler (Hrsg.), Frauenblicke, Männerblicke, Frauenzimmer. Studien zu Blick, Geschlecht und Raum. (S. 37-50). Röhrig Universitätsverlag. St. Ingbert.
- Hassebrauck, M. & Küpper, B. (2002). Theorien interpersonaler Attraktion. In D. Frey & M. Irle (Hrsg.), Theorien der Sozialpsychologie, Band 2: Theorien zur sozialen Interaktion und Gruppenprozessen (S. 156-177). Bern: Huber.
- Heising, Gerd; Hensel, Bernhard & Rost, Wolf (2002). Zur Attraktivität des bösen Objekts. Anwendungen der Objektbeziehungstheorie in der Giessener Schule. : Psychosozial-Verlag.
- Henss, Ronald (1992). "Spieglein, Spieglein an der Wand ..." Geschlecht, Alter und physische Attraktivität. Weinheim: Psychologie-Verl.-Union. [widerspricht dem soziolkulturellen Relativismus und vertritt einen evolutionspsychologischen Standardismus]
- Henss, Ronald (1998). Gesicht und Persönlichkeitseindruck. Sozialpsychologisches Buch über die Wahrnehmung und Beurteilung von Gesichtern.
- Herkner, Wener (1978). Kontakt, Sympathie und Einstellungsähnlichkeit. Untersuchugen zur Balancetheorie [Heider]. Bern: Huber.
- Hergovich, Andreas (Hrsg.) (2002). Psychologie der Schönheit. Physische Attraktivität aus wissenschaftlicher Perspektive.
- Kaufmann, Christine (1997). Meine Schönheitsgeheimnisse. Körper und Seele im Einklang. Augsburg: Weltbild.
- Kümmerling, A. & Hassebrauck, M. (2001). Schöner Mann, reiche Frau? Die Gesetze der Partnerwahl im gesellschaftlichen Wandel. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 32, 81-94.
- Lafrenz, J. & Möller, I. (1976). Gruppenspezifische Aktivitäten als Reaktionen auf die Attraktivität einer Fremdenverkehrsgemeinde. Pilotstudy am Beispiel der Bädergemeinde Haffkrug- Scharbeutz. (Mit zwei weiter Beiträgen v. Breitengross, J.P. u. Schliephake, K.). Hamburg: .
- Mikula, Gerold & Stroebe, W. (1977, Hrsg.). Sympathie, Freundschaft und Ehe. Pychologische Grundlagen zwischenmenschl. Beziehungen. Bern: Huber. [enthält viele, besonders auch historisch wichtige Literaturhinweise]
- Mikula, G. & Stroebe W. (1991). Theorien und Determinanten der zwischenmenschlichen Anziehung. In: Amelang, M. et al. (1991, Hrsg.), 61-104.
- Miller, Geoffrey F. (2001). Die sexuelle Evolution. Partnerwahl und die Entstehung des Geistes.
- Newton, Helmut (2004). Helmut Newton - Portraits. Text von Klaus Honnef. München 2004. [Als Pantheon der VIPs aus Film, Mode, Politik und Kultur kann Helmut Newtons Portraitsammlung allemal gelten. Aber sie ist noch mehr. Auch seinen Portraits sieht man an, daß er am liebsten ein römischer Paparazzo geworden wäre, wie er selbst einmal sagte. Spätestens ab den 80er Jahren gab es unter den beautiful people dieser Welt wohl keinen mehr, der sich nicht von Helmut Newton fotografieren lassen wollte. Vor seiner Kamera ließen sie, ob Frau oder Mann, die Hüllen fallen - ganz konkret und im übertragenen Sinn. In brillanten Inszenierungen feierte er die Attraktivität und Prominenz seiner Modelle ebenso wie ihre Eitelkeiten und kleinen Schwächen. Als Auftragsarbeiten für die großen Modemagazine und elitären Kunstzeitschriften entstanden, ist Newtons hochkarätige Portraitkollektion, die 1985 erstmals erschien, auch ein Erotikon erster Güte. Helmut Newton, 1920 in Berlin geboren, starb im Januar 2004]
- Oberbeil, Klaus (1996). Mineralien und Spurenelemente. Leistungssteigerung, Attraktivität und Glücksgefühle durch Mineralien und Spurenelemente, München: Südwest Verlag.
- Pashos, Alexander (2002). Über die Rolle von Status, physischer Attraktivität und Taktiken in der menschlichen Partnerwahl. Soziokulturelle und evolutionsbiologische Mechanismen und Prozesse menschlichen Sozialverhaltens. Göttingen: Cuvillier.
- Ruch, F. L. & Zimbardo P. G. (dt. 1975 ff). Lehrbuch der Psychologie. Berlin: Springer.
- Schmidtchen, G. (1987). Sekten und Psychokultur. Reichweite und Attraktivität von Jugendreligionen in der Bundesrepublik Deutschland. Freiburg: Herder.
- Smith, Thomas Spence (1992). Strong interaction. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Street, J. R. (1898). A study in moral eduacation. The Paedagogical Seminary and Journal of Generic Psychology 5, 2-40.
- Teschke, Gisela L. (2003). Der Weg zur Schönheit mit den Fünf 'Tibetern'. Mehr Ausstrahlung, Selbstbewusstsein und Attraktivität. : Scherz .
- Wienold, Hanns (1972). Kontakt, Einfühlung und Attraktion. Zur Entwicklung von Paarbeziehungen Stuttgart: Enke.
- Wilson, G. und D. Nias (dt. 1977, engl. 1976). Erotische Anziehungskraft. Psychologie der sexuellen Attraktivität. Übersetzung [und Nachwort] von K.-W. Wenzel. Frankfurt: Ullstein, 1977.
- Gruppendynamik 4/1995. Zeitschrift für angewandte Sozialpsychologie. THEMA: Attraktion und Liebe. Leske + Budrich Leverkusen. INHALT: Helmut E. Lück: Editorial. Manfred Sader: Attraktionsforschung und Gruppenprozeß. Hans W. Bierhoff, Ina Grau: Dimensionen der Liebesbeziehungen. Erich H. Witte, Heidrun Sperling: Wie Liebesbeziehungen den Umgang mit Freunden geregelt wünschen. Viktor Oubaid, Manfred Amelang: Die Attraktivität von Personen auf dem Partnermarkt als Folge bereits vorhandenen Nachwuchses: Prüfung einer soziobiologischen Überlegung. Erich Kirchler, Erik Hölzl: Vom Austausch zum Altruismus: Profitorientierung versus spontane Angebote in interpersonellen Beziehungen. Michael Weber, Mechthild Herzer, Klaus Glaser, Fridbert Hanke: Führungsfortbildung und Personalentwicklung in der Caritas Köln.
- Goffman, : Erving (1982). Das Individuum im öffentlichen Austausch. Mikrostudien zur öffentlichen Ordnung. Frankfurta.M.: Suhrkamp.
- Nickel, Ulrike (1997). Kinowerbung - Der Film vor dem Film, U.M. [ Kino ist ein Gemeinschaftserlebnis von hoher Attraktivität und Aktualität - und Werbung ist mittendrin. Wohin der Trend geht, zeigt diese Analyse der Agentur U.M.]
Bankhofer, Hademar (1985). Hautnah schön. Attraktivität leicht gemacht. 82 Profi-Tips. Ullstein Verlag 1995.
Zur Einordnung noch nicht entschieden (Randgebiete z.B. Werbung, Kommunikation, öff. Leben oder auch zu speziell).
Links (Auswahl: beachte)
Eine Teil der Links wurde von anderen Seiten übernommen (die hier
mit SQ=Sekundärquellenhinweis zitiert werden )
- Die ideale Schönheit des menschlichen Körpers in der Kunst (SQ). http://www.cichon.de/ideal-beauty/
- Die Geschichte der Miss-Wahlen (SQ): http://www.hdg.de/Final/deu/page2339.htm.
- University of St Andrews, School of Psychology (SQ). Forschungsergebnisse zu Attraktivität (Morphing, Alterungsprozesse, Symmetrie, Durchschnittshypothese). Mit Online-Experimenten, die man selbst ausprobieren kann: http://www.st-and.ac.uk/%7Eimaging/.
- Ludwig-Boltzmann-Institute For Urban Ethology (Irenäus Eibl-Eibesfeldt & Karl Grammer). Einige wissenschaftliche Studien zur Attraktivität SQ): http://evolution.anthro.univie.ac.at/institutes/urbanethology/beautypro.html.
***
Ludwig-Boltzmann-Institute For Urban Ethology (Irenäus Eibl-Eibesfeldt
& Karl Grammer)
Einige wissenschaftliche Studien zur Attraktivität
http://evolution.anthro.univie.ac.at/institutes/urbanethology/beautypro.html
Anmerkungen und Endnoten:
___
Aronson 1969. Zitiert nach Ruch & Zimbardo (dt. 1975, S. 332). Lehrbuch der Psychologie. Berlin: Springer.
____
Grimmsche Wörterbuch. 1838 von Brüdern Jacob und Wilhelm Grimm begonnen, 1854 erschien der erste Band. Wilhelm Grimm kam bis D. Jacob Grimm, der 1863 starb, kam bis "Frucht". Danach wurde das Werk von vielen Germanisten fortgesetzt, kam aber erst 1960 in einer gemeinschaftlichen Leistung der BRD und DDR zu einem ersten Abschluß. In mehr als hundert Jahren erschien 16 Bände in 32 Teilbänden; 1971 ergänzt durch ein Quellenverzeichnis. Inzwischen kann man das Grimmsche Wörterbuch auch digital erwerben (z.B. bei Zweitausendeins).
___
MAZOKA ist ein Kunstwort aus der Allgemeinen und Integrativen Willenspsychologie. Es bedeutet: M = Mühe (bereitschaft), A = Ausdauer (bereitschaft), Z = Zeit (Reservierung), O = Opfer (bereitschaft), K = Kosten (bereitschaft), A = Anstrengung (sbereitschaft). Zur praktischen Differentialdiagnose zwischen Wünschen und Wollen kann nun der MAZOKA-Begriff herangezogen werden. Jemand wünscht nur, wenn sie/ er keine oder zu wenig MAZOKA füer ein Motiv aufbringt, einer will in dem Maße, wie sie/er MAZOKA für ein Motiv aufbringt.
__
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
27.05.05 Wissenschaftstheoretische Unterscheidung bei Attraktivitätsbekundungen, die Aussagen oder Werurteile sein können. * Textzitate: Streets erste Befragung 1898 zu Ähnlichkeit und Komplementarität. * Attraktivität ist eine positive Wertigkeit. * Kulturvergleichende Beziehungsforschung (Asendorpf & Banse (2000). * Eckstein Erster Eindruck an sich.
26.05.05 Korektur Graphik. Anmerkung Grimmsches Wörterbuch.
Standort: Attraktivität.
Was bin ich wert? Psychologische Grundlagen des Werterlebens. Zur Psychotherapie der Minderwertigkeitsgefühle.
Die Psychologische Grundfunktion und das Heilmittel Werten in der GIPT.
Überblick: Zwischenmenschliche Beziehungen, Liebe, Sex, Sexuelle Abweichungen und Störungen, Mißbrauch, Psychopathologie, Sex- und Beziehungs- Kriminalität, Psychotraumatologie und Viktimologie.
Psychologie und Sozialpsychologie der Mode.
* Norm, Wert, Abweichung (Deviation), Krank (Krankheit), Diagnose * Welten und Perspektiven *
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. attraktiv site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
Sponsel, Rudolf (DAS). Attraktiv und Attraktivität. Psychologie, Sozialpsychologie, Psychopathologie, Soziologie.
aus allgemeiner und integrativer Sicht. Aus unserer Abteilung Sozialpsychologie. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/sozpsy/attrak0.htm
Stand 05.05.2017: https://web.archive.org/web/20240522111816/https://www.sgipt.org/gipt/sozpsy/attrak0.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen, die die Urheberschaft
der IP-GIPT nicht jederzeit klar erkennen lassen, ist nicht gestattet.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
teil-korrigiert:irs 27.5.5 (Reader).